Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Fragestunde Wiederholung
|
|
|
- Mathilde Huber
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Fragestunde Wiederholung Sonja Jovicic / Christoph Kappeler
2 Wiederholung: Wirtschaftswissenschaftliches Spektrum WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 2
3 Funktionsfähigkeit von Märkten Beurteilung von Wirtschaftspolitik und die Notwendigkeit von Wirtschaftspolitik hängen von der unterstellten Funktionsfähigkeit des Marktes ab. WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 3
4 Funktionsfähigkeit von Märkten Funktionsfähigkeit des Marktes gering, Märkte nicht ständig geräumt Marktversagen! hoch, ständige Markträumung Keynesianische Theorie Institutionelle Theorie Robert Solow, Joseph Stiglitz George Akerlof, Alan Blinder Gregory Mankiw, Olivier Blanchard Alan Kueger, Richard Freeman, Paul Krugman Krupp, Kromphardt Bofinger, Schettkat Neoklassische Makroökonomie Monetarismus Robert Lucas, Milton Friedman Gary Becker, Roberto Alesina Thomas Sargent, Edward Prescott Eugen Fama, Robert Barro Zimmermann, Sinn Bundesbank, EZB, Franz WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 4
5 Frage 1: Markteffizienz WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 5
6 Markteffizienz Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Markt effizient ist? WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 6
7 Aspekte der Paretoeffizienz Paretoeffizienz impliziert folgende drei Aspekte: (1) Tauscheffizienz: Keine Pareto-Verbesserung durch freiwilligen Tauschmöglich (d.h. Güter gehen an die Individuen, welche den höchsten Nutzen aus dem Gut ziehen) (2) Produktionseffizienz(optimale Produktion): Die Ressourcen werden optimal genutzt; d.h. für gegeben der Ressourcen ist es nichtmöglich, das (gesamtwirtschaftliche) Produktionsniveau erhöhen. (3) Produktmixeffizienz: Die produzierten Güter sind jene, welche sich die Gesellschaft zu haben wünscht WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 7
8 Tauscheffizienz Tauscheffizienz: Alle Möglichkeiten des freiwilligen Tausches sind erschöpft d.h. durch Tausch kann keine Pareto-Verbesserung erreicht werden (formell: Grenzrate der Substitution ist für alle Individuen gleich, d.h. es gibt kein Anreiz mehr zu tauschen) Güter fließen zu jenen Individuen, welche den höchsten Nutzen daraus ziehen Bsp. Markus bevorzugt Äpfel, Tina bevorzugt Orangen dann sollte Markus Äpfel und Tina Orangen erhalten. WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 8
9 Edgeworth-Box Bücher Tina Bücherkonsum Tina Tina Kinokarten Markus I T1 I T2 I T3 Kinokarten konsum Tina B I M3 Kinokarten konsum Markus Ist A pareto-optimal? Ist B pareto-optimal? A I M1 I M2 Kinokarten Tina Markus Bücherkonsum Markus Bücher Markus WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 9
10 Edgeworth-Box Bücher Tina Tina Kinokarten Markus Kontraktkurve Markus Bücher Markus Kinokarten Tina WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 10
11 Produktionseffizienz Produktionseffizienz: ist die Allokation, für eine gegebene Ressourcenausstattung, bei der von einem Gut nicht mehr produziert werden kann, ohne dass von einem anderen Gut weniger produziert wird. d.h. die Ressourcen in der Volkswirtschaft werden optimal genutzt WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 11
12 Produktmixeffizienz Produktmixeffizienz:es wird das produziert, was die Gesellschaft zu haben wünscht WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 12
13 Frage 2: Wettbewerbsmärkte WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 13
14 Voraussetzungen für Wettbewerbsmärkte Atomistische Angebots-und Nachfragestruktur (keine Marktmacht der Teilnehmer) abnehmende Skalenerträge (sonst keine atomistische Angebotsund Nachfragestruktur) substitutionaleproduktionsfunktion (Produktionsfaktoren sind austauschbar) keine Informationskosten (vollkommene Information) komplette Märkte (keine Unsicherheit) keine Anpassungskosten keine Mobilitätskosten super rationales Verhalten der Wirtschaftssubjekte WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 14
15 7 Gründe für Marktversagen (1) Unvollkommener Wettbewerb (2)Externe Effekte (3) Öffentliche Güter (4) Unvollständige Märkte (5) Unvollkommene Information (6) Imperfekt-rationales Verhalten (7) Makroökonomische Störungen (z.b. Arbeitslosigkeit) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 15
16 Frage 3: Diskontierung WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 16
17 Kosten-Nutzen-Analyse unterschiedliche Zeithorizonte: Heute gegen Zukunft Zukünftige (externe) Kosten müssen in unsere heutige Entscheidungen einfließen. Die zukünftigen Kosten müssen in die Gegenwart geholt werden ( Diskontierung) Diskontierung zukünftige Einkommen (Nutzen) diskontieren zukünftige Kosten(negative Nutzen) diskontieren WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 17
18 Investitionsprojekt Gegenwartswert (Present Value) PV Auszahlung Investition t Zeit Gegenwartswert > Investition investiere! WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 18
19 Investitionsprojekt Diskontierung (Ermittlung des Gegenwartswertes PV) 1 1 :Gegenwartswert von :Periode : Diskontierungsrate :(Anfangs-) Investition Es gilt, wenn profitable Investition Investition nicht profitabel WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 19
20 Investitionsprojekt Beispiel Heutige Investition (Neue Maschine) 1000Euro 10Jahre Einnahmen in 10 Jahren 2500Euro (a) Diskontrate: 10% 2500, 963Euro Investition nicht profitabel (b) Diskontrate: 5% 2500, 1535Euro profitable Investition WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 20
21 Investitionsprojekt Gegenwartswert (Present Value) PV Diskontrate=5% V10= Diskontrate=10% Investition 10 Jahre t I=1000 a) Diskontrate=10%, Gegenwartswert < Investition Nein b) Diskontrate= 5%, Gegenwartswert > Investition Ja WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 21
22 Diskontrate Diskontrate Diskontrate zur Berechnung von Investitionsentscheidungen Rate, mit der eine zukünftige Investition abgezinst werden muss Die wahre Diskontrate zu finden ist unmöglich, da diese Diskontrate ein Maß für die Unsicherheiteines Projektes ist Jedes noch nicht realisierte Projekt ist mehr oder weniger unsicher (Risiko) Der Diskontsatz ist die problematischste Größe, denn mit ihr steht und fällt die Investitionsentscheidung WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 22
23 Diskontrate geringe Diskontierungsrate in der Zukunft anfallende Kosten (Erträge) haben höheren Gegenwartswert höhere Investitionen in der Gegenwart zur Vermeidung (Erzielung) dieser Kosten (Erträge) sind gerechtfertigt höhere Diskontierungsrate Die in der Zukunft anfallenden Kosten (Erträge) haben geringeren Gegenwartswert nur geringere Investitionen zur Vermeidung (Erzielung) dieser Kosten (Erträge) sind gerechtfertigt WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 23
24 Frage 4: Magische Viereck WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 24
25 Die 4 Ziele des magischen Vierecks Ziele laut dem Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (1967) (1) angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum (2) hoher Beschäftigungsstand (3) außenwirtschaftliches Gleichgewicht (4) stabiles Preisniveau Weitere mögliche Ziele (5) Nachhaltigkeit (Umweltverträglichkeit) (6) Verteilungsgerechtigkeit (7) Schuldenbremse WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 25
26 Magische Viereck Das Wort magisch impliziert, dass nicht alle Ziele gleichzeitig erreicht werden können. Welche Zielbeziehungen sind grundsätzlich möglich? WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 26
27 Zielbeziehungen im Magischen Viereck Grundlegende Zielbeziehungen Komplementaritätsbeziehung Beispiel: Wirtschaftswachstum und hohe Beschäftigung Okun schegesetz:! "#$ % $ & ) mit $ & normal growthrate Neutrale Beziehung Beispiel: außenwirtschaftliches Gleichgewicht und hoher Beschäftigungsstand Konfliktbeziehung Beispiel: Wachstum und Inflation (AS/AD-Modell) Beispiel: Inflation und Arbeitslosigkeit (Phillipskurve) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 27
28 Zielkonflikte Wachstum - Preisniveaustabilität Außenwirtschaftliches Gleichgewicht Vollbeschäftigung WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 28
29 Frage 5: Keynesianische Kreuz WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 29
30 Frage 1 Übungsblatt 6, Aufgabe 1 die Nachfrage ' beschreibt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage (nicht nur die Haushaltsnachfrage), d.h. '()*+ dabei gilt: Nettoexporte = Exporte Importe *++, WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 30
31 Das Keynesianische Kreuz Unterscheidung zwischen Produktion und Güternachfrage Produktion = BIP = - Güternachfrage = Güternachfrage =. Produktion und Nachfrage in einer Volkswirtschaft können stark voneinander abweichen wenn Produktion / Nachfrage Produktion > Nachfrage Lageraufbau (pos. Lagerinvest.) Produktion < Nachfrage Lagerabbau (neg. Lagerinvest.) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 31
32 Güternachfrage. Güternachfrage (') '()* ) )40 1 Annahme: geschlossene Volkswirtschaft d.h. *+0 Wir unterstellen eine lineare Konsumfunktion, die vom Einkommen der Haushalte (1), sowie von Steuern & Transferzahlungen (2) abhängt 0 einkommensunabhängige Konsum 0 marginale Konsumquote: beschreibt wie viel von einem zusätzlichen Euro an Einkommen für den Konsum ausgegeben wird WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 32
33 Güternachfrage. Nachfrage (Z) Produktion (Y) 0 Güternachfrage ' ) )40 1 autonomen Ausgaben )4 Einkommen (Y) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 33
34 Produktion - Produktion (1) wir können die Produktion als Funktion des Einkommens zeichnen da Produktion immer gleich dem Einkommen ist, muss die die Steigung der Geraden genau 1 sein die 45 -Linie beschreibt alle Punkte für Produktion gleich Einkommen sind Zur Erinnerung: 1beschreibt die Produktion, aber auch das Einkommen (wir können das BIP über die Produktions-oder Einkommensseite berechnen) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 34
35 Das Keynesianische Kreuz Nachfrage (Z) Produktion (Y) A 1 Produktion 1' Güternachfrage ' ) )40 1 Z 0 =Y 0 autonomen Ausgaben )4 45 Y Einkommen (Y) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 35
36 Das Keynesianische Kreuz Güternachfrage ' ) Güterproduktion 1 Gleichgewicht ) ) ) ! ) 1 0 Multiplikator autonomen Ausgaben WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 36
37 Beispiel Erhöhung der Staatsausgaben Expansive Fiskalpolitik: Erhöhung der Staatsausgaben ) Nachfrage (Z) Produktion (Y) 1 B D A Z Z ) 1 A C IG #0 IG 0 T> 1 ) Einkommen (Y) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 37
38 Beispiel Erhöhung der Staatsausgaben Erhöhung der Staatsausgaben Erhöhung der Staatsausgaben ) um 1 Mrd. ( )1) (AB) Verschiebung der Z Kurve nach oben zu Z (um 1 Mrd.) Zunahme der Staatausgaben bewirkt nicht nur eine Erhöhung der Produktion um 1 Mrd. (AB) sondern auch der Einkommen (BC) Der Anstieg der Produktion/Einkommen ( 1>ist aber größerals der ursprüngliche Anstieg der Staatsausgaben )! Warum? Die Zunahme der Einkommen bewirkt einen höheren Konsum und daher einen erneuten Nachfrageanstieg (CD) in Höhe von 0 ) Mrd. Dieser Nachfrageanstieg erhöht die Produktion und wiederum die EinkommenZ usw. Dieser Prozess geht solange weiter, bis die Volkswirtschaft im neuen Gleichgewicht ankommt. WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 38
39 Beispiel Erhöhung der Staatsausgaben Erhöhung der Staatsausgaben Diesen Rückkoppelungsprozess zwischen Konsum und Einkommen nennt man Multiplikatoreffekt. Durch den Multiplikatoreffektbleibt die Volkswirtschaft nicht in Punkt C, sondern wandert weiter bis zu Punkt B. Produktion und Einkommen erhöhen sich letztendlich von 1 auf 1 WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 39
40 Auswirkungen des Multiplikatoreffekts Expansive Fiskalpolitik Erhöhung der Staatsausgaben: ) 1 Zunahme der Transferzahlungen: 2 1 Steuersenkungen: Kontraktive Fiskalpolitik Senkung der Staatsausgaben: ) 1 Abnahme der Transferzahlungen: 2 1 Steuererhöhungen: WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 40
41 Frage 6: Phillipskurve WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 41
42 Phillipskurve (1) Phillipskurve nach A.W. Phillips (1958) The Relationship between Unemployment and the Change of Money Wages in the UK Negativer Zusammenhang zwischen Veränderung der Nominallöhnen und Arbeitslosigkeit in UK. Möglicher Grund für den Zusammenhang: Wechselnde Verhandlungsmachtder Gewerkschaften In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit können keine hohen Lohnforderungen durchgesetzt werden In Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit können hohe Lohnforderungen durchgesetzt werden WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 42
43 Phillipskurve (1) Phillipskurve nach A.W. Phillips (1958) Negativer Zusammenhang zwischen Veränderung der Nominallöhnen und Arbeitslosigkeit in UK. Nominale Lohnveränderungen Arbeitslosenquote WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 43
44 Phillipskurve (2) Phillipskurve nach Samuelson/Solow (1960) Keynesianische Phillipskurve( die Phillipskurve) Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy Anwendung des Konzeptes für die USA Negativer Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Arbeitslosenquote Problem: stationäre Erwartungshaltungen der Individuen Individuen begehen systematische Fehler hinsichtlich ihrer Erwartung betrachten die Nominal-und nicht Reallohnentwicklung lassen sich durch Inflation täuschen (Geldillusion) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 44
45 Phillipskurve (2) Phillipskurve nach Samuelson/Solow (1960) Durch den erhöhten Nachfragedruck in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit wird eine höhere Inflation erreicht. Wirtschaftspolitischen Implikationen: Tradeoffzwischen Inflation und Arbeitslosenquote Maß für Inflationsrate: Verbraucherpreisindex Inflationsrate A A B CD EF A CD EF G H I J Arbeitslosenquote WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 45
46 Phillipskurve bis zu den 70er Jahren war die Phillipskurve deutlich zu erkennen In den 70er Jahren verschwand dieser Zusammenhang jedoch Grund: veränderte Erwartungsbildung der Individuen hinsichtlich der Inflationsraten Inflationsraten wurden immer stabilerzeigten und positivewerte neue Beziehung:zwischen der Veränderung der Inflationsrate und der Arbeitslosenquote ( modifizierte Phillipskurve ) Veränderung Inflationsrate A A B CD EF A A B CD EF G H I /J Arbeitslosenquote WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 46
47 Phillipskurve (3) Phillipskurve nach Friedman, Phelps (1968, 1973) Monetaristische Phillipskurve Idee: nominale Variablen (z.b. Inflation) haben langfristig keinen Effekt auf reale Größen (z.b. Arbeitslosigkeit) Neutralität des Geldes NAIRU: Non-accelerating inflation rate of unemployment natürliche Arbeitslosenquote Arbeitslosigkeit, bei der sich die Inflation nicht beschleunigt (d.h. verändert) inflationsstabile Arbeitslosenquote WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 47
48 Phillipskurve (3) Phillipskurve nach Friedman, Phelps (1968, 1973) Hinter der NAIRU steht die Vorstellung, dass eine bestimmte Arbeitslosenquote Knappheitenauf dem Arbeitsmarkt signalisiert wird sie unterschritten, führt dies zu höheren Löhnen und damit zu einer steigenden Inflation. WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 48
49 Phillipskurve (3) Phillipskurve nach Friedman, Phelps (1968, 1973) Langfristige Phillipskurve Inflationsrate (natürliche Arbeitslosenquote) NAIRU: Non-accelerating inflation rate of unemployment B A C Kurzfristige Phillipskurve u n Arbeitslosenquote WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 49
50 Phillipskurve (3) Phillipskurve nach Friedman, Phelps (1968, 1973) Wenn Staat expansive Geldpolitik betreibt, steigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowie die Inflation (A) Unternehmen realisieren die Preissteigerungen (Preissetzer) als die Privaten Haushalte, da sie die Preise besser kennen Die Inflation bewirkt,z Reallöhne sinken Unternehmen werden mehr Arbeiter einstellen Privaten Haushalte unterliegen kurzfristig der Geldillusion (sie halten die Nominallohnerhöhungen für Reallohnerhöhungen) bieten mehr Arbeit an Die Beschäftigung in der Volkswirtschaft steigt (kurzfristig!) (B) Langfristig werden die Individuen den Fehler (Geldillusion) nicht begehen sie fordern höhere Nominallöhne um den Reallohnverlust auszugleichen Rückkehr in das ursprüngliche Gleichgewicht (C) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 50
51 Phillipskurve (3) Phillipskurve nach Friedman, Phelps (1968, 1973) Wirtschaftspolitische Implikation kurze Frist: der ursprüngliche Tradeoffder keynesianischenphillipskurvegilt nur in der kurzen Frist lange Frist: diskretionärepolitik hat in der langen Frist keinen Einfluss auf reale Größen; nur die Preise ändern sich! vertikale natürliche Arbeitslosigkeit WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 51
52 Phillipskurve (4) Phillipskurve nach Lucas, Sargent Neuklassische Phillipskurve In den 70er Jahren lässt sich die alte Korrelation (keynesianische Phillipskurve) nicht mehr nachweisen hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit (Stagflation) Rationale Erwartungen ( John Muth) Idee: Wenn Menschen sich Gedanken über die Zukunft machen, nutzen sie alle verfügbaren Informationen optimal aus und machen keine systematischen Fehler Sie antizipieren die Folgen von Wirtschaftspolitik und passen ihr Verhalten direkt an WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 52
53 Phillipskurve (4) Phillipskurve nach Lucas, Sargent rationale Erwartungen: erwartete Inflation steigt, d.h., der Mechanismus kann nur einmaligablaufen, da Individuen in Zukunft sofort mit höheren Preisen rechnen werden Wirtschaftspolitische Implikationen: kurze Frist: Geld-oder Fiskalpolitik kann die Arbeitslosenquote (NAIRU) nur einmalig beeinflussen! kurze Frist ist so kurz, dass sie zu vernachlässigen ist lange Frist: Geld-oder Fiskalpolitik kann die natürliche Arbeitslosenquote nicht beeinflussen Nur institutionelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt können die NAIRU beeinflussen (z.b. Produktivität, ArbeitsmarktreformenZ) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 53
54 Phillipskurve (4) Phillipskurve nach Lucas, Sargent auch in der kurzen Frist ist die Phillipskurve vertikal Langfristige Phillipskurve Inflationsrate (natürliche Arbeitslosenquote) NAIRU: Non-accelerating inflation rate of unemployment u n Arbeitslosenquote WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 54
55 Frage 7: Allgemeines WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 55
56 Reservationspreis, Preiselastizität Reservationspreis Maximale Preisbereitschaft der Konsumenten für ein Gut Mindestpreis zu dem Produzenten ein Gut anbieten Preiselastizitäten Wie verändert sich die angebotene/nachgefragte Menge eines Gutes, wenn sich der Preis marginal erhöht Beispiel: hohe Preiselastizität; d.h. eine marginale Preiserhöhung eines Gutes hat einen starken Effekt auf die Gütermenge (z.b. starker Nachfragerückgang) WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 56
57 Skalenerträge Skalenerträge Skalenerträge beschreiben den Zusammenhang zwischen Produktion (Output) und Input (K, L) 1K#L,M> konstante Skalenerträge: Erhöhung aller Inputs um den Faktor N Erhöhung des Outputs um Faktor N zunehmende Skalenerträge: Erhöhung aller Inputs um den Faktor N Erhöhung des Outputs um Faktor z.b. 2N abnehmende Skalenerträge: Erhöhung aller Inputs um den Faktor N Erhöhung des Outputs um Faktor z.b. 0.5N WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 57
58 Quantile Quantile: Das P-Quantil trennt eine Verteilung in zwei Bereiche, sodass P 100%der Daten darunterund #1 P> 100%der Daten darüberliegen. Damit ist der Median genau das 50%-Quantil. Besondere Quantile Perzentile: Verteilung wird in 100 gleich große 1%-Quantile zerlegt, d.h. in die 1%, 2%, 100%-Quantile Dezile:Mit Dezilen(lat. Zehntelwerte ) wird die Verteilung in 10 gleiche Teile zerlegt. Bsp: Das 10%-Dezil gibt den Wert an, der die unteren 10% der Daten von den oberen 90% der Daten teilt. Quartile:Verteilung wird in 4 gleiche Teile zerlegt, d.h. in die 25%,50%,75%und75% -Quantile WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 58
59 Quantile p-quantil(s T ) einer stetigen Verteilung p 1-p Quelle: Brüggemann (2009), VL Statistik I WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 59
60 Danke und bis nächstes Mal! WS 2013/2014 Jovicic/Kappeler Übung WiPol Slide 60
Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 2 Markteffizienz
 Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 2 Markteffizienz Sonja Jovicic / Alexander Halbach Aufgabe 1 WS 2015/2016 Jovicic/Halbach Übung WiPol Seite 2 Aufgabe 1 a) Was meinen Ökonomen
Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 2 Markteffizienz Sonja Jovicic / Alexander Halbach Aufgabe 1 WS 2015/2016 Jovicic/Halbach Übung WiPol Seite 2 Aufgabe 1 a) Was meinen Ökonomen
Geschichte der Makroökonomie. (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest
 Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Der Transmissionsmechanismus nach Keynes
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen
 Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Tutorium Makroökonomie I. Blatt 6. Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell
 Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie
 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 3: Der Gütermarkt Günter W. Beck 1 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 2 2 Überblick
Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 3: Der Gütermarkt Günter W. Beck 1 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 2 2 Überblick
Kapitel 2 Der Gütermarkt. Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban. Pearson Studium 2014 Olivier Olivier Blanchard/Gerhard Illing: Illing: Makroökonomie
 Kapitel 2 Der Gütermarkt Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban 1 Pearson Studium 2014 2014 Literaturhinweise Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard, Makroökonomie, 5. Aufl., Pearson 2009, Kap. 3. 2 Vorlesungsübersicht
Kapitel 2 Der Gütermarkt Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban 1 Pearson Studium 2014 2014 Literaturhinweise Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard, Makroökonomie, 5. Aufl., Pearson 2009, Kap. 3. 2 Vorlesungsübersicht
Restriktive Fiskalpolitik im AS-
 Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
4. Konjunktur. Was verursacht Konjunkturschwankungen? 2 Sichtweisen:
 4. Konjunktur Lit.: Blanchard/Illing, Kap. 3-8; Mankiw, Kap. 9-11, 13; Romer, Kap. 5 Was verursacht Konjunkturschwankungen? 2 Sichtweisen: 1. Neoklassische Sicht: vollständige Märkte, exible Preise: Schwankungen
4. Konjunktur Lit.: Blanchard/Illing, Kap. 3-8; Mankiw, Kap. 9-11, 13; Romer, Kap. 5 Was verursacht Konjunkturschwankungen? 2 Sichtweisen: 1. Neoklassische Sicht: vollständige Märkte, exible Preise: Schwankungen
Makroökonomie 1. Skript: Teil 1
 Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 4 Das AS-AD- Modell
 ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Das AS-AD- Modell Version: 23.05.2011 4.1 Der Arbeitsmarkt zentrale Annahmen des IS-LM-Modells werden aufgehoben in der mittleren Frist passen sich Preise an
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Das AS-AD- Modell Version: 23.05.2011 4.1 Der Arbeitsmarkt zentrale Annahmen des IS-LM-Modells werden aufgehoben in der mittleren Frist passen sich Preise an
Olivier Blanchard Gerhard Illing. Makroökonomie. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage
 Olivier Blanchard Gerhard Illing Makroökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Inhaltsübersicht Vorwort 13 Teil I Kapitel 1 Kapitel 2 Einleitung Eine Reise um die Welt Eine Reise durch das Buch
Olivier Blanchard Gerhard Illing Makroökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Inhaltsübersicht Vorwort 13 Teil I Kapitel 1 Kapitel 2 Einleitung Eine Reise um die Welt Eine Reise durch das Buch
BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Klausuraufgaben
 Name: Vorname: Matr. Nr.: BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Klausuraufgaben Integrierter Studiengang Wirtschaftswissenschaft Vorprüfung Grundlagen der VWL I Makroökonomie
Name: Vorname: Matr. Nr.: BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Klausuraufgaben Integrierter Studiengang Wirtschaftswissenschaft Vorprüfung Grundlagen der VWL I Makroökonomie
Inhaltsverzeichnis. eise um die Welt 17 utschland, Euroraum und Europäische Union 18 e Vereinigten Staaten e es weitergeht 34
 II eise um die Welt 17 utschland, Euroraum und Europäische Union 18 e Vereinigten Staaten 25 30 1e es weitergeht 34 ffßj / Eine Reise durch das Buch 41 wr ~' 2.1 Produktion und Wirtschaftswachstum - Das
II eise um die Welt 17 utschland, Euroraum und Europäische Union 18 e Vereinigten Staaten 25 30 1e es weitergeht 34 ffßj / Eine Reise durch das Buch 41 wr ~' 2.1 Produktion und Wirtschaftswachstum - Das
Die Phillipskurve. Steffen Ahrens Fakultät VII Geldtheorie- und Geldpolitik WS2014/2015
 Die Phillipskurve Steffen Ahrens Fakultät VII Geldtheorie- und Geldpolitik WS2014/2015 Die Phillipskurve Illing, Kapitel 3.1; Blanchard/Illing, Kapitel 8; Jarchow, Kapitel 5 bb Statistischer negativer
Die Phillipskurve Steffen Ahrens Fakultät VII Geldtheorie- und Geldpolitik WS2014/2015 Die Phillipskurve Illing, Kapitel 3.1; Blanchard/Illing, Kapitel 8; Jarchow, Kapitel 5 bb Statistischer negativer
7. Übung Makroökonomische Theorie
 7. Übung Makroökonomische Theorie Aufgabe 14 In einer Volkswirtschaft mit Staat sind folgende Größen gegeben: Autonome Nachfrage des Staates: 100 GE Marginale Konsumneigung: 0,8 marginale Sparneigung:
7. Übung Makroökonomische Theorie Aufgabe 14 In einer Volkswirtschaft mit Staat sind folgende Größen gegeben: Autonome Nachfrage des Staates: 100 GE Marginale Konsumneigung: 0,8 marginale Sparneigung:
Makroökonomik. VL 1: Einführung. Prof. Dr. Michael Kvasnicka Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre
 VL 1: Einführung Prof. Dr. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Organisatorisches Vorlesungen Montag, 19:15-20:45, G26-H1 Dienstag, 07:30-09:00, G26-H1 Übungen Beginn: 25. Oktober 2013 (2. Vorlesungswoche)
VL 1: Einführung Prof. Dr. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Organisatorisches Vorlesungen Montag, 19:15-20:45, G26-H1 Dienstag, 07:30-09:00, G26-H1 Übungen Beginn: 25. Oktober 2013 (2. Vorlesungswoche)
Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14. Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 04.03.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Wann führt eine reale Abwertung
Freiburg, 04.03.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Wann führt eine reale Abwertung
Das IS-LM-Modell. IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 5) Friedrich Sindermann JKU
 Das IS-LM-Modell IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 5) Friedrich Sindermann JKU 12.04.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Das IS-LM-Modell 12.04.2011 1 / 1 Überblick Überblick Zentrale Frage:
Das IS-LM-Modell IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 5) Friedrich Sindermann JKU 12.04.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Das IS-LM-Modell 12.04.2011 1 / 1 Überblick Überblick Zentrale Frage:
UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN
 Termin: Musterklausur SS 2011 Prüfungsfach: Makroökonomik I Prüfer: Prof. Dr. Belke Name, Vorname Studiengang MUSTERKLAUSUR MAKROÖKONOMIK I Hinweise zur Bearbeitung der Klausur Seite 1 Bearbeitungszeit:
Termin: Musterklausur SS 2011 Prüfungsfach: Makroökonomik I Prüfer: Prof. Dr. Belke Name, Vorname Studiengang MUSTERKLAUSUR MAKROÖKONOMIK I Hinweise zur Bearbeitung der Klausur Seite 1 Bearbeitungszeit:
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Das aggregierte Angebot
 Das aggregierte Angebot 3.1 Erläutern Sie die kurzfristige Anpassung der Preise und der Produktion in einem Modell monopolistischer Konkurrenz auf dem Gütermarkt, einer limitationalen Produktionsfunktion
Das aggregierte Angebot 3.1 Erläutern Sie die kurzfristige Anpassung der Preise und der Produktion in einem Modell monopolistischer Konkurrenz auf dem Gütermarkt, einer limitationalen Produktionsfunktion
Thema 4: Das IS-LM-Modell. Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM)
 Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Makroökonomische Fragestellungen u. Grundbegriffe. wichtigste Variable in der Makroökonomie: Produktion (Output) u.
 Makroökonomische Fragestellungen u. Grundbegriffe wichtigste Variable in der Makroökonomie: Produktion (Output) u. dessen Wachstum Inflationsrate Arbeitslosenquote Euroraum Gründung der EU 1957 Einführung
Makroökonomische Fragestellungen u. Grundbegriffe wichtigste Variable in der Makroökonomie: Produktion (Output) u. dessen Wachstum Inflationsrate Arbeitslosenquote Euroraum Gründung der EU 1957 Einführung
Das AS-AD Modell. Einführung in die Makroökonomie SS Mai 2012
 Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet:
 1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik
 Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik Version: 12.12.2011 Erwartungen und Nachfrage: eine Zusammenfassung Erwartungskanäle und Nachfrage Erwartungen
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik Version: 12.12.2011 Erwartungen und Nachfrage: eine Zusammenfassung Erwartungskanäle und Nachfrage Erwartungen
Übungsaufgaben zu Kapitel 3: Der Gütermarkt
 Kapitel 3 Übungsaufgaben zu Kapitel 3: Der Gütermarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 20 Folie Übungsaufgabe 3 3 In einer Volkswirtschaft werden zwei Güter gehandelt: Computer
Kapitel 3 Übungsaufgaben zu Kapitel 3: Der Gütermarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 20 Folie Übungsaufgabe 3 3 In einer Volkswirtschaft werden zwei Güter gehandelt: Computer
Ceteris Paribus Der lateinische Ausdruck für andere Dinge gleichbleibend wird als Erinnerung daran verwendet, daß alle anderen als die gerade untersuc
 Definitionen Angebotskurve Ein Graph für die Zuordnungen von Güterpreisen und Angebotsmengen. Quelle: Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1999, Seite 80 Angebotsüberschuß Eine Situation,
Definitionen Angebotskurve Ein Graph für die Zuordnungen von Güterpreisen und Angebotsmengen. Quelle: Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1999, Seite 80 Angebotsüberschuß Eine Situation,
Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 04.08.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Nehmen Sie an, die Geldmenge
Freiburg, 04.08.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Nehmen Sie an, die Geldmenge
JK Makroökonomik I: Wiederholungsklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho 1 Freiburg, WS 2016/17 JK Makroökonomik I: Wiederholungsklausur vom 14.08.2017 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (10 Fragen,
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho 1 Freiburg, WS 2016/17 JK Makroökonomik I: Wiederholungsklausur vom 14.08.2017 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (10 Fragen,
Makroökonomik. Übung 3 - Das IS/LM-Modell
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik
Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik
2. Teilklausur Kurs Einkommen, Inflation, Arbeitslosigkeit
 2. Teilklausur Kurs Einkommen, Inflation, Arbeitslosigkeit 17. Dezember 2008, Gruppe 2B (14.00 14.45) Name: Matrikelnummer: Studienkennzahl: Lösungsmatrix (bitte die richtige Antwort in dieser Matrix hier
2. Teilklausur Kurs Einkommen, Inflation, Arbeitslosigkeit 17. Dezember 2008, Gruppe 2B (14.00 14.45) Name: Matrikelnummer: Studienkennzahl: Lösungsmatrix (bitte die richtige Antwort in dieser Matrix hier
Abschlussklausur vom 25. Februar 2013
 1 Abschlussklausur vom 25. Februar 2013 Teil 1: 10 Multiple-Choice-Fragen (15 Punkte) 1. Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern A Die Summe aus indirekten Steuern und Subventionen 0 ist. B Die indirekten
1 Abschlussklausur vom 25. Februar 2013 Teil 1: 10 Multiple-Choice-Fragen (15 Punkte) 1. Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern A Die Summe aus indirekten Steuern und Subventionen 0 ist. B Die indirekten
Rezepte gegen Arbeitslosigkeit
 Rezepte gegen Arbeitslosigkeit Offizielle Arbeitslosenquote (1980-2005) % 5 4 3 2 1 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Quelle: seco 2 Arbeitslosenquoten Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK und USA
Rezepte gegen Arbeitslosigkeit Offizielle Arbeitslosenquote (1980-2005) % 5 4 3 2 1 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Quelle: seco 2 Arbeitslosenquoten Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK und USA
Matrikelnummer: Makroökonomik bzw. VWL B (Nr bzw. 5022) Semester: Sommersemester 2009
 Matrikelnummer: Klausur: Name: Makroökonomik bzw VWL B (Nr 11027 bzw 5022) Semester: Sommersemester 2009 Prüfer: Zugelassene Hilfsmittel: Bearbeitungszeit: Prof Dr Gerhard Schwödiauer/ Prof Dr Joachim
Matrikelnummer: Klausur: Name: Makroökonomik bzw VWL B (Nr 11027 bzw 5022) Semester: Sommersemester 2009 Prüfer: Zugelassene Hilfsmittel: Bearbeitungszeit: Prof Dr Gerhard Schwödiauer/ Prof Dr Joachim
Volkswirtschaftslehre für Schule, Studium und Beruf
 Gregory N. Mankiw /Mark P. Taylor/ Andrew Ashwin Volkswirtschaftslehre für Schule, Studium und Beruf Übersetzt von Adolf Wagner und Marco Herrmann 2015 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhaltsübersicht
Gregory N. Mankiw /Mark P. Taylor/ Andrew Ashwin Volkswirtschaftslehre für Schule, Studium und Beruf Übersetzt von Adolf Wagner und Marco Herrmann 2015 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhaltsübersicht
Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 3 Marktversagen
 Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 3 Marktversagen Sonja Jovicic / Christoph Kappeler Neues Passwort Moodle 2 Kapitel von Lehrbücher(Stiglitz, Blanchard, usw.) Die Kopien
Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 3 Marktversagen Sonja Jovicic / Christoph Kappeler Neues Passwort Moodle 2 Kapitel von Lehrbücher(Stiglitz, Blanchard, usw.) Die Kopien
Argumentieren Sie im Rahmen des IS/LM-Modells ohne explizite Berücksichtigung des Arbeitsmarktes. Gehen Sie von einem konstanten Preisniveau P aus.
 MC- Übungsaufgaben für die Klausur Aufgabe 1 (IS-LM) In einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlichem Rentensystem besteht Unsicherheit darüber, ob auch in Zukunft der Staat eine Rente garantieren
MC- Übungsaufgaben für die Klausur Aufgabe 1 (IS-LM) In einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlichem Rentensystem besteht Unsicherheit darüber, ob auch in Zukunft der Staat eine Rente garantieren
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre. Übung 2 - Makroökonomische Grundlagen. 1 Volkswirtschaftliche Identität und Kreislaufdiagramme
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Kai Kohler Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Kai Kohler Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von N. Gregory Mankiw Harvard Univers ity Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner 1999 Schaff er-poeschel Verlag Stuttgart Inhalt Einführung 1 TEIL
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von N. Gregory Mankiw Harvard Univers ity Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner 1999 Schaff er-poeschel Verlag Stuttgart Inhalt Einführung 1 TEIL
Wird vom Prüfer ausgefüllt:
 Diplomvorprüfungs-Klausur VWL I Makroökonomie (Prof. Dr. Lutz Arnold) Wintersemester 2005/06, 14.10.2005 Bitte gut leserlich ausfüllen: Name: Vorname: Matr.-nr.: Bearbeiten Sie im Makroökonomie-Teil die
Diplomvorprüfungs-Klausur VWL I Makroökonomie (Prof. Dr. Lutz Arnold) Wintersemester 2005/06, 14.10.2005 Bitte gut leserlich ausfüllen: Name: Vorname: Matr.-nr.: Bearbeiten Sie im Makroökonomie-Teil die
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
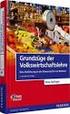 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner 1999 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhalt Einführung 1 Zehn
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner 1999 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhalt Einführung 1 Zehn
Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE. Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Maximale Punktzahl:
 Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Aufgaben-Nr.: 1 2 3 4 Gesamt Maximale Punktzahl: 15 15 15 15 60 Erreichte Punkte: WICHTIGE HINWEISE: Bitte beantworten
Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Aufgaben-Nr.: 1 2 3 4 Gesamt Maximale Punktzahl: 15 15 15 15 60 Erreichte Punkte: WICHTIGE HINWEISE: Bitte beantworten
Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14. Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Prof. Dr. Oliver Landmann Freiburg, 10.06.2014 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Die
Prof. Dr. Oliver Landmann Freiburg, 10.06.2014 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Die
BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Klausuraufgaben. Grundlagen der VWL I Makroökonomie. Alle Studienrichtungen
 Nachname: Matrikelnummer: Vorname: Sitzplatz: BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Klausuraufgaben Grundlagen der VWL I Makroökonomie Alle Studienrichtungen Prüfer: Prof.
Nachname: Matrikelnummer: Vorname: Sitzplatz: BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Klausuraufgaben Grundlagen der VWL I Makroökonomie Alle Studienrichtungen Prüfer: Prof.
Klausur Makroökonomie (WS 2006/2007)
 Prof. Dr. Bernd Kempa Klausur Makroökonomie (WS 2006/2007) 02.04.2007 1) In der vorliegenden Tabelle sehen Sie die gerundete Zusammensetzung des deutschen Inlandsproduktes für das Jahr 2005. Deutschland:
Prof. Dr. Bernd Kempa Klausur Makroökonomie (WS 2006/2007) 02.04.2007 1) In der vorliegenden Tabelle sehen Sie die gerundete Zusammensetzung des deutschen Inlandsproduktes für das Jahr 2005. Deutschland:
Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft
 Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4)
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Übung 3 - Das IS/LM-Modell
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Math. oec. Daniel Siepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Math. oec. Daniel Siepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
a) Wie wird das Wachstum des Produktionspotentials bei der Peak-to-Peak Methode ermittelt?
 Klausurfragen mit Antworten SS 2008 1. Fragen zum Produktionspotential (15 Punkte) a) Wie wird das Wachstum des Produktionspotentials bei der Peak-to-Peak Methode ermittelt? PP-Wachstum = durchschnittliche
Klausurfragen mit Antworten SS 2008 1. Fragen zum Produktionspotential (15 Punkte) a) Wie wird das Wachstum des Produktionspotentials bei der Peak-to-Peak Methode ermittelt? PP-Wachstum = durchschnittliche
Makroökonomie Makroök. Analyse mit flexiblen Preisen. Übersicht Offene Volkswirtschaft
 Übersicht Makroökonomie 1 Prof. Volker Wieland Professur für Geldtheorie und -politik J.W. Goethe-Universität Frankfurt 1. Einführung 2. Makroökonomische Analyse mit Flexiblen Preisen 3. Makroökonomische
Übersicht Makroökonomie 1 Prof. Volker Wieland Professur für Geldtheorie und -politik J.W. Goethe-Universität Frankfurt 1. Einführung 2. Makroökonomische Analyse mit Flexiblen Preisen 3. Makroökonomische
11. Übung Makroökonomischen Theorie
 11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
Wirtschaftspolitik und Markt
 Wirtschaftspolitik und Markt http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/ lexikon-der-wirtschaft/ 84 Wirtschaftspolitische Ziele der sozialen Marktwirtschaft: Magisches Viereck: Stabilität des Preisniveaus hoher
Wirtschaftspolitik und Markt http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/ lexikon-der-wirtschaft/ 84 Wirtschaftspolitische Ziele der sozialen Marktwirtschaft: Magisches Viereck: Stabilität des Preisniveaus hoher
Konjunktur und Wachstum
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Ein Gleichnis für die moderne Volkswirtschaft Die Regel vom komparativen Vorteil Anwendungen des Prinzips vom komparativen Vorteil...
 Inhalt Teil I Einführung... 1 Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... 3 Wie Menschen Entscheidungen treffen... 4 Wie Menschen zusammenwirken... 10 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert...
Inhalt Teil I Einführung... 1 Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... 3 Wie Menschen Entscheidungen treffen... 4 Wie Menschen zusammenwirken... 10 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert...
END-TERM REPETITORIUM MACROECONOMICS I
 END-TERM REPETITORIUM MACROECONOMICS I - EXERCISES - Autor: Sebastian Isenring Frühlingssemester 2016 Zürich, 20. Mai 2016 I. Einstiegsaufgaben 1 1.1 Arbeitsmarkt 1.1.1 Gehen Sie von einer Situation mit
END-TERM REPETITORIUM MACROECONOMICS I - EXERCISES - Autor: Sebastian Isenring Frühlingssemester 2016 Zürich, 20. Mai 2016 I. Einstiegsaufgaben 1 1.1 Arbeitsmarkt 1.1.1 Gehen Sie von einer Situation mit
Kapitel 6 Angebot, Nachfrage und wirtschaftspolitische Maßnahmen Preiskontrollen...124
 Teil I Einführung... Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... Wie Menschen Entscheidungen treffen... Wie Menschen zusammenwirken... Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert... Kapitel 2 Volkswirtschaftliches
Teil I Einführung... Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... Wie Menschen Entscheidungen treffen... Wie Menschen zusammenwirken... Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert... Kapitel 2 Volkswirtschaftliches
Vorwort zur ersten Auflage...
 Vorwort zur zweiten Auflage................................... Vorwort zur ersten Auflage.................................... V IX 1 Einleitendes............................................... 1 1.1 Methodische
Vorwort zur zweiten Auflage................................... Vorwort zur ersten Auflage.................................... V IX 1 Einleitendes............................................... 1 1.1 Methodische
Übungsaufgaben Makroökonomik
 Abteilung für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik Übungsaufgaben Makroökonomik Besprechung: 14.08.2008 bzw. 02.09.2008 Bitte bringen Sie einen Taschenrechner und das Vorlesungsskript mit!
Abteilung für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik Übungsaufgaben Makroökonomik Besprechung: 14.08.2008 bzw. 02.09.2008 Bitte bringen Sie einen Taschenrechner und das Vorlesungsskript mit!
Geld und Währung. Übungsfragen
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Klausur Makroökonomie II Sommersemester 2000
 Klausur Makroökonomie II Sommersemester 2000 Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen. Die Klausur gliedert sich in zwei Teile (Gewichtung A:B = 1:1). Teil A besteht
Klausur Makroökonomie II Sommersemester 2000 Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen. Die Klausur gliedert sich in zwei Teile (Gewichtung A:B = 1:1). Teil A besteht
Phillips Kurve. Einführung in die Makroökonomie. 10. Mai 2012 SS Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10.
 Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Makroökonomik. Mit vielen Fallstudien. Bearbeitet von Prof. N. Gregory Mankiw, Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Dieter John
 Makroökonomik Mit vielen Fallstudien Bearbeitet von Prof. N. Gregory Mankiw, Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Dieter John 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011. Buch. XXIII, 752 S. Gebunden ISBN
Makroökonomik Mit vielen Fallstudien Bearbeitet von Prof. N. Gregory Mankiw, Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Dieter John 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011. Buch. XXIII, 752 S. Gebunden ISBN
Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie
 age 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 7: Das AS-AD-Modell Günter W. Beck 1 age 2 2 Überblick Einleitung Das aggregierte Angebot Die aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen
age 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 7: Das AS-AD-Modell Günter W. Beck 1 age 2 2 Überblick Einleitung Das aggregierte Angebot Die aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen
Magisches Viereck. Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Preisniveaustabilität
 Analyse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Gliederung 1. magisches Viereck 2. Konjunktur 3. Konjunkturprogramme 4. Nachfrageinduzierende Stimuli 5. Ziele der Wirtschaftspolitik 6. Kritik am BIP 7.
Analyse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Gliederung 1. magisches Viereck 2. Konjunktur 3. Konjunkturprogramme 4. Nachfrageinduzierende Stimuli 5. Ziele der Wirtschaftspolitik 6. Kritik am BIP 7.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 3. r überarbeitete Auflage von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner und Marco Herrmann 2004 Schäffer-Poeschel
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 3. r überarbeitete Auflage von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner und Marco Herrmann 2004 Schäffer-Poeschel
Technische Universität Berlin Wintersemester 2014/2015. Makroökonomik Klausur 1. Termin
 Prof. Dr. Frank Heinemann Technische Universität Berlin Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik Klausur 1. Termin Bitte deutlich ausfüllen: Vom Prüfer auszufüllen: Name: Punkte Hausaufgaben: Vorname: Punkte
Prof. Dr. Frank Heinemann Technische Universität Berlin Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik Klausur 1. Termin Bitte deutlich ausfüllen: Vom Prüfer auszufüllen: Name: Punkte Hausaufgaben: Vorname: Punkte
Wirtschaft. Stephanie Schoenwetter. Das IS-LM-Modell. Annahmen, Funktionsweise und Kritik. Studienarbeit
 Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität. Y n = C + I (1)
 2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
Wahr/Falsch: Gütermarkt
 Wahr/Falsch: Gütermarkt Folie 1 Wahr/Falsch: Welche Begründungen erklären einen Zusammenhang zwischen Nettoexporten und dem Realzins? (a) Ein Anstieg des inländischen Zinssatzes führt zu geringerem Kreditangebot
Wahr/Falsch: Gütermarkt Folie 1 Wahr/Falsch: Welche Begründungen erklären einen Zusammenhang zwischen Nettoexporten und dem Realzins? (a) Ein Anstieg des inländischen Zinssatzes führt zu geringerem Kreditangebot
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2016/17 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2016/17 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Makro 2 Tutorium vom Uhr. Makro 1 Klausur SS '12 Lösung: Aufgabe 2 : AD: p = m by + h (i ^w + ε^e ) AS: p = p^e + 2 ( Y Y*)
 Makro 1 Klausur SS '12 Lösung: Aufgabe 2 : AD: p = m by + h (i ^w + ε^e ) AS: p = p^e + 2 ( Y Y*) a) positive Steigung der AS-Kurve: p steigt für gegebene Preiserwartunen p^e sinkender Reallohn (w/p) fällt
Makro 1 Klausur SS '12 Lösung: Aufgabe 2 : AD: p = m by + h (i ^w + ε^e ) AS: p = p^e + 2 ( Y Y*) a) positive Steigung der AS-Kurve: p steigt für gegebene Preiserwartunen p^e sinkender Reallohn (w/p) fällt
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
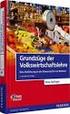 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 4., überarbeitete und erweiterte Auflage von N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner und Marco Herrmann 2008
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 4., überarbeitete und erweiterte Auflage von N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner und Marco Herrmann 2008
Eine Reise durch das Buch
 2004 PEARSON Studium Makroökonomie,, 3/e Olivier Blanchard/ Gerhard Illing K A P I T E L 2 Eine Reise durch das Buch Vorbereitet durch: Florian Bartholomae 2-1 Produktion und Wirtschaftswachstum Das BIP
2004 PEARSON Studium Makroökonomie,, 3/e Olivier Blanchard/ Gerhard Illing K A P I T E L 2 Eine Reise durch das Buch Vorbereitet durch: Florian Bartholomae 2-1 Produktion und Wirtschaftswachstum Das BIP
3. Grundzüge der Makroökonomik. 3.7 Das AS/AD-Modell. Allgemeine Volkswirtschaftslehre. WiMa und andere (AVWL I) WS 2007/08
 3. Grundzüge der Makroökonomik 3.7 Das AS/AD-Modell 1 Herleitung der AD-Kurve Wie wirkt sich ein variables Preisniveau auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus? aggregierte Nachfragekurve (AD-Kurve,
3. Grundzüge der Makroökonomik 3.7 Das AS/AD-Modell 1 Herleitung der AD-Kurve Wie wirkt sich ein variables Preisniveau auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus? aggregierte Nachfragekurve (AD-Kurve,
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell
 Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Kapitel 28 Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
 Kapitel 28 Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Lernziele Was bestimmt die Höhe des Outputs, wenn eine Volkswirtschaft Überschusskapazitäten besitzt? Was sind die Komponenten der aggregierten Ausgaben?
Kapitel 28 Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Lernziele Was bestimmt die Höhe des Outputs, wenn eine Volkswirtschaft Überschusskapazitäten besitzt? Was sind die Komponenten der aggregierten Ausgaben?
Tutorium Makroökonomie I Übungsblatt 3. Aufgabe 1 (Kreislaufmodell einer offenen Volkswirtschaft)
 Tutorium Makroökonomie I Übungsblatt 3 Aufgabe 1 (Kreislaufmodell einer offenen Volkswirtschaft) Es besteht ein Handelsbilanzüberschuss von 40 Talern. Die Einkommensteuer für private Haushalte beträgt
Tutorium Makroökonomie I Übungsblatt 3 Aufgabe 1 (Kreislaufmodell einer offenen Volkswirtschaft) Es besteht ein Handelsbilanzüberschuss von 40 Talern. Die Einkommensteuer für private Haushalte beträgt
Überblick über die Vorlesung
 Überblick über die Vorlesung Prof. Dr. Kai Carstensen LMU und Ifo Institut Inhalt der Vorlesung Empirie es gibt Konjunkturzyklen Produktionskapazitäten sind nicht immer gleich ausgelastet Beschäftigung
Überblick über die Vorlesung Prof. Dr. Kai Carstensen LMU und Ifo Institut Inhalt der Vorlesung Empirie es gibt Konjunkturzyklen Produktionskapazitäten sind nicht immer gleich ausgelastet Beschäftigung
Kapitel 25 Das Vollbeschäftigungsmodell
 Kapitel 25 Das Vollbeschäftigungsmodell Lernziele Was bestimmt in einer Volkswirtschaft mit Vollbeschäftigung den Reallohn, die Höhe der Produktion und die Investitionen? Wie beeinflussen Staatsausgaben
Kapitel 25 Das Vollbeschäftigungsmodell Lernziele Was bestimmt in einer Volkswirtschaft mit Vollbeschäftigung den Reallohn, die Höhe der Produktion und die Investitionen? Wie beeinflussen Staatsausgaben
Theoriegeschichte 2. Neoklassik und Keynesianische Ökonomie
 Theoriegeschichte 2 Neoklassik und Keynesianische Ökonomie Neoklassik Marginalistische Revolution Subjektive Wertlehre Gleichgewichtstheorie Say sches Gesetz Unterschiede zur Klassik Konsequenzen für Wirtschaftspolitik
Theoriegeschichte 2 Neoklassik und Keynesianische Ökonomie Neoklassik Marginalistische Revolution Subjektive Wertlehre Gleichgewichtstheorie Say sches Gesetz Unterschiede zur Klassik Konsequenzen für Wirtschaftspolitik
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II
 Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 7 & 8) Friedrich Sindermann JKU 10.05. & 17.05.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Offene VW 2 10.05.
Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 7 & 8) Friedrich Sindermann JKU 10.05. & 17.05.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Offene VW 2 10.05.
Aufgabensammlung. Präsenzveranstaltung des Lehrgebietes Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik. Termin:
 Präsenzveranstaltung des Lehrgebietes Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik Aufgabensammlung Termin: 20.02.2010 Thema: Freiwilliges Kolloquium zur Klausurvorbereitung Leitung: Dipl.-Volkswirtin Hilke
Präsenzveranstaltung des Lehrgebietes Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik Aufgabensammlung Termin: 20.02.2010 Thema: Freiwilliges Kolloquium zur Klausurvorbereitung Leitung: Dipl.-Volkswirtin Hilke
3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. 2. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow, Kap. V.2.a; Barro/Gordon (1983a)
 3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank 1. Kurz- und langfristige Phillipskurve Literatur: Illing, Kap. 3.1; Jarchow, Kap. V.1.. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow,
3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank 1. Kurz- und langfristige Phillipskurve Literatur: Illing, Kap. 3.1; Jarchow, Kap. V.1.. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow,
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Math. oec. Daniel Siepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Math. oec. Daniel Siepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Grundlagen der Makroökonomie
 Grundlagen der Makroökonomie Prof. Dr. Jürgen Kromphardt Technische Universität Berlin 3., überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag Franz Vahlen München Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
Grundlagen der Makroökonomie Prof. Dr. Jürgen Kromphardt Technische Universität Berlin 3., überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag Franz Vahlen München Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
Der Gütermarkt. Einführung in die Makroökonomie. 9. März 2012 SS Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Der Gütermarkt 9.
 Der Gütermarkt Einführung in die Makroökonomie SS 2012 9. März 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Der Gütermarkt 9. März 2012 1 / 29 Zusammenfassung der letzten Einheiten In den letzten Einheiten
Der Gütermarkt Einführung in die Makroökonomie SS 2012 9. März 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Der Gütermarkt 9. März 2012 1 / 29 Zusammenfassung der letzten Einheiten In den letzten Einheiten
Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2015 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2015 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Lösungen zu Aufgabensammlung. Konjunkturtheorie: Aufgabensammlung I
 Thema Dokumentart Makroökonomie: Konjunkturtheorie und -politik Lösungen zu Aufgabensammlung LÖSUNGEN Konjunkturtheorie: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Was versteht man unter Konjunkturschwankungen?
Thema Dokumentart Makroökonomie: Konjunkturtheorie und -politik Lösungen zu Aufgabensammlung LÖSUNGEN Konjunkturtheorie: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Was versteht man unter Konjunkturschwankungen?
Makroökonomie. Das AS-AD Modell. Dr. Michael Paetz. (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger)
 Makroökonomie Das AS-AD Modell Dr. Michael Paetz (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger) Universität Hamburg Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de 1 / 73 Outline Outline Das AS-AD
Makroökonomie Das AS-AD Modell Dr. Michael Paetz (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger) Universität Hamburg Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de 1 / 73 Outline Outline Das AS-AD
Makroökonomische Theorie I
 Makroökonomische Theorie I Sommersemester 2006 Dr. Stephan Seiter - Makro I 1 Makro-Team Prof. Dr. Harald Hagemann Dr. Stephan Seiter Dipl.oec Ralf Rukwid Dipl.oec. Andreja Benkovic Dipl.oec Markus Schreyer
Makroökonomische Theorie I Sommersemester 2006 Dr. Stephan Seiter - Makro I 1 Makro-Team Prof. Dr. Harald Hagemann Dr. Stephan Seiter Dipl.oec Ralf Rukwid Dipl.oec. Andreja Benkovic Dipl.oec Markus Schreyer
Korrekturrand 1 / 3. Klausur in Makroökonomik / Angewandte Volkswirtschaftslehre. Viel Erfolg!!!
 Wintersemester 2010/11 Fachhochschule Südwestfalen Standort Meschede Fachbereich IW Klausur in Makroökonomik / Angewandte Volkswirtschaftslehre Datum: 28.01.2011 Uhrzeit:11.00 13.00 Hilfsmittel: Taschenrechner
Wintersemester 2010/11 Fachhochschule Südwestfalen Standort Meschede Fachbereich IW Klausur in Makroökonomik / Angewandte Volkswirtschaftslehre Datum: 28.01.2011 Uhrzeit:11.00 13.00 Hilfsmittel: Taschenrechner
Allgemeine Volkswirtschaftslehre I. Übung 2 - Volkswirtschaftliche Regeln
 Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie
 Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
