6. Verbindungen neue Wege Politik
|
|
|
- Kristin Althaus
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 M ä d c h e n a r b e i t i n NRW D e z e m b e r Verbindungen neue Wege Politik Dritter Vernetzungskongress Mädchenarbeit in NRW in Wuppertal
2 3 5 7 Vorwort Grußworte Alberta Großmann-Rath, Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW Sabine Fahrenkrog, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wuppertal VORTRAEGE 10 Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel Mädchenarbeit in schulischer und außerschulischer Bildung I N H A L T Dr. Barbara Stauber Mädchen und Pädagoginnen (un)produktive Verbindungen Claudia Wallner Ihr könnt uns nicht verstehen zum Generationenverhältnis unter Mädchenarbeiterinnen WORKSHOPS Katja Fuchte, Elke Jäger-Klütsch»SchLAu«macht Schule Mädchenarbeit und Schule Karin Krudup Selbstbehauptung Selbstverteidigung: Das kennt doch jede Bettina Bretländer, Heide Adam-Blaneck Sagt uns, wo die Mädchen sind behinderte Mädchen in der Mädchenarbeit Petra Samarah Mädchen! Stärken erkennen und fördern Güler Arapi, Mitja Sabine Lück Girls Act Antirassistische Projekte Sylvia Neldner In and Out lesbische Pädagoginnen in der Mädchenarbeit Eva-Maria Drerup, Petra Kurek Next Generation Alte und neue Lust an Mädchenarbeit Anni Hausladen Klüngeln leicht gemacht Abschlussfeier des Vernetzungskongresses Mädchenarbeit in NRW KÜRZUNGEN IM LANDESHAUSHALT Aktionsbeispiel: Brief an die Landtagsabgeordneten 48 KONGRESS TEILNEHMERINNENLISTE LAG JAHRESTAGUNG 2002 Dr. Andrea Schmidt Balanceakt Mädchenarbeit dekonstruktiven Anregungen für die Praxis von Bildung und Partizipation Regina Rauw Dekonstruktion in der Mädchenarbeit LAG NEWS Impressum
3 V O R W O R T Verbindungen Neue Wege Politik Wir freuen uns, Ihnen/euch mit diesem Rundbrief die Dokumentation des dritten Vernetzungskongresses Mädchenarbeit in NRW vorlegen zu können. In sommerlicher Stimmung trafen sich über 130 Frauen aus der Mädchenarbeit, der Wissenschaft und der Politik um miteinander zu diskutieren, zu streiten, zu träumen und zu feiern. Im Mittelpunkt standen die VERBINDUNGEN zwischen schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit, zwischen Mädchen und Pädagoginnen, zwischen»jungen«und»alten«pädagoginnen. Der Kongress ist ein wichtiger Ort, um kritische Fragen zu stellen:»welchen Stellenwert haben geschlechtshomogene Räume?«,»Was irritiert die Mädchen an den Pädagoginnen und umgekehrt?«,»wie kann eine generationenübergreifende Arbeit mit Mädchen funktionieren?«mädchenarbeit Reichtum für NRW Einmal mehr hat der Kongress gezeigt, dass Mädchenarbeit in NRW aus der Fülle schöpfen kann. Wir danken u.a. der Vorbereitungsgruppe und dem Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW für die Förderung des Kongresses. Mädchenarbeit braucht finanzielle Unterstützung. Durch die Streichung der Position VII»Geschlechtsbezogene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit«aus dem Landesjugendplan wird der Mädchenarbeit in NRW der Boden entzogen. Betroffen sind u.a. Mädchenprojekte, Mädchentreffs und auch die Geschäftsstelle der LAG Mädchenarbeit in NRW. Die LAG wird ihre Arbeit in der bisherigen Qualität nicht weiterführen können. Das betrifft auch die bisher so erfolgreichen Vernetzungskongresse. Der Vorstand der LAG ist bemüht, die Strukturen der Mädchenarbeit in NRW abzusichern. Wir möchten Sie/euch herzlich bitten, uns bei dieser Arbeit im Interesse der Mädchen zu unterstützen. Nähere, aktuelle Informationen finden Sie unter Die Erinnerung an den Kongress bestärkt uns in unserer Arbeit in diesen schwierigen Zeiten. Ohne die Besinnung auf unsere Ressourcen lassen sich persönlich wie kollektiv keine Probleme lösen. Wir wünschen allen LeserInnen eine anregende und bereichernde Lektüre! Barbara Klein-Senge, Britta Maier Dagmar Nüsse, Andrea Reckfort Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. 3
4 Vernetzungskongress KONGRESS Mädchenarbeit in NRW Verbindungen Verbindungen Juli 2003 in Wuppertal Pädagogik Pädagogik Neue Wege Neue Wege Spaß Spaß Dialog Dialog Wertschätzung Wertschätzung Politik Politik Verbindungen Verbindungen Pädagogik Seit 1999 veranstaltet die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. alle zwei Jahre den Vernetzungskongress Mädchenarbeit NRW. Dieses»Gipfeltreffen«der Mädchenarbeit steht für: Die Verbindung von Theorie und Praxis Podiumdiskussion, Vernetzungskongress Mädchenarbeit in NRW Die alte und die neue Lust an der Mädchenarbeit Gespräche und Begegnungen unter Fachfrauen der Mädchenarbeit aus der Praxis, der Wissenschaft und der Politik Synergieeffekte durch Austausch für eine lebendige und innovative Mädchenarbeit in NRW. Auf dem Kongress 2003 wurde Vernetzung unter dem Aspekt von»verbindung«thematisiert, denn aktuelle Fragen in der Mädchenarbeit sind: Die Verbindung zwischen schulischer und außerschulischen Mädchenarbeit wie können die positiven Erfahrungen geschlechtshomogener Kontexte genutzt werden? Die Verbindung zwischen Mädchen und Pädagoginnen, Schülerinnen und Lehrerinnen was hat Mädchenarbeit den Mädchen heute zu bieten? Die Verbindung zwischen»jungen«und»alten«pädagoginnen und damit verbunden, neue und alte Konzepte Auf diesem Hintergrund bildeten die drei zentralen Vorträge von Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, Dr. Barbara Stauber und Claudia Wallner den thematischen Rahmen des Kongresses. In Ergänzung zu diesen übergreifenden Fragestellungen wurden in sieben Workshops praxisrelevante Konzepte vorgestellt. Auf der den Kongress abschließenden Podiumsdiskussion berichteten Abgeordnete des Landtags NRW über Ihre Erfahrungen als Frau in der Politik. Thema war hier auch die Bedeutung von Vernetzungsstrukturen unter Frauen in der Politik. Weitere Specials für formelle und informelle Kontakte war die historische Schwebebahnfahrt, der Besuch des Völkerkundemuseums, die Info Börse, Bewegung, Kabarett und Fest. Pädagogik Wertschätzung 4
5 G R U ß W O R T Alberta Großmann-Rath, Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen K O N G R E S S M Ä D C H E N A R B E I T I N N RW J U L I I N W U P P E RTA L Sehr geehrte Frauen der LAG Mädchenarbeit, sehr geehrter Herr Dr. Kühn, sehr geehrte Frau Fahrenkrog, sehr geehrte Damen, zunächst möchte ich Ihnen die Grüße der Landesregierung insbesondere die herzlichen Grüße von der Jugendministerin Ute Schäfer übermitteln. Mädchenarbeit ist inzwischen vielfach ein Thema mit jugendpolitischer Ausstrahlung. Die Mädchenarbeiterinnen haben erreicht, dass spezielle, auf die Belange von Mädchen und jungen Frauen abgestimmte Angebote durchgeführt werden. Sie haben auch erreicht, dass Angebote in Schule und Jugendhilfe vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Belange von Mädchen und Jungen hinterfragt werden. Mädchenarbeit steht wegen ihrer Querschnittsfunktion nicht zuletzt auch wegen Gender Mainstreaming in engem Zusammenhang mit den Diskussionen in vielen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen. Partizipation, Prävention, Emanzipation und Integration bestimmen hierbei die Ziele. Mädchenprojekte setzen sich auseinander mit Themen wie Partizipationsmöglichkeiten im sozialen Umfeld und bei politischen Prozessen, aber auch mit übergreifenden gesellschaftlichen Themen wie Antirassismus, Gewalt oder Gesundheit und nicht zuletzt Bildung. Hier spielt der Begriff der Bildung in einem umfassenden Verständnis, das die allgemeine und individuelle Bildung sowohl im schu lischen als auch im außerschulischen Bereich einbezieht, zunehmend eine herausgehobene Bedeutung. Bildung beinhaltet eben nicht nur Wissensvermittlung. Im Sinne der Förderungen des Landesjugendplans mit den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sprich dem außerschulischen Bildungsbereich ist der Schwerpunkt vor allem auf die Förderung der Persönlichkeitsbildung, auf die Aneignung von sozialen und kulturellen Kompetenzen und auf die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelegt. Die Förderung der sozialen, geistigen, körperlichen und emotionalen Fähigkeiten der jungen Menschen ist hierbei Richtschnur der Bildungsmaßnahmen. Mädchen haben hier oft andere Interessenslagen und andere Zugänge als Jungen. Am Beispiel der Entwicklung von Me - dienkompetenz ist dies schon vielfach diskutiert worden. Die Angebote sollen deshalb gezielt auf die Bedürfnisse und Interessen von Mädchen eingehen, um den Mädchen und jungen Frauen die optimale Förderung zu ermöglichen. Dies bedeutet im Einzelfall auch eigens an Mädchen gerichtete Bil- 5
6 dungsangebote zu machen und diese parallel zur Koedukation anzubieten. Darüber hinaus sollen aber auch die koedukativen Angebote so qualifiziert werden, dass sie gleichrangig den Interessen von Mädchen und denen von Jungen gerecht werden. Das Jugendministerium hat hierzu unter Beteiligung der pluralen Zusammenschlüsse der Träger der Jugendhilfe Empfehlungen für die parteiliche Mädchenarbeit entwikkelt und veröffentlicht. Sie beinhalten praktische Anforderungen an eine Mädchen und jungen Frauen gerecht werdende Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Für die Mädchenarbeit bedeutet dies, dass sie kontinuierlich gefordert ist (wie übrigens auch die Jungenarbeit) an der Lebenswelt der Mädchen und jungen Frauen orientiert Angebote zu entwickeln. Hierbei sind auch die Mädchen selbst gefordert mit der Reflexion ihrer eigenen Wünsche und Interessen und deren Artikulation, damit eine ihnen gerecht werdende Teilhabe ermöglicht werden kann. Es ist aber auch das Verhältnis zwischen Mädchen und Pädagoginnen im Sinne der Partizipation von Mädchen zu klären. Mädchen müssen oft erst lernen die eigenen Interessen zu erkennen und zu vertreten. Für die Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen wie außerschulischen Bildungsprozess ist deshalb der offene, auf die Belange von Mädchen und jungen Frauen gerichtete Blick für Beteiligungsformen wichtig. Denn Ziel ist die Unterstützung der Mädchen und jungen Frauen bei der Entwicklung einer selbstbestimmten Lebensplanung und Lebensführung. Gerade im Hinblick auf die Berufswahlorientierung ist ein Zusammenwirken schulischer und außerschulischer Angebote von Bedeutung. Der Bereich Medienkompetenz ist wieder ein anschauliches Beispiel dafür, dass sowohl im schulischen Bereich wie auch in der außerschulischen Mädchenarbeit das Berufswahlspektrum mit Blick auf die verschiedenen Medienberufe erweitert werden kann. Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule er möglicht es, diese Förderung von Mädchen effektiv zu gestalten. Heute und in den nächsten Tagen bietet der Vernetzungskongress allen hier Anwesenden wieder die Möglichkeit zu gemeinsamer Reflexion und gegenseitigem Austausch über Erfahrungen und Konzepte. Das Ziel des Kongresses, die Vernetzung weiterhin zu stärken und Kooperationen anzuregen, wird in einer ganzen Reihe von interessanten Workshops und unterstützenden Fachbeiträgen verfolgt. Ich wünsche Ihnen viele interessante Diskussionen und Anregungen für Ihre Arbeit und natürlich auch viel Spaß! Alberta Großmann-Rath, Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen Dr. Stefan Kühn, Dezernent für Soziales, Jugend und Integration Begrüßung der Teilnehmerinnen des 3. Vernetzungskongresses zur Mädchenarbeit in Wuppertal 6
7 G R U ß W O R T Sabine Fahrenkrog, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wuppertal WA S H AT G L E I C H S T E L L G U N G S P O L I T I K M I T M Ä D C H E N A R B E I T Z U T U N? Sehr geehrter Herr Dr. Kühn, sehr geehrte Frau Großmann-Rath, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fachfrauen Was hat Gleichstellungspolitik mit Mädchenarbeit zu tun? In der Regel wird Gleichstellungspolitik damit verbunden, dass die Arbeit der Gleichstellungsstellen und Frauenbüros vorrangig auf die Verbesserung der Lebenssituation und Chancengleichheit erwachsener Frauen ausgerichtet ist. Jedoch: Mädchenförderung ist nicht nur ein Thema der Jugendhilfe, Alleingang zu machen ist. Somit ist sie nicht nur etwas, dass den Kolleginnen in der Mädchenarbeit zugewiesen werden kann. Wenn sie als Querschnitts-aufgabe durchgesetzt werden soll, müssen sich andere Institutionen dieser Aufgabe annehmen und breite Bündnisse ge schlossen werden. In einer Stellungnahme des Jugendamtes Magdeburg wird folgendes formuliert:»mädchenarbeit ist im - mer überlastet, wenn ge schlechts - spezifische Fragen nicht gesamtgesellschaftlich in alle Strukturen eingebunden werden. Viele Fachfrauen berichten von dem Problem, dass ihre Mädchen gestärkt aus ihren Projekten hervorgehen, dann aber in die Schule oder an den Arbeitsplatz kommen, wo sich nichts geändert hat. Deshalb ist es notwendig, dass diese Projekte durch Eintritt in weitere gesellschaftliche Institutionen erhalten und eingebunden werden.«sondern betrifft als Querschnittsaufgabe alle Lebens- und Politikbereiche. Mädchenprojekte haben hierzu wichtiges angestoßen, die Erfahrung zeigt jedoch auch, dass eine Veränderung in den Ge - schlechterverhältnissen nicht im Wenn Mädchenförderung als Querschnittsaufgabe begriffen wird, die in alle Bereiche, in denen Benachteiligungen von Mädchen sei es strukturell oder in Form von Angeboten festgestellt wird eingreifen soll, spielen Gleichstellungsstellen eine wichtige Rolle. Kommunale Gleichstellungsstellen können als Profis einer arbeitsfeld- 7
8 übergreifenden Arbeit und als Schnittstelle von Gleichstellungspolitik und Mädchenförderung fungieren. Ob die Förderung von Mädchen und jungen Frauen in den Arbeitsbereich der Gleichstellungsstellen oder ausschließlich in den Arbeitsbereich der Jugendhilfe gehört, ist nicht klar benannt. Eine wichtige Rolle zur Klärung der Zuständigkeiten spielen Netzwerke oder Projekte, die Handlungsbedarf formulieren. Eine Zusammenarbeit kann sowohl durch weitreichende Unterstützung und gegenseitige Anerkennung gekennzeichnet sein als auch von enttäuschenden Hoffnungen, gegenseitigen Ängsten und Misstrauen geprägt sein. auf Landes- und Bundesebene. Alle drei Ebenen gehören eng zu - sammen und sind aufeinander an - gewiesen. Mädchenförderung ist dann ideal organisiert, wenn sie tatsächlich auf allen drei Ebenen stattfindet. Um eine umfassende Mädchenförderung zu erreichen möchte ich drei Ebenen kurz skizzieren: Wo bestehen nun Handlungsbedarfe und wer macht sie deutlich? Kongressteilnehmrinnen auf dem Verentzungskongress Die Arbeit von Gleichstellungsstellen bringt es mit sich, dass sie so - wohl mit Akteurinnen und Akteuren aus der Verwaltung und der Kommunalpolitik als auch mit autonomen Frauengruppen und -projekten sowie traditionellen Frauenverbänden in Kontakt sind. Zudem gibt es ein breites Spektrum an Organisationen, Vereinen, Verbänden, kirchlichen Einrichtungen, Bildungsinstitutionen und Netzwerken von Gleichstellungsbeauftragten. Jede Gruppe hat naturgemäß spezifische Erwartungen an das Amt und die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten. Den einen hat sie zu wenig Biss, greift zu wenig brisante Themen auf, die anderen stört sie und verletzt kommunalpolitische Spielregeln und ist nicht loyal genug mit ihrem Arbeitgeber. So kann sie parteilich und zu parteilich und gleichzeitig nicht parteilich genug sein. Erstens: Die strukturelle Verankerung der Interessen von Mädchen und jungen Frauen. Hiermit sind u.a. die Erstellung von kommunalen Leitlinien, Mädchenförderplänen, Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfeplanung und die Verankerung von Mädchenarbeitskreisen und Fachtagungen zur kommunalen Mädchenförderung gemeint. Gleichzeitig gehören hierzu jedoch auch die Etablierung partizipativer Strukturen, wie projektbezogene aber auch ständige Beteiligungsprojekte oder -möglichkeiten von Mädchen. Zweitens: Es sind alle Bereiche des Lebenszusammenhangs von Mädchen und jungen Frauen in den Blick zu nehmen. Hierzu gehören neben den Themen Berufswahl bzw. Berufs- und Le - bens planung, Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen, Mädchenkultur, Mädchenförderung im Vorschulbereich und in der Schule auch Themen wie Sexualität, Gesundheit und unterschiedliche Lebensentwürfe bzw. Familienmodelle. Drittens: Organisation und Vernetzung der Mädchenförderung. Hier geht es vorrangig um die Etablierung regionaler oder kommunaler arbeitsfeld- und themenspezifischer Arbeitskreise. Dazu gehören aber auch Vernetzungsstrukturen In der Studie»Gleichstellungsorientierte Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen«wurden von Seiten der Gleichstellungsstellen als vorrangiger Bedarf zur Verbesserung der Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen zwei Punkte benannt: 1.der Übergang Schule-Beruf bzw. der Lebensraum Schule und 2.die Gewalt gegen Mädchen bzw. die Gestaltung mädchengerechter öffentlicher Räume. Grundsätzlich ist festzuhalten: Wo kein Handlungsbedarf erkannt bzw. deutlich gemacht wird, können sich Kommunen oder die Öf - fentlichkeit in dem Glauben wähnen, dass auch kein Handlungsbedarf besteht. Nur wenn deutlich wird, wo Mädchen und junge Frauen weniger Chancen haben, ihre Interessen umzusetzen, wie vergleichsweise gleichaltrige Jungen, können Lücken ausgemacht und damit Handlungsbedarfe aufgezeigt werden. Protagonistinnen für das Aufzeigen von Handlungsbedarf sind sowohl professionelle Jugendhilfezusammenhänge, Frauengruppen und Verbände, Gleichstellungsstellen und nicht zuletzt die Mädchen selbst. Die oben genannte Studie stellt fest, dass je kleiner die Orte und je ländlicher das Bundesland, desto höher ist der Prozentsatz der Mädchen, die bei Gleichstellungs- 8
9 stellen selbst Handlungsbedarf an - melden bzw. Aktivitäten einfordern. Dies überrascht umso mehr, als das es für Mädchen immer schwieriger scheint, die Ungleichheit der Ge - schlechter zu thematisieren, weil sie es als Zuschreibung, die Zeichen der Moderne nicht verstanden zu haben, erleben. Es überrascht auch, weil es eigentlich nicht üblich ist, dass Gleichstellungsstellen gemäß ihres Arbeitsauftrages vielfältigen direkten Kontakt mit Mädchen haben. Hierbei ist es natürlich wichtig, dass die Chancen, dass von Mädchen und jungen Frauen geäußerter Bedarf politisch wahrgenommen wird, größer sind, wenn ihre Interessen von solidarischen Erwachsenen unterstützt werden. Mädchenförderung meint in diesem Sinne nicht nur die Planung einzelner konkreter Angebote, sondern die Bereitstellung eines Rahmens für Ausdrucksmöglichkeiten, für Verständigung untereinander und mit Erwachsenen, der die Artikulation von Unmut und Interessen ermöglicht und eigene Einschätzungen als legitim bestärkt. Hieraus folgt, dass Projekte, in de nen nach den Bedürfnissen von Mädchen gefragt wird, in Be - stands aufnahmen und Planungsprozesse aufgenommen werden müssen. Darüber hinaus bedeutet dies aber auch, dass Verantwortliche in den direkten Kontakt und die Auseinandersetzung mit Mädchen gehen sollten, statt Vermutungen als Ausgangspunkt ihrer Handlungen zu nehmen. Mädchen und junge Frauen müssen vor Ort eine erkennbare Stelle vorfinden, bei der sie Wünsche anmelden und sicher gehen können, dass diese aufgegriffen werden. Ob Gleichstellungsstellen diese Stelle sein müssen, sei dahin gestellt, dies hängt sicherlich auch von den je - weiligen Strukturen vor Ort ab. Sie sind auf jeden Fall Stellen, die entsprechende Wünsche und Handlungsbedarfe weiterleiten können an andere Stellen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Gleichstellungsstellen sind und können Katalysator und Motor für Ini - tiativen werden, die sie mitentwickeln und dann weiterreichen. Sie können als Expertinnen fungieren, die anderen Impulse geben. Gleichstellungsstellen sichern, dass bei Bedarf bislang nicht wahrgenommene Interessen zur Geltung ge - bracht werden. Im Zuge der Diskussion um Gender Mainstreaming und der damit verbundenen möglichen Gefahr einer allgemeinen Zielpolitik, die Zielgruppen aus dem Auge verliert, muss deutlich werden, dass Gleichstellungsstellen immer noch spezifische Anlaufstellen für Mädchen und Frauen sind. Zum Schluss meiner Rede möchte ich natürlich noch den vielen Akteurinnen danken, die diesen Kongress geplant und dieses hervorragende Programm zusammengestellt haben. Für die LAG-Geschäftsstelle danke ich Ulrike Graff, die unterstützt von Anna Rabien und Silke Blotschinski (Bellzett Bielefeld) den Löwinnen-Anteil der Arbeit geleistet hat. Für das Orga(nisations)team danke ich zunächst den Fachfrauen der Mädchenarbeit aus anderen Städten, die sich an diesem Kongress beteiligt haben. Uschi Knebel-Ittenbach vom Gleichstellungsamt des LVR in Köln, Petra Kurek vom Mädchenzentrum Mabilda und den Kolleginnen aus ihrem Team, sowie Trixi Schulz vom Mädchenkrisenhaus Outlaw in Münster. Zuletzt danke ich natürlich den beteiligten Wuppertaler Kolleginnen, die dafür gesorgt haben, dass Wuppertal als Ort für den 3. Vernetzungskongress sicherlich unvergesslich bleiben wird. Dagmar Nüsse vom Nachbarschaftsheim Alte Feuerwache und Sprecherin des AK Mädchenarbeit Martina Völker, Referentin für Mädchenarbeit im SB Jugend und Freizeit, ebenfalls Sprecherin des AK Mädchenarbeit, Annelie Schettler von der VHS, Bereich Ausbildung und Umschulung, Christine Specht als Journalistin für die Pressearbeit zuständig. Und zu guter Letzt danke ich ganz herzlich meinen Kolleginnen aus der GST Wuppertal, die mit großem Einsatz und hohem persönlichen Engagement zur Verwirklichung dieses Kongresses beigetragen haben. Vielen Dank an Rossi Bocklage und an Ulli Kirst, die die Info-Börse organisiert hat. Ich wünsche dem Kongress ein gutes Gelingen und freue mich auf die vielen interessanten Vorträge und Workshops. Sabine Fahrenkrog, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wuppertal 9
10 Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel M Ä D C H E N P Ä D A G O G I K I N S C H U L I S C H E R U N D A U ß E R S C H U L I S C H E R B I L D U N G Vorbemerkung Mit Bewunderung habe ich die vielen kreativen Mädchenprojekte zur Kenntnis genommen, die sich auf diesem Vernetzungskongress zur Diskussion stellen. Das alles gab es vor 20 Jahren noch nicht. In meinem Beitrag diskutiere ich, in welchem Verhältnis feministische Konzepte der Mädchenarbeit zu Befunden der Geschlechterforschung stehen sowie Forschungsergebnisse zu den Selbsteinschätzungen von Mädchen und Jungen. Die zentrale Frage ist, wie sehen sich die Mädchen, und wie werden sie gesehen, aber ist überhaupt noch von den Mädchen zu reden und welche Differenzierung wären angebracht? Ich gehe in meinem Beitrag ein auf: 1. Konzepte der Mädchenarbeit und ihre Resonanz 2. Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemäß PISA- Studie 3. Selbsteinschätzung und Können am Beispiel von Computer Literacy 4. Studien zur Koedukation und Monoedukation 5. Gender Mainstreaming und Mädchenarbeit Konzepte der Mädchenarbeit und ihre Resonanz Das Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der Mädchenarbeit, das Dorit Meyer und Gerlinde Sei - denspinner 1999 formuliert haben, hat eine heftige Debatte zur Folge gehabt. Genereller Forschungsbefund zur aktuellen Jugendgeneration sei ein Moment der Dauergefährdung als Lebensgefühl sowie die Vorwegnahme von Problemen der Arbeitswelt. Diese würden Jugendliche am stärksten beschäftigen, nicht dagegen die»klassischen Lehrbuchprobleme der Identitätsfindung, Partnerwahl und Verselbständigung«(ebda: 69). Ihre These lautet, dass nur noch junge Mädchen bis 13 Jahre und besondere Zielgruppen, wenn überhaupt, von einer feministischen Mädchenarbeit angesprochen würden, nicht dagegen die wichtigere Gruppe der ab 15 Jährigen. Die Rede ist von veralteten Denkkategorien der 70er und 80er Jahre. Die heutigen Mädchen würden sich gegen eine Opferrolle und das Diskriminierungsparadigma wehren. Daher stießen geschlechtshomogene Angebote auf Ablehnung und würden als diskriminierend empfunden. So weit so gut. Dieser Behauptung von der mangelnden Resonanz auf Mädchenangebote ist heftig widersprochen worden, z. B. von Debbing/Ingenfeld 1999 u.a. Da ich die empirische Forschung zur Beteiligung an den getrennten Angeboten für die Mäd- 10
11 chen nicht kenne, halte die Frage hier zunächst für offen. Die Entwicklung der Mädchenarbeit, die seit dem 6. Jugendbericht einen besonderen Schwung erhalten hat, und ihr aktuell behaupteter Nischen- oder Sonderstatus in der Jugendhilfe, bleiben davon unbenommen. Die Autorinnen Meyer und Seidenspinner haben die kritische Auseinandersetzung mit defizit-, differenz- und ressourcenorientierten Ansätzen in der Mädchenarbeit wohl beabsichtigt und viel frische Motivation hervorgelockt. 1 Dies ist durchaus ein bemerkenswerter Verdienst. Ich referiere und reflektiere im Folgenden Forschungsbefunde, die Geschlechterdifferenzen und ihre Auflösung zum Gegenstand haben und versuche sie auf die Debatte zur gemeinsamen oder geschlechtergetrennten Jugendarbeit zu beziehen. Meine These lautet: Der öffentliche Diskurs hat sich gewandelt. Mädchen wachsen zur Zeit unter anderen Bedingungen auf als noch vor 25 Jahren. Ob sich ihre Chancen im gesamten Lebensverlauf denen der Jungen angenähert haben, ist jedoch eine offene Frage. Die Ausgangssituation für die Mädchenarbeit ist eine andere geworden, denn die Bildungsbenachteiligung der Mädchen hat sich in einen partiellen Bildungsvorsprung ge - wandelt. Das heißt nicht, dass es nicht noch viele einzelne Mädchen gibt, die im Bildungssystem nicht erfolgreich sind. Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemäß PISA-Studie In allen in die Untersuchung einbezogenen OECD-Ländern haben die 15 jährigen Mädchen einen (signifikanten) Vorsprung gegenüber den altersgleichen Jungen in der Lesekompetenz. Diese Unterschiede sind am ausgeprägtesten auf der Skala»Reflektieren und Bewerten«(Baumert 2002, Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der Internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000, OECD 2001, Metz-Göckel 2002 a) Der internationale Vergleich und die unterschiedlichen Befunde zu den Geschlechterdifferenzen in den einzelnen OECD-Ländern machen offensichtlich, dass zwischen den Geschlechter-Zuschreibungen und den sozialen Kontexten ein Zusam - menhang besteht, der in der Theorie der Geschlechterforschung als soziale Konstruktion von Geschlecht erfasst wird (Gildemeister 1992). Denn nach PISA ist ein Rückgriff auf natürliche Interessen von Jungen und Mädchen im Sinne von ge - schlechtsspezifischen Unterschieden nicht mehr vertretbar. Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen erweisen sich im internationalen Vergleich nicht als geschlechts - spezifische, sondern als soziale Differenzen. Was das Interesse weckt, wird gern getan, ausdauernd ausgeübt und geht in den Freizeitbereich über. Was bei den Mädchen fürs Lesen gilt, gilt bei den Jungen für die Nutzung des PC und teils auch für die Mathematik. In der mathematischen Grundbildung bringen die Jungen in Korea, Brasilien, Österreich und Deutschland sowie einigen anderen Ländern bessere Leistungen. Die Jungen ha ben zwar einen Vorsprung in Ma - the matik, aber dieser ist geringer als der Lesevorsprung der Mädchen und am deutlichsten in den Spitzenleistungen. In der naturwissenschaftlichen Grundbildung bestehen in Deutschland wie in den meisten Ländern keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wenn, dann können sie zugunsten von Mädchen sein wie in Russland und Lettland oder zugunsten der Jungen wie in Korea, Dänemark und Österreich. Mit zunehmenden Schüleralter nehmen die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen eher zu als ab. Fazit: Der in fast allen Ländern be - ob achtbare erhebliche Vorsprung der Mädchen in der Lesekompetenz sowie die in vielen Ländern besseren Ergebnisse der Jungen in der mathematischen Grundbildung sind auf den jeweiligen kulturellen Hin - tergrund bzw. auf pädagogische Maßnahmen und Praktiken zurückzuführen.»einige Länder bieten ganz offenbar ein Lernumfeld, das beiden Ge - schlechtern gleichermaßen zugute kommt, was entweder unmittelbar auf bildungspolitische Maßnahmen oder auf einen günstigeren gesellschaftlichen Kontext zurückgeführt werden kann. Korea, und in geringerem Ausmaß Irland, Japan und dem Vereinigten Königreich gelingt es, bei der Lesekompetenz sowohl höhere durchschnittliche Punktwerte zu erreichen, als auch die ge - schlechtsspezifischen Unterschiede in Grenzen zu halten. In der mathematischen Grundbildung erzielen Belgien, Finnland, Japan, Neuseeland und das Vereinigte Königreich einerseits hohe Durchschnittsleistungen und andererseits auch geringe geschlechtsspezifische 11
12 Unterschiede«(Deutsches PISA- Konsortium 2003: 147). D.h., hohe Leistungen in der Lese-, Mathe- und Naturwissenschaftskompetenz können mit geringen Geschlechterdifferenzen einhergehen. In der naturwissenschaftlichen und mathematischen Grundbildung, bei der Jungen in der Vergangenheit häufig besser abgeschnitten haben, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern meist sehr viel geringer ausgeprägt als die Unterschiede zu Gunsten der Mädchen bei der Lesekompetenz. Schülerinnen ha - ben in der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundbildung aufgeholt und ihren Vorsprung in der Lesekompetenz eher ausgebaut. International ist dieser Befund jedoch zu differenzieren.»in den Naturwissenschaften lässt sich kein eindeutiges Muster der geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen: Mädchen schneiden in Lettland, Neuseeland und der russischen Föderation besser ab als Jungen, während in Österreich, Dänemark und Korea die Jungen vor den Mädchen liegen. In den übrigen Ländern, also auch Deutsch land, sind die Differenzen statistisch nicht signifikant«(ebda: 149). 2 Länderübergreifend gibt es demnach zwar sehr ähnliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Lesekompetenz, viel eingeschränkter aber in der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundbildung. Die grundlegenden Merkmale des Bildungs- und Gesellschaftssystems beeinflussen die gesamte schulische Laufbahn hindurch die Leistungsunterschiede. Ein länderspezifisch exotischer Be - fund lautet: Mädchen in Portugal lesen besonders gern und nur in Portugal haben Mädchen ein höheres Interesse an Mathematik als Jungen.»Finnland z.b. weist die höchsten geschlechtsspezifischen Unterschiede auf der Gesamtskala Lesekompetenz auf (51 Punkte zu Gunsten der Mädchen), hingegen sind dort die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auf der Skala für mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung gering. Umgekehrt ergeben sich für Korea die geringsten geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Lesekompetenz (14 Punkte zu Gunsten der Mädchen), während die Ab - stände zwischen Jungen und Mädchen in der mathematischen Grundbildung (27 Punkte zugunsten der Jungen) und in der naturwissenschaftlichen Grundbildung (19 Punkte zu Gunsten der Jungen) zu den größten im gesamten OECD Raum gehören. Solche Abweichungen zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen zeigen, dass diese Disparitäten durch die unterschiedlichen Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler bedingt sind und somit durch Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen abgebaut werden können«(ebda: 149). Wenn anhand der PISA-Studie von problematischen geschlechtsspezifischen Unterschieden die Rede ist, dann sind die Jungen gemeint. Sie verdienen neue Aufmerksamkeit und zwar sowohl deutsche Schüler als auch solche mit einem familialen Migrationshintergrund. Die Jungen sind schulisch zum Problemgeschlecht geworden. Insofern müsste sich der öffentliche Diskurs der Bildungsbenachteiligung von Jungen zuwenden und deren Imperative problematisieren. Blickt man auf die inhaltlichen Interessen, dann trennen sich junge Frauen und junge Männer weiterhin voneinander. Anders ausgedrückt: Das deutsche Schulsystem leistet fast nichts im Hinblick darauf, die traditionelle Interessenpolarisierung zwischen den Geschlechtern aufzulösen. Selbsteinschätzung und Können am Beispiel von Computer Literacy Der Computer Literacy als fächerund bereichsübergreifender Kompetenz ist große Aufmerksamkeit zu widmen, da in der Wissensgesellschaft computerbezogene Kompetenzen und Selbsteinschätzungen eine eminente Rolle spielen. Bei den Schüler/innen in Deutschland wurde eine erstaunlich große Diskrepanz zwischen Computerinteresse und ihren computerbezogenen Selbsteinschätzungen ermittelt. Mit den Jungen in Deutschland können nur noch die luxemburgischen mithalten. In der Selbsteinschätzung ihrer computerbezogenen Fähigkeiten dagegen liegen die deutschen Schüler/innen jedoch an zweitletzter Stelle, mit Ungarn als Schlusslicht. Schaut man genauer hin, wie diese Diskrepanz zustande kommt, zeigt sich, dass es hauptsächlich (ca. 60%) die Spiele sind, die in der Freizeit den Computer zum Gegenstand des Interesses machen. Die Nutzung von Lern- und Arbeitssoftware und selbst das Internet und die elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten spielen eine viel geringere Rolle, wobei es einige spezifische Länderdifferenzen gibt. Da die PC-Kompetenzen jedoch im Hinblick auf die Lern- und Arbeitssoftwarenutzung beurteilt werden, sackt in dieser Hinsicht die Selbsteinschätzung der Schüler/innen dramatisch ab. 12
13 Die PISA Befunde weisen zudem erneut auf einen sozialen Bias im Zugang zum Computer hin. Er differiert auch zwischen den Bundesländern und macht auf die kompensatorische Bedeutung von Schule für die Familien mit niedrigem so - zialen Status aufmerksam. Die Schule hat für die Einschätzung von computerbezogenen Fähigkeiten eine geringe Bedeutung. Dies»schlägt sich auch in ihrem geringen Effekt auf die Nutzung unterschiedlicher Software nieder«(ebda: 203). Die Autoren schreiben hier der Schule eine große Verantwortlichkeit zu, vor allem da die Geschlechterunterschiede in der Bundesrepublik besonders krass sind. In den USA und Mexiko interessieren sich die Mädchen ähnlich stark für den Computer wie ihre Mitschüler. Die PISA-Autoren (Wirth/Klieme) gehen davon aus, dass bei einer gezielten Förderung des Umgangs mit Lern- und Arbeitssoftware sowie mit dem Internet und seinen Kommunikationsmöglichkeiten eine Verbesserung der Computer Literacy erreicht werden könnte. Die Schule»ist nahezu bedeutungslos bei der Reduzierung von Be - nach teiligungen verschiedener Schülergruppen. (Bei Jugendlichen mit einem geringeren sozioökonomischen Status ergaben sich keine bedeutsamen Unterschiede.) Im Gegensatz dazu sind die nachweisbaren Geschlechterunterschiede im computerbezogenen Interesse und in den entsprechenden Kompetenzeinschätzungen ein deutlicher Hinweis auf wünschenswerte Verbesserungen des Bildungsangebots an deutschen Schulen«(ebenda: 207). PC-Kompetenzen werden hauptsächlich außerhalb der Schule erworben (vgl. auch Schulz-Zander 2002). Wie kommt es hier zu dem geringen Interesse der Mädchen? Schründer-Lenzen (1995) fand heraus, dass diejenigen Mädchen, die ein eher weibliches Selbstkonzept haben, die Computerkultur oder die Arbeit mit dem Computer häufiger ablehnen. Diese Mädchen nehmen den Computer auch häufiger als Teil einer männlichen Kultur wahr und sind der Meinung, dass Computer mit ihrer Geschlechtsidentität nicht einhergeht, dass Computer nichts für Mädchen sind. Das weibliche Selbstkonzept ist dabei vor allem durch Beziehungs- und Helferorientierungen charakterisiert. Diejenigen Mädchen, die zur Gruppe der PC Befürworterinnen zählen, zeichneten sich im Gegensatz dazu durch eine größere Leistungs- und Aufstiegsorientierung aus. Dieser Befund ist zwar schon 8 Jahre alt, zeigt aber auch bereits einen Wandel an, an den feministische Mädchenarbeit anknüpfen kann. Dabei scheint mir wichtig, dass sich Ausgangsposition sowie die Inhalte feministischer Mädchenarbeit ändern. Die computerkompetenten Mädchen haben zwar kein»männliches«selbstkonzept, aber dieses enthält weniger traditionell weibliche Elemente (ebda: 239 ff). Ihr Selbstkonzept ist unter dem Leitbild der Ähnlichkeit der Ge schlechter entwickelt. Sie haben eher»geschlechtsneutrale«sozialisationserfahrungen ge macht, in denen ein frühzeitiger Umgang mit Technik möglich war. 3 Kongressteilnehmrinnen auf dem Verentzungskongress 13
14 Studien zur Koedukation und Monoedukation Insbesondere die Studie von Kessels (2002) hat gezeigt, dass das Interesse von Schülerinnen in Physik stark von der Lernkonstellation abhängt und in monoedukativen Gruppen länger aufrechterhalten wird. Sie hat ein sehr interessantes Modell entwickelt und unterscheidet in ihrer Studie zum Undoing Gender in der Schule globale und situationale Geschlechts typisierung und untersuchte den Einfluss der Geschlechterkonstellation in der Lerngruppe auf das Ausmaß der situationalen Geschlechtstypisierung. Die Studie operiert mit einem situational aktivierten Identitätskonzept und einem Selbstwissen, das situational beeinflusst ist. Des weiteren unterscheidet sie geschlechtseigenes und geschlechtsfremdes Wissen, maskulines und feminines Selbst wissen sowie chronische und situationale Geschlechtsrollenorientierung. Damit teilt sie das Genderkonzept nicht nur in eine Außen- und eine Innenperspektive auf, sondern be zieht diese auf konkrete Umfeldkonstellationen, z.b. die Geschlechterzusammensetzung der Lerngruppe. Es zeigte sich, dass die Überzeugung, für Physik allgemein begabt zu sein, in Abhängigkeit vom Geschlecht und der Gruppenkonstellation variierte. In den gemischtgeschlechtlichen Gruppen unterschieden sich die Begabungsüberzeugungen von Jungen und Mädchen. Mädchen reagierten im Unter schied zu den Jungen sehr viel stärker auf die Lernumgebung und welches Klima und Geschlechterverhältnis dort herrschte. Selbsteinschätzungen und Selbstkonzepte von heranwachsenden männlichen und weiblichen Jugendlichen unterscheiden sich vor allem dadurch, dass weibliche Jugendliche stärker umfeldabhängig sind als männliche. Das läßt sich auch so deuten, dass Mädchen im allgemeinen auf ein anderes Umfeld treffen als Jungen, zumindest in den sogenannten männlich konnotierten Lern- und Arbeitsfeldern. Sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen erwies sich die Geschlechtstypisierung in koedukativen Gruppen als ausgeprägter als in den monoeduaktiven Gruppen. Dagegen wurde ausschließlich für die Gruppe der Mädchen ein klarer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Geschlechtstypisierung und dem physikbezogenen Selbstkonzept sowie der physikbezogenen Motivation gefunden. Eine relativ maskuline chronische Geschlechtsrollenorientierung geht mit einem größeren Engagement und einem besseren Selbstkonzept in Physik einher.»bei den Mädchen ergaben sich folgende Zusammenhänge zwischen der situational aktivierten Identität während des Unterrichts und Ma - ßen des physikbezogenen Selbstkonzepts und der Motivation: Je mehr maskulinen Items sie zu - stimmten, desto stärker waren sie zu einem späteren Zeitpunkt davon überzeugt, im Physik-Unterricht gute Leistungen zu zeigen, für Physik begabt zu sein und sich am Physikunterricht aktiv beteiligt zu haben.... Je häufiger die Mädchen maskuline (relativ zu femininen) Adjektive für selbstbeschreibend hielten, desto bessere Werte hatten sie auf den gerade genannten Skalen«(Kessels 2002: 215). Diese Ergebnisse stimmen mit Studien überein, nach denen psychologisch maskuline Mädchen/Frauen sich in Bereichen wie mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä - chern stärker und erfolgreicher engagieren. Die Studie von Kessels betont die Bedeutung der situational aktivierten Geschlechtsidentität, vor allem des Unterrichts. Mir scheint, dass sich diese Befunde auf den außerschulischen Bereich übertragen lassen. Ich referiere daher im folgenden Befunde und Überlegungen zu den geschlechtshomogenen und gemischten Geschlechterkonstellationen. Es zeigt sich, dass es sehr unterschiedliche Konstellationen von Gleichheit und Ungleichheit in der jungen Generation gibt, und dass die Aussagen zu den Geschlechterverhältnissen komplexer werden müssen. Die theoretische Begründung für eine bewusst hergestellte bzw. reflexive monoedukative Lernsituation ist, dass Mädchen und Jungen grundsätzlich gleich fähig sind. Das gilt auch für die Koedukation, die Kritik an ihr ist kontextspezifisch zu differenzieren und auf mehreren Ebenen angesiedelt, auf der Ebene der alltäglichen, meist unbewusst ablaufenden schulischen Interaktionen, der Ebene der verinnerlichten Geschlechterstereotypisierungen bei männlichen und weiblichen Jugendlichen (und allen anderen), der Ebene der gespiegelten Geschlechterungleichheit innerhalb der institutionellen Schulkultur. Unbestritten ist z.b., dass in Physik die Schülerinnen von der Ge - schlecht ertrennung profitieren (Häussler/Hoffmann 1995, Kron- Traudt 1998, Kessels 2002). Die Schülerinnen selbst haben aber ein ausgesprochen ambivalentes Verhältnis zu einer geschlechtshomo- 14
15 genen Lernsituation, selbst oder gerade dann wenn diese für sie er - folgreicher ist als eine koedukative. Hier ist auf unbedachte Nebenfolgen zu verweisen, auf die Faulstich- Wieland/Horstkemper aufmerksam gemacht haben. Zu diesen gehört, dass die Rückvermittlung des in den Mädchenkursen Gelernten in den koedukativen Kontext nicht gelingt und die Stereotypisierungen der Schüler sich dadurch eher noch verstärken als auflösen. Eine andere Kritik richtet sich darauf, dass Schüler und Schülerinnen mehrheitlich für die gemeinsame Unterrichtung eintreten und nicht getrennt werden wollen (Faulstich-Wieland/ Horstkemper 1995). Die bisherigen Projekte einer absichtlichen Geschlechterseparierung sind eine kritische Antwort auf eine asymmetrische Geschlechterkultur, in der sich die koedukative Erziehung und Bildung meistens vollzieht. Diese Projekte zeigen gleichzeitig, dass Geschlechtertrennung etwas anderes bedeutet, je nachdem ob sie spontan zustande kommt, ob sie erzwungen und verordnet wird oder ob sie freiwillig und absichtlich hergestellt wird. Jungen und Mädchen beteiligen sich über ihre jeweiligen peer groups ganz intensiv an der Herstellung einer asymmetrischen Gruppengeschlechterkultur. Wie wir aus der Sozialisationsforschung wissen, halten sich Jungen und Mädchen im Verlauf ihrer Entwicklung spontan sehr ausgiebig in geschlechtshomogenen Gruppen auf (Thorne 1993, Maccoby 1990). Im Prozess ihres Erwachsenwerdens verlassen weibliche Jugendliche mehr und mehr ihre Mädchengruppen zugunsten von gemischtgeschlechtlichen. Die frauenbewussten Projekte einer geschlechtshomogenen Lern- oder Studiensituation begründen die außergewöhnliche Monoedukation mit einer besseren Förderung als es die Koedukation vermag. Sie können dies aber nur leisten, wenn sie mit weitergehenden Reformmaßnahmen verknüpft werden. Für den Schulbereich werden daher mit der Einrichtung von Mädchenkursen didaktische Neuorientierungen erprobt, die in einer weiteren Phase auch den Jungen zugute kommen sollen (Häussler/Hoffman 1995). Diese schulischen Experimente mit ge - schlechtshomogenen Gruppen betreffen eine winzige Minderheit, sie sprechen nur einen kleinen Teil junger Frauen an und stehen in ständiger Konkurrenz zu den koedukativen Angeboten. Ein monoedukatives Setting durchbricht nur dann Geschlechtergrenzen, wenn es nicht mit Vorgaben über Weiblichkeit oder Männlichkeit gekoppelt wird, vielmehr durch die Konzentration auf Frauen mögliche frauenspezifische Begrenzungen ausgehebelt werden. Dies ist mit paradoxer Intervention ge meint, dass nämlich die Ge - schlechtszugehörigkeit bedeutungsloser wird, wenn sie durch die Trennung zunächst einmal dramatisiert wird (Teubner 1997). Ein monoedukatives Angebot durchbricht dann nicht die Geschlechtergrenzen, wenn es als Nachhilfeangebot oder gar als minderwertiges Angebot eingeführt wird. Das ist der zentrale Unterschied, auf den die Schülerinnen mit Ablehnung reagieren und wohl im allgemeinen auch die Mädchen. Schülerinnen und Schüler meinen, mit der Koedukation sei die Gleichberechtigung verwirklicht. Mädchen und weibliche Jugendliche immunisieren sich gegen subtile Diskriminierungen und strukturelle Ungleichheit dadurch, dass sie die Gleichberechtigung für realisiert halten, quasi durch ihre imaginierte Gleichheit. Die Ausgangssituation der aktuellen Koedukationsdebatte ist somit hoch komplex und durch Widersprüchliches gekennzeichnet: Mädchen haben durch die Koedukation in mancher Hinsicht einen Vorsprung erzielt, dennoch wirkt eine partielle Benachteiligung biografisch verschoben fort und zwar mit der Familiengründung. Jungen haben es inzwischen schwerer und viele leiden unter den Imperativen einer dominanten Männlichkeit, trotzdem sind sie langfristig die gesellschaftlich Erfolgreicheren. Die Interessen von Mädchen gehen in einigen Bereichen wie Sport, Computerbeschäftigung und der Technik in eine andere Richtung als die von Jungen, obwohl sie in ihren Potentialen gleich sind. LehrerInnen wollen ihre Schüler und Schülerinnen gleich und gerecht behandeln, trotzdem sind sie auch wirksame VermittlerInnen von (unbewussten) Geschlechterstereotypisierungen. Die Debatte zur Koedukation ist inzwischen differenziert geworden. Auch für BefürworterInnen zählt dazu ein flexibler Umgang mit geschlechtshomogenen Gruppen (in Sport, Physik, Computerkursen). Werden Mädchengruppen in koedukativen Kontexten eingerichtet, setzen sie sich der Gefahr aus, abgewertet zu werden, egal wie ihre Ergebnisse sind. Sie er - zeugen auch kontraproduktive Effekte vor allem bei Jungen (Kron-Traudt 1998). 15
16 Gender Mainstreaming und Mädchenarbeit Das Konzept des Gender Mainstreaming ist auf den ersten Blick auf Koedukation ausgerichtet. Es macht monoedukative Experimente jedoch nicht überflüssig, solange die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen nicht verwirklicht ist, ebenso wenig eine mädchenbewusste Pädagogik. Das Gender Mainstreaming Konzept ist als zusätzliche Strategie ergänzend zu den frauenpolitischen Instrumenten gedacht. Es macht aber darauf aufmerksam, dass auch die Männer ein Geschlecht haben. Das Gender Mainstreaming-Konzept impliziert (Metz-Göckel 200b): Die Berücksichtigung von Frauen und Männern gleichermaßen und zwar jeweils dort, wo das eine Geschlecht unterrepräsentiert ist. Das macht es auf den ersten Blick weniger radikal und aus männlicher Perspektive we - niger diskriminierend (als die bisherige Frauenförderung). Die Integration einer geschlechtersensiblen Perspektive in alle politischen und wissenschaftlichen Entscheidungsprozesse; z.b. durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenslagen und Interessen von (jungen) Frauen und Männern. Die antizipatorische Wirkungsanalyse von Maßnahmen, Programmen und Politiken in ge - schlechterdifferenzierender Weise ebenso ihre Evaluation. Dazu bedarf es eines reflexiven Differenzwissens. Die Geschlechterperspektive in bisher als geschlechtsneutral geltende Bereiche der Jugendarbeit zu integrieren, bedeutet die Aufnahme von Kritik und die Herausforderung zum Umdenken. Daher war es leichter, die Frauen- und Geschlechterforschung und Mädchenarbeit»separat«zu institutionalisieren, als sie in den Mainstream zu integrieren. Im Sinne des Gender Mainstreaming reicht dies jedoch nicht aus, da alle Bereiche auf ihre Ge - schlechterrelevanz hin reflektiert werden sollen. Die konzeptionell vorgesehene Verbindung von Bildungsarbeit mit dem Gendermainstremaing enthält angesichts des Paradigmenwechsels in der Geschlechterforschung einige Gegenläufigkeiten: Das Konzept des Gender Mainstreaming baut auf einer generellen Vergeschlechtlichung aller Handlungsebenen auf, die daraufhin untersucht werden sollen, welchen differenziellen Einfluss sie auf die Geschlechter haben (könnten). Damit schließt es an die Omnirelevanzthese an, derzufolge das Ge schlecht immer präsent und relevant ist. Im aktuellen Diskurs der Frauenund Geschlechterforschung ist dagegen durchaus eine sehr kritische Haltung gegenüber einer solchen Generalisierung zu verzeichnen, eher eine Haltung der Selbstvergessenheit der Geschlechtszugehörigkeit denn ihre Dramatisierung. Geschlecht wird mehr und mehr mit anderen Differenz und Hierarchie konstituierenden Merk malen in Verbindung gebracht. Das Konzept setzt differenziertes Wissen über die Geschlechter und Geschlechterverhältnisse voraus, sollte dieses aber nicht fixieren. Viel mehr müsste es als»flexibles Differenzwissen«in Bewegung ge halten werden, denn es gibt keine universellen Geschlechterdifferenzen, die auf die Geschlechtszugehörigkeit zurückzuführen wären. Es gibt noch kaum konkrete Um - setzungserfahrungen, wie vor allem mit Konflikten und sich widerstreitenden Interessen, die unabdingbar im Geschlechterverhältnis angesiedelt sind, um - gegangen werden kann. Gerade in einem konfliktreichen Feld ist es von eminenter Bedeutung, welche übergreifenden Perspektiven und Interessen mobilisiert werden können. Die Verantwortung für den Er - folg wird an diejenigen delegiert, die bisher (meist unwissentlich) eine Gleichstellungspolitik blokkiert oder für unwichtig gehalten haben. Schlussbemerkungen Pädagoginnen und Pädagogen stehen vor dem Dilemma, den An - spruch auf Gleichbehandlung und Gerechtigkeit gegenüber Kindern und Jugendlichen verträglich zu machen mit der Zielsetzung einer Entpolarisierung der Geschlechtercharaktere und einer Wertorientierung der Parteilichkeit gegen Ge - schlechterdiskriminierung. Das bedeutet, geschlechtersensible Bildungskonzepte für beide Ge - schlech ter zu entwickeln. Ganz summarisch und hier lediglich in Stichpunkten formuliert schließt dies konkret ein, Gender Trainings in Frau-Mann Teams durchzuführen, auf eine ausgeglichene Zusammensetzung von Jungen und Mädchen in den Lern- und Bildungsgruppen zu achten und minoritäre Beteiligung eines Geschlechts zu vermeiden, übergeordnete Interessen an - sprechen und wo es irgend geht, nicht an Geschlechterpolarisierung anzuknüpfen. Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, Professorin an der Universität Dortmund mit dem Schwerpunkt Bildungs- und Hochschulforschung, Frauenforschung 16
17 Literatur: BAUMERT, JÜRGEN (2002) Lesen muss sein. Interview in: Das Magazin. Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, 13. Jahrgang Heft 1 DEBBING, CÄCILIA /INGENFELD, MARITA (1999) Die Mädchen sind der zentrale Ort, von dem die Mädchenarbeit ausgeht! In: Forum Jugendhilfe Heft 3, S DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM (Hrsg.) (2003) Pisa Ein differenzierter Blick auf die Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Leske + Budrich, Opladen FAULSTICH-WIELAND, HANNELORE/ HORSTKEMPER, MARIANNE (1995)»Trennt uns bitte, bitte, nicht! Koedukation aus Mädchen- und Jungensicht.«Opladen GILDEMEISTER, REGINE (1992) Die soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit. In: Ostner, Ilona/Lichtblau: Feministische Vernunftkritik, Frankfurt/M HÄUSSLER, PETER/HOFFMANN, LORE (1995) Physikunterricht an den Interessen von Mädchen und Jungen orientiert, In: Unterrichtswissenschaft, 23. Jahrgang, Heft 2, S KESSELS, UURSULA (2002) Undoing Gender in der Schule. Eine em - pi rische Studie über Koedukation und Geschlechtsidentität im Physikunterricht. Weinheim München KRON-TRAUDT, ULRIKE (1998) Geschlechtergetrennter Unterricht der Jahrgänge 9 und 10 in Physik und Chemie, Abschlußbericht, Paderborn OECD (2001) Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der Internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000 MACCOBY, ELEANOR (1990) Gender and Relationships. A Developmental Account, In: American Psychologist, Vol 45, No. 4, S METZ-GÖCKEL, SIGRID (1999) Koedukation nicht um jeden Preis. Eine Kritik aus internationaler Perspektive. In: BEHM, BRITTA / HEINRICHS, GESA / TIEDEMANN, HOLGER (Hrsg.): Das Geschlecht der Bildung Die Bildung der Geschlechter. Opladen METZ-GÖCKEL, SIGRID (2002) Die Jungen sind zum Problemgeschlecht geworden. Kompetenzdefizite von Jungen und Mädchen und die kulturelle Stabilisierung von Geschlechterdifferenzen im deutschen Schulsystem. In: zweiwochendienst Berlin Juni METZ-GÖCKEL, SIGRID (2002) Die Karriere des Gender Mainstreaming in Politik und Wissenschaft Etikettenschwindel oder neuer Schritt im Geschlechterund Generationenverhältnis? In: Diskurs, Heft 3 METZ-GÖCKEL, SIGRID (2003) Exzellenz und Elite im amerikanischen Hochschulsystem. Portrait eines Women s College. Opladen MEYER, DORIT / SEIDENSPINNER, GERLINDE (1999) Mädchenarbeit. Plädoyer für einen Paradigmenwechsel. In: Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe: Einheit der Jugend hilfe 50 Jahre Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe. S TEUBNER, ULRIKE (1997) Erfolg unter wechselnden Vorzeichen einige Anmerkungen zur Geschich te der Frauencolleges der USA. In: METZ-GÖCKEL, SIGRID/STECK, FELIZITAS (Hrsg.): Frauenuniversitäten. Initiativen und Reformprojekte im internationalen Vergleich, Opladen THORNE, BARRIE (1993) Gender Play. Girls and Boys in School, New Brunswick 1993 SCHRÜNDER-LENZEN, AGI (1995) Weibliches Selbstkonzept und Computerkultur. Weinheim SCHULZ-ZANDER, RENATE (2002) Geschlecht und neue Medien im Bildungsbereich. Schule Empirische Befunde zur Computernutzung, zu Interesse, Selbstkonzept, Interaktion und Fördermaßnahmen. In: KAMPSHOFF, MARITA/LUMER, BEATRIX (Hg.): Chancengleichheit im Bildungswesen. Opladen Anmerkungen: 1 Zentrale Begriffe in dem zitierten Aufsatz beziehen sich auf den reflexiven Hintergrund und gesellschaftlichen Fluchtpunkt der Mädchenarbeit, als da sind Individualisierung, die auch die Mädchen erreicht hat, Medialisierung und Kommunikationskultur. 2 Die Ergebnisse unterscheiden sich hier deutlich von denen der TIMSS-Studie, die in den Naturwissenschaften bei Schülern der 8. Klasse sehr viel größere geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt hat und die Jungen fast durchweg die besseren Resultate aufwiesen. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass in der PISA-Studie den Biowissenschaften ein größeres Gewicht zu ge wiesen wurde und naturwissenschaftliche Prozesse und die An - wendung von Wissen stärker be tont (PISA: 149). 3 Schründer-Lenzen teilt Mädchen und Jungen in sieben Kategorien (Freaks, Befürworter, Pragmatiker, Ambivalente, Desinteressierte, Kritiker, Gegner) ein, auf die sich die Geschlechter unterschiedlich verteilen, sie vermeidet damit die schlichten Geschlechterpolarisierungen und Verallgemeinerungen (ebda.: 200). 17
18 Dr. Barbara Stauber M Ä D C H E N U N D P Ä D A G O G I N N E N ( U N ) P R O D U K T I V E V E R B I N D U N G E N Eine erste Vorbemerkung liegt mir am Herzen: das Thema für einen Vortrag auf einer LAG-Tagung so zu vergeben, ist beachtlich; denn die Einsicht in ein Problem bedeutet immer, sich einer Auseinandersetzung zu stellen, sich zu öffnen für das, was unabsehbarer Weise durch diese Auseinandersetzung auf eine zukommt. Und hier ist es die Einsicht, dass wir ein Problem haben, wo wir es als jüngere Frauen nicht vermutet hätten: dass diejenigen, die sich als junge Frauen explizit für Mädchenarbeit, für Mädchenprojekte interessieren, sei als Teilnehmerinnen, sei als junge Kolleginnen im Team, ganz anders drauf sind, ganz anders reden und handeln, vor allem aber völlig anders über das Geschlechterverhältnis denken und sich in ihm verhalten. Eine nachdenkliche und problematisierende Haltung ist aber auch ein Fortschritt gegenüber dem»juhu wir sind alle anders«, also einem problemverleugnenden Feiern der Unterschiedlichkeit, mit dem, so Ilse Lenz schon 1992, vor allem Hierarchien (und auch zwischen jung und alt gibt es Hierarchien), aber auch Verletzungen und Enttäuschungen vertuscht werden. Es hat sich gezeigt bzw. es zeigt sich im Alltag immer wieder neu: so einfach ist es nicht. Die erste Position (die der Gleichheit) ist ebenso falsch wie die zweite (das Lob der Differenz). Nicht umsonst nimmt sich die mädchenpolitische Fachdiskussion auf Veranstaltungen wie dieser dem Generationenthema in der Mädchenarbeit an. Dies zu erkennen und zu benennen als Irritation, als Problem, möglicherweise sogar als Hemmschuh in der Auseinandersetzung ist auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber der Meinung, die in Restbeständen durchaus noch vorhanden ist: dass wir als Feministinnen an einem Strang ziehen und also irgendwie»gleich«seien. Mit dieser Anerkennung der Problemeinsicht, oder besser: der Einsicht darin, dass hier etwas schwierig ist, will ich starten. Und ich will gleich benennen, wo ich ankommen will: bei einem Ansatz von Generationenlernen zwischen Frauen unterschiedlichen Alters, der das (Lern-)potential, das verschiedene Generationen einander bieten können, ausschöpft, anstatt es zu zerreiben. Ich will ankommen bei Haltungen, die für ein solches Generationenlernen nötig sind, und auf dem Wege dahin vielleicht auch ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie ein solches Generationenlernen praktisch aussehen könnte. 18
19 In sechs Punkten will ich das Generationenthema in der Mädchenarbeit umreißen: Mädchenarbeit als Generationenprojekt der Gründerinnen ein Ausgangspunkt, der die Brisanz des Themas Generationenbeziehungen für die Mädchenarbeit ausmacht. Hier ist daran zu erinnern, dass die neue Mädchenarbeit entwickelt wurde von einer Gründerinnengeneration, das sind grob gesagt Frauen der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1965, die ab den späten siebziger Jahren aus dem Kontext der Frauenbewegung heraus zur neuen oder feministischen Mädchenarbeit aufgebrochen sind der Erkenntnis aus der Praxis folgend, dass sich die Verheißungen der Koedukation für die Mädchen nicht eingelöst hatten, und gerade in der Jugendarbeit den Jugendhäusern genauso wie der verbandlichen Jugendarbeit Mädchen eher marginalisiert wurden. Der Vorwurf damals: Jugendarbeit ist Jungenarbeit, hier nicht als ge - schlechterreflexive Jungenarbeit verstanden, sondern als eine Ju - gend arbeit, die aufgrund ihrer Räumlichkeiten, Ar beits formen und Zugänge nur Jungen anspricht. Es ging also da rum, eigene Räume für Mädchen zu schaffen, für eigene Erfahrungen, und hierfür eigene pädagogische Zugänge zu entwickeln. Dies alles geschah, wie Susanne Maurer sehr schön rekonstruiert hat, in der Verschränkung von professioneller (sozial-)pädagogischer Praxis, po litischer Praxis in der Neuen Frauenbewegung, aber eben auch persönlicher Praxis im privaten Bereich, die zunehmend als politisch gewertet wurde. Dieser gesamte Kontext der Entstehung von Deutungsmustern in dem, was Giddens dann Lebenspolitiken genannt hat, macht die Mädchenarbeit zu einem Generationen- Projekt der Gründerinnen (hierzu genauer: Maurer 2001: 312f.); zu diesem Kontext gehören, und das ist hier wichtig, auch die Generationenbeziehungen, in der diese Päda - goginnen zur Generation ihrer Eltern standen und die un ab - hängig vom Einzelfall durch Ab - leh nung dessen, was diese Elterngeneration erreicht hatte, charak terisiert waren. Die Mädchenarbeit ist somit ein Beispiel für die (Zitat Böhnisch)»reflexive Rückbindung der Sozialpädagogik an die Energie sozialer Bewegungen«(Böhnisch 1996: 109). Der Kampf nach außen hatte seine Entsprechung in der Solidarität nach innen, und auf der Ebene der pädagogischen Beziehung konnte gerade durch die gemeinsame Opposition nach außen vieles, was an realen Differenzen zwischen Mädchen und Pädagoginnen vorhanden war, verdeckt werden. Veränderte Generationenbeziehungen und modernisiertes Geschlechterverhältnis Dieses polare und bereits historisch anmutende Bild weibliche Solidarität nach innen (im Binnenraum der pädagogischen Beziehung, in den geschützten Räumen) versus Kampf gegen patriarchale Strukturen im Außenraum hat sich real und in der Wahrnehmung durch die Beteiligten differenziert. Hierzu gehören erstens die Veränderung der Generationenbeziehungen in der späten Moderne, und zweitens das modernisierte Geschlechterverhältnis. Zu ersterem: die Übergänge von der Jugend ins Erwachsensein werden länger, verflüssigen sich, verlieren ihre Konturen: Jugend verzahnt sich in den verschiedenen Lebensthemen unterschiedlich mit Erwachsensein, es entstehen immer deutlicher Gleichzeitigkeiten von (ökonomischer, emotionaler etc.) Abhängigkeit und selbständiger Gestaltung des eigenen Lebens (Teil-Autonomien), es sind Planungen notwendig, für die Erwachsene als kompetente RatgeberInnen immer weniger zur Verfügung stehen bzw. nützlich sind. Also: die Lebenslage der jüngeren Generation hat sich entscheidend verändert. Gleichzeitig aber haben sich auch Lebenslage und Lebensgefühl der Erwachsenengeneration verändert: die heutigen fourty-somethings haben durchaus noch, zumindest in höheren Bildungsschichten, das Gefühl der verlängerten Jugend gestreift, für sie ist immer noch, verglichen mit älteren Generationen, sehr vieles in Fluss, was berufliche Karrieren und persönliche Lebensplanung anbelangt, sie fühlen sich also selbst noch viel mehr in Bewegung (»im Übergang«) als so richtig angekommen. Letzteres, das Lebensgefühl des»angekommen-seins«wird mit den normalbiografischen Entwürfen (weiblicher und männlicher Normallebenslauf) aussterben. In diesen strukturellen Verwerfungen der Generationenbeziehungen aufgrund dessen, was wir in unseren Projekten die Yoyo-isierung von Übergängen genannt haben (Walther, Stauber et al. 2002) verschieben sich Nähe und Distanzbedarf der Beteiligten ineinander, neue Auseinandersetzungsformen sind gefragt, neue Aushandlungen und Arrangements statt schlichter Abgrenzung, weil z.b der längere Verbleib im Elternhaus sonst nicht möglich wäre. Neben diesen veränderten Generationenbeziehungen wichtig ist zweitens das modernisierte Ge - schlechterverhältnis, das heißt ein Geschlechterverhältnis, das im Hinblick auf die rechtliche Gleichstellung, vor allem aber auf die gesell- 19
20 schaftliche Sichtbarkeit und Positionierung von Frauen auf einige Errungenschaften zurückblicken kann, das aber weiterhin von hierarchischen Strukturen durchzogen ist, die umso unsichtbarer bleiben, je stärker das offizielle Bild Gleichheit suggeriert (Knapp 2001: 69). Zum Beispiel kann gezeigt werden, wie das System beruflicher Bildung immer noch einen geschlechtersegmentierten Zuschnitt hat, mit einem vollzeitschulischen Bereich, der ganz überwiegend (zu 77 %) von Mädchen frequentiert wird, der jedoch im Hinblick auf Ausbildungsdauer, -vergütung und späterer»amortisierung«der Bildungsinvestition eindeutig dem Dualen System der Berufsausbildung unterlegen ist, zu dem Jungen immer noch (mit knapp 60 %) den besseren Zugang haben (Zahlen nach Datenreport 2002) (vgl. Krüger 2001). Unter diesen gesellschaftlichen Vorzeichen hat sich auch die Mädchenarbeit verändert, hat fachliche Standards gesetzt, hat eigene Strukturen ausgebildet (LAG s, BAG) und befindet sich inzwischen in einem Zu stand von prekärer Etablierung, Normalisierung und immer wieder erforderlicher Legitimierung (Maurer 2001): etabliert in verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe, hier je - doch zumeist mit prekärem Status, normalisiert im positiven wie im negativen Sinne, aus der Perspektive der Mädchen wie aus der Fachwelt, und in diesem Zusammenhang oft auch wieder dethematisiert als vermeintlich erreichter Standard, dem nun keine weitere Beachtung mehr zu schenken ist; und immer wieder unter dem Zwang, sich als sinnhaft zu legitimieren. Die Mädchenarbeit (das Generationenprojekt der Gründerinnen) blieb also immer ein erkämpftes Terrain, das bis heute, darauf weisen die Ex - pertisen zum aktuellen 11. Jugendbericht hin, nicht sicher ist, das im - mer wieder verteidigt werden muss trotz dem Meilenstein des 6. Ju - gendberichts von 1984, trotz einem zunehmenden Verständnis von Ge schlechterpädagogik als Quer - schnitts aufgabe, trotz dem inzwischen 12 Jahre alten KJHG, das in seinem berühmten 9 Abs. 3 darauf hinweist,»die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern«, was ja eigentlich bedeuten müsste: die Förderung aller Angebote und Maßnahmen aller Träger der Ju - gendhilfe generell an eine adäquate Erfüllung des 9 Abs. 3 zu binden, was nachweislich nicht der Fall ist. Verständigungsprobleme In dieser Mädchenarbeit sind unter den Vorzeichen von veränderten Generationenbeziehungen und mo - dernisierten Geschlechterverhältnissen neue Generationen angetreten, und zwar auf beiden Seiten dieser pädagogischen Beziehung: also nicht nur auf der Seite der Mädchen, sondern auch auf der Seite der Pädagoginnen. Verstärkt werden in der einschlägigen mädchenpolitischen Fachdiskussion Generationenthemen als Verständigungsprobleme wahrgenommen, die sich folgendermaßen umreißen lassen: der erkämpfte Raum der Mädchenarbeit ist für die jüngeren Generationen, für Pädagoginnen wie Klientinnen, etwas Selbstverständliches geworden, es fehlt an Motivation, um diesen Raum weiterhin zu kämpfen, zumal die Themen sich verändert haben, mit denen sich Mädchen und junge Frauen heute auseinandersetzen müssen, gleichzeitig ist die Verständigung zwischen Mädchen und Pädagoginnen auf vielen Ebenen, namentlich auf denen des Mädchen- und Frauenbildes und der Lebensentwürfe schwieriger ge-worden. In Klammern: Vieles in dieser Diskussion ist fraglich, namentlich der Kurzschluss auf die Folgerung, aufgrund all dessen sei die Mädchenarbeit nicht mehr zeitgemäß. Meine Gegenthese hierzu wäre: gerade die Auseinandersetzung mit schwierigen Themen wie dem 20
21 Generationenthema braucht einen sicheren Raum. Ich will diese Verständigungsprobleme hier zugespitzt skizzieren, indem ich eine konstruierte Gegenüberstellung vornehme zwischen»pädagoginnen aus der Gründerinnen- Ära«und einer neuen Generation von Mädchen, unter die ich hier auch junge Kolleginnen subsumieren würde, die in altersgemischten Teams den Mädchen in vielen Punk ten näher stehen können als ihren älteren Kolleginnen. Diese Gegenüberstellung will ich vornehmen in dem Bewußtsein, dass es gerade in Generationenbeziehungen darauf ankommt, diese Verallgemeinerungen auch wieder aufzulösen, also genauer hinzusehen und sowohl Mädchen und junge Frauen als auch die eigene Generation in der Differenz, in der Vielfalt wahrzunehmen. Klar ist dabei: Weder gibt es die Mädchen ihre Lebenslagen unterscheiden sich nach sozialer und Bildungsschicht, nach ethnischer Zugehörigkeit und freilich nach Alter beträchtlich, noch gibt es die Pädagoginnen auch sie sind eine heterogene Gruppe. Doch gleichzeitig gibt es in dieser Heterogenität zweifellos Generationenthemen, Dinge also, die uns innerhalb von Generationen und zwischen Generationen beschäftigen. Deshalb die folgende Zuspitzung, die, wie gesagt, konstruiert ist. In dieser Zuspitzung begegnen Pädagoginnen (die älteren also) einer neuen Generation von Mädchen und jungen Frauen, die sich selbstbewusst für ihre Belange einsetzen (»wir nehmen uns, was wir wollen«), dabei das, was sie bereits vorfinden zum Beispiel den Mädchenraum mit größter Selbstverständlichkeit nutzen und auch wieder infrage stellen, dies alles mit einer weiblichen Selbstbehauptung, die frau sich in den siebziger, achtziger Jahren gewünscht hätte, als das eher zurückhaltende Mädchenbild dominierte, gegen das so lange an - gekämpft wurde. Im neuen Mädchenbild sind Mädchen ganz stark, ganz frech, ganz selbstbewusst, und gleichzeitig sind die realen Mädchen mit durchaus traditionellen Widersprüchen konfrontiert: die Stichworte: erschwerter Zugang zu beruflicher Qualifizierung trotz besserer schulischer Performanz von Mädchen; traditionelle innerfamiliäre Arbeitsteilungen trotz postulierter Neuarrangements der Geschlechterbeziehungen, Alleinzuständigkeit für die Vereinbarkeitsthematik als Lebensthema von Mädchen, nicht jedoch von Jungen (13. Shell- Jugendstudie 2000). Diese Mädchengeneration muss also trotz der genannten und noch weiterer Widersprüche ihre Übergänge zum Frau-Werden unter den Vorzeichen erreichter Gleichstellung bewerkstelligen, und hat entsprechende Bearbeitungsstrategien hierfür gefunden, die auffälligste dabei: die der Körperstrategien was sich im»straßenbild des Mäd chens«in körperbetonten Outfits und einer entsprechenden Körper- und Bewegungskultur zeigt, die zu Hauptthemen geworden sind (Fuhrmann 2003). Auf der anderen Seite die Pädagoginnen, als eine Generation, die sich sowohl politisch als auch im professionellen Bereich als auch privat ihre Position im Geschlechterverhältnis errungen, erkämpft, erarbeitet hat, um die Ideologie der erreichten Gleichstellung weiß und dem mo - dernisierten Geschlechterverhältnis mit Skepsis begegnet; sie wird, weil es sonst niemand tut, immer wieder auf das Erreichte als Ergebnis harter Auseinandersetzungen hinweisen, auf vielen Ebenen also mit dem Problem der fehlenden Anerkennung umgehen, dabei auch die Notwendigkeit eines aktiven Sich-Einsetzens für Mädchen und Frauen immer wieder erfahren. Das sind ihre Haupt themen.gleichzeitig hat sie trotz und manchmal entgegen ihres emanzipatorischen Anspruchs auch bereits ihre Kompromisse ge - macht, in privaten Beziehungen, auf ihrem professionellen Weg, aber auch unter Frauen (Bürmann/ Micus-Loos 2002), und musste auf allen Ebenen auch Enttäuschungen bewältigen (Brückner 1996: 273). Was die Pädagoginnen an den Mäd chen irritiert und Ambivalenzen verursacht (und hiermit greife ich auf eigene Forschungserfahrungen in diesem Bereich zurück): dass Mädchen nicht davor zurückschrecken, in ihrer Selbstinszenierung auch kräftige Anleihen bei den herrschenden Weiblichkeitsstereotypen zu machen, und darüber hinaus auch aggressiv und laut zu werden (Gewalttätigkeit inbegriffen); dass diese starke Selbstinszenierung urplötzlich wegbrechen kann, z.b. im Verhalten in Männerbeziehungen; dass Mädchen dabei, auch in höchst komplizierten Lebenslagen, auf keinen Fall Trägerinnen eines Problems sein wollen, schon gar nicht als Mädchen; vielmehr äußerst sensibel auf alle Formen von Verallgemeinerung und Stigmatisierung reagieren, und jede Problembeschreibung sehr schnell als Problemzuschreibung auffassen. 21
22 Was die Mädchen an den Pädagoginnen irritiert und ihrerseits Ambivalenzen verursacht (auch hier exemplarisch drei Punkte): Dass diese permanent auf ein Problem hinauswollen, egal, ob es sich um die neue Diät, den neuen Freund, die neue Bewerbung, den Mädchenraum handelt. Aus unserem Projekt Yoyo: Zitat Mona:«Man muss nur mal einen schlechten Tag haben, dann fragen gleich alle, ob ich ein Problem habe«, wobei zu ihrer Geschichte gehört, dass sie in jüngster Zeit vielfältige Therapieerfahrungen gemacht hat und auf solche Nachfragen sehr empfindlich reagiert. Dass Pädagoginnen permanent auf Gemeinschaft insistieren: Zitat Dani:»Vor allem am An - fang hab ich schon den Eindruck gehabt, das wird einem so richtig eingetrichtert, das mit dem Zu - sammenhalt«(dani), wobei zu ihrer Geschichte gehört, dass sie diese Gemeinschaft später sehr geschätzt hat. Und: Dass Pädagoginnen immer von»den Mädchen«oder»der Gruppe«sprechen, und nicht verstehen wollen, dass Zitat Jelena:»ich halt echt auch anders bin als die anderen«. Diskrepanzen Um nun nicht bei den Irritationen stehen zu bleiben, ist zu fragen, wie trotz der ambivalenten Gefühle eine tragfähige pädagogische Beziehung entstehen kann. Diese Frage will ich für einen Moment von der Beziehungsebene wieder auf die Ebene der jeweiligen Frauengeneration bringen, und mit Claudia Born und Helga Krüger fragen, wie jeweils mit der Diskrepanz zwischen Ge - schlech ternorm und Geschlechterrealität umgegangen wird, was gerade unter den Vorzeichen des mo - dernisierten Geschlechterverhältnisses besonders wichtig er scheint, unter denen solche Diskrepanzen immer weniger thematisierbar sind. Ich will davon ausgehen, dass beide Generationen, die Mädchen- wie die Pädagoginnengeneration, in der Diskrepanz zwischen Geschlechternorm und Geschlechterrealität leben; und dies auf unterschiedliche Weise: die Mädchen leben in der Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung und Selbstanspruch als eigenständige junge Frau und den be - grenzten Möglichkeiten der Realisierung dieses Anspruchs (zum Beispiel machen sie in einem der von uns evaluierten Projekte ganz deutlich die Erfahrung, dass ihnen als jungen nicht-deutschen Frauen mit Hauptschulabschluß nur noch sehr wenige Ausbildungsberufe offenstehen,»die typischen Mädelssachen halt, Friseurin, Verkäuferin, auf die ich keine Lust hab«(jelena 21). Die Pädagoginnen leben in der Diskrepanz zwischen ihren Kämpfen und der gesellschaftlichen Realität, die ihnen unter dem Vorzeichen von erreichter Gleichstellung nach wie vor und gerade in der Mädchenarbeit, immer wieder Steine in den Weg legt. Wichtig ist hier festzuhalten: diese Diskrepanzen werden bewusst oder unbewusst auch in der Interaktion zwischen den Frauen-Generationen bearbeitet. Zu fragen ist also: wie tauchen die Diskrepanzen, die die Pädagoginnen zwischen Geschlechternorm und Geschlechterrealität erleben, in ihrer pädagogischen Beziehung zu den Mädchen wieder auf? In welchen biographischen Konstrukten werden sie verarbeitet? Werden Kompromisse, Niederlagen und Enttäuschungen geglättet, um die eigene Geschlechternorm die der engagierten Frau, die mit ihrem Einsatz auch etwas erreicht aufrechtzuerhalten? Und wenn man mit Mollenhauer (1983) berücksichtigt, dass die Rolle, die die Erwachsenengeneration in der pädagogischen Beziehung spielt, sich nicht nur nach dem richtet, was sie intendiert, sondern vor allem nach dem, was sie präsentiert- dann ist davon auszugehen, dass in der Interaktion zwischen Pädagoginnen und Mädchen, bzw. jüngeren Kolleginnen, Pädagoginnen immer noch eine kämpferische Geschlechternorm präsentieren, was die Beziehungen zum anderen Geschlecht anbelangt, eine solidarische, was Frauenzusammenhänge anbelangt, und eine problemorientierte, was die Bearbeitung der Mädchenthemen anbelangt. Die Gefahr dabei ist, dass hierbei Übertragungen stattfinden, und dass in dieser Botschaft latent der Vorwurf an die jüngere Generation mitschwingt, selbst nicht kämpferisch genug zu sein, dem Mythos der Gleichberechtigung aufzusitzen, Männern und der patriarchalen Gesellschaft gegenüber nicht kritisch genug zu sein. Letztlich an dieser Ideologie der erreichten Gleichstellung mitzuwirken. Und: die Errungenschaften der Älteren nicht anerkennend zu beerben, sondern als selbstverständlich hinzunehmen. Die Frage ist, wie mit den Diskre- 22
23 panzen zwischen Geschlechternorm und Geschlechterrealität produktiv umgegangen werden kann. Die un - produktivste Version wäre die: Dass beide auf ihre Weise die erlebte Realität fortgesetzt mit der Norm kaschieren und damit füreinander unzugänglich werden. Ein produktiverer Umgang mit diesen Diskrepanzen hängt meines Erachtens von der Frage ab, ob genügend Raum existiert, soviel gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln, dass es möglich wird, die jeweiligen Diskrepanzen offenzulegen: Was für die Jüngeren hieße: sich auch in ihrer bedürftigen Seite zeigen zu können, sich also nicht entscheiden zu müssen zwischen einem immer falschen»entwederoder«, z.b. entweder ganz tough oder ganz schwach zu sein, sondern die vielfältigen Nuancen, Mi - schungs verhältnisse und Gleichzeitigkeiten aus Unabhängigkeit und Angewiesenheit, Schwäche und Stärke, leben und auch zeigen zu können, um dann auch entsprechende Hilfs- und Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen zu können. Und was für die Pädagoginnen hieße: sich in den Zwiespälten zeigen zu können, und auch in den Kompromissen, die sie auf ihrem Weg machen mussten, z.b. in der Heterogenität von Frauenzusammenhängen, in real erlebten Differenzen, Konkurrenzen, Enttäuschungen. Umgang mit Ambivalenzen Was sind also die Konsequenzen für die (Pädagoginnen in der) Mädchenarbeit? Ich will sie abschließend beschreiben als Skizze eines Generationenlernens, das den Umgang mit Generationenambivalenz impliziert. Vorab ist zu klären, was ich unter Generationenambivalenz verstehe: Dieser Begriff wurde von der ForscherInnengruppe um Kurt Lüscher (Uni Konstanz) als Ausgangshypothese für ihre zahlreichen Untersuchungen, allerdings zu familiären Generationenbeziehungen, entwickelt. Diese Hypothese besagt Generationenbeziehungen erfordern den Umgang mit Ambivalenz, mehr noch: Generationenbeziehungen implizieren und generieren Ambivalenz das ist also eines ihrer Charakteristika, und das ist auch der Auftrag, der mit ihnen verbunden ist: mit ebendiesen Ambivalenzen umzugehen. Wobei sich Ambivalenz vor allem dadurch auszeichnet, dass die Widersprüchlichkeiten, die hier in Gefühlen und in konkreten Handlungsbedingungen existieren, letztlich nie völlig aufzulösen sind, dass also lebenspraktisch mit Generationenambivalenz umgegangen werden muss. Was also bedeutet Umgang mit Generationenambivalenz in der Mädchenarbeit? Eine Skizze bestehend aus fünf Punkten: Hierzu gehört erstens der Umgang mit der Ambivalenz, die sich aus der Verschiebung von Le - bensthemen ergibt, die Mädchen heute an erster Stelle bewegen, und das sind zu meist nicht Geschlechterthemen. Dies bedeutet: Themenverschiebungen im Kontext der neuen Anforderungen an Mädchen-Sein heute zu sehen und zuzulassen. Dies schließt ein: die zuschreibende Wirkung der Kategorie Geschlecht auf Mädchen zu reflektieren, die zum Beispiel in einem Motto wie»mädchen stärken«steckt. Hier ist der Gedanke von Carol Hagemann-White wichtig, die auf die nahezu unvermeidliche Übertragung von Wünschen und Hoffnungen hingewiesen hat, die von einer (Frauen-) Generation auf die nächste stattfindet:»...eine legitime Hoffnung, die zugleich notwendig enttäuscht wird, da die jüngere Generation immer die eigenen Probleme in Angriff nimmt und nicht die der vorigen Generation, oder anders gesagt, mit der Durchsetzung besserer Voraussetzungen zur Problemlösung ändern sich nicht nur die Optionen, sondern auch die Probleme selbst«(hagemann- White 1998: 33). Hierzu gehört zweitens der Um - gang mit der Ambivalenz, die sich aus der Widersprüchlichkeit der Bewältigungsstrategien von Mädchen ergibt. So ist auch der Rekurs auf das Bild des starken Mädchens keineswegs in sich konsistent. Er kann auch bewirken, so eine Erfahrung des Mädchengesundheitsladen Stuttgart, dass keine Fragen mehr gestellt werden, weil ein kompetentes Mädchen Bescheid weiß, obwohl gerade in dem Bereich, in dem dieses Projekt Körperlichkeit, Sexualität, Verhütung arbeitet, sehr viele Fragen offen sind. Die Herausforderung besteht darin, auch hier beides zu erkennen: die Subjektleistung, das Handlungspotential genauso wie die eben auch widersprüchliche Antwort auf widersprüchliche Anforderungen; d.h: Bewältigungsstrategien zu dechiffrieren, ohne sie zu reduzieren. Am Beispiel der Selbstinszenierungen von Mädchen und jungen Frauen als»stark und schön«: genügend analytische Distanz zu entwickeln, um zu erkennen: es gibt eine Lust, sich so zu inszenieren, und es gibt einen Zwang, sich so zu inszenieren. Beide sind untrennbar miteinander verbunden. Die Selbstinszenierungen als starke schöne Mädchen haben eine konfliktver- 23
24 deckende Seite, sie lassen die real existierenden Konflikte hinter der glatten Fassade verschwinden, und gleichzeitig sind sie aktives Bewältigungshandeln im Hinblick auf die Widersprüche des Erwachsenwerdens. Hier ist neben dem systematischen Blickwechsel in der Analyse, der beides erkennt, und die Kritik am Verdecken gleichberechtigt neben die Anerkennung der Leistung stellt, dann auch ein ganz bestimmter pädagogischer Zugang wichtig, der den Mädchen die Lust an der Inszenierung nicht nimmt, aber den Raum öffnet für die Thematisierung der Zwänge, des Stresses, der mit der modernen Mädchenrolle verbunden ist. Denn heute geht es ja darum, allround kompetent zu sein und immer gut dabei auszusehen. Hierzu gehört drittens der Umgang mit der Ambivalenz, die sich aus einem veränderten Verständnis von Eigenständigkeit ergibt. So steckt zum Beispiel im Abbruch einer Ausbildungsstelle oder im frühen Wunsch nach einem Kind ein Ge - staltungsanspruch, der zunächst einmal ernst genommen werden muss wo zunächst also dafür ge - sorgt werden muss, mit Mädchen im Gespräch zu bleiben, was diese grundsätzliche Anerkennung von eigenständigen Wegen voraussetzt. Zum Umgang mit Generationenambivalenz gehört viertens, das wurde bereits deutlich, auch die Selbstreflexion der Pädagogin auf eigene biographische Konstruktionen, auf die Konstruktion fiktiver Wir s (vgl. Bude 2000), auf eigene Enttäuschungserfahrungen, mit Frauen, mit Männern. Diesbezüglich fragte Carol Hagemann-White in einer Tübinger Diskussion: warum reden wir viel lieber über die»zielgruppe«als über unser eigenes erwachsenes Verhalten? Die Grundanforderung an PädagogInnen ist hier, sensibel und selbstreflexiv die eigenen Konstruktionen in Augenschein zu nehmen, und sich sozusagen als permanent mitlaufende Ebene der eigenen Biografie zu vergewissern. Und fünftens gehört hierzu, auch die Grenzen der Generationenverständigung wahrzunehmen: Am Beispiel Stuttgarter Mädchengesundheitsladen: das Team sucht als Ersatz für eine scheidende Gründerin explizit eine junge Frau, weil es erkannt hat, dass jüngere Frauen, z. B. Praktikantinnen, in den Themen, um die es in diesem sexualpädagogischen Beratungsangebot für Mädchen geht, andere Zugänge zu den Mädchen haben. Das heißt: hier gibt es ein klares Erkennen von Verständigungsgrenzen zwischen den Generationen. Anstatt sich an diesen Grenzen abzuarbeiten, wird der alternative Weg beschritten und eine junge Kollegin gesucht. Zusammengefasst Generationenbezogene Mädchenarbeit ist die Arbeit am und mit dem Widerspruch (Bitzan/Daigler 2001: 95ff.): An den eigenen (ver - deckten) Wi der sprüchen in der Lebensführung der Pädagoginnen genauso wie an den Widersprüchen der Mädchen. Selbst nicht widerspruchsfrei er scheinen wollen, ist wohl der beste Weg, um von Mäd - chen/jungen Frauen als glaubwürdig anerkannt zu werden. Und dies ist die Voraussetzung, um Mädchen das geben zu können, was sie brau - chen: Emotionalen Halt und ein kritisches Gegenüber. Generationenbezogene Mädchenarbeit ist die Arbeit an und mit der Differenz: Sie eröffnet ein Lernfeld, und zwar für beide Generationen. Die Erfahrung von sinnhafter Begegnung in der Generationenbeziehung wirkt sich nicht nur auf den Lebenszusammenhang der Mädchen, sondern auch der Pädagoginnen aus. Vielleicht muss hierfür auf beiden Seiten verstärkt eine fragende Haltung eingenommen werden, mit der anerkannt wird, dass die jeweiligen Generationen Expertinnen für unterschiedliche Themen sind. Fragen als Haltung, die zum Ausdruck bringt: ich weiß nicht (schon) alles, und vor allem auch: ich will mehr wissen. Diese fragende Grundhaltung einzunehmen erfordert in vielen Situationen Mut, vor allem auch Mut zu dem Eingeständnis:»ich verstehe nicht alles, ich brauche Deine Expertinnenschaft«. Das Fragen wieder zu lernen, genau das braucht aktive Generationenarbeit.»Möglicherweise liegt (.) die Aufgabe der Pädagogik darin, (.) die Generationendifferenz bewusst zu inszenieren«(winkler 2002: 62), um ein Lernen an der Differenz möglich zu machen. Das bedeutet: Weiterentwicklung z.b. von biographiebezogenen Ar - beitsformen in der Mädchenarbeit, zum Beispiel durch vermehrtes Einbeziehen von Forschungs-Elementen in die Mädchenarbeit; Interviewprojekte, Filmprojekte, Umfrageprojekte. Das alles sind Generationenprojekte! Wichtig hierbei: sie dürfen keine Einbahnstraßen bleiben: Für die jüngeren Frauen sind hier Projekte zur Aufarbeitung von lokaler Frauengeschichte, z.b. Großmütter-Interviews etc., genauso spannend und wichtig wie für ältere Frauen die Erkundung und damit Anerkennung der Symbolwelten von Mädchen. 24
25 Dies erinnert an Christina Thürmer- Rohrs Verständnis von Dialog, der das Interesse an der Welt und vor allem an der anderen voraussetzt - und systematisch mit der Möglichkeit rechnen muss, dass die andere so ganz anders ist (Thürmer-Rohr 2000). Es geht hier also um ein fragendes Interesse an der anderen Person als Person, der jungen Frau in diesem Fall, mit der die Pädagogin in einen äußerst spannenden und für beide Seiten lehrreichen Dialog treten kann. Und hierfür braucht sie Räume, sozusagen vom Existenzdruck entlastete Räume, einen sicheren Rahmen also für Dialog mit offenem Ausgang. Der Dialog braucht die sichernde Struktur, egal, wie er sich inhaltlich entwickelt. Dann wird Generationenlernen, das Lernen der Generationen voneinander, möglich, das immer auch Ge - schlechter-lernen ist, als Lernen von Variationen auf ein Thema: das Gestalten des Frau-Seins. Und umgekehrt: so wird ein Geschlechterlernen möglich, das immer auch Generationenlernen ist. Dr. Barbara Stauber, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für regionale Innovations- und Sozialforschung, IRIS e.v., Schwerpunkte u.a. geschlechterdifferenzierende Übergangsforschung Literatur: BITZAN, MARIA/DAIGLER, CLAUDIA (2001) Eigensinn und Einmischung. Einführung in Grundlagen und Perspektiven parteilicher Mädchenarbeit. Weinheim und München, Juventa BÖHNISCH, LOTHAR (1996) Pädagogische Soziologie. Eine Einführung. Weinheim und München, Juventa BORN, CLAUDIA / KRÜGER, HELGA (Hrsg.): Individualisierung und Verflechtung. Geschlecht und Generation im deutschen Lebenslaufregime. Weinheim und München, Juventa BRÜCKNER, MARGRIT (1996) Frauen- und Mädchenprojekte. Leske+Budrich, Opladen BUDE, H EINZ (2000) Die biographische Relevanz der Generation, In: KOHLI, MARTIN/SZYD- LIK, MARC (Hrsg.) Generationen in Familie und Gesellschaft. Leske+Budrich, Opladen, S BÜRMANN/MICUS-LOOS (2002) FUHRMANN, MATTHIAS (2003) Aspekte einer körperbezogenen Jugendsoziologie. Jugend Körper Mode, In: MANSEL, JÜRGEN/GRIESE, HARTMUT M./SCHERR, ALBERT (Hrsg.) Theoriedefizite der Jugendforschung. Standortbestimmung und Perspektiven, Weinheim und München, Juventa, S HAGEMANN-WHITE, CAROL (1998) Identität Beruf Geschlecht. In: OECHSLE, MECHTHILD/GEISS- LER, BIRGIT (Hrsg.): Die ungleiche Gleich heit, Leske+Budrich, Opladen KNAPP, GUDRUN-AXELI (2001) Grundlagenkritik und Stille Post. Zur Debatte um einen Bedeutungsverlust der Kategorie»Ge- schlecht«. In: HEINTZ, BETTINA (Hrsg.) Geschlechtersoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 41, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, S KRÜGER, HELGA (2001) Geschlecht, Territorien, Institutionen. Beitrag zu einer Soziologie der Lebenslauf-Relationalität, In: BORN, CLAUDIA/ KRÜGER, HELGA (Hrsg.) Individualisierung und Verflechtung. Geschlecht und Generation im deutschen Lebenslaufregime, Weinheim und München, Juventa, S LENZ, ILSE (1992) Fremdheit / Vertrautheit. Von der Schwierigkeit im Umgang mit kulturellen Un - terschieden. In: KNAPP, GUDRUN-AXELI /MÜLLER, URSULA (Hrsg.): Ein Deutschland zwei Patriarchate? Dokumentation der Jahrestagung der Sektion»Frauenforschung in den Sozialwissenschaften«in Hannover vom , Bielefeld/Hannover Lettke, Frank / Lüscher, Kurt (2002) Generationenambivalenz Ein Beitrag zum Verständnis von Familie heute, In: Soziale Welt 53, Heft 4, S MAURER, SUSANNE (2001) Geschlecht Mädchen, In: SCHRÖER, WOLFGANG / STUCK, NORBERT/WOLFF, MECHTHILD (Hrsg.) Handbuch Kinder- und Jugendhilfe, Weinheim und München, Juventa, S MOLLENHAUER (1983) 13. Shell Jugenstudie (2000) 2 Bände, Leske+Budrich THÜRMER-ROHR, CHRISTINA (2000) Dialogisches Denken, unveröffentlichtes Redemanuskript. WALTHER, ANDREAS /STAUBER, BARBARA et al. (Hrsg.) (2002) Misleading Trajectories Integration Policies for Young Adults in Europe and their Unintended Risks of Social Exclusion. Leske+Budrich, Opladen W INKLER, M ICHAEL (2002) Generationenverhältnisse in der Sozialpädagogik. Einige konzeptionelle Überlegungen, In: SCHWEPPE, CORNELIA (Hrsg.) Generation und Sozialpädagogik, Weinheim und München, Juventa, S
26 Claudia Wallner I H R K Ö N N T U N S N I C H T V E R S T E H E N Z U M G E N E R AT I O N E N V E R H Ä LT N I S U N T E R M Ä D C H E N A R B E I T E R I N N E N Kongressteilnehmerinnen und Infostand auf dem Kongress in Wuppertal Das Generationenverhältnis zwischen den sogenannten»alten«mädchenarbeiterinnen und den»neuen«,»jungen«ist durchaus konflikthaft: Zwei Generationen treffen aufeinander, von denen die jüngere schon von dem profitiert hat, was die ältere erkämpft hat. Die Verbindung von Kämpferinnen und Profiteurinnen im gemeinsamen Einsatz für die Rechte und das Wohlergehen der nun folgenden Mädchengenerationen kann nicht symbiotisch verlaufen, muss Konflikte hervorbringen, die bearbeitet werden müssen, ehe produktiv zusammen gearbeitet werden kann. Der Fokus der Betrachtung soll an dieser Stelle auf die konflikthaften Aspekte des Verhältnisses zweier Generationen von Mädchenarbeiterinnen gerichtet werden. Damit soll nicht behauptet werden, dass das Generationenverhältnis immer und überall oder vorwiegend problematisch ist. Vielmehr geht es um diesen einen ausgewählten Aspekt, weil es in vielen Mädchenarbeitskreisen tatsächlich Konflikte zwischen den Kolleginnen gibt, die aber nicht offen ausgetragen werden und die die gemeinsame Arbeit behindern oder sogar verhindern. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Um die Konfliktlinien deutlicher herausarbeiten zu können, werden die Situation und die Konflikte im Folgenden zugespitzt und simplifiziert. Es ist eine Eigenheit der Menschen, dass sie immer denken, ihre aktuellen Probleme oder Konflikte seien einzigartig und noch nie da gewesen und deshalb besonders schwierig zu bewältigen. So geht es auch seit einigen Jahren vielen Kolleginnen in der Mädchenarbeit. In vielen Mädchenarbeitskreisen herrscht schlechte Stimmung und das große Schweigen, wenn es um das Selbstverständnis zur Mädchenarbeit geht. Der Grund: Die Unterschiede zwischen den Frauen sind sehr groß, und diese Unterschiedlichkeit trägt eine gehörige Portion Konfliktpotential in sich. Da wir aber unter Frauen und insbesondere unter Mädchenarbeiterinnen solidarisch und homogen sind bzw. sein wollen, verfallen wir eher ins große Schweigen als offen in den Konflikt zu gehen. Wie kam es zu dieser Situation? Die»alten Wölfinnen«sind über das jahrelange Kämpfen müde ge worden und würden den Stab gerne übergeben an die jungen Kolleginnen. Insgeheim wird erwartet, dass die jungen Kolleginnen wissbegierig und dankbar das Wissen und die Erfahrungen aufnehmen und die Mädchenarbeit so in die nächste Generation übernehmen. Aber da sitzen junge Frauen, die weder Dankbarkeit verspüren noch bereit sind, einfach das weiterzumachen, was die älteren Kolleginnen entwickelt haben. Im Gegenteil: Einige entfachen Dis - kussionen darüber, ob geschlechtshomogene Settings überhaupt noch zeitgemäß und sinnvoll und von den Mädchen gewünscht sind, ob die Unterstützung von Mädchen nicht eher sys temisch als parteilich ausgerichtet sein müsste, ob nicht auch feministische und/oder sensible Männer Mädchenarbeit machen können, ob Männer nicht auch in den Mädchenarbeitskreis aufgenommen werden können, ob Ar - beits kreise zur Geschlechterpädago- 26
27 gik nicht Mädchenarbeitskreise ablösen sollten und generell eine Zusammenarbeit mit den Kollegen anzustreben sei oder ob Mädchenarbeit nicht insgesamt ein alter Hut ist. Skepsis und Widerstand statt Dankbarkeit und Lerneifer, die daraus folgende Dynamik lässt sich leicht vorstellen. Die einen denken:»was für unpolitische und unreflektierte Frauen! Die sind dem Patriarchat voll auf den Leim gegangen und verstehen überhaupt nicht, dass die Lebenssituation von Mädchen und Frauen immer noch eine deklassierte ist. Aber wenn sie uns nicht glauben wollen, dann werden sie es noch am eigenen Leib erfahren, und dann werden sie sehen, dass wir Recht hatten!«die anderen denken:»seht euch die an, die leben immer noch in den 70er und 80er Jahren. Die sehen gar nicht, dass heute alles anders ist, dass wir inzwischen frei sind, uns für das Leben zu entscheiden, das wir wünschen. Die sind verbissen und männerfeindlich und dogmatisch dazu, Feministinnen eben!«und beide denken:»gut, dass ich nicht bin wie die!«konfliktverschärfend kommt hinzu, dass es in den meisten Fällen beim stillen Denken bleibt und der Konflikt nicht ausgesprochen wird. Die Folge: Gegenseitige Vorurteile entstehen, Schubladen werden gebaut und die Kolleginnen entsprechend wechselseitig einsortiert. Die ge - meinsame Arbeit ist blockiert. Was aber befördert diesen Konflikt? Ist er entstanden, weil Frauen so schlecht streiten können, weil die Unterschiede zwischen Frauen zu groß geworden sind oder weil ihnen die gegenseitige Akzeptanz fehlt? Eher nicht, denn die Ursachen liegen in der Geschichte der Mädchenarbeit, im Generationenverhältnis und im Lauf der Zeit: 1. Der Konflikt ist ein Produkt der Geschichte der Mädchenarbeit Die radikal-feministischen Wurzeln und der kontinuierliche Widerstand von außen haben Mädchenarbeit zu einem geschlossenen System mit hohem Anspruch an gegenseitige Solidarität werden lassen. Wer ständig Angriffen von außen und Ab - wertungen ausgesetzt ist, braucht in den eigenen Reihen Vertrauen und Solidarität. Das fördert eine Affinität dazu, Gegensätze und Kon flikte eher zu verdrängen ein ganz normaler Vorgang. Die zunehmende mädchenspezifische Ausgestaltung von Angeboten der Jugendhilfe führt auch dazu, dass Sozialarbeiterinnen zumeist unter anderem mit Mädchenarbeit beauftragt werden, die dies nicht erstritten haben oder die diesen Auftrag übernehmen müssen, weil er in der Stellenausschreibung steht. Das sind ohne das bewerten zu wollen gänzlich andere Zugänge zur Mädchenarbeit als die derjenigen Mädchenarbeiterinnen, die für jede Stunde Mädchenarbeit gekämpft haben. Auch das ist normal. 2. Junge Frauen machen eigene Erfahrungen Von den Fachhochschulen kommen heute junge Frauen als Sozialpädagoginnen, die Ende der 70er Jahre geboren und die in den 90er Jahren erwachsen wurden. Dreißig Jahre nach Beginn der zweiten deutschen Frauenbewegung sind sie selbstverständlich mit Rechten und Freiheiten aufgewachsen, die erst in den Jahrzehnten vorher erstritten wurden. Aber in den 90ern ist vieles schon Normalität, und welche Generation hätte die Normalität, in der sie aufwächst, je hinterfragt im Sinne von»warum haben wir diese Rechte?«oder»warum haben wir Handy, Computer und Internet?«? Und noch mal: Auch das ist normal. Wenn es also darum geht, Generationenkonflikte unter Mädchenarbeiterinnen zu lösen, dann ist ein erster wesentlicher Schritt die ge - meinsame Erkenntnis: Der Konflikt ist nicht dramatisch, nicht einzigartig und liegt nicht hauptsächlich oder ausschließlich im gemeinsamen Thema der Mädchenarbeit, sondern er ist ganz normal und überall dort zu finden, wo soziale Bewegungen sich in allgemeinen Strukturen wie z. B. der Jugendhilfe festsetzen und wo Generationen aufeinander treffen. 3. So ist Geschichte eben Ein Blick in die Geschichte sozialer Bewegungen zeigt: Einer Generation von KämpferInnen folgt immer eine Generation von ProfiteurInnen. Ein Beispiel:»Eine leise Unruhe hat die Frauenbewegung (...) ergriffen, angesichts der Haltung der jungen Generation, die teils mit unverhohlener Skepsis auf die Errungenschaften der Führerinnen blickt, teils sich abkehrt und erklärt, eigene Wege einschlagen zu wollen. Man erkennt und beklagt diese Eigenwilligkeit und versucht vielfach, die Jugend auf die erprobten Wege zurückzuführen, die die Führerinnen gebahnt haben.«4 Dieses Zitat ist nicht aus einer aktu - ellen Veröffentlichung der Mädchenarbeit, sondern aus einer Studentinnenzeitschrift von Auch damals folgte der Generation der Kämpferinnen der ersten deutschen Frauenbewegung eine Generation junger Frauen nach, die von den erkämpften Rechten selbstverständlich profitierte und sich deshalb doch genauso selbstverständlich nicht vorschreiben lassen wollte, was sie zu denken und wie sie zu leben hätten auch nicht von denen, die ihnen diese Freiheiten ermöglicht hatten. 27
28 Dass wir es also momentan mit einer Generation junger Frauen zu tun haben, die ihre Rechte und Möglichkeiten nutzt und genießt, gehört zum normalen Lauf der Geschichte und kommt als Phänomen auch in anderen Bereichen wie z. B. der Friedens- und der Umweltschutzbewegung vor. D. h., in der Begegnung der Generationen von Mädchenarbeiterinnen geht es nicht nur darum, sich als Individuen zu sehen und zu begegnen, sondern gewahr zu sein, dass alle Frauen auch Teil ihrer Generation sind und dies sehr unterschiedliche Erfahrungen mit sich bringt. Aus dieser Warte noch einmal auf den Generationenkonflikt geschaut wird deutlich, dass sich die Perspektiven verschieben: Es geht nicht darum, dass weise Frauen sich mit naiven herumschlagen müssen oder dass moderne Frauen mit ewig Gestrigen»geschlagen«sind. Der Konflikt liegt begründet in der Einschätzung und Bewertung der gesellschaftspolitischen Situation von Mädchen und Frauen, die wiederum ist nicht unwesentlich ge schuldet den Erfahrungen in den jeweiligen Generationen, die eben sehr unterschiedlich sind: Die Gründerinnen feministischer Mädchenarbeit, geboren in den 50er Jahren, wuchsen mit einem extrem eingeengten Frauenbild auf: Die Frau als Hausfrau und Mutter, Ausbildung für Mädchen wurde als nicht so wichtig erachtet, dafür wurde ihnen eine eigene oder gar lustvolle Sexu alität abgesprochen. Gesetze im Bereich des Arbeits- und Familienrechts kannten keine Gleich be handlung der Geschlechter bzw. verstanden Gleichberechtigung als die Manifestierung unterschiedlicher Geschlechterrollen und -rechte zu Ungunsten von Frauen. Als jun ge Frauen erlebten und gestalteten sie die Studenten- und Frauenbewegung mit und stellten radikale Forderungen nach Freiheit und gleichen Rechten auf. Sie erlebten die Einführung der Pille, den Kampf und das Recht auf Abtreibung und die sexuelle Revolution. Wer in den 80er Jahren aufwuchs, spürte als Mädchen noch an vielen Stellen, Geschlecht zweiter Klasse mit erheblichen Benachteiligungen und Einschränkungen zu sein. Die Rechtslage war deutlich verbessert, die Bildung von Mädchen wurde ernster genommen, doch machten Slogans wie»mädchen können mehr!«im Kontext der Bundesmodellversuche im Bereich gewerblichtechnischer Ausbildungen oder»mädchen klettern nicht auf Bäu - me«(ein Spiel zur Berufsorientierung) deutlich, dass es immer noch eine klare Trennung von Zuschreibungen, Chancen und Verhaltensanforderungen zwischen Mädchen und Jungen gab.»mädchen werden und sind benachteiligt«, das war spätestens seit dem sechsten Jugendbericht der Bundesregierung 1984 gesellschaftlicher Konsens und die Botschaft, mit der die Generation junger Frauen in den 80ern aufwuchs. Mit den Girlies begann in den 90er Jahren ein neues öffentliches Bild von Mädchen und jungen Frauen und ihrem gesellschaftlichen Status. Schön, stark und mutig, selbstbewusst und gebildet kommen sie nun in der öffentlichen Präsentation da - her. Neben allen kritischen Aspekten vermittelt so ein Mädchenbild Mädchen und jungen Frauen doch ein deutlich positiveres Selbstbild als die Benachteiligten- oder Zweiter- Klasse-Bilder früherer Jahrzehnte. Während die sogenannten»alten«, feministischen Mädchenarbeiterinnen unter der Last zu Frauen wurden, als Benachteiligte zu gelten und sich hieraus sicherlich die Kraft, die Entschiedenheit und das Durchhaltevermögen entwickelte, sich gegen diese Zuschreibungen und realen Diskriminierungen zur Wehr zu setzen, sind gerade die jungen Frauen aus dem Mittelstand und dem Bildungsbürgertum mit der Botschaft aufgewachsen, dass Niemand mehr Mädchen und Frauen benachteiligen will und dass sie es auch nicht mehr sind. Gerade aus diesen gesellschaftlichen Gruppen studieren viele Frauen Sozialpädagogik und werden zu den jungen Kolleginnen in Jugendhilfe und Mädchenarbeit. Wenn die Generationen von Mädchenarbeiterinnen also miteinander ins Gespräch kommen wollen, dann geht das nicht darüber, wie wer die aktuelle Situation von Mädchen und Frauen einschätzt. Der Weg der Verständigung geht vielmehr über das offen legen der jeweiligen Er fahrungshintergründe. Notwendig ist die gegenseitige Vermittlung dessen, mit welchen Mädchen- und Frauenbildern und mit welchem Wissen über Erfahrungen über den Status von Mädchen und Frauen die Frauen unterschiedlicher Generationen aufgewachsen sind. Dieser Zugang eröffnet vielfältige Optionen statt gegenseitiger Abwertung: Es kann ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen den»neuen«und den»alten«mädchenarbeiterinnen, denn alle haben ihre Erfahrungen gemacht, die gleich viel wert sind. Vorschnelle Zuschreibungen und Vorurteile können abgebaut werden, weil es darum geht, voneinander zu verstehen zu lernen, warum welche Frau die gesellschaftliche Situation von Mädchen und Frauen und die Mädchenarbeit so sieht, wie sie es tut. Vorschnelles Bewerten kann abgebaut, gegenseitige Aufmerksamkeit gefördert werden: Damit können heimliche Hierarchien von Wissen- 28
29 den und weniger Wissenden abgebaut werden. Gemeinsam kann gelernt werden, dass die Erfahrungen jeder Generation interessant und wichtig sind. Ziel ist, eine Situation gegenseitiger Akzeptanz herzustellen, in der es nicht die weisen Frauen und die Lehrlinge gibt sondern Frauen, die auch auf Grund unterschiedlicher Generationszugehörigkeiten zu unterschiedlichen Vorstellungen über Mädchen und Mädchenarbeit gekommen sind. Die einen landen in der Mädchenarbeit, weil Frauenrechte ihnen ein zentrales Anliegen ihres Lebens sind. Andere, weil sie neugierig sind, wieder andere, weil sie ge - sandt werden von ihren Arbeitgebern. Soll der Stab an die nachfolgende Generation übergeben werden, dann geht das nur über das gegenseitige Akzeptieren und ehrliches Interesse aneinander. Auf dieser Grundlage ist es dann möglich, im Dialog die Situation von Mädchen und Frauen heute zu diskutieren, ebenso wie die Konzepte und Grundsätze parteilicher Mäd chenarbeit: Wenn es um zu - nehmend verdeckte strukturelle Benachteiligungen von Mädchen und Frauen und Privilegien von Jungen und Männern geht, werden die einen mehr beisteuern können, Wenn es um das Lebensgefühl und Zugänge zu Mädchen geht, werden die anderen mehr wissen. ihr Wissen ein weiteres Mal zur Verfügung zu stellen und die Konzepte nicht als unveränderbar zu begreifen. Wenn aus gegenseitigen Vorurteilen und Skepsis Interesse wird, kann gerade das generationsübergreifende Arbeiten Mädchenarbeit zeitgemäß, lebendig und politisch bleiben lassen. Bei den Mädchen, mit denen Mädchenarbeit arbeitet, wird von den Mädchenarbeiterinnen unisono die Vielfältigkeit und Individualität gepriesen. Diese Sichtweise sollte auch für die Unterschiedlichkeit in den eigenen Reihen Standard werden. Claudia Wallner, Lehrbeauftragte der FU Berlin, Referentin für Mädchenarbeit und Mädchenpolitik, Münster Anmerkungen 1 Humbert, Gabriele: Jugend und Frauenbewegung. In: Die Studentin, Heft 5/6 1929, S. 41. Zitiert nach: Weingarten, Susanne/ Wellershoff, Marianne: Die widerspenstigen Töchter. Für eine neue Frauenbewegung. Köln 1999, S. 56 Sollen die jungen Kolleginnen parteiliche Mädchenarbeit weiterführen, dann müssen sie auch Fragen stellen dürfen und eigene Meinungen haben und vertreten, dann müssen sie aber auch die Erfahrungen und das Wissen der älteren Kolleginnen annehmen, dann müssen die älteren Kolleginnen bereit sein, 29
30 Katja Fuchte, Elke Jäger-Klütsch S c h L A u M A C H T S C H U L E Oma: Möchteste noch ne Kartoffel?! Mutter: Nee, danke Oma. Wir sprechen doch gerade über watt Ernstes! Ett Kathrin is doch lesbisch! Oma: Musste nich so eng sehen! Möchtse trotzdem noch ne Kartoffel? So, oder so ähnlich, kann ein Rollenspiel für eine Coming-Out-Situation in der Familie aussehen, wenn wir EhrenamtlerInnen von SchLAu Wuppertal (Schwul-lesbisches Aufklärungsprojekt Wuppertal, eine von vielen landesweit arbeitenden Lokalgruppen von SchLAu NRW) im Einsatz sind. Denn neben den durchaus ernsthaften Gesprächen in unserer Arbeit ist auch eine Portion Spaß dabei wenn wir auftauchen. Unser Team will durch Besuche in Schulklassen (ab Jahrgangsstufe 6), Jugendeinrichtungen und bei Multiplikatorenschulungen Einblicke in schwul-lesbische Lebenswelten geben. Ziel unserer Arbeit ist es der alltäglichen Heteronormativität in unserer Gesellschaft entgegen zu wirken. Deswegen hinterfragen wir bestehende Vorurteile und begegnen Berührungsängsten im Bezug auf lesbische, schwule und andere Lebensweisen teils argumentativ und teils spielerisch. Neben anderen Hilfsmitteln arbeiten wir vor allem mit der»schlauen Kiste«, einem vom Land NRW geförderten Me - thodenkoffer. Das Team von SchLAu Wuppertal ist also bestens ausgerüstet und wurde zudem von einem Diplompsychologen fachdidaktisch geschult. Unser Aufklärungsangebot wird durch die neuen»richtlinien für die Sexualerziehung in Nordrhein- Westfalen«unterstützt. Diese stellen heraus, dass die Aufgaben und Ziele der schulischen Sexualerziehung für alle Schulformen gelten, und die Be hand lung der Inhalte grundsätzlich für alle Schulformen verbindlich ist. Beim Thema»Sexu - elle Orientierung und Identität«sollen die SchülerInnen in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensweisen ihre eigene Sexualität und Identität reflektieren. Ferner sollen die Jugendlichen lernen be - wusst zu ihrem eigenen Lebensentwurf zu stehen. Ein weiteres Ziel ist es die gegenseitige Akzeptanz unter allen Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität zu fördern. Es wird in den Richtlinien ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit mit außer schulischen ExpertInnen empfehlenswert ist, da sie eine konkrete Unterstützung der PädagogInnen bietet. 30
31 Wie wird das SchLAu-Projekt im Schulalltag konkret eingebunden? Wir werden insbesondere in den Unterricht der Fächer Biologie, Deutsch, Erziehungswissenschaften, Religion, Sozialpädagogik, Sozialwissenschaften (...) eingeladen, ge stalten Projekttage, oder Stunden von Mädchen bzw. Jungen-AGs, wie»frauenrunde«oder»männerrunde«. Es sind aber auch andere, individuelle Formen der Zusammenarbeit möglich. Exemplarisch wird im Folgenden veranschaulicht, wie das SchLAu- Projekt im Fach Sozialpädagogik (10. Jahrgangsstufe, Ge samt schule) eingebettet werden könnte. Das Thema der Unterrichtsreihe heißt in diesem Fall»typisch Mädchen typisch Jungen«: 1. Schritt: Herausarbeiten von bestehenden Geschlechtsstereotypen Als»typisch«geltende Eigenschaften von Mädchen und Jungen hinterfragen»schubladendenken«z. B. anhand von Zeitungsausschnitten oder Inhalten von Witzen und Liedern thematisieren Klischees bezüglich Jungen- und Mädchenspielzeug (Auto, Heman,..., Puppe, Barbiepuppe) aufarbeiten Geschlechtsspezifische Erziehung / Entstehung von Geschlechterrollen analysieren Schritt: Von den erarbeiteten Geschlechtsstereotypen abweichendes Rollenverhalten thematisieren Kontakt- und Informationsmöglichkeiten finden Sie unter: SchLAu Wuppertal: schlau@bj-wuppertal.de SchLAu NRW: LesBiSchwule Jugendgruppe Wuppertal e.v.: B.J. Jugendnetzwerk Lambda e.v.: Lesben- und Schwulenverband Deutschland e.v.: Seminartleiterinnen: Katja Fuchte, SchLAu, Wuppertal, Elke Jäger-Klütsch, Else-Lasker-Gesamtschule, Wuppertal Coming-out-Geschichten besprechen, neu erfinden Bewusstsein für Freuden und Schwierigkeiten im Leben lesbischer, schwuler und anders lebender Menschen schaffen Schritt: Besuch des SchLAu-Projektes im Unterricht Sexualpädagogische Spiele Frage- und Antwortrunden Rollenspiele Diskussion über lesbischwules Leben Schritt: Auswertung des Besuches Das SchLAu-Team steht Ihnen bei der Gestaltung eines Unterrichtskonzeptes gerne mit Rat und Tat zur Seite; außerdem arbeiten wir eng mit der B.J. LesBiSchwule Jugendgruppe Wuppertal e.v. zusammen und stellen für interessierte Jugendliche und Erwachsene Kontakte her. 31
32 Karin Kudrup SELBSTVERTEIDIGUNG/SELBSTBEHAUPTUNG DAS KENNT DOCH JEDE! Das Bellzett arbeitet seit 19 Jahren nach dem Wendo-Konzept. Wendo ist ein Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskonzept, das von Frauen für Frauen und Mädchen vor mittlerweile 30 Jahren entwickelt worden ist und mit der konkreten Arbeit mit Mädchen und Frauen weiter gewachsen und ge - reift ist. Wendo ist seit Mitte der 80er fester Bestandteil der feministischen, parteilichen Mädchenarbeit. Es gibt nicht das Wendo-Konzept. Der Ansatz ist sehr lebendig und in seiner Umsetzung individuell ge - prägt. Zur Stärke des Konzeptes tragen sicherlich die Vernetzung, die politisch-feministische Einbettung und die kontinuierliche Wei terent - wicklung des Konzeptes über Jahrzehnte bei. Spätestens seit der Bewilligung des Initiativprogramms»Selbstbehauptung für Mädchen an Schulen«im Land NRW im Jahre 1998 ist Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen in aller Munde. Die Nachfrage nach Selbstbehauptungskursen an Schulen ist seitdem enorm gestiegen, da die Schulen mit dem Landesprogramm die Mög lichkeit haben, die Kurse zu finanzieren. Dieser Bedarf hatte Auswirkungen auf der Anbieterinnenseite: Im Laufe der Jahre gab es neben den Wendo-Trainerinnen immer mehr AnbieterInnen von Selbstverteidigungskursen für Mädchen mit unterschiedlichen Konzepten, be - ruflichen Hintergründen und Qualifizierungen, mal mehr und mal weniger feministisch oder ganz ohne feministischen Hintergrund. Selbstverteidigung/Selbstbehauptung das kennt doch jede! Aber was kennt jede? Ziel des Workshops»Selbstverteidigung/Selbtbehauptung das kennt doch jede!«war für mich, das Wendo-Konzept in der praktischen Umsetzung erfahrbar zu machen, Entwicklungsschritte des Wendo- Konzeptes in den letzten 19 Jahren grob zu skizzieren und die Frage aufzuwerfen, ob Selbstverteidigung/Selbstbehauptung auch heute noch aktuell für Mädchen ist, wie ich die Mädchen erreiche und welche Inhalte ich vermittele. Bei der Vorbereitung auf den Workshop haben mich zentrale Prinzipien aus der praktischen Kursarbeit mit Mädchen geleitet: Im Mittelpunkt steht jedes Mädchen in ihrer ganzen Person Für mich als Trainerin bedeutet das immer wieder die Herausforderung in jeder Gruppe wieder neu mit den Mädchen in Beziehung zu treten, ob jung, ob alt, ob Migrantin oder mit körperlicher Einschränkung, ob hetera oder lesbisch, ob im schulischen Kontext oder im Wochenendseminar. Und es ist auch so, dass das nicht immer gelingt, aber ich sehe diese Herausforderung als meine Aufgabe, wenn ich Mädchen dazu einladen will, sich in ihrer Per - sönlichkeit zu zeigen und sie ermutige, neue Handlungsmöglichkeiten aus zu probieren. 32
33 Das Kursgeschehen selbst ist Gegenstand des Kurses Der Kurs selber ist Übungsfeld für Grenzsetzung (z.b. sich entscheiden, eine Übung nicht mitzumachen), Konfliktbewältigung (z.b. Ausgrenzung von einzelnen Mädchen, Konflikte zwischen Kursleiterin und Mädchen) Der Hintergrund für mich ist, dass ich Mädchen nicht einerseits vermitteln kann, ihre Gren zen wahrzunehmen und zu be haupten und andererseits das Kursgeschehen selbst als Erfahrungsraum ausklammere. Die beste Grundlage für Mädchenarbeit ist die Bewusstheit der eigenen Person, des eigenen Frauseins Gewaltprävention (Selbstbehauptung zähle ich dazu) ist keine Technik, sondern eine Erziehungshaltung. Ich bin als Frau immer für die Mädchen sichtbar, ich bin Vorbild und repräsentiere eine mögliche Form von Lebensplanung. Je mehr ich mir meiner Person bewusst bin, desto differenzierter kann ich auch die Mädchen wahrnehmen und auf sie eingehen. Es geht um Verständigung, Verständnis und Kommunikation. Ein klares Wissen von Gewaltstrukturen ist in der Praxis spürbar Die eigene Auseinandersetzung mit Gewalt und ihren Strukturen sensibilisiert meinen Blick als Trainerin auf Gewaltsituationen, die die Mädchen im Alltag erleben und die sie mit in den Kurs bringen. Die Klärung des eigenen Gewaltbegriffs ist wichtig, da er bestimmt, an welchem Punkt ich mit Selbstbehauptung ansetze. Zentrale Punkte zur Auswertung des Workshops Bemerkenswert für mich war, dass ungefähr die Hälfte der Teilnehmerinnen selber Selbstbehauptungskurse für Mädchen anbietet und somit ein breites Spektrum an Konzepten und Erfahrungen mit Selbstbehauptungskursen Vorort war. Fragen und Beiträge waren dadurch sehr stark auf die Praxis ausgerichtet, was die Diskussion um die Frage, wie erreiche ich Mädchen mit welchem Inhalt, sehr lebendig und praxisnah machte. Spannend und kontrovers war die Diskussion darüber, was jede als Gewalt empfindet, im Besonderen um den Punkt der strukturellen Gewalt. Mir ist (mal wieder) eindrücklich klar geworden, wie wichtig und für die Praxis hilfreich eine fundierte Ausbildung, kollegiale Unterstützung, Austausch und Vernetzung sind und dass es diese Aspekte im Wendo- Zusammenhang gibt, aber nicht zwischen Wendo- Trainerinnen und anderen Selbstbehauptungstrainerinnen und dass es dafür gegenseitiges Vertrauen und einer Offenheit bedarf, die nicht selbstverständlich da sind. Der Vortrag von Claudia Wallner über den Generationenkonflikt in der Mädchenarbeit war für mich an dieser Stelle sehr erhellend: Auch wir in den Selbstverteidigungszusammenhängen haben einen Generationenkonflikt, der die Kommunikation miteinander erschwert oder verhindert. Gemeint ist hier nicht der Konflikt zwischen jungen und alten Trainerinnen, sondern die Kluft zwischen den Wendo-Trainerinnen und allen anderen Selbstbehauptungstrainerinnen. Das Wendo-Konzept steht für die einen für die anspruchsvolle, feministische Generation, die nicht den Dialog mit den anderen sucht und ein geschlossenes System darstellt mit hohen Standards; und für die Wendo-Trainerinnen sind die anderen oftmals die unpolitischen, die systemimmanenten, die den Schlichen des Patriarchats aufgesessen sind. Fazit Der Dialog zwischen diesen beiden Generationen, die in sich auch nicht homogene Gruppen bilden, steht an und für mich geht es darum, über»konfessionsgrenzen«hinaus, uns über Inhalte und Ziele von Selbstbehauptung für Mädchen zu unterhalten und auszutauschen, gemeinsame Qualitätsstandards zu entwickeln und Netzwerke zu bilden. Erste Schritte gibt es schon: die Arbeitsgruppe in der LAG»Selbstbehauptung«Karin Krudup, seit 15 Jahren Mitarbeiterin im Bellzett, dem Selbstverteidigungsund Bewegungszentrum für Mädchen und Frauen in Bielefeld, 33
34 Bettina Bretländer, Heide Adam-Blaneck» S A G T U N S W O D I E M Ä D C H E N S I N D. B E H I N D E R T E M Ä D C H E N I N D E R M Ä D C H E N A R B E I T: M Ö G L I C H K E I T E N U N D H Ü R D E N I H R E R I N T E G R AT I O N «Behinderte Mädchen sind zu aller erst Mädchen und sollten sich von den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen sowie den Angeboten der Mädchenarbeit im Besonderen angesprochen fühlen. Wieso sind sie aber dann so selten in den entsprechenden Einrichtungen anzutreffen? Die Hürden ihrer Integration sind vielfältig und können wie folgt skizziert werden: Zunächst ist festzuhalten, dass be - hinderte Mädchen in den Angeboten der Mädchenarbeit in den allerseltensten Fällen direkt angesprochen oder konzeptionell berücksichtigt werden (vgl. Bretländer 2003). So wie geschlechtsneutrale Formulierungen frau vor die Frage stellen, ob sie vielleicht mit gemeint sei, entsteht für behinderte Mädchen durch Angebote der Mädchenarbeit, die behinderte Mädchen nicht explizit ansprechen, eine vergleichbare Unsicherheitslage. Will frau nun behinderte Mädchen in Mädchenarbeitsangeboten berücksichtigen, so müssen Hürden überwunden werden, die sich zum einen auf einer organisatorischen und zum anderen auf einer integrationspädagogisch-konzeptionellen Ebene ansiedeln lassen. Auf der organisatorischen Ebene sollte berücksichtigt werden, dass lange Schulzeiten (Ganztagsunterricht) und ggf. lange Schulwege sowie Internatunterbringungen oftmals die Teilnahme an außerschulischen Nachmittagsangeboten am Wohnort erschweren; die Informationen über potenzielle Angebote zu den Mädchen»gebracht«werden müssen ein Auslegen von Flyern wird nicht ausreichen, die Mädchen zu erreichen; eine selbständige Anreise der behinderten Mädchen oftmals unmöglich ist, da die öffentlichen Verkehrsmittel nicht durchweg behindertengerecht ausgestattet sind, so dass Eltern oder ggf. Institutionen der Behindertenhilfe bei der Planung von Angeboten eingebunden werden müssen; die Veranstaltungsräumlichkeiten behindertengerecht ausgestattet sein sollten oder ggf. Absprachen mit den Teilnehmerinnen über Assistenzbedarf u.ä. getroffen werden. Eine mögliche Alternative zur üblichen»komm-struktur«offener Angebote der Mädchenarbeit würde eine aufsuchende Mädchenarbeit (z.b. in Kooperation mit Sonderschulen) darstellen, im Sinne einer»geh-zu-den-mädchen-hin- Struktur«(Adam-Blaneck 2001). Weitere Angebotsvarianten, die von behinderten Mädchen genutzt werden könnten, stellen Wochenendseminare oder Tagesangebote dar. Um behinderte Mädchen tatsächlich nachhaltig in die Mädchenarbeit zu integrieren bzw. um ein integratives Angebot zu planen, das sowohl nichtbehinderte als auch behinderte Mädchen gemeinsam anspricht, reicht es nicht aus, einfach laufende Angebote oder offene Treffs für behinderte Mädchen zu öffnen. Es bedarf vielmehr einer integrationspädagogischen Konzeptentwicklung, die z.b. die Theo- 34
35 rie und Praxis der»pädagogik der Vielfalt«(Prengel 1995) zugrundelegt. Darüber hinaus sollte frau folgende Fragestellungen und Aspekte reflektieren: Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung als Nichtbehinderte zum Thema»Behinderung«: Welche Motivation, Bezüge, Vorerfahrungen, Ängste o.ä. habe ich selber? Welche Ängste, Widerstände, Verhaltensunsicherheiten o.ä. erwarte ich auf Seiten der nichtbehinderten wie auch auf Seiten der behinderten Mädchen und wie können diese potenziellen psycho-emotionalen Barrieren thematisiert bzw. konzeptionell berücksichtigt werden? Und wie motiviere ich überhaupt nichtbehinderte Mädchen an der Teilnahme integrativer Angebote? Literatur: ADAM-BLANECK, HEIDE (2001) Mittendrin Lebenswelten behinderter Mädchen und junger Frauen. Ein Modellprojekt zieht Bilanz, In: Das Band 1, S BRETLÄNDER, BETTINA (2003) Mädchenarbeit mit behinderten Mädchen. Pädagogisch-konzeptionelle Ansätze, (integrations-) politische Herausforderungen und Forschungsbedarfe, In: Kirsten Bruhns (Hrsg.): Geschlechterforschung in der Kinder- und Jugendhilfe. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Leske+Budrich PRENGEL, ANNEDORE (1995) Pädagogik der Vielfalt, Leske + Budrich, Opladen Kontaktadressen: Die bisherigen Erfahrungen mit behinderten Mädchen in der Mädchenarbeit z.b. bei den regelmäßig stattfindenden»mädchenkonferenzen«(organisiert vom Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.v., Düsseldorf) oder den Angeboten von»mixed pickles«e.v. (Verein für Mädchen und Frauen mit und ohne Behinderung, Lübeck) zeigen, dass die Mädchenarbeit mit behinderten Mädchen nicht nur von großer pädagogischer und politischer Bedeutung ist, sondern vor allem auch sehr große und kaum beschreibbare Freude bereitet. Seminartleiterinnen: Dipl.-Päd. Bettina Bretländer Heide Andam Blanek BUNDESVERBAND FÜR KÖRPER- UND MEHRFACHBEHINDERTE e.v., Brehmstr. 5-7, Düsseldorf (Ansprechpartnerin: Heide Adam-Blaneck) FRAUENFORSCHUNG IN REHABILITATION UND PÄDAGOGIK BEI BEHINDERUNG, Universität Dortmund, Fakultät 13, Emil-Figge-Str. 50, Dortmund (Ansprechpartnerin: Bettina Bretländer) NETZWERK VON FRAUEN UND MÄD- CHEN MIT BEHINDERUNGEN NRW, Neubrückenstr , Münster mixed pickles e.v. (Verein für Mädchen und Frauen mit und ohne Behinderungen), Kanalstr. 70, Lübeck 35
36 Petra Samarah M Ä D C H E N! S T Ä R K E N E R K E N N E N U N D F Ö R D E R N Ein Workshop zur interkulturellen Mädchenarbeit mit kunsttherapeutischen Methoden Die eigenen Stärken erkennen und nutzen... ja! Wie wohltuend und vor allem bereichernd ist es, sich einmal ausdrükklich mit den eigenen Stärken zu be schäftigen! Wir wissen aber auch, wie leicht es passiert, dass uns beim Nachdenken über unsere Stärken oft genau das Gegenteil einfällt, nämlich unsere Schwächen! Kunsttherapeutische Methoden sind ge - rade dann hilfreich, weil sie nicht beim Denken und beim Wort ansetzen, sondern beim Erleben und bei inneren Bildern. Warum das Thema in der interkulturellen Arbeit mit Mädchen? Mädchen von heute sind in vielen Bereichen selbstbewusster als»wir Frauen früher«, klarer in dem, was sie (nicht) wollen, zum Teil auch fähiger, sich abzugrenzen. Andererseits besteht besonders bei jugendlichen Frauen ein sehr einseitiges Verständnis von Stärken (schön, intelligent, selbstbewusst etc.). Vor dem Hintergrund dieses Anpassungsdrucks können oder wollen sie ihre tatsächlichen und vor allem auch individuellen Fähigkeiten und Stärken häufig nicht entwickeln. Mädchen aus anderen Kulturen leben darüber hinaus mit dem Spagat zwischen familiärer Werte-Tradition und solchen Werten, die sich aus ihrem Leben unter Deutschen ergeben. Sie haben es oft doppelt schwer, ihre eigenen Stärken zu entdecken und sich mit diesen in ihrem Umfeld zu behaupten. Für die interkulturelle Arbeit mit Mädchen entstehen daraus eine Vielzahl von Problemstellungen, oft noch verstärkt durch den Generationsunterschied und damit zusammen hängenden Verständnisschwierigkeiten. Die erste Runde zu Beginn unseres Workshops ergibt, dass viele Teilnehmerinnen (Erzieherinnen, Ausbilderinnen, Sozialpädagoginnen) in erster Linie methodische Anregungen suchen, die an den Ressourcen»ihrer Mädchen«anknüpfen und die Mädchen verstärkt miteinander in Kontakt bringen sollen. Wir arbeiten mit zwei Methoden, die diesem Ziel dienen sollen und die sich miteinander verknüpfen lassen: ein kunsttherapeutisches»stärkentier«einen gestalterischen Dialog/ Multilog Das»Stärkentier«... Die Teilnehmerinnen identifizieren sich im Laufe einer Bewegungseinheit mit einem ihrer betreuten Mädchen und visualisieren im Anschluss dazu ein»(fantasie-)tier oder Lebewesen«. Großformatig auf Papier oder Pappe gebracht, stellen wir ausführlich Fragen zu dessen We - sen, dessen Eigenheiten und Stärken, zu Lebenswelt und Schutzräumen, zu guter und schlechter Nahrung, zu Arten der Kontaktaufnahme und zur Kontaktgestaltung dieses Lebewesens. Zuletzt die Frage, was dieses Tier braucht, um seine Stärken leben zu können. Im anschließenden Austausch sprechen die Teilnehmerinnen über ihr Erleben im Rollentausch, über Wiedererkanntes, Neues und Überraschen- Kongressteilnehmrinnen auf dem Verentzungskongress 36
37 des beim Betrachten und Befragen ihres Bildes. Ich fordere die Teilnehmerinnen auf, sich einmal zu überlegen, ob sich daraus neue Impulse für die Arbeit mit dem von ihnen gewählten Mädchen ergeben. Der gestalterische Dialog/Multilog Nach der Pause sammeln sich die Frauen zu Kleingruppen rund um ein großes Papier am Boden (z.b. 3x3 Meter bei Vierergruppe). Ausgangspunkt ist, dass sie sich möglichst entgegengesetzte Tiere aussuchen, um noch einmal verstärkt den interkulturellen Aspekt zu beleuchten. In einem nonverbalen Dialog/ Multilog begegnen sich nun die Tiere auf dem Papier (flüssige Farben oder Kreiden). Die einzige Spielregel heißt: ohne zu sprechen miteinander»ins Gespräch zu kommen«und es zu beenden. Im An - schluss tragen wir Erfahrungen zusammen, die es später bei der Anleitung solcher und anderer Methoden unbedingt zu beachten gilt. Wir diskutieren das unterschiedliche Erleben der eigenen Rolle, die Entfaltung eines gemeinsamen Themas, Dynamik und Grundstimmung des Dialogs. Was wird förderlich für den Kontakt erlebt, was eher hinderlich? Wichtig sind auch Fragen nach Erfahrungen mit Grenzen, Gefühlen von Ausgrenzung, Grenzüberschreitungen und -verletzungen. Welche Ideen gibt es für den Transfer in die Arbeit mit Mädchen? Die Teilnehmerinnen sammeln vielfältige Ideen und Varianten für gestalterische Dialoge/ Multiloge in der Arbeit mit Mädchen: zum Beispiel mit und ohne Thema, mit und ohne Musik, mit und ohne Spielregeln. Die verschiedensten Materialien werden genannt von Abfallstoffen über Textilien zu Naturmaterialien und Fundstücken. Auch längerfristige Projekte sind denkbar. Wichtig ist es, die Bedingungen in den Mädchengruppen und die eigene Erfahrung in der Anleitung mit zu berücksichtigen: im Zweifelsfall sind kleinere Gruppen und Spielerisches vorzuziehen. Zur Methode des»stärkentiers«: Ich erläutere den Teilnehmerinnen eine mögliche Variante des»stärkentiers«, bei der man zuerst in Form eines ausführlichen Stärkenprofils die eigenen Stärken sammeln lässt. Ich nenne diesen Teil der Vorarbeit den»protzzettel«, weil es darum geht, Stärken in einem weit gefassten Sinn zu sammeln (Selbst- und Fremdwahrnehmung). Im Anschluss entscheiden sich die Mädchen dann für 3(!) Hauptstärken. Zu diesen letzteren visualisieren und gestalten sie dann ein»stärkentier«. Je nach Zielsetzung können Fragen zur Lebenswelt dieses Tieres gestellt werden wie gehabt. Diese Verfahrensweise setzt eine größere Vorarbeit mit Mädchen voraus, besonders die Heranführung an das Thema»Stärken«. Sie eignet sich eher für ältere Mädchen. Welche besonderen Chancen liegen in den Methoden mit kreativen Medien? Fast jedes Material (egal ob Farbe, Ton oder sonstige Materialien) regt an zum praktischen Tun, hat Aufforderungscharakter. Die Frage der kulturellen Identität tritt hinter dem Miteinander zurück. Kreatives gestalterisches Tun macht neugierig aufeinander. Solange es in einem bewertungsfreien bzw. wertschätzenden Rahmen geschieht, ist Aufgeschlossenheit für Unbekanntes oder Fremdes möglich. Gestalten ist nonverbal und ermöglicht Mädchen das Ausdrücken von Gefühlen dort, wo Worte fehlen oder nicht reichen. Bilder brauchen häufig keine»übersetzung«. Vieles kann man stehen lassen. Andererseits regen Gestaltungen auch zum kontroversen Gespräch an. Kreative Medien ermöglichen neue Ausdrucks- und (Selbst-) Erfahrungsräume für Mädchen. Daraus ergibt sich die Chance, ein größeres Selbstbewusstsein zu entwickeln. Gestalterisches Tun bringt Freude, Spaß und Erfolgserlebnisse. Dies sind wichtige Voraussetzung für das Erfahren und das Entwickeln individueller Stärken. Kreative Angebote, wenn sie mit eigener Freude, gezielt und altersgemäß angeleitet werden, entlasten und bereichern auch die Arbeit der Pädagoginnen. Leider kommen die beiden letzten Fragestellung in dem nur dreistündigen Workshop zu kurz. Was mich deshalb freut, ist folgende Rückmeldung der Teilnehmerinnen: die neue oder wieder entdeckte Lust, gestalterische Methoden vermehrt in ihre Arbeit mit Mädchen einzubringen. Dass Selbsterfahrung mit kunsttherapeutischen Methoden wichtig ist, bevor man mit ihnen arbeitet, haben diese Frauen konkret an sich und anderen erlebt. Petra Samarah, Kunst- und Gestalttherapeutin, Wuppertal 37
38 Güler Arapi, Mitja Sabine Lück G I R L S A C T Antirassistische Mädchenprojekte 2003, Fortbildungen für Multiplikatorinnen Seit April 2001 ist das Projekt»Girls act Antirassistische Mädchenprojekte«im Mädchentreff Bielefeld verankert. Während der Schwerpunkt auf der Durchführung von kreativen Projekten mit jüngeren Mädchen lag, führten wir in Zukunftswerkstatt-Projekte in Kooperation mit Bielefelder Schulen durch. Unsere Zielgruppe waren Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren. In beiden Jahren nahmen je - weils über 100 Mädchen an unseren Workshops teil. Foto Hermine Oberück»Ich will respektiert werden!«rassismus geht uns alle an Gefördert aus Mitteln des KJP-Programmes des Bundes»Jugend für Toleranz und Demokratie gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus«in Verbindung mit dem Programm»Jugend gegen Rechts«des Ministeriums für Jugend, Frauen, Familie und Gesundheit des Landes NRW Im Projekt 2002 machten wir die Erfahrung, dass der Anteil der Schü lerinnen mit Migrationshintergrund sich verringert, je höher die Bildungsstufe ist. So bestand die Grup pe der Sonder- und Hauptschülerinnen zu beinahe 100% aus Mädchen mit Migrationshintergrund, deren Chancen auf einen Bildungsaufstieg verschwindend gering sind. Obwohl rassistische Diskriminierung selten ein offenes Thema für diese Jugendlichen ist, wissen sie doch um ihre gesellschaftliche Stellung und Benachteiligung. Sie fühlen sich betrogen, da sie täglich spüren, dass sie an Grenzen stoßen und ihre Aufstiegschancen begrenzt durch ihre (imaginierte und faktische) Herkunft sind. Zuschreibungen und Ausschlusspraxen aufgrund von Herkunft sind alltägliche Praxis zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft. Weißen deutschen Jugendlichen sind diese Machtinbalancen meist nicht bewusst, rassistische Diskriminierung ist für sie»kein Thema«. Sie übernehmen rassistische Zu - schrei bungen unhinterfragt und reproduzieren diese. In unseren Workshops versuchten wir, Rassismus so zu thematisieren, dass Mädchen jeglicher Herkunft damit erreicht werden. Wir entwickelten dynamische Methoden, die Jugendlichen Spaß machen und gleichzeitig antirassistische Haltungen vermitteln. Dieses Konzept wurde von den teil nehmenden Mädchen gut angenommen. Die Erprobung und Wei - tergabe der Konzepte an erwachsene Pädagoginnen und Lehrerinnen stellt für uns einen sinnvollen nächsten Schritt dar. In den Gesprächen mit pädagogischen Fachkräften äußerten diese häufig Unsicherheiten im konkreten Umgang mit Mädchen of color sowie anderer religiöser Hintergründe und einen großen Bedarf nach Beratung und Weiterbildung in Bezug auf das Thema Rassismus. Daher möchten wir unsere Erfahrungen in der antirassistischen Mädchenarbeit in diesem Jahr an Multiplikatorinnen aus pädagogischen Handlungsfeldern weitergeben. 38
39 Ziele unserer Arbeit sind: Anmerkungen Multiplikatorinnen zu befähigen: a) konkrete antirassistische Projekte mit Jugendlichen durchzuführen. Es werden konkrete Methoden und Materialien zur Umsetzung antirassistischer Projekte sowie Handlungskompetenz in Bezug auf Konfliktsituationen, die sich auf Ethnizität beziehen, vermittelt b) Rassismus im Leben von Kindern/Jugendlichen of color nicht zu leugnen oder zu bagatellisieren, sondern einen Umgang damit zu finden c) Eine antirassistische Haltung in ihre gängigen pädagogischen Konzepte und Methoden einzubauen d) vorhandene Materialien daraufhin zu überprüfen, ob sie geeignet sind, Rassismus in der Gesellschaft abzubauen 1»Girls act Antirassistische Mädchenprojekte im Rampenlicht«, gefördert im Rahmen des Programms»Jugend gegen Rechts«des Ministerium für Jugend, Frauen, Familie und Gesundheit des Landes NRW 2»Girls act Antirassistische Mädchenprojekte in Kooperation mit Schule«, gefördert im Rahmen des Programms»ENTIMON Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus«des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Die Sensibilisierung von Multiplikatorinnen bezogen auf: a) gesellschaftliche Machtverhältnisse b) verinnerlichten Rassismus und eigene stereotype Bilder c) Rassismus in den Medien d) die diskriminierenden institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten und die sie teilweise unbewusst mittragen und reproduzieren e) die psychosozialen Belastungen, die Rassismus im Leben von Kindern/Jugendlichen auslöst Projektleiterinnen: Güler Arapi Mitja Sabine Lück 39
40 Sylvia Neldner» I N A N D O U T «L E S B I S C H E P Ä D A G O G I N N E N I N D E R M Ä D C H E N A R B E I T Hintergrund und Ziel Häufig sind lesbische Pädagoginnen in dem Konflikt, dass Sie ihre lesbische Identität vor ihrem Arbeitgeber und ihrem Klientel geheim halten (müssen). Zeigen sie sich offen als Pädagogin an ihrem Arbeitsplatz müssen sie einerseits eine Kündigung befürchten und/oder Diskriminierung, Ausgrenzung und Ge - walt durch ihr Klientel. Verheimlichen sie ihr Lesbisch-Sein, tragen sie unter anderem dazu bei, dass (möglichen) lesbischen Mädchen und Frauen Identifikationsmodelle fehlen und ihr»outen«würde einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Diskriminierung von Lesben in unserer Gesellschaft leisten. Ziel des Workshop war es, Pädagoginnen die Möglichkeit und den Raum zu bieten, sich mit ihrer Rolle als lesbischer Pädagogin in einem für sie geschützten Rahmen auseinander zu setzen, sich mit anderen lesbischen Pädagoginnen auszutauschen und so eine Stärkung in ihrer Rolle als Pädagogin zu erfahren. Verlauf des Workshops Zum Kennen lernen und Aufwärmen begann der Workshop mit dem Bewegungsspiel»Landkarte«: 1. In welcher Stadt wohnst Du? (alle Teilnehmerinnen ordnen sich den Himmelsrichtungen entsprechend zu) 2. Wie alt bist Du? (Zuordnung nach Alter, Alterskette) 3. Wie lange bist Du in der Mädchenarbeit tätig? (Jahreskette) 4. Welches Sternzeichen bist Du? (die Teilnehmerinnen ordnen sich spontan nach Feuer-Wasser-, Luft- und Erdzeichen) 5. Hast Du Kinder? (Ja Nein) 6. Lebst Du in einer Beziehung? (Ja Nein) 7. Bist Du am Arbeitsplatz geoutet? (Ja Nein) Während des Spiels erfuhren die Frauen einiges über einander und stiegen in einen kurzen Austausch über ihre Rolle und Situation als lesbische Pädagogin an ihrem Arbeitsplatz ein. Lesbische Pädagoginnen sind in unserer Gesellschaft heterosexuell sozialisiert. Oft fehlt eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen lesbischen Identität als auch eine Sprache dafür, sowohl untereinander, als auch mit den heterosexuellen KollegInnen und ihrem Klientel. Als Methode hierfür wurde der»grabbelsack«gewählt. In einem Samtsack sind verschiedene Gegenstände, wie z.b. Lippenstift, Marla Glen CD, Dessous, Jil Sander Parfümprobe, Plastikfußball, Regenbogenlesbenanhäger, Plastikbanane, (Kirmis-) Rose, Lesbenkrimi, Anti- Baby-Pille, (Ehe-) Ringe. Dieser Sack wird reihum gereicht. Jede Frau nimmt ohne hereinzuschauen einzeln einen Gegenstand aus dem Sack und sagt, was sie damit zum Thema lesbische Lebensweisen assoziiert. Auch die anderen Teilnehmerinnen können Gedanken und Zusammenhänge benennen. Nach einer kurzen Pause berichtete Sylvia Neldner über ihre Erfahrungen in der lesbischen Mädchenarbeit. Hier wurde deutlich, dass die anwesenden Frauen ein großes Interesse an einer Auseinandersetzung mit dem Thema auch innerhalb der LAG Mädchenarbeit haben. 40
41 Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Austausch über die Rolle als lesbische Pädagogin. Die Referentin stellte als Diskussionsgrundlage die Erwartungen/Forderungen in Bezug auf den Arbeitsplatz und der Rolle von lesbischen Pädagoginnen, die auf dem Vernetzungskongress in Münster im Rahmen des gleichnamigen Workshops formuliert wurden zur Verfügung. Als Ziel und Wünsche an die LAG Mädchenarbeit formulierten die Frauen gemeinsam: Einen regelmäßigen Austausch über die praktische Arbeit (lesbisch-feministische Mädchenarbeit) Mehr Präsenz in der LAG Mädchenarbeit Lesbisch feministische Mädchenarbeit als großes Thema auf den Vernetzungskongressen auch für die nicht-lesbischen Pädagoginnen Informellen Austausch,»klüngeln«Stammtische in anderen Städten, Austausch über Literatur ALLTAG, JULE (Hrsg.) (1996)»... eigentlich habe ich s schon immer gewusst...«lesbischfeministische Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen. Verlag Frühlingserwachen, Hamburg CALIFIA, PAT (1998) Wie Frauen es tun Das Buch der lesbischen Sexualität. Orlanda, Berlin DREHER, SARAH (1990) Stoner Mc Tavish Ariadne, Hamburg RIEDER, INES (1997) Wer mit wem? Berühmte Frauen und ihre Liebhaberinnen, DTV SCHUPP, KARIN (1998) Angst vor den wilden Lesben! Skandale, Klatsch & Tratsch. Querverlag, Berlin SOZIALWERK FÜR LESBEN UND SCHWULE e.v. (1995) Coming-Out. Broschüre, Köln STREIB, ULI (Hrsg.) (1991) Von nun an nannten sie sich Mütter Lesben und Kinder. Orlanda, Berlin WERNER, PIA/WÖRMANN, BARBARA (2000) Jane liebt Julia Das Coming-Out-Buch, Knaur, München Sylvia Neldner arbeitet als Diplom-Sozialpädagogin in der Mädchenberatungsstelle von femina vita, Mädchenhaus Herford e.v bis 2000 hat sie die Junglesbengruppe»No Limits«geleitet, 1999 bis 2001 war Sylvia Neldner Mitarbeiterin im Projekt»Aufbau einer Angebotsstruktur für lesbische Mädchen im ländlichen Raum«. Freiberuflich ist sie als Referentin u.a. in der»lesbisch-feministischen Mädchenarbeit«tätig. Infobörse auf dem Kongress in Wuppertal 41
42 Eva-Maria Drerup, Petra Kurek» N E X T G E N E R AT I O N «A LT E U N D N E U E L U S T A N D E R M Ä D C H E N A R B E I T Diskussionsforum für alte und neue Mädchenarbeiterinnen Zur Idee und zur Entstehung des Workshops Wie wir oft sorgenvoll gefragt wurden, hat die Entscheidung zur Vorbereitung dieses Workshops nichts damit zu tun, dass das Mädchenzentrum Mabilda in Duisburg ein von Generationskonflikten geschüttelter Ort ist. Ganz im Gegenteil, unsere Arbeit profitiert von der Kompetenz von Pädagoginnen von Ende Zwanzig bis Anfang Vierzig. Während der Vorbereitung des Kongresses ist das Thema eines möglichen Konfliktpotentials zwischen»jungen«und»alten«pädagoginnen jedoch in viele Gespräche eingeflossen, so dass es uns schließlich einer näheren Betrachtung wert erschien. Und wir hatten Lust, (angelehnt an die Lust, die im Titel des Workshops auftaucht) ge - meinsam mit Frauen aus anderen Einrichtungen in ein offenes Ge - spräch darüber zu ge hen, inwieweit Unterschiede zwischen»neu«und»alt«in der Praxis überhaupt zum Tragen kommen. Ein Bedarf an wertschätzender Auseinandersetzung Wir haben den Workshop mit einem Warm-Up begonnen (Ich sitze im Grünen und liebe ganz heimlich...) und konnten in ein ganz entspanntes Kennen lernen mit Partnerinneninterviews starten. SAMMLUNG: Stichwörter zu neuer Mädchenarbeit Neue Theorien, neue Offenheit, neue Fragen Medienkompetenz Nicht mehr kämpfen oder weiterkämpfen? Verschiedenheit, Differenz Stichwörter zu alter Mädchenarbeit Widerstand / Kampf / Energie 3 Politische Heimat, Gesellschaft verändern Frust, mangelnde Würdigung durch junge Frauen Bewusst machen, stärken, helfen»fröhliche Weiblichkeit«Frauenarbeit bedingt Mädchenarbeit Körperlichkeit Intensität Mädchen neu sehen, Bilder in Frage stellen Selbstfindung / Outing Zu Kompetenzen stehen Feminismus Individualität Kraft Respekt Separatismus 42
43 Anschließend wurde auf dem Boden eine Zeittafel angelegt, so dass für alle visualisiert wurde, wie die Altersverteilung in diesem Workshop war. Der von der ältesten bis zur jüngsten Frau betrug fast genau 30 Jahre. Ganz deutlich wurde von den Frauen in der Abfrage ihrer Erwartungen an den Workshop der Wunsch nach Auseinandersetzung ohne Schranken geäußert, die zwar spannend und deutlich sein sollte, wichtig war aber vielen Frauen ein Klima, das ohne Anschuldigungen und Schuldzuweisungen auskommt und das von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist für uns ein Zeichen dafür, dass die Möglichkeit verletzender Diskussionen zu diesem Thema von den Frauen als potentielles Risiko gesehen wurde. Was ist eigentlich»alt«und was ist»neu«? In einem Brainstorming haben wir im nächsten Schritt auf zwei verschiedenen Wandzeitungen gesammelt, welche Begrifflichkeiten, Themen und Gedanken jeweils zu»alter«und»neuer«mädchenarbeit spontan geäußert werden. Zusammengefasst ergaben sich folgende Pole zwischen»alt«und»neu«: Neue Mädchenarbeit konzentriert sich auf die Individualität von Mädchen alte Mädchenarbeit hat Gemeinsamkeit zum Thema. Neue Mädchenarbeit ist weiter gefächert und lässt Ambivalenzen zu alte Mädchenarbeit ist radikaler und kompromissloser. Die daran anschließende Diskussion orientierte sich zunächst auf die Themenbereiche Theorieentwicklung in der Mädchenarbeit und die Einschätzung der Auswirkungen von Geschlechterhierarchien auf die Lebensbedingungen von jungen Frauen, die sich sehr wohl verändert haben oder vielleicht sogar gar nicht verändert haben, oder der Verdeckungszusammenhang ist schwieriger aufzudecken oder...oder???. Welchen Einfluss haben zum jetzigen Zeitpunkt Theorien der Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht auf die Praxis der Mädchenarbeit? Einige Frauen äußerten an dieser Stelle den Wunsch, zu diesem Thema in regionalen Gruppen weiter arbeiten zu wollen. Ich will was von euch wissen! Aber es wurde auch unruhig, und eine weitere Erwartung an diesen Workshop wurde deutlich, nämlich der Wunsch nach»geschichte«, die Frage nach der Genese der Mädchenarbeit, d.h. jüngere Frauen äußerten ganz klar:»erzählt mir doch bitte, was Mädchenarbeit vor 25 Jahren war! Was habt ihr damals gedacht, was war euer Antrieb? Für einige stand auch die Frage im Raum: Zu welcher Generation gehöre ich eigentlich? Was wollen die Mädchen? Könnt ihr jüngeren Frauen mir das vermitteln? Und: Was wollen die jungen Frauen eigentlich? An dieser Stelle begann ein sehr lebhafter Austausch von Erfahrungen: Auf der einen Seite wurden Projekte aus den 80er Jahren geschildert auf der anderen Seite gab es Schilderungen von Situationen aus der Praxis, in denen unterschiedliche Haltungen älterer und jüngerer Frauen deutlich wurden in der Mehrheit Situationen, in denen es um die Selbstinszenierungen und die Schönheitsideale von Mädchen ging. Fazit dieser Gespräche war die Unerlässlichkeit ständiger Kommunikation über die differierende Wahrnehmung und Einschätzung der unterschiedlichen Kolleginnen. Und was jetzt weiter mit dem Thema? Zum Schluss des Workshops stand die Frage im Raum: Wie machen wir weiter mit all den leider nur angeschnittenen Themen, mit den Fragen, die noch immer nicht be - antwortet auf der Flip-Chart standen? Klar ist: Es gibt den Bedarf, auch in regional vernetzter Form die Gespräche über unterschiedliche Sichtweisen und den Umgang vor Ort damit fortzuführen. Dazu könnte die LAG als koordinierendes Organ, vielleicht auch durch geeignete Referentinnen einen Beitrag leisten. Ein weiterer Wunsch an die LAG war die Thematisierung des Themas»Generationswechsel in der Mädchenarbeit«, wenn es um die Ausbildung von Pädagoginnen geht und die Vermittlung weiterer Forschungsergebnisse dazu, inwiefern sich die Zukunftsperspektiven von Mädchen tatsächlich verändert haben. Dieser Aspekt wurde im Vortrag von Prof. Dr. Sigrid Metz- Göckel nur angedeutet (»Bis zur Hochzeit und was dann?«). Wenn ihr also Interesse habt, an dem Thema»De kon struktivistische Theorien und ihr Einfluss auf die Praxis der Mädchenarbeit«zu arbeiten und darüber zu diskutieren, meldet euch in der Geschäftsstelle der LAG oder im Mädchenzentrum Mabilda. Dort werden dann die Adressen der Interessierten zur weiteren Koordination zusammengetragen. Seminartleiterinnen: Eva-Maria Drerup, Petra Kurek, Mädchenzentrum Mabilda e.v., Duisburg 43
44 Anni Hausladen K L Ü N G E L N L E I C H T G E M A C H T O D E R K L Ü N G E L N A L S E R F O L G S S T R AT E G I E D A S P E R S Ö N L I C H E N E T Z W E R K Der Workshop vermittelte einen systematischen Überblick, wie Klüngeln und Vernetzen funktionieren, welches Know-how Sie brauchen und wie Sie es anwenden. Eine Übung am Schluss förderte die Vernetzung der Teilnehmerinnen untereinander. Klüngeln heißt: Sich gemeinsam erfolgreich machen. Wir kennen und wir unterstützen uns.»können Sie sich vorstellen, dass in 2 oder 4 Jahren Ihr Jugendhilfeausschuss zu 50% mit Frauen besetzt ist?«spontanes Gelächter. Absurd? Nein, nicht einmal als Ziel scheint es vorstellbar zu sein.»wozu sich vernetzen, wenn ich doch gute Arbeit leiste?«fragten sich manche. Jedoch für Ihren beruflichen Erfolg und zur Absicherung Ihres Projektes brauchen Sie ein berufliches Netz vor allem unter Frauen in dem Sie sich gegenseitig informieren, schützen, fördern und sich in die entscheidenden Ausschüsse platzieren. Als Einzelkämpferin haben Sie wenig Chancen. Das Märchen von der Qualifikation schockte viele Teilnehmerinnen und hinterließ einen bleibenden Eindruck: Eine IBM-Studie belegt: Zur Beförderung einer Person sind zu 10% ihre Qualifikation ausschlaggebend, zu 30% ihr Image und zu 60% ihr Bekanntheitsgrad. Wenn Sie 60% ihrer Arbeitszeit dafür verwenden würden, Kontakte herzustellen und zu pflegen, wo stünden Sie heute beruflich? Viele Frauen stecken 90% ihrer Arbeit in das»gute Produkt«und in die Büroarbeit und bleiben damit das fleißige Lieschen für andere. Männer hingegen pflegen ihre Jahrhunderte alte berufliche und gesellschaftliche Klüngeltradition in ihren Clubs, Stammtischen, Vereinen, Beiräten, Ausschüssen... Sie nehmen sich Zeit für ihre Treffen, um hier die neuesten Informationen auszutauschen, neue Ideen zu spinnen, sich lukrative Jobs zu vermitteln und sich gegenseitig auf die Schlüsselpositionen zu hieven. Frauen»arbeiten«lieber und wundern sich. Die Priorität auch beruflich auf die Person und nicht nur auf die Sache zu richten fällt schwer. Doch schon während des Workshops beschlossen viele Teilnehmerinnen ihre Strategie zu ändern oder zumindest zu erweitern. Erfolgreich Netzwerken bedeutet professionell zu handeln. Professionelles Klüngeln heißt zielgerichtet und geplant Kontakte 44
45 suchen, pflegen und gegenseitig nutzen. Wer sind für Sie die potentiellen KlüngelpartnerInnen KollegInnen, Vorgesetzte, andere Entscheidungsträger, Institutionen? Wer genau sollte in das persönliche Berufsnetz eingewoben werden? Und wo knüpfe und pflege ich diese Kontakte? Zum Beispiel in den Pausen bei Sitzungen, in der Kantine, beim gemeinsamen Feiern... Denken Sie daran, Aufträge werden lieber an die vergeben, die persönlich bekannt sind. Hier noch einige Fähigkeiten, die Sie als Klünglerin brauchen Neugierig sein auf andere, das Klüngelpotential der anderen erkennen Sich selbst darstellen das eigene Klüngelpotential mitteilen Bewusst Kontakte knüpfen und pflegen sich vernetzen Die wichtige Regel von Geben und Nehmen partnerschaftliches Handeln einhalten Klüngelzeiten nutzen Mit der Vernetzungsübung am Schluss wurde viel vorhandenes Klüngelpotential sichtbar und die Vernetzung untereinander konnte bereits beginnen. Anni Hausladen, Klüngeln & Co, Coaching und Network, Köln Literatur Begleitprogramm auf dem Kongress in Wuppertal HAUSLADEN/LAUFENBERG Die Kunst des Klüngelns. Erfolgsstrategien für Frauen. Ein Handbuch für Frauen mit vielen Klüngelanleitungen. 45
46 A K T I O N S B E I S P I E L KÜRZUNGEN IM LANDESHAUSHALT Im Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt des Landes NRW sind Kürzungen im Landesjugendplan von derzeit ca. 93 Mio. Euro auf 67 Mio. in 2004 und auf 57,7 Mio. in 2005 vorgesehen. Somit wird der Landesjugendplan um 28% und schließlich um 39% gekürzt. Die Position VII»geschlechtsbezogene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit«soll komplett gestrichen werden. Im Landesjugendplan wird eine neue Förderungsstruktur ausgewiesen, die derzeitigen 29 Untertitel werden z.t. in die neuen 6 Untertitel zusammengefasst. Zur Erinnerung: der»neue«landesjugendplan, der unter dem Engagement vieler Beteiligter entstanden ist, und der die die geschlechtsspezifische Arbeit als Querschnittsaufgabe absicherte, ist erst am in Kraft getreten. Der Haushaltsentwurf soll voraussichtlich Ende Januar 2004 verabschiedet werden. Mädchenarbeit ist von den Kürzungen mehrfach betroffen: durch die Streichung der Position VII im Landesjugendplan durch die massiven Kürzungen bei Verbänden und offenen Türen (hier sind besonders viele Mädchentreffs existenziell betroffen) durch Kürzungen im Bereich Gewaltschutz, so z.b. bei den Mädchenhäusern, bei den Frauennotrufen und bei Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, durch die Streichung des Initiativprogramms»Selbstbehauptung für Mädchen an Schulen«LAG Mädchenarbeit NRW Die LAG Mädchenarbeit muss ihre Geschäftsstelle zum schließen. Es ist noch vollkommen unklar, ob und wie wir unsere Arbeit weiterführen können. Der Vorstand versucht z. Zt. mit großen Engagement die Strukturen für die Mädchenarbeit im Land abzusichern. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung! Informationen Haushaltsentwürfe, Adressen Abgeordnete, Sitzungstermine aktuelle Infos, Stellungnahmen, Aktionsideen Homepage des DPWV NRW Homepage der LAG kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW Aktionen Wir wollen weitermachen Spendenaktion zum Erhalt der Geschäftsstelle Landesarbeitsgemeinschaft Maächenarbeit in NRW e.v. Näheres unter Volksinitiative zur Absicherung der Kinder und Jugendarbeit in NRW. Initiatorin ist die AGOT- NRW und die LAG katholischer OT s NRW. Infos unter: Kampagne der freien Wohlfahrtspflege in NRW, 46
47 Brief der Teilnehmerinnen des Vernetzungskongresses an die Landtagsabgeordneten AKTIONSBEISPIEL An den/die Landagsabgeordnete des Landtags NRW Frau/Herr... siehe: Mädchen Mädchenarbeit Mädchenpolitik: Reichtum in NRW 3. Vernetzungskongress Mädchenarbeit in NRW Sehr geehrte Frau/Herr... Als Vertreterinnnen der Mädchenarbeit in Ihrem Wahlkreis erleben wir täglich die Lebendigkeit und die Vielfalt von Mädchen. Mit unserer Arbeit geben wir Mädchen die Möglichkeit, sich stark und verletzlich, lustvoll und neugierig, kraftvoll und vorsichtig zu erfahren. Wir stellen unsere fachliche Kompetenz zur Verfügung und wissen um die Fähigkeiten und Potentiale der Mädchen. Wir wissen aber auch, dass diese Ressourcen nicht fortwährend abgerufen werden können, ohne sie zu pflegen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, bot der Vernetzungskongress Mädchenarbeit in NRW, der vom Juli 2003 in Wuppertal stattfand. Hier trafen sich Fachfrauen der Mädchenarbeit aus der Praxis, der Theorie und der Politik. Wir haben uns informiert, uns ausgetauscht, diskutiert, gestritten, Visionen entwickelt und gefeiert. So wurden die Vielfalt, die Lebendigkeit und der Reichtum der Mädchenarbeit in NRW spürbar. Die Mädchen und das Gemeinwesen, in dem wir arbeiten, werden von der fachlichen Weiterentwicklung und der Inspiration dieser Veranstaltung profitieren. Der Vernetzungskongress wurde aus Mitteln des Landesjugendplans NRW gefördert. Als Landtagsabgeordnete unseres Wahlkreises möchten wir Sie an diesem Reichtum der Mädchenarbeit teilhaben lassen. Wir wissen, dass die Unterstützung von Mädchenarbeit durch Landesmittel zwar selbstverständlich sein sollte, aber nicht selbstverständlich ist. Wir sind in Sorge um den Erhalt des Landesjugendplans, der die wichtigste finanzielle Grundlage unserer Arbeit für und mit Mädchen darstellt. Die Erfahrungen aus dem Vernetzungskongress Mädchenarbeit zeigen einmal mehr, wie gewinnbringend diese Mittel eingesetzt werden. Als verantwortliche Mitarbeiterinnen der Mädchenarbeit bieten wir Ihnen unsere Bereitschaft an, die von Ihnen zur Verfügung gestellten Mittel möglichst sinnvoll und nachhaltig einzusetzen. Wir möchten Sie dazu einladen, sich an der Vielfalt der Mädchen und der Mädchenarbeit in unserem Land zu erfreuen und sich mit Ihrer Arbeit für deren Erhalt einzusetzen. Mit freundlichen Grüßen Unterschrift am besten als Institution und/oder Institutionsleitung 47
48 T E I L N E H M E R I N N E N 3. V E R N E T Z U N G S K O N G R E S S Abufaiad Nitz, Rosemeri; Vincenzvon-Paul-Schule, Schule für Erzie hungs hilfe; Am Plack 03, Dortmund; Tel / ; rose@nomatter.de Adam-Blaneck, Heide; Bundesverband für Körper- u. Mehrfachbehinderte; Brehmstr. 5-7, Düsseldorf; Tel. 0211/ Amsbeck, Gerlinde; Z.i.B. Zukunft im Blick; Warendorfer Str. 3, Münster; Tel. 0251/556 72; ZiB@frauen-und-beruf-muenster.de Arapi, Güler; Mädchentreff Bielefeld e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel / ; kontakt@ maedchentreff-bielefeld.de Aßmann, Dorothea; Nottebohmstr. 1, Münster; Tel. 0251/ Aufberg, Elisabeth; Diakonisches Werk Marl-Haltern; Rheinhardt- Freericks-Str. 17, Haltern; Tel / Baumeister, Lena; Stadt Wuppertal, Stadtbetrieb Jugend und Freizeit; Röttgen 102 a, Wuppertal; Tel Bäuml, Karla; VHS Wuppertal, minet; Lenneper Str , Wuppertal Benger-Diederichs, Ina; Jugend- und Kulturzentrum Rensdorf; Scheidtstr. 36, Wuppertal; Tel. 0202/ Bernhard, Susanne; Übermittagsbetreuung Hauptschule Rott; Rödigerstr. 113, Wuppertal; Tel. 0202/ Beyer, Conny; Mädchentreff Bielefeld e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel. 0521/ ; kontakt@ maedchentreff-bielefeld.de Blomberg, Marion; Wildwasser Hagen; Postfach 4025, Hagen; Tel / Blotschinski, Silke; BellZett e. V. Frauen machen Frauen fit; Sudbrackstr. 36a, Bielefeld; Tel. 0521/ ; info@bellzett.de Blum, Bettina; Sozialdienst katholischer Frauen e. V.; Kamekestr. 19, Köln; Tel. 0221/ Bocklage, Roswitha; Gleichstellungsstelle Wuppertal; Wegnerstr. 7, Wuppertal; Tel. 0202/ ; roswitha. bocklage@stadt.wuppertal.de Bordonau Tinoco, Fina; Caritasverband f. die Stadt Solingen; Goerdelerstr. 55, Solingen Böving, Silke; Awo Jugend Kulturbahnhof; Bahnhofsplatz 6, Steinfurt; Tel / ; talentschuppen@awo-ms-st.de Boxen, Nadine; Mädchenzentrum MABILDA e.v.; Kalthoffstr. 73, Duisburg; Tel. 0203/ ; mabilda@t-online.de Bretländer, Bettina; Universität Dortmund, Fak. 13, Frauenforschung; Emil-Figge-Str. 50, Dortmund; Tel. 0231/ ; bettina.bretlaender@ uni-dortmund.de Collet, Andrea; Stadt Castrop-Rauxel, Jugendzentrum TRAFO; In der Wanne 102, Castrop-Rauxel; Tel / Conscience, Alexa; Mädchenzentrum Gladbeck; Uhlandstr. 16, Gladbeck; Tel /233 42; info@mz-gladbeck.de Cremer, Heike; Stadt. Jugendhaus Vohwinkel-Mitte; Gräfrather Str. 9, Wuppertal; Tel. 0202/ ; jugendhausvohwinkelmitte@stadt.wuppertal.de de Buhr, Kerstin; Frauenberatung, Frauenselbsthilfe e. V.; Laurentiusstr. 12, Wuppertal; Tel. 0202/ ; kerstindebuhr@aol.com Dreckmann, Dr., Ute; Landtag NRW; Postfach , Düsseldorf Drerup, Eva-Maria; Mädchenzentrum MABILDA e.v.; Kalthoffstr. 73, Duisburg; Tel. 0203/ ; mabilda@t-online.de Dünnwald, Anja; Kinder- und Jugendtreff Heckinghausen; Heckinghauser Str , Wuppertal; Tel. 0202/ El Amri, Jasmin; Stadt Wuppertal, Stadtbetrieb Jugend und Freizeit; Röttgen 102 a, Wuppertal; Tel. 0202/
49 Emberger, Diana; LAG Lokale Medienarbeit; Emscherstr. 71, Duisburg; Tel. 0203/ ; Exner, Carola; Bielefelder Jugendring e.v.; Ravensberger Str. 12, Bielefeld; Tel. 0521/ ; Fahrenkrog, Sabine; Gleichstellungsstelle Wuppertal; Wegnerstr. 7, Wuppertal; Tel. 0202/ Fegter, Susann; MAJA e.v., Verein zur Förderung und Weiterentwicklung feministischer Mädchenarbeit und reflektierender Jungenarbeit; Berenskamp 9, Bielefeld; Tel. 0521/ ; Foltin, Anke; Universität Duisburg/ Essen, Standort Essen, Zentrum für Hochschuldidaktik; Universitätsstr. 12, Essen; Tel. 0201/ Frank, Kathy; Pro Familia Beratungsstelle Bonn, Mädchentelefon; Poppelsdorfer Allee 15, Bonn; Tel. 0228/ ; Freienstein, Claudia; Vincenz-von-Paul- Schule, Schule für Erziehungshilfe; Am Plack 03, Dortmund; Tel. 0231/ Freund, Miriam; Florentine- Eichler-Str. 18, Köln; Tel. 0221/ Frowein-Momberg, Liesel; Stadt Wuppertal, Interkulturelle Jugendbildung; Alexanderstr. 18, Wuppertal; Tel. 0202/ ; stadt.wuppertal.de Fuchte, Katja; Arnikaweg 78, Paderborn; Tel / Gottschalk, Gabriele; PSG DV Paderborn e. V.; Hakenstr. 13, Dortmund; Tel. 0231/ ; t-online.de Graff, Ulrike; LAG Mädchenarbeit NRW e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel. 0521/ ; Grünewald, Katja; animo e.v., Verein für geschlechterbewusste Pädagogik und Gewaltprävention; Sibeliusstr. 26, Münster; Tel. 0251/ ; Hahne-Butz, Birgit; Wuppertaler Stadtwerke; Blomberger Str , Wuppertal; Tel. 0202/ Hammers, Nicole; Spielplatzhaus Schönebeck; Ulmenstr. 1, Wuppertal; Tel. 0202/ Hausladen, Anni; Klüngeln & Co., Coaching + Network; Christophstr. 50, Köln; Tel. 0221/ ; info@frauen-kluengeln.de Heidemann, Katja; Ev. Kinder- und Jugendzentrum Enger; Ringstr. 65, Enger; Tel / ; tot-enger@gmx.de Hox, Ina; NETZ-Gruppe Kleve; Rütgerstr. 4, Kleve Ingenfeld, Marita; FUMA; Landstr. 164, Gladbeck; Tel /309 59; FUMA@gmx.de Jaeger-Klütsch, Elke; Gesamtschule Else-Lasker-Schüler; Siegesstr. 82, Wuppertal; Tel. 0202/ Jansen, Susanne; Outlaw ggmbh, Mädchenkrisenhaus Münster; Postfach 5566, Münster; Tel /550 19; maedchenkrisenhaus@outlaw-jugendhilfe.de Jordan, Nina; Stadt Castrop-Rauxel, Jugendzentrum D; Dresdenerstr. 24, Castrop-Rauxel; Tel /37 98 Kassette, Astrid; pro familia Beratungsstelle Wuppertal; Hofaue 21, Wuppertal; Tel. 0202/ ; wuppertal@profamilia.de Kieninger, Gerda; Landtag NRW; Postfach , Düsseldorf Klar, Dorothée; Soziokulturelles Zentrum und Jugendzentrum Altstadtschmiede e.v.; Kellerstr. 10, Rekklinghausen; Tel /212 12; homes@altstadtschmiede.de Klein-Senge, Barbara; Wambeler Hellweg 137, Dortmund; Tel. 0231/ ; klein-senge@web.de Klingemann, Sandra; Mädchenzentrum MABILDA e.v.; Kalthoffstr. 73, Duisburg; Tel. 0203/ ; mabilda@t-online.de Klink, Rita; Hermann-Josef-Haus; Urfttalstr. 41, Kall-Urft; Tel /885 51; Hermann-Josef-Haus-Urft@ t-online.de Klosa, Gabriela; TSE Hochdahl Kinderund Jugendzentrum; Am Laubacher Feld 19, Mettmann; Tel. 0170/ Klosa, Gabriela; Neckarstr. 60, Duisburg; Tel. 0203/ ; gabriela.klosa@gmx.de Knebel-Ittenbach, Uschi; LV Rheinland, Gleichstellungsamt; Kennedy-Ufer 2, Köln; Tel. 0221/ ; ursula.knebel-ittenbach@lvr.de Koberg, Ulrike; Wüstenhöfer Str. 97, Essen; ulli.koberg@web.de Koch, Heidi; Ökumnische Werkstatt; Missionsstr. 9, Wuppertal Koczy, Ute; Landtag NRW; Postfach , Düsseldorf Konermann, Anne; Westfälisches Jugendheim Tecklenburg, Wohngruppe Ledde; Osnabrücker Str. 18, Tecklenburg; Tel /96 20 Korte, Christina; Stadt Münster, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Drogenberatung; Schorlemer Str. 8, Münster; Tel. 0251/ ; kortec@stadt-muenster.de Köster, Doro; Sozialdienst kathol. Frauen e.v.; Turnerstr. 4, Bielefeld; Tel. 0521/ ; jugendhaus-elpke@t-online.de Krause, Denise; Mädchenzentrum MABILDA e.v.; Kalthoffstr. 73, Duisburg; Tel. 0203/ ; mabilda@t-online.de Kreul, Michelle; OT Klingholzberg; Heinrich-Böll-Str. 136, Wuppertal; Tel. 0202/
50 Krudup, Karin; BellZett e. V. Frauen machen Frauen fit; Sudbrackstr. 36 a, Bielefeld; Tel. 0521/ ; Kühn, Stefan; Beigeordneter der Stadt Wuppertal, Ressort Jugendamt + soz. Dienste; Neumarkt 10, Wuppertal; Tel. 0202/ Kurek, Petra; Mädchenzentrum MABILDA e.v.; Kalthoffstr. 73, Duisburg; Tel. 0203/ ; mabilda@t-online.de Lager, Berit; Nachbarschaftsheim Offene Tür; Platz der Republik 9-10, Wuppertal; Tel. 0202/ ; beritlager@yahoo.de Lappöhn, Claudia; LWL Landesjugendamt; Warendorfer Str. 25, Münster; Tel. 0251/ ; c.lappoehn@lwl.org Lück, Mitja Sabine; Mädchentreff Bielefeld e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel. 0521/ ; kontakt@ maedchentreff-bielefeld.de Lück, Sylvia; Mädchentreff Bielefeld e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel. 0521/ ; kontakt@ maedchentreff-bielefeld.de Ludwig, Claudia; Stadt Erftstadt, Kinder-, Jugend- u. Bürgerzentrum; Kirchplatz 3, Erftstadt Maaß, Karin; Ev. Jugendhilfe Münsterland ggmbh, Flexible Hilfen; Wiesenstr , Coesfeld; Tel / ; flexi-coe@t-online.de Mahnert, Gabriele; AK Mädchenarbeit Wuppertal, Ev. Jugendzentrum; Cäcilienstr. 7, Wuppertal; Tel. 0202/ ; g.mahnert@t-online.de Maier, Britta; BellZett e.v. Frauen machen Frauen fit; Sudbrackstr. 36 a, Bielefeld; Tel. 0521/ ; info@bellzett.de Mechsner-Tölkes, Monika; Höfferhof 1, Much; Tel /61 51; monimtoelkes@t-online.de Mielek, Andrea; Rosa Strippe e. V.; Alleestr. 54, Bochum; Tel. 0234/ ; orga@rosstrippe.de Müller, Judith; Stadtverwaltung Mülheim, Gleichstellungsstelle; Ruhrstr , Mülheim a. d. Ruhr; Tel. 0208/ ; Judith.Mueller@Stadt-mh.de Müller, Ute; Volkshochschule; Auer Schulstr. 20, Wuppertal; Tel. 0202/ Neldner, Sylvia; Große-Kurfürsten- Str. 49, Bielefeld; Tel. 0521/ ; sneldner@aol.com Nüsse, Dagmar; AK Mädchenarbeit Wuppertal, c/o»alte Feuerwache«; Gathe 6, Wuppertal; Tel. 0202/ ; alte-feuerwache@web.de + nbh.wtal@t-online.de Oelkers, Marion; Haus der Jugend; Tempelhoferstr. 17, Monheim am Rhein; Tel / ; Moelkers@monheim.de Osterbrink, Judith; föbe GmbH; Friedrichstr. 41, Siegen; Tel. 0271/ Pitang, Barbara; TSE Hochdahl Kinder- u. Jugendzentrum; Am Laubacher Feld 19, Mettmann; Tel. 0170/ Pollmann, Annegret; Gleichstellungsstelle Erkrath; Bahnstr. 16, Erkrath; Tel. 0211/ ; annegret.pollmann@erkrath.de Puffer, Regina; Mädchentreff Bielefeld e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel. 0521/ ; kontakt@ maedchentreff-bielefeld.de Rabien, Anna; LAG Mädchenarbeit NRW e.v.; Alsenstr. 28, Bielefeld; Tel. 0521/ ; lag@maedchenarbeit-nrw.de Raschtuttis, Jutta; Jugendzentrum Klingholzberg; Heinrich-Böll-Str. 136, Wuppertal; Tel. 0202/ ; otk@stadt-wuppertal.de Reetz, Cornelia; Hermann-Josef-Haus; Urfttalstr. 41, Kall-Urft; Tel /885 51; Hermann-Josef- Haus-Urft@t-online.de Reich, Patricia; Wuppertaler Stadtwerke; Blomberger Str , Wuppertal; Tel. 0202/ Ressel, Karin; Technikzentrum Lübbecke e.v.; Schnathorster Str. 2, Lübbecke; Tel / ; technikzentrum@t-online.de Reuter, Dagmar; Stadt Werne, FB Jugend und Familie; Bahnhofstr. 8, Werne; Tel / Rottmann, Petra; Wildwasser Hagen; Postfach 4025, Hagen; Tel / Rudack, Helga; Ruhr-Universität Bochum; Universitätsstr. 150, Bochum; Tel. 0234/ ; thekla@rub.de Salewski, Reinhilde; Spielplatzhaus Reppkotten; Schellenbecker Str. 27, Wuppertal; Tel. 0202/ Samarah, Petra; Helmholtzstr. 7, Wuppertal; Tel. 0202/ oder dienstl. Scharlibbe, Suzana; Universität Duisburg/Essen, Standort Essen, Zentrum für Hochschuldidaktik; Universitätsstr. 12, Essen; Tel. 0201/ ; suzana.scharlibbe@uni-essen.de Schettler, Annelie; Volkshochschule; Auer Schulstr. 20, Wuppertal; Tel. 0202/ ; annelie-schettler@stadt.wuppertal.de Schröder, Alexandra; Jugendamt der Stadt Wiehl, Jugendzentrum; Homburger Str. 14, Wiehl; Tel / Schulz, Trixi; Outlaw ggmbh, Mädchenkrisenhaus Münster; Postfach 5566, Münster; Tel /550 19; maedchenkrisenhaus@outlawjugendhilfe.de Schunke, Irena; Landesstelle Mädchenarbeit Sachsen-Anhalt e.v.; Goethestr. 19, Magdeburg; Tel. 0391/ ; landesstellemaedchenarbeit@ web.de Seelig, Anja; Awo Jugend Kulturbahnhof; Bahnhofsplatz 6, Steinfurt; Tel / ; talentschuppen@awo-ms-st.de Segschneider, Antje; Althoffstr. 13, Dortmund; Tel. 0231/
51 Siebert, Tatjana; Outlaw ggmbh, Mädchenkrisenhaus Münster; Postfach 5566, Münster; Tel /550 19; Sokolowski, Claudia; Jugendamt Mettmann, Schulsozialarbeit Eks; Goethestr. 34, Mettmann; Tel / ; Soluch, Malgorzata; Mädchenzentrum MABILDA e.v.; Kalthoffstr. 73, Duisburg; Tel. 0203/ ; Sommerfeld, Brit; Distelbeck 55, Wuppertal; Tel. 0202/ Stauber, Barbara; Paul-Pfizer-Str. 55, Reutlingen; Tel / ; Steigerwald-Riepl, Christine; Gerhart-Hauptmann-Str. 33, Bergheim; Tel / ; drk-erftkreis.de Steuber, Susanne; Zum Brunnen 3, Hille; Tel ; Stockmeier, Silke; Kreis Steinfurt Jugendamt, Fachberatung Jugendarbeit, AG geschlechtsspezifische Arbeit; Tecklenburger Str. 10, Steinfurt; Tel / ; Strutz-Fürth, Heike; Spielplatzhaus Leibusch; Leibuschstr. 37, Wuppertal; Tel. 0202/ ; stadt.wuppertal.de Tekath, Ursula; Hermann-Josef-Haus; Urfttalstr. 41, Kall-Urft; Tel /885 51; t-online.d Thimm, Beate; Ev. Jugendhilfe Münsterland, Büro Flexible Hilfen Lüdinghausen; Steverstr. 8, Lüdinghausen Topp, Margret; Johannesschule Greven; Letterhausstr. 7, Emsdetten; Tel /72 62 Trappe, Gisela; Gleichstellungsstelle Wuppertal; Wegnerstr. 7, Wuppertal; Tel. 0202/ Gruppenleitung 3. Vernetzungskongress in Wuppertal Treitz, Ingrid; Stadt Velbert, Zentrale Dienste-Logistik; Thomasstr. 7, Velbert; Tel / ; Tücking, Rita; Lahnstr. 14, Münster; Tel. 0251/ ; Tüysüz, Saadet; Volkshochschule; Auer Schulstr. 20, Wuppertal; Tel. 0202/ ; stadt.wuppertal.de Urspruch, Natasche; Jugendzentrum Outback; Spitzenstr. 30, Wuppertal; Tel. 0202/ van Dinther, Regina; Landtag NRW; Postfach , Düsseldorf Vinke, Beate; Fridolinstr. 14, Köln; Tel. 0221/ ; Volk, Ulla; BBZ Wiehl; Neuwiehler Str. 37, Wiehl; Tel /763 10; Völker, Martina; Stadt Wuppertal, Stadtbetrieb Jugend + Freizeit; Alexanderstr. 18, Wuppertal; Tel. 0202/ ; Martina.Voelker@stadt.wuppertal.de Wallner, Claudia; Scheibenstr. 102, Münster; Tel. 0251/ Wehner, Margarete; Volkshochschule; Auer Schulstr. 20, Wuppertal; Tel. 0202/ ; annelie-schettler@stadt.wuppertal.de Weissenfeld-Thiemann, Henrike; Jugendberatungsstelle Neuss; Drususallee 81, Neuss; Tel /270 33; jubsneuss@t-online.de Welpmann, Marie; MAJA e.v., Verein zur Förderung und Weiterentwikklung feministischer Mädchenarbeit und reflektierender Jungenarbeit; Berenskamp 9, Bielefeld; Tel. 0521/ ; kontakt@maja-ev.de Werlein, Claudia; SKF Jugendhaus Elpke; Turnerstr. 04, Bielefeld; Tel. 0521/ Wessels, Sabine; Stadt Coesfeld, Jugendamt; Bernhard-von- Galen-Str. 10, Coesfeld; Tel / ; sabine.wessels@coesfeld.de Wigbers-Hentze, Agnes; Schulpsychologische Beratung; Friedrich-Engel- Allee 83, Wuppertal; Tel. 0202/ Willich, Monika; Landesjugendring NRW e.v.; Martinstr. 2 a, Neuss; Tel /469 50; ljrnrw@t-online.de Winterscheidt, Antje; Mädchentreff Mabuka; Kolberger Str. 20, Leverkusen; Tel /539 39; maedchentreff-leverkusen@telelev.net Wollny, Angela; MSJK; Völkinger Str. 49, Düsseldorf; Tel. 0211/ Woosmann, Angelika; Jugendfreizeitheim Höhe; Höhe 67, Wuppertal; Tel. 0202/ Wortberg, Christiane; Z.i.B. Zukunft im Blick; Warendorfer Str. 3, Münster; Tel. 0251/556 72; ZiB@frauen-und-beruf-muenster.de 51
52 Dr. Andrea Schmidt» B A L A N C E A K T M Ä D C H E N A R B E I T «D E K O N S T R U K T I V E A N R E G U N G E N F Ü R D I E P R A X I S V O N B I L D U N G U N D PA R T I Z I PAT I O N Das Verfahren der Dekonstruktion lässt sich plastisch als»demontage von Denkgewohnheiten«beschreiben (vgl. Corinna Voigt-Kehlenbeck 2001). So bedeutet Dekonstruktion, Konstruktionen als solche zu begreifen und die Herstellungsmodi dieser»hergestellten Wahrheiten«aufzuzeigen. Der Poststrukturalistische Philosoph Jacques Derrida (1990) versteht sein Verfahren der Dekon- Dokumentation Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. In meinen folgenden Überlegungen konzentriere ich mich auf das pädagogische Feld der außerschulischen Mädchenarbeit. Gegenwärtig werden in Theorie und Praxis außerschulischer Mädchenarbeit Perspektivenwechsel diskutiert. Zur Zeit scheint geradezu ein Konkurrenzkampf um die»richtigere«bzw.»bessere«art mit Mädchen zu arbeiten, entbrannt zu sein. Der Mädchenarbeit bliebe ihr Klientel fern, so der m.e. noch nicht hinreichend belegte Ruf aus den Untiefen der Jugendhilfe und -politik. In Zeiten knappster monetärer Ressourcen und dem neuen Zauberwort»Gender Mainstreaming«ist dies sicher kein Zufall. In diesem Kontext ziehen sich zur Zeit auch theoretische Ansätze, die unter den Stichworten Poststrukturalismus, Dekonstruktion und geschlechterreflektierende Koedukation subsumiert werden können, durch die Diskussionen um Mädchenarbeit. Sie bringen zum Teil Begriffsverwirrungen, unzulässige Verkürzungen hochkomplexer philosophischer Zusammenhänge mit sich und schüren neuerliche Konflikte um den»richtigen«und den»falschen«feministischen Ansatz. Auf der Strecke bleiben vielfach die zentralen Paradigmen der Mädchenarbeit wie Bildung und Partizipation, um die es ja hier auf dieser Tagung auch geht und die Hauptakteurinnen dieses pädagogischen Feldes, die Mädchen selbst. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin überzeugt von der Produktivität, Dekonstruktion als philosophisches Verfahren in pädagogische Handlungsfelder einzubeziehen. Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle verdeutlichen, das Dekonstruktion keine neue Erfindung ist, die gleichsam lösgelöst von der Existenz anderer theoretischer Ansätze gedacht werden kann. Dekonstruktion lebt erst durch die Reibung an anderen feministischen Denkansätzen die zum Abbau des hierarchischen Geschlechterverhältnisses beitragen wollen, wie der Strategie der Androgynie und der Strategien um die Pole Gleichheit und Differenz. Diese Strategien spiegeln sich auch in Konzepten und in Praxen von Mädchenarbeit wider. Sie wurden, dies macht ein Rückblick auf die Historie deutlich, verändert, verworfen, bestanden nebeneinander und wurden weiterentwickelt. Das Verfahren der Dekonstruktion lässt sich quasi quer auf die bestehenden Ansätze legen und eröffnet so neue Perspektiven auf Bildung und Partizipation in der Mädchenarbeit. Zunächst erhelle ich das Verfahren der Dekonstruktion und zeige im Anschluss Perspektiven für Bildung und Partizipation in der außerschulischen Arbeit mit Mädchen auf. Annäherung an den Begriff»Dekonstruktion«52
53 struktion nicht nur metatheoretisch, sondern konkret herrschaftskritisch, denn mit dem Aufzeigen der Herstellungsmechanismen wirkungsmächtiger Diskurse wie z.b. Justiz und Gesetzgebung ist stets die Frage verwoben, wem nutzt es was, wenn bestimmte Aspekte ausgeblendet bzw. eindeutig zugeordnet werden. Strukturen und das Wirken von Diskursen, die unser Leben durchziehen, können mit diesem Ansatz hinterfragt werden. Dekonstruktion beschreibt eine Denkstrategie des»sowohl-als-auch«. Unser durch die Aufklärung geprägtes Denken der Moderne, der westlichen Welt hingegen ist ein Denken in Gegensätzen, in Kategorien des»entweder-oder«. So sind wir permanent damit beschäftigt zu kategorisieren, zu zuordnen, einzuordnen, Widersprüche zu glätten und mithin zu vereindeutigen. Das Denken des Entweder-Oder funktioniert als Ordnungssystem, welches einen permanenten Zuordnungsdruck und folglich Normierungen erzeugt und damit Ausgrenzungen bewirkt. Dies soll am Beispiel des Systems der hierarchischen Zweigeschlechtlichkeit verdeutlicht werden, sind wir auf diesem Gebiet doch alle Expertinnen und Experten: In diesem System müssen sich die Protagonisten in die Kategorien Frau und Mann einordnen lassen und ordnen sich selber zu. Diese Zuordnungen haben eindeutig zu sein und sie sind in der Regel unveränderbar ein Leben lang. Jede Abweichung von der so konstruierten Norm wird als störend empfunden und drängt jeden Einzelnen und jede Einzelne dazu, sich selbst in die bestehende Ordnung einzugliedern und diese wieder stimmig zu machen. Dies klingt nun erst einmal relativ unverdächtig, das Fatale an diesem Mechanismus ist jedoch, das mit jenen Zuordnungen Hierarchien, Abwertungen, Ausblendungen, Verwerfungen und Benachteiligungen verwoben sind, die auch durch Bemühungen von Strategien der Gleichberechtigung wie z.b. Gender Mainstreaming nicht behoben werden können. Diese eben skizzierte Demontage von Denkgewohnheiten lässt sich auch auf andere Ordnungen übertragen, wie zum Beispiel auf das Verhältnis von Homo- und Heterosexualität, auf das Verhältnis von Theorie und Praxis, der Beziehung von öffentlichem und freiem Träger, von Pädagogin und Mädchen. Und auch auf Kategorien, die in der Pädagogik von zentraler Bedeutung sind, wie Subjekt, Identität, Handeln, Bildung und Partizipation. Betonen möchte ich hierbei ausdrücklich, dass es nicht um das Auflösen oder Abschaffen jener Kategorien geht, sondern darum, deutlich zu machen, dass es nahezu unmöglich ist, diese Kategorien, also beispielsweise eine Identität, herzustellen, ohne bedeutsame Aspekte bzw. Anteile zu negieren. So müssen im Rahmen der Konstruktion einer heterosexuellen Geschlechtsidentität lesbische und schwule Anteile ausgeblendet werden. Das Verfahren der Dekonstruktion wurde in feministischen Diskussionen aufgegriffen und trug zu der Erkenntnis bei, dass die Festlegung auf nur zwei Geschlechter selbst schon eine Konstruktion ist. Die damit verbundene Kritik an der scheinbaren Naturhaftigkeit der Struktur der Zweigeschlechtlichkeit zielt auf die Ausgerichtetheit der ihr innewohnenden Gegensätze (Dichotomien) nämlich Männer und Frauen, denn in dieser Etablierung jener Gegensätze und der Bewertung der Kategorien, liegt die Hierarchisierung des Geschlechterverhältnisses begründet. Als ein Fazit für die Frauen- und Geschlechterforschung lässt sich die Suche nach Möglichkeiten, starre Zuschreibungen in der Geschlechterordnung zu überwinden ziehen. Dabei wird vor diesem Hintergrund davon ausgegangen, dass Geschlecht das ist was wir tun und nicht das, was wir sind (Doing gender). Konsequenzen für Theorie und Praxis außerschulischer Mädchenarbeit Dekonstruktion auf pädagogische Handlungsfelder zu übertragen bedeutet zunächst ein verstärktes Bemühen, dichotome starre Festlegungen zu vermeiden und Zwischenräume und Uneindeutigkeiten zu formen. So stehen im Rahmen einer dekonstruktiven Mädchenarbeit nicht mehr die Verweise auf besondere Problemlagen von Mädchen im Vordergrund, sondern der Bedarf an Unterstützung, den Mädchen im Prozess der Herstellung ihrer Geschlechtsidentität selbst einfordern. Was bedeutet dies nun für die Paradigmen Bildung und Partizipation? Meine Überlegungen gehen dahin, weniger den Bildungsaspekt in der Mädchenarbeit hervorzuheben, sondern sich stärker auf die Partizipation zu konzentrieren. Dieses argumentiere ich wie folgt: Ich zitiere aus der Einladung zu dieser Jahrestagung:»Bildungspotenziale von Mädchenarbeit liegen in der Anregung zur Selbstbildung und zur Selbstreflexion mittels einer parteilichen pädagogischen Beziehung und zur Selbsttätigkeit mittels vielfältiger Angebote zum Experiment und zum Selbstausdruck.«Dies bezeichnet m.e. einen offenen bzw. beweglichen Bildungsbegriff. Vielfach wird jedoch in Theorie und Praxis von außerschulischer Arbeit mit Mädchen 53
54 (und nicht nur dort) ein relativ starres, lineares Bildungsparadigma transportiert. Dies ist sicherlich stark verwoben mit der Verknüpfung von Mädchenarbeit mit Mädchenpolitik. Problemlagen von Mädchen sollen eben nicht nur individualisiert betrachtet werden, sondern strukturell. Das heißt, dass es im Rahmen von Mädchenarbeit vielfach darum geht, Mädchen und junge Frauen in ihrem Eingliederungsprozess in das hierarchische Geschlechterverhältnis zu unterstützen und gleichzeitig das Geschlechterverhältnis zu dekonstruieren. Das System der Zweigeschlechtlichkeit soll als Konstruktion transparent gemacht und Erfahrungs- und Bewegungsräume von Mädchen erweitert beziehungsweise neu eröffnet werden. In vielen Konzepten zur Mädchenarbeit liest sich dies dann wie folgt: Mädchen sollen ihr»gewordenund Zugerichtet-Sein«aufarbeiten und ihre»benachteiligungs- und Unterdrückungserfahrungen«analysieren (Renate Klees et al., 1992, S. 37). Sie sollen ihre»eigenen Bedürfnisse entdecken, zu sich selbst kommen«(renate Klees et al., 1992, S. 36) und ihre»eigenständige Persönlichkeit«entwickeln sowie»widerstand gegen Funktionalisierung von Gewalt im patriarchalen System«leisten (Gabriele Möhlke; Gabi Reiter, 1995, S. 25ff.). Mädchen sollen»gängige Weiblichkeitsbilder«hinterfragen,»ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern«und in»öffentlichen Räumen als eigenständig agierende Persönlichkeit präsent sein«(elisabeth Glücks; Franz-Gerd Ottemeier-Glücks, 1994, S.118 ff.). Lesbische Mädchen müssen sich fragen, ob sie ihre»eigentliche Identität leben wollen«und trotz»diskriminierung ein lesbisches Selbstbewusstsein finden«(jule Alltag, 1996, S. 28). Am Beispiel dieser Zitate wird deutlich, dass in Konzepten zur Mädchenarbeit folgendes Bildungsideal existent ist: Mädchen sollen sich gegen ge - schlechtsstereotype Sozialisation wehren und sich widerständig zu gesellschaftlichen Anforderungen verhalten. Sie sollen Mechanismen einer geschlechtshierarchisch organisierten Gesellschaft durchschauen und selbstbestimmt ihren eigenen Weg gehen lernen. Sie sollen die weibliche Sozialisation wertschätzen und ihren Körper anerkennen. Neben einem androzentrischen Maßstab, existiert in Konzepten zur Mädchenarbeit ein feministisch geprägtes Referenzsystem. Dieses feministische Mädchenideal ist so komplex, teilweise widersprüchlich und so unerreichbar, das reale Mädchen gemessen an ihm wieder defizitär erscheinen. Das Formulieren des feministischen Ideals ist auf der einen Seite verstehbar, denn Pädagogik kommt schwerlich ohne Kategorisierungen aus. Auf der anderen Seite bedeutet dies, das Pädagoginnen mit Konstruktionen über ihre Klientel arbeiten. Tradierten normativen Bildern über Mädchen werden neue feministische Anforderungen gegenübergestellt, die in der Regel entgegengesetzte Ideale transportieren. Die Protagonistinnen in Konzepten zur außerschulischen Arbeit mit Mädchen sind stark und mutig, andere tradierte Bilder von Mädchen z.b. in Jugendzeitschriften sind zum Teil stark sexualisiert. Mädchen bewegen sich vor diesem Hintergrund in einem Dilemma: Auf der einen Seite finden sie patriarchal geprägte Zuschreibungen vor und auf der anderen Seite feministisch konnotierte Anforderungen. Mädchenarbeit, soviel wird hier deutlich, beschreibt mit diesen Standards relativ präzise Anforderungen an das pädagogische Feld, an die Pädagoginnen und an die Klientel selbst. Durch diese ge - schlossene Gestalt, läuft Mädchenarbeit Gefahr, neue pädagogisierte Räume zu schaffen, Mädchensein ein- und abzugrenzen und so wo - möglich an den Bedürfnissen von Mädchen vorbeizugehen und ihnen Ziele und Ideale gleichsam überzustülpen. Ein solches Ideal von Bildung wird den Ansprüchen von Selbstbildung, Selbstreflexion, Selbsttätigkeit und Selbstausdruck wenig gerecht, stehen doch weniger Mädchen mit ihrem Wollen, mit ihrem Selbst im Zentrum, sondern Überlegungen von Pädagoginnen, was gut und was schlecht für Mädchen ist. Von der Bildung zur Partizipation? Um die zuvor skizzierte geschlossene Gestalt der Mädchenarbeit zu öffnen und junge Frauen selbst mehr als bisher in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken, scheint mir ein Perspektivenwechsel vom linearen Bildungsparadigma hin zu mehr Partizipation geboten. Ich zitiere noch einmal aus der Einladung zu dieser Jahrestagung:»Partizipation als konzeptionelles Prinzip der Arbeit setzt sich um in Beteiligungsprojekten, aber auch in der selbstreflexiven Haltung der Pädagogin gegenüber eigenen Mädchenbildern, damit sie Partizipation nicht nur in Übereinstimmung gestalten kann.«dies ist für mich eine sehr gelungene Beschreibung von Partizipation, lese ich in ihr doch ein Plädoyer für die Akzeptanz und Anerkennung von Mädchen in ihrem so sein, auch und gerade wenn sie sich nicht so verhalten, wie es sich die mit ihnen arbeitende Pädagogin vielleicht gerade wünscht. Für die Pädago- 54
55 ginnen beschreibt dies wahrlich eine Herausforderung, denn die Akzeptanz und Anerkennung des Handelns der Mädchen bedeutet ja womöglich auch, das Verhalten von Mädchen auch dann nicht zu sanktionieren, wenn sie sich analog tradierter Geschlechterstereotypen verhalten und sich nun unter Um - ständen auf einer Party im Mädchentreff für das Buffett zuständig fühlen und den ausnahmsweise eingeladenen Jungen den Part des Musikmachens überlassen. Oder wenn sie sich im Rahmen der Programmplanung den 100ten Schminkkurs wünschen. Gründe hierfür müssen ja nicht im Versagen der Pädagogin oder in einer Veränderungsresistenz der Mädchen liegen, sondern schlicht und einfach darin, das Mädchen, insbesondere in der Pubertät und Adoleszenz, andere Dinge im Kopf haben als die Problematik der Geschlechtergerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist in ihrem momentanen subjektiven Empfinden vielleicht gerade nicht das zentrale Problem. Und wenn das so ist, dann muss dies auch akzeptiert werden. Dies kann für die Pädagogin einen»harten Brocken«darstellen, denn die Arbeit mit Mädchen ist, dies haben wir alle hier am eigenen Leib schon erfahren, ein persönlich aufgeladenes Feld und immer sind die Pädagoginnen mit ihren eigenen Lebensgeschichten und ihren eigenen Emanzipationsvorstellungen in die Arbeit mit Mädchen verstrickt. Partizipation als absolute Anerkennung des Subjektstatus von Mädchen und jungen Frauen zu definieren, birgt in der Praxis von Mädchenarbeit jedoch die Chance, Verhaltensweisen von Mädchen und jungen Frauen zu»entpathologisieren«: Mädchen sind aktiv Handelnde im Hier und Jetzt, Mädchen sind nicht einfach Mädchen, sondern sie sind es, weil sie es tun und weil die Pädagoginnen mittun. An die Pädagoginnen stellt dies die Anforderung, das eigene Tun, die eigenen Identifizierungen, Abwehrmechanismen, Deutungsmuster und Verdeckungszusammenhänge immer wieder zu reflektieren. Balanceakt Mädchenarbeit Ich fasse zusammen: Vor dem Hintergrund von Dekonstruktion begreife ich Mädchenarbeit als Balanceakt des Pendelns zwischen dem Aufdecken von Zuschreibungen an Mädchen und der Herstellung neuer Konstruktionen über Mädchen. Mit jedem Gedanken, mit jedem Satz, mit jeder Handlung stellen wir neue Konstruktionen her, analysieren und interpretieren Situ - ationen vor dem Hintergrund unserer Deutungsmuster, inszenieren uns selbst. Dekonstruktion kann uns lehren, dass diese Herstellungsmodi und Deutungsmuster immer verwoben sind mit Macht und Herrschaft und nicht naturgegeben, quasi un - schuldig sind. Ich möchte an dieser Stelle ausdrükklich betonen, dass es mir nicht um eine Abschaffung feministischer Arbeit mit Mädchen geht. Es soll nicht darum gehen, die Arbeit mit Mädchen als eigenständige Zielgruppe von Jugendarbeit aufzugeben, und auch nicht, die Forderungen nach eigenen Räumen und ausreichender finanzieller Ausstattung einzustellen. Mädchenarbeit muss sich jedoch m.e. in ihrer Theorie und Praxis einer Reflexion unterziehen und sich so verändern, dass informelle Praktiken von Mädchen eine weitaus größere Akzeptanz im Rahmen von Mädchenarbeit erfahren und nicht in erster Linie feministische Theorie bzw. dass was Pädagoginnen meinen was gut für Mädchen sei, in den Vordergrund der Arbeit gerückt wird. Mädchenarbeit muss sich mehr als bisher öffnen für Mädchen und ihre jetzt aktuellen Bedürfnisse und sie sollte mit bisherigen Kernpunkten von Mädchenarbeit offener und fließender umgehen. Für den Anspruch von Bildung und Partizipation bedeutet dies, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und sich zu verabschieden von einem linearen Bildungsparadigma hin zu einer Praxis von Partizipation wie sie hier schon formuliert wurde. Das bedeutet nicht, dass es nun gar keine Bildungsangebote für Mädchen geben soll, diese jedoch werden sich aus einer konsequenten Umsetzung des Partizipations- und Beteiligungsgedanken ergeben. Eine weitere Konsequenz, die aus diesem Ansatz von Partizipation zu ziehen ist die, dass Mädchenarbeit ihre Rechtfertigung in erster Linie aus den komplexen Lebensrealitäten von Mädchen und jungen Frauen im Hier und Jetzt bezieht. Bei der Bewältigung der Aufgaben die sich aus ihren Lebenszusammenhängen ergeben, haben sie Anspruch auf eine vielfältige Unterstützung, deren Umfang, Art und Weise von ihnen selbst zu bestimmen sind. Was ich bisher formuliert habe soll jetzt nicht, wie es leider oft ge - schieht, in einem Plädoyer für mehr Offenheit in der pädagogischen Praxis münden, denn damit kann ja kaum jemand etwas anfangen. Die Auseinandersetzung mit der Philosophie um Dekonstruktion hat mich, neben den zuvor skizzierten Aspekten, folgendes, auch für meine eigene Praxis, klipp und klar gelehrt: Als Pädagogin muss ich Mädchen und junge Frauen als Subjekte anerkennen, in ihrer Widersprüchlichkeit. D.h. wenn Mädchen und jun - ge Frauen ihre Bedürfnisse nicht artikulieren können, muss ich sie im 55
56 täglichen Umgang mit ihnen in Erfahrung bringen. Meine Aufgabe als Pädagogin ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Suchbewegungen ihren Raum und ihren Ort haben. Als Pädagogin trage ich Verantwortung dafür, dass das Subjektsein von Mädchen und jungen Frauen öffentlich gemacht wird und ich muss mich für die Akzeptanz des Subjektseins von Mädchen einsetzten. Als Pädagogin muss ich mir immer und immer wieder meine eigenen Konstruktionen über Mädchen be - wusst machen und mich mit meinen Wunschbildern konfrontieren. Daraus folgt, dass ich mir heimliche Messlatten, die ich an das Handeln und an die Selbstinszenierungen von Mädchen lege, transparent mache. Ich muss die Herausforderung annehmen die sich ergibt, wenn Mädchen und junge Frauen so anders sind als es meinen eigenen Vorstellungen entspricht. Wenn ich diese Aspekte zur Ausgangsbasis meines pädagogischen Denkens und Handelns mache und mich frage, was sie für Anforderungen an meine Arbeit mit Mädchen stellen, dann ist dies ein Schritt zu einer verbindlichen Ebene der Übereinkunft, die eine gegenseitige kritische Auseinandersetzung zur Weiterentwicklung von Mädchenarbeit befördern kann. Dies hat dann mit einer inhaltsleeren Floskel nach größerer Offenheit, einer der Postmoderne vorgeworfenen Beliebigkeit, einem»anything goes«nichts gemein. Dr. Andrea Schmidt, Institut für Sozialpädagogik, TU Berlin Literatur: ALLTAG, JULE (1996)»...eigentlich habe ich es schon immer ge - wusst.«lesbisch-feministische Arbeit mit Mädchen und jungen Lesben. Verlag Frühlingserwachen, Hamburg DERRIDA, JACQUES (1986) Positionen. Gespräch mit Jean- Louis Houdebine und Guy Scarpetta. In: Positionen. Gespräche mit Henri Rohse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta. Graz, Wien, Böhlau, S DERRIDA, JACQUES (1988) Die Différance. In: Engelmann, Peter (Hrsg.): Derrida, Jacques: Randgänge der Philosophie. Passagen Verlag, Wien, S DERRIDA, JACQUES (1990) Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. In: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Reclam, Stuttgart, S FRITZSCHE, BETTINA /HARTMANN, JUTTA/SCHMIDT, ANDREA/ TERVOOREN, ANJA (Hrsg.) (2001) Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Leske + Budrich, Opladen GLÜCKS, ELISABETH/OTTEMEYER- GLÜCKS, FRANZ-GERD (Hrsg.) (1994) Geschlechtsbezogene Pädagogik. Votum, Münster KLEES, RENATE/MARBURGER, HELGA/SCHUMACHER, MICHAELA (1992: 2.Auflage) Mädchenarbeit. Praxishandbuch für die Jugendarbeit. Teil 1. Weinheim, Juventa, München KLEES, RENATE/MARBURGER, HELGA/SCHUMACHER, MICHAELA (2000: 4.Auflage) Mädchenarbeit. Praxishandbuch für die Jugendarbeit. Teil 1. Weinheim, Juventa, München MÖHLKE, GABRIELE/REITER, GABI (1995) Feministische Mädchenarbeit gegen den Strom. Votum, Münster Schmidt, Andrea (2002) Balanceakt Mädchenarbeit. Beiträge zu dekonstruktiver Theorie und Praxis. IKO, Frankfurt/M., London 56
57 Regina Rauw DEKONSTRUKTION IN DER MÄDCHENARBEIT EINE HERAUSFORDERUNG FÜR PÄDAGOGINNEN Dokumentation Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. Mädchenarbeit unter den Perspektiven von Bildung und Partizipation Schon seit Jahren erfährt der Ge - schlechterdiskurs durch den Ansatz der Dekonstruktion spannende und wichtige Impulse auf theoretischer Ebene. Doch immer wieder bleibt die Frage offen, wie sich Dekonstruktion und Mädchenarbeit in der pädagogischen Praxis zueinander verhalten. Es scheint sich dabei auf den ersten Blick um einen Widerspruch zu handeln: Dekonstruktion stellt die Konstruiertheit der Kategorie Geschlecht in den Mittelpunkt und kritisiert die Orientierung an eindeutigen geschlechtlichen Identitäten. Mädchenarbeit hingegen knüpft am Begriff bzw. an der Bezeichnung der Menschengruppe»Mädchen«an, und setzt damit in der Regel voraus, dass Geschlecht einen wesentlicher Bestandteil der jeweils eigenen Identität darstellt. Es stellt sich also die Frage, ob eine Verbindung von Mädchenarbeit und Dekonstruktion überhaupt möglich ist, d.h. wie mit diesem Widerspruch umzugehen ist, dass die Kategorie Geschlecht in Frage gestellt wird und diese zugleich den Ausgangspunkt von Mädchenarbeit darstellt. Auf den zweiten Blick müssen wir zunächst die Ebenen unterscheiden, mit denen wir es hier zu tun haben: Dekonstruktion ist ein philosophischer Ansatz, der sich insbesondere erkenntnistheoretisch mit der Frage beschäftigt, wie gesellschaftliche Phänomene (z.b. Geschlecht, Macht, Identität, Kultur, Hierarchie) hergestellt werden. Dabei werden nach Jacques Derrida die beiden Aspekte»destruktiv«und»konstruktiv«miteinander verwoben: Der»destruktive«Aspekt verdeutlicht die Sichtweise, dass es keine Wahrheit, keine objektive Wirklichkeit, keine Eindeutigkeit gibt. Der»konstruktive«Aspekt betont die Existenz von Verweisungszusammenhängen, die für unser Denken und Handeln konstitutiv sind. (vgl. Zirfas, S. 52) Gesellschaftliche Realitäten gestalten also unser Leben/ unseren Alltag (konstruktiv), sind aber nicht aus sich heraus existent oder wahr, sondern veränderbar (destruktiv). Bezogen auf die Geschlechterfrage versuche ich damit eine für das weitere Verständnis zentrale Kernaussage der Dekonstruktion herauszufiltern: Die Kultur der Zweigeschlechtlichkeit gestaltet unser gesellschaftliches Leben, beruht aber nicht auf einer objektiven Wahrheit und existentiellen Wesenhaftigkeit von Geschlecht und ist folglich veränderbar bzw. grundsätzlich überwindbar. Von hier aus kommen wir dann zur Ebene der Mädchenarbeit, dass heißt zu pädagogischen Konzepten und Handlungsweisen von Pädagoginnen, wobei ich mich hier auf die außerschulische Bildungsarbeit mit Mädchen beziehe, die in einem parteilich-feministischen Kontext steht. Mit dem obigen Verständnis von Dekonstruktion können wir nun Mädchenarbeit durchforsten und die Übertragbarkeit prüfen. Weil dies häufig in der Umsetzung für Missverständnisse sorgte, möchte ich besonders betonen, dass die 57
58 dekonstruktiven Ansätze nicht die Existenz von Geschlecht als gesellschaftliches Phänomen bestreiten. Sie weisen»lediglich«ausdrücklich auf die Konstruiertheit und Wirkungsweisen dieser scheinbaren Selbstverständlichkeiten hin. Und dies gilt es als philosophische Denkbewegung in die Betrachtungsweise von Mädchenarbeit zu integrieren.»für die Praxis ist die Frage von Bedeutung, was ein Mädchen ausmacht und um einen veränderten Identitätsbegriff zu ermöglichen wie das Konstrukt Mädchen zu dekonstruieren ist. Den Begriff Mäd chen zu dekonstruieren bedeutet, die Existenz der Kategorie Geschlecht zwar als gesellschaftliche Realität zu erkennen, aber nicht mehr definieren zu können, was Mädchen sind.«(howard, S. 305) Es geht also im folgenden nicht mehr um die Frage, ob es mit einem dekonstruktiven Erkenntnishintergrund überhaupt noch Mädchenarbeit geben kann oder geben soll, sondern darum, wie Mädchenarbeit gestaltet sein muss, damit sie der Dekonstruktion entspricht (und nicht widerspricht). Mädchenarbeit trägt weder per se zur Dekonstruktion bei noch verunmöglicht sie diese. Es kommt statt dessen auf die Qualität von Mädchenarbeit an, d.h. darauf, auf welchem Hin - tergrund und in welcher Weise eine Pädagogin Interaktionen und Kommunikation mit Mädchen gestaltet. Diese Qualität soll anhand einiger zentralen Thesen aus dem dekonstruktiven Denkgebäude auf die Praxis heruntergebrochen werden, bzw. soll die Praxis mit dem Gedankengut der Dekonstruktion kritisch»durchgebürstet«werden. 1. These: Geschlecht ist ein Konstrukt, d.h.»mädchen«hat keine essentielle Bedeutung Diese Aussage fordert Pädagoginnen genau zu jener Denkbewegung heraus, die eigenen Konstruktionen von Geschlecht zu erkennen. Damit sind sowohl die Konstruktion»Mäd chen«gemeint (Spätestens bei dem Gedanken, dass jemand sich nicht verhält, wie ein»richtiges«mädchen, treten unsere Konstruktionen deutlichst zutage.) als auch jene von»weiblichkeit«und des verbindenden und zugleich ausschließenden»wir Frauen«. Will Mädchenarbeit dekonstruktiv sein, so darf sie Mädchen nicht auf ein Bild von Mädchen-Sein festlegen, weder auf das»klassische, angepasste«noch auf das»aufmüpfige, widerspenstige«mädchen. Auch die Mädchen selbst zu kategorisieren als die»braven«und die»bösen«, die»deutschen«und die»ausländischen«etc. trägt im - mer wieder zu einer Festlegung von statischen Identitäten und den ihnen anhängenden Typisierungen bei. Mädchenbilder spiegeln sich in der Praxis zum Beispiel in einem durch die Pädagogin gestalteten Mädchenraum wider, d.h. in der Projektion von bestimmten Interessen und Gemeinsamkeiten von Mädchen (z.b. in der Annahme, Mädchen legten Wert auf Atmosphäre). Welche Vorannahmen auch immer, sie verstellen den Blick auf die le - ben digen Mädchen und stellen Projektionen eigener Erwartungen dar, wie sich Mädchen als Ergebnis einer weiblichen Sozialisation darstellen würden. Wenn sich die These der Konstruiertheit von Geschlecht in der Mädchenarbeit niederschlagen soll, so bedeutet dies, den Raum, die Angebote, die Möglichkeiten möglichst weit zu (er-)öffnen, damit Mädchen diese selbst gestalten können. Partizipation von Mädchen ist somit eine unerlässliche Bedingung für eine dekonstruktive Mädchenarbeit. So können anstelle eines Konstruktes von Mädchen-Sein die Interessen der Mädchen zum Ausgangspunkt werden. Für die Pädagogin bedeutet dies, die Offenheit herzustellen und auszuhalten, nicht zu wissen, mit welchen Bedürfnissen sich die jeweiligen Mädchen einbringen werden. Je weniger die Optionen in der Mädchenarbeit durch Mädchenbilder eingeengt sind, umso stärker wird sich auch die Vielfalt der Mädchen entfalten können. Dies entsteht zum einen schon dadurch, dass im geschlechtshomogenen Setting weniger Automatismen funktionieren, Mädchen und Jungen als polare Ergänzung zu definieren und auf ein binäres Schema zu reduzieren (Mädchen sind das, was Jungen nicht sind). Gerade in geschlechtshomogenen Gruppenzusammensetzungen kann es möglich werden, Vorstellungen von Homogenität zu entlarven, wenn Differenz und Differenzen zwischen Mädchen (und zwischen Frauen) erlaubt und sichtbar werden. Das»Differenz-Erlauben«kann zum Beispiel in der Praxis heißen, dass Konflikte in der Mädchenarbeit ausgetragen werden und Streiten gelernt wird, an - statt Konflikte insbesondere unter Mädchen negativ zu bewerten. Auch Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Einstellungen bzw. Lebenskonzepte zwischen der Pädagogin und (einem) Mädchen können in diesem Sinne transparent und konstruktiv genutzt werden, wenn sie frei sind von einem Maßstab für das allgemeingültig»richtigere«weiblichkeitskonzept. 58
59 2. These: Geschlecht wird diskursiv hergestellt (doing gender), d.h. Mädchen»tun«Geschlecht Für die Pädagogin bedeutet die Konsequenz aus dieser These eine Sichtweise auf sich selbst und die Mädchen, nach der das jeweilige Verhalten nicht als Ausdruck einer wesensmäßigen Prägung verstanden wird, sondern als Inszenierung des Selbst in Relation zum gesellschaftlichen Konzept von Weiblichkeit und zu den jeweiligen Umständen (Diskursivität des Handelns). Kulturelle Normierungen stellen einen Rahmen von legitimierter Weiblichkeit zur Verfügung, zu dem sich Mädchen und Frauen mit ihrem Handeln in Beziehung setzen, sei es durch Anpassung oder Widerstand. Auch hier trägt die Selbstreflexion zu einem besseren Verständnis der Zielgruppe bei, d.h. sich selbst zu fragen, wie ich mein Geschlecht unter welchen Bedingungen inszeniere. Ändere ich z.b. meine Selbstdarstellung (Körpersprache, Kleidung, Haltung etc.) im Beisein von Männern? Wie bewerte ich selber meine unterschiedlichen Strategien? Wie sehr bin ich mir meiner eigenen Handlungskompetenz auch in Hinblick auf die Herstellung von Ge - schlecht bewusst, oder wann und warum denke ich, ich kann nicht anders? Rollenspiele und Verkleidungsaktionen sind in der Mädchenarbeit eine gute Möglichkeit, den Inszenierungscharakter von Geschlecht erlebbar zu machen, vorausgesetzt es wird eine große Bandbreite von alternativen Rollen bzw. Kleidungen angeboten. Und auch hier darf ich eine»lieblingsrolle«haben, mit der ich mich besonders wohl fühle. Das Experimentieren mit Alternativen ist in diesem Sinne schon lange ein Beitrag der Mädchenarbeit zur Dekonstruktion. Ein wichtiger neuer Impuls scheint mir hier zu sein, dass es nicht mehr darum geht, eine Alternative zum klassischen Weiblichkeitskonzept als den»besseren Weg«zu bewerten, sondern den Fokus auf die Wahlmöglichkeit selber zu legen, d.h. auf die jeweilige subjektive Bewertungs- und Entscheidungskompetenz der Mädchen. Wenn Mädchen erfahren, dass Mädchen-Sein nicht einfach mit ihnen geschieht, sondern dass sie selbst die Handelnden in diesem Spiel sind, so ist dies eine wesentlicher Beitrag zur Selbstbestimmung, welche die Relevanz von Konstrukten entmächtigt. 3. These: Neben der Konstruktion Ge - schlecht wirken auch andere Kategorien mit ähnlichen Wirkungsmechanismen Die Lebensumstände von Mädchen sind vieldimensional und bei weitem nicht nur durch die Strukturkomponente Geschlecht bestimmt. Andere Konstrukte wie Rasse, Kultur, Schicht, Behinderung, sexuelle Orien tierung etc. durchdringen ebenso unseren gesellschaftlichen Kontext. Die kollektiven Denkstrukturen von Dualismus und Hierarchie bilden den gemeinsamen Hintergrund dieser Kategorien. Für Pädagoginnen entsteht hierdurch die Herausforderung, die eigene Eingebundenheit in die verschiedenen Kategorien zu erkennen und Erfahrungen des Diskriminiert- Seins sowie des Diskriminierens zu reflektieren. Ein Knackpunkt dabei liegt darin, diese Strukturen auch aus der Perspektive der dominanten Position heraus wahrzunehmen, d.h. sie nicht nur dann zu erkennen und zu benennen, wenn ich zu der Gruppe der strukturell Benachteiligten gehöre (z.b. als Frau, als Lesbe, als Migrantin, als Arbeiterkind etc.), sondern auch, wenn ich zur kulturell privilegierten Gruppe gehöre (z.b. als deutsche Staatsbürgerin, als Weiße, als körperlich nicht Beeinträchtigte). Wenn Mädchenarbeit qualitativ dieser These entsprechen will, so gilt es, die verschiedenen Dimensionen der subjektiven Lebensumstände der Mädchen bewusst einzubeziehen, d.h. den Blick auf Rassismen und andere Diskriminierungen ge - nauso wichtig und selbstverständlich einzunehmen wie auf Sexismus und die Geschlechterfrage. Rassismus ist kein»unterthema«im»hauptthema«geschlecht, denn es darf keine Hierarchisierung zwischen den Kategorien entstehen. Auf die Praxis übertragen»erleichtert«diese Enthierarchisierung Mädchenarbeit von der selbstauferlegten Pflicht, in ihren Inhalten mit Priorität solche anzubieten, die Geschlecht und Mädchen-Sein thematisieren. Es entsteht eine größere Offenheit, in der Orientierung an den Interessen der Mädchen und ihren Lebensumständen genau jene Inhalte und Themen in den Mittelpunkt zu stellen, die den beteiligten Mädchen subjektiv entsprechen und wichtig sind. Wieder ist hier die Neugier auf die jeweiligen Mädchen in ihren sozialen Bezügen als Haltung der Pädagogin und die Einladung zur Partizipation als unabdingbaren Bestandteil von Mädchenarbeit anzusehen. Damit sei nicht gegen die Thematisierung von geschlechtsspezifischen Inhalten gesprochen wie z.b. Menstruation, Schwangerschaft, geschlechtsbezogene Diskriminierung und Gewalt, wenn sie für die beteiligten Mädchen von Interesse sind. Die Qualität von Mädchenarbeit bestimmt sich aber nicht durch gerade diese Themen, sondern dadurch, dass Mädchen in der Vieldimensionalität ihrer Entwicklung gesehen und begleitet werden. 59
60 4. These: Vereindeutigungen, insbesondere Dualismen und Ausschluss, produzieren Herrschaftsverhältnisse Im Zentrum der dekonstruktiven Denkweise steht die Kritik an Hierarchien, die durch die Vereindeutigung in einem bipolaren Schema entstehen. Diese dualistischen Zuordnungen lassen sich nur durch Ausgrenzung der Vielfalt herstellen. Bezogen auf das Geschlechterverhältnis werden Männlichkeit und Weiblichkeit als Gegensatzpaar vereindeutigt und damit der legitime Rahmen von Geschlechtsidentität vorgegeben. Zwischentöne und Ambivalenzen werden nicht zur Wahrnehmung zugelassen sondern ausgegrenzt oder umgedeutet und angepasst. Für die Mädchenarbeit muss folglich nun überprüft werden, wo sie selbst zu Vereindeutigungen beiträgt. Dies lässt sich zum Beispiel anhand verschiedener Ausschreibungen von Mädchenprojekten eruieren. Wie offen sind diese An - gebote tatsächlich für die unterschiedlichen Mädchen, oder erwecken sie den Eindruck, dass indirekt bestimmte Mädchen eingeladen sind, ohne dass dies deutlich benannt wird? Auch entstehen in der Mädchenarbeit (ebenso wie in anderen pädagogischen Kontexten) immer dann Polarisierungen, wenn zwei Gruppen konstruiert werden: die deutschen und die ausländischen Mädchen, die heterosexuellen und die lesbischen Mädchen, die benachteiligten und die gebildeten Mädchen usw. Hiermit wird zum einen suggeriert, die Gruppen ließen sich eindeutig voneinander abgrenzen, zum anderen, innerhalb der jeweiligen Gruppe gäbe es eine innere Homogenität. Doch was ist mit den Un - entschiedenheiten, den Differenzen innerhalb des einen Pols, den Kontinuen zwischen den Polen? Und was ist mit den Bewertungen der beiden Pole, die gesellschaftlich oft schon eindeutig vorgegeben sind, oder in pädagogisch- sozialen Kreisen oft eben genau umgedreht werden (»Die beste Mädchenarbeiterin ist die lesbische Migrantin«)? Aber auch damit ist die Hierarchisierung und Dualität nicht überwunden. Weitere Polarisierung finden statt, wenn Männlichkeit mit Täter-Sein und Weiblichkeit mit Opfer-Sein in eine kontinuierliche Parallelität gesetzt wird. Dies konnte ich selbst in einer Evaluation einer von mir und in der»alten Molkerei Frille«häufig eingesetzten Methode feststellen. In dem Spiel werden in verschiedenen Themenfeldern (Schule, Eltern, Politik, Sexualität, Freundschaft) neben Meinungsfragen und Gruppenaktionen problematische Alltagssituationen vorgegeben, die von den Mädchen im Rollenspiel weiter entwickelt werden sollen, um alternative Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die Auswertung brachte zutage, dass in den Vorgaben Jungen und Männer fast ausschließlich als (potentielle) Täter von (sexueller) Gewalt vorgegeben waren, Mädchen hingegen als Opfer. Hiermit wird den Mädchen eine Polarisierung vermittelt, nach der Mädchen als Täterinnen und Jungen als Opfer bzw. als Unterstützer und Freund nicht vorkommen oder zumindest in der Mädchenarbeit keinen Stellenwert haben. Damit möchte ich natürlich nicht bestreitet, dass Gewalt insbesondere sexuelle im häufigsten Fall von Männern ausgeübt wird. Aber Mädchenarbeit könnte hier einen Beitrag leisten, aufzuzeigen, dass Männlichkeit nicht zwangsläufig mit Gewalt verbunden ist, und Weiblichkeit eben nicht zwangsläufig mit dem Opferstatus. Aus dieser Sichtweise ergibt sich im weiteren die Konsequenz, die Beteiligung von Frauen und Mädchen an Macht -und Herrschaftsverhältnissen wahrzunehmen. Auch Mädchen können untereinander ausgrenzend und verletzend sein, sie können Jungen ärgern, schikanieren oder gewalttätig sein und dies wird nicht besser aber auch nicht noch schlimmer dadurch, dass die Mädchen sind. 5. These: Auch»Männlichkeit«ist ein Konstrukt Mit dieser (simplen) These verfolge ich die Intention, durch die Beschäftigung mit Dekonstruktion neue bzw. erweiterte Zusammenhänge in bezug auf die Geschlechterfrage zwischen Frauen und Männern zu ermöglichen. Geht es um die Herstellungspraxis von Geschlecht, so sind Mädchen wie Jungen, Frauen wie Männer daran beteiligt. Alle unterliegen der Norm, dass Identitätsentwicklung in unserer Kultur unmittelbar mit dem Zwang zu einer eindeutigen Geschlechtsidentität verbunden ist. Auf dem Hintergrund der dekonstruktiven Denkbewegung bietet es sich an, auch für die pädagogische Arbeit eine gemeinsame konzeptionelle Grundlagen von Jungen- und Mädchenarbeit zu entwickeln. Interessant sind in diesem Kontext auch Überschneidungen in Hinblick auf die Fragen, welches Frauenbild die Jungenarbeit und welches Männerbild die Mädchenarbeit vermittelt. Wird auch Männlichkeit als Konstrukt angesehen, was sich selbstverständlich auf theoretischer Ebene erschließt, so heißt dass, auch das Verhalten von Jungen als kontextgebundene Inszenierung des Selbst in Relation zum gesellschaftlichen Konzept von Männlichkeit zu erkennen. Damit ist für die pädagogische Arbeit der Abschied 60
61 von Jungenbilder auch von Seiten der Pädagoginnen gefragt. Mir ist klar, dass im Alltag eine inhaltlichkonzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Mädchen- und Jungenarbeit schon häufig daran scheitert, dass zu wenig qualifizierte und motivierte Männer für die Arbeit mit Jungen vorhanden sind. Wenn es diese aber geben sollte, könnte ein gemeinsames geschlechtsbezogenes Konzept auf dem Hintergrund der Dekonstruktion durchaus auch hin und wieder koedukative Elemente beinhalten. Wenn zum Beispiel Mädchen und Jungen die Erfahrung machen, dass sie auch gemeinsam Henna-Tattoos oder ein Lagerfeuer machen können, ohne dass die konstruierten Normalitäten weiterhin funktionieren, so halte ich das für eine sehr gelungene Aktion. Dies ist aber nur möglich, wenn Mädchen- und Jungenarbeit hier die Voraussetzungen geschaffen haben, das»sichere Korsett«der eindeutigen Geschlechterpolarität zu verlassen. Unter diesen Bedingungen ist koedukatives Arbeiten dann kein konzeptioneller Rückschritt, sondern ein neues qualitatives Niveau in der Jugendarbeit, welches geschlechtliche Konstrukte bewusst angeht, anstatt sie in geschlechtsneutraler Normalität weiterhin zu verfestigen. Diese Ebene halte ich auch deshalb für wichtig, damit Mädchen- und Jungenarbeit sowie geschlechtsbezogener Pädagogik von allen Beteiligten als Qualitätsmerkmal der Jugendhilfe angesehen wird und nicht als zusätzliches Angebot neben bzw. außerhalb der»allgemeinen«jugendarbeit. Was wird aus der Parteilichkeit mit Mädchen? Abschließend möchte ich das zentrale Paradigma der Parteilichkeit in der Mädchenarbeit mit dem dekonstruktiven Gedankengut hin und her wenden und auf seine Aktualität hin überprüfen. Verstehen wir die Zweigeschlechtlichkeit als ein gesellschaftliches Konstrukt, ein Produkt unserer Sprache, unseres Denkens, unserer Kultur und unseres Verhaltens, so hat schon der Begriff»Mädchen«keinen essentiellen Kern, keine absolute Wahrheit mehr -wie viele andere Begriffe auch nicht mehr. Folglich kann sich Parteilichkeit auch nicht mehr per se auf Mädchen aufgrund ihres Geschlechts als objektive Wirklichkeit beziehen. Dennoch ist aber Geschlecht eine gesellschaftlich veränderbare Realität, die in unsere Entwicklung und den sozialen Charakter unseres Seins hinein wirkt. So sind vom»do ing gender«alle Menschen unserer Kultur betroffen, denn im jetzigen Kontext gibt es keine Identitätsentwicklung außerhalb der Geschlechtlichkeit (kein»undoing gender«). In diesem Sinne müssen sich alle Kinder- und Jugendlichen in ihrer Entwicklung mit den vergeschlechtlichten Sozialisationserwartungen auseinandersetzen. Jene, bei denen ein weiblicher Körper unterstellt wird, nennen wir sie Mädchen, müssen sich insbesondere mit der Konstruktion von Weiblichkeit auseinandersetzen. Parteilichkeit ist aus meiner Sicht weiterhin eine der wichtigen pädagogischen Haltungen in der Mädchenarbeit, wenn sie sich auf die Erfahrung bezieht, sich mit der Konstruktion von Weiblichkeit auseinandersetzen zu müssen. Die Art der Auseinandersetzungen, die Mädchen und Frauen zeigen, sind sehr differenziert und lassen keine Subsummierung in einer homogenen Gruppe zu. Doch der Druck, sich auseinander setzen zu müssen, sich zu Weiblichkeit verhalten und in Beziehung setzen zu müssen, stellt aus meiner Sicht eine Gemeinsamkeit dar, auf deren Basis eine parteiliche Haltung nach wie vor möglich und nötig ist. Dekonstruktion über Mädchenarbeit hinaus Auf dem Hintergrund der Dekonstruktion wird in den letzen Jahren gerade die Mädchenarbeit und die geschlechtsbezogene Pädagogik kritisch hinterfragt, ob sie nicht durch den konzeptionellen Rückbezug auf Geschlecht eben diese Kategorie verfestigt, die zu hinterfragen sie selbst angetreten ist. Ich halte diesen Vorwurf für nicht haltbar, denn zum einen beobachte ich in der Praxis, dass an einigen Orten Mädchenarbeit den von mir in diesem Beitrag aufgestellten Qualitätskriterien entspricht und Pädagoginnen sich den Herausforderungen der Dekonstruktion als Denkbewegung und Reflexionsimpuls stellen. Zum anderen hat auch Mädchenpolitik in ihrem Einwirken auf die Jugendhilfe an manchen Punkten»dekonstruktivistische«Forderungen aufgestellt, wenn diese auch nicht immer in diesem Sinne verstanden wurden. Mit dem theoretischen Rückbezug auf feministische Theorien hat die Mädchenpolitik in der pädagogischen Arbeit Impulse gesetzt, Geschlecht zu thematisieren und die Geschlechtsneutralität der Jugendarbeit als eine Orientierung am männlichen Maßstab zu entlarven. Dass Mädchen als Zielgruppe der Jugendarbeit bewusst eingefordert wurden, hat die Ju - gendhilfe insofern qualifiziert, dass 61
62 die Kategorie Geschlecht überhaupt thematisiert wurde. Dekonstruktion findet eben dann gerade nicht statt, wenn so getan wird, als gäbe es Geschlecht nicht, bzw. als wäre Geschlecht nicht relevant. Dekonstruktion bedeutet, die Denkgewohnheiten von Geschlecht als solche zu erkennen und gleichzeitig deren Relativität, Kontextgebundenheit und Veränderbarkeit in den Blick zu nehmen. Doch dieser Prozess hat bezogen auf die Jugendhilfe als Ganzes gerade erst begonnen. Für die Zukunft halte ich es für angebracht, die verschiedenen Handlungsfelder der Jugendhilfe anhand der dekonstruktivistischen Denkansätze zu überprüfen und zu qualifizieren. Partizipationsmöglichkeiten und Subjektorientierung sind in diesem Sinne Prüfsteine, ob die Jugendarbeit die Jugendlichen in ihren vieldimensionalen Lebensbedingungen begleitet und unterstützt. Wenn PädagogInnen diese Herausforderung annehmen, wird sich die Jugendhilfe verändern und beleben, so dass mehr Kinder und Jugendliche darin eine Begleitung erleben. Regina Rauw, Diplom-Pädagogin; pädagogische Mitarbeiterin im Leitungsteam der Heimvolkshochschule»Alte Molkerei Frille«, Leitung des Instituts für Gender- Perspektiven an der»alten Molkerei Frille«; 1999 bis 2002 Vorstandsfrau der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. Literatur: JENNY HOWALD: Ein Mädchen ist ein Mädchen ist kein Mädchen? Mögliche Bedeutungen von»queer Theory«für die feministische Mädchenarbeit. In: Bettina Fritzsche, Jutta Hartmann, Andrea Schmidt, Anja Tervooren (Hrsg.): Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen 2001, S REGINA RAUW, OLAF JANTZ, ILKA REINERT, FRANZ GERD OTTEMEIER-GLÜCKS: Perspektiven geschlechtsbezogener Pädagogik. Impulse und Reflexionen zwischen Gender, Politik und Bildungsarbeit. Reihe Quersichten, Band 1. Opladen 2001 REGINA RAUW, ILKA REINERT: Perspektiven der Mädchenarbeit. Partizipation, Vielfalt, Feminismus. Reihe Quersichten, Band 2. Opladen 2001 JÖRG ZIRFAS: Identitäten und Dekonstruktionen. Pädagogische Überlegungen im Anschluss an Jacques Derrida. In: BETTINA FRITZSCHE, JUTTA HARTMANN, ANDREA SCHMIDT, ANJA TERVOOREN (Hrsg.): Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen 2001, S L A G N e w s L A G N e w s Wir wollen weitermachen Spendenaktion zum Erhalt der LAG Geschäftsstelle»Wir wollen weitermachen«sagten sich die Teilnehmerinnen der Mitgliedsversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. am in Siegen und hatten damit gleich den Namen für die von ihnen geschaffene Spendenaktion gefunden. Unser Reichtum sind u.a. unsere mittlerweile über 100 Mitglieder, sowie zahlreiche weitere UnterstützerInnen und FreundInnen der Mädchenarbeit. Die Idee ist, dass all diese Verbündeten ausgestattet mit einer Postkarte und Infomaterial ihre Kontakte zu Freundinnen, (Groß)Müttern, KollegInnen, Fachfrauen, Vereinen und PolitikerInnen nutzen, um SpenderInnen für die LAG zu gewinnen. Wenn 100 Mitglieder jeweils fünf SpenderInnen gewinnen haben wir schon 500 SpenderInnen! Wir brauchen Ihre/eure Unterstützung! Postkarten und Infomaterial gibt es bei der LAG Geschäftsstelle und unter / Uhr in Wuppertal Perspektiven für die Mädchenarbeit in Nordrhein Westfalen Einladung zur Mitgliedsversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. am 25. Februar 2004 von 10 bis 16 Uhr. Wie schon bei der Mitgliedsversammlung im November 2003 in Siegen möchten wir Netze und Ideen spinnen, um die Mädchenarbeit in NRW abzusichern. Für uns soll s Geld und Rosen regnen! Mit herzlichem Dank Der Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.v. und die Projektgruppe»Wir wollen weitermachen«62
Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit...
 Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit... Zur Erinnerung: GM bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet...... grundsätzlich danach zu fragen, wie sich Maßnahmen und Gesetzesvorhaben
Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit... Zur Erinnerung: GM bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet...... grundsätzlich danach zu fragen, wie sich Maßnahmen und Gesetzesvorhaben
Leitbild Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Freiburg
 Leitbild Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Freiburg Stand 21.11.2011 Präambel Die Stadt Freiburg schafft und erhält positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-,
Leitbild Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Freiburg Stand 21.11.2011 Präambel Die Stadt Freiburg schafft und erhält positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-,
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Zum pädagogischen Umgang mit Gleichheit und Differenz
 Zum pädagogischen Umgang mit Gleichheit und Differenz Fallstricke und Ambivalenzen Christine Riegel (Uni Tübingen) 33. Sozialpädagogiktag Differenz und Ungleichheit. Diversität als Herausforderung für
Zum pädagogischen Umgang mit Gleichheit und Differenz Fallstricke und Ambivalenzen Christine Riegel (Uni Tübingen) 33. Sozialpädagogiktag Differenz und Ungleichheit. Diversität als Herausforderung für
Für den gewerkschaftlichen Kontext adaptiert von der AG Gender Mainstreaming des VÖGB.
 Qualitätskriterien für genderkompetente gewerkschaftliche Bildungsarbeit Quelle: bm:ukk (Hg.): Gender Kompetenz & Gender Mainstreaming. Kriterienkatalog für Schulen. Erstellt im Rahmen des Projektes GeKoS,
Qualitätskriterien für genderkompetente gewerkschaftliche Bildungsarbeit Quelle: bm:ukk (Hg.): Gender Kompetenz & Gender Mainstreaming. Kriterienkatalog für Schulen. Erstellt im Rahmen des Projektes GeKoS,
Geschlechterdifferenzierung Gender Mainstreaming
 Geschlechterdifferenzierung Gender Mainstreaming FUMA Fachstelle Mädchenarbeit NRW Cäcilia Debbing Fachstelle Jungenarbeit NRW Dr. Christoph Blomberg 1 Wie kam es zu Gender Mainstreaming? Seit den 80er
Geschlechterdifferenzierung Gender Mainstreaming FUMA Fachstelle Mädchenarbeit NRW Cäcilia Debbing Fachstelle Jungenarbeit NRW Dr. Christoph Blomberg 1 Wie kam es zu Gender Mainstreaming? Seit den 80er
Seite 1. Grußwort PSt in Marks
 Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Wege zu einer geschlechtergerechten Schule. Dr. Jürgen Budde Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland Januar 2008
 Wege zu einer geschlechtergerechten Schule Dr. Jürgen Budde Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland Januar 2008 1. Was meint doing gender? Er oder Sie? Sie sehen im Folgenden sechs Fotos. Entscheiden Sie
Wege zu einer geschlechtergerechten Schule Dr. Jürgen Budde Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland Januar 2008 1. Was meint doing gender? Er oder Sie? Sie sehen im Folgenden sechs Fotos. Entscheiden Sie
Jungs und Mädchen im naturwissenschaftlichtechnischen
 Jungs und Mädchen im naturwissenschaftlichtechnischen Unterricht 2. SWiSE Innovationstag 5. März 2011 Dorothee Brovelli PHZ Luzern Überblick 1. Ausgangslage 2. Ziele der Mädchenförderung im Bereich Technik
Jungs und Mädchen im naturwissenschaftlichtechnischen Unterricht 2. SWiSE Innovationstag 5. März 2011 Dorothee Brovelli PHZ Luzern Überblick 1. Ausgangslage 2. Ziele der Mädchenförderung im Bereich Technik
Interkulturelle Kompetenz
 Interkulturelle Kompetenz für Bildungspatenschaften Christa Müller-Neumann Mainz, 01. Dezember 2011 Fragestellungen Was ist Interkulturelle Kompetenz Ein Blick auf die Zielgruppe der Aktion zusammen wachsen
Interkulturelle Kompetenz für Bildungspatenschaften Christa Müller-Neumann Mainz, 01. Dezember 2011 Fragestellungen Was ist Interkulturelle Kompetenz Ein Blick auf die Zielgruppe der Aktion zusammen wachsen
Meine Damen und Herren,
 Starke Bibliotheken! Aspekte einer gemeinsamen Bibliotheksstrategie NRW Grußwort von Frau Ministerin Ute Schäfer zur gemeinsamen Bibliothekskonferenz des MFKJKS und des vbnw 15. Januar 2014 Sehr geehrter
Starke Bibliotheken! Aspekte einer gemeinsamen Bibliotheksstrategie NRW Grußwort von Frau Ministerin Ute Schäfer zur gemeinsamen Bibliothekskonferenz des MFKJKS und des vbnw 15. Januar 2014 Sehr geehrter
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Bremer Erklärung zur Bedeutung von Kinder- und Jugendarbeit
 1 Bremer Erklärung zur Bedeutung von Kinder- und Jugendarbeit Am 16. September 2009 fand zum Thema Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung an der Hochschule Bremen der 1. Bremer
1 Bremer Erklärung zur Bedeutung von Kinder- und Jugendarbeit Am 16. September 2009 fand zum Thema Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung an der Hochschule Bremen der 1. Bremer
LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF
 LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF 2013 2017 Präambel: Zur Zielgruppe der Jugendarbeit Regensdorf gehören Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren. Die Jugendarbeit ist ein freiwilliges
LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF 2013 2017 Präambel: Zur Zielgruppe der Jugendarbeit Regensdorf gehören Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren. Die Jugendarbeit ist ein freiwilliges
Interkulturelle Orientierung von Bildungspatenschaften und Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen Mousa Othman
 Interkulturelle Orientierung von Bildungspatenschaften und Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen Mousa Othman Saarbrücken, 27. September 2011 RAA-Netzwerk in NRW Regionale Arbeitsstellen zur Förderung
Interkulturelle Orientierung von Bildungspatenschaften und Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen Mousa Othman Saarbrücken, 27. September 2011 RAA-Netzwerk in NRW Regionale Arbeitsstellen zur Förderung
KINDER- JUGEND- UND BETEILIGUNG.
 KINDER- UND JUGEND- BETEILIGUNG www.jugendbeteiligung.at Was bedeutet Kinder- und Jugendbeteiligung? Was bewirkt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen? Eine funktionierende Demokratie braucht Beteiligung
KINDER- UND JUGEND- BETEILIGUNG www.jugendbeteiligung.at Was bedeutet Kinder- und Jugendbeteiligung? Was bewirkt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen? Eine funktionierende Demokratie braucht Beteiligung
Barbara Stauber. Zwischen Erfolgs- und Looser-Skript: Lebenslagen und Bewältigungsstrategien von Mädchen und jungen Frauen
 Barbara Stauber Zwischen Erfolgs- und Looser-Skript: Lebenslagen und Bewältigungsstrategien von Mädchen und jungen Frauen Vortrag im Rahmen der Fachtagung Flotte Lotte am 22. Februar 2008, im Haus der
Barbara Stauber Zwischen Erfolgs- und Looser-Skript: Lebenslagen und Bewältigungsstrategien von Mädchen und jungen Frauen Vortrag im Rahmen der Fachtagung Flotte Lotte am 22. Februar 2008, im Haus der
PISA Lesekompetenz (Teil 1)
 PISA Lesekompetenz (Teil 1) PISA-Punkte* und geschlechtssprezifischer Unterschied, ausgewählte europäische Staaten, Erhebung 2009 PISA-Punkte* insgesamt Vorsprung der Mädchen in Punkten Finnland 536 55
PISA Lesekompetenz (Teil 1) PISA-Punkte* und geschlechtssprezifischer Unterschied, ausgewählte europäische Staaten, Erhebung 2009 PISA-Punkte* insgesamt Vorsprung der Mädchen in Punkten Finnland 536 55
Perspektiven muslimischer Eltern auf Bildung und Schule wahrnehmen Elternbeteiligung stärken
 Perspektiven muslimischer Eltern auf Bildung und Schule wahrnehmen Elternbeteiligung stärken Meryem Uçan und Dr. Susanne Schwalgin Fachtagung des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg
Perspektiven muslimischer Eltern auf Bildung und Schule wahrnehmen Elternbeteiligung stärken Meryem Uçan und Dr. Susanne Schwalgin Fachtagung des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg
Eine Pädagogik der Inklusion
 Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Gender-Mainstreaming Arbeitshilfe/Fragebogen zur Antragsstellung von LOS-Projekten (Entwurf Stand: )
 Gender-Mainstreaming Arbeitshilfe/Fragebogen zur Antragsstellung von LOS-Projekten (Entwurf Stand: 26.1.2007) Die ersten Fragen gehen von der Annahme aus, dass Gender Mainstreaming keine isolierte Betrachtungsweise
Gender-Mainstreaming Arbeitshilfe/Fragebogen zur Antragsstellung von LOS-Projekten (Entwurf Stand: 26.1.2007) Die ersten Fragen gehen von der Annahme aus, dass Gender Mainstreaming keine isolierte Betrachtungsweise
Mädchen und junge Frauen in der rechten Szene Erfahrungen von SozialarbeiterInnen in Sachsen. Prof. Dr. Gudrun Ehlert
 Mädchen und junge Frauen in der rechten Szene Erfahrungen von SozialarbeiterInnen in Sachsen Prof. Dr. Gudrun Ehlert Projekt Mädchen und Frauen für ein tolerantes Sachsen Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchen und junge Frauen in der rechten Szene Erfahrungen von SozialarbeiterInnen in Sachsen Prof. Dr. Gudrun Ehlert Projekt Mädchen und Frauen für ein tolerantes Sachsen Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft
Inklusion von Anfang an
 Inklusion von Anfang an Herausforderungen für die Kita Jun. Prof. Dr. Timm Albers, Karlsruhe Kompetent für Inklusion 2. Wiff-Bundeskongress für Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik Berlin, den 17./18.
Inklusion von Anfang an Herausforderungen für die Kita Jun. Prof. Dr. Timm Albers, Karlsruhe Kompetent für Inklusion 2. Wiff-Bundeskongress für Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik Berlin, den 17./18.
Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk
 Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk März 2006 1 Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung Wir als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im
Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk März 2006 1 Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung Wir als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im
Jugendliche in neuen Lernwelten
 Peter Wahler Claus J.Tully Christine Preiß Jugendliche in neuen Lernwelten Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung 2., erweiterte Auflage VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
Peter Wahler Claus J.Tully Christine Preiß Jugendliche in neuen Lernwelten Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung 2., erweiterte Auflage VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
Fachtag. Schul - sozialarbeit. in NRW , 10:30-15:30 Uhr KGS Thomas Schule Blumenthalstraße Düsseldorf 1 NRW AWO NRW.
 Perspektiven der Schul - sozialarbeit 07. 03.2018, 10:30-15:30 Uhr KGS Thomas Schule Blumenthalstraße 11 40476 Düsseldorf 1 Perspektiven der bietet mit umfangreichen Angeboten - von der Beratung und individuellen
Perspektiven der Schul - sozialarbeit 07. 03.2018, 10:30-15:30 Uhr KGS Thomas Schule Blumenthalstraße 11 40476 Düsseldorf 1 Perspektiven der bietet mit umfangreichen Angeboten - von der Beratung und individuellen
WAS IST MIT ARMUTSSENSIBLEM HANDELN
 WAS IST MIT ARMUTSSENSIBLEM HANDELN GEMEINT? Gerda Holz, Frankfurt am Main Schwerpunkte Armut bei Kindern und Jugendlichen Definition, Ursachen, Risiken Das Kindergesicht der Armut Kindbezogene Armutsprävention
WAS IST MIT ARMUTSSENSIBLEM HANDELN GEMEINT? Gerda Holz, Frankfurt am Main Schwerpunkte Armut bei Kindern und Jugendlichen Definition, Ursachen, Risiken Das Kindergesicht der Armut Kindbezogene Armutsprävention
Trennt uns bitte, bitte nicht!"
 Hannelore Faulstich-Wieland Marianne Horstkemper Trennt uns bitte, bitte nicht!" Koedukation aus Mädchen- und Jungensicht Institut für Berufspädagoge Leske + Budrich, Opladen 1995 Inhaltsverzeichnis 1
Hannelore Faulstich-Wieland Marianne Horstkemper Trennt uns bitte, bitte nicht!" Koedukation aus Mädchen- und Jungensicht Institut für Berufspädagoge Leske + Budrich, Opladen 1995 Inhaltsverzeichnis 1
Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie
 Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie Lehrbuchreihe zur sozialwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung der Sektion Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie Band 3 Sabine
Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie Lehrbuchreihe zur sozialwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung der Sektion Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie Band 3 Sabine
Grundlagen und Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung Flensburg
 Grundlagen und Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung Flensburg Grundlagen und Ziele interkultureller Öffnung Die komplementäre Perspektive: Diversity Management Interkulturelle
Grundlagen und Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung Flensburg Grundlagen und Ziele interkultureller Öffnung Die komplementäre Perspektive: Diversity Management Interkulturelle
Dialog eigenständige Jugendpolitik RLP
 JES! Jung. Eigenständig. Stark. Dialog eigenständige Jugendpolitik RLP auf dem Weg zu einem Bündnis für und mit der Jugend STRUKTUR DES VORTRAGS 1. Gesetzliche Grundlagen 2. Trägerstruktur / Kooperationspartner/-innen
JES! Jung. Eigenständig. Stark. Dialog eigenständige Jugendpolitik RLP auf dem Weg zu einem Bündnis für und mit der Jugend STRUKTUR DES VORTRAGS 1. Gesetzliche Grundlagen 2. Trägerstruktur / Kooperationspartner/-innen
Voraussetzungen wirksamer Präventionsprojekte
 Voraussetzungen wirksamer Präventionsprojekte Vortrag im Rahmen der wissenschaftliche Fachtagung des Thüringer Landesbeirates Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Landestelle Gewaltprävention zur
Voraussetzungen wirksamer Präventionsprojekte Vortrag im Rahmen der wissenschaftliche Fachtagung des Thüringer Landesbeirates Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Landestelle Gewaltprävention zur
Begrüßungsworte Internationaler Frauentag 2014 Partizipation von Mädchen und jungen Frauen 10. März 2014, 11 Uhr, Plenarsaal des Landtags
 Begrüßungsworte Internationaler Frauentag 2014 Partizipation von Mädchen und jungen Frauen 10. März 2014, 11 Uhr, Plenarsaal des Landtags Sehr geehrte Damen und (vereinzelte) Herren, liebe Kolleginnen
Begrüßungsworte Internationaler Frauentag 2014 Partizipation von Mädchen und jungen Frauen 10. März 2014, 11 Uhr, Plenarsaal des Landtags Sehr geehrte Damen und (vereinzelte) Herren, liebe Kolleginnen
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 2. Jahrestreffen des am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) angesiedelten Regionalen Innovationsnetzwerks
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 2. Jahrestreffen des am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) angesiedelten Regionalen Innovationsnetzwerks
Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter
 Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter Wie Natur Wissen Schafft Ansätze mathematischer und naturwissenschaftlicher
Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter Wie Natur Wissen Schafft Ansätze mathematischer und naturwissenschaftlicher
PISA 2012 Zusammenfassung erster Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen
 bm:ukk, Abt. IT/1, Referat a Dr. Mark Német (Tel. DW 5902), Mag. Andreas Grimm (DW 4316) PISA 2012 Zusammenfassung erster Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen Differenz zwischen Knaben und
bm:ukk, Abt. IT/1, Referat a Dr. Mark Német (Tel. DW 5902), Mag. Andreas Grimm (DW 4316) PISA 2012 Zusammenfassung erster Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen Differenz zwischen Knaben und
Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung
 Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung Präsentation auf der 3. Fachkonferenz des Kommunalen Netzwerkes für Arbeitsmarktintegration und Gesundheitsförderung am 29. November 2007 in Frankfurt am
Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung Präsentation auf der 3. Fachkonferenz des Kommunalen Netzwerkes für Arbeitsmarktintegration und Gesundheitsförderung am 29. November 2007 in Frankfurt am
Rede von Ulrike Flach Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages Grußwort
 Rede von Ulrike Flach Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages Grußwort auf dem 1. Männergesundheitskongresses der BZgA "Männergesundheit
Rede von Ulrike Flach Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages Grußwort auf dem 1. Männergesundheitskongresses der BZgA "Männergesundheit
Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern
 2. Kultur.Forscher!- Netzwerktreffen am 09. und 10. Oktober 2009 in Berlin Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern Moderation Harriet Völker und Jürgen Schulz Einführung:
2. Kultur.Forscher!- Netzwerktreffen am 09. und 10. Oktober 2009 in Berlin Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern Moderation Harriet Völker und Jürgen Schulz Einführung:
Hannelore Faulstich-Wieland (Hg.) Abschied von der Koedukation?
 Hannelore Faulstich-Wieland (Hg.) Abschied von der Koedukation? Inhalt Hannelore Faulstich-Wieland Einleitung: Koedukation - ein erledigtes Thema? 7 1. Problemaufriß 7 2. Zur Bildungsgeschichte von Mädchen
Hannelore Faulstich-Wieland (Hg.) Abschied von der Koedukation? Inhalt Hannelore Faulstich-Wieland Einleitung: Koedukation - ein erledigtes Thema? 7 1. Problemaufriß 7 2. Zur Bildungsgeschichte von Mädchen
5. Grundlegende Arbeitsprinzipien
 Inhalt 1. Leitbild und Zielrichtungen 1.1. Leitbild 1.2. Allgemeine Zielrichtungen 2. Rahmenbedingungen 2.1. Orte 2.2. Zeiten 2.3. Personelle Strukturen 3. Zielgruppen 4. Zielsetzungen 5. Grundlegende
Inhalt 1. Leitbild und Zielrichtungen 1.1. Leitbild 1.2. Allgemeine Zielrichtungen 2. Rahmenbedingungen 2.1. Orte 2.2. Zeiten 2.3. Personelle Strukturen 3. Zielgruppen 4. Zielsetzungen 5. Grundlegende
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Jugendliche in neuen Lernwelten
 Peter Wahler-Claus J.Tully Christine Preiß Jugendliche in neuen Lernwelten Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt 1 Vorbemerkung :
Peter Wahler-Claus J.Tully Christine Preiß Jugendliche in neuen Lernwelten Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt 1 Vorbemerkung :
Partizipation - Anforderungen an eine diversitätsbewusste Jugendarbeit
 Partizipation - Anforderungen an eine diversitätsbewusste Jugendarbeit Vielfalt & Partizipation Fachtagung zu interkultureller Jugendarbeit Linz am 17. 11. 07 Vortrag: Dr. Richard Krisch to do s: 1. Entgrenzung
Partizipation - Anforderungen an eine diversitätsbewusste Jugendarbeit Vielfalt & Partizipation Fachtagung zu interkultureller Jugendarbeit Linz am 17. 11. 07 Vortrag: Dr. Richard Krisch to do s: 1. Entgrenzung
Jugendarbeit ist Bildungsarbeit
 Positionen zum Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendarbeit in Friedrichshain-Kreuzberg Jugendarbeit ist Bildungsarbeit Positionen zum Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendarbeit in Friedrichshain-Kreuzberg
Positionen zum Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendarbeit in Friedrichshain-Kreuzberg Jugendarbeit ist Bildungsarbeit Positionen zum Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendarbeit in Friedrichshain-Kreuzberg
Inklusion auf kommunaler Ebene: Wie kann Inklusion geplant werden? Prof. Dr. Albrecht Rohrmann
 Inklusion auf kommunaler Ebene: Wie kann Inklusion geplant werden? Prof. Dr. Albrecht Rohrmann Gliederung 1. Zum Begriff der Inklusion 2. Herausforderung für die kommunale Planung 3. Ansatzpunkte für die
Inklusion auf kommunaler Ebene: Wie kann Inklusion geplant werden? Prof. Dr. Albrecht Rohrmann Gliederung 1. Zum Begriff der Inklusion 2. Herausforderung für die kommunale Planung 3. Ansatzpunkte für die
Die Gruppe "Jugendfragen" hat dem beigefügten Wortlaut des oben genannten Entschließungsentwurfs einstimmig zugestimmt.
 RAT R EUROPÄISCHEN UNION Brüssel, den 28. April 2005 (11.05) (OR. fr) 8522/05 JEUN 20 EDUC 73 SOC 184 EINLEITENR VERMERK des Generalsekretariats des Rates für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/den
RAT R EUROPÄISCHEN UNION Brüssel, den 28. April 2005 (11.05) (OR. fr) 8522/05 JEUN 20 EDUC 73 SOC 184 EINLEITENR VERMERK des Generalsekretariats des Rates für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/den
Begrüßung durch Frau Brigitte Döcker Mitglied des Vorstands, AWO Bundesverband e.v. BAGFW-Fachtagung:
 Begrüßung durch Frau Brigitte Döcker Mitglied des Vorstands, AWO Bundesverband e.v. BAGFW-Fachtagung: Vom Betreuungsverein zum Kompetenzzentrum am 10. Oktober 2013 in Kassel Sehr geehrte Damen und Herren,
Begrüßung durch Frau Brigitte Döcker Mitglied des Vorstands, AWO Bundesverband e.v. BAGFW-Fachtagung: Vom Betreuungsverein zum Kompetenzzentrum am 10. Oktober 2013 in Kassel Sehr geehrte Damen und Herren,
Landesverband Nordrhein-Westfalen
 Landesverband Nordrhein-Westfalen Grundbildung für alle! Thesen und Konkretionen für die Alphabetisierung Regionalkonferenz Weiterbildung im Regierungsbezirk Arnsberg 29. Oktober 2014 in Hamm 27.06.2014
Landesverband Nordrhein-Westfalen Grundbildung für alle! Thesen und Konkretionen für die Alphabetisierung Regionalkonferenz Weiterbildung im Regierungsbezirk Arnsberg 29. Oktober 2014 in Hamm 27.06.2014
Prof. Dr. Iris Beck, Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker
 Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen (PuLL), dargestellt vor dem Hintergrund des Curriculums im M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaft Prof. Dr. Iris Beck, Prof. Dr. Anke Grotlüschen,
Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen (PuLL), dargestellt vor dem Hintergrund des Curriculums im M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaft Prof. Dr. Iris Beck, Prof. Dr. Anke Grotlüschen,
Auf die Haltung kommt es an!
 Auf die Haltung kommt es an! ANREGUNGEN ZUR ENTWICKLUNG EINER PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG IM KINDERGARTEN SONJA SCHMID, BA Ein Beispiel aus dem Berufsalltag https://www.youtube.com/watch?v=m7e
Auf die Haltung kommt es an! ANREGUNGEN ZUR ENTWICKLUNG EINER PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG IM KINDERGARTEN SONJA SCHMID, BA Ein Beispiel aus dem Berufsalltag https://www.youtube.com/watch?v=m7e
MÄDCHENARBEIT RELOADED
 3./4. November 2016 MÄDCHENARBEIT RELOADED Prozess Mädchen_arbeit reloaded II FACHTAGUNG UNTERSCHIEDLICH VERSCHIEDEN! VON DER THEORIE ZUR PRAXIS Konzeptionelle Überlegungen für die Praxis (queer-)feministischer
3./4. November 2016 MÄDCHENARBEIT RELOADED Prozess Mädchen_arbeit reloaded II FACHTAGUNG UNTERSCHIEDLICH VERSCHIEDEN! VON DER THEORIE ZUR PRAXIS Konzeptionelle Überlegungen für die Praxis (queer-)feministischer
1. Oberstufen Praktikum
 Fachschule für Sozialpädagogik BEURTEILUNGSBOGEN zur Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung von individuellen pädagogisch relevanten Kompetenzen im 1. Oberstufen Praktikum Studierende/r:...................................................................
Fachschule für Sozialpädagogik BEURTEILUNGSBOGEN zur Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung von individuellen pädagogisch relevanten Kompetenzen im 1. Oberstufen Praktikum Studierende/r:...................................................................
Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen
 Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen Ergebnisse einer repräsentativen Lehrerbefragung Auswertung Baden-Württemberg 21. April 2015 q5355/31532
Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen Ergebnisse einer repräsentativen Lehrerbefragung Auswertung Baden-Württemberg 21. April 2015 q5355/31532
Grundlagen der Sportpädagogik
 Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Rede anlässlich 20 - jährigem Jubiläum der 1. Remscheider Gesamtschule Albert - Einstein - Schule
 Rede anlässlich 20 - jährigem Jubiläum der 1. Remscheider Gesamtschule Albert - Einstein - Schule Es gilt das gesprochene Wort Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Schulleiter Herr Lück-Lilienbeck,
Rede anlässlich 20 - jährigem Jubiläum der 1. Remscheider Gesamtschule Albert - Einstein - Schule Es gilt das gesprochene Wort Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Schulleiter Herr Lück-Lilienbeck,
Das Leitbild der MA 57. MA 57 Bei uns stehen Frauen und Mädchen im Mittelpunkt
 Das Leitbild der MA 57 MA 57 Bei uns stehen Frauen und Mädchen im Mittelpunkt Präambel Die Frauenabteilung setzt sich auf Basis einer visionären, feministischen Grundhaltung für eine geschlechtergerechte
Das Leitbild der MA 57 MA 57 Bei uns stehen Frauen und Mädchen im Mittelpunkt Präambel Die Frauenabteilung setzt sich auf Basis einer visionären, feministischen Grundhaltung für eine geschlechtergerechte
BRÜCKE e.v. Augsburg. Leitbild. Die BRÜCKE in 10 Sätzen. 1. Wir sind Teil einer Reformbewegung. 2. Wir setzen gesetzliche Vorgaben um
 BRÜCKE e.v. Augsburg Leitbild Die BRÜCKE in 10 Sätzen 1. Wir sind Teil einer Reformbewegung 2. Wir setzen gesetzliche Vorgaben um 3. Wir nehmen gesellschaftliche Verantwortung wahr 4. Wir sehen den ganzen
BRÜCKE e.v. Augsburg Leitbild Die BRÜCKE in 10 Sätzen 1. Wir sind Teil einer Reformbewegung 2. Wir setzen gesetzliche Vorgaben um 3. Wir nehmen gesellschaftliche Verantwortung wahr 4. Wir sehen den ganzen
Auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Kommune
 Auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Kommune Nutzen und Handlungsbedarfe Fachforum auf dem 15. DJHT 05. Juni 2014 Berlin Dr. Christian Lüders lueders@dji.de Prämissen von Jugendpolitik Sämtliche Akteure,
Auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Kommune Nutzen und Handlungsbedarfe Fachforum auf dem 15. DJHT 05. Juni 2014 Berlin Dr. Christian Lüders lueders@dji.de Prämissen von Jugendpolitik Sämtliche Akteure,
Reflexive Koedukation
 Reflexive Koedukation Einführung 1 27.08.2009 Dipl.-Päd. Kristina Pomerenke-Schön Gliederung 2 Definition Konsequenzen für Unterricht und Schule Ziele und Anliegen der Reflexiven Koedukation Fazit für
Reflexive Koedukation Einführung 1 27.08.2009 Dipl.-Päd. Kristina Pomerenke-Schön Gliederung 2 Definition Konsequenzen für Unterricht und Schule Ziele und Anliegen der Reflexiven Koedukation Fazit für
Partizipation von Seniorinnen und Senioren im vorparlamentarischem Bereich von Bund, Ländern und Kommunen
 Partizipation von Seniorinnen und Senioren im vorparlamentarischem Bereich von Bund, Ländern und Kommunen 25.09.2013 Akademie Frankenwarte eifert@post.uni-.de Was Sie heute erwartet 1. Partizipation Älterer
Partizipation von Seniorinnen und Senioren im vorparlamentarischem Bereich von Bund, Ländern und Kommunen 25.09.2013 Akademie Frankenwarte eifert@post.uni-.de Was Sie heute erwartet 1. Partizipation Älterer
Lebenssituation und Einstellungen von Jugendlichen Kurzfassung
 Diese Studie beschäftigt sich mit der Arbeits- und Lebenssituation von Jugendlichen, ihren Wertorientierungen und politische Einstellungen. Ergebnisse aktueller Untersuchungen zu Jugendlichen in Österreich
Diese Studie beschäftigt sich mit der Arbeits- und Lebenssituation von Jugendlichen, ihren Wertorientierungen und politische Einstellungen. Ergebnisse aktueller Untersuchungen zu Jugendlichen in Österreich
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sylvia Löhrmann
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann Tag der Freien Schulen, zentrale Veranstaltung im Deutschen Theater Berlin 18. September 2015 Sehr geehrte
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann Tag der Freien Schulen, zentrale Veranstaltung im Deutschen Theater Berlin 18. September 2015 Sehr geehrte
Diversity in der Begleitung von Übergängen - Reflexionsansätze. Angela Rein, Hochschule für Soziale Arbeit. Workshop 6 - Diversity 1
 Diversity in der Begleitung von Übergängen - Reflexionsansätze Angela Rein, Hochschule für Soziale Arbeit 1 1. Übung: Schritt voran Struktur 2. Präsentation: Welchen Einfluss hat Diversity im Übergang
Diversity in der Begleitung von Übergängen - Reflexionsansätze Angela Rein, Hochschule für Soziale Arbeit 1 1. Übung: Schritt voran Struktur 2. Präsentation: Welchen Einfluss hat Diversity im Übergang
SCHUTZ UND CHANCENGLEICHHEIT FÜR ALLE KINDER - EINE HERAUSFORDERUNG FÜR POLITIK UND GESELLSCHAFT -
 07.06.07 Rede der jugendpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Sandra Scheeres. SCHUTZ UND CHANCENGLEICHHEIT FÜR ALLE KINDER - EINE HERAUSFORDERUNG FÜR POLITIK UND GESELLSCHAFT - Sehr geehrter Herr Präsident,
07.06.07 Rede der jugendpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Sandra Scheeres. SCHUTZ UND CHANCENGLEICHHEIT FÜR ALLE KINDER - EINE HERAUSFORDERUNG FÜR POLITIK UND GESELLSCHAFT - Sehr geehrter Herr Präsident,
VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017
 VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017 Neuwürschnitz 15.06.2013 Tobias Bilz Glauben auf evangelische Art In der evangelischen Jugendarbeit sind wir überzeugt davon, dass unsere Glaubenspraxis dem
VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017 Neuwürschnitz 15.06.2013 Tobias Bilz Glauben auf evangelische Art In der evangelischen Jugendarbeit sind wir überzeugt davon, dass unsere Glaubenspraxis dem
Vision Inklusion. Der Landschaftsverband Rheinland. auf dem Weg. Arbeitstagung des LVR-Landesjugendamtes. für Fachberaterinnen und Fachberater für TfK
 Vision Inklusion Der Landschaftsverband Rheinland auf dem Weg Arbeitstagung des LVR-Landesjugendamtes für Fachberaterinnen und Fachberater für TfK in kommunaler Trägerschaft, Köln-Deutz, 29.02.2012 Bernd
Vision Inklusion Der Landschaftsverband Rheinland auf dem Weg Arbeitstagung des LVR-Landesjugendamtes für Fachberaterinnen und Fachberater für TfK in kommunaler Trägerschaft, Köln-Deutz, 29.02.2012 Bernd
Ehrenamtsförderung mit System
 Ehrenamtsförderung mit System Dr. Daniel Illmer, Führungs-Akademie des DOSB Führungs-Akademie des DOSB /// Willy-Brandt-Platz 2 /// 50679 Köln /// Tel 0221/221 220 13 /// Fax 0221/221 220 14 /// info@fuehrungs-akademie.de
Ehrenamtsförderung mit System Dr. Daniel Illmer, Führungs-Akademie des DOSB Führungs-Akademie des DOSB /// Willy-Brandt-Platz 2 /// 50679 Köln /// Tel 0221/221 220 13 /// Fax 0221/221 220 14 /// info@fuehrungs-akademie.de
von Alexander Mavroudis LVR-Landesjugendamt Rheinland Input beim 3. Fachtag Kooperation Jugendhilfe & Schule am 26. April 2016 in Aachen
 Der Stellenwert von Schulsozialarbeit in den Bildungslandschaften in Nordrhein-Westfalen von Alexander Mavroudis LVR-Landesjugendamt Rheinland Input beim 3. Fachtag Kooperation Jugendhilfe & Schule am
Der Stellenwert von Schulsozialarbeit in den Bildungslandschaften in Nordrhein-Westfalen von Alexander Mavroudis LVR-Landesjugendamt Rheinland Input beim 3. Fachtag Kooperation Jugendhilfe & Schule am
Auf dem Weg zur geschlechtergerechten Hochschule. Bedingungen, Potentiale und Instrumente der Entwicklung
 Auf dem Weg zur geschlechtergerechten Hochschule Bedingungen, Potentiale und Instrumente der Entwicklung Stichworte Leitbilddiskussion Geschlechtergerechtigkeit als Ziel Essentials aus der Diskussion E-Quality:
Auf dem Weg zur geschlechtergerechten Hochschule Bedingungen, Potentiale und Instrumente der Entwicklung Stichworte Leitbilddiskussion Geschlechtergerechtigkeit als Ziel Essentials aus der Diskussion E-Quality:
Forum für kulturelle Diversität & Gender in Lehre und Beratung:
 Forum für kulturelle Diversität & Gender in Lehre und Beratung: Doing und undoing gender in der Hochschullehre 28.06.2011 Dr. Elke Bosse (qualiko LBF) Dr. Corinna Tomberger ( Gender in die Lehre ) Handlungsebenen
Forum für kulturelle Diversität & Gender in Lehre und Beratung: Doing und undoing gender in der Hochschullehre 28.06.2011 Dr. Elke Bosse (qualiko LBF) Dr. Corinna Tomberger ( Gender in die Lehre ) Handlungsebenen
Aktives Altern und Geschlechterperspektiven. Petra-Angela Ahrens / Gerhard Wegner 11. September 2015 in Hannover
 Aktives Altern und Geschlechterperspektiven Petra-Angela Ahrens / Gerhard Wegner in Hannover Was Sie erwartet 1. Geschlechtsspezifische Altersbilder Ausgangspunkt im 6. Altenbericht der Bundesregierung
Aktives Altern und Geschlechterperspektiven Petra-Angela Ahrens / Gerhard Wegner in Hannover Was Sie erwartet 1. Geschlechtsspezifische Altersbilder Ausgangspunkt im 6. Altenbericht der Bundesregierung
Pfadfinden wirkt! Jugendliches Ehrenamt fördert demokratische Kompetenzen
 VCP Bundeszentrale. Wichernweg 3. 34121 Kassel An die Mitglieder der Leitungsgremien auf Bundes- und Landesebene Mitglieder der Fach- und Projektgruppen auf Bundesebene Hauptberuflichen Mitarbeiterinnen
VCP Bundeszentrale. Wichernweg 3. 34121 Kassel An die Mitglieder der Leitungsgremien auf Bundes- und Landesebene Mitglieder der Fach- und Projektgruppen auf Bundesebene Hauptberuflichen Mitarbeiterinnen
Elternarbeit und Integration
 Tagung Elternarbeit und Integration Vortrag Elternarbeit und Integration von Mag. Siegfried Kiefer, Institutsleitung VHS OÖ Institut für Interkulturelle Pädagogik, gehalten am 22. September 2012 Integrationsbüro
Tagung Elternarbeit und Integration Vortrag Elternarbeit und Integration von Mag. Siegfried Kiefer, Institutsleitung VHS OÖ Institut für Interkulturelle Pädagogik, gehalten am 22. September 2012 Integrationsbüro
Pädagog_innen in der Arbeit mit Jungen und Jungenarbeit
 Mart Busche Pädagog_innen in der Arbeit mit Jungen und Jungenarbeit Fach- und Praxistagung am 16.06.2009 KuKMA@Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg, Potsdam Aufbau I. Was machen
Mart Busche Pädagog_innen in der Arbeit mit Jungen und Jungenarbeit Fach- und Praxistagung am 16.06.2009 KuKMA@Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg, Potsdam Aufbau I. Was machen
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Der interkulturelle Selbstcheck
 Der interkulturelle Selbstcheck Ein Instrument r Selbstreflexion für Jugendringe und Jugendverbände Impressum: Herausgeber: Landesjugendring NRW e.v. Martinstraße 2a 41472 Neuss Telefon: 0 21 31 / 46 95-0
Der interkulturelle Selbstcheck Ein Instrument r Selbstreflexion für Jugendringe und Jugendverbände Impressum: Herausgeber: Landesjugendring NRW e.v. Martinstraße 2a 41472 Neuss Telefon: 0 21 31 / 46 95-0
Kinder und Jugendliche fördern Bildung und Erziehung als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe 8. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 2005
 Kinder und Jugendliche fördern Bildung und Erziehung als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe 8. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 2005 8. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Inhalt
Kinder und Jugendliche fördern Bildung und Erziehung als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe 8. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 2005 8. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Inhalt
Ein Projekt des Paritätischen Bildungswerkes Bundesverband e.v.
 Transferagentur Sozialer Freiwilligendienst für Jungen in Kooperation mit: Jugendbildungswerk gefördert von : Ein Projekt des Paritätischen Bildungswerkes Bundesverband e.v. BMFSFJ Bundesministerium für
Transferagentur Sozialer Freiwilligendienst für Jungen in Kooperation mit: Jugendbildungswerk gefördert von : Ein Projekt des Paritätischen Bildungswerkes Bundesverband e.v. BMFSFJ Bundesministerium für
Manifest. für eine. Muslimische Akademie in Deutschland
 Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Dr. Christoph Werth. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Dr. Christoph Werth Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Grußwort zur Eröffnung des Intensivkurses Deutsch als Fremdsprache für Mediziner am Zentrum für kreatives Sprachtrining Jena
Dr. Christoph Werth Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Grußwort zur Eröffnung des Intensivkurses Deutsch als Fremdsprache für Mediziner am Zentrum für kreatives Sprachtrining Jena
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen --------------------------------------------------------------------------
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen --------------------------------------------------------------------------
Es gilt das gesprochene Wort.
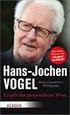 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Michaeli Schule Köln Freie Waldorfschule mit inklusivem
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Michaeli Schule Köln Freie Waldorfschule mit inklusivem
Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden
 Simon Burtscher-Mathis ta n z Ha rd Ra Fr as nk W weil ol fur t Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden Ausgangspunkte Wieso und warum müssen
Simon Burtscher-Mathis ta n z Ha rd Ra Fr as nk W weil ol fur t Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden Ausgangspunkte Wieso und warum müssen
Forum 4. Jugendhilfe und Schule eine Win-Win Situation? Input 1 Erich Sass. Wissenschaftliche Fachtagung. Wissenschaftliche Fachtagung
 Forum 4 Wissenschaftliche Begleitung des Projektes Bildung(s)gestalten Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung gestalten Bildungslandschaften Input 1 Erich Sass Jugendhilfe und Schule eine
Forum 4 Wissenschaftliche Begleitung des Projektes Bildung(s)gestalten Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung gestalten Bildungslandschaften Input 1 Erich Sass Jugendhilfe und Schule eine
Uli Boldt. Wie Jungen Schule erleben und was Pädagoginnen und Pädagogen davon lernen
 Uli Boldt Wie Jungen Schule erleben und was Pädagoginnen und Pädagogen davon lernen Schwäbisch Hall, 22. April 2015 Was meinen wir über die Jungen zu wissen? Jungen erbringen schlechtere Leistungen in
Uli Boldt Wie Jungen Schule erleben und was Pädagoginnen und Pädagogen davon lernen Schwäbisch Hall, 22. April 2015 Was meinen wir über die Jungen zu wissen? Jungen erbringen schlechtere Leistungen in
Schülerfragebogen zum Thema Globale Entwicklung
 Schülerfragebogen m Thema Globale Entwicklung Hinweise m Ausfüllen des Fragebogens Liebe Schülerin, lieber Schüler, deine Meinung m Projektunterricht im Themenfeld Globale Entwicklung ist gefragt! Die
Schülerfragebogen m Thema Globale Entwicklung Hinweise m Ausfüllen des Fragebogens Liebe Schülerin, lieber Schüler, deine Meinung m Projektunterricht im Themenfeld Globale Entwicklung ist gefragt! Die
Abenteuer Pupertät - Jugendliche zwischen Entwicklungsaufgaben und Jugendkulturellem Jetzt.
 Abenteuer Pupertät - Jugendliche zwischen Entwicklungsaufgaben und Jugendkulturellem Jetzt. Offene Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich mit ihrem Programm, den Angeboten und Projekten an den Lebenslagen,
Abenteuer Pupertät - Jugendliche zwischen Entwicklungsaufgaben und Jugendkulturellem Jetzt. Offene Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich mit ihrem Programm, den Angeboten und Projekten an den Lebenslagen,
PISA Kennwerte zum Kompetenzstand von 15-Jährigen (Teil 1)
 PISA Kennwerte zum Kompetenzstand von 15-Jährigen (Teil 1) OECD- Durchschnitt 494 501 496 Naturwissenschaftliche Kompetenz Südkorea 538 536 554 Niederlande Finnland * bei der PISA-Studie (Programme for
PISA Kennwerte zum Kompetenzstand von 15-Jährigen (Teil 1) OECD- Durchschnitt 494 501 496 Naturwissenschaftliche Kompetenz Südkorea 538 536 554 Niederlande Finnland * bei der PISA-Studie (Programme for
Präventionskette Kreis Warendorf
 Präventionskette Kreis Warendorf Aufbau, Entwicklung, Wirkung Fachtagung: Präventionsketten in Niedersachsen 25.08.2016 Rahmenbedingungen: der Kreis Warendorf Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des
Präventionskette Kreis Warendorf Aufbau, Entwicklung, Wirkung Fachtagung: Präventionsketten in Niedersachsen 25.08.2016 Rahmenbedingungen: der Kreis Warendorf Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des
DER ÖGD ALS KOORDINIERENDER AKTEUR? Möglichkeiten und Grenzen bei der Gestaltung kommunaler (Inklusions-) Strategien
 DER ÖGD ALS KOORDINIERENDER AKTEUR? Möglichkeiten und Grenzen bei der Gestaltung kommunaler (Inklusions-) Strategien Holger Kilian, MPH Gesundheit Berlin-Brandenburg Berlin, 24. Juni 2014 Förderung von
DER ÖGD ALS KOORDINIERENDER AKTEUR? Möglichkeiten und Grenzen bei der Gestaltung kommunaler (Inklusions-) Strategien Holger Kilian, MPH Gesundheit Berlin-Brandenburg Berlin, 24. Juni 2014 Förderung von
Empfehlungen aus den Workshops
 I 5. DOSB Frauen-Vollversammlung 2010 I Frauen im Sport - Managerinnen von Familie, Beruf und Ehrenamt Empfehlungen aus den Workshops 1 I Workshop 1: Trotz Familie ehrenamtlich aktiv? 1. gesellschaftspolitische
I 5. DOSB Frauen-Vollversammlung 2010 I Frauen im Sport - Managerinnen von Familie, Beruf und Ehrenamt Empfehlungen aus den Workshops 1 I Workshop 1: Trotz Familie ehrenamtlich aktiv? 1. gesellschaftspolitische
Wer hat welche Aufgaben und wer hat welche Fähigkeiten? Zur Rollenklärung von schulbezogener Jugendsozialarbeit
 Wer hat welche Aufgaben und wer hat welche Fähigkeiten? Zur Rollenklärung von schulbezogener Jugendarbeit, schulbezogener Jugendsozialarbeit und Schule Dr. Karsten Speck (Universität Potsdam) Fachtagung
Wer hat welche Aufgaben und wer hat welche Fähigkeiten? Zur Rollenklärung von schulbezogener Jugendarbeit, schulbezogener Jugendsozialarbeit und Schule Dr. Karsten Speck (Universität Potsdam) Fachtagung
Genderforschung in die Curricula: Lehrinhalte und Vermittlungsformen. Dr. Beate Kortendiek, Netzwerk Frauenforschung NRW, TU Dortmund,
 Genderforschung in die Curricula: Lehrinhalte und Vermittlungsformen Dr. Beate Kortendiek, Netzwerk Frauenforschung NRW, TU Dortmund, 24.10.2008 2 Projekte im Kontext des Netzwerks Frauenforschung Handbuch
Genderforschung in die Curricula: Lehrinhalte und Vermittlungsformen Dr. Beate Kortendiek, Netzwerk Frauenforschung NRW, TU Dortmund, 24.10.2008 2 Projekte im Kontext des Netzwerks Frauenforschung Handbuch
Betreff: Umfrage zu Geschlechterreflektierte Pädagogik, Männer und Erzieherausbildung, Geschlechterkompetenz und Gender Mainstreaming
 Folgendes Anschreiben und den dazugehörigen Fragebogen verschickten wir im Zeitraum vom 7.12.2006 bis zum 28.2.2007 an 312 Fachschulen/Fachakademien für Sozialpädagogik. Die Auswertung des Fragebogens
Folgendes Anschreiben und den dazugehörigen Fragebogen verschickten wir im Zeitraum vom 7.12.2006 bis zum 28.2.2007 an 312 Fachschulen/Fachakademien für Sozialpädagogik. Die Auswertung des Fragebogens
forum neue bildung Und was sagen Sie? Demokratisierung Inklusion Selbstbestimmung Gerechtigkeit Ein offener Dialog über die Zukunft der Bildung in RLP
 forum neue bildung Ein offener Dialog über die Zukunft der Bildung in RLP Demokratisierung Inklusion Selbstbestimmung Gerechtigkeit Und was sagen Sie? Das forum neue bildung Das forum neue bildung ist
forum neue bildung Ein offener Dialog über die Zukunft der Bildung in RLP Demokratisierung Inklusion Selbstbestimmung Gerechtigkeit Und was sagen Sie? Das forum neue bildung Das forum neue bildung ist
Der neue Lehrplan Fachschule Sozialpädagogik. Vorstellung des neuen Lehrplans NRW in Sachsen-Anhalt Juni 2014
 Der neue Lehrplan Fachschule Sozialpädagogik Vorstellung des neuen Lehrplans NRW in Sachsen-Anhalt Juni 2014 1 Lehrplan für die FSP in NRW Entstehungszusammenhang Lernfelder auf der Grundlage von Handlungsfeldern
Der neue Lehrplan Fachschule Sozialpädagogik Vorstellung des neuen Lehrplans NRW in Sachsen-Anhalt Juni 2014 1 Lehrplan für die FSP in NRW Entstehungszusammenhang Lernfelder auf der Grundlage von Handlungsfeldern
Die Gestaltung des Übergang Schule-Beruf und Berufsorientierung als Herausforderung für das Bildungspersonal
 Die Gestaltung des Übergang Schule-Beruf und Berufsorientierung als Herausforderung für das Bildungspersonal Dr. Claudia Kalisch, Universität Rostock Impulse für den Workshop Übergang Schule-Beruf Begrifflichkeiten,
Die Gestaltung des Übergang Schule-Beruf und Berufsorientierung als Herausforderung für das Bildungspersonal Dr. Claudia Kalisch, Universität Rostock Impulse für den Workshop Übergang Schule-Beruf Begrifflichkeiten,
