Schuster (Hrsg.) Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum
|
|
|
- Juliane Brodbeck
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 1 Schuster (Hrsg.) Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum
3 2 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Kulturelle Bildung /// 41 Eine Reihe der BKJ Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, Remscheid (vertreten durch Hildegard Bockhorst und Wolfgang Zacharias) bei kopaed Beirat Karl Ermert Burkhard Hill Birgit Jank Peter Kamp Birgit Mandel Wolfgang Sting Rainer Treptow (Bundesakademie Wolfenbüttel a.d.) (Hochschule München) (Universität Potsdam) (Vorstand BKJ/BJKE) (Universität Hildesheim) (Universität Hamburg) (Universität Tübingen) Kulturelle Bildung setzt einen besonderen Akzent auf den aktiven Umgang mit künstlerischen und ästhetischen Ausdrucksformen und Wahrnehmungsweisen: von Anfang an und lebenslang. Sie umfasst den historischen wie aktuellen Reichtum der Künste und der Medien. Kulturelle Bildung bezieht sich zudem auf je eigene Formen der sich wandelnden Kinderkultur und der Jugendästhetik, der kindlichen Spielkulturen und der digitalen Gestaltungstechniken mit ihrer Entwicklungsdynamik. Entsprechend der Vielfalt ihrer Lernformen, Inhalts bezüge und Ausdrucksweisen ist Kulturelle Bildung eine Querschnittsdisziplin mit eigenen Profilen und dem gemeinsamen Ziel: Kultur leben lernen. Sie ist gleicher maßen Teil von Sozial- und Jugendpolitik, von Kunst- und Kultur politik wie von Schul- und Hochschulpolitik bzw. deren Orte, Institutionen, Professionen und Angebotsformen. Die Reihe Kulturelle Bildung will dazu beitragen, Theorie und Praxis Kultureller Bildung zu qualifizieren und zu professionalisieren: Felder, Arbeitsformen, Inhalte, Didaktik und Methodik, Geschichte und aktuelle Entwicklungen. Die Reihe bietet dazu die Bearbeitung akzentuierter Themen der ästhetisch-kulturellen Bildung, der Kulturvermittlung, der Kinder- und Jugendkulturarbeit und der Kultur pädagogik mit der Vielfalt ihrer Teildisziplinen: Kunst- und Musikpädagogik, Theater-, Tanz-, Museums- und Spielpädagogik, Literaturvermittlung und kulturelle Medienbildung, Bewegungskünste, Architektur, Stadt- und Umweltgestaltung.
4 3 Meike Schuster (Hrsg.) Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum situativ temporär performativ partizipativ Unter Mitarbeit von Wolfgang Zacharias
5 4 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte biblio grafi sche Daten sind im Internet über abrufbar Umschlagfoto: Stephanie Lyakine-Schönweitz Soweit nicht anders gekennzeichnet, liegen die Abbildungsrechte bei den jeweiligen Verfassern, ansonsten bei der PA/SPIELkultur e.v. Alle nicht namentlich gekennzeichneten Texte sind von der Herausgeberin. Die Veröffentlichung wird aus Mitteln der Pädagogischen Aktion/SPIELkultur e.v. gefördert, im Rahmen des Projekts kunstwerkstadt, Tage des Spiels und im Auftrag Jugendkulturwerk/Jugendamt LH München. ISBN Druck: Kessler Druck+Medien, Bobingen kopaed 2013 Pfälzer-Wald-Str. 64, München Fon: Fax: Internet:
6 Inhalt 5 Inhalt Vorwort Meike Schuster 7 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 9 Eine kleine Phänomenologie Kaleidoskop Kunst Spiel Aktion Raum: Places called public spaces for learning Wolfgang Zacharias 14 2 Aktualität: Zeiträumliche Lern- und Bildungsformen Ästhetisches Lernen in öffentlichen Räumen ungewöhnliches Lernen Aktive Wahrnehmung und soziale Kreativität Renaissance des Spielerischen und Aktionistischen Zeitlichkeit und Räumlichkeit Symbolverschiebungen und Bildungsprozesse: Medialität/Realität/Fakten/Fiktionen Aktualität Kulturelle Bildung: Der Rahmen 52 Zwischenspiel I Kunstpädagogische Kontexte und Zuspitzungen: Rückgriffe und Aktualitäten Wolfgang Zacharias 58 3 Theoriebezüge: Räume bilden urbanes Lernen Die neue Prominenz des Raumparadigmas Der performative Raumbegriff und das Prinzip Partizipation Neue Urbanität: Wem gehört die Stadt? 88 Praxisexkurs I: Das Exempel MOVE_YOU Irritationen und Unfreiheiten im öffentlichen Raum Raumaneignung und urbanes Lernen: Sozial-, kultur- und bildungsräumliche Konzepte 112 Praxisexkurs II: Das Exempel MOVE_YOU Interaktion durch Auftrags- und Fragekarten 119
7 6 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum 3.5 Raumbildung Bildungsraum: Lebenswelten als Lernwelten 127 Praxisexkurs III: Das Exempel MOVE_YOU Intervention und Raumaneignung durch Aktionen mit Absperrband und Tape Ästhetische Erlebnisse und Erfahrungen in Räumen, Umwelten, Atmosphären 138 Praxisexkurs IV: Das Exempel MOVE_YOU Zwischenräume für Transformationen und ästhetische Erfahrungen 147 Zwischenspiel II Kulturelle Bildung 2.0 ist mehr biochronotopologisch Wolfgang Zacharias Praxisformate, Projekte, Programme und Netze Münchner Infrastrukturen: kommunal, kooperativ, kreativ kunstwerkstadt: Die Aktivierung des öffentlichen Raums 187 Mit einem Beitrag von Tanja Baar, Barbara Soldner 4.3 Projektparade: Ästhetisches Lernen im urbanen Raum 194 Mit Beiträgen von Günther Anfang, Tanja Baar, Sabine Bankauf, Anna Bauregger, Karin Bergdolt, Daniela Biebl, Karl-Michael Brand, Barbara Breen, Ulrike Bührlen, Klaus Erich Dietl, Michael Dietrich, Stephan Engleitner, Gabi Finkenzeller, Maria Frank, Florian Froese-Peeck, Anja Junghans, Sulamith Karzel, Fridhelm Klein, Evelyn Knecht, Gerhard Knecht, Janine Lennert, Stephanie Lyakine-Schönweitz, Julia Marx, Katharina Maurer, Sara-Duana Meyer, Stephanie Müller, Judith Müller, Sebastian Ring, Martin Sailer, Katharina Salvatore, Achim Sauter, Daniela Schicketanz, Sibylle Schnapp, Meike Schuster, Barbara Soldner, Sophie Stroedel, Kati Struckmeyer, Andreas Wagner 4.4 Perspektiven über die lokale Projektpraxis hinaus 318 Finale mit Ausblick Didaktische Strukturen für situativ-ästhetisches Lernen Wolfgang Zacharias 320 Nachwort, generationsübergreifend Wolfgang Zacharias 341 Literatur 343
8 7 Vorwort Meike Schuster Ästhetisches Lernen im öffentlichen (Stadt-)Raum ist in der kunst- und kulturpädagogischen Szene seit einigen Jahren ein aktuelles Thema. Aber wie kam es zu meiner persönlichen Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld im Kontext der Münchner Projektlandschaft? Wo setzten die Theoriebezüge und Projektbeispiele an? Im Großen und Ganzen: Was war Anlass, Motivation und Hintergrund dieser Veröffentlichung? Als Kunstpädagogikstudentin bei Rainer Goetz in Würzburg suchte ich schon während der Studienzeit den Kontakt zur kunst- und kulturvermittelnden Szene und Bildungslandschaft Münchens und arbeitete ab dem Sommer 2010 bei Projekten der Pädagogischen Aktion/SPIELkultur e.v. und Kultur & Spielraum e.v. mit. Hier bekam ich Einblicke in die offene Kinder- und Jugendkulturarbeit vor Ort und realisierte schließlich 2011 im Rahmen der Aktionsausstellung kunstwerkstadt eigene mobile Projekte. kunstwerkstadt. Urbanes Lernen durch Interaktion, Irritation, Intervention. lautete der Titel des 2011 veranstalteten Kooperationsprojekts von PA/SPIELkultur e.v., Kulturreferat und Stadtjugendamt. Zahlreiche Einzelprojekte zum Thema gestalteten das Aktionsprogramm im Münchner Rathaus und im Stadtraum temporär, offen und partizipativ. Mit der Konzeption und Umsetzung meiner Projekte MOVE_YOU und LOKAL/ SUR/REAL in diesem Kontext und den Erfahrungen aus Vorbereitung und Planung des Ausstellungsprojekts wuchs mein Interesse am Feld des urbanen ästhetischen Lernens und der non-formalen bzw. informellen Kulturellen Bildung im öffentlichen Raum. Durch die Mitarbeit bei der Aktionsausstellung sowie der dazugehörigen Tagung erlangte ich im Herbst 2011 weitere Kenntnisse im aktuellen Diskurs um den öffentlichen Raum als Sozial- und Bildungsraum. Sowohl soziologische, pädagogische als auch künstlerische und architektonische Perspektiven waren mit Christine Heil, Ulrike Stutz, Bettina Uhlig, Marion Thuswald, Uwe Lewitzky und Martina Löw wenn nicht als Tagungsgäste, dann indirekt durch den Büchertisch präsent. Meinen Zugang zum Thema des ästhetischen Lernens im urbanen Raum stellte also nach den Erfahrungen und Erlebnissen der Projektpraxis die intensive theoretische Auseinandersetzung dar. Damit behielt ich auch meine neugierig forschende, suchende Herangehensweise nach den Projektdurchführungen bei, als ich beschloss, meine Magisterarbeit zum Projekt MOVE_YOU und der Aktionsausstellung zu schreiben. WEM GEHÖRT DIE STADT? Interaktion, Irritation und Intervention durch kunstpädagogische Aktionen im urbanen Raum lautete der Titel. In Zusammenarbeit mit Wolfgang Zacharias entstand als erweiterte Fassung der Magisterarbeit diese Veröffentlichung, die sowohl aktuelle kunstpädagogische, anthropologische, kulturelle und mediale Positionen einbezieht als auch historische Einordnungen,
9 8 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum insbesondere seit ca. 1970, berücksichtigt und schließlich aus der Sicht verschiedenster Akteure, Pädagogen und Künstler einen breiten Praxisrahmen der Münchner Kultur- und Bildungslandschaft aufzeigt. Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum setzt sich somit aus vielerlei Elementen, Theoriebezügen, Versatzstücken, Praxisexkursen, Zwischenspielen und Projektbeschreibungen zusammen. Damit ist eine Art mehrperspektivische Collage entstanden, die versucht, das Thema anschaulich und aus verschiedenen Blickwinkeln zu behandeln. Dies unterstreichen auch die zahlreichen Abbildungen, die wenn nicht anders gekennzeichnet sowohl von den jeweiligen Projektleitern und -mitarbeitern als auch von den Teilnehmern, also den Kindern und Jugendlichen selbst, aufgenommen wurden: So werden vielfältige und differenzierte Einblicke möglich. Danken möchte ich an dieser Stelle der PA/Spielkultur e.v. und ganz speziell Wolfgang Zacharias für die Ermutigung und Begleitung dieser Veröffentlichung. Auch den vielen Projektleitern, die im Rahmen des Praxisteils ihre Aktionen und Programme anschaulich beschreiben, möchte ich für ihren flexiblen und kooperativen Einsatz danken. Ein ganz besonderer Dank geht außerdem an Christopher Wilker, der diese Veröffentlichung von Anfang bis Ende intensiv begleitet, gegengelesen und unterstützt hat. Danke auch an Elke und Stefan Schuster für die Inspiration und die Zeit, die sie mir geschenkt haben. Hinweisen möchte ich noch auf die Tatsache, dass in den Texten und Beiträgen auf die weibliche Form verzichtet wurde, diese jedoch selbstverständlich mit eingeschlossen ist. Auch wurden aus Gründen der Lesbarkeit bei einigen Zitaten auf Auslassungspunkte und eckige Klammern verzichtet, diese jedoch dadurch nicht in ihrer Aussage verfälscht. Die Hervorhebungen in den Zitaten wurden weitestgehend beibehalten. Meike Schuster (*1987), M.A., Kunst- und Kulturpädagogin aus Kulmbach, Oberfranken. Nach Abitur 2006 einjähriges Praktikum im Städel Museum Frankfurt Studium der Kunstpädagogik, Pädagogik und Kunstgeschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg freie Mitarbeit bei kunst-, kultur-, spiel- und naturpädagogischen Projekten der PA/SPIELkultur e.v. sowie bei Kultur & Spielraum e.v. in München. Dabei Konzeption und Leitung eigener mobiler Projekte. Seit 2013 freie Mitarbeiterin bei der Kreativitätsschule Düsseldorf e.v.
10 9 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial Entscheidend ist, dass ein Ort, der uns in verschiedenen Formen, Stofflichkeiten, Atmosphären begegnen kann und stets auf andere Zeiten und Ereignisse verweist, für ein Kind ein existentielles Gefühl für sein Hiersein vermittelt. Damit ist weit mehr als eine geografische Markierung gemeint. Das Hier als geografische Markierung kann als ein immer gleicher Ort historisch, sozial und kulturell einen jeweils anderen Raum abbilden. Raum bzw. Räumlichkeit wird generiert je nach der Weise der Nutzung, der Machtkonstellation und der Zeitbezüge. Es gibt so gesehen keinen neutralen Raum. Die Räume, in denen wir aufwachsen, leben und erziehen, beeinflussen uns über alle vorüberlegten Arrangements und bewusst angelegten Funktionen hinaus. Räume wirken bildend und sind für Heranwachsende wichtige Bedingungsgefüge ihrer Selbst- und Weltaneignung. Räume und ihre Orte werden sozial, kulturell und sinnlich-symbolisch vermittelt (Westphal/Hoffmann 2007:7). Ästhetisches Lernen fand lange Zeit offiziell und institutionell nur in geschlossenen Räumen und festen Gruppen, bestenfalls mit Exkursionen, statt und nannte sich Unterricht, Kurs oder Projekt. Die Öffnung von Schule und ein neues, erweitertes Verständnis von Lernen und Bildung erfolgte in vielen Teilschritten in den letzten hundert Jahren: Von den Reformpädagogen Anfang des 20. Jahrhunderts, die das Subjekt in den Mittelpunkt rückten und Natur und Umwelt stärker einbezogen, über die lebensweltlich orientierte Forschung in den 1920er und 1930er Jahren in der Großstadt bis zu den Erfindungen und Erneuerungen in den 1970er Jahren. Zu dieser Zeit wurde ganz bewusst die urbane und lokale Umwelt als Raum für ästhetische Bildung verstanden, und die Akteure entwickelten neue pädagogische Aktionsformen in der Stadtöffentlichkeit. Im Laufe der 1990er Jahre rückte der Raumbegriff selbst weiter in den Fokus und wurde aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven genauer betrachtet. Es kam zur raumkritischen Wende, dem spatial turn. Das Raumparadigma wurde somit variantenreich in verschiedenen systematischen Handlungsfeldern aktuell und sowohl diskurs- wie strukturrelevant behandelt. Gerade für die heutige Diskussion um das urbane Lernen spielt die Neuentdeckung des Raums durch den spatial turn eine entscheidende Rolle. Für die modernen formalen, non-formalen und informellen pädagogischen Infrastrukturen sind die analogen Begriffe der Bildungs-, Lern- oder Spiellandschaften leitend. In der Stadtgestaltung sowie in Kultur und Kunst spricht man zunehmend von Kulturräumen und vom öffentlichen Raum als ästhetischen Erlebnis-, Erfahrungs- und Aktionsraum. Im Kontext der neuen digitalen Medien geht es um immaterielle globale Welten, den Cyberspace und das globale Dorf. Die Aktualität des Raumparadigmas führt auch zur Rückbesinnung auf explizite und implizite Themen des Raums. Diese sind beispielsweise in einer Anthologie von Texten zur Theorie des Raums, herausgegeben von Stephan Günzel (2013), mit der einleitenden Begründung und einem interdisziplinären Ansatz von Ethnologie über Kunst-, Kultur- und Medienwissenschaften bis hin zu Design und Stadtplanung versammelt. Es stellt sich
11 10 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum heraus, das Raumdebatten erst im 20. Jahrhundert zum allgemeinen Diskursthema wurden: In dessen zweiter Hälfte erfolgte nicht nur eine Neubewertung des Räumlichen, sondern auch eine Rückbesinnung auf frühere Ansätze, zumeist begleitet von einem Übertrag eines Raumkonzepts aus einem naturwissenschaftlichen oder geographischen in einen kultur- oder sozialwissenschaftlichen Kontext (Günzel 2013:13). Perspektive Sozialraumorientierung Die Orientierung an räumlich-milieuspezifischen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen als Sozialraumorientierung im Kontext der Sozialen Arbeit meint sowohl handlungskonzeptionelle Reformprogramme als auch kommunal-administrative Strategien der neuen Steuerung in den Feldern Sozialer Arbeit, welche seit Anfang der 1990er Jahre weithin verhandelt werden (Kessl/Reutlinger 2011:1508). Der Terminus Sozialraum beschreibt räumlich definierbare und messbare Lebenslagen, ökonomische Verhältnisse und unterschiedliche Defizitstrukturen, z. B. mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf. Im Rahmen von Sozialarbeit und Sozialpädagogik ist die sozialräumliche Perspektive, vor allem, wenn es um systemisch-institutionelle Strukturen geht, umstritten (vgl. ebd.:1513). Schnell weist sie einseitig-negative, entpersönlichte Etikettierungen auf. Flächendeckende Hilfs- und Versorgungsverfahren festigen und fixieren die Zustände eher noch als diese zu verändern und ressourcengenerierende Prozesse vor Ort zu initiieren und zu motivieren. Dies betrifft insbesondere soziale Brennpunkte mit Exklusionstendenzen, z. B. bei urbanen Standortentwicklungen. Sozialraum meint dann einen territorialen Lebensraum, der durch eine geografische Fläche und aus einer besonderen Perspektive (Hilfsbedarf, Förderungen, Gestaltungszusammenhang) wahrgenommen und öffentlich betreut und verwaltet wird (Kiez, Quartier, Stadtteil, Viertel). Die Raumeinteilung erfolgt hierbei oft nach sozialen und statistischen Lebenskriterien oder den Adressaten (Kinder, Jugendliche, Senioren, Arbeitslose). Gemeint ist immer eine objektiviert-verwaltungsrelevante Problemgröße, nicht die subjektive und persönliche Lebensweltwahrnehmung. Die systematische Sozialraumorientierung blendet dabei die subjektiv-soziale Perspektive von einzelnen Menschen oder Gruppen und damit deren Raumdeutungen und Raumnutzungsmöglichkeiten aus (vgl. Kessl/Reutlinger 2005, 2007). Das Problem ist das Entstehen einer unsichtbaren Mauer in den Städten, die die soziale Spaltung je nach Wohn- und Lebenslage als Konsequenz der verwaltungstechnischen Sozialraumorientierung mit sich bringt. Was folgen sind Stigmatisierung und Ausgrenzung, etwa im urbanen Stadtquartiersprozess der Gentrifizierung, also der sozialen sowie kulturell-ökonomischen Umwandlung eines Stadtgebiets (vgl. Budde/Früchtel/Hinte 2006). Im Verbund mit Jugendhilfe, Kultur-, Jugendarbeit und Schule entspannt sich die kritische Einschätzung, da hier im positiven Sinne das Subjekt, etwa das Kind oder der Jugendliche, zugunsten seiner aktiven Lebensweltaneignung und möglichen Bildungschancen im Mittelpunkt gesehen wird. Determinanten und Chancen für gelingende Sozialisation liegen in jeder Form von Umwelt: Schule, Jugendarbeit, Familie, Freundeskreis und Szene oder dem öffentlichen Raum. Dies bedeutet öffentlich-professionell steigenden Kooperations- und Vernetzungsbedarf der Akteure in lebensweltlichen, sozialräumlichen
12 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 11 und expansiv zu nutzenden Territorien, die so zu attraktiven Räumen aktiver Aneignung werden können (Deinet 2008:724). Dem eher weiten, raum- und subjektbezogenen Sozialraumverständnis ist eine sozialraumorientierte kunst- und kulturpädagogische Sichtweise verwandt. Hierbei liegt der Fokus auf räumlicher Präsenz und Repräsentanz künstlerischer, kultureller und ästhetischer Phänomene der jeweils erreichbaren und nutzbaren Lebens(um)welt. Sowohl die produktivgestaltende wie auch die partizipativ-interaktive Chance der Raumnutzung wird dabei als wertvoll gesehen und betont als Möglichkeit professioneller Aktivierungs- und Aktionsangebote für die in diesem Kultur- und Sozialraum lebenden Kinder und Jugendlichen. Dies ermöglicht ästhetisches Lernen vor Ort, in und außerhalb von Schule, in Kitas, Jugendarbeit und Kultureinrichtungen: So können räumliche Strukturen Ermöglichungsbedingungen für partizipatorische Bildungsprozesse schaffen, z. B. in der Strukturierung von Schulräumen, Stadträumen, Medienräumen (Stutz 2012:7). Hier setzt die chronotopologische Sicht- und Arbeitsweise einer Kulturellen Bildung 2.0 in zeiträumlicher Perspektive 3D (Zacharias 2012b:76) als zukunftsrelevantes und nachhaltiges Segment kulturell-ästhetischen Erlebens und Lernens an wie in dieser Veröffentlichung begründet und illustriert wird. Auseinandersetzungen und Aneignungsformen durch ästhetische Prozesse mit und in der städtischen Umwelt können die Mitsprache verschiedenster Menschen und damit auch die Teilhabe an einer demokratischen Öffentlichkeit ermöglichen und echte Urbanität entstehen lassen. Gerade offene kunst- und kulturpädagogische Angebote im Stadtraum bieten Kindern und Jugendlichen so Ausdrucksmöglichkeiten und geben ihnen eine eigene Stimme. Wie solche non-formalen Programme entstehen und aussehen können, zeigen die Projektbeispiele in dieser Veröffentlichung anschaulich (vgl. Phänomenologie und Kapitel 4). Der Verlauf der Erörterung zwischen Theorien und Praxisformen Über eine historische Einordnung, zeiträumliche Bezüge und die Darstellung zahlreicher aktueller Positionen von Pädagogen und Kunstwissenschaftlern soll in Kapitel 2 die Diskussionsgrundlage für ästhetisches Lernen im öffentlichen (Stadt-)Raum geschaffen werden. Rückblicke in die kultur- und kunstpädagogische Bewegung und Theoriebildung seit den 1970er Jahren sind dabei ebenso Bestandteil wie mediale und künstlerische Zeitbezüge. Die Auseinandersetzung mit den Themen Raumwahrnehmung, Aneignung von und Lernen in der städtischen Lebenswelt beschäftigte schon im 19. Jahrhundert Pädagogen und Soziologen. Deren Positionen und Theorien werden in den Ausführungen in Kapitel 3 vorgestellt und seien hier kurz genannt: Bis heute und speziell für die Beschäftigung mit Bildungsräumen haben die handlungs- und lebensweltorientierten Erkenntnisse des US-amerikanischen Pädagogen und Philosophen John Dewey, der mit seinen Werken Experience and Education (1938) und Art as Experience (1934) den Einfluss von Räumen und Umgebungen auf die kindliche Entwicklung darstellte, Relevanz. Gerade der Akzent Kunst erhält dort in einem weiten Verständnis besondere Bedeutung. Ebenfalls weit zurück reicht der sozialräumliche Ansatz der Hamburger Psychologin Martha Muchow, der ausführlich die Verankerung und Raumaneignung von Kindern und Jugendlichen im deutschen Großstadtraum der 1920er und 1930er Jahre beschreibt.
13 12 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Das neue und fast epochale relationale Raumverständnis der Soziologin Martina Löw, die Raum als von Prozessen, Strukturen und sozialen Handlungen geprägt versteht, bietet eine entscheidende Grundlage für ästhetische Bildungsprozesse im dynamischen, heterogenen Raum. Auch Erika Fischer-Lichtes Rauminterpretation und ihr Fokus auf performative, künstlerische Ereignisse, Erlebnisse sowie Wechselwirkungen von persönlichen Bedeutungen, Wahrnehmungen und Atmosphären, die ästhetische Erfahrungen überhaupt erst entstehen lassen, liefern wertvolle Begründungen für diese Prozesse. Relevant werden außerdem die aktuellen Positionen des Soziologen Uwe Lewitzky und der Kunstpädagogin Marion Thuswald, die die Bedeutung künstlerischer Ausdrucksformen und kultureller Programme im urbanen Raum herausstellen und so einen präzisierten Bogen zur Raumaneignung durch künstlerische und kunstvermittelnde Aktionen schlagen. Weitere Veröffentlichungen zum Thema Raumaneignung, beispielsweise der sozialräumliche Ansatz des Soziologen Ulrich Deinet, greifen traditionelle Erkenntnisse und Untersuchungen auf und entwickeln sie im Kontext moderner Raumvorstellungen weiter. Insgesamt illustrieren vier Praxisexkurse zum Projekt MOVE_YOU aus dem Jahr 2011 die theoretischen Ausführungen, in denen u. a. Irritationen, Interventionen und Interaktion der Projektpraxis im öffentlichen Raum sowie entstandene Zwischenräume und Atmosphären in Form qualitativer (Selbst-)Reflexion beschrieben werden. Anschließend an die Theoriebezüge wird in Kapitel 4 kurz die Kultur-, Lern-, Spiel- und Bildungslandschaft Münchens, das lokale Netzwerk der Stadt, vorgestellt, wobei dem exemplarischen kommunalen Gesamtkonzept Kulturelle Bildung (erstmals verabschiedet 1990), besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Den praxisbezogenen Schwerpunkt der Veröffentlichung bilden schließlich 36 Projekte und Programme der spiel-, kunstund kulturpädagogischen Szene Münchens. Insbesondere werden zahlreiche Formate mit sozialräumlichem Bezug der PA/SPIELkultur e.v. sowie deren Umfeld und Netzwerk vorgestellt. So sind unterschiedliche mobile, naturnahe und mediale Formate Teil der differenzierten kulturellen kommunalen Bildungslandschaft. Auch Projekte und Aktionen von Künstlern und temporäre Inszenierungen der Aktionsausstellung kunstwerkstadt 2011 im Münchner Rathaus werden beschrieben. Erweiterte Einblicke in kunst- und kulturpädagogische Programme in Deutschland und weltweit, kunstpädagogische Zusammenhänge und zeiträumliche Kontexte (chronotopologisch) gibt Wolfgang Zacharias in seiner Phänomenologie und den beiden Zwischenspielen. Das Finale mit Ausblick versucht als Resümee des Ganzen zugunsten einer professionellen Einbindung in sowohl erziehungswissenschaftliche Didaktik als auch handlungsorientierte Kulturpädagogik, Aussagen zur Planbarkeit, Organisierbarkeit und bildungspolitischen Begründbarkeit zu machen. Dabei liegt der Fokus auf temporär-situativem ästhetischen Lernen als Praxis mit infrastruktureller Einbindung in die (allgemeine) Kulturelle Bildung. Methodischer Hinweis leitende Begriffe Das balancierende Pendeln zwischen Begründungen und Erfahrungen, zwischen Theoriebezügen und Praxisprojekten des Folgenden ist gewollt. Gerade kulturpädagogische Praxis, die sich auf die flexiblen und fluiden Themen, Inhalte und Phänomene der Künste,
14 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 13 Kulturen, Medien, generell des Ästhetischen bezieht und Vermittlung professionell organisieren will, braucht beide Bezüge im engen, wechselweisen Verbund: praxisfundierte Theorien und theoriekompatible Praxis- und Projektvielfalt. Dies entspricht dem methodischen Ansatz der hier vorliegenden Themenbearbeitung im Wechselspiel von Reflexion und Produktion sowie von dokumentierten Erfahrungen und Verallgemeinerungen, sowohl in Form von Rückgriffen (Münchner Praxis ab 1970) als auch von traditionellen und aktuellen kunstpädagogischen Diskursen. Trotz fehlender Linearität und Wiederholungen ist gerade dies methodisch dem Thema, der Bezugspluralität und Handlungskomplexität im Fokus des subjektorientierten und sozialräumlichen ästhetischen Lernens angemessen. Vorausgeschickt sei die Benennung einiger leitender Begriffe, die wiederholt auftauchen. Sie liefern sozusagen die roten Fäden, die die Texte in Theorie und Praxis durchziehen und die gerade zwischen Entstehungs-, Begründungs- und Anwendungszusammenhängen immer wieder explizit benannt werden, um Zusammenhänge zu betonen und ein Profil zum Vorschein zu bringen. Situativ meint spezielle und nicht standardisiert-planbare, zeiträumliche und atmosphärische Gelegenheiten, bzw. Gegebenheiten. Diese entstehen aus eigensinnigen auch ästhetisch wahrnehmbaren und personell zufälligen Konstellationen mit authentischer Einmaligkeit in einem räumlichen (lokalen) Ensemble mit jedoch zumindest vergleichbaren Mustern und möglichen Verlaufsformen. Temporär meint zeitlich begrenzt, von einem Augenblick über Minuten, Stunden, Tage, Wochen bis hin zu Monaten, aber immer mit definierbarem Anfang und Ende. Es beschreibt die flexible zeitliche Dimension idealerweise partizipativ und situativ gemäß Interessen, Inhalten, Imaginationen, Bedingungen. Damit stehen temporäre Aktionen und Angebote in Differenz zu fixierten Zeitpartituren, etwa solchen des institutionellen Lernens. Performativ ist die darstellende Methode und Absicht dessen, was geschieht, geplant und inszeniert wird. Damit ist immer ein offenes, vermittelndes und zumindest informell bildendes Interesse verbunden. Performativität ist somit ein wichtiger Teil des komplexen ästhetischen Lernens in öffentlichen Räumen und in sozialen und atmosphärischen Milieus. Partizipativ bedeutet die Chance aktiver Teilhabe und idealerweise Mitgestaltung, Mitbestimmung dessen, was gerade geschieht oder was werden soll. Abhängig ist Partizipation als ein demokratieanaloges Kriterium ästhetischen Lernens von Ressourcen, Situationen und zeiträumlichen Gestaltungschancen. Interaktiv betont die kommunikative Wechselwirkung als individuelles Potenzial, als Bereicherung von Verläufen und Entwicklungen sowie die performative Partizipation bei situativ-temporären Anlässen, Projekten, Ereignissen und Abläufen. Zum Teil ist Interaktion selbstbildend und kompetenzfördernd. Die angeführten Wortdeutungen basieren auf einem weiten Verständnis des Ästhetischen: von Wahrnehmung bis Künste, von Sinneserfahrungen bis Symbolrezeption, -produktion und bis hin zu Medien und pluralen soziokulturellen Erscheinungs- und Ausdrucksformen. In diesem Verständnis übersteigt und unterfüttert das Ästhetische zeitspezifisch das, was jeweils als das Künstlerische (bzw. in kanonisierten/curricularisierten Formen als Kunst) bezeichnet und fixiert wird.
15 14 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Eine kleine Phänomenologie Kaleidoskop Kunst Spiel Aktion Raum: Places called public spaces for learning Wolfgang Zacharias Fast ein Zufallssammelsurium, was das Folgende enthält: Eine Illustration, worum es im öffentlichen Raum als Spiel-Kultur-Lern-Bildungsraum gehen kann, bunt gemischt. Zwei Vorbemerkungen: >> Die Qualitätsfrage wird hier absichtsvoll nicht gestellt, zumal sie für unterschiedliche Nutzer und Geschmäcker nicht vorsortiert beantwortet werden soll. Subjekt und Situation, Emotionen und Erfahrungen entscheiden. Die Exempel waren und sind allerdings nachgefragt und auffällig geworden. Sie haben, z. T. auch kontrovers, ihr Publikum gefunden. Die Frage Kunst oder nicht Kunst stellt sich hier nicht bzw. bestenfalls ironisch im gängigen Spruch: Ist das Kunst oder kann das weg? Jedenfalls geschehen alle hier aufgeführten Beispiele öffentlich, inszeniert, sind und werden Teil von Diskursen und Erinnerungen und sind damit immer auch bildungsrelevant. >> Temporär-situative, ungewöhnliche Ereignisse und Inszenierungen werden inzwischen, oft leicht abfällig, als Event etikettiert. Eine Unterscheidung zwischen Festen, Festivals, Festspielen, Umzügen, Prozessionen und Jubiläen macht jedoch keinen Sinn. Pop- wie massenkulturelle Phänomene einer damit denunzierten Spaßgesellschaft bieten natürlich ästhetische Erlebnisse und Erfahrungen aller Art und in aller Differenz und Pluralität, mit variantenreichen Erscheinungsformen als populäre Events : Sie sind Zeichen kulturellen Wandels im Horizont von Medialität, Spiel, Öffentlichkeit, Urbanität, Orten, Räumen, Prominenz, Faszination, Inszenierungen im wechselseitigen Steigerungsspiel (vgl. Hepp/Höhn/Vogelgesang 2010). Der Kultursoziologe Lutz Hieber, der sich mit der Ästhetisierung des Sozialen beschäftigt (vgl. Hieber/Moebius 2011), thematisiert die Vermischung von Kunstwelten und Popkulturen historisch als raumzeitlich übergreifende transformatorischästhetische Phänomene: Pop entfaltet sich in den USA als gattungsübergreifendes Phänomen. Einer der ersten Höhepunkte waren in den sechziger Jahren die Ereignisse in San Francisco. Bilderwelten entstanden in Form des psychedelischen Plakats, das die Galerie verschmähte und auf die Straße drängte. Einer der Begründer des psychedelischen Plakats, Victor Moscoso, hatte beim früheren Bauhaus-Lehrer Josef Albers studiert. Der Acid-Rock von Jimi Hendrix, den Doors, Grateful Dead, von Janis Joplin und ihrer Band Big Brother and the Holding Company forderten das Gegenteil der im Konzertsaal bis dahin üblichen Kontemplation ihre Musik wurde tanzend rezipiert. Künstler des Abstrakten Expressionismus statteten die Rockmusik-Säle mit Lichteffekten aus (Hieber, SZ :15). Das Populäre in den Kulturen, ob als Pop- oder Subkulturen, Event oder massenmedialer Hype, findet immer sein besonderes, auch mehrheitsfähiges Publikum, meist mit einer kommerziellen und konsumanalogen Dimension. Dieses Publikum findet das
16 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 15 jeweilige kulturelle Produkt entsprechend Wahrnehmung, Erlebnis und Emotionalität, Erregung und Betroffenheit, Spaß und Freude, einfach schön: jeder Einzelne, aus welchen Motiven auch immer; die Summe zählt. All dies sind ästhetische Erlebnisse und Erfahrungen, mit subjektiv empfundener und kollektiv geteilter Pluralität des Schönen. Heute noch von einer abwertenden, distinktiven Ästhetisierung der Lebenswelt mit E- und U-Kulturen, Volks- und Konsum-/Billigkulturen zu reden und wertsetzend Menschen und ihre ästhetischen Interessen nach oben oder unten zu kategorisieren bzw. objektiv Schönheiten zu kanonisieren, macht keinen Sinn mehr. Dies gilt umso mehr, sobald wir im Kontext von Bildung vom Subjekt ausgehen und seinen interaktiven und partizipativen Interessen, z. B. bezüglich (massen)medialer Phänomene. Andernfalls müsste man hier auch von sozialer bzw. intellektueller Diskriminierung sprechen. Die große Mehrheit der Zeitgenossen strebt nach Eindrücken, Erfahrungen, Erlebnissen, die sie als schön empfindet und zwar, weil sie sie als schön empfindet. Die meisten derartigen Dinge, Aufführungen, Aktivitäten und Kunstgenres werden von der herkömmlichen Ästhetik übersehen oder/und als trivial defizient abgetan (Maase 2008:9). Dies betrifft beispielsweise und ganz allgemein: Faschingsumzüge, Karneval in Köln und Mainz und so weiter: Der öffentliche Raum als Makrobühne mit Tradition und Aktualitäten eine ästhetisch-performative Masseninszenierung und jährliche Selbstverständlichkeit. Das deutschlandweite Wave-Gotik-Treffen an Pfingsten in Leipzig verändert die Wahrnehmung in der Stadt: All die jungen schwarzen, sich selbst seltsam inszenierenden Leute der öffentliche Raum macht es möglich. Wallfahrten und Pilgerreisen, Lourdes und Mekka, Altötting und das rituelle Bad im indischen Ganges gehören eigentlich auch hierher: Oft einmalige Lebenshöhepunkte in großen Masseninszenierungen mit performativen Verlaufsformen, jahrhundertealten Traditionen und eindeutig kulturell-ästhetischen Akzenten, erlebnis- und ereignisintensiv (selbst) inszeniert. Das Folgende versteht sich als Art collagiertes Kaleidoskop einer eher zufälligen Auswahl auf der Basis aufgehobener Dokumente, Prospekte, Zeitungsausschnitte als
17 16 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum kleine Zufallsphänomenologie: mit Referenztipps aus den Künsten, urbanen Inszenierungswelten und Künstlersetzungen wie der Soziokultur und Jugendbildungsarbeit. Der unsystematisch entfaltete Phänomenreichtum zeigt die bildende Vielfalt des Erscheinens neuer künstlerischer und ästhetischer Produktionsformen der Eroberung, Besetzung und Besiedelung des öffentlichen Raums jenseits ökonomischer oder technologischer Nutzungsinteressen, aber mit deutlichen Aufmerksamkeits-, Erlebnis- und Erfahrungschancen. Immer wieder neu werden überraschende Raum- Zeit-Konstellationen mit biografisch relevanten, realen und unterschiedlichsten Symbol- und Inhaltsbedeutungen deutlich: die Lebenswelt als Alltagsbühne. Sie ist jedoch durchsetzt mit Imaginationen, Interaktionen, Irritationen und Interventionen als überraschende Wahrnehmungs- und Sinndeutungsmöglichkeiten. Die kleine Phänomenologie-Parade beginnt entsprechend dem Entstehungszusammenhang und der vorrangigen Lokalisierung des in dieser Veröffentlichung Thematisierten in München. Eine subversive Frage begleitet diese Präsentation: Wem gehört die Stadt? Wo sind Spielräume für partizipative Aktions-, Lern- und Kulturräume? Daraus, beispielsweise aus künstlerischen, aber auch transformatorisch-protesthaltigen Initiativen und Aktionen, gilt es eine kulturpädagogische Programmatik zugunsten des ästhetischen Lernens in öffentlichen, urbanen Räumen und an ungewöhnlichen Orten zu entwickeln ohne Imitationen und ohne nur reflexive Reduktion: handelnd erfindend, situativ und temporär im Hier und Heute, motiviert und inszeniert durch die Künste, aber im bildend-pädagogischen Interesse als leitende Intention. Entstanden ist ein durchaus erfindungsreich-amüsantes Wortfeld, eine Ereigniscollage. Da und dort: Künste und Aktionen Es beginnt in München-Schwabing: Situation Schackstraße Der Künstler HA Schult kippte in Form einer Materialshow lastwagenweise alte Zeitungen auf die Nebenstraße am Siegestor und der Kunstakademie. Kunst trifft Wirklichkeit, das Material des Alltags wird zum Material der Kunstaktion durch künstlerische Setzung. Wir jungen Kunstpädagogen waren begeistert, auch wenn HA Schult ein arrogantes A.loch war, wie wir ihn betitelten, allerdings durchaus anteilig bewundernd. Die Polizei kam. Das war großartig, sie wurde, notwendigerweise und unwissend, zum irritiert performativen Inszenierungsanteil, also zur Kunst per Künstlerdefinition. HA Schult hat seitdem vielerlei im öffentlichen Raum inszeniert, von New York bis Köln, aber: immer unter der Großkunstschutzglocke, genehmigt, versichert, pressebegleitet, wohl auch gut finanziert. Aktionskunst, öffentlich und museal, verbreitete sich. Valie Export ließ sich am Münchner Stachus ihre hinter einem Karton verborgenen Brüste öffentlich befühlen (Aktion). Marina Abramović stellte sich mit ihrem Partner in Bologna nackt aus (Performance) und wiederholte derartige Aktionen retrospektiv-musealisierend, z. B. um 2009 im MoMa in New York. 1 Die SZ titelte im Feuilleton am zur 1
18 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 17 Feststellung, dass die Aktionskunst (z. B. heute auch als Performance) nun auf dem Weg ins Museum sei: Der Wumms des Augenblicks, der vergeht. Der US-Amerikaner Allan Kaprow propagierte mit der Methode und Kunstform Happening die Verschmelzung von Kunst und Leben: What is a Happening? A game, an adventure, number of activities, engaged in by participants for the sake of playing (1967). Kunst wurde zum sozial-kulturellen Instrument, zum Spiel, zur spontanen Gemeinschaft im öffentlichen Raum, zum Protest. Man konnte und kann auch sagen: Aktion, Intervention, Irritation, Performance, Show, Event, Inszenierung. In einer Ausstellung im Münchner Haus der Kunst 2006 wurde Allan Kaprow sozusagen reinszeniert und musealisiert, archiviert und präsentiert gleichermaßen. Environments war ein früher Zentralbegriff Allan Kaprows: veränderbar inszenierte Räume mit atmosphärischen Besonderheiten. Eine edukative Funktion war prinzipiell mitgedacht Kunstaktion als Vermittlungsanstoß ästhetischer Erfahrungen. Zumindest erwähnt sei die Kunstbewegung in den offenen Raum, als Landart bekannt seit den 1960ern vor allem in den USA. Es war auch ein Auf- und Ausbruch aus traditionellen Kunsträumen in die Natur und eine gestaltende Transformation und Interpretation von Landschaften, situativ gegebenen Großräumen sowie ungewöhnlichen Orten. Beispielhaft genannt sei hier Walter de Maria: Maps, Bulldozers maintools of a new art war seine Programmatik, etwa in der Wüste und 1977 war er auf der Documenta Kassel vertreten. Landart allerdings lässt sich in vielen Varianten denken und machen, insbesondere auch als kultur- und kunstpädagogisches Projekt, jetzt mit Begründungen und Effekten des Spacings (Löw 2001) und zweckfrei-intensiven ästhetischen Raumerfahrungen. In diesem Anregungsmilieu begann in München und Nürnberg die paed-action rund um 1970 als KEKS. Urbane Kunstdiskurse und Highlights im öffentlichen Raum Natürlich gehört der Verweis auf Street Art und Urban Art hierher. Sie sind immer wieder neu der subkulturell-subversive Aufbruch zur Nutzung und Illustration der öffentlichen Räume, in der Spannung zwischen Sachbeschädigung, Kunstfreiheit und frischer Jugendästhetik, weltweit. Der Graffitistar Banksy ist inzwischen Kunst und Kult, Filmthe-
19 18 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum ma und Kunsthandels-Produkt, Politbotschafter und visueller Interventionist überraschender Raum- und Ortsinterpretation sowie Protagonist für Millionen Jugendliche. Illegale Skulpturen verwandeln die Stadt in einen Abenteuerspielplatz der Künste. Der öffentliche Raum wird plastisch und surreal bevölkert, mit Anklängen an die Pariser Situationisten der 1960er, an Fluxus, Dada, Ready-Mades und Minimalismus moderner Kunstavantgarden damals, auch Vorbilder der neuen Streetartkünstler mit einer Doppelprogrammatik: Streetartskulpturen für alle und die kulturelle Öffentlichkeit sowie street credibility, szenischen Ruhm für den (teils) anonymen Künstler. Inzwischen gibt es immer mehr Musealisierung und Erinnerungsarbeit im öffentlichen Raum: , Treff in der Pinakothek der Moderne, München, jeder hat einen Stuhl dabei. Es geht los in den Stadtraum: Der Chairwalk von Joseph Beuys und zu Ehren seines 90. Geburtstags als eine Rememberaktion (aber wir Münchner paed-actionisten machten dies jenseits von Beuys als KEKS-Aktion mit dem Titel: Bayrischer Stuhlgang schon 1968/69 und wiederholten dies als KEKS-Revival 2011). Kunst und Künstler sind mit intervenierenden Aktionen temporär, performativ und partizipativ längst im öffentlichen Raum, mit und ohne Genehmigungen angekommen. Einer der derzeit Großen mit Gehör in der art world weltweit formuliert treffend und selbstverständlich, worauf sich alles ästhetische Produzieren und Lernen in öffentlichen Räumen und mit irritativ-subversiven, transformierenden Absichten und Folgen beziehen kann und soll: Ich verstehe Kunst so, dass sie immer nach neuen Möglichkeiten fragt und versucht, die Grenzen des Bestehenden zu überschreiten. Ein Künstler muss mit seiner besonderen Empfindsamkeit auf das Leben reagieren und es verändern, sagt der Weltchinese Ai Weiwei im Spiegel-Interview (19/2013:97). Diese Programmatik gilt für alle, nicht nur für Kunst und Künstler, wenn wir Kulturen, Medien, Künste, das Ästhetische und Symbolische allgemein zu Inhalt und Form von Bildung machen wie etwa in der Kunstpädagogik und im ästhetischen Lernen. Zurück in der Zeit, nach Berlin und zur Kunst im öffentlichen Raum um 1987 und noch vor der Wende: Da war das große Ereignis Skulpturenboulevard Kurfürstendamm-Tauentzienstraße, ein Projekt des Neuen Berliner Kunstvereins im Auftrag des Senators für kulturelle Angelegenheiten anlässlich der 750 Jahrfeier Berlins. Im Prinzip war es ein statischer, moderner Möblierungsprozess durch beauftragte Künstler mit Parolen wie: Umfunktionierung, Verfremdung, Wiedergewinnung von Natur also subversiven Botschaften, symbolischer Verdichtung und Zuspitzung. Es gab Proteste konservativer Kunsterwartungen, beispielsweise die gestapelten Absperrgitter von Olaf Metzel am Kurfürstendamm betreffend. Berlin heute: 2011 fand das Internationale Street Games Festival: You Are Go! 2 von und mit dem Theaterhaus HAU2 statt. Es ging um postdigitale Spielkulturen, bei denen virtuelle Welten auf den Plattformen des Alltags installiert werden: Mit Smartphones und Walkie-Talkies ebenso wie mit Kreide und Luftballons, abstrusen Funktionen, Körpern in der Stadt, so der Flyertext. Hörpol heißt der Streifzug durch Berlin-Mitte für Menschen ab 14 mit Stadtplan und historischen Hotspots. Man geht, wo und wie man will und bekommt die inszenierten 2
20 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 19 Infos von bekannten Persönlichkeiten über MP3-Player oder ein geeignetes Handy 3. Die Selbstdarstellung im Prospekt: Hörpol fordert dich heraus, hat Risiken und Nebenwirkungen, lässt dich zweifeln, wütend werden, tanzen, lachen fragt dich, wer du bist. Ein großartiges Ensemble, museal und aktuell gleichermaßen, ist die East Side Gallery an der Spree in Friedrichshain. An sonnigen Sommertagen strömen die Massen, vor allem junge Menschen, aus wirklich aller Welt dorthin. Das Ganze umsonst und draußen. Es ist eine öffentliche Galerie aktueller Bildersprachen (Street Art, Graffiti) und eine historische symbolisch komplex ausgelegte Interpretation des geteilten Deutschlands Ost/West und der Wende auf der realen Fläche der damaligen Mauer, die als historisches Dokument hier erhalten und geschützt wird. Der langgezogene, zweiseitig begehbare Ort (Rückseite: Großfotos aktueller Mauern aus aller Welt, von USA/Mexiko über Israel/Palästina bis Irak) ist ein Erinnerungsmonument als aktuelles Erlebnis und Ereignis des ästhetischen und politischen Lernens, der Veranschaulichung im öffentlichen Raum (vgl. die in diesen Kapiteln verteilten Abbildungen). Auch in Berlin, Sommer 2013: Tausende strömen zum 17. Internationalen Bierfestival auf der Karl-Marx-Allee. Die Christopher-Street-Day-Parade und der Stadtmarathon inszenieren den öffentlichen Raum prominent und variantenreich. Der Kellnerlauf, das Rennen mit Servierequipment und im Berufsoutfit, lockt Zuschauer und legt am Kurfürstendamm den Verkehr lahm: Event und performative Partizipation für viele Tausende in ihrem öffentlichen Raum. Es gäbe noch viele Beispiele, wie das wunderbare Pfingstspektakel in Kreuzberg, Karneval der Kulturen. Mit einem Umzug verwandelt sich der Stadtteil zum interkulturellen Fest im öffentlichen Raum. Hier zeigt sich ein sowohl ästhetischer wie performativ-partizipativer Reichtum, der temporär und situativ überzeugt. Auch die Ausstellung Zerstörte Vielfalt im Gedenken an 75 Jahre Nazipogrome im Berliner Stadtraum gehört in diese Linie. Playing the City hieß die Aktionsausstellung in und ausgehend von der Schirn Kunsthalle Frankfurt Die stationäre Ausstellung wurde temporär mobil mit Interventionen und Präsentationen im Stadtraum ergänzt: Kunst, wo du sie nicht erwartest. Die Kunst als das große Spiel, mit öffentlich geförderten Protesten, Aktionen, 3
21 20 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Performances und einem White Dinner Flashmob zum Mitmachen, Staunen und Nachdenken für Frankfurter und Fremde, Kinder und Erwachsene. Auch provokant agierende Künstler sind so im öffentlichen, geförderten Kunst- und Kulturvertrieb angekommen. Emscherkunst in NRW, rund um Bottrop als aktuelle Kunst im Stadtraum und der Landschaft drumherum, Titelstory in der SZ 06/ : Die Ausstellung Emscherkunst findet genau das Publikum, von dem alle Museumsdirektoren träumen. Denn sie bringt die Kunst zu den Menschen in der gesellschaftlichen Peripherie immerhin eine begrüßenswerte soziokulturelle Programmatik. Kunstvermittlung ist dabei wohl die entscheidende Größe, Kuratoren erproben sich im öffentlichen Raum und beteuern, dass sie die Arbeit in der gesellschaftlichen Peripherie als ihr ureigenstes Terrain empfinden. Sommer 2013: In Essen findet die Star Wars Celebration statt. Der Krieg der Sterne, Kultfilm seit 1977, findet sein reales, leibliches und in Rollen verwandeltes Personal. Aus Medialität wird gespielte symbolische Realität der Fangemeinde. Sie meint es ernst und viele sind schon deutlich älter: Science-Fiction als Retroevent Fans in der Black-Rock-Wüste, Nevada, auch im Jahr 2013: Beim Burning Man Festival gibt es Musik und Kunstinstallationen und zum Abschluss geht die überlebensgroße Skulptur eines Mannes in Flammen auf. Kunst und/oder Event, elitär und/oder populär? In jedem Fall situativ und temporär und performativ für alle: ein Ereignis ästhetischen Erlebens und Erfahrens. Festspiele Wagnerjubiläum 2013: Der Ring der Nibelungen in Bayreuth, Frank Castorf, der frühere Berliner Theaterrevoluzzer, lässt Rheingold im Wilden Westen und die Walküre im Öl-Boom von Baku spielen: alles ästhetische Transformationen und Verfremdungen, temporär im Sommer und situativ auf einem Edelhügel in der fränkischen Kleinstadt Bayreuth. Alle kommen soweit prominent und andere nur, wenn sie Karten zugeteilt bekommen: auch ein Event im (teil-)öffentlichen Raum, hochsubventioniert, staatskulturtragend kommunal, föderal, national... Castorf wurde vor Ort ausgebuht und im Feuilleton hoch gelobt. Ästhetische Wertfragen sind eben sehr relativ und subjektiv, status- und kompetenzabhängig. Es geht um kulturelle Diskurschancen, nicht mehr vertikal (oben/unten), sondern horizontal: kulturelle Vielfalt und Akzeptanz des Fremden. Wagner ist dafür in Deutschland die perfekte Ausgangslage. Da steht die historische Belastung des Komponisten auf der einen Seite, das Werk mit seinen hochemotionalen Spannungsbögen auf der anderen. Die Frage bleibt nur, ob Frank Castorf eine Debatte anzetteln kann, die über ästhetische Fragen hinausgeht. Die Künstler des 20. Jahrhunderts taten sich da leichter. Abstraktion und Verfremdung waren Herausforderungen. Der gesellschaftliche Wandel hatte eine progressive Stoßrichtung. Heute gehören abstrakte Kunst und Punk zum kulturellen Kanon. Und die Bürgerschaft, die sich in den Künsten wiederfindet, kämpft weniger um Fortschritt als gegen die Tücken eines globalen Wandels (SZ, :4). Gleichzeitig findet in Wacken, einer CDU-regierten norddeutschen Gemeinde mit 1874 Einwohnern, das weltgrößte Heavy-Metal-Open-Air-Festival statt: Besucher in Zelten. Das neue Markenzeichen heißt Heavy Metal Town und bei der Eröffnung spielt 4
22 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 21 die Feuerwehrkapelle. Die Sensation 2013: Heino singt gemeinsam mit Rammstein Sonne, das Rammsteinlied, von Heino gecovert. Das ist großartig, Performationsund Erlebnisqualität sicher auf Bayreuth-Niveau. Heiliger Gral nannte das Feuilleton das Wackenevent auch, das immer ausverkauft und bezahlbar für alle ist. City-Animation und aktivierende Spielraumkulturen Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW 5 hieß es 2004 landesweit. Es ging um Spielraum für Spielräume: Erleben, Besetzen, Begegnen im öffentlichen Raum, veranstaltet vom Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW. Stadtabenteuer für Kinder und Jugendliche wurden gesucht und ermöglicht jenseits des virtuellen Raums, diesseits in der realen, analogen (Um-)Welt. 25 Kommunen machten mit. Diese Beteiligung ergab aus vielen Spielprojekten eine Struktur als Spiel- und Erfahrungslandschaft: Platz da!? Kulisse, Sandkasten, Marktplatz, Legotruck, Katzenparade, Straßenspiel, Hiphop unter der Rheinbrücke, Rollstuhlparcours, Fabelwesenwerkstatt, Tipidorf, Luminarium, Grionda Nocturna, Baggern, Aktionskunst, öffentliche Chatrooms, Es war einmal, Bonopolis, Auf die Plätze fertig, Spiel!, Knax-Bus-Fest, Menschenkicker, Drachentage, Schlaraffenland, Klasse Mülheim, Lust auf City, Spiel(t)räume, Bauhütte, Farbe bekennen!, Laufstelle, Kinderstadt-Taxi, Memory das alles gab es und noch viel mehr, beispielhaft und mit systematischen Folgen, wie kommunalen Gesamtkonzepten Kultureller Bildung und offenen Spielund Lernlandschaften. 5
23 22 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Das Berliner Projekt Junge Pächter 6, organisiert vom Jugendkunst- und Kulturhaus Schlesische 27 in Kooperation mit Studenten der FH Potsdam, inszeniert leere Räume u. a. in Neukölln: mit 2 Millionen Ideen, 20 Eimer Farbe, 1t Größenwahn, 6 Mal 70 qm Kreativität. Seit 2011 können Jugendliche und junge Erwachsene günstig, symbolisch und zeitbegrenzt leerstehende Räume pachten. Außerhalb von Schule und Familie verwirklichen sie dort ihre Interessen, beleben die Räume und leben ihre Kulturen, erleben praktisches Lernen, Organisieren, Inszenieren in eigener Regie, sozusagen als Kuratoren, ihrer Räume im öffentlichen Rahmen gegebenenfalls mit studentischen Mentoren sowie wohlwollendem, institutionellem Rückhalt: informelle (Selbst-)Bildungschancen. Performing the City zurück in München Kunst Aktionismus im Stadt Raum 60er und 70er Jahre : So hieß eine Ausstellung in der Städtischen Kunsthalle Lothringer 13 im Jahr Es ging um Tokio/Seoul/ Moskau/Neapel/Berlin/Paris/São Paulo/New York/Mexiko City und München. Die Ausstellung war eine Art lokaler Auftakt, sowohl kommunal- als auch kulturpolitisch, soweit es die Kunst als Initiative im öffentlichen Raum betraf. Ausgestellt wurde zum performativen Urbanismus der 1960er und 1970er Jahre. Unter institutions- und gesellschaftskritischen Vorzeichen begaben sich Künstler/innen auf die Straße als Ort leibhaftiger und idealiter demokratischer Öffentlichkeit. Getragen von der avantgardistischen Utopie einer Versöhnung von Kunst und Leben setzten sie dem Objektcharakter der Kunst die personengebundene Aktion entgegen. Dabei eröffnete sich ein Spektrum von konzeptualistischen und körperbetont aktionistischer, von spielerisch interventionistischer und dezidiert politischer Kunst, lautete es im Programmheft. Zumindest konzeptionell ein großartiger symbolischer Aufschlag öffentlich-kommunaler Kulturpolitik mitten in Bayern. München stellt (sich) aus. Im kommunalen Stadtmuseum gab es 2011 die Ausstellung Protest in München seit 1949, gemeinsam mit Universität, Volkshochschule, vielen Archiven sowie jede Menge alt gewordener, ehemals rebellischer und protestierender Zeitzeugen. Es war ein Art Veteranentreffen der 68er: Reclaim the streets, Prost Protest, Unruhe im Untergrund. Es gab Ortsbegehungen, Stadteilspaziergänge, Zeitzeugengespräche, sehr nett und auch nach dem Motto damals: Mia san dageng. Aber auch Mia san mia passt, der Slogan des FCB heute. Eine gefeierte Besonderheit: Die Schwabinger Krawalle an der Leopoldstraße 1962 (!), als drei studentische Straßengitarristen wegen öffentlicher Ruhestörung den tagelangen Protest Tausender auslösten in der Weltstadt mit Schmerz. Es war wunderbar: 2011 spielten in einem nahen soziokulturellen Zentrum, der städtischen Seidlvilla, eben diese drei Musiker, grauhaarige Siebzigjährige, nochmals vor deutlich älterem, exquisitem Publikum auf ihre Straßenlieder von damals, begleitet von Lesungen aus den damaligen Polizeiprotokollen. Es war seltsam und reminiszent, amüsant: Retro-Ereigniskultur, sehr lokal und bürgerlich. 6
24 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial folgte die Stadtmuseumsausstellung: Wem gehört die Stadt? 7. Es ging um Manifestationen neuer sozialer Bewegungen im München der 1970er Jahre die Eröffnungsansage: Durchsagen sind jederzeit möglich, Musik macht Sparifankerl 2, Bier steht im Kühlschrank. Auch die Kunsterziehergruppe KEKS (wir) wurde ebenfalls ausgestellt, also lebend musealisiert. Protest und Aktion in öffentlichen Räumen, zumindest rückwirkend, sind inzwischen akzeptiert und werden gefeiert: zeitgemäße Stadtgeschichte. Aber wie und wo geht es weiter? Was sind die entstehenden informellen und inventiven Formate, Erlebnisse und Erfahrungen der kommenden Generationen? Wo sind die Zeiten und Räume dafür, die dem 21. Jahrhundert angemessen sind? Vermessungen und Inszenierungen des Urbanen Eine Münchner Initiative heißt die urbanauten. 8 Sie erfindet und realisiert heute öffentliche urbane Events, temporär, kurzzeitig oder längerfristig: Es geht immer um die partizipativ-kommunikative Umnutzung öffentlicher Räume: z. B. der Strand an der Ludwigstraße vor der Uni und an der Isar beim Deutschen Museum. Oder das Corso Leopold: Da ist die zentrale Schwabinger Straße als Flanier-, Kultur- und Feiermeile zwei Wochenenden im Jahr gesperrt. Der Oberbürgermeister Christian Ude im Grußwort: Wo sonst Blechkarawanen den Straßenraum beherrschen, entsteht ein Ort urbanen Lebens und Erlebens, ein Freiraum für Kreativität und Phantasie, Inspiration und Interaktion (SZ, ). Analog fand 2013 der Isarboulevard auf Probe statt, die Parole: Kinder und Kunst statt Autos, mit Picknick und Prosecco, heute auch urbane Aktion genannt. Eine weitere Aktion der urbanauten und besonders amüsant gelungen: Mob in der Oper. Tatsächlich ein Flashmob in der Staatsoper! Kurzfristig angekündigt und per Facebook, Twitter, SMS und Mundpropaganda gesteuert, zog man durch die Stadt bis zu den Opernfestspielen mit einer entsprechenden Hausbesetzung: Die Oper gehört uns. Durch einen Hintereingang wurde dann die Bühne während der Aufführung bevölkert: Oper für alle. Der Flashmob der urbanauten war allerdings auf 200 Personen begrenzt und natürlich war alles mit der Opernregie inszenatorisch abgesprochen. Insofern waren die Protestler auch Komparsen mit Anrecht auf Pausenverköstigung. Darüber lässt sich streiten, pro und contra. Aber immerhin es zeigt, was inzwischen öffentlich-aktionistisch und als kulturell-ästhetische Mischpraxis geht. Die Fachöffentlichkeit nimmt Kenntnis davon: Die Evangelische Akademie Tutzing veranstaltete in Verbindung mit den urbanauten Anfang 2011 eine Fachtagung: Die
25 24 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Vermessung des Urbanen 3.0 : Der öffentliche Raum der Stadt erlebt gegenwärtig eine Renaissance. , SMS, später Blogs, Facebook und Twitter: anders als Kulturpessimisten prophezeiten, haben die neuen Kommunikationsfor(m)en des Internets nicht zu Verfall und Ende öffentlicher Stadträume geführt. Im Gegenteil, so hieß es im Programmheft. Themen waren: Telepolis und Datacity, Echtzeitfreiheit, Schöne neue Welt? Von der Steinzeit zur Echtzeit, Hybride Räume, Locating Media, Kunst und Protest, reale und virtuelle Interventionen, tweet up your life, Stadt als Spielplatz: Mobile Mixed Reality Spiele, Digitale Zivilgesellschaft? Und abschließend das Diskursthema im Plenum: Der öffentliche Zwischenraum, ein neues Aktionsfeld. Soweit die hochaktuelle und prominent vertretene Themen- und Begriffsspannweite in Tutzing. Im Sommer 2013 inszenierte die spanische Spektakelgruppe la Fura dels Baus vor der Münchner Oper und auch wieder im Rahmen der Festspiele, mit Polizeiorchester und Feuerwerk, die Show: Verdi vs. Wagner mit vorheriger Internetabstimmung. Verdi hat gewonnen. Schaustelle 9 heißt der temporäre Gerüstbau im Sommer 2013 vor oder besser hinter der Münchner Pinakothek der Moderne, während restauriert werden muss. Aktionen, die studentische Holzbaustelle, Schauing, Treffs und Performances wechseln sich ab, meist öffentlich, beispielsweise zum Thema Performativer Urbanismus aktive Architektur. Bring your own chair: Stühle. Stühle? Stühle! hieß eine Stuhlsammelaktion mit praktischen Diskurs- und Nutzungseffekten: Live on stage. Außerdem fanden in der Stadt Tagging-Aktionen (Markierungen mit Farben) statt, die dokumentiert und dann in der Schaustelle präsentiert wurden. Dann wurde 2013 die Münchenvariante von Dinner in Weiß am zentralen Wittelsbacherplatz organisiert allerdings nicht umsonst, obwohl draußen. Im Stadtteilpark Riem gab es das Holi-Festival, den indischen Lauf mit Farbbeuteln: 8000 nahmen teil. Im Sommer: Die Blade Night wälzt sich 19 km auf gesperrten Straßen durch die Stadt, jeweils Montags ab 21 Uhr. Tausende sind auf ihren Rollerskates dabei. Auch gibt es in diesem Kontext die SZ-Stadtteilsonderseiten mit regelmäßigen Wochenend-Sommerrätseln: anspruchsvolle Bildersuchspiele im begrenzten Münchner Quartier mit Preisen und der Auflösung eine Woche später. Die unspektakuläre, aber überraschende Bildauswahl ist eine amüsante Herausforderung. Tausende wandern suchend umher. Wenn man in so einer Straße, in oder an betroffener Location wohnt, ist was los. Informell kulturell-topografische und aktivierende visuell-ästhetische Bildung pur, oft in Grüppchen oder im Familienverband. Kürzlich in der TZ: ebenfalls ein Innenstadtrundgang mit verschiedenen, eher unbekannten, Attraktionen: Die erste Brezel im Kirchenfresko von 1318, der Lindwurm am Rathaus (warum? Pest!), die zu streichelnde Löwenschnauze an der Residenz (bringt Glück und Geld), die Kugel in der Mauer vom Alten Peter aus den Napoleonischen Kriegen, die Frauenbüste oben im Domgewölbe (wohl eine Köchin) sowie der Teufelstritt am Eingang. Dann der 182 kg schwere Stein im Residenzinnenhof, den Herzog Christoph der Starke (ca. 1470) warf, so die überlieferte Geschichte. Und die große Uhr am Isartor, deren Zeiger sich verkehrt herum drehen. Warum? Drinnen ist das Valentinmuseum, und er dachte eher linksdrehend. 9
26 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 25 Natürlich existiert auch ein Münchner Sprayerführer und Hinweise auf Streetart- Kunst im öffentlichen Raum. Der berühmteste Sprayer Münchens, Loomit, gibt heute Jugendkulturkurse im Jungendzentrum, verkauft in Galerien und hat bereits 1984 das private Badezimmer von Oberbürgermeister Ude gestaltet. Grünanlagenkunst und Urban Gardening gibt es genauso wie die Urban Explorer, die verfallene und vergessene Orte, Räume, Gebäude, Bunker, Hallen, Kanalisation suchen, öffnen, erkunden und temporär nutzen: für Spurensuche und realdigitale Schnitzeljagden, Detektivspiele wie Geocaching usw. Neu auch die öffentliche Pflege von Bienenvölkern: Im soziokulturellen Zentrum Seidlvilla wurden 2013 zwei Bienenvölker gehegt und gepflegt München summt. Ab September gab es dann Schwabinger Honig zu kaufen. Urban bodies werden maximal realistisch und überraschend im Stadtraum lokalisiert: Kunstaktionen z. B. der Tänzerin Monica Gomis. Und das temporäre Büro für irrelevante Zeichen verteilt überdimensionale Fundstücke im öffentlichen Raum. Ein Department für öffentliche Erscheinungen als Künstlerkollektiv verändert Wahrnehmung im öffentlichen Raum irritativ: public (dis)appearance. Auch als (re)appearance. Das mehrjährige Millionenprogramm des Münchner Kulturreferats 2013 A Space Called Public / Hoffentlich Öffentlich 10 bestückt die Stadt temporär und prominent inzwischen nach einem kunstbetriebsanalogen Kuratorenmodell (Elmgren und Dragset). Ein künstlerisch-ästhetisches Motiv ist angekommen Ereignisse und Projekte, performative Präsentationen und partizipative Aktionen an öffentlichen Orten und in urbanen Räumen. Ein kommunales Programm mit einem Zentrum im Rathaus und ca. 16 dezentralen, temporären Stationen und vielerlei Aktionen, Rundgängen, Events. Es hält schöne Überraschungen bereit, erzeugt sowohl Neugierde als auch Protest. Das Programm kooperiert mit Schulen und Sponsoren und wird durch das städtische Kulturreferat öffentlich finanziert, auch eine Dokumentation wird erstellt. Das Motiv ist also im öffentlichen Kunst- und Kulturbetrieb angekommen, hochlegitimiert, aber auch gezähmt, entschärft und professionell kuratiert sowie professionell vermittelt. Einige Beispiele aus dem Programm 2013: Das Metroprojekt von Martin Kippenberger hinter dem Rathaus imaginiert mittels einer Eingangstreppe ein globales U-Bahn-System, analog-assoziativ auslegbar als potenzielle weltweite Vernetzung. Das Projekt reicht seit 1993 von Hollywood über New York, Paris, Leipzig, Athen bis Ägypten. Allerdings hängt ein offizielles Schild vor dem fiktiven Eingang: Betreten verboten. Bustouren viermal links führen zu seltsamen, abgelegenen Orten, z. B. dem labyrinthischen Pharaonenhochhaus und einem Parkplatz im Euroindustriepark mit Parkwächtergespräch. Um 12 Uhr nachts geht es dann noch zu einem Kieswerk im Osten, wo man mit besonderem Schuhwerk eine Art beleuchtete Mondlandschaft erkundet. Dann ist da der umgestürzte Riesenbuddha am zentralen Viktualienmarkt mit Inschrift auf der sichtbaren Bodenfläche: Made in Dresden. Es gibt Dauerproteste, eine echte öffentliche Verunsicherung. 10
27 26 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum Am Odeonsplatz täglich um 12 Uhr ruft ein Sprecher in ein Megaphon: Es ist niemals zu spät, sich zu entschuldigen. An dieser Stelle scheiterte 1923 der Hitlerputsch. Wunderbar ist vor dem Hotel Bayerischer Hof das Bubblesdenkmal in Erinnerung an Michael Jacksons Affen. Es besteht aus jeder Menge Bildern, Souvenirs, Devotionalien, Blumen und Kerzen, von Fans regelmäßig gepflegt, drapiert rund um das seriöse Denkmal Orlando di Lassos. Aber schon vorher war die Fangemeinde auch ohne Kunstkuratierung am Denkmal daneben tätig: Für die Verehrungsstätte von Michael Jackson selbst, dem Jacko-Memorial. Er hatte im Hotel dahinter einmal übernachtet. Es ist der zentrale Münchner Fantreffpunkt. Diese haben die Pflege sehr sorgfältig übernommen. Man trifft auch allerlei Michael Jackson-Inkarnationen live und persönlich. Sie erzählen von ihrer Doppelidentität und Verehrung, bis ins Aussehen. Das Denkmal wird bisher geduldet, auch ohne Kunstaura und gegen die Hotelinteressen. Zukunft im kulturellen Spiel und als Kunstprojekt: Münchner Zeitkapsel der Friends Factory. Interessierte können Botschaften, Nachrichten, Dinge, Bilder, Objekte schicken, die für eine Ausstellung in München 2113 aufbewahrt werden. Mal sehen, ob es funktioniert, von der praktischen Idee zur inszenierten Präsentation. Jugendliche Raumkünste: Wildes Lernen und geplante Bildungsprojekte Natürlich hat das präsentative und partizipative kulturelle Raumparadigma längst auch die Kontexte von (Aus-)Bildung, Vermittlung, Pädagogik und Schule erreicht. Der Kreisjugendring München Stadt (KJR), der Zusammenschluss aller Jugendorganisationen, vertritt ein neues Programm: Wildes Lernen?!. 11 Es geht um werthaltige Jugend- und Freizeitarbeit, gerade auch in der Kooperation mit Schule: In den Inhalten werden die Leitlinie wie Partizipation, parteiliche Arbeit mit Mädchen und Jungen, Inklusion sowie Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt. Freiwilligkeit, Offenheit, Lebensweltorientierung, Selbstorganisation und Pluralität ermöglichen es, ein Stück mehr Bildungsgerechtigkeit für die Teilnehmenden zu realisieren, heißt es im Programm. Jugend(kultur)arbeit ist ein wichtiges Segment aller Kulturellen Bildung gerade neben Kunst- und Schulorientierung und deren Dominanzen. Betont wird der Akzent des informellen, sozial-kulturellen Lernens, lebensweltlich verortet. Es geht beim KJR auch um Räume: Räume jenseits formeller Einrichtungen sind für Kinder und Jugendliche attraktive Lernfelder, in denen sie ihre Selbstbestimmung erproben und sich individuell Kompetenzen aneignen, also durch ungewöhnliches, selbstwirksames, neugieriges, kreatives, experimentelles, eben wildes Lernen und Ausprobieren, insbesondere jenseits von Schule und Elternhaus. In der KJR-Einrichtung Die Färberei fand 1983 erstmals die jugendliche Graffitiszene Heimat und Schutz. Inzwischen gibt es dort eine Galerie, Sprayerworkshops, dazu 12 organisierte legale Flächen in der Stadt, Hiphop-Szene, Festivals und vieles mehr. Eine andere, inzwischen legendäre, kommunal finanzierte, aber eigenständige Jugendkulturwerkstatt ist das Münchner Feierwerk mit DIY-Kultur (Do It Yourself): Junge Künste, Musikstile, Sub- 11
28 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 27 kulturen, interkulturelle Formate, Farbenladen (Sprayerszene), Skaterplatz, Radio Feierwerk, Mehrgenerationenhaus, Fachstelle POP und dem Dschungelpalast für Kinderkulturarbeit. Das städtische Luisengymnasium im Zentrum führte 2011 das Projekt Platz da? Hier bin ich! durch. Es war inszeniert im Rahmen von Kunstunterricht als theatraler Protest mit Live-Performance im öffentlichen Raum rund um die Schule. Die Perspektive und Wunschidee der Flyer-Programmatik: Das subtile Spiel mit Raum und Mensch, Architektur und Zeit wirkt provozierend auf das gut geölte Alltagsgetriebe der Passanten. Es war sehr mutig entworfen und dann einmalig/temporär/situativ/lokal engagiert-angemessen gelungen: durchaus kunstpädagogisch zukunftsweisend. Ein Sommerspiel an zehn Orten in München veranstaltete 2013 der städtische Programmpartner und freie Verein Pädagogische Aktion/Spielen in der Stadt e.v. Das Stationenspiel mit zehn Disziplinen dauerte von Mai bis September: Schieben und Rollen, Werfen und Zielen, Balancieren und Kugeln, Fliegen und Treffen, Stapeln und Bauen, Laufen und Werfen, Fahren und Bauen, Werfen und Fangen, Abschlagen und Zielen, Transportieren und Kostümieren. Die Veranstaltung bot eine erspielbare, erfahrbare, erlebbare Stadt mit vielfältigen Spiel- und Aktionsformen, attraktiven Inszenierungen und offenen Angeboten als spiel- und sinnespädagogisches Ereignis. Dann ist da noch der effiziente und stadtweit mit zwei Zentren tätige Kinder- und Jugendkulturorganisator Kultur & Spielraum e.v. 12 Auch er ist seit etwa 1970 ein Ableger der Pädagogischen Aktion, KEKS & Co., kommunal finanziert und eigenständig seit Das vielfältige Programm stadtweit, drinnen und draußen, entspricht einem temporärsituativen räumlichen Ansatz mit Angeboten unterschiedlichster Anlässe, Inhaltsbezüge, Adressaten mit sporadischen wie kontinuierlichen Schulkooperationen. Das im Detail sozusagen gesamtkommunal gepuzzelte Programm hat jedoch professionelle, systematische Infrastrukturen, von Personal über Fuhrpark, Materialfundus und Lagerhallen bis zu Werbestrukturen und dauerhaften Kooperationspartnern (vom Deutschen Museum bis Oktoberfest). Sowohl eine eigene Kinder- und Jugendzeitung in Partnerschaft sowie die Regie des üppigen Netzwerks Kinderkultursommer KIKS 13 zugunsten informativer und kurzzeitiger Sommerereignisse wird stadtweit aktiv betrieben und ist auch überregional bekannt. Einige beispielhafte Programmangebote herausgegriffen: >> Die Kinderferienakademie Kunst & Krempel findet jährlich im Olympiapark am See statt: Zelte, Werkstätten, Ateliers mit Freiluftausstellung des Produzierten. Unter Anleitung von Künstlern, Handwerkern und Kulturpädagogen stellen Kinder und Jugendliche, z. B. aus Natur- und Abfallmaterialien, Kunst- und Spielobjekte her: Großbilder und Riesenfiguren, Windräder und Klanggerüste, Papiermode, Mobile und Mosaike, Spiegelbilder, Skulpturen und Objekte aus Holz, Gips, Metall, Stroh, Leder, Ton, Wolle, Seil, Stoff und vielen anderen Materialien. Gemalt und gezeichnet wird natürlich auch. >> Der Beitrag zum jährlichen Stadtgründungsfest im Juni und im ganzen Stadtzentrum heißt: Feuer auf der Isar. Es ist ein Aktionsprogramm im Alten Hof zur Geschichte Münchens mit Werkstätten, Bühne und einem Stationentheater mit
29 28 Stadt(t)räume Ästhetisches Lernen im öffentlichen Raum historischen Figuren durch die Altstadt. Meist gilt es, einen Kriminalfall zu lösen, dafür werden Detektive gesucht. >> Das Kinder-Krimifest dauert zwei Wochen mit Lesungen, Spielen, Krimi-Schreibwettbewerb in der ganzen Stadt und einem Highlight, der Kinder-Krimi-Nacht im soziokulturellen Zentrum Seidlvilla mit Preisverleihung für selbstverfasste Kurzkrimis. >> Jährlich während der Münchner Bücherschau im kommunalen Kulturzentrum Gasteig wird die Bücherschau Junior angeboten: Ein Spiel- und Aktionsraum mit über 30-jähriger Tradition: Aktivitäten rund ums Buch. >> Die Kinderuni München findet seit 2002 an der LMU, TU und den Kunsthochschulen statt und bietet Vorlesungen von echten Hochschulwissenschaften für neugierige Kinder an, samstags und mit Semesterthemen. Die Kinder kommen zahlreich. >> Wiesn-Forscherspiel: Auch das jährliche Oktoberfest wird zum Anlass einer besonderen ästhetisch-touristischen Forschung für Kinder und Familien mit Orientierungshilfen und Preisbelohnung mitten im größten Event der Stadt. >> Trepp auf Trepp ab heißen die Gruppen- und Schulklassen-Streifzüge durch das Münchner Rathaus hinter die Kulissen von Politik und Verwaltung, immer wieder mit Besuch beim Oberbürgermeister. Ein didaktisch-politischer Werkstattraum ist die Basis und gehört dazu mitten im Rathaus. >> Außerdem existiert noch das Aushängeschild und der Höhepunkt aller Münchner Kinder- und Jugendkulturprogramme, sozusagen das methodisch-partizipatorische Premiumprodukt: die Kinderspielstadt Mini-München 14 : Das Stadtspiel bietet interaktive Stadtstrukturen und Rollen dabei auf mehreren 1000 m 2 als real-symbolischen Handlungsraum, mit räumlich-temporären Infrastrukturen. Es gibt Berufe und Spielgeld, Arbeitsamt und Hochschule, TV und Küche ( Zur fetten Sau ), eine Stadtbaustelle und vieles mehr. Man kann Geld verdienen (MiMüs) und dafür echt einkaufen: Essen, Trinken, Werkstattdinge, Kinoeintritt, Lose usw. Gegründet 1979 im Jahr des Kindes von der Pädagogischen Aktion und den damaligen Aktivisten Gerd Grünseil, Karla Leonhardt, Haimo Liebich, Marina Mann, Hans Mayrhofer, Wolfgang Zacharias u. a. Es ist die Mutter aller Spielstädte, inzwischen bundesweit nachgeahmt von Düsseldorf über Berlin bis Regensburg und international, von Österreich bis Japan. Dieser komplexe Spiel- und Lernort, temporär und partizipativ, findet inzwischen alle zwei Jahre statt, mit ca. 100 Mitarbeitern, bis zu 3000 Kindern täglich, umsonst, drinnen und draußen im Olympiapark. Wir nannten es auch eine Schule des Lebens (vgl. Grüneisl/Zacharias 1989). Eigentlich müsste jedes Kind immer wieder und überall die Chance haben, an derartigen Projekten teilzunehmen. Es ist ein unübertroffener Spiel- und Lernraum pluraler und partizipativ-performativer Erlebnisse und Ereignisse: Eigentlich ein must have und nicht nur ein could be kommunaler Infrastrukturen für ästhetisch-sozialkulturelles Lernen der anderen Art als Schule und Unterricht. 14
30 1 Einführung: Räume bilden ästhetisch und sozial 29 Fazit: Ab nach draußen! Der Kulturjournalist Hanno Rauterberg schrieb in der ZEIT ( ), was aktuell die Dialektik der realen und digitalen Räume, der realdigitalen Welten und Lebenswirklichkeiten betrifft: Wie ausgerechnet das Internet eine Renaissance des öffentlichen Lebens befeuert. Zusammenfassend ist dies genau die phänomenologische Feststellung, Voraussage und Bedeutung, die das allgemeine Paradigma von situativen Räumen und Orten, Landschaften und Territorien, temporären Erlebnissen und Ereignissen darin zugunsten von Kultureller Bildung und ästhetischem Lernen qualifiziert auf Zukunft und nachhaltig im Generationenwechsel gesehen. Es ist ausgesprochen bemerkenswert, was Hanno Rauterberg schrieb, deshalb sei er abschließend ausführlich zitiert, denn es betrifft den öffentlichen Realraum wie auch die neuen digitalen Welten gleichermaßen als Einheit sowie deren durchaus produktiven Wechselverhältnisse: Eine stille Anarchie scheint viele Menschen zu erfassen, vor allem die jüngeren: Sie begreifen noch die hässlichsten Parkhäuser als Übungsplätze für athletische Kunststücke (Parkour), verwandeln betonierte Straßenränder in kleine Blumenbeete (Guerilla Gardening), machen aus Stromkästen Kunstwerke (Street Art) oder erklären verwaiste Stadtplätze zur neuen Partyzone (Outdoor Clubbing). Und wiederum ist das Internet, sind Facebook und Twitter oft Katalysatoren. Hier gibt es die nötigen Hinweise, hier wird überwunden, was als städtische Anonymität lange gefürchtet war. Von einem Mitmach-Urbanismus ließe sich sprechen, von Kreativ- oder von Wohlfühl-Urbanismus, denn ähnlich wie die Gesellschaft sich pluralisiert hat, bilden sich auf den Straßen und Plätzen höchst diverse Formen und Funktionen von Gemeinschaft. Und wohl gerade deshalb zieht es viele Menschen in die Stadt: Sie erweist sich als Möglichkeitsraum, offen für widerstreitende Interessen (Rauterberg 2013:14f.). Es geht also ohne offiziellen Kunstbezug, aber immer als kulturelle Praxis und kreatives Experiment auf den öffentlichen Raum bezogen: performatives Spacing. Hybridisierung heißt das auch: Öffentliches und Privates verschwimmen, Zeit und Raum werden diffus und wolkig, so Rauterberg. Der öffentliche Raum wird neu belebt, dank Internet, Smartphone und den neuen kulturellen Medienkompetenzen der kommenden Generationen, für die sie zunächst weder Schule noch Pädagogen benötigen. Sie brauchen einfach Räume und Möglichkeiten, Akzeptanz und Experimentierfreude, ästhetische Kreativität dank technologischer Faszinationen und kommunikativer Neugierde: digitale Nomaden, die im Öffentlichen zuhause sind (Rauterberg) mit der Parole: Ab nach draußen!
Organisationsadresse: c/o PA/ SPIELkultur e.v. Leopoldstr München
 Stand 24.08.2011 www.kunstwerk-stadt.de Organisationsadresse: c/o PA/ SPIELkultur e.v. Leopoldstr. 61 80802 München www.spielkultur.de info@kunstwerk-stadt.de Tagung Donnerstag 13.10./ Freitag 14.10.2011
Stand 24.08.2011 www.kunstwerk-stadt.de Organisationsadresse: c/o PA/ SPIELkultur e.v. Leopoldstr. 61 80802 München www.spielkultur.de info@kunstwerk-stadt.de Tagung Donnerstag 13.10./ Freitag 14.10.2011
Barrieren für die Raumaneignung armutsbetroffener Kinder
 Barrieren für die Raumaneignung armutsbetroffener Kinder Input im Rahmen der Tagung Teilhabe und Zugehörigkeit neu denken Inklusion von armutsbetroffenen Kindern, organisiert von der Volkshilfe;, Wien.
Barrieren für die Raumaneignung armutsbetroffener Kinder Input im Rahmen der Tagung Teilhabe und Zugehörigkeit neu denken Inklusion von armutsbetroffenen Kindern, organisiert von der Volkshilfe;, Wien.
Wedding-Strukturen 1
 Künstler aus dem Kreativzentrum Christiania zeigen im Brunnenviertel Wedding-Strukturen 1 Arbeiten auf Fotopapier und Industrie-Email Ort: Räume des KulturvorRat in der Ramlerstraße 28 A. Zeit: 20.12.2010
Künstler aus dem Kreativzentrum Christiania zeigen im Brunnenviertel Wedding-Strukturen 1 Arbeiten auf Fotopapier und Industrie-Email Ort: Räume des KulturvorRat in der Ramlerstraße 28 A. Zeit: 20.12.2010
Veranstaltungen von Michael Lingner an der FH / HAW (Fb: Gestaltung)
 Veranstaltungen von Michael Lingner an der FH / HAW (Fb: Gestaltung) 1985-2008 Wintersemester 1985/1986 Wahrnehmungstheoretische und philosophische Grundlagen der Rezeptionsästhetik Ihre Bedeutung für
Veranstaltungen von Michael Lingner an der FH / HAW (Fb: Gestaltung) 1985-2008 Wintersemester 1985/1986 Wahrnehmungstheoretische und philosophische Grundlagen der Rezeptionsästhetik Ihre Bedeutung für
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland
 Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Raumwahrnehmung aus soziologischer Perspektive
 Raumwahrnehmung aus soziologischer Perspektive Beitrag zur 7. Hessenkonferenz von Oktober 2015 Der Behälterraum Der Behälterraum bezeichnet ein Territorium bzw. ein dreidimensional einzugrenzendes Gebiet
Raumwahrnehmung aus soziologischer Perspektive Beitrag zur 7. Hessenkonferenz von Oktober 2015 Der Behälterraum Der Behälterraum bezeichnet ein Territorium bzw. ein dreidimensional einzugrenzendes Gebiet
Tanz und kulturelle Bildung
 Antje Klinge Tanz und kulturelle Bildung Tanz im Bildungskontext Kulturelle Bildung und Tanz Zum Bildungswert von Tanz Tanzvermittlung im Kontext kultureller Bildung Tanz im Bildungskontext PISA-Schock
Antje Klinge Tanz und kulturelle Bildung Tanz im Bildungskontext Kulturelle Bildung und Tanz Zum Bildungswert von Tanz Tanzvermittlung im Kontext kultureller Bildung Tanz im Bildungskontext PISA-Schock
Kulturelle Praxis und Interessen von Jugendlichen
 Olaf Martin Kulturelle Praxis und Interessen von Jugendlichen Tagung Jugendarbeit goes culture Freitag 1. November 2013 10 Uhr bis 17 Uhr Göttingen, Kulturzentrum musa Das Folgende 1. Ausgangsfragen 2.
Olaf Martin Kulturelle Praxis und Interessen von Jugendlichen Tagung Jugendarbeit goes culture Freitag 1. November 2013 10 Uhr bis 17 Uhr Göttingen, Kulturzentrum musa Das Folgende 1. Ausgangsfragen 2.
Einleitung. Martin Spieß. in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, S.
 Einleitung Martin Spieß in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, 2014. S. 13 14 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek
Einleitung Martin Spieß in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, 2014. S. 13 14 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek
Der 2. Band umfasst die Kapitel KAPITEL 3 steigen die Kinder aus und wir queren das offene Gelände und nähern
 Leseprobe No. 1 Vorwort Als ich im Sommer letzten Jahres Kolleg_innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anschrieb und sie bat mir einen Text für das vorliegende ebook zu schreiben, hatte ich
Leseprobe No. 1 Vorwort Als ich im Sommer letzten Jahres Kolleg_innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anschrieb und sie bat mir einen Text für das vorliegende ebook zu schreiben, hatte ich
In art we trust!? Zur gesellschaftlichen Relevanz Kultureller Bildung im 21. Jahrhundert
 In art we trust!? Zur gesellschaftlichen Relevanz Kultureller Bildung im 21. Jahrhundert Kulturkongress 2013 Rendsburg Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss Bundesakademie Wolfenbüttel Universität
In art we trust!? Zur gesellschaftlichen Relevanz Kultureller Bildung im 21. Jahrhundert Kulturkongress 2013 Rendsburg Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss Bundesakademie Wolfenbüttel Universität
Publikationen Studium Universale
 Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0
Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0
Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen heute
 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Gesichter des Bürgerfunks in NRW Fachtagung 21.-22. Mai 2012 Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen heute Prof. Dr. Ulrich Deinet,
Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Gesichter des Bürgerfunks in NRW Fachtagung 21.-22. Mai 2012 Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen heute Prof. Dr. Ulrich Deinet,
Ganztagsschule und sozialräumliche Bildungskultur
 Uwe Sielert Ute Kohrs Ulrich Selle Ulrich Ziermann Ganztagsschule und sozialräumliche Bildungskultur Ganztagsschule und sozialräumliche Bildungskultur Überblick: 1. Das ist Gaarden : ein audiovisueller
Uwe Sielert Ute Kohrs Ulrich Selle Ulrich Ziermann Ganztagsschule und sozialräumliche Bildungskultur Ganztagsschule und sozialräumliche Bildungskultur Überblick: 1. Das ist Gaarden : ein audiovisueller
SYMPOSIUM UND POP-UP-AUSSTELLUNG Kann Gestaltung Gesellschaft verändern?
 projekt bauhaus SYMPOSIUM UND POP-UP-AUSSTELLUNG Kann Gestaltung Gesellschaft verändern? Symposium Freitag, 18. bis Samstag, 19. September 2015 Pop-Up-Ausstellung Mittwoch, 3. bis Sonntag, 20. September
projekt bauhaus SYMPOSIUM UND POP-UP-AUSSTELLUNG Kann Gestaltung Gesellschaft verändern? Symposium Freitag, 18. bis Samstag, 19. September 2015 Pop-Up-Ausstellung Mittwoch, 3. bis Sonntag, 20. September
Wird Vermittlung überflüssig oder nur anders? Museumspädagogik, Wissensvermittlung, Pädagogische Kommunikation
 Wird Vermittlung überflüssig oder nur anders? Museumspädagogik, Wissensvermittlung, Pädagogische Kommunikation Fabian Hofmann, Goethe-Universität Frankfurt am Main / Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
Wird Vermittlung überflüssig oder nur anders? Museumspädagogik, Wissensvermittlung, Pädagogische Kommunikation Fabian Hofmann, Goethe-Universität Frankfurt am Main / Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
Veränderung ist eine gute Schule 2. Werkstatt für Pädagogik und Architektur
 Veränderung ist eine gute Schule 2. Werkstatt für Pädagogik und Architektur Werkstatt Lernen in der Baukulturellen Bildung Ablauf des Workshops 14.00 Uhr 16.00 Uhr UHRZEIT INHALT 14.00 14.15 UHR Vorstellung
Veränderung ist eine gute Schule 2. Werkstatt für Pädagogik und Architektur Werkstatt Lernen in der Baukulturellen Bildung Ablauf des Workshops 14.00 Uhr 16.00 Uhr UHRZEIT INHALT 14.00 14.15 UHR Vorstellung
Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen
 Ev. Hochschule NürnbergN Institut für f r Praxisforschung und Evaluation Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen Fachtagung
Ev. Hochschule NürnbergN Institut für f r Praxisforschung und Evaluation Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen Fachtagung
Prof. Dr. Iris Beck, Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker
 Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen (PuLL), dargestellt vor dem Hintergrund des Curriculums im M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaft Prof. Dr. Iris Beck, Prof. Dr. Anke Grotlüschen,
Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen (PuLL), dargestellt vor dem Hintergrund des Curriculums im M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaft Prof. Dr. Iris Beck, Prof. Dr. Anke Grotlüschen,
Moserstraße Stuttgart
 29. + 30. 07. 2017 Moserstraße Stuttgart www.labyrinth-stuttgart.de 1 Stuttgart, 01.12.2016 LABYRINTH Festival 2017 Interkulturelles spartenübergreifendes Straßenkunstfestival vom 29. - 30. Juli 2017 in
29. + 30. 07. 2017 Moserstraße Stuttgart www.labyrinth-stuttgart.de 1 Stuttgart, 01.12.2016 LABYRINTH Festival 2017 Interkulturelles spartenübergreifendes Straßenkunstfestival vom 29. - 30. Juli 2017 in
Fach: Bildende Kunst Klasse 5
 Fach: Bildende Kunst Klasse 5 Auf der Basis eigener Erfahrungen Gefühl für die Vielfalt von Darstellungsmöglichkeiten entwickeln Bilder bzw. Kunstwerke: beschreiben, vergleichen und bewerten üben Experimente
Fach: Bildende Kunst Klasse 5 Auf der Basis eigener Erfahrungen Gefühl für die Vielfalt von Darstellungsmöglichkeiten entwickeln Bilder bzw. Kunstwerke: beschreiben, vergleichen und bewerten üben Experimente
Jugendarbeit und Ganztagsschulen in lokalen Bildungslandschaften
 Jugendarbeit und Ganztagsschulen in lokalen Bildungslandschaften Fachtag Jugendfarm Bonn e.v. 14. Mai 2013 Theoretische und praktische Ansätze zur Bedeutung der Jugendarbeit im Kontext lokaler Bildungspartnerschaften
Jugendarbeit und Ganztagsschulen in lokalen Bildungslandschaften Fachtag Jugendfarm Bonn e.v. 14. Mai 2013 Theoretische und praktische Ansätze zur Bedeutung der Jugendarbeit im Kontext lokaler Bildungspartnerschaften
Präventionsketten als Chance einer gelingenden Zusammenarbeit in der Kommune. Sozialraumkonferenz 7. November 2016
 Präventionsketten als Chance einer gelingenden Zusammenarbeit in der Kommune Sozialraumkonferenz 7. November 2016 1 Realität versus Vision 2 Verständnis Präventionskette = kommunale, lebensphasenübergreifende
Präventionsketten als Chance einer gelingenden Zusammenarbeit in der Kommune Sozialraumkonferenz 7. November 2016 1 Realität versus Vision 2 Verständnis Präventionskette = kommunale, lebensphasenübergreifende
Eine Pädagogik der Inklusion
 Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Konzept Stadtteilarbeit. Stadtteilzentren in Hamm
 Konzept Stadtteilarbeit Stadtteilzentren in Hamm Geschichte der Stadtteilarbeit in Hamm Herausfordernd war die soziale Entwicklung der 80er und 90er Jahre, in denen sich in deutschen Großstädten soziale
Konzept Stadtteilarbeit Stadtteilzentren in Hamm Geschichte der Stadtteilarbeit in Hamm Herausfordernd war die soziale Entwicklung der 80er und 90er Jahre, in denen sich in deutschen Großstädten soziale
Es ist heute modern geworden, in allen Bereichen und auf allen. möglichen und unmöglichen Gebieten rankings zu
 Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Gustav Klimt und die Kunstschau 1908 am Dienstag, dem 30. September im Belvedere Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist heute modern
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Gustav Klimt und die Kunstschau 1908 am Dienstag, dem 30. September im Belvedere Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist heute modern
Gestaltung von Leistungen für Familien im Sozialraum Lebensphase Kita
 Dialogforum Bund trifft kommunale Praxis 30. November 2017/1. Dezember 2017 Gliederung 1. Vorstellung Projekt Weiterentwicklung der er Kinderund Jugendhilfe nach den Prinzipien der Sozialraumorientierung
Dialogforum Bund trifft kommunale Praxis 30. November 2017/1. Dezember 2017 Gliederung 1. Vorstellung Projekt Weiterentwicklung der er Kinderund Jugendhilfe nach den Prinzipien der Sozialraumorientierung
Dieter Daniels, Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 (second edition
 Dieter Daniels, Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 (second edition 1994) 380 pages Zusammenfassung: DUCHAMP UND DIE ANDEREN
Dieter Daniels, Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 (second edition 1994) 380 pages Zusammenfassung: DUCHAMP UND DIE ANDEREN
zur Eröffnung der Ausstellung Die Zehn Gebote.
 Redemanuskript für Landrat Dr. Müller zur Eröffnung der Ausstellung Die Zehn Gebote. Sinn & Design am Samstag, den 4.3.2017, um 15:30 Uhr im Museum Kloster Kamp, Abteiplatz 24, 47475 Kamp-Lintfort Es gilt
Redemanuskript für Landrat Dr. Müller zur Eröffnung der Ausstellung Die Zehn Gebote. Sinn & Design am Samstag, den 4.3.2017, um 15:30 Uhr im Museum Kloster Kamp, Abteiplatz 24, 47475 Kamp-Lintfort Es gilt
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit
 Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Pädagogische Grundprinzipien
 Pädagogische Grundprinzipien Heike Maria Schütz Oliver Wiek STUDIENHEFT FPG 1.2 Band 1.2 der Reihe Studienhefte für Ganztagsschulpädagogik Herausgegeben von Heike Maria Schütz im Auftrag der Akademie für
Pädagogische Grundprinzipien Heike Maria Schütz Oliver Wiek STUDIENHEFT FPG 1.2 Band 1.2 der Reihe Studienhefte für Ganztagsschulpädagogik Herausgegeben von Heike Maria Schütz im Auftrag der Akademie für
» Ästhetische Erfahrung, Kunsterfahrung, Umgang mit (originalen) Kunstwerken» Evaluation und Selbstreflexion in der kulturellen Bildung
 PROF. DR. PHIL. FABIAN HOFMANN, M.A. LEHRGEBIET Ästhetische Bildung und Erziehung in der Kindheit SCHWERPUNKTE» ästhetische Bildung und Erziehung» außerschulische Kunstpädagogik» Kunstvermittlung und Museumspädagogik»
PROF. DR. PHIL. FABIAN HOFMANN, M.A. LEHRGEBIET Ästhetische Bildung und Erziehung in der Kindheit SCHWERPUNKTE» ästhetische Bildung und Erziehung» außerschulische Kunstpädagogik» Kunstvermittlung und Museumspädagogik»
Die soziale Frage bei Gerhart Hauptmann
 Sprachen Matias Esser Die soziale Frage bei Gerhart Hauptmann Eine kulturwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Studie anhand ausgewählter Werke Masterarbeit Bibliografische Information der
Sprachen Matias Esser Die soziale Frage bei Gerhart Hauptmann Eine kulturwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Studie anhand ausgewählter Werke Masterarbeit Bibliografische Information der
Zeitgenössische Kunst verstehen. Wir machen Programm Museumsdienst Köln
 Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Albert-Einstein-Gymnasium
 Albert-Einstein-Gymnasium BILDUNGSSTANDARDS und SCHULCURRICULUM Fach: Kunst Klasse: 6 Zur Unterscheidung von G8 und G9 setzt der Fachlehrer/ die Fachlehrerin Schwerpunkte in von ihm/ ihr gewählten Bereichen
Albert-Einstein-Gymnasium BILDUNGSSTANDARDS und SCHULCURRICULUM Fach: Kunst Klasse: 6 Zur Unterscheidung von G8 und G9 setzt der Fachlehrer/ die Fachlehrerin Schwerpunkte in von ihm/ ihr gewählten Bereichen
DG: Eupen Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften. Sozialraumanalyse - Grundlagen
 DG: Eupen 27.11.12 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Sozialraumanalyse - Grundlagen Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Sozialraumorientierung
DG: Eupen 27.11.12 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Sozialraumanalyse - Grundlagen Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Sozialraumorientierung
#ODD16 #OGMNRW 1/5
 Wir plädieren für ein offenes NRW Wir sind Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und setzen uns dafür ein, den Prozess der Offenheit, Zusammenarbeit und
Wir plädieren für ein offenes NRW Wir sind Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und setzen uns dafür ein, den Prozess der Offenheit, Zusammenarbeit und
INTERKULTURELLE ÖFFNUNG & ZIELGRUPPENANSPRACHE. - Strategien aus Theorie & Praxis -
 INTERKULTURELLE ÖFFNUNG & ZIELGRUPPENANSPRACHE - Strategien aus Theorie & Praxis - Warum Interkultur? Es gibt eine migrationsbedingte demografische Herausforderung an die Kulturpolitik, die Kultur- und
INTERKULTURELLE ÖFFNUNG & ZIELGRUPPENANSPRACHE - Strategien aus Theorie & Praxis - Warum Interkultur? Es gibt eine migrationsbedingte demografische Herausforderung an die Kulturpolitik, die Kultur- und
VON DER HEYDT-MUSEUM WUPPERTAL BILDER ALS BRÜCKE ZUR SPRACHE
 VON DER HEYDT-MUSEUM WUPPERTAL Deutsch lernen im Museum Ein Projekt des Von der Heydt-Museums Museen sind ein zentraler Teil unserer kulturellen Landschaft. Als Orte des Sammelns und Bewahrens, aber auch
VON DER HEYDT-MUSEUM WUPPERTAL Deutsch lernen im Museum Ein Projekt des Von der Heydt-Museums Museen sind ein zentraler Teil unserer kulturellen Landschaft. Als Orte des Sammelns und Bewahrens, aber auch
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend
 Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Fachtagung Sprache durch Kunst 24. April 2015 von Uhr Eine Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen gefördert durch die Stiftung Mercator
 Tagungsdokumentation Sprache durch Kunst ist ein interkulturelles Kooperationsprojekt zwischen dem Museum Folkwang und der Universität Duisburg-Essen, das Kunstvermittlung und Sprachförderung verbindet.
Tagungsdokumentation Sprache durch Kunst ist ein interkulturelles Kooperationsprojekt zwischen dem Museum Folkwang und der Universität Duisburg-Essen, das Kunstvermittlung und Sprachförderung verbindet.
ANTRAG ZUR AUFNAHME IN MUSENKUSS MÜNCHEN
 ANTRAG ZUR AUFNAHME IN MUSENKUSS MÜNCHEN ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION Name der Organisation / Einrichtung Vertretungsberechtigte/r Ansprechpartner/in für die Musenkuss-Redaktion Postadresse Telefon
ANTRAG ZUR AUFNAHME IN MUSENKUSS MÜNCHEN ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION Name der Organisation / Einrichtung Vertretungsberechtigte/r Ansprechpartner/in für die Musenkuss-Redaktion Postadresse Telefon
6. Modelle vermittelter Kommunikation
 06-05-1001-1 Basismodul I: Vorlesung Theorien der Kommunikationswissenschaft WS 2013/14 6. Modelle vermittelter Kommunikation Dr. Denise Sommer Lehrstuhl für Historische und Systematische Kommunikationswissenschaft
06-05-1001-1 Basismodul I: Vorlesung Theorien der Kommunikationswissenschaft WS 2013/14 6. Modelle vermittelter Kommunikation Dr. Denise Sommer Lehrstuhl für Historische und Systematische Kommunikationswissenschaft
Bildung im Netzwerk - Netzwerke bilden
 Bildung im Netzwerk - Netzwerke bilden Impulsvortrag der 4. TischMesse der Kinder- und Jugendhilfe in Radolfzell Anke Schlums, Bildungsmanagerin Was ist Bildung? Annäherung an einen modernen Bildungsbegriff
Bildung im Netzwerk - Netzwerke bilden Impulsvortrag der 4. TischMesse der Kinder- und Jugendhilfe in Radolfzell Anke Schlums, Bildungsmanagerin Was ist Bildung? Annäherung an einen modernen Bildungsbegriff
Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten
 Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten 1. Stundendotation 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 1. Semester 3 3 3 4 2. Semester 3 3 3 4 2. Allgemeine Bildungsziele Es gelten die
Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten 1. Stundendotation 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 1. Semester 3 3 3 4 2. Semester 3 3 3 4 2. Allgemeine Bildungsziele Es gelten die
Antje Flade (Hrsg.) Stadt und Gesellschaft. im Fokus aktueller. Stadtforschung. Konzepte-Herausforderungen- Perspektiven.
 Antje Flade (Hrsg.) Stadt und Gesellschaft im Fokus aktueller Stadtforschung KonzepteHerausforderungen Perspektiven ^ Springer VS Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung
Antje Flade (Hrsg.) Stadt und Gesellschaft im Fokus aktueller Stadtforschung KonzepteHerausforderungen Perspektiven ^ Springer VS Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung
Teilstudiengang. Kunst für das Lehramt an Gymnasien. Studienheft
 Teilstudiengang Kunst für das Lehramt an Gymnasien Studienheft Willkommen an der Kunsthochschule Kassel Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung haben wir nicht Ihre Mappe aufgenommen, sondern Sie als Person,
Teilstudiengang Kunst für das Lehramt an Gymnasien Studienheft Willkommen an der Kunsthochschule Kassel Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung haben wir nicht Ihre Mappe aufgenommen, sondern Sie als Person,
Handbuch Gemeinwesenarbeit
 Traditionen und Positionen, Konzepte und Methoden. Deutschland Schweiz Österreich Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 4 Herausgegeben von: Sabine Stövesand Ueli Troxler Tagung Gemeinwesenarbeit
Traditionen und Positionen, Konzepte und Methoden. Deutschland Schweiz Österreich Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 4 Herausgegeben von: Sabine Stövesand Ueli Troxler Tagung Gemeinwesenarbeit
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart
 Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Leben und Aufwachsen in marginalisierten Lebensräumen - Bewältigungsstrategien männlicher Jugendlicher
 Leben und Aufwachsen in marginalisierten Lebensräumen - Bewältigungsstrategien männlicher Jugendlicher Barbara Rink Leben und Aufwachsen in marginalisierten Lebensräumen Bewältigungsstrategien männlicher
Leben und Aufwachsen in marginalisierten Lebensräumen - Bewältigungsstrategien männlicher Jugendlicher Barbara Rink Leben und Aufwachsen in marginalisierten Lebensräumen Bewältigungsstrategien männlicher
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Schrey 09/01
 Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Schrey 09/01 Vier Kriterien eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts T H E S E Der Deutschunterricht stellt den Schülerinnen
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Schrey 09/01 Vier Kriterien eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts T H E S E Der Deutschunterricht stellt den Schülerinnen
Forum 4. Jugendhilfe und Schule eine Win-Win Situation? Input 1 Erich Sass. Wissenschaftliche Fachtagung. Wissenschaftliche Fachtagung
 Forum 4 Wissenschaftliche Begleitung des Projektes Bildung(s)gestalten Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung gestalten Bildungslandschaften Input 1 Erich Sass Jugendhilfe und Schule eine
Forum 4 Wissenschaftliche Begleitung des Projektes Bildung(s)gestalten Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung gestalten Bildungslandschaften Input 1 Erich Sass Jugendhilfe und Schule eine
Qualifikationsphase (Q1) - GRUNDKURS. Unterrichtsvorhaben II:
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Pädagogik Leibniz-Gymnasium Dortmund Qualifikationsphase (Q1) - GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wer ist Papis Frau? Pädagogisches Handeln auf der Grundlage des
Schulinterner Lehrplan für das Fach Pädagogik Leibniz-Gymnasium Dortmund Qualifikationsphase (Q1) - GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wer ist Papis Frau? Pädagogisches Handeln auf der Grundlage des
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Kunst- und Kulturgeschichte
 Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Joseph Beuys - Werk und Wirkung
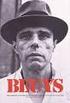 Medien Catharina Cerezo Joseph Beuys - Werk und Wirkung Bachelorarbeit Universität Konstanz Geisteswissenschaftliche Sektion Fachbereich Literaturwissenschaft Literatur-Kunst-Medien Bachelorarbeit Joseph
Medien Catharina Cerezo Joseph Beuys - Werk und Wirkung Bachelorarbeit Universität Konstanz Geisteswissenschaftliche Sektion Fachbereich Literaturwissenschaft Literatur-Kunst-Medien Bachelorarbeit Joseph
WAS IST KULTURELLE BILDUNG? Antworten in einfacher Sprache
 WAS IST KULTURELLE BILDUNG? Antworten in einfacher Sprache Text in einfacher Sprache: Charlotte Hübsch (leicht-schreiben.de) Testlesung: Prüfer der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen
WAS IST KULTURELLE BILDUNG? Antworten in einfacher Sprache Text in einfacher Sprache: Charlotte Hübsch (leicht-schreiben.de) Testlesung: Prüfer der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung... 1 Antje Flade
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung................................................ 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung................................. 13 Monica Rüthers 2.1 Geschichte und Methoden
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung................................................ 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung................................. 13 Monica Rüthers 2.1 Geschichte und Methoden
I. Begrüßung: Kontext der Initiative Anrede
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative
Ganztagsschule als Lebensort aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. 1 Studie und Ergebnisse 2 Theorie und Transfer
 Ganztagsschule als Lebensort aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen 1 Studie und Ergebnisse 2 Theorie und Transfer Forum GanzTagsSchule NRW 2016 Fragestellung und Hypothesen Wie wird die Schule wahrgenommen?
Ganztagsschule als Lebensort aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen 1 Studie und Ergebnisse 2 Theorie und Transfer Forum GanzTagsSchule NRW 2016 Fragestellung und Hypothesen Wie wird die Schule wahrgenommen?
In Räumen denken Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit schaffen Inklusion. Regionale Integrationskonferenz Wohnen und Leben am
 In Räumen denken Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit schaffen Inklusion Regionale Integrationskonferenz Wohnen und Leben am 16.11.2016 Frank Auracher Gemeinwesenarbeit Nordstadt.Mehr.Wert Leitung
In Räumen denken Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit schaffen Inklusion Regionale Integrationskonferenz Wohnen und Leben am 16.11.2016 Frank Auracher Gemeinwesenarbeit Nordstadt.Mehr.Wert Leitung
Jahrbuch für Kulturpolitik 2010
 HERAUSGEGEBEN FÜR DAS INSTITUT FÜR KULTURPOLITIK DER KULTURPOLITISCHEN GESELLSCHAFT E.V. VON BERND WAGNER Jahrbuch für Kulturpolitik 2010 Band 10 Thema: Kulturelle Infrastruktur Kulturstatistik Chronik
HERAUSGEGEBEN FÜR DAS INSTITUT FÜR KULTURPOLITIK DER KULTURPOLITISCHEN GESELLSCHAFT E.V. VON BERND WAGNER Jahrbuch für Kulturpolitik 2010 Band 10 Thema: Kulturelle Infrastruktur Kulturstatistik Chronik
Tanja Maier, Martina Thiele, Christine Linke (Hg.) Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in Bewegung
 Tanja Maier, Martina Thiele, Christine Linke (Hg.) Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in Bewegung Band 8 Editorial Die Reihe Critical Media Studies versammelt Arbeiten, die sich mit der Funktion und
Tanja Maier, Martina Thiele, Christine Linke (Hg.) Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in Bewegung Band 8 Editorial Die Reihe Critical Media Studies versammelt Arbeiten, die sich mit der Funktion und
Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen?
 Prof. Dr. Uwe Hericks Institut für Schulpädagogik Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen? Vortrag im Rahmen des Studium Generale Bildung im Wandel am
Prof. Dr. Uwe Hericks Institut für Schulpädagogik Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen? Vortrag im Rahmen des Studium Generale Bildung im Wandel am
Handbuch Museumspädagogik
 Klaus Weschenfelder/Wolfgang Zacharias Handbuch Museumspädagogik Orientierungen und Methoden für die Praxis Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf Inhalt Vorwort 9 Einleitung: Zur Begriffsbestimmung
Klaus Weschenfelder/Wolfgang Zacharias Handbuch Museumspädagogik Orientierungen und Methoden für die Praxis Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf Inhalt Vorwort 9 Einleitung: Zur Begriffsbestimmung
Ideal oder real? Die Darstellung weiblicher Schönheit in der Werbung der Dove-Kampagne "Initiative für wahre Schönheit"
 Pädagogik Anna-Maria Lehre Ideal oder real? Die Darstellung weiblicher Schönheit in der Werbung der Dove-Kampagne "Initiative für wahre Schönheit" Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Pädagogik Anna-Maria Lehre Ideal oder real? Die Darstellung weiblicher Schönheit in der Werbung der Dove-Kampagne "Initiative für wahre Schönheit" Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Industrie und Tourismus
 Industrie und Tourismus Innovatives Standortmanagement für Produkte und Dienstleistungen Herausgegeben von Professor Dr. Harald Pechlaner Eva-Maria Hammann Elisabeth Fischer Mit Beiträgen von Anke Bockstedt,
Industrie und Tourismus Innovatives Standortmanagement für Produkte und Dienstleistungen Herausgegeben von Professor Dr. Harald Pechlaner Eva-Maria Hammann Elisabeth Fischer Mit Beiträgen von Anke Bockstedt,
Zur Bedeutung von Kunst in der Stationären Jugendhilfe. Prof. Dr. Daniela Braun
 Zur Bedeutung von Kunst in der Stationären Jugendhilfe Prof. Dr. Daniela Braun 1 Annahme Kunst als Ausdrucksmöglichkeit fördert die Resilienz von Kindern Prof. Dr. Daniela Braun 2 Aufbau Wissenschaftliche
Zur Bedeutung von Kunst in der Stationären Jugendhilfe Prof. Dr. Daniela Braun 1 Annahme Kunst als Ausdrucksmöglichkeit fördert die Resilienz von Kindern Prof. Dr. Daniela Braun 2 Aufbau Wissenschaftliche
Sehr geehrter Herr Knoll, sehr geehrte Frau Professorin Dr. Mandel, meine sehr verehrten Damen und Herren,
 1 Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Eröffnung der Folgeveranstaltung Be Berlin - be diverse Best-Practise-Beispiele am Dienstag, dem 25. Mai 2010 um 18.00 Uhr Hertie-School of Governance,
1 Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Eröffnung der Folgeveranstaltung Be Berlin - be diverse Best-Practise-Beispiele am Dienstag, dem 25. Mai 2010 um 18.00 Uhr Hertie-School of Governance,
BNE-KOMPETENZEN IN SCHULEN AUFBAUEN. Mehr BNE an Schulen durch kreative und mediale Zugänge
 BNE-KOMPETENZEN IN SCHULEN AUFBAUEN Mehr BNE an Schulen durch kreative und mediale Zugänge AKTUELLE SITUATION Aufbau von BNE-Kompetenzen ein vernachlässigtes Feld an Schulen? Aktuelle Situation an meiner
BNE-KOMPETENZEN IN SCHULEN AUFBAUEN Mehr BNE an Schulen durch kreative und mediale Zugänge AKTUELLE SITUATION Aufbau von BNE-Kompetenzen ein vernachlässigtes Feld an Schulen? Aktuelle Situation an meiner
THOMAS PRESSEMITTEILUNG
 P A U L K L E E M U S I K U N D T H E A T E R I N L E B E N U N D W E R K W I E N A N D PAUL K L E E MUSIK UND THEATER IN LEBEN UND WERK 23. Februar - 12. Mai 2018 Eröffnung am Donnerstag, 22. Februar
P A U L K L E E M U S I K U N D T H E A T E R I N L E B E N U N D W E R K W I E N A N D PAUL K L E E MUSIK UND THEATER IN LEBEN UND WERK 23. Februar - 12. Mai 2018 Eröffnung am Donnerstag, 22. Februar
Public History Ein neuer Master-Studiengang an der Freien Universität Berlin
 1 Otto Langels für: SWR 2, Impuls; 11.11.08 Public History Ein neuer Master-Studiengang an der Freien Universität Berlin Für die Mod.: Der Studiengang Public History öffentliche Geschichte wird schon seit
1 Otto Langels für: SWR 2, Impuls; 11.11.08 Public History Ein neuer Master-Studiengang an der Freien Universität Berlin Für die Mod.: Der Studiengang Public History öffentliche Geschichte wird schon seit
Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW
 Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW Wettbewerbserfolg durch ungewöhnliche Kooperationen Dr. Annette Klinkert Bielefeld Marketing GmbH bcsd-herbsttagung 2007 Was ist Ab in die Mitte!? PPP-Projekt für
Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW Wettbewerbserfolg durch ungewöhnliche Kooperationen Dr. Annette Klinkert Bielefeld Marketing GmbH bcsd-herbsttagung 2007 Was ist Ab in die Mitte!? PPP-Projekt für
Bildungsfelder. Bildungsfelder. Bildungsfelder. Bildungsfelder. Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder. Starke Kinder
 Theoretische Grundlagen Teil eins der Rahmenrichtlinien Teil zwei der Rahmenrichtlinien Bildungsvisionen, Bildungsziele, Kompetenzen und : 1. Die Philosophie der Rahmenrichtlinien Positives Selbstkonzept
Theoretische Grundlagen Teil eins der Rahmenrichtlinien Teil zwei der Rahmenrichtlinien Bildungsvisionen, Bildungsziele, Kompetenzen und : 1. Die Philosophie der Rahmenrichtlinien Positives Selbstkonzept
KLAGENFURTER BEITRÄGE ZUR VISUELLEN KULTUR. Jörg Helbig / René Reinhold Schallegger (Hrsg.) Digitale Spiele HERBERT VON HALEM VERLAG
 KLAGENFURTER BEITRÄGE ZUR VISUELLEN KULTUR Jörg Helbig / René Reinhold Schallegger (Hrsg.) HERBERT VON HALEM VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
KLAGENFURTER BEITRÄGE ZUR VISUELLEN KULTUR Jörg Helbig / René Reinhold Schallegger (Hrsg.) HERBERT VON HALEM VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Netzwerkbildung in der Bildungslandschaft gezeigt am Beispiel Deutschland
 Internationale Konferenz im Rahmen des EU-Projektes TEMPUS IV «Aus- und Weiterbildung für Pädagogen und Bildungsmanager im Bereich Diversity» an der Staatlichen Universität Nowgorod, Russland 18.-22. Mai
Internationale Konferenz im Rahmen des EU-Projektes TEMPUS IV «Aus- und Weiterbildung für Pädagogen und Bildungsmanager im Bereich Diversity» an der Staatlichen Universität Nowgorod, Russland 18.-22. Mai
Das Medienhandeln von Jugendlichen online
 Das Medienhandeln von Jugendlichen online Sozialisationstheoretische Aspekte zum Verständnis des Lebensraums Internet Dr. Ulrike Wagner Regensburg, 16.11.2012 Medienwelten von Jugendlichen In Lokalisten,
Das Medienhandeln von Jugendlichen online Sozialisationstheoretische Aspekte zum Verständnis des Lebensraums Internet Dr. Ulrike Wagner Regensburg, 16.11.2012 Medienwelten von Jugendlichen In Lokalisten,
Evangelische Religion, Religionspädagogik
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Von der Irritation zur Orientierung oder: Systemische Aufstellungsarbeit als Prozess der kollektiven Sinnstiftung
 Von der Irritation zur Orientierung oder: Systemische Aufstellungsarbeit als Prozess der kollektiven Sinnstiftung Claude Rosselet, lic. oec. HSG Inhalt: Sinnstiftung Sinnstiftung und evolutionärer Prozess
Von der Irritation zur Orientierung oder: Systemische Aufstellungsarbeit als Prozess der kollektiven Sinnstiftung Claude Rosselet, lic. oec. HSG Inhalt: Sinnstiftung Sinnstiftung und evolutionärer Prozess
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli
 Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Wirkungen Kultureller Bildung
 Wirkungen Kultureller Bildung Tagung Kultur.Bildung Bamberg, 17.03.2012 München 1 Zur Unterscheidung (Natur-)Wissenschaftliches Wirkungsverständnis Kontrolle aller Wirkfaktoren im Ursache-Wirkungs- Zusammenhang
Wirkungen Kultureller Bildung Tagung Kultur.Bildung Bamberg, 17.03.2012 München 1 Zur Unterscheidung (Natur-)Wissenschaftliches Wirkungsverständnis Kontrolle aller Wirkfaktoren im Ursache-Wirkungs- Zusammenhang
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
INSTITUT FÜR GLEICHSTELLUNG UND GENDER STUDIES
 INSTITUT FÜR GLEICHSTELLUNG UND GENDER STUDIES Gesellschaftliche Zielsetzung und Aufgaben Seit dem Aufkommen der Bewegung rund um die Gender Studies und feministische Wissenschaft, v.a. mit den poststrukturalistischen
INSTITUT FÜR GLEICHSTELLUNG UND GENDER STUDIES Gesellschaftliche Zielsetzung und Aufgaben Seit dem Aufkommen der Bewegung rund um die Gender Studies und feministische Wissenschaft, v.a. mit den poststrukturalistischen
Kinderliteratur im Medienzeitalter
 Kinderliteratur im Medienzeitalter Grundlagen und Perspektiven für den Unterricht in der Grundschule von Anja Ballis und Mirjam Burkard Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die
Kinderliteratur im Medienzeitalter Grundlagen und Perspektiven für den Unterricht in der Grundschule von Anja Ballis und Mirjam Burkard Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die
Kulturmanagement Hochschule Bremen. Struktur des Curriculums
 Kulturmanagement Hochschule Bremen Struktur des Curriculums Der Studiengang Kulturmanagement (M.A.) ist berufsbegleitend organisiert und wird jeweils in Blockveranstaltungen an Wochenenden angeboten. Er
Kulturmanagement Hochschule Bremen Struktur des Curriculums Der Studiengang Kulturmanagement (M.A.) ist berufsbegleitend organisiert und wird jeweils in Blockveranstaltungen an Wochenenden angeboten. Er
Politik begreifen. Schriften zu theoretischen und empirischen Problemen der Politikwissenschaft. Band 16
 Politik begreifen Schriften zu theoretischen und empirischen Problemen der Politikwissenschaft Band 16 Können sozialpolitische Dienstleistungen Armut lindern? Eine empirische Analyse wirtschaftlich entwickelter
Politik begreifen Schriften zu theoretischen und empirischen Problemen der Politikwissenschaft Band 16 Können sozialpolitische Dienstleistungen Armut lindern? Eine empirische Analyse wirtschaftlich entwickelter
Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit
 Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Biografie - Partizipation - Behinderung
 Klinkhardt forschung Biografie - Partizipation - Behinderung Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie von 1. Auflage Julius Klinkhardt 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Klinkhardt forschung Biografie - Partizipation - Behinderung Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie von 1. Auflage Julius Klinkhardt 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Fachbereich Jugendkultur
 Fachbereich Jugendkultur 2. Soziokulturelle Animation 1.Einleitung 2. Ziel 3. Definitionen 4. Kultur & Offene Kinder und Jugendarbeit / Soziokulturelle Animation 5. Hauptstossrichtungen Fachbereich Jugendkultur
Fachbereich Jugendkultur 2. Soziokulturelle Animation 1.Einleitung 2. Ziel 3. Definitionen 4. Kultur & Offene Kinder und Jugendarbeit / Soziokulturelle Animation 5. Hauptstossrichtungen Fachbereich Jugendkultur
Bilderbuchlesarten von Kindern
 Bilderbuchlesarten von Kindern Neue Erzählformen im Spannungsfeld von kindlicher Rezeption und Produktion Bearbeitet von Alexandra Ritter 1. Auflage 2017. Taschenbuch. 304 S. Paperback ISBN 978 3 8340
Bilderbuchlesarten von Kindern Neue Erzählformen im Spannungsfeld von kindlicher Rezeption und Produktion Bearbeitet von Alexandra Ritter 1. Auflage 2017. Taschenbuch. 304 S. Paperback ISBN 978 3 8340
Hanne Detel. Netzprominenz. Entstehung, Erhaltung und Monetarisierung von Prominenz im digitalen Zeitalter HERBERT VON HALEM VERLAG
 Hanne Detel Netzprominenz Entstehung, Erhaltung und Monetarisierung von Prominenz im digitalen Zeitalter HERBERT VON HALEM VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Hanne Detel Netzprominenz Entstehung, Erhaltung und Monetarisierung von Prominenz im digitalen Zeitalter HERBERT VON HALEM VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Was hast du ausgestellt, und warum im Frisiersalon Picasso?
 Was hast du ausgestellt, und warum im Frisiersalon Picasso? Es handelt sich um zehn Zeichnungen, die Berliner Schulkinder nach Zeichnungen von Pablo Picasso gemacht und signiert haben. Ich habe zunächst
Was hast du ausgestellt, und warum im Frisiersalon Picasso? Es handelt sich um zehn Zeichnungen, die Berliner Schulkinder nach Zeichnungen von Pablo Picasso gemacht und signiert haben. Ich habe zunächst
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Erinnerung Gedenkstein Memorial Gedächtnis Fleck Markierung Jahrestag Monument Andenken Zeichen Kunstwerk
 SICHER! Ihr @ktueller Unterrichtsservice Das Erbe Europas (Ge)denken + Mal = Denkmal? a Welches Wort passt zu welchem Begriff? Ordnen Sie zu. Erinnerung Gedenkstein Memorial Gedächtnis Fleck Markierung
SICHER! Ihr @ktueller Unterrichtsservice Das Erbe Europas (Ge)denken + Mal = Denkmal? a Welches Wort passt zu welchem Begriff? Ordnen Sie zu. Erinnerung Gedenkstein Memorial Gedächtnis Fleck Markierung
JAHRBUCH MEDIEN UND GESCHICHTE Dietrich Leder / Hans-Ulrich Wagner (Hrsg.) Sport und Medien. Eine deutsch-deutsche Geschichte
 JAHRBUCH MEDIEN UND GESCHICHTE 2011 Dietrich Leder / Hans-Ulrich Wagner (Hrsg.) Sport und Medien Eine deutsch-deutsche Geschichte Herbert von Halem Verlag Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
JAHRBUCH MEDIEN UND GESCHICHTE 2011 Dietrich Leder / Hans-Ulrich Wagner (Hrsg.) Sport und Medien Eine deutsch-deutsche Geschichte Herbert von Halem Verlag Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Kinder und ihre Kindheit in Deutschland Eine Politik für Kinder im Kontext von Familienpolitik Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen
 Kinder und ihre Kindheit in Deutschland Eine Politik für Kinder im Kontext von Familienpolitik Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen Band 154 Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Kinder und ihre Kindheit in Deutschland Eine Politik für Kinder im Kontext von Familienpolitik Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen Band 154 Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Nachbarschaft zwischen sozialem Zusammenhalt als Governance-Strategie und Ermächtigung
 Nachbarschaft zwischen sozialem Zusammenhalt als Governance-Strategie und Ermächtigung Katharina Kirsch-Soriano Tagung da Silva Soziale (Caritas Arbeit Wien) und Stadtentwicklung & Christoph Stoik 22.
Nachbarschaft zwischen sozialem Zusammenhalt als Governance-Strategie und Ermächtigung Katharina Kirsch-Soriano Tagung da Silva Soziale (Caritas Arbeit Wien) und Stadtentwicklung & Christoph Stoik 22.
WAS IST MIT ARMUTSSENSIBLEM HANDELN
 WAS IST MIT ARMUTSSENSIBLEM HANDELN GEMEINT? Gerda Holz, Frankfurt am Main Schwerpunkte Armut bei Kindern und Jugendlichen Definition, Ursachen, Risiken Das Kindergesicht der Armut Kindbezogene Armutsprävention
WAS IST MIT ARMUTSSENSIBLEM HANDELN GEMEINT? Gerda Holz, Frankfurt am Main Schwerpunkte Armut bei Kindern und Jugendlichen Definition, Ursachen, Risiken Das Kindergesicht der Armut Kindbezogene Armutsprävention
FÜREINANDER ein Kunstprojekt
 FÜREINANDER ein Kunstprojekt Konzept für das Kunstprojekt der Initiative Dialog der Generationen von in Zusammenarbeit mit den Deichtorhallen Hamburg unterstützt von der Stiftung Füreinander und der stilwerk
FÜREINANDER ein Kunstprojekt Konzept für das Kunstprojekt der Initiative Dialog der Generationen von in Zusammenarbeit mit den Deichtorhallen Hamburg unterstützt von der Stiftung Füreinander und der stilwerk
