Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
|
|
|
- Heini Fuchs
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bildungszentrum für Technik Frauenfeld Schulinternerlehrplan aus dem KoRe-Katalog für nlagen- und pparatebauer / In EFZ BiVo / Ko Re Reform vom 01. Januar 13 Liste der verwendeten bkürzungen bkürzung Bezeichnung Beschreibung nwenden nwenden der Ressourcen E Einführen Einführen der Ressource T Einführen bis Teilprüfung Einführen der betreffende Ressource spätestens bis zur Teilprüfung Ende 2. LJ Technische Grundlagen F1 Mathematik, 1. Semester, F1.1 Grundlagen Mathematik 10 F1.1.1 Zahlen, Zahlendarstellung, Gebrauch des Taschenrechners Taschenrechner anwenden (Darstellungen mit und ohne Exponenten, Reihenfolge der Operationen, Klammern, Speicher, Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel, Änderung der Darstellung (Kommastellung, Exponentialdarstellung) und trigonometrische Funktionen) Genauigkeit von Resultatangaben abschätzen und Rundungsregeln beachten Resultate bezüglich Grössenordnung abschätzen T
2 F1.1.2 Koordinatensystem, grafische Darstellungen Punkte im rechtwinkligen Koordinatensystem einzeichnen und Koordinaten bestimmen Wertetabellen erstellen und entsprechende Diagramme aufzeichnen T F1.1.3 SI-Einheiten T Bedeutung der Masseinheiten erklären Rechnen mit SI-Einheiten und deren gebräuchlichen Massvorsätzen F1.2 lgebra 30 F1.2.1 Grundoperationen T Rechnen mit allgemeinen Zahlen (Grundoperationen) Hirarchie der Operationen, ddition (assoziatives und kommutatives Gesetz), Subtraktion, Klammern, Vorzeichen, Multiplikation, usmultiplizieren, usklammern Erweitern und Kürzen von Brüchen (ggt), ddition und Subtraktion von Brüchen (kgv), Multiplikation und Division von Brüchen. F1.2.2 Potenzen und Wurzeln T Potenzbegriff erklären Zehnerpotenzen verstehen und anwenden sowie als Vorsätze interpretieren Wurzel als Umkehroperation der Potenz erklären und berechnen F1.2.3 Gleichungen ersten Grades T Gleichungen lösen, Quadrat und Quadratwurzel in Gleichungen auflösen Verhältnisgleichungen aufstellen und lösen Textaufgaben in eine Gleichung überführen und lösen Technische Grundlagen F1 Mathematik, 2. Semester, F1.1 Grundlagen Mathematik 5 F1.1.4 Zeitberechnungen T Berechnungen mit Zeiteinheiten durchführen F1.1.5 Prozent, Promille T Prozent als Verhältnis zweier Grössen erklären ngewandte Beispiele wie Zins, Rabatt, Steigung, Fehler, usw. berechnen
3 Promille und ppm erklären F1.3 Geometrie 15 F1.3.1 Längen-, Flächen-, Volumen- und Massenberechnungen Längen, Flächen und Winkel an Dreiecken, Vierecken und Kreisen berechnen Längen, Flächen und Volumen an folgenden Körpern berechnen: Prismen und Zylinder Massenberechnungen Einfache zusammengesetzte Flächen und Körper berechnen F1.3.2 Dreiecksarten T Seiten und Winkel im Dreieck sowie Dreiecksarten bezeichnen F1.3.3 Pythagoras T Die Zusammenhänge des Pythagoras wiedergeben Berechnungen mit dem Pythagoras durchführen T F1.4 Trigonometrie 15 F1.4.1 Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck Definition der Winkelfunktionen sin, cos, tan als Seitenverhältnisse erklären Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck berechnen T F1.5 Funktionen 10 F1.5.1 Mathematische Funktionen, Wertetabelle und grafische Darstellung T Die Funktion als Zuordnung zweier veränderlicher Grössen erkennen Zusammenhang Funktionsgleichung, Wertetabelle und Graph einer Funktion nennen und anwenden Funktionen aufgrund von Gleichungen und Wertetabellen grafisch darstellen F1.6 Freiraum Mathematik 15 Mathematikprogramme praktisch anwenden E Technische Grundlagen F4 Physik, 3. Semester, F4.1 Mechanik F4.1.1 Bewegungslehre T 14
4 Gleichförmig geradlinige und kreisförmige Bewegungen berechnen Gravitationsbeschleunigung "g" durch die Schwerkraft erklären und in praktischen ufgaben berechnen Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm interpretieren Den Begriff Umfangsgeschwindigkeit erklären und anwenden F4.1.2 Kraft T 6 Ursachen und Wirkungen der Kraft Kraft als Vektor darstellen Technische Grundlagen F4 Physik, 4. Semester, F4.1 Mechanik F4.1.2 Kraft T 8 Zwei Kräfte grafisch zusammen-setzen, eine Kraft in zwei Einzelkräfte zerlegen F4.1.3 Reibung T 2 Haft-, Gleit-, und Rollreibung erklären Reibkraft (beschränkt auf Haftreibung) berechnen F4.1.4 Drehmoment T 10 Die Begriffe Hebelarm und Drehmoment erklären Momentengleichung an Hebelsystemen anwenden uflagerreaktionen mit Einzelkräften bestimmen Gleichgewichtszustände unterscheiden Funktionen an Rollen, Flaschenzügen und Winden erkennen und Berechnungen durchführen Technische Grundlagen F4 Physik, 5. Semester, F4.1 Mechanik F4.1.5 rbeit, Leistung und Energie E Die Begriffe rbeit, Leistung und Energie unterscheiden und in praktischen Beispielen an geradlinigen und kreisförmigen Bewegungen anwenden Energieformen unterscheiden Technische Grundlagen
5 F4 Physik, 6. Semester, F4.1 Mechanik 10 F4.1.6 Wirkungsgrad E 2 Einzelwirkungsgrad erläutern und berechnen Zusammenhang zwischen Einzel- und Gesamtwirkungsgrad aufzeigen F4.1.7 Getriebeübersetzung E 8 einfache Übersetzungen (Drehzahlen, Umdrehungen und Drehmomente) berechnen F4.2 Flüssigkeiten und Gase 10 F4.2.1 Druck E 10 Druck definieren und berechnen Luftdruck erklären Über-, Unter- und absoluter Druck berechnen Druckmessgeräte unterscheiden und anwenden Technische Grundlagen F4 Physik, 7. Semester, F4.2 Flüssigkeiten und Gase 5 F4.2.2 Gesetz von Pascal E 5 Bedeutung des Druckausbreitungs- Gesetzes an Hydraulik- und Pneumatikanlagen erklären und praktische Beispiele berechnen F4.3 Wärmelehre 15 F4.3.1 Temperatur, Temperaturskalen, Temperaturmessung Begriff Temperatur erklären Temperaturskalen Celsius und Kelvin unterscheiden Temperaturmessgeräte aufzählen und einsetzen F4.3.2 Wärmeausdehnung E Ursache der Wärmeausdehnung begründen usdehnung aufgrund der Wärme an festen und flüssigen Stoffen berechnen Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen E F4.3.3 Wärmeenergie E Begriff Wärme Möglichkeiten der Wärmeerzeugung aufzählen F4.3.4 ggregatszustandsänderungen E
6 Übergänge von festem, flüssigem und gasförmigem Zustand F4.3.5 Wärmeübertragung E Begriffe Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung an praktischen Beispielen aufzeigen Technische Grundlagen F4 Physik, 8. Semester, F4.4 Freiraum Physik F4.4.1 Bewegungslehre / Newtonsches Gesetz Beschleunigung und Verzögerung erklären und in praktischen ufgaben berechnen Dynamisches Grundgesetz erklären und Berechnungen durchführen F4.4.2 Modellierungen mit dem Computer E F4.4.3 Kontinuitätsgleichung E F4.4.4 Gesetz von Boyle-Mariotte E E Technische Grundlagen F5 Elektro- und Steuerungstechnik, 2. Semester, Lekt. F5.1 Elektrosicherheit 5 F5.1.1 Gefahren der Elektrizität T Die Begriffe Stark- und Schwach-strom sowie Klein-, Nieder- und Hochspannung unterscheiden Die Gefahren der Elektrizität F5.1.2 Schutzmassnahmen T Massnahmen für den Personenschutz Massnahmen für den Sachenschutz aufzählen F5.2 Elektrische Energie 5 F5.2.1 Erzeugung und Nutzung elektrischer Energie im Energiewandlungssystem Erzeugung elektrischer Energie in den Grundzügen erklären T F5.3 Einfacher und erweiterter Stromkreis 10 F5.3.1 Die elementaren elektrischen Grössen im Stromkreis Den elektrischen Stromkreis als Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern in Schaltplänen mit genormten Symbolen darstellen Die Grössen Strom, Spannung und Widerstand T
7 Das ohmsche Gesetz wiedergeben und anwenden Strom- und Spannungsarten unterscheiden (C/DC) F5.3.2 Messen von elektrischen Grössen T Vielfachmessgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand anwenden F5.3.3 nschluss von Verbrauchern ans Drehstromnetz Den nschluss von Verbrauchern an das Versorgungsnetz T F5.4 Grundlagen der Steuerungstechnik 10 F5.4.1 Einteilung, Begriffe T Steuerungsarten am Beispiel Elektro, Pneumatik und Hydraulik gliedern Begriffe Steuerung und Regelung unterscheiden Unterschiede zwischen Hydraulik und Pneumatik in den Grundzügen nennen F5.4.2 Schaltungslogik T Die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT und deren Symbole bezeichnen F5.5 Elektrische oder pneumatische Steuerungen 10 F5.5.1 Sensoren T Sensorarten nennen und nwendungen F5.5.2 Komponenten der elektrischen T Steuerung Eigenschaften und nwendungen F5.5.3 Komponenten der pneumatischen T Steuerung Eigenschaften und nwendungen F5.5.4 Schema T Pneumatik-Schemas lesen F5.5.5 Signal- und Steuerglieder T Signal- und Steuerglieder der Pneumatik Betätigungsarten der Signalglieder nennen F5.5.6 Stell- und rbeitsglieder T Stell- und rbeitsglieder der Pneumatik Betätigungsarten der Stellglieder nennen F5.5.7 nwendungen von Steuerungen (elektrisch oder pneumatisch) Einfache Steuerungen aufbauen und prüfen T Werkstoff- und Fertigungstechnik
8 F7 Werkstofftechnik, 1. Semester, F7.1 Werkstoffgrundlagen 25 F7.1.1 Einteilung T 2 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie Betriebs- und Hilfsstoffe gliedern F7.1.2 ufbau T 10 Stoffeinteilung und Materiebausteine Den prinzipiellen ufbau von Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen Gemische und chemische Bindungen erklären Bindungsarten (tom-, Ionen- und Metallbindungen) unterscheiden F7.1.3 Eigenschaften T 2 Eigenschaften der Werkstoffe (Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit, Längenausdehnung) Elastisches und plastisches Verformungsverhalten erklären F7.1.4 Herstellung T 4 Das Prinzip von Oxidations- und Reduktionsvorgängen (Redoxreaktion) am Beispiel der Stahlherstellung Bedeutung des Werkstoffrecyclings F7.1.5 Verwendung T 2 Typische nwendungsbeispiele bei den Eisenmetallen, Nichteisenmetallen und Kunststoffen nennen F7.1.6 Gefahrenstoffe T 5 Gefahrensymbole von Gefahrenstoffen verstehen Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen interpretieren Gefahren im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen aufzählen Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffe aufzählen Erste Hilfe-Massnahmen bei Verätzungen F7.2 Werkstoffarten 15 F7.2.2 Nichteisenmetalle (NE-Metalle (Cu, Ti, l, Ni)) Wichtigste NE-Metalle nach Dichte und Verwendung gliedern Eigenschaften der wichtigsten NE- Metalle nwendung der wichtigsten NE-Metalle nennen T 15
9 Die wichtigsten NE-Metall-Legierungen aufzählen und nwendungen aufzeigen Normbezeichnungen wichtiger NE- Metalle interpretieren Werkstoff- und Fertigungstechnik F7 Werkstofftechnik, 2. Semester, F7.2 Werkstoffarten 30 F7.2.1 Eisenmetalle T Die Begriffe Eisen und Stahl erklären Legierungselemente nennen und Einflüsse auf die Werkstoffeigenschaften Einfluss des Kohlenstoffes auf die Werkstoffeigenschaften rten von Gusseisen nennen und ihre Hauptmerkmale Normbezeichnung wichtiger Stahlsorten interpretieren Stähle nach ihrer nwendung unterscheiden Halbfabrikate und deren Schweisseignung nennen Herstellung, nwendungen und Eigenschaften Berufsüblicher Halbzeuge (Bleche, Rohre, Profile) erläutern. F7.2.3 Kunststoffe T 10 Einteilung und Eigenschaften nennen usgangsstoffe nennen Kunststoffe nach ihrer nwendung unterscheiden F7.3 Werkstoffbehandlung 10 F7.3.2 Korrosion und Korrosionsschutz T 10 Korrosionsarten unterscheiden (Chemische und elektrochemische Korrosion) Korrosionsbeständige Grundwerkstoffe aufzählen Korrosionsschutz durch Oberflächenbehandlung Korrosionsarme / beständige Grundwerkstoffe aufzählen Verfahren sowie ihre Merkmale und nwendungsformen an praktischen Beispielen erläutern Einfache, konstruktive Massnahmen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes Werkstoff- und Fertigungstechnik F7 Werkstofftechnik, 3. Semester,
10 F7.2 Werkstoffarten 10 F7.2.4 Verbundwerkstoffe E 5 Den Begriff Verbundwerkstoff erläutern ufbau und Eigenschaften erklären Faserverstärkte Werkstoffe und Verwendungsmöglichkeiten aufzählen F7.2.5 Hilfsstoffe T 5 Den Begriff Hilfsstoffe erläutern Schweiss-, Brenn- und Schmiermittel nennen und nwendungen aufzählen F7.4 Festigkeitslehre 10 F7.4.1 Begriffe T 2 Die Beanspruchungsarten (Zug, Druck, Flächenpressung, Scherung, Biegung, Torsion) unterscheiden F7.4.2 Spannungs-Dehnungs-Diagramm T 3 Zusammenhang zwischen Spannungs- Dehnungs-Diagramm und Zugversuch erläutern Spannungs-Dehnungs-Diagramm verschiedener Werkstoffe interpretieren F7.4.3 Zug, Druck, Flächenpressung, Scherung Einfache Zug-, Druck- und Scherbelastungen und Flächenpressung berechnen Sicherheitskennzahlen bei Berechnungen anwenden T 5 Werkstoff- und Fertigungstechnik F7 Werkstofftechnik, 4. Semester, F7.4 Festigkeitslehre F7.4.3 Zug, Druck, Flächenpressung, Scherung Einfache Zug-, Druck- und Scherbelastungen und Flächenpressung berechnen Sicherheitskennzahlen bei Berechnungen anwenden T Werkstoff- und Fertigungstechnik F7 Werkstofftechnik, 5. Semester, F7.2 Werkstoffarten 5 F7.2.4 Verbundwerkstoffe E 5
11 Sinterwerkstoffe am Beispiel von Hartmetall und/oder Filter erklären F7.3 Werkstoffbehandlung 10 F7.3.1 Wärmebehandlungen E 10 Ziele für Wärmebehandlungen nennen Kristallgitter anhand des Eisen- Kohlenstoff-Diagramms unterscheiden Gefügearten anhand des Eisen- Kohlenstoff-Diagramms unterscheiden Die 4 Hauptarten (Glühen, Härten, nlassen und Vergüten) unterscheiden Spannungsarm-, Rekristallisations- und Normalglühen Die wichtigsten Härteprüfverfahren unterscheiden (Brinell, Vickers, Rockwell) F7.5 Freiraum Werkstofftechnik 5 F7.5.1 Werkstoffprüfung E Werkstattprüfungen durchführen Zug- und Kerbschlagbiegeversuche durchführen F7.5.2 Oberflächenveredelung E Neue Korrosionsschutzverfahren benennen rten von Oberflächenbeschichtungen nennen Einsatzgebiete der Nanotechnologie nennen Einsatzgebiete keramischer Überzüge aufzählen F7.5.3 Werkstoff-Trends E Neue Werkstoffe (z. B. Composit) erläutern Einsatz nachwachsender Werkstoffe aufzählen Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik benennen Werkstoff- und Fertigungstechnik F7 Werkstofftechnik, 6. Semester, F7.5 Freiraum Werkstofftechnik F7.5.1 Werkstoffprüfung E Werkstattprüfungen durchführen Zug- und Kerbschlagbiegeversuche durchführen F7.5.2 Oberflächenveredelung E Neue Korrosionsschutzverfahren benennen rten von Oberflächenbeschichtungen nennen Einsatzgebiete der Nanotechnologie nennen
12 Einsatzgebiete keramischer Überzüge aufzählen F7.5.3 Werkstoff-Trends E Neue Werkstoffe (z. B. Composit) erläutern Einsatz nachwachsender Werkstoffe aufzählen Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik benennen Werkstoff- und Fertigungstechnik F8 Fertigungstechnik, 1. Semester, F8.1 Spanende und spanlose Formgebung F8.1.1 Verfahren, Einflussfaktoren T 5 Die Hauptgruppen der Formgebung und die zugehörigen Fertigungs-verfahren aufzählen Faktoren aufzählen, welche die Wahl des Verfahrens beeinflussen und bestimmen F8.1.2 Spanende Formgebung T 10 Verfahren und nwendungen (nreissen, Sägen, Feilen, Bohren, Senken, Reiben, Gewindeherstellung, Schleifen) Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide unterscheiden Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung bezüglich Standzeit aufzeigen F8.1.3 Scherende Trennverfahren T 12 Verfahren und nwendung (Scheren, Stanzen, Nibbeln) Schnittspalt und Schnittspiel begründen F8.1.5 Biegen T 10 rbeitsprinzipien erklären (Schwenkund Gesenkbiegen (Luft-, Dreipunktund Prägebiegen) von Blechen; Runden von Blechen und Profilen; Biegen von Rohren und Profilen; Bördeln, Sicken und Falzen von Blechen) F8.1.7 Richten T 3 Richtverfahren praktischen Problemem zuordnen (Richten durch Biegen und Strecken, Flammrichten) Werkstoff- und Fertigungstechnik F8 Fertigungstechnik, 2. Semester, F8.1 Spanende und spanlose Formgebung 5
13 F8.1.5 Biegen T 5 Massnahmen für eine korrekte Fertigung Schwenkbiegen F8.2 Fügen 35 F8.2.1 Grundlagen T 10 Prinzipielle Unterschiede der verschiedenen Fügeverfahren (lösbare, unlösbare Verbindungen) Lösbare und nicht lösbare Verbindungen den Wirkungsweisen kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig zuordnen Die Kraftübertragung lösbarer Verbindungen beurteilen Unterschiede in den verschiedenen Schweissverfahren (Schmelz- und Pressschweissen) Eigenschaften und nwendungen von Schweissgasen Stossarten, Nahtarten und Nahtlagen benennen Unregelmässigkeiten (Schweissnahtfehler) und deren Vermeidung Prinzip der Schweissschrumpfung erklären Massnahmen zur Minderung der Schrumpfung (z. B. Schweissreihenfolge, Vorspannen etc.) Massnahmen für Unfallverhütung und Gesundheitsschutz F8.2.2 Schmelzschweissen T 15 rbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren erklären (Bezug zur Elektrotechnik; Gefahren und Schutzmassnahmen) Einrichtungen Einsatzbereiche nennen und den Schweissverfahren zuordnen (E; MSG (MIG, MG); WSG (WIG, WP); Laser; inkl. automatisierte Schweissverfahren (Orbital und UP)) F8.2.6 Kleben T 10 rbeitsprinzip erklären Einflussfaktoren für eine gute Klebeverbindung Klebstoffe aufzählen und nwendungen zuordnen Werkstoff- und Fertigungstechnik F8 Fertigungstechnik, 6. Semester, F8.1 Spanende und spanlose Formgebung 15 F8.1.4 Strahlschneideverfahren E 10
14 Verfahren und nwendung (autogenes Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschneiden, Laserstrahlbrennschneiden, Wasserstrahlschneiden) F8.1.6 Zugdruckumformen E 5 rbeitsprinzip erklären (Tiefziehen) Verfahren und nwendungen F8.2 Fügen 5 F8.2.3 Pressschweissen E 5 rbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren erklären (Punktschweissen; Buckelschweissen; Rollennahtschweissen; Bolzenschweissen) Einrichtungen Einsatzbereiche nennen und den Schweissverfahren zuordnen Werkstoff- und Fertigungstechnik F8 Fertigungstechnik, 7. Semester, F8.1 Spanende und spanlose Formgebung F8.1.8 Numerisch gesteuerte Produktionsmittel ufbau und Funktionsweise rechnergesteuerter Maschinen erklären Besonderheiten gegenüber konventionellen Maschinen unterscheiden ufbau von einfachen CNC- Programmen erklären Bearbeitung einfacher Blechteile mit Fertigungsprogrammen simulieren. E F8.2 Fügen F8.2.4 Löten E 10 F8.2.5 rbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren erklären (Weichlöten; Hartlöten; MIG-Löten) Einrichtungen Einsatzbereiche nennen und den Lötverfahren zuordnen Prüfung von Schweiss- und Lötverbindungen Nichtzerstörende Prüfverfahren in den Grundzügen (Farbeindringverfahren; Metallpulver; Ultraschall; Röntgen) E 5 F8.2.7 Pressverbindung E 5 Eigenschaften und nwendungsmöglichkeiten Wirkungsweise an Beispielen erläutern
15 Werkstoff- und Fertigungstechnik F8 Fertigungstechnik, 8. Semester, F8.3 Qualitätssicherung 5 F8.3.1 Grundlagen der Qualität E Begriffe: Qualität und Qualitätsmanagementsystem erläutern Qualitätsmerkmale aufzählen F8.4 Freiraum Fertigungstechnik 15 F8.4.1 Schnittkraftversuche E Schnittkraft berechnen, Schnittkraftversuche durchführen F8.4.2 Materialwirtschaft E Materialwirtschaft am Beispiel der Beschaffung, Disposition, Lagerhaltung und Fertigung aufzeigen F8.4.3 Qualitätssicherung E Grundzüge der Qualitätssicherung (z. B. Fehleranalyse) aufzeigen F8.4.4 Produktionskalkulation E Herstellungskosten mit einfachem Kalkulationsschema berechnen F8.4.5 Datentransfer (CD/CM-CNC) E CD/CM-CNC-Datenkonvertierung an einfachem Beispiel aufzeigen F8.4.6 Fügen durch Umformen E weitere Fügeverfahren (z. B: Stecken, Clinchen, Bördeln) in den Grundzügen erläutern F8.4.7 Fügen durch Schweissen E weitere Schweissverfahren (z. B: CMT, Speed-up) in den Grundzügen erläutern F8.4.8 Rohrleitungsbau E Vertiefung im Bereich von Muffen, Pressen, Rohrschweissen, Spiralschweissen, Flanschverbindungen oder Schieber und Klappen F8.4.9 Verfahrenstechnik E ufzeigen der Verfahrensschritte Mischen, Lösen, Trennen und Filtern. F Rapid Prototyping E nwendungen und Grenzen des Rapid Prototyping erläutern F Herstellung von Halbzeugen durch Umformen nwendungen und Herstellungsverfahren für Halbzeuge erläutern E
16 Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 1. Semester, F9.1 Zeichnungsgrundlagen F9.1.1 Technische Dokumente T 10 Technische Dokumente (z. B. Pläne, Zeichnungen, Stücklisten, bläufe, Schemas, Hinweise) unterscheiden und deren Informationsgehalt in den Grundzügen wiedergeben Sinn und Zweck der Normung begründen Zeichnungsformate nennen Massstäbe und Linienarten unterscheiden und anwenden Erstellung technischer Dokumente von Hand und mittels CD F9.1.2 Skizziertechnik (Freihandskizzieren) T 10 Objekte darstellen sowie Ideen und Vorstellungen visualisieren Skizzen als Mittel zur Kommunikationsunterstützung erstellen Detailverbindung zweier Bauteile (usklinkung beim T-Stoss von Profilen, Eckstoss mit ungleichen Profilen) skizzieren Parallelperspektivische Darstellungen einfacher Werkstücke skizzieren F9.1.3 Normalprojektion T Nach perspektivischer Darstellung die Normalprojektionen zeichnen und herauslesen nsichtkombinationen interpretieren und nsichtergänzungen ausführen Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 2. Semester, F9.1 Zeichnungsgrundlagen F9.1.4 Perspektiven T 10 Einfache Werkstücke perspektivisch darstellen Von Normalprojektionen die Perspektiven zeichnen F9.1.5 Schnitte T 10 Schnitte in Zeichnungen interpretieren und anwenden: Vollschnitt, Halbschnitt, Teilschnitt und herausgezogene Querschnitte F9.1.6 nsichten T 5
17 Besondere nsichten deuten und anwenden: ngrenzende Teile, Durchdringungen, einzelne ebene Flächen, vor einer Schnittebene liegende Partien, umgeklappte Partien und Lochkreise, symmetrische Teile, abgebrochen und unterbrochen dargestellte Teile F9.1.7 Bemassung T 15 Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen interpretieren und anwenden (Produktgerechte Bemassung: Funktion, Fertigung, Prüfung, geometrische Form) Formsymbole von nschrägungen, nsenkungen, Kantenbearbeitung, Teilungen, Winkeln, Sehnen, Bogen, Konen und Neigungen (nzug) deuten und bei der Bemassung anwenden Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 3. Semester, F9.1 Zeichnungsgrundlagen F9.1.8 Schweissnahtangaben T Schweissnähte vollständig bezeichnen (Nahtdicke, Nahtform, Schweissverfahren) Bestimmung von Schweissnahtformen und Nahtdicke bei einfachen Konstruktionen F9.1.9 Masstoleranzen T 10 Definitionen und Begriffe von Masstoleranzen und Passungen erläutern Masstoleranzen und Passungen festlegen ufbau des ISO-Toleranzsystems in den Grundzügen Masstoleranz, Spiel und Übermass berechnen F Geometrische Tolerierung T 5 F Masstoleranzen interpretieren und anwenden (llgemeintoleranzen, Toleranzen mit Zahlenwerten, ISO- Toleranz-System) bmasse und Passungscharakter nach Funktion bestimmen und normgerecht angeben Definitionen, Begriffe, Symbole und Bestimmungsgrössen interpretieren Form- und Lagetoleranzen mit Hilfe der Normen deuten. Oberflächenbeschaffenheit und Bearbeitungsangaben Rauheitsklassen unterscheiden ngaben mit Hilfe der Normen eintragen und interpretieren T 5
18 Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 4. Semester, F9.1 Zeichnungsgrundlagen F Lesen technischer Zeichnungen und Stü T Den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung nhand einer Zeichnung den rbeitsfolgeplan zur Herstellung des Werkstückes erstellen Stücklisten interpretieren Sinnbilder interpretieren und aus Tabellen herauslesen (Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagschei-ben, Keile, Nieten, Splinten, Schweissangaben und weitere Maschinenelemente) Normbezeichnungen aus Normtabel-len herauslesen und in Zeichnungen und Stücklisten eintragen F9.3 Durchdringungen und bwicklungen F9.3.1 Durchdringungen E Durchdringungen im Zusammenhang mit den bwicklungen konstruieren Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 5. Semester, F9.2 CD-Technik F9.2.1 CD Grundlagen E Einfache Werkstückgeometrie erstellen Werkstücke bemassen und tolerieren Symbole korrekt anwenden Maschinenelemente fachgerecht einsetzen Änderungen durchführen Daten verwalten Daten konventieren und ausgeben Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 6. Semester, F9.3 Durchdringungen und bwicklungen F9.3.2 bwicklungen E bwicklungen von Prismen, Zylindern, Pyramiden und Kegeln konstruieren
19 bwicklungen von Übergangskörpern "rund auf rund" und "rund auf vierkant" im Dreieckverfahren konstruieren (Krümmer, Stutzen, Verschalungen) Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 7. Semester, F9.3 Durchdringungen und bwicklungen F9.3.2 bwicklungen E bwicklungen von Prismen, Zylindern, Pyramiden und Kegeln konstruieren bwicklungen von Übergangskörpern "rund auf rund" und "rund auf vierkant" im Dreieckverfahren konstruieren (Krümmer, Stutzen, Verschalungen) Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Zeichnungstechnik, 8. Semester, F9.3 Durchdringungen und bwicklungen F9.3.2 bwicklungen E bwicklungen von Prismen, Zylindern, Pyramiden und Kegeln konstruieren bwicklungen von Übergangskörpern "rund auf rund" und "rund auf vierkant" im Dreieckverfahren konstruieren (Krümmer, Stutzen, Verschalungen) Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Maschinentechnik, 3. Semester, F9.4 Verbindungselemente F9.4.1 Einteilung, Eigenschaften T Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen F9.4.2 nwendung T Gewinde: die gebräuchlichsten rten aufzählen sowie ihre Unterschiede im Profil und ihre nwendungsmöglichkeiten Die berufsüblichen Schrauben, Muttern, nker, Dübel und Sicherungselemente benennen und den entsprechenden nwendungen zuordnen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach Form und Verwendung unterscheiden und benennen
20 Stifte, Wellen-Naben-Verbindungen nach Form, Wirkungsweise und nwendung unterscheiden Verschiedne Nietarten benennen und den entsprechenden nwendungen zuordnen (Vollnieten; Blindnieten; Schliessringbolzen; Blindnietmuttern) nwendungen gegenüber Schweissverbindungen abgrenzen Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Maschinentechnik, 4. Semester, F9.5 Übertragungselemente F9.5.1 Wellen, chsen T Wellen und chsen vergleichen und unterscheiden Gebräuchliche Wellenarten nach Form und Verwendung benennen F9.5.2 Lager T Nach Bau- und Beanspruchungsarten unterscheiden Normierte Wälzlager-Kurzzeichen interpretieren nwendungsmöglichkeiten von Gleitund Wälzlagern F9.5.3 Dichtungselemente E ufbau, Wirkungsweise und nwendung der gebräuchlichsten rten Zeichnungs- und Maschinentechnik F9 Maschinentechnik, 8. Semester, F9.6 Freiraum Zeichnungs- und Maschinentechnik F9.6.1 Projektmanagement E Grundlagen des Projektmanagements anwenden F9.6.2 Gestaltungsgrundsätze E Kosten- und fertigungsgerechtes Konstruieren und Gestalten Nachhaltige Lösungen (Ökologie, soziale Verträglichkeit, Wirtschaftlichkeit) entwerfen Grundsätze der Bionik erläutern F9.6.3 Energietechnik E Energieformen und Energieumwandlung nennen Maschinen in rbeits- und Kraftmaschinen einteilen Maschinen nach physikalischer Wirkungsweise und Bauart unterscheiden F9.6.4 Feder- und Dämpfungselemente E
21 ufbau, Wirkungsweise und nwendung erklären F9.6.5 Riemen, Ketten, Zahnräder und Getriebe rten unterscheiden und nwendungen nennen Stirn-, Kegel-, Schrauben- sowie Schneckenräder und Schnecken unterscheiden und ihre nwendungen nennen; Verzahnungsarten unterscheiden die Begriffe Teilkreis, Zähnezahl, Kopfkreis, Teilung, Modul und chsdistanz erklären und am Beispiel eines geradverzahnten Stirnrades diese Normgrössen berechnen E ufbau, Wirkungsweise und nwendung von Riemen-, Zahnrad- und Kettentriebe Zeichnungs- und Maschinentechnik F10 Bereichsübergreifende Projekte Die des Unterrichtsbereichs «Bereichsübergreifende Projekte» sind wie folgt einzusetzen: Förderung der Handlungskompetenz durch bereichsübergreifende nwendungen (Bereichsübergreifende Projektarbeiten, Bearbeitung von Praxisbeispielen, Vorbereitungen auf überbetriebliche Kurse und das Qualifikationsverfahren) Behandlung neuer Technologien (Technologien und branchenspezifische Themen die nicht im KoRe-Katalog enthalten sind) Die Inhalte und behandelten Themen werden durch die Berufsfachschule in enger Zusammenarbeit mit den Lehrbetrieben festgelegt. Sie müssen sich klar von Stütz- und Förderunterricht abgrenzen. E Technische Grundlagen XXF3 Lern- und rbeitstechnik, 1. Semester, XXF3.1 Lern- und rbeitstechniken XXF3.1.1 Lerntechniken T Persönliche Bedürfnisse Massnahmen zur Steigerung der Lernmotivation nennen Den eigenen Lerntyp Eigene Lerngewohnheiten und Lernerfahrungen schildern Verbesserungsmassnahmen treffen
22 Funktionsweise des Gehirns modellhaft darstellen Massnahmen zur Steigerung der Konzentration kennen und anwenden Gedächtnistechniken anwenden XXF3.1.2 rbeitstechniken T rbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken anwenden Entscheidungen vorbereiten Grundlagen der Kommunikation und der Konfliktbewältigung anwenden Kontrollmöglichkeiten unterscheiden und Selbstkontrollen durchführen Massnahmen zur ngst- und Stressbewältigung und situationsgerecht anwenden XXF3.1.3 rbeitsplanung und uftragsabwicklung ufträge interpretieren und Ziele erläutern rbeitsabläufe festlegen ufträge und Projekte in rbeitsschritte gliedern Rahmenbedingungen und Kriterien für die rbeitsschritte festlegen Dauer von rbeitsschritten abschätzen T Prioritäten setzen Terminpläne erstellen Persönliche genda führen XXF3.1.4 rbeitsdokumentation T Dokumentationsarten wie Berichte, Prüfprotokolle, nleitungen usw. unterscheiden Dokumentationen aus dem praktischen rbeitsbereich erstellen Dokumentationen systematisch ablegen XXF3.1.5 Präsentation T Präsentationshilfsmittel aufzählen Struktur und blauf einer Präsentation Kriterien für eine erfolgreiche Präsentation nennen Präsentationen vorbereiten, durchführen und auswerten Technische Grundlagen F2 Informatik, 1. Semester, F2.1 Computer- und Datenorganisation 5 F2.1.1 PC-System T PC-System und Peripheriegeräte einrichten, bedienen und warten
23 Grundlegende Funktionen von Computer und Betriebssystem anwenden PC-System vor Computerviren schützen F2.1.2 Daten und Programme T Dateien und Ordner verwalten (organisieren, kopieren, verschieben, löschen) Einsatz von Programmen und Funktionen beurteilen F2.2 Textverarbeitung 10 F2.2.1 Grundeinstellungen T Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vornehmen F2.2.2 Dokumentenerstellung T Texte bearbeiten (kopieren, verschieben, löschen, suchen etc.) Textdokumente erstellen, formatieren und gestalten Texte mit Tabellen, Spalten und Tabulatoren strukturieren Bilder und Grafiken bearbeiten und importieren F2.2.3 Vorlagen T rbeitsabläufe automatisieren und Vorlagen einrichten Textdokumente drucken F2.3 Tabellenkalkulation 15 F2.3.1 Grundeinstellungen T Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vornehmen F2.3.2 Tabellenerstellung T Tabellen mit Daten erstellen, strukturieren und formatieren Daten verwalten (kopieren, löschen, suchen, sortieren) F2.3.3 Funktionen und Diagramme T Formeln und Funktionen einsetzen Daten auswerten und Diagramme erstellen Tabellen drucken F2.4 Präsentation 10 F2.4.1 Grundeinstellungen T Grundeinstellungen der Präsentationssoftware vornehmen Rechtliche Grundlagen bei der Verwendung von Material (Copy-Right, Quellenhinweis) F2.4.2 Präsentationserstellung T
24 Präsentation erstellen, formatieren und vorbereiten Texte, Bilder und Grafiken einfügen und bearbeiten Präsentation drucken Technische Grundlagen F6 Technisches Englisch 80 F6.1 Verstehen (Niveau: 1) F6.1.1 Hören T Einzelne und häufig gebrauchte Wörter verstehen, wenn es um einfache Informationen zu Personen, rbeitstätigkeiten und dem beruflichen Umfeld geht Wesentliche Informationen von kurzen, klaren und einfachen Durchsagen verstehen F6.1.2 Lesen T Ganz kurze, einfache Texte aus dem beruflichen Umfeld lesen und verstehen In einfachen, kurzen lltagstexten (z.b. technischen Dokumenten, nweisungen, Handbüchern, Katalogen, Prospekten) konkrete, vorhersehbare Informationen verstehen Einfache geschäftliche Kurzmitteilungen verstehen F6.2 Sprechen (Niveau: 1) F6.2.1 n Gesprächen teilnehmen T uf einfache rt verständigen, wobei der Gesprächspartner etwas langsamer wiederholt oder anders sagt und beim Sprechen hilft. Einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge und um sehr vertraute Themen handelt F6.2.2 Zusammenhängend sprechen T Einfache Wendungen und Sätze gebrauchen, um bekannte Leute, meinen Wohnort und meine Tätigkeit zu F6.3 Schreiben (Niveau: 1) F6.3.1 Einfache Mitteilung und kurze Notiz schr T Eine Notiz schreiben, um jemanden über meinen ufenthaltsort oder Treffpunkt zu informieren In einfachen Sätzen über die eigene Person schreiben, z. B. Wohnort und Tätigkeit
Bildungszentrum Limmattal. Semesterplan Mathematik. Logistik und Technologie Polymechaniker/in, Konstrukteur/in V17.4
 Bildungszentrum Limmattal Logistik und Technologie Semesterplan Mathematik V17.4 2/5 1. Semester XXF1.1 Grundlagen der Mathematik XXF1.1.1 Zahlen, Zahlendarstellung, Gebrauch des Taschenrechners XXF1.1.2
Bildungszentrum Limmattal Logistik und Technologie Semesterplan Mathematik V17.4 2/5 1. Semester XXF1.1 Grundlagen der Mathematik XXF1.1.1 Zahlen, Zahlendarstellung, Gebrauch des Taschenrechners XXF1.1.2
1. Sem. 60 Lektionen. Profil E 140 Lektionen. Mathematik
 1. Sem. 60 Lektionen Grundlagen / 15L Zahlen, Zahlendarstellung, Gebrauch des Taschenrechners Koordinatensystem, grafische Darstellungen SI-Einheiten Zeitberechnungen Prozente, Promille Taschenrechner
1. Sem. 60 Lektionen Grundlagen / 15L Zahlen, Zahlendarstellung, Gebrauch des Taschenrechners Koordinatensystem, grafische Darstellungen SI-Einheiten Zeitberechnungen Prozente, Promille Taschenrechner
ARBEITSPROGRAMM. Polymechaniker G, Produktionsmechaniker. Erstellt: durch Th. Steiger Überarbeitung: durch Kontrolle/Freigabe: durch
 Version 2.0 1/6 Semester 1 160 (PR: 120) Einteilung Werkstoffgrundlagen 2 KPF1.1.1 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie Betriebs- und
Version 2.0 1/6 Semester 1 160 (PR: 120) Einteilung Werkstoffgrundlagen 2 KPF1.1.1 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie Betriebs- und
Bildungszentrum Limmattal. Semesterplan Physik. Logistik und Technologie Polymechaniker/in, Konstrukteur/in V17.1
 Bildungszentrum Limmattal Logistik und Technologie Semesterplan Physik V17.1 2/7 S. Forster 1. Semester XXF4.1 Dynamik 15 Lektionen XXF4.1.1 Bewegungslehre 15 Lektionen Gleichförmig geradlinige und kreisförmige
Bildungszentrum Limmattal Logistik und Technologie Semesterplan Physik V17.1 2/7 S. Forster 1. Semester XXF4.1 Dynamik 15 Lektionen XXF4.1.1 Bewegungslehre 15 Lektionen Gleichförmig geradlinige und kreisförmige
Lehrplan Konstrukteurin EFZ / Konstrukteur EFZ
 Lehrplan Konstrukteurin EFZ / Konstrukteur EFZ Basiert auf den Kompetenzen-Ressourcen-Katalog (Version 2.0) vom 30. November 2015 und Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung (Version
Lehrplan Konstrukteurin EFZ / Konstrukteur EFZ Basiert auf den Kompetenzen-Ressourcen-Katalog (Version 2.0) vom 30. November 2015 und Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung (Version
1. Sem. 40 Lektionen. Polymechaniker-/in EFZ Konstrukteur-/in EFZ Schullehrplan Kanton Bern Gültig ab 2016 Version 1.0.
 1. Sem. 40 Lektionen Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Werkstoffgrundlagen 25 L Einteilung 5 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe
1. Sem. 40 Lektionen Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Werkstoffgrundlagen 25 L Einteilung 5 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe
1. Sem. 40 Lektionen. Polymechaniker-/in EFZ Konstrukteur-/in EFZ Schullehrplan Kanton Bern Gültig ab 2016 Version 1.0.
 1. Sem. Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Werkstoffgrundlagen 20 L Einteilung 4 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie
1. Sem. Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Werkstoffgrundlagen 20 L Einteilung 4 Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Schullehrplan. Produktionsmechaniker/in. Bildungsdepartement
 Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Produktionsmechaniker/in EFZ Bildungsdepartement Schullehrplan Mathematik und Physik Semester 1 Anzahl Lektionen pro
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Produktionsmechaniker/in EFZ Bildungsdepartement Schullehrplan Mathematik und Physik Semester 1 Anzahl Lektionen pro
Schulinterner Lehrplan ab 2016 Konstrukteur und Polymechaniker Profil E Kompetenzen-Ressourcen-Katalog; Version 2.0 vom
 Die Überarbeitung der Ausbildung im Rahmen der neuen Bildungsverordnung für Lehrbeginn ab Sommer 2016 hat eine Gruppierung der einzelnen Fächer in Hauptfächer zur Folge. Im fachkundlichen Unterricht werden
Die Überarbeitung der Ausbildung im Rahmen der neuen Bildungsverordnung für Lehrbeginn ab Sommer 2016 hat eine Gruppierung der einzelnen Fächer in Hauptfächer zur Folge. Im fachkundlichen Unterricht werden
ARBEITSPROGRAMM. Konstrukteur, Polymechaniker E. Erstellt: durch Th. Steiger Überarbeitung: durch Kontrolle/Freigabe: durch
 Version 2.0 1/6 Semester 3 120 KPF4.1.1 Einteilung, Eigenschaften Lösbare 2 Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen KPF4.1.2 Wirkungsweise
Version 2.0 1/6 Semester 3 120 KPF4.1.1 Einteilung, Eigenschaften Lösbare 2 Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen KPF4.1.2 Wirkungsweise
Fertigungstechnik 60 Lektionen. 1. Sem. 20 Lektionen. Produktionsmecheniker-/in Schullehrplan Kanton Bern Version 1.0
 Produktionsmecheniker-/in Fertigungstechnik 60 Lektionen 1. Sem. Grundlagen der Qualitätssicherung Mess- und Prüfverfahren 10 Mess- und Prüfverfahren unterscheiden. Mess- und Prüfmittel erläutern Messfehler
Produktionsmecheniker-/in Fertigungstechnik 60 Lektionen 1. Sem. Grundlagen der Qualitätssicherung Mess- und Prüfverfahren 10 Mess- und Prüfverfahren unterscheiden. Mess- und Prüfmittel erläutern Messfehler
Elektronikerin. Beispielhafte Situation. Lernkooperation Betrieb Bemerkungen. Ressourcen. Semester XXF grafisch darstellen Lineare Funktionen
 Lineare Funktionen (2/5) ID XXF.5. XXF.5.2 Ressourcen Mathematische Funktionen, Wertetabelle und grafische Darstellung Die Funktion als Zuordnung zweier veränderlicher Grössen erkennen Zusammenhang Funktionsgleichung,
Lineare Funktionen (2/5) ID XXF.5. XXF.5.2 Ressourcen Mathematische Funktionen, Wertetabelle und grafische Darstellung Die Funktion als Zuordnung zweier veränderlicher Grössen erkennen Zusammenhang Funktionsgleichung,
Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften
 80 Lektionen 1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L
80 Lektionen 1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L
Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften
 1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L Lösbare und nicht
1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L Lösbare und nicht
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Schullehrplan. Maschinenbau Anlehre. Bildungsdepartement
 Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Maschinenbau Anlehre Bildungsdepartement 1 ÜBERSICHT... 2 2 ZEICHENKUNDE: 1.JAHR... 3 3 ZEICHENKUNDE: 2.JAHR... 4 4 PHYSIK:
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Maschinenbau Anlehre Bildungsdepartement 1 ÜBERSICHT... 2 2 ZEICHENKUNDE: 1.JAHR... 3 3 ZEICHENKUNDE: 2.JAHR... 4 4 PHYSIK:
ARBEITSPROGRAMM. Polymechaniker G, Produktionsmechaniker. Erstellt: durch Th. Steiger Überarbeitung: durch Kontrolle/Freigabe: durch
 Version 2.0 1/6 Semester 1 KPF2.1.1 KPF2.1.1 Verfahren, Einflussfaktoren Die Hauptgruppen der Formgebung und die zugehörigen Fertigungsverfahren aufzählen Faktoren aufzählen, welche die Wahl des Verfahrens
Version 2.0 1/6 Semester 1 KPF2.1.1 KPF2.1.1 Verfahren, Einflussfaktoren Die Hauptgruppen der Formgebung und die zugehörigen Fertigungsverfahren aufzählen Faktoren aufzählen, welche die Wahl des Verfahrens
Fachbereich Maschinenbau
 Fachbereich Maschinenbau Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Liestal Schullehrplan Fachunterricht Liestal, 16. April 2010 Produktionsmechaniker,
Fachbereich Maschinenbau Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Liestal Schullehrplan Fachunterricht Liestal, 16. April 2010 Produktionsmechaniker,
Lehrplan ab Physik (5. Semester) [20 Lektionen] Physik (4. Semester) [20 Lektionen] Mathematik (2. Semester) [40 Lektionen]
![Lehrplan ab Physik (5. Semester) [20 Lektionen] Physik (4. Semester) [20 Lektionen] Mathematik (2. Semester) [40 Lektionen] Lehrplan ab Physik (5. Semester) [20 Lektionen] Physik (4. Semester) [20 Lektionen] Mathematik (2. Semester) [40 Lektionen]](/thumbs/55/36759593.jpg) Physik (5. Semester) [20 Lektionen] Aero- und Hydrodynamik 5. Semester, 1 Lektion Aero- und Hydrodynamik Physik (4. Semester) [20 Lektionen] Aero- und Hydrostatik 4. Semester, 1 Lektion Aero- und Hydrostatik
Physik (5. Semester) [20 Lektionen] Aero- und Hydrodynamik 5. Semester, 1 Lektion Aero- und Hydrodynamik Physik (4. Semester) [20 Lektionen] Aero- und Hydrostatik 4. Semester, 1 Lektion Aero- und Hydrostatik
21 Technische Grundlagen
 21 Technische Grundlagen Die für die Berufstätigkeit erforderlichen elementaren technischen Grundlagen erarbeiten und an Beispielen anwenden. 1. Quartal 10 Lektionen 211.1 Arbeitssicherheit 3 2 Gefahrensymbole
21 Technische Grundlagen Die für die Berufstätigkeit erforderlichen elementaren technischen Grundlagen erarbeiten und an Beispielen anwenden. 1. Quartal 10 Lektionen 211.1 Arbeitssicherheit 3 2 Gefahrensymbole
Fachbereich Maschinenbau
 Fachbereich Maschinenbau Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Liestal Schullehrplan Fachunterricht Liestal, 16. April 2010 Mechanikpraktiker,
Fachbereich Maschinenbau Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Liestal Schullehrplan Fachunterricht Liestal, 16. April 2010 Mechanikpraktiker,
4. Sem. 20 Lektionen. Profil G 40 Lektionen. Elektrotechnik. Polymechaniker-/in Schullehrplan Kanton Bern Version 1.2
 Elektrotechnik 40 Lektionen 4. Sem. Einfacher Stromkreis Die elementaren elektrischen Grössen im Stromkreis Messen von elektrischen Grössen Erweiterter Stromkreis Schaltungsarten von Erzeugern und Verbrauchern
Elektrotechnik 40 Lektionen 4. Sem. Einfacher Stromkreis Die elementaren elektrischen Grössen im Stromkreis Messen von elektrischen Grössen Erweiterter Stromkreis Schaltungsarten von Erzeugern und Verbrauchern
Lehrplan Anlagen- und Apparatebauerin EFZ und Anlagen- und Apparatebauer EFZ
 Lehrplan Anlagen- und Apparatebauerin EFZ und Anlagen- und Apparatebauer EFZ Überarbeitete Auflage Version 3 Gültig ab Schuljahr 015 / 016 Lehrplan gemäss Verordnung des BBT über die berufliche Grundbildung
Lehrplan Anlagen- und Apparatebauerin EFZ und Anlagen- und Apparatebauer EFZ Überarbeitete Auflage Version 3 Gültig ab Schuljahr 015 / 016 Lehrplan gemäss Verordnung des BBT über die berufliche Grundbildung
Berufsfachschule Solothurn. Schullehrplan für Polymechaniker Niveau G. Seite 1
 Berufsfachschule Solothurn Schullehrplan für Polymechaniker Niveau G Seite 1 Vorwort zum Schullehrplan (SLP) der GIBS Solothurn Sehr geehrte Damen und Herren Der vorliegende Schullehrplan (SLP) für Konstrukteure
Berufsfachschule Solothurn Schullehrplan für Polymechaniker Niveau G Seite 1 Vorwort zum Schullehrplan (SLP) der GIBS Solothurn Sehr geehrte Damen und Herren Der vorliegende Schullehrplan (SLP) für Konstrukteure
Lehrplan Technische Grundlagen / Mathematik Mechanikpraktiker/in EBA
 V 7.0.09 Lehrplan Technische Grundlagen / Mathematik Mechanikpraktiker/in EBA Lehrmittel Arbeitsblätter Formelbuch selber erstellen Total Lektionen 80 Semesterplan.. 3. 4. 0 0 0 0 Taxonomiestufen und deren
V 7.0.09 Lehrplan Technische Grundlagen / Mathematik Mechanikpraktiker/in EBA Lehrmittel Arbeitsblätter Formelbuch selber erstellen Total Lektionen 80 Semesterplan.. 3. 4. 0 0 0 0 Taxonomiestufen und deren
Sachliche und zeitliche Gliederung
 Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Technische/r Zeichner/-in Fachrichtung: Maschinen- und Anlagentechnik AUSZUBILDENDE / -R: Ausbildungsbetrieb:
Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Technische/r Zeichner/-in Fachrichtung: Maschinen- und Anlagentechnik AUSZUBILDENDE / -R: Ausbildungsbetrieb:
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Schullehrplan. Produktionsmechaniker/in. Bildungsdepartement
 Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan /in EFZ Bildungsdepartement Schullehrplan EFZ Mathematik/Physik Schullehrplan Mathematik/Physik Semester 1+2 2 Lekt.
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan /in EFZ Bildungsdepartement Schullehrplan EFZ Mathematik/Physik Schullehrplan Mathematik/Physik Semester 1+2 2 Lekt.
^ääöéãéáåé=déïéêäéëåüìäé=_~ëéä=
 bêòáéüìåöëçéé~êíéãéåíçéëh~åíçåë_~ëéäjpí~çí ^ääöéãéáåédéïéêäéëåüìäé_~ëéä jéåü~åáëåüjíéåüåáëåüé^äíéáäìåö Stundentafel Schulinterner Lehrplan Berufsgruppe Automatiker 25. Mai 09 ^ääöéãéáåédéïéêäéëåüìäé_~ëéä
bêòáéüìåöëçéé~êíéãéåíçéëh~åíçåë_~ëéäjpí~çí ^ääöéãéáåédéïéêäéëåüìäé_~ëéä jéåü~åáëåüjíéåüåáëåüé^äíéáäìåö Stundentafel Schulinterner Lehrplan Berufsgruppe Automatiker 25. Mai 09 ^ääöéãéáåédéïéêäéëåüìäé_~ëéä
Bildungszentrum Arbon. Berufsreform Berufsfachschulen
 Berufsreform 2009 Berufsfachschulen Polymechaniker / Konstrukteure Anzahl Lektionen Profil G Profil E Polymechaniker/in 1800 2160 (wie bisher) Konstrukteur/in 2160 (wie bisher) 2 Lektionsverteilung (wie
Berufsreform 2009 Berufsfachschulen Polymechaniker / Konstrukteure Anzahl Lektionen Profil G Profil E Polymechaniker/in 1800 2160 (wie bisher) Konstrukteur/in 2160 (wie bisher) 2 Lektionsverteilung (wie
Metallbauer / Metallbauerin, Schwerpunkt: Konstruktionstechnik chronologisch
 1 1 Berufsbildung, Arbeitsund Tarifrecht 2 1 Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes Wi-So Wi-So 3 1 Sicherheit und Wi-So M H17 Sicherheits- und Schutzmaßnahmen Gesundheitsschutz bei der Arbeit
1 1 Berufsbildung, Arbeitsund Tarifrecht 2 1 Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes Wi-So Wi-So 3 1 Sicherheit und Wi-So M H17 Sicherheits- und Schutzmaßnahmen Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Schullehrplan. Produktionsmechaniker/in. Bildungsdepartement
 Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Produktionsmechaniker/in EFZ Bildungsdepartement Lektionenverteilung Produktionsmechaniker nach BIPLA 2016 1. Lehrjahr
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Produktionsmechaniker/in EFZ Bildungsdepartement Lektionenverteilung Produktionsmechaniker nach BIPLA 2016 1. Lehrjahr
ARBEITSPROGRAMM. Automobil-Mechatroniker P
 Version 3.0 1/8 Semester 1 40/125 gemäss 1.1.1 Techn. Rechnen SI-Basiseinheiten aufzählen und den Messgrössen zuordnen MO 5 K1 1 den Messgrössen, Formel- und Einheitszeichen zuordnen MO 5 K1 2 einfache
Version 3.0 1/8 Semester 1 40/125 gemäss 1.1.1 Techn. Rechnen SI-Basiseinheiten aufzählen und den Messgrössen zuordnen MO 5 K1 1 den Messgrössen, Formel- und Einheitszeichen zuordnen MO 5 K1 2 einfache
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Schullehrplan. Polymechaniker/in Profil G EFZ. Bildungsdepartement
 Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Polymechaniker/in Profil G EFZ Bildungsdepartement Lektionenverteilung Polymechaniker Profil G Ab Aug 2016-2020 1. Lehrjahr
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Polymechaniker/in Profil G EFZ Bildungsdepartement Lektionenverteilung Polymechaniker Profil G Ab Aug 2016-2020 1. Lehrjahr
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Schullehrplan. Produktionsmechaniker/in. Bildungsdepartement
 Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Produktionsmechaniker/in EFZ Bildungsdepartement ERFA-SG-AR, Semesterpläne Polymechaniker Profil G, 2016-2020 Lektionenverteilung
Kanton St.Gallen Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal Schullehrplan Produktionsmechaniker/in EFZ Bildungsdepartement ERFA-SG-AR, Semesterpläne Polymechaniker Profil G, 2016-2020 Lektionenverteilung
Minimalziele Mathematik
 Jahrgang 5 o Kopfrechnen, Kleines Einmaleins o Runden und Überschlagrechnen o Schriftliche Grundrechenarten in den Natürlichen Zahlen (ganzzahliger Divisor, ganzzahliger Faktor) o Umwandeln von Größen
Jahrgang 5 o Kopfrechnen, Kleines Einmaleins o Runden und Überschlagrechnen o Schriftliche Grundrechenarten in den Natürlichen Zahlen (ganzzahliger Divisor, ganzzahliger Faktor) o Umwandeln von Größen
Maschinenelemente und Festigkeitslehre
 Längenprüftechnik Qualitätsmanagement Fertigungstechnik Maschinenelemente und Festigkeitslehre Instandhaltung Steuerungstechnik Computertechnik Handhabungstechnik Grundlagen der Elektrotechnik Werkstofftechnik
Längenprüftechnik Qualitätsmanagement Fertigungstechnik Maschinenelemente und Festigkeitslehre Instandhaltung Steuerungstechnik Computertechnik Handhabungstechnik Grundlagen der Elektrotechnik Werkstofftechnik
Materialhinweise Leistungsbeurteilung Mögliche Fächerverbindung Schulbuch - S (G) Arbeitsheft - S (G)
 MAT 10-01 Quadratische Funktionen 12 DS Leitidee: Funktionaler Zusammenhang Thema im Buch: Brücken und mehr quadratische Funktionen von linearen Funktionen unterscheiden. quadratische Funktionen durch
MAT 10-01 Quadratische Funktionen 12 DS Leitidee: Funktionaler Zusammenhang Thema im Buch: Brücken und mehr quadratische Funktionen von linearen Funktionen unterscheiden. quadratische Funktionen durch
Polymechaniker-/in / Konstrukteur-/in Profil E Stoffplan Kanton Bern
 Polymechaniker-/in / Konstrukteur-/in Stoffplan Kanton Bern Gültig ab 1. August 2009 Semester 1 2 3 4 5 6 7 Mathematik Technische Grundlagen Informatik Lern-und Arbeitstechnik Physik Technisches Englisch
Polymechaniker-/in / Konstrukteur-/in Stoffplan Kanton Bern Gültig ab 1. August 2009 Semester 1 2 3 4 5 6 7 Mathematik Technische Grundlagen Informatik Lern-und Arbeitstechnik Physik Technisches Englisch
Automatikmonteur EFZ Automatikmonteurin EFZ
 Kanton St.Gallen Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen Interner Lehrplan utomatikmonteur EFZ utomatikmonteurin EFZ usgabe erstellt Fachkommission usbildungsgänge Beginn Datum: Visum:
Kanton St.Gallen Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen Interner Lehrplan utomatikmonteur EFZ utomatikmonteurin EFZ usgabe erstellt Fachkommission usbildungsgänge Beginn Datum: Visum:
MS Naturns Fachcurriculum Mathematik überarbeitet die Dezimalzahlen - definieren
 Jahrgangstufe: 1. Klasse Basiswissen Kompetenzen Der Schüler/die Schülerin kann Thema: Natürliche Zahlen Inhalte: Vergleichen, ordnen, zählen, Daten sammeln und darstellen Thema: Zahlensysteme Inhalte:
Jahrgangstufe: 1. Klasse Basiswissen Kompetenzen Der Schüler/die Schülerin kann Thema: Natürliche Zahlen Inhalte: Vergleichen, ordnen, zählen, Daten sammeln und darstellen Thema: Zahlensysteme Inhalte:
ARBEITSPROGRAMM. Automobil Fachfrau / Fachmann (Pkw)
 Version 2.0 1/13 Semester 1 Spezifische Grundlagen: Stoffkunde und Fertigungstechnik 15/151 1.3 Stoffkunde und Fertigungstechnik 1.3.1 Chemische Grundlagen den Atomaufbau nach dem Borschen Atommodell beschreiben
Version 2.0 1/13 Semester 1 Spezifische Grundlagen: Stoffkunde und Fertigungstechnik 15/151 1.3 Stoffkunde und Fertigungstechnik 1.3.1 Chemische Grundlagen den Atomaufbau nach dem Borschen Atommodell beschreiben
Zeichnungstechnik Profil E 160 Lektionen. 1. Sem. 20 Lektionen. Polymechaniker-/in Schullehrplan Kanton Bern Version 1.2
 Zeichnungstechnik 160 Lektionen 1. Sem. Vertiefung Polymechaniker Zeichnungstechnik 3 Technische Darstellungsarten unterscheiden Merkmale einer technischen Zeichnung beschreiben Bedeutung der Normung aufzeigen
Zeichnungstechnik 160 Lektionen 1. Sem. Vertiefung Polymechaniker Zeichnungstechnik 3 Technische Darstellungsarten unterscheiden Merkmale einer technischen Zeichnung beschreiben Bedeutung der Normung aufzeigen
A/17/7 METALLBEARBEITUNG. Aufsteigend gültig ab 09/10
 A/17/7 METALLBEARBEITUNG 2010 Aufsteigend gültig ab 09/10 Seite 2 Anlage: A/17/7 Metallbearbeitung I. Stundentafel Gesamtstundenzahl: 3 Klassen zu insgesamt 1260 Unterrichtsstunden (Pflichtgegenstände)
A/17/7 METALLBEARBEITUNG 2010 Aufsteigend gültig ab 09/10 Seite 2 Anlage: A/17/7 Metallbearbeitung I. Stundentafel Gesamtstundenzahl: 3 Klassen zu insgesamt 1260 Unterrichtsstunden (Pflichtgegenstände)
Allgemeine Hinweise und Vereinbarungen für den Mathematikunterricht an der IGS Buchholz
 Allgemeine Hinweise und Vereinbarungen für den Mathematikunterricht an der IGS Buchholz Zeichnungen mit Bleistift und Lineal anfertigen Beim Messen und Zeichnen gilt: max. 1 2 mm bzw. 1-2 Toleranz Aufgaben,
Allgemeine Hinweise und Vereinbarungen für den Mathematikunterricht an der IGS Buchholz Zeichnungen mit Bleistift und Lineal anfertigen Beim Messen und Zeichnen gilt: max. 1 2 mm bzw. 1-2 Toleranz Aufgaben,
Sachliche und zeitliche Gliederung
 Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Technische/r Zeichner/-in Fachrichtung: Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik AUSZUBILDENDE / -R:
Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Technische/r Zeichner/-in Fachrichtung: Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik AUSZUBILDENDE / -R:
Problemlösen. Zahl Ebene und Raum Größen Daten und Vorhersagen. Fachsprache, Symbole und Arbeitsmittel anwenden
 Curriculum Mathematik 3. Klasse Aus den Rahmenrichtlinien Die Schülerin, der Schüler kann Vorstellungen von natürlichen, ganzen rationalen Zahlen nutzen mit diesen schriftlich im Kopf rechnen geometrische
Curriculum Mathematik 3. Klasse Aus den Rahmenrichtlinien Die Schülerin, der Schüler kann Vorstellungen von natürlichen, ganzen rationalen Zahlen nutzen mit diesen schriftlich im Kopf rechnen geometrische
Profil E 60 Lektionen. 3. Sem. 20 Lektionen. Elektrotechnik. Polymechaniker-/in / Konstrukteur-/in Schullehrplan Kanton Bern Version 1.
 Elektrotechnik 60 Lektionen 3. Sem. Einfacher Stromkreis Die elementaren elektrischen Grössen im Stromkreis Messen von elektrischen Grössen Erweiterter Stromkreis Schaltungsarten von Erzeugern und Verbrauchern
Elektrotechnik 60 Lektionen 3. Sem. Einfacher Stromkreis Die elementaren elektrischen Grössen im Stromkreis Messen von elektrischen Grössen Erweiterter Stromkreis Schaltungsarten von Erzeugern und Verbrauchern
Berufsfachschule Solothurn. Schullehrplan für Polymechaniker/Konstrukteure mit BM. Seite 1
 Berufsfachschule Solothurn Schullehrplan für Polymechaniker/Konstrukteure mit BM Seite 1 Vorwort zum Schullehrplan (SLP) der GIBS Solothurn Sehr geehrte Damen und Herren Der vorliegende Schullehrplan (SLP)
Berufsfachschule Solothurn Schullehrplan für Polymechaniker/Konstrukteure mit BM Seite 1 Vorwort zum Schullehrplan (SLP) der GIBS Solothurn Sehr geehrte Damen und Herren Der vorliegende Schullehrplan (SLP)
Kompetenzraster Mathematik 7
 Bruchrechnen Ich kann mit Brüchen Grundrechenarten sicher durchführen. Ich kann mit Brüchen Anwendungsaufgaben lösen. Ich kann Bruchterme und Bruchgleichungen aufstellen. Zahlen Ich kann mit positiven
Bruchrechnen Ich kann mit Brüchen Grundrechenarten sicher durchführen. Ich kann mit Brüchen Anwendungsaufgaben lösen. Ich kann Bruchterme und Bruchgleichungen aufstellen. Zahlen Ich kann mit positiven
Böttcher/Forberg Technisches Zeichnen
 Ulrich Kurz Herbert Wittel Böttcher/Forberg Technisches Zeichnen Grundlagen, Normung, Darstellende Geometrie und Übungen Mit 1.173 Abbildungen, 98 Tabellen, zahlreichen Beispielen und Projektaufgaben 25.,
Ulrich Kurz Herbert Wittel Böttcher/Forberg Technisches Zeichnen Grundlagen, Normung, Darstellende Geometrie und Übungen Mit 1.173 Abbildungen, 98 Tabellen, zahlreichen Beispielen und Projektaufgaben 25.,
Kompetenzniveau F. Prozessorientiert. Modellieren Problemlösen. Problemlösen Argumentieren Modellieren
 Andreas Schule / SchiC / Teil C Fach: Mathematik 8 Stand: Monat/Jahr_02-2017_ Schulhalbjahr Std. 1. Halbjahr Unterrichtseinheit / Inhalt (Stenumfang / ggf. Diagnose) 25 h Lineare Gleichungen mit 2 Variablen/LGS
Andreas Schule / SchiC / Teil C Fach: Mathematik 8 Stand: Monat/Jahr_02-2017_ Schulhalbjahr Std. 1. Halbjahr Unterrichtseinheit / Inhalt (Stenumfang / ggf. Diagnose) 25 h Lineare Gleichungen mit 2 Variablen/LGS
die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion mit Hilfe von drei Punkten bestimmen.
 MAT 10-01 Quadratische Funktionen 12 DS Leitidee: Funktionaler Zusammenhang Thema im Buch: Null und nichtig quadratische Funktionen durch Term, Gleichung, Tabelle, Graph darstellen und zwischen den Darstellungen
MAT 10-01 Quadratische Funktionen 12 DS Leitidee: Funktionaler Zusammenhang Thema im Buch: Null und nichtig quadratische Funktionen durch Term, Gleichung, Tabelle, Graph darstellen und zwischen den Darstellungen
Inhaltsverzeichnis VII. 1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise...
 VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
Inhalt HM TB Metall TP MSR TT IQ-S IQ-L Lernziele L Methoden L Lernmittel L zeitlicher Ablauf L
 1.0 Einstieg 0 4 1.0.1 Bezüge in das berufliche Handlungsfeld L 0 4 1.0.2 Beschreibung des Lernfeldprojektes L 1.1 uftragsannahme 0 1.1.1 Lernziele L 0 1.1.2 Methoden L 0 1.1.3 Lernmittel L 0 1.1.4 zeitlicher
1.0 Einstieg 0 4 1.0.1 Bezüge in das berufliche Handlungsfeld L 0 4 1.0.2 Beschreibung des Lernfeldprojektes L 1.1 uftragsannahme 0 1.1.1 Lernziele L 0 1.1.2 Methoden L 0 1.1.3 Lernmittel L 0 1.1.4 zeitlicher
Schuleigener Arbeitsplan Fach: Mathematik Jahrgang: 5
 Stand:.0.206 Sommerferien Zahlen und Operationen» Zahlen sachangemessen runden» große Zahlen lesen und schreiben» konkrete Repräsentanten großer Zahlen nennen» Zahlen auf der Zahlengeraden und in der Stellenwerttafel
Stand:.0.206 Sommerferien Zahlen und Operationen» Zahlen sachangemessen runden» große Zahlen lesen und schreiben» konkrete Repräsentanten großer Zahlen nennen» Zahlen auf der Zahlengeraden und in der Stellenwerttafel
7 Technische Produktdesigner. 7.1 Grundlagen der Metallbearbeitung für Nicht-Metallberufe. (Kursdauer 4 Wochen, zu Beginn des 1.
 7 Technische Produktdesigner 7.1 Grundlagen der Metallbearbeitung für Nicht-Metallberufe (Kursdauer 4 Wochen, zu Beginn des 1. Ausbildungsjahr) Die Technische Zeichnung als Kommunikationsmittel Allgemeine
7 Technische Produktdesigner 7.1 Grundlagen der Metallbearbeitung für Nicht-Metallberufe (Kursdauer 4 Wochen, zu Beginn des 1. Ausbildungsjahr) Die Technische Zeichnung als Kommunikationsmittel Allgemeine
Lehrplan Fachkunde Produktionsmechaniker/in
 V 7.0.09 Lehrplan Fachkunde Produktionsmechaniker/in Lehrmittel Metallbautechnik Fachbildung / Europaverlag Normenauszug / Formelbuch Swissmem Tabellenbuch / Formelauszug Europa Total Lektionen 60 Semesterplan..
V 7.0.09 Lehrplan Fachkunde Produktionsmechaniker/in Lehrmittel Metallbautechnik Fachbildung / Europaverlag Normenauszug / Formelbuch Swissmem Tabellenbuch / Formelauszug Europa Total Lektionen 60 Semesterplan..
1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise... 3
 VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
Sachliche und zeitliche Gliederung
 Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Konstruktionsmechaniker/-in Feinblechbautechnik AUSZUBILDENDE/-R: Ausbildungsbetrieb: Unterschrift/Stempel IHK:
Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Konstruktionsmechaniker/-in Feinblechbautechnik AUSZUBILDENDE/-R: Ausbildungsbetrieb: Unterschrift/Stempel IHK:
Strahlensätze anwenden. ähnliche Figuren erkennen und konstruieren. ähnliche Figuren mit Hilfe zentrischer Streckung konstruieren.
 MAT 09-01 Ähnlichkeit 14 Doppelstunden Leitidee: Raum und Form Thema im Buch: Zentrische Streckung (G), Ähnlichkeit (E) Strahlensätze anwenden. ähnliche Figuren erkennen und konstruieren. ähnliche Figuren
MAT 09-01 Ähnlichkeit 14 Doppelstunden Leitidee: Raum und Form Thema im Buch: Zentrische Streckung (G), Ähnlichkeit (E) Strahlensätze anwenden. ähnliche Figuren erkennen und konstruieren. ähnliche Figuren
Mathematisch modellieren eine Situation in ein mathematisches Modell transferieren und bearbeiten (z.b. Bestimmung einer Höhe).
 MAT 09-01 Ähnlichkeit 14 DS Leitidee: Raum und Form Thema im Buch: Konstruieren und Projizieren ähnliche Figuren erkennen. den Ähnlichkeitsfaktor bestimmen. anhand des Ähnlichkeitsfaktors erkennen, ob
MAT 09-01 Ähnlichkeit 14 DS Leitidee: Raum und Form Thema im Buch: Konstruieren und Projizieren ähnliche Figuren erkennen. den Ähnlichkeitsfaktor bestimmen. anhand des Ähnlichkeitsfaktors erkennen, ob
Schuleigener Kompetenzplan für das Fach Mathematik Jahrgang 10 Stand 2008 Lehrbuch: Mathematik heute 10
 Schuleigener Kompetenzplan für das Fach Mathematik Jahrgang 0 Stand 008 Lehrbuch: Mathematik heute 0 Inhalte Seiten Kompetenzen gemäß Kerncurriculum Eigene Bemerkungen Quadratische Gleichungen Quadratischen
Schuleigener Kompetenzplan für das Fach Mathematik Jahrgang 0 Stand 008 Lehrbuch: Mathematik heute 0 Inhalte Seiten Kompetenzen gemäß Kerncurriculum Eigene Bemerkungen Quadratische Gleichungen Quadratischen
MATHEMATIK. 1 Stundendotation. 2 Didaktische Hinweise. 4. Klasse. 1. Klasse. 3. Klasse. 5. Klasse. 2. Klasse
 MATHEMATIK 1 Stundendotation 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der Unterricht im Grundlagenfach
MATHEMATIK 1 Stundendotation 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der Unterricht im Grundlagenfach
Allgemeine Hinweise und Vereinbarungen für den Mathematikunterricht an der IGS Buchholz
 Allgemeine Hinweise und Vereinbarungen für den Mathematikunterricht an der IGS Buchholz Zeichnungen mit Bleistift und Lineal anfertigen Beim Messen und Zeichnen gilt: max. 1 2 mm bzw. 1-2 Toleranz Aufgaben,
Allgemeine Hinweise und Vereinbarungen für den Mathematikunterricht an der IGS Buchholz Zeichnungen mit Bleistift und Lineal anfertigen Beim Messen und Zeichnen gilt: max. 1 2 mm bzw. 1-2 Toleranz Aufgaben,
Technisches Zeichnen. 4 l Springer Vieweg. Selbstständig lernen und effektiv üben. Susanna Labisch Christian Weber
 Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 4 l Springer Vieweg Hardware Schnittstellen VII Inhaltsverzeichnis 1
Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 4 l Springer Vieweg Hardware Schnittstellen VII Inhaltsverzeichnis 1
M E T A L L B A U E R
 INSTITUT FÜR AUS- UND WEITERBILDUNG IM MITTELSTAND UND IN KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN Vervierser Straße 4a B 4700 Eupen Tel: 087/306880 Fax: 087/891176 E-MAIL: IAWM@IAWM.BE MEISTERPROGRAMM M E T
INSTITUT FÜR AUS- UND WEITERBILDUNG IM MITTELSTAND UND IN KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN Vervierser Straße 4a B 4700 Eupen Tel: 087/306880 Fax: 087/891176 E-MAIL: IAWM@IAWM.BE MEISTERPROGRAMM M E T
Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln. Schulinternes Curriculum Fach: Mathematik Jg. 9
 Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln Schulinternes Curriculum Fach: Mathematik Jg. 9 Reihe n-folge Buchabschnit t 1 1.1; 1.3; 1.4 1.5 Themen Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Die
Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln Schulinternes Curriculum Fach: Mathematik Jg. 9 Reihe n-folge Buchabschnit t 1 1.1; 1.3; 1.4 1.5 Themen Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Die
Technisches Zeichnen
 Technisches Zeichnen Herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.v. Bearbeitet von Dipl.-Ing. Hans Werner Geschke, Michael Helmetag und Wolfgang Wehr, Berlin 23., neubearbeitete und erweiterte
Technisches Zeichnen Herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.v. Bearbeitet von Dipl.-Ing. Hans Werner Geschke, Michael Helmetag und Wolfgang Wehr, Berlin 23., neubearbeitete und erweiterte
Physikalische und 1 mathematische Grundlagen Formeln der Mechanik Formeln der Elektrotechnik
 Physikalische und 1 mathematische Grundlagen 11...48 Formeln der Mechanik 49...70 2 Formeln der Elektrotechnik 71...122 3 Formeln der Elektronik 123...154 4 Sachwortregister 155...160 5 Bibliografische
Physikalische und 1 mathematische Grundlagen 11...48 Formeln der Mechanik 49...70 2 Formeln der Elektrotechnik 71...122 3 Formeln der Elektronik 123...154 4 Sachwortregister 155...160 5 Bibliografische
Technisches Zeichnen
 Viewegs Fachbücher der Technik Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben von Susanna Labisch, Christian Weber 1. Auflage Technisches Zeichnen Labisch / Weber schnell und portofrei erhältlich
Viewegs Fachbücher der Technik Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben von Susanna Labisch, Christian Weber 1. Auflage Technisches Zeichnen Labisch / Weber schnell und portofrei erhältlich
Sachliche und zeitliche Gliederung
 Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: FACHRICHTUNG: Technischer Produktdesigner / Technische Produktdesignerin Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: FACHRICHTUNG: Technischer Produktdesigner / Technische Produktdesignerin Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Technisches Zeichnen
 Technisches Zeichnen Herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.v. Bearbeitet von Dtpl.-Ing. Hans Werner Geschke, Michael Helmetag und Wolfgang Wehr, Berlin 23., neubearbeitete und erweiterte
Technisches Zeichnen Herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.v. Bearbeitet von Dtpl.-Ing. Hans Werner Geschke, Michael Helmetag und Wolfgang Wehr, Berlin 23., neubearbeitete und erweiterte
Fach: Mathematik Arbeitsstand: August 2017
 Fach: Mathematik Arbeitsstand: August 2017 Jahrgangsstufen: 5 und 6 Anmerkungen: - kein Taschenrechnereinsatz im regulären Unterricht - Innerhalb der Schulhalbjahre ist die Reihenfolge der Bearbeitung
Fach: Mathematik Arbeitsstand: August 2017 Jahrgangsstufen: 5 und 6 Anmerkungen: - kein Taschenrechnereinsatz im regulären Unterricht - Innerhalb der Schulhalbjahre ist die Reihenfolge der Bearbeitung
Technisches Zeichnen. Susanna Labisch Christian Weber. Intensiv und effektiv lernen und üben. 2., überarbeitete Auflage
 Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben 2., überarbeitete Auflage Mit 296 Abbildungen und 55 Tabellen Viewegs Fachbücher der Technik a Vieweg V1L Inhaltsverzeichnis
Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben 2., überarbeitete Auflage Mit 296 Abbildungen und 55 Tabellen Viewegs Fachbücher der Technik a Vieweg V1L Inhaltsverzeichnis
Schuleigener Lehrplan Mathematik -Klasse 9 -
 Schuleigener Lehrplan Mathematik -Klasse 9 - 1. Quadratische Funktionen und quadratische 1 Wiederholen Aufstellen von Funktionsgleichungen 2 Scheitelpunktbestimmung quadratische Ergänzung 3 Lösen einfacher
Schuleigener Lehrplan Mathematik -Klasse 9 - 1. Quadratische Funktionen und quadratische 1 Wiederholen Aufstellen von Funktionsgleichungen 2 Scheitelpunktbestimmung quadratische Ergänzung 3 Lösen einfacher
3 Ansichten, Schnittdarstellungen, Gewinde, Oberflächenangaben, Lesen und Verstehen von Zeichnungen... 63
 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung........................................... 9 1.1 Bedeutung der technischen Zeichnungen und der Zeichnungsnormen.... 9 1.2 Zeichengeräte für das manuelle Zeichnen.......................
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung........................................... 9 1.1 Bedeutung der technischen Zeichnungen und der Zeichnungsnormen.... 9 1.2 Zeichengeräte für das manuelle Zeichnen.......................
MATHEMATIK. 1 Stundendotation. 2 Didaktische Hinweise G1 G2 G3 G4 G5 G6
 MATHEMATIK 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der
MATHEMATIK 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der
Eine zugehörige interaktive Selbstkontrolle findet sich jeweils am Ende des Kapitels.
 Materialienübersicht Verstehen Theorieunterstützung Kompetenzenübersicht für die standardisierte Reife- und Diplomprüfung... 5... 63... 95 Eine zugehörige interaktive Selbstkontrolle findet sich jeweils
Materialienübersicht Verstehen Theorieunterstützung Kompetenzenübersicht für die standardisierte Reife- und Diplomprüfung... 5... 63... 95 Eine zugehörige interaktive Selbstkontrolle findet sich jeweils
Böttcher/Forberg Technisches Zeichnen
 Ulrich Kurz. Herbert Wittel Böttcher/Forberg Technisches Zeichnen Grundlagen, Normung, Übungen und Projektaufgaben 26., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 1.176 Abbildungen, 98 Tabellen, zahlreichen
Ulrich Kurz. Herbert Wittel Böttcher/Forberg Technisches Zeichnen Grundlagen, Normung, Übungen und Projektaufgaben 26., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 1.176 Abbildungen, 98 Tabellen, zahlreichen
Arbeitszeit Teil A 45 Minuten Teil B 45 Minuten
 Inhalt/Lernziele Arbeitszeit Teil A 45 Minuten Teil B 45 Minuten Teil A Teiler einer Zahl bestimmen Teilbarkeitsgegeln anwenden Primzahlen kleiner 100 erkennen Quadratzahlen kleiner 300 erkennen Getönte
Inhalt/Lernziele Arbeitszeit Teil A 45 Minuten Teil B 45 Minuten Teil A Teiler einer Zahl bestimmen Teilbarkeitsgegeln anwenden Primzahlen kleiner 100 erkennen Quadratzahlen kleiner 300 erkennen Getönte
Mathematik verstehen 1 JAHRESPLANUNG (5. Schulstufe) 1. Klasse AHS, NMS
 Mathematik verstehen 1 JAHRESPLANUNG (5. Schulstufe) 1. Klasse AHS, NMS Monat Lehrstoff Lehrplan Inhaltsbereich Handlungsbereiche September Ein neuer Anfang 1 Natürliche Zahlen 1.1 Zählen und Zahlen 1.2
Mathematik verstehen 1 JAHRESPLANUNG (5. Schulstufe) 1. Klasse AHS, NMS Monat Lehrstoff Lehrplan Inhaltsbereich Handlungsbereiche September Ein neuer Anfang 1 Natürliche Zahlen 1.1 Zählen und Zahlen 1.2
Technisches Zeichnen. Susanna Labisch Christian Weber
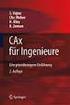 Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 3., überarbeitete Auflage Mit 329 Abbildungen und 59 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER VII Inhaltsverzeichnis
Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 3., überarbeitete Auflage Mit 329 Abbildungen und 59 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER VII Inhaltsverzeichnis
Jgst. 5 Fach Mathematik Lehrwerk: Elemente der Mathematik 5
 Jgst. 5 Fach Mathematik Lehrwerk: Elemente der Mathematik 5 3 pro (maximal 45 Minuten) Rechnen mit natürlichen Zahlen; Darstellung natürlicher Zahlen und einfacher Bruchteile; Rechnen mit Größen Maßstabsverhältnisse;
Jgst. 5 Fach Mathematik Lehrwerk: Elemente der Mathematik 5 3 pro (maximal 45 Minuten) Rechnen mit natürlichen Zahlen; Darstellung natürlicher Zahlen und einfacher Bruchteile; Rechnen mit Größen Maßstabsverhältnisse;
Verteilung der Lernabschnitte des Lehrplans Mathematik GemS Erläuterungen
 Verteilung der Lernabschnitte des Lehrplans Mathematik GemS Erläuterungen Vorschlag zur Verteilung der Lernabschnitte für die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 sowie 9/10 zum Lehrplan Mathematik für die Gemeinschaftsschule
Verteilung der Lernabschnitte des Lehrplans Mathematik GemS Erläuterungen Vorschlag zur Verteilung der Lernabschnitte für die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 sowie 9/10 zum Lehrplan Mathematik für die Gemeinschaftsschule
Vorläufiger schuleigener Lehrplan für das Fach Mathematik Jahrgang 7 Stand Lehrbuch: Mathematik heute 7
 Zuordnungen - Zuordnungen in Tabellen und Graphen - Proportionale Zuordnungen - Antiproportionale Zuordnungen - Schätzen mit proportionalen und antiproportionalen Zuordnungen - Zuordnungen und Tabellenkalkulation
Zuordnungen - Zuordnungen in Tabellen und Graphen - Proportionale Zuordnungen - Antiproportionale Zuordnungen - Schätzen mit proportionalen und antiproportionalen Zuordnungen - Zuordnungen und Tabellenkalkulation
Modul 4. Physik und Stoffe. Automobildiagnostiker mit eidg. Fachausweis. Fachrichtung Nutzfahrzeuge. Fachrichtung leichte Motorfahrzeuge
 Modul 4 Physik und Stoffe Fachrichtung leichte Motorfahrzeuge Automobildiagnostiker mit eidg. Fachausweis Fachrichtung Nutzfahrzeuge Module 7 bis 9 Module 10 bis 12 Module 1 bis 6 AGVS, Mittelstrasse 32,
Modul 4 Physik und Stoffe Fachrichtung leichte Motorfahrzeuge Automobildiagnostiker mit eidg. Fachausweis Fachrichtung Nutzfahrzeuge Module 7 bis 9 Module 10 bis 12 Module 1 bis 6 AGVS, Mittelstrasse 32,
Kern- und Schulcurriculum Mathematik Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum Mathematik Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Klasse 5 UE 1 Natürliche en und Größen Große en Zweiersystem Römische en Anordnung, Vergleich Runden, Bilddiagramme Messen von Länge
Kern- und Schulcurriculum Mathematik Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Klasse 5 UE 1 Natürliche en und Größen Große en Zweiersystem Römische en Anordnung, Vergleich Runden, Bilddiagramme Messen von Länge
3 Werkzeugmechaniker. 3.1 Grundlagen der Metallbearbeitung für Metallberufe. (Kursdauer 6 Wochen, Beginn 1. Ausbildungsjahr) Lehrgangsinhalt
 3 Werkzeugmechaniker 3.1 Grundlagen der Metallbearbeitung für Metallberufe (Kursdauer 6 Wochen, Beginn 1. Ausbildungsjahr) Lehrgangsinhalt Die Technische Zeichnung als Kommunikationsmittel Allgemeine Grundlagen
3 Werkzeugmechaniker 3.1 Grundlagen der Metallbearbeitung für Metallberufe (Kursdauer 6 Wochen, Beginn 1. Ausbildungsjahr) Lehrgangsinhalt Die Technische Zeichnung als Kommunikationsmittel Allgemeine Grundlagen
Inhaltsverzeichnis VII. 1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise...
 VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
Orientierungsmodul Oberstufe OS 1. Zahlen auf dem Zahlenstrahl darstellen und interpretieren. natürliche Zahlen bis 2 Millionen lesen und schreiben
 ernziele Inhalt/ernziele Zahlendarstellung Zahlen auf dem Zahlenstrahl darstellen und interpretieren natürliche Zahlen bis 2 Millionen lesen und schreiben Schwierigkeitsgrad A1 73%, A2 57%, A4 56% A3 68%
ernziele Inhalt/ernziele Zahlendarstellung Zahlen auf dem Zahlenstrahl darstellen und interpretieren natürliche Zahlen bis 2 Millionen lesen und schreiben Schwierigkeitsgrad A1 73%, A2 57%, A4 56% A3 68%
Einstiegsqualifizierung
 Einstiegsqualifizierung Technisches Zeichnen Tätigkeitsbereiche: Grundlagen des technischen Zeichnens Betriebliche Organisation und Kommunikation Lesen und Anwenden technischer Unterlagen Sicherheit und
Einstiegsqualifizierung Technisches Zeichnen Tätigkeitsbereiche: Grundlagen des technischen Zeichnens Betriebliche Organisation und Kommunikation Lesen und Anwenden technischer Unterlagen Sicherheit und
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WERKZEUGBAUTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/17/5 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WERKZEUGBAUTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der 1., 2.
Anlage A/17/5 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WERKZEUGBAUTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der 1., 2.
Computertechnik Elektrotechnik Mechanik
 TG: Profil Mechatronik Grundgedanke 0 Zukunftsfähige technische Lösungen erfordern [ ] verstärkt vernetztes Denken [ ]. Die Schülerinnen und Schüler erwerben [ ] Fähigkeiten, die Ihnen die [ ] Arbeitsweise
TG: Profil Mechatronik Grundgedanke 0 Zukunftsfähige technische Lösungen erfordern [ ] verstärkt vernetztes Denken [ ]. Die Schülerinnen und Schüler erwerben [ ] Fähigkeiten, die Ihnen die [ ] Arbeitsweise
Fertigungs- und Automatisierungstechnik. Maschinenbau. Fachschule
 Fertigungs- und Automatisierungstechnik Ausbildung Die Facharbeiterinnen- und Facharbeiterausbildung der ergänzt die Ausbildung technik um Ausbildungen in Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik,
Fertigungs- und Automatisierungstechnik Ausbildung Die Facharbeiterinnen- und Facharbeiterausbildung der ergänzt die Ausbildung technik um Ausbildungen in Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik,
BILDUNGSSTANDARDS 4. Schulstufe MATHEMATIK
 BILDUNGSSTANDARDS 4. Schulstufe MATHEMATIK Allgemeine mathematische Kompetenzen (AK) 1. Kompetenzbereich Modellieren (AK 1) 1.1 Eine Sachsituation in ein mathematisches Modell (Terme und Gleichungen) übertragen,
BILDUNGSSTANDARDS 4. Schulstufe MATHEMATIK Allgemeine mathematische Kompetenzen (AK) 1. Kompetenzbereich Modellieren (AK 1) 1.1 Eine Sachsituation in ein mathematisches Modell (Terme und Gleichungen) übertragen,
Geogebra im Geometrieunterricht. Peter Scholl Albert-Einstein-Gymnasium
 Geogebra im Geometrieunterricht Bertrand Russel in LOGICOMIX Geometrie im Lehrplan Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Oberstufe Parallele und senkrechte Geraden Kreise Winkel benennen, messen
Geogebra im Geometrieunterricht Bertrand Russel in LOGICOMIX Geometrie im Lehrplan Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Oberstufe Parallele und senkrechte Geraden Kreise Winkel benennen, messen
Inhaltsbezogene Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler...
 I Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen 1. Aufstellen von Funktionsgleichungen stellen quadratische Funktionen mit eigenen Worten, in Wertetabellen, Graphen und in Termen dar, wechseln zwischen
I Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen 1. Aufstellen von Funktionsgleichungen stellen quadratische Funktionen mit eigenen Worten, in Wertetabellen, Graphen und in Termen dar, wechseln zwischen
Einstiegsqualifizierung
 Einstiegsqualifizierung Technisches Zeichnen Tätigkeitsbereiche: Grundlagen des technischen Zeichnens Betriebliche Organisation und Kommunikation Lesen und Anwenden technischer Unterlagen Sicherheit und
Einstiegsqualifizierung Technisches Zeichnen Tätigkeitsbereiche: Grundlagen des technischen Zeichnens Betriebliche Organisation und Kommunikation Lesen und Anwenden technischer Unterlagen Sicherheit und
Grundmodul Metalltechnik
 Grundmodul Metalltechnik Inhaltsverzeichnis 1 Längenberechnungen... 4 1.1 Allgemein... 4 1.2 Randabstand gleich der Teilung... 4 1.3 Randabstandteilung ungleich Teilung... 4 1.4 Trennung von Teilstücken...
Grundmodul Metalltechnik Inhaltsverzeichnis 1 Längenberechnungen... 4 1.1 Allgemein... 4 1.2 Randabstand gleich der Teilung... 4 1.3 Randabstandteilung ungleich Teilung... 4 1.4 Trennung von Teilstücken...
