Ich versich~elbststiindig verfasst habe. Felix Manfred Pries, der 04. m.17
|
|
|
- Michaela Färber
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Sind gute Argumente erfolgreich? Felix Manfred Pries Jahrgangsstufe 13 pi 1 / Frau Dr. Lang Schule: Sebastian-Münster-Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße Ingelheim Privatanschrift: Felix Pries Obere Froschau Ingelheim Ich versich~elbststiindig verfasst habe. r. ~ Felix Manfred Pries, der 04. m.17
2 Über Argumente, deren Bewertung und ihren Erfolg Sind gute Argumente erfolgreich? Um diese Frage sinnvoll zu beantworten, bedarf es zunächst der Beantwortung dreier vorgeordneter Fragen: (1) Was ist ein Argument? (2) Wann ist ein Argumentund diese ist meiner Ansicht nach die entscheidendste, weil disputabelste Frage - gut? (3) Wann ist ein Argument erfolgreich? Widmen wir uns anfänglich der Definition eines Arguments, der Beantwortung der Frage (1) also. Obwohl jede*r tagtäglich Argumente verwendet, erscheint eine allgemeine Bestimmung bei genauerer Betrachtung gar nicht so einfach. Nehmen wir einfach mal an, ich möchte ein Argument benutzen, um jemanden von meiner Meinung zu überzeugen. Oder - um es noch anschaulicher zu machen: Nehmen wir mal an, ich möchte jemanden davon überzeugen, dass sie jeden Abend schlafen gehen soll. Ich brauche nun einen Grund, der dafür spricht, der sie davon überzeugt, dies zu tun. Sagen wir mal, es ist ungesund, nicht jeden Abend schlafen zu gehen. Ich würde ihr folglich sagen können: (1),,Du solltest jeden Abend schlafen gehen, da es ungesund ist, dies nicht zu tun." Selena Gomez gehört zu den meistabonnierten Persönlichkeiten auf Instagram. Setzen wir einfach, dass ich aus sicherer Quelle weiß, dass auch sie jeden Abend schlafen geht. So könnte ich stattdessen auch sagen: (II),,Du solltest jeden Abend schlafen gehen, weil Selena Gomez das auch tut." In beiden Fällen habe ich ein Argument geliefert. Ich habe in beiden Fällen die gleiche These, von der ich jemanden überzeugen will. Und in beiden Fällen habe ich eine weitere These, die meine Ursprungsthese unterstützen und im Eigentlichen das Gegenüber von meiner These überzeugen soll. Im Alltäglichen wird diese weitere These oft als das Argument bezeichnet. Argument A (Es ist ungesund, nichtjeden Abend schlafen zu gehen) stützt These B (Man soll jeden Abend schlafen gehen). Dabei macht die Gesamtheit der beiden Sätze und ihre Beziehung zueinander erst das Argument. Für sich ist "Argument A" auch nicht mehr als eine einfache These. Erst die Verknüpfung der beiden zu einer Schlussfolgerung macht das Argument.Präzise ausgedrückt ließe sich unser erstes Argument (1) so darstellen: Es ist ungesund, nicht jeden Abend schlafen zu gehen. Du solltest nichts Ungesundes tun. Also: Du solltest nicht nicht jeden Abend schlafen gehen (was gleichbedeutend ist mit der Aussage, du solltest jeden Abend schlafen gehen). Der Form nach handelt es sich um einen deduktiven Schluss, dessen Konklusion automatisch dann wahr ist, wenn all seine Prämissen dies auch sind. Im Zusammenhang der Definition des Arguments möchte ich die sogenannten stüzenden Thesen Prämissen und die Hauptthese Konklusion nennen. Denn grundsätzlich lässt sich jedes Argument in seiner Reinform als logischer Schluss darstellen. Die zweite Prämissen blieb in unserem Argument implizit; ich könnte davon ausgehen, dass jede*r diesen Schritt im Kopf mitmacht. Jedoch zeigt dieser Verhalt, dass ein Argument aus mehreren Prämissen bestehen kann bzw. muss es das so gar. Aus einem einzigen Satz, einer einzigen Prämisse, lässt sich nichts folgern, was nicht schon in in ihm resp. ihr selbst enthalten ist. Oft bleiben Prämissen, von denen der argumentierende Mensch ausgeht, jede*r würde sie akzeptieren, ungenannt. (Was meiner Meinung nach übrigens enorm oft der Grund für fehlgeschlagene Kommunikation innerhalb einer Diskussion ist, aber das ist ein anderes Thema... ) Es ist also sinnvoll einem Argument prinzipiell mit Wohlwollen zu begegnen. Wir sollten - um uns eines konstruktiven Diskurses zu bemühen - immer überlegen, welche Prämissen ungenannt geblieben sein könnten. Nach unserer kurzen Untersuchung des Arguments ließe sich diese Definition festhalten: Ein Argument ist eine Folge mehrerer Sätz, von denen ein Satz (die Konklusion) scheinbar aus den anderen (den Prämissen) logisch gefolgert werden kann. Das "scheinbar" ist essentiell für die Frage (2): Wann ist ein Argument gut? Denn ließen wir dieses "scheinbar" weg, so wäre es schwieriger, von guten und schlechten Argumenten zu sprechen. Aber prüfen wir zunächst, nach welchen Kriterien die Beurteilung eines Arguments durchgeführt werden kann. Ich könnte sagen: (III) "Du solltest jeden Abend schlafen gehen, weil sonst ein böser Geist kommt und deinen kleinen Bruder aufisst." Der Schluss als solcher ist - unter Annahme der impliziten Prämisse Du solltest
3 verhindern, dass ein böser Geist deinen kleinen Bruder aufisst - korrekt. Trotzdem käme wohl fast niemand auf die Idee, diese Aussage als ein gutes Argument zu bezeichnen. Denn eine enthalte Prämisse ist - sehr sehr wahrscheinlich ( ein epistemischer Scherz am Rande) - unwahr. Die Schlussfolgerung innerhalb kann somit zwar korrekt sein, das Argument insgesamt dennoch nicht gültig. Gute Argumente enthalten keine falschen Prämissen. Ein weiteres Argument für unsere Konklusion wäre auch: (IV)"Du solltest jeden Abend schlafen gehen, weil Mr. Anderson, infolge dessen er nicht jeden Abend schlafen gegangen ist, wahnsinnig geworden ist" Gehen wir davon aus, die explizite Prämisse sei wahr. Auch wenn wir nicht wahnsinnig werden wollen, zwingt uns das Argument nicht dazu, die Wahrheit der Konklusion trotz Wahrheit aller Prämissen anzuerkennen: Die Schlussform ist nicht zwingend. Im Gegensatz zum ersten Argument schließen wir diesmal von einer begrenzten Stichprobe auf ein allgemeingültiges Gesetz, man spricht von einem induktiven Schluss. Die Gültigkeit eines solchen Schlusses lässt sich berechtigterweise (und in diesem Fall offensichtlich) bezweifeln. Einem guten Argument liegt eine korrekte Schlussform zugrunde. Fassen wir nocheinmal zusammen: Es gibt erst einmal zwei Möglichkeiten, ein Argument zu beurteilen. Entweder setze ich an den Prämissen an und bestreite deren Wahrheitsgehalt, oder aber ich stelle das zugrundeliegende Schlussmuster infrage. Für die Sinnhaftigkeit des Schlussmusters entscheidend ist, ob die Konklusion aus den Prämissen gefolgert werden kann. Mit sehr viel Wohlwollen ließen sich also zu jedem Argument solche Prämissen konstruieren, die die Schlussform insgesamt zu einer sinnvollen machten. Dem Argument "Wenn A, dann B. A also C" könnte dann ein korrektes Schlussmuster zugrunde liegen, wenn davonausgegangen wäre, dass die Prämisse "Wenn B, dann C" eine so offensichtliche Wahrheit ist, dass sie nicht genannt werden braucht. Ein gutes Argument braucht die Konstruktion der hypothetischen Prämissen nicht, sondern macht die notwendigen Prämissen von vornehrein explizit. Kommen wir zurück auf das "scheinbar" in unserer Definition. Auch (IV) ist ein Argument. Die Konklusion lässt sich aber nicht wirklich - also nur scheinbar - a_us den Prämissen folgern, somit ist es nicht gut. Ihm liegt ein nicht sinnvolles Schlussmuster zugrunde. Kommen wir nun aber zu dem entscheidenden Punkt, der die ganze Sache unheimlich kompliziert macht: Während ein deduktiver Schluss entweder korrekt ist oder nicht, ist die Beurteilung eines induktiven Schlusses eine beträchtlich subjektive Sache. So ist auch der Schluss, dass die Sonne morgen aufgehen wird, induktiv. Die Tatsache, dass die Sonne bisher jeden Tag aufgegangen ist und gleichzeit morgen ein Tag ist, reicht nicht, um ein morgiges Aufgehen der Sonne als logisch zwingend zu rechtfertigen. (Dass die Sonne heute Nacht von Außerirdischen zerstört wird, ist zwar abwegig und unwahrscheinlich, aber nicht unlogisch.) Es scheint dennoch sinnvoll, daran zu glauben, dass die Sonne morgen aufgeht. Diese Grenze, wann ein induktiver Schluss als sinnvoll und wann als nicht sinnvoll anzusehen ist, verläuft- insbesondere in der Diskussion - subjektiv. Stellen wir uns einen sehr verhaltensauffälligen 8. Klässer vor. Eine Exkursion steht an und die Lehrkräfte beraten: "Da Felix (der Name ist rein zufällig gewählt) auf jeder schulischen Veranstaltung negativ aufgefallen ist, halte ich es für richtig, ihn bei dieser auszuschließen, da er wieder negativ auffallen wird" Hier liegt es im Auge der Betrachtenden, das Argument zu akzeptieren oder nicht. Und wo wir schon beim Subjektiven sind: Auch die Beurteilung des Wahrheitsgehalts einer Prämisse ist subjektiv. Gucken wir uns Argument (1) an. Implizite Prämisse war: Du solltest nichts Ungesundes tun. Dieser Satz kann nur subjektiv Gültigkeit besitzen. Es handelt sich weder um einen Fakt noch um ein allgemeingültiges Gesetz. Und die wenigsten Argumente gehen in ihren Prämissen lediglich von Fakten und allgemeingültigen Gesetzen aus. (Auch, wenn strittige Prämissen gerne als solche verpackt werden) Aussagen über Begriffe wie "Gerechtigkeit", "Moral" oder "Nützlichkeit" sind nicht eindeutig wahr oder falsch. Resümieren wir: Die Bewertung eines Arguments nach objektiven Kriterien führt zu subjektiven und unterschiedlichen Ergebnissen abhängig von der bewertenden Person. Man kann nur von relativ
4 guten Argumenten sprechen. Nun sind wir schon mitten in der Bestimmung des Erfolges der Argumentation. Betrachten wir, welche Funktion dem Argument zukommt. Sein Zweck ist es grundsätzlich, jemanden von einem Standpunkt ( der Konklusion) zu überzeugen. Wenn dies geschieht, war das Argument, das zu Überzeugung gebraucht wurde, für das Gegenüber gut. Stellt sich also die Frage: Ist ein Argument vielleicht doch eher dann gut, wenn es erfolgreich ist? Oder ist es dann erfolgreich, wenn es gut ist? Kommen wir zunächst zurück auf Argument (II). Ihm liegt weder ein sinnvolles Schlussmuster zugrunde, noch enthält es ausschließlich wahre Prämissen. (Ja, wir haben letzeres vorhin angenommen, aber mal ehrlich: Selena Gomez ist jung und wohnt in L.A. oder so; als ob sie da jeden Abend schlafen geht) Stell dir jetzt vor, du hättest eine kleine Schwester, die voll auf Selena Gomez abfährt. Und weil sie abends einfach nicht ins Bett will, kommst du ihr mit Argument (II). Und siehe da: Überzeugt. Du warst mit deinem Argument (na ja, eigentlich meinem) erfolgreich, anscheinend war es für dein Gegenüber - deine kleine Schwester gut. Und das, obwohl es keinem der beiden Kriterien entspricht. (Die unübersehbar falsche Prämisse "Du solltest das tun, was Selena Gomez tut" wäre eventuell von deiner Schwester hinterfragt worden und hätte letzlich zu einem Misserfolg deines Arguments führen können, weil deine Schwester hätte bemerken können, dass du sie nur per Trick von etwas überzeugen willst) Auch hier tut sich gerade der Abgrund des Subjektiven und Relativen auf. Denn selbst wenn ich objektive Kriterien genannt habe, nach denen sich etwaige Beweisführungen bewerten lassen, ist die Annahme, dass ein Argument beide erfüllen muss, um gut zu sein auch - ja, verdammt noch einmal subjektiv. Schließlich ist mein Zugang zur Argumentation höchst theoretisch. Die Aussage "Dasjenige Argument ist gut, das seinen Zweck erfüllt" ist zwar strittig, absolut falsch definitiv aber nicht. Falls aber nun die Argumente gut wären, die erfolgreich sind, dann hätte sich die Ausgangsfrage direkt erübrigt. Dass ein gutes Argument erfolgreich wäre, ergäbe sich unmittelbar aus der Bestimmung des "guten Arguments". Der absolute Relativismus - gerade und vor allem in Bezug auf den Diskurs - ist aber gefährlich. (Man könnte an dieser Stelle bestimmt weit ausholen über den Ausdruck des "Postfaktischen Zeitalters", leider hat der Terminus etwas höchst Rückwärtsgewandtes und überhebliches an sich.) Ziehen wir den Populismus samt seinen derzeitigen Protagonisten heran. Die populistische Argumentation wird dominiert von Argumenten, die auf eklatante Weise unserer vorigen Definition widersprechen. Unmögliche Prämissen, absurde Schlussmuster... und dennoch scheint sie erfolgreich zu sein. Wollen wir ersthaft von einem solchen Argument behaupten, dass es gut ist? : (V) "Wenn es heute erlaubt wird, eine Person gleichen Geschlechts zu heiraten, dann wir es morgen erlaubt sein, ein Kind - und übermorgen einen Hund zu heiraten." Ich hoffe an dieser Stelle ergibt sich eine nähere Erläuterung durch das Beispiel. Ein neutralerer und allgemeinerer Zugang wie der so eben dargestellte ist angebracht, geradezu notwendig. So ist er ja dennoch nicht bedingungslos normativ; bietet er ja dennoch keine echte Kompetivität. Das fundamental subjektivistische Element bleibt. Und somit müsste die Frage: "Sind gute Argumente erfolgreich?" indessen immer noch mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. Schließlich gilt ja das Argument als gut, dessen Gegebenheiten (Schlussform, Wahrheitsgehalt) die Zuhörerschaft akzeptiert. So viel Verstand, demzufolge auch das Argument samt Konklusion zu akzeptieren, darf man wohl von seiner Zuhörerschaft erwarten. Oder? Und hiermit sind wir an der Stelle angekommen, an der die Praxis alle graue Theorie über den Haufen wirft. Egal, wo Argumente benutzt und gebraucht werden, in den allermeisten Fällen spielen Logik und erst Recht Wahrheitsbemühungen keinerlei Rolle. Die meisten Entscheidungen (und dabei geht es dem/der Argumentierenden nun einmal um eine (Um)Entscheidung der anderen Seite) werden vorschnell und unüberlegt getroffen. Auf allen Seiten. Eingeschlossen sind Entscheidungen für bzw. gegen die Wahrheit der Prämissen. Stell dir vor: Dein Gegenüber widerspricht deiner These. Im Gespräch lässt du einzelne Prämissen und - falls notwendig - die Prämissen dieser Prämissen zugeben. Nehmen wir also an, alle für deinen Schluss gebrauchten Prämissen wurden vom Gegenüber zugegeben. Du zeigst nun, wie sich die Wahrheit der Konklusion zwingend aus den
5 Prämissen ergibt. Es ist nicht unwahrscheinlich (und ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen), dass die Wahrheit der Konklusion dennoch bestritten wird. (Und das ist meistens dann der Fall, wenn die Konklusion der Überzeugung des/der Anderen diametral entgegen steht) Mustergültig lässt sich hier der Streit anführen, den ich als Vegetarier mehr oder weniger ständig mit Fleischessern führe(n muss): Du solltest kein Fleisch aus der Massenindustrie essen. Dem widerspricht der Fleischesser natürlich. Im Gespräch gibt er dann zu, dass die Verhältnisse dort nicht den Bedürfnissen der Tiere entsprechen und diese extrem leiden müssen. Er gibt zu, dass kein leidensfähiges Wesen leiden sollen müsste. Außerdem gibt er zu, dass jede/r Einzelne Verantwortung zu übernehmen habe für die Konsequenzen seiner/ihrer Handlungen; letzlich auch, dass die Konsequenz der Industrie aus dem erfolgreichen Verkauf ihres Fleisches ist, weiterhin Tieren Leid zuzufügen um weiterhin erfolreich Fleisch verkaufen zu können. Jedoch: Der Fleischesser bestreitet die Konklusion, er solle kein Fleisch der Massenindustrie kaufen, weiterhin. Er erklärt (emotional aufgebracht, evtl. sogar wütend), wieso manche Prämissen jetzt plötzlich doch nur eingeschränkt gelten sollten o.ä.(der Streit muss leider sehr verkürzt dargestellt werden. Es geht hier nur um Veranschaulichung, nicht um ein moralisches Urteil - ich gerate nur dann in den Streit, wenn Leute offensiv gegen meinen Vegetarismus zu argumentieren versuchen.) Was indiziert das? Die Überzeugung geht der Logik vorraus. Das Ganze funktioniert auch andersherum: Du wiedersprichst der These (Konklusion) deines Gegenübers. Du zeigst, welche unmöglichen oder abzulehnenden Konsequenzen sich aus ihrer Wahrheit samt der ihrer Prämissen ergeben würden; du führst seine Argumentation ad absurdum. Selbst wenn du dabei absolut deduktiv vorgehst und dein Gegenüber die (hypotetische) Konsequenz ebenso ablehnt, kann es passieren, dass es die Wahrheit deiner Konsequenz bestreitet. (Auch hier ließe sich der Vegetarismusstreit exemplarisch einsetzen) Oder auf andere Weise versucht, seinen Beweis samt Konklusion zu retten. Wer schon gefestigt ist in seiner Meinung, wird schwerlich von seiner Überzeugung ablassen. Die Überzeugung geht der Logik vorraus. Beispielhaft dafür steht der öffentliche Diskurs. Durch ein höchst heterogenes Spektrum der Subjekte lässt sich - möchte man konstruktiv an ihm teilnehmen - von vorneherein keine einfache Klassifizierung des guten Arguments anhand des Wahrheitsgehalts seiner Prämissen vornehmen. Was einige für wahr halten, halten andere für falsch. Auch der Populist kann ein bedingt gutes Argument bringen. Auch bei einem "guten" populistischen Argument ist die exakte Analyse die einzig zweckbringende Waffe, die uns zur Verfügung steht. Es gilt, die einzelnen Grundsätze offen darzulegen. Erst so kann ermittelt werden, an welcher Stelle Uneinigkeit besteht. Um diese Stelle - und nicht irgendeine aus ihr folgende Konsequenz - muss gestritten werden. (Das kommt natürlich auch darauf an, wo und worum diskutiert wird) Stattdessen ist es keine Seltenheit, dass das Populistische vor vorneherein aus Prinzip abgelehnt wird. Die Argumentation sei schlecht und falsch und populistisch. Solches Vorgehen ist nicht weniger ideologisch bzw. dogmatisch als das der Populisten selbst. Es kann nämlich passieren, dass selbst die populitische Argumentation auf mehr oder weniger rationale Gründe aufbaut. In solch einem Fall kann man konstruktiv um verschiedene Lösungen des Ausgangsproblems streiten ohne sich auf die Grundsätze versteiffen zu müssen. Es gibt nämlich zwei Arten der Diskussion. Die, die eine Konsens- und die die eine Kompromissfindung zur Folge haben (Erste hat natürlich quasi nie eine Konsensfindung zur Folge, wir erinnern uns: Überzeugungen und so). Bei erster ist die Methode der gründlichen Analyse der Prämisse samt folgender Grundsatzdiskussion anzuwenden. Trotzdem ist im Vorab zu sagen, dass eine Konsensfindung unmöglich ist und die wenigstens Menschen - mich eingeschlossen - ihre Grundsätze so mir nichts dir nichts wegen eines guten Arguments aufgeben. Aber oftmals sind es eben einzelne Grundsätze, aus denen eine Haltung zu einem spezifischen Thema abgeleitet werden. In der Kompromissfindung gilt es, die eigenen Grundsätze zurückzustellen (nicht aufzugeben). Jetzt mal ehrlich: Gute Argumente existieren in meiner Form nur in der Theorie, in der Praxis bestimmt Charisma, Eloquenz und Überzeugungskraft den Erfolg eines Arguments. Prinzipien der Subjekte bestimmen ihre relative Qualität. Alles wird bestimmt von Faktoren, die außerhalb des Arguments liegen, so dass dieser ganze Essay eigentlich sinnlos ist.
Formale Logik. 1. Sitzung. Allgemeines vorab. Allgemeines vorab. Terminplan
 Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Erinnerung 1. Erinnerung 2
 Erinnerung 1 Ein Argument ist eine Folge von Aussagesätzen, mit der der Anspruch verbunden ist, dass ein Teil dieser Sätze (die Prämissen) einen Satz der Folge (die Konklusion) in dem Sinne stützen, dass
Erinnerung 1 Ein Argument ist eine Folge von Aussagesätzen, mit der der Anspruch verbunden ist, dass ein Teil dieser Sätze (die Prämissen) einen Satz der Folge (die Konklusion) in dem Sinne stützen, dass
Der metaethische Relativismus
 Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Beweistechniken 1.1 Prädikatenlogik..................................... 1. Direkter Beweis.................................... 3 1.3 Indirekter Beweis....................................
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Beweistechniken 1.1 Prädikatenlogik..................................... 1. Direkter Beweis.................................... 3 1.3 Indirekter Beweis....................................
Logik und Missbrauch der Logik in der Alltagssprache
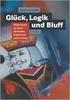 Logik und Missbrauch der Logik in der Alltagssprache Wie gewinnt man in Diskussionen? Carmen Kölbl SS 2004 Seminar: " Logik auf Abwegen: Irrglaube, Lüge, Täuschung" Übersicht logische Grundlagen Inferenzregeln
Logik und Missbrauch der Logik in der Alltagssprache Wie gewinnt man in Diskussionen? Carmen Kölbl SS 2004 Seminar: " Logik auf Abwegen: Irrglaube, Lüge, Täuschung" Übersicht logische Grundlagen Inferenzregeln
1. Grundzüge der Diskursethik
 Die Diskursethik 1. Grundzüge der Diskursethik Interpretiere das oben gezeigte Bild: Moralische Kontroversen können letztlich nicht mit Gründen entschieden werden, weil die Wertprämissen, aus denen wir
Die Diskursethik 1. Grundzüge der Diskursethik Interpretiere das oben gezeigte Bild: Moralische Kontroversen können letztlich nicht mit Gründen entschieden werden, weil die Wertprämissen, aus denen wir
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
Analyse ethischer Texte
 WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG ANGEWANDTE ETHIK SOMMERSEMESTER 2005 Prof. Dr. Kurt Bayertz Analyse ethischer Texte 23. Juli 2005 I. Was sind Argumente? Zunächst eine allgemeine Charakterisierung von Argumenten
WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG ANGEWANDTE ETHIK SOMMERSEMESTER 2005 Prof. Dr. Kurt Bayertz Analyse ethischer Texte 23. Juli 2005 I. Was sind Argumente? Zunächst eine allgemeine Charakterisierung von Argumenten
Die Anfänge der Logik
 Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können. Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer:
 Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer: 503924 Email: yalu@gmx.com 06. Dezember 2006 Einleitung Die Frage, die ich in diesem Essay
Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer: 503924 Email: yalu@gmx.com 06. Dezember 2006 Einleitung Die Frage, die ich in diesem Essay
Q.E.D. Algorithmen und Datenstrukturen Wintersemester 2018/2019 Übung#2, Christian Rieck, Arne Schmidt
 Institute of Operating Systems and Computer Networks Algorithms Group Q.E.D. Algorithmen und Datenstrukturen Wintersemester 2018/2019 Übung#2, 01.11.2018 Christian Rieck, Arne Schmidt Einführendes Beispiel
Institute of Operating Systems and Computer Networks Algorithms Group Q.E.D. Algorithmen und Datenstrukturen Wintersemester 2018/2019 Übung#2, 01.11.2018 Christian Rieck, Arne Schmidt Einführendes Beispiel
Hinweise zur Logik. Ergänzung zu den Übungen Mathematische Grundlagen der Ökonomie am 22. Oktober 2009
 Hinweise zur Logik Ergänzung zu den Übungen Mathematische Grundlagen der Ökonomie am 22. Oktober 2009 Im folgenden soll an einige Grundsätze logisch korrekter Argumentation erinnert werden. Ihre Bedeutung
Hinweise zur Logik Ergänzung zu den Übungen Mathematische Grundlagen der Ökonomie am 22. Oktober 2009 Im folgenden soll an einige Grundsätze logisch korrekter Argumentation erinnert werden. Ihre Bedeutung
1. Musterlösung zu Mathematik für Informatiker I, WS 2003/04
 1 Musterlösung zu Mathematik für Informatiker I, WS 2003/04 MICHAEL NÜSKEN, KATHRIN TOFALL & SUSANNE URBAN Aufgabe 11 (Aussagenlogik und natürliche Sprache) (9 Punkte) (1) Prüfe, ob folgenden Aussagen
1 Musterlösung zu Mathematik für Informatiker I, WS 2003/04 MICHAEL NÜSKEN, KATHRIN TOFALL & SUSANNE URBAN Aufgabe 11 (Aussagenlogik und natürliche Sprache) (9 Punkte) (1) Prüfe, ob folgenden Aussagen
DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION
 DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
Grundformel, Naturgesetzformel und Menschheitsformel des kategorischen Imperativs nur verschiedene Formulierungen desselben Prinzips?
 Grundformel, Naturgesetzformel und Menschheitsformel des kategorischen Imperativs nur verschiedene Formulierungen desselben Prinzips? Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 1. August 2007 1 Was werde
Grundformel, Naturgesetzformel und Menschheitsformel des kategorischen Imperativs nur verschiedene Formulierungen desselben Prinzips? Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 1. August 2007 1 Was werde
Argumentationstheorie 9. Sitzung
 Terminplan Argumentationstheorie 9. Sitzung Oktober 12.10.04 19.10.04 November 02.11.04 09.11.04 Dezember 07.12.04 14.12.04 Januar 04.01.05 11.01.05 ebruar 01.02.05 Test 3 Prof. Dr. Ansgar Beckermann intersemester
Terminplan Argumentationstheorie 9. Sitzung Oktober 12.10.04 19.10.04 November 02.11.04 09.11.04 Dezember 07.12.04 14.12.04 Januar 04.01.05 11.01.05 ebruar 01.02.05 Test 3 Prof. Dr. Ansgar Beckermann intersemester
Ethischer Relativismus und die moralische Beurteilung der Handlungen von Menschen in anderen Kulturen. Jörg Schroth
 Philosophie und/als Wissenschaft Proceedings der GAP.5, Bielefeld 22. 26.09.2003 Ethischer Relativismus und die moralische Beurteilung der Handlungen von Menschen in anderen Kulturen Jörg Schroth Für den
Philosophie und/als Wissenschaft Proceedings der GAP.5, Bielefeld 22. 26.09.2003 Ethischer Relativismus und die moralische Beurteilung der Handlungen von Menschen in anderen Kulturen Jörg Schroth Für den
Argumentieren. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2044X_DE Deutsch
 Argumentieren BAUSTEINE NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2044X_DE Deutsch Lernziele Lerne eine komplexe Meinung auszudrücken und diese auch zu argumentieren Erweitere deinen Wortschatz mit neuen Ausdrücken
Argumentieren BAUSTEINE NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2044X_DE Deutsch Lernziele Lerne eine komplexe Meinung auszudrücken und diese auch zu argumentieren Erweitere deinen Wortschatz mit neuen Ausdrücken
Ethisch-moralisches Argumentieren Station 3: Sein-Sollen-Fehlschluss Seite 1 von 5. Grundlagen:
 Ethisch-moralisches Argumentieren Station 3: Sein-Sollen-Fehlschluss Seite 1 von 5 Grundlagen: Die Grundlage unseres Argumentierens bildet der sog. Syllogismus, der aus Prämissen (Voraussetzungen) und
Ethisch-moralisches Argumentieren Station 3: Sein-Sollen-Fehlschluss Seite 1 von 5 Grundlagen: Die Grundlage unseres Argumentierens bildet der sog. Syllogismus, der aus Prämissen (Voraussetzungen) und
Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an
 Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar Sagen Sie dann Ihre Meinung Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein Reagieren Sie
Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar Sagen Sie dann Ihre Meinung Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein Reagieren Sie
1 Argument und Logik
 Seminar: 1/5 1 Argument und Logik Aussagesatz (1): Ein Aussagesatz ist ein Satz im Indikativ, der entweder wahr oder falsch ist. Problem der Indexikalität: Sätze im Indikaitv, die indexikalische Ausdrücke
Seminar: 1/5 1 Argument und Logik Aussagesatz (1): Ein Aussagesatz ist ein Satz im Indikativ, der entweder wahr oder falsch ist. Problem der Indexikalität: Sätze im Indikaitv, die indexikalische Ausdrücke
Argumentationstheorie 4. Sitzung
 Noch ein Beispiel Argumentationstheorie 4. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2004/5 empirische Hypothese (P1) echte Noch ein Beispiel Noch ein Beispiel empirische Hypothese (P1) Ein metaphysischer
Noch ein Beispiel Argumentationstheorie 4. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2004/5 empirische Hypothese (P1) echte Noch ein Beispiel Noch ein Beispiel empirische Hypothese (P1) Ein metaphysischer
Frege und sein Reich der Gedanken
 Frege und sein Reich der Gedanken Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 10. Februar 2008 1 Was werde ich tun? In seinem Text Der Gedanke - Eine logische Untersuchung argumentiert Gottlob Frege für
Frege und sein Reich der Gedanken Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 10. Februar 2008 1 Was werde ich tun? In seinem Text Der Gedanke - Eine logische Untersuchung argumentiert Gottlob Frege für
Dallmann, H. & Elster, K.H. (1991). Einführung in die höhere Mathematik, Band I. Jena: Fischer. (Kapitel 1, pp )
 Logik Literatur: Dallmann, H. & Elster, K.H. (1991). Einführung in die höhere Mathematik, Band I. Jena: Fischer. (Kapitel 1, pp. 17-30) Quine, W.V.O. (1964 / 1995). Grundzüge der Logik. Frankfurt a.m.:
Logik Literatur: Dallmann, H. & Elster, K.H. (1991). Einführung in die höhere Mathematik, Band I. Jena: Fischer. (Kapitel 1, pp. 17-30) Quine, W.V.O. (1964 / 1995). Grundzüge der Logik. Frankfurt a.m.:
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Frage 8.3. Wozu dienen Beweise im Rahmen einer mathematischen (Lehramts-)Ausbildung?
 8 Grundsätzliches zu Beweisen Frage 8.3. Wozu dienen Beweise im Rahmen einer mathematischen (Lehramts-)Ausbildung? ˆ Mathematik besteht nicht (nur) aus dem Anwenden auswendig gelernter Schemata. Stattdessen
8 Grundsätzliches zu Beweisen Frage 8.3. Wozu dienen Beweise im Rahmen einer mathematischen (Lehramts-)Ausbildung? ˆ Mathematik besteht nicht (nur) aus dem Anwenden auswendig gelernter Schemata. Stattdessen
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Einführung in die Argumentationslehre
 Joachim Stiller Einführung in die Argumentationslehre Präsentation Alle Rechte vorbehalten 3.1 Argumentationslehre: Übersicht - Fehlargumente - Persönlicher Angriff, Argumentum ad personam - Totschlagargument
Joachim Stiller Einführung in die Argumentationslehre Präsentation Alle Rechte vorbehalten 3.1 Argumentationslehre: Übersicht - Fehlargumente - Persönlicher Angriff, Argumentum ad personam - Totschlagargument
Prof. Dr. Jürgen Neyer. Einführung in die Politikwissenschaft. - Was ist Wissenschaft? Di
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Erkenntnis: Was kann ich wissen?
 Erkenntnis: Was kann ich wissen? Philosophie Die Grundfragen Immanuel Kants Hochschule Aalen, 26.03.18 Karl Mertens Immanuel Kant, Logik (AA IX, 23-25, bes. 25): "Philosophie ist also das System der philosophischen
Erkenntnis: Was kann ich wissen? Philosophie Die Grundfragen Immanuel Kants Hochschule Aalen, 26.03.18 Karl Mertens Immanuel Kant, Logik (AA IX, 23-25, bes. 25): "Philosophie ist also das System der philosophischen
zu überprüfen und zu präzisieren. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
 1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einführung in die moderne Logik
 Sitzung 1 1 Einführung in die moderne Logik Einführungskurs Mainz Wintersemester 2011/12 Ralf Busse Sitzung 1 1.1 Beginn: Was heißt Einführung in die moderne Logik? Titel der Veranstaltung: Einführung
Sitzung 1 1 Einführung in die moderne Logik Einführungskurs Mainz Wintersemester 2011/12 Ralf Busse Sitzung 1 1.1 Beginn: Was heißt Einführung in die moderne Logik? Titel der Veranstaltung: Einführung
Vorlesung. Beweise und Logisches Schließen
 Vorlesung Beweise und Logisches Schließen Der folgende Abschnitt dient nur zur Wiederholung des Stoffes der ersten Vorlesung und sollten nur genannt bzw. Teilweise schon vor der Vorlesung angeschrieben
Vorlesung Beweise und Logisches Schließen Der folgende Abschnitt dient nur zur Wiederholung des Stoffes der ersten Vorlesung und sollten nur genannt bzw. Teilweise schon vor der Vorlesung angeschrieben
Vorkurs Mathematik 2016
 Vorkurs Mathematik 2016 WWU Münster, Fachbereich Mathematik und Informatik PD Dr. K. Halupczok Skript VK1 vom 8.9.2016 VK1: Logik Die Kunst des Schlussfolgerns Denition 1: Eine Aussage ist ein sprachliches
Vorkurs Mathematik 2016 WWU Münster, Fachbereich Mathematik und Informatik PD Dr. K. Halupczok Skript VK1 vom 8.9.2016 VK1: Logik Die Kunst des Schlussfolgerns Denition 1: Eine Aussage ist ein sprachliches
Über Wittgensteins Logikbegriff in der Logischphilosophischen
 HU Berlin SS 06 Seminar Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus von Uwe Scheffler und Ulrich Schlösser Essay von Johannes Stein Über Wittgensteins Logikbegriff in der Logischphilosophischen Abhandlung
HU Berlin SS 06 Seminar Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus von Uwe Scheffler und Ulrich Schlösser Essay von Johannes Stein Über Wittgensteins Logikbegriff in der Logischphilosophischen Abhandlung
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Ende und Schluß. Dr. Uwe Scheffler. Januar [Technische Universität Dresden]
![Ende und Schluß. Dr. Uwe Scheffler. Januar [Technische Universität Dresden] Ende und Schluß. Dr. Uwe Scheffler. Januar [Technische Universität Dresden]](/thumbs/94/122345206.jpg) Ende und Schluß Dr. Uwe Scheffler [Technische Universität Dresden] Januar 2011 Bestimmte Kennzeichnungen 1. Dasjenige, über welches hinaus nichts größeres gedacht werden kann, ist Gott. 2. Die erste Ursache
Ende und Schluß Dr. Uwe Scheffler [Technische Universität Dresden] Januar 2011 Bestimmte Kennzeichnungen 1. Dasjenige, über welches hinaus nichts größeres gedacht werden kann, ist Gott. 2. Die erste Ursache
Zweite und dritte Sitzung
 Zweite und dritte Sitzung Mengenlehre und Prinzipien logischer Analyse Menge Eine Menge M ist eine Zusammenfassung von wohlbestimmten und wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung und unseres Denkens
Zweite und dritte Sitzung Mengenlehre und Prinzipien logischer Analyse Menge Eine Menge M ist eine Zusammenfassung von wohlbestimmten und wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung und unseres Denkens
Handout zu Beweistechniken
 Handout zu Beweistechniken erstellt vom Lernzentrum Informatik auf Basis von [Kre13],[Bün] Inhaltsverzeichnis 1 Was ist ein Beweis? 2 2 Was ist Vorraussetzung, was ist Behauptung? 2 3 Beweisarten 3 3.1
Handout zu Beweistechniken erstellt vom Lernzentrum Informatik auf Basis von [Kre13],[Bün] Inhaltsverzeichnis 1 Was ist ein Beweis? 2 2 Was ist Vorraussetzung, was ist Behauptung? 2 3 Beweisarten 3 3.1
typische Beweismuster Allgemeine Hilfe Beweistechniken WS2014/ Januar 2015 R. Düffel Beweistechniken
 Beweistechniken Ronja Düffel WS2014/15 13. Januar 2015 Warum ist Beweisen so schwierig? unsere natürliche Sprache ist oft mehrdeutig wir sind in unserem Alltag von logischen Fehlschlüssen umgeben Logik
Beweistechniken Ronja Düffel WS2014/15 13. Januar 2015 Warum ist Beweisen so schwierig? unsere natürliche Sprache ist oft mehrdeutig wir sind in unserem Alltag von logischen Fehlschlüssen umgeben Logik
Ihr Handwerkszeug: Argumente
 Wie Sie von diesem Buch profitieren 19 Ihr Handwerkszeug: Argumente Wer weiß, wie Argumente funktionieren und warum, kann sie nicht nur leichter durchschauen und womöglich entkräften, er versetzt sich
Wie Sie von diesem Buch profitieren 19 Ihr Handwerkszeug: Argumente Wer weiß, wie Argumente funktionieren und warum, kann sie nicht nur leichter durchschauen und womöglich entkräften, er versetzt sich
Vorlesung. Logik und Beweise
 Vorlesung Logik und Beweise Der folgende Abschnitt dient nur zur Wiederholung des Stoffes der ersten Vorlesung und sollte nur genannt bzw. teilweise schon vor der Vorlesung angeschrieben werden. Wiederholung
Vorlesung Logik und Beweise Der folgende Abschnitt dient nur zur Wiederholung des Stoffes der ersten Vorlesung und sollte nur genannt bzw. teilweise schon vor der Vorlesung angeschrieben werden. Wiederholung
Paradoxien der Replikation
 Joachim Stiller Paradoxien der Replikation Alle Rechte vorbehalten Paradoxien Die Paradoxien (Wiki) Hier einmal Auszüge aus dem Wiki-Artikel zum Begriff Paradoxon Ein Paradox(on) (auch Paradoxie, Plural
Joachim Stiller Paradoxien der Replikation Alle Rechte vorbehalten Paradoxien Die Paradoxien (Wiki) Hier einmal Auszüge aus dem Wiki-Artikel zum Begriff Paradoxon Ein Paradox(on) (auch Paradoxie, Plural
Aufbau einer Rede. 3. Zweite Rede eröffnende Regierung - (gegebenenfalls Erläuterung zum Antrag) - Rebuttal - Weitere Pro-Argumente erklären
 Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
1 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnittäus ders.: Kritik
 In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
PHILOSOPHISCHER ANARCHISMUS:
 PHILOSOPHISCHER ANARCHISMUS: R.P. WOLFF, EINE VERTEIDIGUNG DES ANARCHISMUS AUTONOMIE 24-34 WOLFF 24-25B: VERANTWORTUNG & DAS ERLANGEN VON WISSEN Grundannahme der Moralphilosophie Handeln Verantwortung
PHILOSOPHISCHER ANARCHISMUS: R.P. WOLFF, EINE VERTEIDIGUNG DES ANARCHISMUS AUTONOMIE 24-34 WOLFF 24-25B: VERANTWORTUNG & DAS ERLANGEN VON WISSEN Grundannahme der Moralphilosophie Handeln Verantwortung
Das Pumping Lemma der regulären Sprachen
 Das Pumping Lemma der regulären Sprachen Frank Heitmann heitmann@informatik.uni-hamburg.de 1 Das Pumping Lemma Das Pumping Lemma der regulären Sprachen macht eine Aussage der Art wenn eine Sprache L regulär
Das Pumping Lemma der regulären Sprachen Frank Heitmann heitmann@informatik.uni-hamburg.de 1 Das Pumping Lemma Das Pumping Lemma der regulären Sprachen macht eine Aussage der Art wenn eine Sprache L regulär
Einführung in die formale Logik. Prof. Dr. Andreas Hüttemann
 Einführung in die formale Logik Prof. Dr. Andreas Hüttemann Textgrundlage: Paul Hoyningen-Huene: Formale Logik, Stuttgart 1998 1. Einführung 1.1 Logische Folgerung und logische Form 1.1.1 Logische Folgerung
Einführung in die formale Logik Prof. Dr. Andreas Hüttemann Textgrundlage: Paul Hoyningen-Huene: Formale Logik, Stuttgart 1998 1. Einführung 1.1 Logische Folgerung und logische Form 1.1.1 Logische Folgerung
Alle drei Grundelemente kommen in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Folgende Formen kann man vor allem unterscheiden: Klassifikation von THESEN
 G R U N D B E G R I F F E der A R G U M E N T A T I O N Inhalt: Elemente der Argumentation Strategien der Meinungsbildung Strategien der Auseinandersetzung Aufbauformen der Argumentation / Erörterung 1.
G R U N D B E G R I F F E der A R G U M E N T A T I O N Inhalt: Elemente der Argumentation Strategien der Meinungsbildung Strategien der Auseinandersetzung Aufbauformen der Argumentation / Erörterung 1.
Diskutieren und Argumentieren in Verhandlungen
 Diskutieren und Argumentieren in Verhandlungen Der Beginn Ich habe die Ehre, (die Verhandlung) für eröffnet zu erklären. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Lassen Sie uns mit (der Tagung/Besprechung)
Diskutieren und Argumentieren in Verhandlungen Der Beginn Ich habe die Ehre, (die Verhandlung) für eröffnet zu erklären. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Lassen Sie uns mit (der Tagung/Besprechung)
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Konflikte im Unternehmen kreativ nutzen
 Konflikte im Unternehmen kreativ nutzen Konflikte gehören zum beruflichen und privaten Alltag. Sie belasten mal mehr, mal weniger - und kosten oft viel Zeit und Nerven. Gerade im Berufsleben stören Sie
Konflikte im Unternehmen kreativ nutzen Konflikte gehören zum beruflichen und privaten Alltag. Sie belasten mal mehr, mal weniger - und kosten oft viel Zeit und Nerven. Gerade im Berufsleben stören Sie
HERZLICHEN DANK SELBST- COACHING
 HERZLICHEN DANK SELBST- COACHING Wie du mit 4 simplen Fragen dein Leben positiv verändern kannst... Mit nur 4 essentiellen Fragen kannst du dein Leben positiv verändern und deine Probleme an den Wurzeln
HERZLICHEN DANK SELBST- COACHING Wie du mit 4 simplen Fragen dein Leben positiv verändern kannst... Mit nur 4 essentiellen Fragen kannst du dein Leben positiv verändern und deine Probleme an den Wurzeln
Wenn alle Bären pelzig sind und Ned ein Bär ist, dann ist Ned pelzig.
 2.2 Logische Gesetze 19 auch, was für Sätze logisch wahr sein sollen. Technisch gesehen besteht zwar zwischen einem Schluss und einem Satz selbst dann ein deutlicher Unterschied, wenn der Satz Wenn...dann
2.2 Logische Gesetze 19 auch, was für Sätze logisch wahr sein sollen. Technisch gesehen besteht zwar zwischen einem Schluss und einem Satz selbst dann ein deutlicher Unterschied, wenn der Satz Wenn...dann
Es ist eigentlich so einfach, dass es unmöglich ist. Ein Abend mit Daniel, Januar 2012
 Es ist eigentlich so einfach, dass es unmöglich ist. Ein Abend mit Daniel, Januar 2012 Daniel, ich hab eine ganz spannende Überlegung gehabt, die ich aber nicht ganz zu Ende überlegt habe weil Vielleicht
Es ist eigentlich so einfach, dass es unmöglich ist. Ein Abend mit Daniel, Januar 2012 Daniel, ich hab eine ganz spannende Überlegung gehabt, die ich aber nicht ganz zu Ende überlegt habe weil Vielleicht
Einführung in die Naturschutzethik
 Einführung in die Naturschutzethik Fortbildungsreihe Klugheit Glück Gerechtigkeit Vilm, 8.-11.10.2012 Uta Eser Koordinationsstelle Wirtschaft und Umwelt, HfWU U. Eser, HfWU 1 Übersicht Teil I: Grundlagen
Einführung in die Naturschutzethik Fortbildungsreihe Klugheit Glück Gerechtigkeit Vilm, 8.-11.10.2012 Uta Eser Koordinationsstelle Wirtschaft und Umwelt, HfWU U. Eser, HfWU 1 Übersicht Teil I: Grundlagen
Analytische Erkenntnistheorie & Experimentelle Philosophie
 Analytische Erkenntnistheorie & Experimentelle Philosophie Klassische Analyse von Wissen Die Analyse heisst klassisch, weil sie auf Platon zurück geht (Theaitetos) Sokrates will wissen, was das Wissen
Analytische Erkenntnistheorie & Experimentelle Philosophie Klassische Analyse von Wissen Die Analyse heisst klassisch, weil sie auf Platon zurück geht (Theaitetos) Sokrates will wissen, was das Wissen
Essaypreis des Zentrums für Wissenschaftstheorie, Münster im Wintersemester 2010/ Platz. Helen Wagner
 Essaypreis des Zentrums für Wissenschaftstheorie, Münster im Wintersemester 2010/11 3. Platz Helen Wagner Ein Vergleich zwischen Pragmatismus und Rationalismus anhand der Pragmatismustheorie von William
Essaypreis des Zentrums für Wissenschaftstheorie, Münster im Wintersemester 2010/11 3. Platz Helen Wagner Ein Vergleich zwischen Pragmatismus und Rationalismus anhand der Pragmatismustheorie von William
e) Rede planen: Plant eine kleine Überzeugungsrede: d) Erläuterungen finden: Findet zu jedem Argument
 AB4.1 Gruppenauftrag In einer 7. Klasse steht eine Klassenfahrt in ein Schullandheim an. Die Klasse diskutiert, ob die Schüler ihre Playstation Portable mitnehmen dürfen sollen. Am Ende sollen die Klasse,
AB4.1 Gruppenauftrag In einer 7. Klasse steht eine Klassenfahrt in ein Schullandheim an. Die Klasse diskutiert, ob die Schüler ihre Playstation Portable mitnehmen dürfen sollen. Am Ende sollen die Klasse,
Gutes Gewissen, schlechtes Gewissen?
 Gutes Gewissen, schlechtes Gewissen? Learning Unit: Philosophy Speaking & Discussion Level B1 www.lingoda.com 1 Gutes Gewissen, schlechtes Gewissen? Leitfaden Inhalt Manchmal ist es ganz schön schwierig,
Gutes Gewissen, schlechtes Gewissen? Learning Unit: Philosophy Speaking & Discussion Level B1 www.lingoda.com 1 Gutes Gewissen, schlechtes Gewissen? Leitfaden Inhalt Manchmal ist es ganz schön schwierig,
KAPITEL 1 WARUM LIEBE?
 KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich
KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich
Musterlösung zu Blatt 11, Aufgabe 3
 Musterlösung zu Blatt 11, Aufgabe 3 I Aufgabenstellung Wir nennen eine Teilmenge A R abgeschlossen, wenn der Grenzwert einer konvergenten Folge in A stets wieder in A liegt. Beweisen Sie: a) Für eine beliebige
Musterlösung zu Blatt 11, Aufgabe 3 I Aufgabenstellung Wir nennen eine Teilmenge A R abgeschlossen, wenn der Grenzwert einer konvergenten Folge in A stets wieder in A liegt. Beweisen Sie: a) Für eine beliebige
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Redemittelsammlung 1) sich entschuldigen Es tut mir sehr/aufrichtig leid, (dass ) Entschuldigen Sie bitte, (aber ) Verzeihen Sie (mir) bitte, Ich
 Redemittelsammlung 1) sich entschuldigen Es tut mir sehr/aufrichtig leid, (dass ) Entschuldigen Sie bitte, (aber ) Verzeihen Sie (mir) bitte, Ich bitte (Sie) um Verzeihung/Entschuldigung/Verständnis. Ich
Redemittelsammlung 1) sich entschuldigen Es tut mir sehr/aufrichtig leid, (dass ) Entschuldigen Sie bitte, (aber ) Verzeihen Sie (mir) bitte, Ich bitte (Sie) um Verzeihung/Entschuldigung/Verständnis. Ich
EPISTEMISCHE LOGIK Grundlagen
 EPISTEMISCHE LOGIK Grundlagen Endliches Wissen Manuel Bremer University of Düsseldorf, Germany www.mbph.de Endliche epistemische Subjekte Wie in der Einführung erläutert behandelt die formale Erkenntnistheorie
EPISTEMISCHE LOGIK Grundlagen Endliches Wissen Manuel Bremer University of Düsseldorf, Germany www.mbph.de Endliche epistemische Subjekte Wie in der Einführung erläutert behandelt die formale Erkenntnistheorie
Text: Ausschnitt aus dem ersten Kapitel (Morality, Religion, and the Meaning of Life) des Buchs Evolution, Morality, and the Meaning of Life (1982)
 Jeffrie G. Murphy: Warum? * 1940 1966 Ph.D. mit einer Arbeit über Kants Rechtsphilosophie Lehre an der University of Minnesota, der University of Arizona, ab 1994 als Professor of Law and Philosophy an
Jeffrie G. Murphy: Warum? * 1940 1966 Ph.D. mit einer Arbeit über Kants Rechtsphilosophie Lehre an der University of Minnesota, der University of Arizona, ab 1994 als Professor of Law and Philosophy an
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Mathe <> Deutsch. Die 7 verwirrendsten Mathe-Floskeln einfach erklärt! Math-Intuition.de
 Mathe Deutsch Die 7 verwirrendsten Mathe-Floskeln einfach erklärt! Inhalt hinreichend & notwendig kanonisch wohldefiniert beliebig paarweise trivial o.b.d.a & o.e. hinreichend & notwendig Bei jeder
Mathe Deutsch Die 7 verwirrendsten Mathe-Floskeln einfach erklärt! Inhalt hinreichend & notwendig kanonisch wohldefiniert beliebig paarweise trivial o.b.d.a & o.e. hinreichend & notwendig Bei jeder
SCHAFF DIR EINE WELT, WIE SIE DIR GEFÄLLT!
 KURZANLEITUNG Norman Brenner Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen des Lesers und daraus entstehende Folgen. DIE WELT VERÄNDERN WIE GEHT DAS? In dieser Kurzanleitung
KURZANLEITUNG Norman Brenner Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen des Lesers und daraus entstehende Folgen. DIE WELT VERÄNDERN WIE GEHT DAS? In dieser Kurzanleitung
Leben mit... Lernen, behindert zu werden: persönliche Gedanken zum Ereignis Sehverlust. Florian Windisch, Deutschland
 Leben mit... Lernen, behindert zu werden: persönliche Gedanken zum Ereignis Sehverlust Florian Windisch, Deutschland Was heisst es, die Sehkraft zu verlieren? Der Verlauf, den die RP bei mir nimmt, ist
Leben mit... Lernen, behindert zu werden: persönliche Gedanken zum Ereignis Sehverlust Florian Windisch, Deutschland Was heisst es, die Sehkraft zu verlieren? Der Verlauf, den die RP bei mir nimmt, ist
Argumentationstheorie 5. Sitzung
 Zwei Arten von Schlüssen Argumentationstheorie 5. Sitzung All reasonings may be divided into two kinds, namely demonstrative reasoning, [ ] and moral (or probable) reasoning. David Hume An Enquiry Concerning
Zwei Arten von Schlüssen Argumentationstheorie 5. Sitzung All reasonings may be divided into two kinds, namely demonstrative reasoning, [ ] and moral (or probable) reasoning. David Hume An Enquiry Concerning
erst mal wünsche ich Dir und Deiner Familie ein frohes Neues Jahr.
 Denkstrukturen Hallo lieber Tan, erst mal wünsche ich Dir und Deiner Familie ein frohes Neues Jahr. Jetzt habe ich schon wieder Fragen, die einfach bei dem Studium der Texte und der praktischen Umsetzung
Denkstrukturen Hallo lieber Tan, erst mal wünsche ich Dir und Deiner Familie ein frohes Neues Jahr. Jetzt habe ich schon wieder Fragen, die einfach bei dem Studium der Texte und der praktischen Umsetzung
Kants 'guter Wille' in: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"
 Geisteswissenschaft Alina Winkelmann Kants 'guter Wille' in: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: 1. Vorwort 2. Begriffserklärung 2.1 Was ist gut? 2.2 Was ist ein
Geisteswissenschaft Alina Winkelmann Kants 'guter Wille' in: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: 1. Vorwort 2. Begriffserklärung 2.1 Was ist gut? 2.2 Was ist ein
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Textgebundene Erörterungen schreiben im Unterricht
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Textgebundene Erörterungen schreiben im Unterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Textgebundene Erörterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Textgebundene Erörterungen schreiben im Unterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Textgebundene Erörterungen
1.3 Aussagen. Beispiel: Das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik Deutschland ist höher als das der USA ist eine offenbar falsche Aussage.
 1.3 Aussagen In der Mathematik geht es um Aussagen. Eine Aussage ist ein statement, das entweder wahr oder falsch sein kann. Beides geht nicht! Äußerungen, die nicht die Eigenschaft haben, wahr oder falsch
1.3 Aussagen In der Mathematik geht es um Aussagen. Eine Aussage ist ein statement, das entweder wahr oder falsch sein kann. Beides geht nicht! Äußerungen, die nicht die Eigenschaft haben, wahr oder falsch
Deutsche Version der Cambridge Behaviour Scale
 Deutsche Version der Cambridge Behaviour Scale von Simon Baron-Cohen und Sally Wheelwright Übersetzung von Dipl.-Psych. Jörn de Haen Bitte tragen Sie Ihre Daten ein und lesen Sie dann die Anweisungen darunter.
Deutsche Version der Cambridge Behaviour Scale von Simon Baron-Cohen und Sally Wheelwright Übersetzung von Dipl.-Psych. Jörn de Haen Bitte tragen Sie Ihre Daten ein und lesen Sie dann die Anweisungen darunter.
Erörterung. Hauptteil Zweck: Themafrage erörtern; Möglichkeiten des Hauptteils:
 Erörterung Ausgangsfrage Einleitung Zweck: Interesse wecken, Hinführung zum Thema; Einleitungsmöglichkeiten: geschichtlicher Bezug, Definition des Themabegriffs, aktuelles Ereignis, Statistik/Daten, Zitat/Sprichwort/Spruch;
Erörterung Ausgangsfrage Einleitung Zweck: Interesse wecken, Hinführung zum Thema; Einleitungsmöglichkeiten: geschichtlicher Bezug, Definition des Themabegriffs, aktuelles Ereignis, Statistik/Daten, Zitat/Sprichwort/Spruch;
Nietzsche gegen die Lehrer der Selbstlosigkeit
 Nietzsche gegen die Lehrer der Selbstlosigkeit Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 26. November 2007 1 Was werde ich tun? Im folgenden Essay werde ich ein Argument analysieren, in welchem Friedrich
Nietzsche gegen die Lehrer der Selbstlosigkeit Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 26. November 2007 1 Was werde ich tun? Im folgenden Essay werde ich ein Argument analysieren, in welchem Friedrich
Teil 1 Gleichungen und Ungleichungen
 Teil 1 Gleichungen und Ungleichungen Gleichungen Eine mathematische Gleichung ist eine logische Aussage über die Gleichheit von Termen. Das, was links vom Gleichheitszeichen (=) steht, hat den gleichen
Teil 1 Gleichungen und Ungleichungen Gleichungen Eine mathematische Gleichung ist eine logische Aussage über die Gleichheit von Termen. Das, was links vom Gleichheitszeichen (=) steht, hat den gleichen
Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit
 Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit Martha C. Nussbaum *1947 1975 Promotion in klassischer Philologie in Harvard Lehrtätigkeiten in Harvard (1975-1983), Brown University
Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit Martha C. Nussbaum *1947 1975 Promotion in klassischer Philologie in Harvard Lehrtätigkeiten in Harvard (1975-1983), Brown University
Lösung zu Serie 3. Lineare Algebra D-MATH, HS Prof. Richard Pink. Sei K ein beliebiger Körper.
 Lineare Algebra D-MATH, HS 204 Prof. Richard Pink Lösung zu Serie 3 Sei K ein beliebiger Körper.. [Aufgabe] Sei n Z 0 eine gegebene nicht-negative ganze Zahl. Übersetzen Sie die folgenden Aussagen in eine
Lineare Algebra D-MATH, HS 204 Prof. Richard Pink Lösung zu Serie 3 Sei K ein beliebiger Körper.. [Aufgabe] Sei n Z 0 eine gegebene nicht-negative ganze Zahl. Übersetzen Sie die folgenden Aussagen in eine
Einführung in die Philosophie
 in die Philosophie Glauben und Wissen Wintersemester 2016 17 // bei Moritz Schulz Plan Erscheinung und Wahrnehmung 1 Erscheinung und Wahrnehmung 2 3 Wahrnehmung Sinneswahrnehmung ist eine (womöglich sogar
in die Philosophie Glauben und Wissen Wintersemester 2016 17 // bei Moritz Schulz Plan Erscheinung und Wahrnehmung 1 Erscheinung und Wahrnehmung 2 3 Wahrnehmung Sinneswahrnehmung ist eine (womöglich sogar
20 Beurteilung umgangssprachlicher Sätze und Argumente mit prädikatenlogischen Mitteln
 20 Beurteilung umgangssprachlicher Sätze und Argumente mit prädikatenlogischen Mitteln Erinnerung Man kann die logischen Eigenschaften von Sätzen der Sprache PL in dem Maße zur Beurteilung der logischen
20 Beurteilung umgangssprachlicher Sätze und Argumente mit prädikatenlogischen Mitteln Erinnerung Man kann die logischen Eigenschaften von Sätzen der Sprache PL in dem Maße zur Beurteilung der logischen
Vorlesung. Einführung in die mathematische Sprache und naive Mengenlehre
 Vorlesung Einführung in die mathematische Sprache und naive Mengenlehre Allgemeines RUD26 Erwin-Schrödinger-Zentrum (ESZ) RUD25 Johann-von-Neumann-Haus Fachschaft Menge aller Studenten eines Institutes
Vorlesung Einführung in die mathematische Sprache und naive Mengenlehre Allgemeines RUD26 Erwin-Schrödinger-Zentrum (ESZ) RUD25 Johann-von-Neumann-Haus Fachschaft Menge aller Studenten eines Institutes
sich die Schuhe zubinden können den Weg zum Bahnhof kennen die Quadratwurzel aus 169 kennen
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Formale Methoden II. Gerhard Jäger. SS 2005 Universität Bielefeld. Teil 3, 12. Mai Formale Methoden II p.1/23
 Formale Methoden II SS 2005 Universität Bielefeld Teil 3, 12. Mai 2005 Gerhard Jäger Formale Methoden II p.1/23 Logische Folgerung Definition 6 (Folgerung) Eine Formel ϕ folgt logisch aus einer Menge von
Formale Methoden II SS 2005 Universität Bielefeld Teil 3, 12. Mai 2005 Gerhard Jäger Formale Methoden II p.1/23 Logische Folgerung Definition 6 (Folgerung) Eine Formel ϕ folgt logisch aus einer Menge von
Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1
 Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1 Teil A: Wissenschaftstheoretische Grundlagen WS 2016/2017 Prof. Dr. Richard Roth 1 Inhaltsverzeichnis A. Wissenschaftstheoretische Grundlagen 1 Wissenschaft
Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1 Teil A: Wissenschaftstheoretische Grundlagen WS 2016/2017 Prof. Dr. Richard Roth 1 Inhaltsverzeichnis A. Wissenschaftstheoretische Grundlagen 1 Wissenschaft
Brauchen Kinder Leitwölfe? Liebevolle Führung in der Familie
 Brauchen Kinder Leitwölfe? Liebevolle Führung in der Familie In der heutigen Welt brauchen Kinder mehr denn je klare, verlässliche Signale von ihren Eltern. Dies ist nicht immer einfach, weil sich die
Brauchen Kinder Leitwölfe? Liebevolle Führung in der Familie In der heutigen Welt brauchen Kinder mehr denn je klare, verlässliche Signale von ihren Eltern. Dies ist nicht immer einfach, weil sich die
Einführung in die Naturschutzethik
 Einführung in die Naturschutzethik Fortbildungsreihe Klugheit Glück Gerechtigkeit Vilm, 11.-14.11.2013 Uta Eser Koordinationsstelle Wirtschaft und Umwelt, HfWU U. Eser, HfWU 1 Übersicht Teil I: Grundlagen
Einführung in die Naturschutzethik Fortbildungsreihe Klugheit Glück Gerechtigkeit Vilm, 11.-14.11.2013 Uta Eser Koordinationsstelle Wirtschaft und Umwelt, HfWU U. Eser, HfWU 1 Übersicht Teil I: Grundlagen
Elementare Beweismethoden
 Elementare Beweismethoden Christian Hensel 404015 Inhaltsverzeichnis Vortrag zum Thema Elementare Beweismethoden im Rahmen des Proseminars Mathematisches Problemlösen 1 Einführung und wichtige Begriffe
Elementare Beweismethoden Christian Hensel 404015 Inhaltsverzeichnis Vortrag zum Thema Elementare Beweismethoden im Rahmen des Proseminars Mathematisches Problemlösen 1 Einführung und wichtige Begriffe
Précis zu The Normativity of Rationality
 Précis zu The Normativity of Rationality Benjamin Kiesewetter Erscheint in: Zeitschrift für philosophische Forschung 71(4): 560-4 (2017). Manchmal sind wir irrational. Der eine ist willensschwach: Er glaubt,
Précis zu The Normativity of Rationality Benjamin Kiesewetter Erscheint in: Zeitschrift für philosophische Forschung 71(4): 560-4 (2017). Manchmal sind wir irrational. Der eine ist willensschwach: Er glaubt,
Wahrheit individuell wahr, doch die Art, wie wir das, was wir wahrnehmen, rechtfertigen und erklären, ist nicht die Wahrheit es ist eine Geschichte.
 Was ist Wahrheit Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung durch
Was ist Wahrheit Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung durch
Geisteswissenschaft. Robin Materne. Utilitarismus. Essay
 Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Vier Werte, die Kinder ein Leben lang tragen
 Vier Werte, die Kinder ein Leben lang tragen Ziel der heutigen Erziehung Junge Erwachsene mit einer psychischen und mentalen Gesundheit und einer guten psychosozialen Kompetenz. Beziehung x x Autoritäre
Vier Werte, die Kinder ein Leben lang tragen Ziel der heutigen Erziehung Junge Erwachsene mit einer psychischen und mentalen Gesundheit und einer guten psychosozialen Kompetenz. Beziehung x x Autoritäre
Tilman Bauer. 4. September 2007
 Universität Münster 4. September 2007 und Sätze nlogik von Organisatorisches Meine Koordinaten: Sprechstunden: Di 13:30-14:30 Do 9:00-10:00 tbauer@uni-muenster.de Zimmer 504, Einsteinstr. 62 (Hochhaus)
Universität Münster 4. September 2007 und Sätze nlogik von Organisatorisches Meine Koordinaten: Sprechstunden: Di 13:30-14:30 Do 9:00-10:00 tbauer@uni-muenster.de Zimmer 504, Einsteinstr. 62 (Hochhaus)
Methodologie der Sozialwissenschaften
 Karl-Dieter Opp Methodologie der Sozialwissenschaften Einführung in Probleme ihrer Theorienbildung und praktischen Anwendung 6. Auflage VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort 10
Karl-Dieter Opp Methodologie der Sozialwissenschaften Einführung in Probleme ihrer Theorienbildung und praktischen Anwendung 6. Auflage VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort 10
1 Vorbereitung: Potenzen 2. 2 Einstieg und typische Probleme 3
 Das vorliegende Skript beschäftigt sich mit dem Thema Rechnen mit Kongruenzen. Das Skript entsteht entlang einer Unterrichtsreihe in der Mathematischen Schülergesellschaft (MSG) im Jahr 2013. Die vorliegende
Das vorliegende Skript beschäftigt sich mit dem Thema Rechnen mit Kongruenzen. Das Skript entsteht entlang einer Unterrichtsreihe in der Mathematischen Schülergesellschaft (MSG) im Jahr 2013. Die vorliegende
