ADOLF NOE v. ARCHENEGG, ATAVISTISCHE BLATTFORMEN DES TULPEN BAUM ES. ÜBER VORGELEGT IN DER SITZUNG VOM 5. APRIL I894. und aus
|
|
|
- Bettina Feld
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 269 ÜBER ATAVISTISCHE BLATTFORMEN DES TULPEN BAUM ES. ADOLF NOE v. VON ARCHENEGG, STUD. PHIL., D. Z. DEMONSTRATOR AM PHYTOPALÄONTOLOGISCHEN INSTITUTE DER UNIVERSITÄT GRAZ. (i?lcil 4 c'iafefn in SCatiiiJc-CtjOriidV itns 1 Svxttiawi). VORGELEGT IN DER SITZUNG VOM 5. APRIL I894. Vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zu jener phylogenetischen Forschung liefern, die sich in einer Reihe von Abhandlungen aus der Feder Ettingshausen's, Krasan's und Krasser's äusserte und aus der Beobachtung und Untersuchung atavistischer Blattformen Aufschlüsse über die phylogenetischen Beziehungen jetztlebender zu fossilen Pflanzenarten zu erhalten sucht. Ich habe in einem Aufsatze»Über den gegenwärtigen Stand der phytopaläontologischen Forschung«im Jahrgange 1893 der»natur«heft 37, die besagte Forschungsrichtung betreffenden Publicationen ausführlich besprochen, so dass es überflüssig wäre an dieser Stelle sich länger aufzuhalten, und ich mich mit dem blossen Hinweis begnüge. Nur eine Veröffentlichung aus der Reihe der in dem citirten Aufsatze besprochenen Schriften muss eingehender gewürdigt werden, da sie dem von mir behandelten Thema besonders nahesteht, nämlich Dr. Fridolin Krasser's Arbeit:»Über den Polymorphismus des Laubes von Liriodendron tulipifera L.«(Sitzungsberichte der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Bd. XL. 5. November 1890). Dr. Krasser gibt daselbst einen durch schematische Holzschnitte illustrirten Überblick der von ihm am Laube von L. tulipiferum unterschiedenen Blattformen, deren Zusammenhang mit den fossilen uns bekannten Abdrücken er nachzuweisen sucht und daher erstere für atavistische Bildungen erklärt. Anknüpfend an die Untersuchungen Krasser's bezweckt meine Arbeit die Behandlung der zahlreichen im phytopaläontologischen Institute der Universität Graz aufoewahrten polymorphen Blätter cultivirter Stöcke von Liriodendron tulipiferum, welche mir der Vorstand dieses Institutes Herr Regierungsrath Professor Dr. Co n- stantin Freiherr von Ettingshausen zum näheren Studium vorlegte. Bei genauer Betrachtung der vorliegenden Blätter fand ich in ihnen ein vollkommen hinreichendes Material, die Untersuchungen Krasser's in vieler Beziehung zu erweitern und durch ganz neue Resultate zu ergänzen, und glaubte daher die Ergebnisse meiner Bearbeitung der Veröffentlichung übergeben zu können. Zugleich erschien es zum Verständnisse der Betrachtungen nothwendig, die betreffenden Objecte in Naturselbstdruck darzustellen. Zum vollen Verständnisse der nun folgenden Erörterungen ist es nöthig, sich einige der hier zu Tage tretenden Forschungsrichtung angehörende Beobachtungen allgemeinen Charakters vor Augen zu halten.
2 270 Adolf Koc v. Archenegg, Häufig können wir an einem in vollem Blätterschmucke prangenden Baume die interessante Beobachtung machen, dass sein Laubwerk aus mannigfachen Elementen zusammengesetzt ist, so dass in Bezug auf seine Blätter ein geringerer oder grösserer Formenunterschied herrscht, und zwar nicht allein zwischen Haupt- und Nebenblättern, sondern auch zwischen Organen von ganz gleichem morphologischen Werte; der eine Ast trägt so, der andere anders gestaltete Blattformen, die jedoch nicht in einer wirren chaotischen Unregelmässigkeit und Unordnung bestehen, sondern scharf ausgeprägte durch Übergänge verbundene Typen kennzeichnen. Forschen wir dann nach der Bedeutung dieses Vorkommens, so bieten sich mancherlei Erklärungen dar. Diese Abweichungen können durch bestimmte äussere und innace Einflüsse bedingte Variationen des normalen Laubes sein; ihre Ursache kann aber auch in dem Rückschlage zu phylogenetisch älteren Formen ihre Erklärung finden, die Pflanze hat gleichsam zurückgegriffen in den Schatz altererbter Formen und ein Normalblatt einer viel früheren, längst vergangenen Entwicklungsepoche ans Tageslicht gezogen. Bevor wir so etwas annehmen können, muss erst der Beweis geliefert sein, dass diese vor uns befindlichen abnormen Blattformen ihre Analogien in der Geschichte der betreffenden Art besitzen, der uns durch die Paläontologie ermöglicht wird. Erst dann, wenn zu den fraglichen Blattformen aus dem Kreise der uns bekannten fossilen Formen unverkennbare Ebenbilder gestellt werden können, dürfen wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, der grössten die in derartigen schwierigen Fällen überhaupt möglich ist, auf das Vorhandensein atavistischer Formelemente schliessen. Was von dem Blatte Giltigkeit besitzt, bezieht sich auch auf alle anderen Organe des Pflanzenkörpers. Natürlich ist auch das sogenannte Normalblatt nichts als ein Formelement, es ist nur durch seine überwiegende Ausbildung momentan vorherrschend. Es sei mir gestattet an dieser Stelle einen Augenblick zu verweilen, um einem Ausdrucke, den ich hier gebrauchte, nämlich "Formelement,«die entsprechende Erklärung folgen zu lassen. Professor Franz Krasan fasst die Erklärung dieses Wortes in folgendem Satze zusammen:»ein Formelement nennen wir im Allgemeinen eine jede selbständige und typisch ausgebildete Form eines Organes oder Gliedes des Pflanzenkörpers, des Stammes, des Blattes, der Blüthe, der Frucht u. s. f., bei letzterer auch eines Theiles, z. B. der Cupula.«' Nach Constatirung der merkwürdigen Thatsache, dass wir es hier wirklich mit atavistischen Formen zu thun haben, drängt sich uns zunächst die Frage nach der unmittelbaren Veranlassung dieser Erscheinung auf, und wir müssen bestrebt sein, der Erklärung eines Zurückgreifens in der Entwicklungsgeschichte einer Pflanzenart durch emsiges Beobachten der Umstände, unter denen atavistische Formen zur Entwicklung kommen, und wenn möglich, durch das Experiment näher zu gelangen. Die Beobachtungen haben nun das Auftreten atavistischer Bildungen gelehrt: 1. Nach der Einwirkung von Frösten. Vom Frühjahrsfroste getroffene und abgefrorene Zweige werden durch neue Adventivknospen (wir nennen sie der Kürze wegen Frosttriebe) ersetzt und diese zeigen atavistische Blattbildungen. 2. Nach der Entlaubung der Zweige durch Insectenfrass. Nach einer entsprechenden Zeit kommen aus den abgefressenen Zweigen selbst, oder wenn dieselben bereits abgestorben sind, an den zunächst gelegenen Stellen deraxe Adventivknospen hervor, zur Entwicklung bringen. die mit atavistischen Formen besetzte Zweige 3. Bei kränkelnden Holzgewächsen, die stark mit Stockausschlägen besetzt sind. Unter den letzteren sind oft Zweige, die atavistische Formen tragen. werden grösstenteils an solchen Zweigen gesammelt. 4. Nach starkem Zurückschneiden oder Stutzen der Bäume oder auch nach Windbrüchen. Die atavistischen Blätter von Castanea vesca Die ausgesprochensten atavistischen Formen von Fagtis silvatica bemerkte ich an stark zugestutzten Buchenhecken. 1 Franz Krasan, Ergebnisse der neuesten Untersuchungen über die Formelemente der Pflanzen. Engler's Botanische Jahrbücher. Leipzig 1873, 13. Bd.
3 Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes Nach dem Versetzen der Bäume und St rauch er in Gärten, mit oder ohne g! e ich zeitigem Beschneiden der Aste. Ein in vorliegender Abhandlung erörterter Fall, auf den die Tafeln II IV Bezug haben, gehört hieher. Es lag der Versuch nahe, durch künstliches Herbeiführen eines der eben angeführten Umstände atavistische Bildungen auf experimentellem Wege zu erhalten. Ettingshausen hat durch Frosteinwirkung (mittelst Kältemischung oder auch Erfrierenlassen von Zimmerpflanzen im Winter), durch Entblättern der Aste, durch Versetzen, Verstümmeln, unpassende Cultur und andere ungünstige Einwirkungen auf die Pflanze atavistische Formen erzeugt. Diese Beobachtungen und Experimente lassen erkennen, dass der letzte Anstoss zur Bildung atavistischer Formen wahrscheinlich in irgend einer Störung in der individuellen Entwicklung und im Haushalte des betreffenden Organismus, einem Ent wickl ungshemmniss, besteht. Eine thatsächliche und eingehende Erklärung der biologischen Ursachen derartiger Atavismen scheint mir nach dem gegenwärtigen Stande der vorliegenden Beobachtungen und Untersuchungen noch nicht möglich, doch hoffe ich durch vorstehende Zeilen vielleicht diesbezüglich eine Anregung gegeben zu haben. Atavistische Formen bieten ein unschätzbares Hilfsmittel, um die Phylogenie einer Pflanzenart oder selbst einer höheren systematischen Ordnung festzustellen, denn nicht allein, dass uns auf diesem Wege die Beziehungen recenter zu vorweltlichen Arten entschleiert werden, es kommen auch auf diesem Wege sogenannte adelphische Formelemente zum Vorschein, d. i. solche, welche den recenten Normalelementen anderer Arten derselben Gattung entsprechen. Hieraus kann der directe Beweis des genetischen Zusammenhanges der betreffenden Arten mit der Urform abgeleitet werden. Wie weit der Atavismus einzelner Arten zurückführt, ist bei den verschiedenen Arten verschieden, bei Fagus silvatica und Liriodendron tulipiferum erreicht er sogar die Kreideperiode. Von grosser Wichtigkeit ist es jedoch, einen Punkt bei der Beurtheilung atavistischer Formelemente im Auge zu behalten, nämlich die Dürftigkeit des uns vorliegenden fossilen Materiales, das unzweifelhaft nur einen kleinen Bruchtheil der wirklich vorhanden gewesenen Formelemente der betreffenden Art wiedergibt, wir daher nur in ausserordentlich seltenen Fällen die genauen Analogien der muthmasslich atavistischen Formen unter den uns bekannten Fossilien ausfindig machen können und uns daher in den meisten Fällen mit blossen Annäherungen an einen bestimmten, uns fossil überlieferten Typus zufriedenstellen müssen, wobei es uns manchmal bei Vorhandensein einer genügenden Zahl bekannter fossiler Formen möglich ist, die betreffende atavistische Blattform als Übergang, Mischform, zwischen zwei bekannten fossilen oder einer fossilen und einer lebenden zu erklären. I. Die Normalform von Liriodendron tulipiferum L. Der in Nordamerika einheimische Tulpenbaum hat wechselständige, langgestielte abfällige, beiderseits vollkommen kahle Blätter von dünner fast membranöser Textur. Die im Umrisse rundliche oder querbreite Lamina zeigt eine gerundete, abgeschnittene oder etwas vorgezogene Basis und eine breit und fast geradlinig abgeschnittene oder nur seicht ausgerandete Spitze, an deren Mitte der Primärnerv als sehr kurzes Endspitzchen hervortritt. Der Rand ist buchtig-dreilappig. Der breite Mittellappen, dessen Spitze abgeschnitten ist, hat eine fast rechteckige Gestalt mit zwei scharfen Ecken. Die beiden Seitenlappen, welche sich gegen die Basis zu vereinigen, sind mit je zwei kleinen Lappen oder Zähnen besetzt und von dem oberen durch eine stumpfe, seichte Bucht getrennt. Die Nervation zeigt einen an der Basis stark hervortretenden geradläufigen, gegen die Spitze zu beträchtlich verfeinerten Primärnerv, von welchem jederseits 7 10 Secundärnerven unter Winkeln von entspringen. Von diesennerven sind die 1 2 untersten ganz oder nahezu grundständig, was einen Nervationstypus darstellt, welchen wir auch bei Urtica dioica, Phyteuma spicatum, Stachys silvatica u. A. finden und als unvollkommen strahlläufig bezeichnen. Die übrigen Secundärnerven entspringen manchmal unter spitzeren Winkeln, als die ersteren und sind, je nachdem sie die Lappen versorgen oder dazwischen eingeschaltet sind, länger oder kürzer. Die längeren sind
4 272 Adolf No c v. A rc h e n egg, randläufig, reich verzweigt und meist gabeltheilig, die grundständigen mit Aussennerven versehen. Von den Gabelästen ziehen die stärkeren zu den Spitzen, die schwächeren zu den Buchten der Lappen hin. Die Tertiärnerven entspringen von beiden Seiten der Secundärnerven unter spitzen Winkeln, treten stark hervor und anastomosiren untereinander. Die gegen den Rand der Lappen zu liegenden bilden weite Schlingen, welche nach demselben hinziehen, die übrigen begrenzen schmälere mehr oder weniger gebogene Segmente. Die Quarternärnerven gehen von beiden Seiten der tertiären unter nahezu rechtem Winkel ab und anastomosiren bei geschlängeltem Verlaufe mehr untereinander, den Tertiärsegmenten in der Form ähnliche Segmente bildend. Die quinternären Nerven entspringen unter rechtem Winkel und vereinigen sich zu einem aus polygonalen, II. isodiametrischen Maschen zusammengesetzten Netze. Normalblatt von Liriodendron tulipifcrum L. Kurze Charakteristik der fossilen Liriodendronblätter. In der nun folgenden kurzen Beschreibung der fossilen Liriodendronblätter sollen alle bekannten Formen Erwähnung finden, theils der Vollständigkeit wegen, theils um dem Leser, auch wenn ihm nicht die gesammte einschlägige Litteratur zur Verfügung steht, die Controle der von mir aufgestellten Behauptungen zu erleichtern und ihm einen Fingerzeig für weitere Betrachtungen atavistischer Formen an Liriodendron zu bieten. Es braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass diejenigen fossilen Formen, welche in den später folgenden Erörterungen eine besonders wichtige Rolle spielen, eingehender gewürdigt sind.
5 Atavistische Blattformen des Tulpenbatimes Tertiäre Blattformen von Liriodendron. 1. Liriodendron Procaccinii Unger, Synopsis, p A. Massalongo e G. Scarabelli, Studii sulla (lora fossile c geologia stratigraphica del Senegalliese 1859, p Tab. VII, Fig. 23; Tab. XXXIX, Fig. 3, 4, 5, 6; Tab. XLIV, Fig. 7. G. de Saporta et A. F. Marion, Recherches sur les vegetaux fossiles de Meximieux, p. 268; Tab. XXXIII, Fig. 1 6, o. 0. Heer, Flora fossilis arctica, Band I, Tal. XXVI Fig. 7 b, Tal". XXVII, Fig. 5 8; Urwelt der Schweiz, Fig. 223./. Der Formenkreis, der uns unter L. Procaccinii Ung. von den einzelnen Autoren beschrieben und abgebildet wird, ist ein ausserordentlich grosser. Es ist dies die im Tertiär am meisten vertretene Art von Liriodendron, und es scheint fast, als ob die wenigen sonst noch aus dieser Formation bekannten Lirmdendron -Abdrücke ebenfalls nur Glieder dieses Formenkreises darstellen würden. Ich will nun einen Überblick über die Formelemente von Liriodendron Procaccinii geben, wobei ich bestrebt sein werde, mich möglichst an die Aufstellungen, die von den genannten Autoren selbst gegeben wurden, a) Forma islandica. (Liriodendron islandicum Saporta et Marion.) zu halten. Saporta und Marion gaben den von Heer aus Island beschriebenen L. Procaccmii-Blättem den Speciesnamen»islandicum,* bemerkten jedoch selbst, dass L. islandicum höchst wahrscheinlich die Urform von L. Procaccinii sei. Da jedoch Heer, Fl. foss. aret. I, p. 151 und Urwelt der Schweiz,' p. 381 diese Formen unter L. Procaccinii stellt und kein weiterer Grund zur Trennung vorliegt, so will ich dieselbe einfach als Formelement bei L. Procaccinii anführen, umsomehr als sie sich dem Normalblatt von Liriodendron tulipiferum auffällig nähert. Forma islandica unterscheidet sich von letzterem hauptsächlich durch die tiefere Ausrandung der Spitze und die engere Bucht nächst den oberen Seitenlappen. Die Nervation beider ist ziemlich ähnlich, nur sind der äusseren Blattform entsprechend die oberen Secundärnerven bei forma islandica bogig aufwärts gekrümmt, während bei der Normalform das Gegentheil der Fall ist. Im Ganzen ergibt sich aber hieraus, dass die Forma islandica den nächsten Anschluss an die lebende Art zur Geltung bringt. b) Forma helvetica Heer, Flora fossilis Helvetiae Bd. III, p. 29, Tab. 108, Fig. 6 und 6b. Heer beschreibt diese Form anfangs Bd. III, p. 29 als selbständige Art, dann aber erklärt er S. 195 von Liriodendron helveticum:»nach Einsicht von Abbildungen des L. Procaccinii, die mir Professor Massalongo mitgetheilt hat, zweifle ich nicht, dass unsere Art mit der von Senegaglia zusammengehöre,«wonach es mir wohl gestattet sein dürfte, L. helveticum als ein Formelement von L. Procaccinii aufzufassen. Die Blätter, die nur fragmentarisch erhalten sind, besitzen drei Lappen, und zwar sind die Lappen nach vorne gebogen. Während forma islandica noch getheilte Seitenlappen hat, sind sie hier einfach und weniger scharf gespitzt, auch sind die Blätter weniger breit und die Sccundärnerven entspringen unter spitzeren Winkeln. Ein Hauptunterschied zwischen f. islandica und helvetica ist die herzförmig ausgezogene Basis der letzteren. Sonst bieten a) und b) bedeutende Ähnlichkeiten, besonders was die Nervatur betrifft, deren Secundärnerven noch zahlreicher sind als bei L. tulipiferum. Fig. 7. c) Forma acutiloba Massalongo, Flora fossile Senegalliese, p. 312, Tab. VII, Fig. 23, Tab. XLIV, Unter den von Massalongo beschriebenen Formen schliesst sich diese am meisten an b) an, nur sind hier, wie schon der Name sagt, die Lappen spitzer, der Mittellappen ist ebenfalls tief getheilt und beide Hälften sind scharf gespitzt. Auch ist die Basis mehr verschmälert, die Secundärnerven sind minder zahlreich und unter spitzeren Winkeln abgehend. d) Forma obtusifolia Massalongo 1. c. p. 312, Tab. XXXIX, Fig. 3, 5. Dreilappige Blätter mit abgerundeten Seitenlappen und abgeschnittenem Mittellappen. Die Buchten zwischen Mittel- und Seitenlappen sind seichter, das ganze Blatt mehr isodiametrisch, die Basis schwach Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. LX!. Bd.
6 274 Adolf Noe v. Archenegg, keilförmig und die Secundärnerven entspringen unter minder spitzeren Winkeln, als bei der vorher beschriebenen Form. Saporta und Marion bilden»flore fossile de Meximieux«Tab..33, Fig. 4 ein Rlattfragment ab, das eine auffällige Übereinstimmung mit forma obtusifolia von Massalongo zeigt, nur ist die Basis hier noch weniger vorgezogen. Auffällig ist gegenüber L. tulipiferum (Normalblatt) die grössere Zahl der Secundärnerven und die Regelmässigkeit der von ihnen gebildeten Segmente. e) Forma rotundata Massalongo 1. c. p. 312, Tab. XXXIX, Fig. 5. Dreilappige, nahezu querovale Lamina mit fast halbkreisförmiger Basis. Die Seitenlappen sind abgerundet und von dem circa ein Drittel des Blattdurchmessers messenden Mittellappen, der schwach ausgebuchtet ist, durch kleine fast rechtwinklig ausgeschnittene Buchten getrennt. Forma incisa Massalongo 1. c. p. 312, Tab. XXXIX, Fig. 4, 6. f) Das Blatt ist dreilappig mit runder Basis und tiefausgeschnittenen Buchten. Der Mittellappen ist ebenfalls durch einen tiefgehenden spitzen Einschnitt in zwei rundlich endende Lappen gespalten. Die Secundärnerven zeigen auf dem von Massalongo abgebildeten grösseren Blatte Fig. 4 einen geschlängeltcn Verlauf und gehen unter ziemlich spitzen Winkeln aus. g) Forma integrifolia. Saporta und Marion bilden in der Fossilen Flora von Meximieux Taf.33, Fig. 1 3 mehrere Blätter ab, die fast ganz ungelappt sind, höchstens mit der Andeutung einer schwachen Buchtung in der Gegend, wo die übrigen Procaccinii-F ormen deutlich ausgeprägte Haupt- und Seitenlappen trennende Buchten besitzen. Sonst nähern sich diese Blätter in Bezug auf Form und Nervatur den früher beschriebenen Formen. Auffallend ist nur bei einigen die bedeutende Grösse. Die Spitze des Blattes ist stets tief eingeschnitten und die hiedurch entstandenen Lappen sind abgerundet, auch ist die Basis stumpf bis herzförmig. Leider ist nur ein einziges Blatt ganz erhalten, während die übrigen sämmtlich fragmentarisch sind, weswegen man nicht angeben kann, welchen von den übrigen Formen sich die einzelnen Blätter nähern. 2. Liriodendron Haueri Ettingshausen, Fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin, III. Theil, Bd. XXIX d. Denkschriften d. k. Akademie in Wien. Taf. XLI, Fig. 10, 10/'. Das Blatt ist nur nach der Nervation bestimmt, da der Rand nur äusserst unvollkommen erhalten ist. Jene stimmt mit der Nervation von L. tulipiferum (Normalblatt) in auffallender Weise überein. Die Tertiärnerven sind verlängert, entspringen von beiden Seiten der hervortretenden Secundärnerven unter spitzen Winkeln und bilden durch ihre Anastomosen nach aussen coneave Schlingbögen. Die sehr entwickelten Quarternärnerven bilden ein aus unregelmässig viereckigen Maschen zusammengesetztes Netz, welches die ansehnlichen, gekrümmten Tertiärsegmente erfüllt. Die an der Basis genäherten Secundärnerven sind nach aussen divergirend-bogig gekrümmt und durch letzteres Merkmal schliesst sich diese Art an L. tulipiferum an. 3. Liriodendron Gardneri Saporta, Origine paleontologique des arbres etc., p Dreilappiges Blatt, dessen untere Seitenlappen weit vorgezogen und assymmetrisch erscheinen. Die Ausbuchtungen zwischen ihnen und dem Mittellappen sind tief. 4. Liriodendron Laramiense Ward, Types of the Laramie Flora, Bulletin of the U. S. Geological Survey, No. 37, Washington 1887, p. 102, Tab. 48, Fig. 2. Ward nennt so ein nur fragmentarisch erhaltenes Blatt. Der obere Theil und fast die ganze eine Blatthälfte fehlen, so dass die Bestimmung ziemlich schwierig ist. Der vorhandene Blattrand deutet auf ein ungetheiltes Blatt mit äusserst schwach angedeuteten unteren Lappen. Die Nervation nähert sich bedeutend an L. tulipiferum, nur besitzen die Secundärnerven einen gleichmässigeren Verlauf. Letztere bilden auch den Unterschied gegen L. Haueri Ett., indem dieses gegenüber dem etwas geschlängelten, jedoch dieselbe Richtung innehaltenden Verlaufe der Secundärnerven von L. Laramiense sich durch nach auswärts bogenläufige Nerven auszeichnet.
7 Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. 275 B. Blattformen von Liriodendron aus der Kreide. 5. Liriodendron Meekii Heer, Flora fossilis arctica, Bd. VI, Abth. 2, p. 87 ff., Taf. 18, 22, 23, 25 45; Bd. VII, p. 39 Taf. 63. Auch Liriodendron Meekii besitzt einen ausgedehnten Formenkreis, und ich werde daher ähnlich wie bei L. Procacciuii die von Heer beschriebenen Formen an der Hand der von demselben aufgestellten Varietäten als Formelemente charakterisiren. a) Forma Marcouana Heer, 1. c. p. 88, Taf. 22, Fig. 4 7; Taf. 23, Fig. 3; Taf. 45, Fig. \3b. Heer führt unter demnamen dieserform auch das Taf. 45, Fig.l3a abgebildete Blatt an, doch scheint es mir seines tiefen Einschnittes an der Spitze wegen, durch den es sich hauptsächlich von den übrigen Blättern dieserform unterscheidet, nicht hieherzugehören, und ich habe es daher von dieser Gruppe getrennt. Die Blätter sind oval oder verkehrt länglich-oval, ohne Spur von seitlichen Lappen, vorne stumpf zugerundet und ausgerandet, sowie am Grunde verschmälert. Die Secundärnerven sind zart, meist einander genähert und entspringen in spitzen Winkeln. b) Forma obeordata Heer I.e. Taf. 22, Fig. 2; Taf. 23, Fig. 4. Das am Grunde in den Blattstiel verschmälerte Blatt besitzt eine eiförmige oder verkehrt herzförmige Gestalt und zeichnet sich der unter et) beschriebenen Form gegenüber durch eine breitere und relativ kürzere Form aus, wozu noch vorn eine tiefe Ausrandung, sowie abgerundete Ecken kommen. Die untersten Secundärnerven verlaufen gegenständig und sind stark nach vorne gebogen und wie die folgenden im spitzen Winkel ausgehend und nach aussen im Bogen verbunden. c) Forma mucronulata Heer 1. c. Taf. 22, Fig. 3, 10. Die Blattlamina ist vorne gestutzt und am Auslauf des Mittelnerven mit einer kleinen Spitze versehen. d> Forma subincisa Heer 1. c. Taf. 22, Fig. 8; Taf. 45, Fig. 13 a. Blatt am Grunde breiter, vorne tief eingeschnitten. c) Forma primaeva (Liriodendron primaevum Newberry) Heer 1. c. p. 88, Taf. 18. Fig. 4c; Taf. 22. Fig. 9; Taf. 23, Fig. 5. Das Blatt besitzt drei schwach ausgerandete Lappen. Die beiden seitlichen treten nur wenig hervor und sind nur durch eine seichte Bucht von dem Mittellappen getrennt. f) Forma genuina Heer 1. c. Taf. 22, Fig. 12, 13; Taf. 23, Fig. 6. An dem zu dieser Form gehörigen Blatte fallen vor Allem die bereits deutlich ausgebildeten Lappen auf, durch welche der Blattlamina eine dreilappige Gestalt verliehen wird. Die Form dieser Seitenlappen ist rundlich-stumpf. Der mittlere Lappen ist, wie das nur theilweise erhaltene Exemplar erkennen lässt, am Grunde verschmälert. Die Secundärnerven entspringen in spitzen Winkeln und sind verästelt. Heer macht die Bemerkung, dass auch der lebende Tulpenbaum (L. tulipiferum) uns einen ähnlichen Formenkreis von Blättern zeigt, was ihn auch bestimmt, alle die oben angeführten Formen zu einer Art zu bringen. Heer's Bemerkung ist für uns von hervorragendem Interesse, denn sie beweist, dass bereits diesem Autor der Polymorphismus der Liriodendron-BYätter auffiel, und er diesen zur Deutung der ihm vorliegenden Abdrücke heranzog. Allein nicht nur Heer, sondern fast allen Bearbeitern fossiler Liriodendron-Formen muss diese Übereinstimmung von einzelnen Blättern der recenten Art mit den von ihnen untersuchten fossilen Formen aufgefallen sein, da es sonst unerklärlich wäre, wie so vielgestaltige 35*
8 276 Adolf Noe v. Archen egg, und den normalen Blättern von L. tulipiferum verschiedene Formen hei Liriodendron untergebracht wurden. 6. Liriodendron intermedium Lesquereux, Contributions to the fossil Flora of the Western territories, Part I. The Cretaceous Flora. U.S. Geological Survey. Washington 1876, p. 93, PI. 20, Fig. 5. Das stark verletzte Blatt ist dreilappig, der mittlere Lappen an der Basis stark verengt und an der Spitze tief ausgerandet, die unteren vom mittleren durch weite, stumpfe Buchten getrennt. Die Hälften des Mittellappens sind rundlich-abgestumpft. Die Lamina war, wie es scheint, dicklich bis lederartig. 7. Liriodendron giganteum Lesq. 1. c. PI. 22, Fig. 2. Lesquereux erklärt das von ihm unter diesem Namen beschriebene Fragment als die Hälfte des oberen (Mittel-) Lappens eines Blattes, gehörig zur Gattung Liriodendron. Wie wir aber im Verlaufe unserer weiteren Untersuchung sehen werden, ist diese Annahme irrthümlich, und dasselbe stellt einen Seitenlappen einer dreilappigen Blattform, die sich phylogenetisch eng an L. intermedium anschliesst, dar. So viel an dem abgebildeten Fragmente zu sehen ist, müssen die die Mittel- und Seitenlappen trennenden Buchten ziemlich tief gewesen sein, da sie bis nahe an den Mittelnerv reichen. Der Rand dieses flügelartigen Lappens ist geschweift und muss derselbe in Folge seiner Grösse einem auffallend grossen Blatte angehört haben. Die Secundärnerven sind besonders stark. Der Vollständigkeit wegen füge ich noch einige von Lesquereux beschriebene, aber nicht abgebildete Formen hinzu. 8. Liriodendron acuminatum Lesq. 1. c. Cretaceous Flora II, p. 74. Ein dreilappiges Blatt mit schmalen Seiten- und ebensolchen Theillappen des tiefausgerandeten Mittellappens. Sämmtliche Lappen sind nach aufwärts gebogen und das ganze Blatt hat eine Länge von gegen cm. 9. Liriodendron crueiforme Lesq. 1. c. II, p. 75. Das Blatt ist dreilappig, der Mittellappen breit und abgeschnitten, die Seitenlappen sind schmal und aufwärts gebogen, der am Ende sehr breite Mittellappen ist an seiner Basis sehr stark verschmälert, so dass er an der Spitze gleichsam einen Querbalken trägt und dem ganzen Blatte die Gestalt eines Ankers verleiht. 10. Liriodendron semi-alatum Lesq. 1. c. II, p. 75. Das dreilappige Blatt besitzt einen an der Basis sehr verengten, dann keilförmig aufsteigenden und abgeschnitten endigenden Mittellappen, an den sich unten zwei kurze, runde, entgegengesetzt stehende Scitenlappen anschli essen. 11. Liriodendron pinnatifidum Lesq. 1. c. II, p. 75. Lesquereux beschreibt unter diesem Namen ein einfaches, Form und Nervation von Liriodendron tragendes Blatt, das jedoch nahezu lineal im Umrisse und nur an beiden Seiten mit je drei fast alternirenden, durch seichte Buchten getrennten, fast wechselständigen Lappen versehen ist. Letztere sind halbrund und gänzlich oder theilweise schwach gezähnt. Die Nervation ist parallel. Die Länge des Blattes beträgt 9 cm und die Breite zwischen den mittleren Seitenlappen 5 cm. Spitze und Basis sind zerstört. Im Anschlüsse an die von Lesquereux beschriebenen Ltriodendron-Formen ist noch die von diesem Autor unter der Bezeichnung Liriophyllum beschriebene Form zu beachten, welche wir aber noch zu Liriodendron bringen, wo sie wahrscheinlich eine besondere Art bildet. 12. Liriodendron populoides (Syn. Liriophyllum p.) 1. c. II, p. 76, PI. 9, Fig. 1, 2. Es sind zweilappige, breitovale Blätter von herzförmiger Basis. Beide Blatthälften laufen in ohrförmige Lappen aus, die sich an ihren Spitzen nähern und zwischen sich eine tiefe, schmale Bucht freilassen, an
9 Atavistische Blattformen des Tulpenbatimes. 177 deren Basis der Mittelnerv endigt. Von diesem verlaufen beiderseits je vier starke, wenig verzweigte Secundärnerven, die zu einander fast parallel sind und bogig aufwärts gekrümmt erscheinen. Die beiden untersten Secundärnerven senden bogig gekrümmte, der Basis parallele Ausläufer nach aussen, während die obersten Secundärnerven einen der Bucht nahezu parallelen Verlauf zeigen. Das eine Blatt ist vorzüglich erhalten; vom anderen ist die eine Hälfte fast gänzlich zerstört. Es wird durch eine atavistische Form gezeigt werden, dass diese Blätter mehr passend zu Liriodendron zu stellen sind. III. Atavistische Blattformen von Liriodendron tulipiferum L. In Folgendem soll eine Übersicht der von mir an Liriodendron tulipiferum beobachteten atavistischen Formelemente gegeben werden. Vor Aufstellung dieser Übersicht sei es mir gestattet, mich über die Provenienz des von mir untersuchten Materiales und die Umstände, unter welchen die hier bearbeiteten Atavismen zu Tage treten, näher auszulassen. Die auf Tafel I wiedergegebenen Blätter stammen aus dem in Graz befindlichen Parke der Frau Baronin Wüllerstorff und befinden sich in der Sammlung des hiesigen phyto-paläontologischen Institutes. Dieselben sind einem grossen schönen Baume entnommen, der vor vielen Jahren in dem genannten Parke gepflanzt worden ist. Der Baum trägt gegenwärtig ausser dem Normalblatt atavistische Blätter, deren Formen in besagte Tafel aufgenommen worden sind. Die auf den Tafeln II IV dargestellten Formen sind aus dem in Aussee befindlichen Garten der Frau Auguste v. Karajan, deren freundlicher Mittheilung genaue und wichtige Daten entnommen werden konnten. Im Jahre 1875 hat ein Ischler Gärtner einen kleinen Tulpenbaum in den zur Villa der Frau v. Karajan gehörigen Garten in Markt Aussee gesetzt. Das Stämmchen hatte beiläufig 3 cm Durchmesser. Dieses Bäumchen gedieh bis zum Herbste 1879 gut. Im strengen Winter 1879/80 ist dasselbe, das eine Höhe von etwa 2 ;// erreicht hatte, bis auf die Wurzel abgefroren. Im Frühjahr 1880 wurde der abgefrorene Theil bis knapp ober der Wurzel abgenommen und das kurze Stück sammt Wurzel umgesetzt. Hierauf entwickelten sich im weiteren Verlaufe des Frühjahres aus dem zum Theil in der Erde steckenden Strünke zwei Knospen, die noch im selben Sommer zu zwei starken Trieben (a, b) wurden. Bis zum Jahre 1889 ging die weitere Entwicklung der Pflanze, die nur das Aussehen eines Strauches mit zwei vom Grunde abgehenden starken Ästen erreichte, ungestört vor sich. Im Winter 1889/90, der in Aussee abermals sehr streng war, erfror der eine Ast (a) zum grössten Theile, während der andere Ast (b) nicht beschädigt wurde. Im Sommer 1890 entwickelten sich aus dem lebensfähig gebliebenen Reste des erfrorenen Astes um neue Triebe, die sich im Sommer 1891 ungestört verstärkten. Erst in diesem Sommer aber wurden die Blätter des Strauches von der Frau des Hauses, welche im Winter durch einen Vortrag des Herrn Regierungsrathes Freiherrn v. Ettingshausen über die atavistischen Erscheinungen bei Pflanzen belehrt wurde, beobachtet, und da entdeckte Frau v. Karajan, dass die zwei Aste ganz verschiedene Blätter zeigten. Die Blätter des nicht erfrornen Astes (b) Taf. II. Fig. 3 waren durchaus ungetheilt, während die des erfrorenen (a) Taf. II, Fig. 2 durchaus»feigenblattartig' gelappt waren. Frau v. Karajan hatte die Güte, eine Anzahl von Blättern, wie sie sagte, alle von ihr beobachteten Formen beider Äste, dem phyto-paläontologischen Institute zu übersenden. Der Sommer 1892 brachte dieselbe Erscheinung, nur waren die Blätter auffallend gross (s. Taf. III, Fig. 1, 2). Es war ein sehr heisser Sommer nach vorhergegangener, längerer Durchfeuchtung, während im Winter kein Frostschaden stattgefunden hat. Im Frühjahre 1893 wurde über Auftrag der Frau v. Karajan der Strauch an eine geschützte Stelle des Gartens versetzt. Der Einfluss der Versetzung machte sich besonders bei den Blättern des durch Frost geschädigten Astes (a) bemerklich. Alle Blätter sind kleiner, vielleicht wegen des trockenen Sommers dieses Jahres (Taf. IV, Fig. 1 I). Bis zum Sommei 1891 kann man über die Blätter nichts erfahren. Von diesem Zeitpunkte an aber wissen wir, dass alle Blätter atavistisch waren ; die des Astes (b) zeigtentertiärformen,
10 278 Ado If Noe v. Archen egg, die des wiederholt beschädigten Astes (a) aber Kreideformen. Eine reichhaltige Sammlung der Blätter von diesen Jahren liegt uns vor. Aus Vorstehendem ist ersichtlich, dass die atavistischen Blattformen des im Garten der Frau v. Karajan gewachsenen Exemplares von L. tulipiferum ihre eigenthümlichen Bildungen unter den in der Einleitung Punkt 1 und 5 angeführten Vegetationsstörungen zur Erscheinung brachten. Bei der nun folgenden Übersicht der von mir an Liriodendron tulipiferum beobachteten atavistischen Formelemente sollen als Eintheilungsprincip die Beziehungen derselben zu den fossilen Liriodendron- Formen gelten, d. h. die erwähnten atavistischen Formelemente sind nach ihren fossilen Analogien zu ordnen. Beim Betreten dieses Pfades empfiehlt es sich, von den uns zunächst liegenden tertiären Formen auszugehen, und so allmählich zu den phylogenetisch entfernteren, d. h. der Kreide angehörenden, überzugehen..4. Formelemente von Liriodendron tulipiferum, deren Analoga der Tertiärformation angehören. 1. Kecente Analogien von Liriodendron Procaccinii. Unter den von mir untersuchten Blättern ist dieses Formelement sehr stark vertreten und deutlich gekennzeichnet. Von den früher bei L. Procaccinii unterschiedenen Formen finden sich hier wieder: a) Forma acutiloba. Taf. I, Fig. 2. Annäherungen an diese durch ihre verkehrt-herzförmige Lamina und scharf geschnittenen Spitzen, sowie den dreieckig ausgerandeten Mittellappen gekennzeichnete Form fand ich mehrfach ; besonders markant und fast in allen Zügen mit dem von Massalongo beschriebenen Fossile übereinstimmend an einem Blatte, welches Taf. I, Fig. 2 in Naturselbstdruck abgebildet ist. Zu unterscheiden wäre nur, dass beim recenten Blatte der Mittellappen etwas weniger tief ausgerandet ist, auch sind die Seitenlappen bei unserem Blatte etwas spitzer und um ein Unbedeutendes mehr nach aussen gebogen als beim Fossil, und letzteres ist auch von etwas schmälerer Form. Was die sonst auffallend übereinstimmende Nervatur betrifft, so ist im fossilen Blatte der Secundärnerv zwischen den beiden in die Seitenlappen und die Spitzen des Mittellappens mündenden Secundärnerven stark entwickelt und reicht bis an den Rand des Blattes, während er im recenten Blatte rudimentär und nicht einmal bis in die Mitte der Blatthälfte reichend auftritt. Vom recenten Normalblatt unterscheidet sich die hier besprochene atavistische Form durch die spitze vorgezogene Blattbasis, den Mangel der beiden Zähne, mit welchen die Seitenlappen des recenten Normalblattes versehen sind, die schmälere Blattlamina und den tiefer ausgeschnittenen Mittellappen. b) Forma obtusifolia Taf. I, Fig. 1. Findet sich in scharf ausgeprägten Analogien vertreten, leicht erkennbar durch den gerade abgeschnittenen Mittellappen. Die hierher gehörigen Blätter haben nur etwas spitzere Seitenlappen, stimmen jedoch sonst mit dem von Massalongo abgebildeten Fossile auffallend überein. Das Taf. I, Fig. 1 abgebildete Blatt besitzt einen etwas breiteren Mittellappen als die von Massalongo abgebildeten Formen und das Blatt von Meximieux. Auch an letzteres fand ich bedeutende Annäherungen, gut zu erkennen an der stumpfen Basis. Wie zwischen fast allen von mir beobachteten atavistischen Liriodendron-Blattformen, so zeigen sich auch zwischen den Formen acutiloba und obtusifolia zahlreiche Übergänge, hier erkennbar an mehreren Exemplaren durch die spitzer vorgezogene Basis, die tiefer eingeschnittenen Seitenbuchten, eine schwache
11 Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. 279 Ausbuchtung an der Spitze des Mittellappens und die unter spitzeren Winkeln abgehenden Secundärnerven. Wahrend sich dieses Blatt durch den abgeschnittenen Mittellappen dem recenten Normalblatte nähert. unterscheidet es sich von ihm ahnlich der vorstehenden Form durch den Mangel der Zahnung der Seitenlappen und die schmälere Lamina, wozu noch die stumpf abgerundete Basis kommt. In Bezug auf die Xervation herrscht eine gewisse Übereinstimmung. c) Forma incisa Tat'. I, Fig. 3, 8. Findet sich gut ausgeprägt vertreten und stimmt mit den fossilen Funden bis auf die etwas schärfer gespitzten Lappen gut überein. An dem von Massalongo 1. c. Tab. 39, Fig. 1 abgebildeten Exemplare zeichnen sich einige Secundärnerven durch einen schwach geschlängelten Verlauf aus, während unsere auf Tat'. I, Fig. 3, 8 abgebildeten Blätter dies vermissen lassen. Ausser den schon bei den früheren Formen erwähnten Unterschieden vom recenten Normalblatt tritt hier noch die tiefe Spaltung des Mittellappens hinzu. d) Forma rotundata Taf. I, Fig. 7; Tai'. II, Fig. 3. Das recente und fossile Blatt gleichen sich auffallend, nur besitzt ersteres, durch die weniger breite Lamina bedingte unter spitzten Winkeln abstehende Secundärnerven und seichtere Buchten. Die runde halbkreisförmige Basis und die querovale Form, sowie Anzahl und Verlauf der Secundärnerven lassen unser atavistisches Blatt mit aller Sicherheit als hierher gehörig erscheinen und unterscheiden es, abgesehen vom Mangel der Zahnung der untersten Lappen, scharf vom Normalblatt. Charakteristisch sind bei forma rotundata die hochgelegenen Seitenbuchten (Taf. I, Fig. 7). Hierher gehört auch das Taf. II, Fig. 3 abgebildete Blatt. Es unterscheidet sich vom Fossil durch die spitzen Ecken, den breiteren Mittellappen, sowie die wegstehenden stärker hervortretenden Seitenlappen, auch ist der dritte Secundärnerv (von unten gezählt) gabelig getheilt, was am Fossil nicht zu bemerken ist. Besagtes Blatt steht sonach dem fossilen Analogon ferner als die vorbeschriebenen Vertreter von forma rotundata und bildet einen ÜJbergang zu einem später unter den Analogien der Liriodendren der Kreide zu behandelnden Typus, worauf ich noch speciell zurückkommen werde. e) Forma integrifolia. Taf. I, Fig. 4. Dieses Formelement findet sich unter den von mir untersuchten Blättern ziemlich häufig; weicht jedoch vom fossilen darin auffallend ab, dass nicht wie bei letzterem jede Blatthälfte stumpf, sondern gespitzt endet. Zwischen den Spitzen befindet sich wie beim Fossil ein mehr oder weniger seichter Einschnitt. Fig. 4 besitzt ausserdem etwas steilere Secundärnerven als die von Saporta und Marion abgebildeten Formen. Wenn auch nicht alle beschriebenen Formelemente von Liriodendron Procaccinii unter den atavistischen Blattformen von Liriodendron ttilipiferum vertreten erscheinen, so sind doch in Obigem so viele Fälle genetischer Beziehungen von forma Procaccinii mit L. ttilipiferum auseinandergesetzt worden, dass ich mich der Überzeugung der Zusammengehörigkeit beider Arten nicht mehr zu verschliessen vermag. 2. Recente Analogien von Liriodendron Laramiense Ward. Taf. I, Fig. 6. Dieses fast nur nach seiner Nervation bestimmte Blatt lässt sich an dieser leicht aus meinem Material herausfinden. Die zur ungelappten Procaccinü-F'orm (forma integrifolia) gehörigen atavistischen Blätter besitzen eine auffallende Übereinstimmung in Bezug auf die Nervation mit L. laramiense, doch sind die Secundärnerven bei letzterer etwas weniger dick.
12 280 A d o If Noe v. Archen egg, B. Formelemente von Liriodendron tulipiferum, deren Analoga der Kreide angehören. 3. Recente Analogien von Liriodendron Meekii. Tai". I, Fig. 5. Unter den von mir untersuchten Blattformen ist dieses Formelement nicht rein erhalten, wohl aber in einer unverkennbaren Annäherung, und zwar weist besonders die verkehrt herzförmige Lamina und die viel stärker als bei Liriodendron Procaccinii forma acutiloba ausgezogene Blattbasis aufl. Meekii, was in so ausgesprochener Weise von keiner tertiären Blattform gezeigt wird (Taf. I, Fig. 5). Ferner deutet auf Meekii die tiefe, mehr gerundete Ausbuchtung an der Spitze des Blattes, während die Spitzen der Blatthälften, sowie die. noch immer ziemlich breite Lamina unverkennbar auf L. Procaccinii hinweisen. Das von mir abgebildete Blatt dürfte daher ein Mischform sein zwischen L. Meekii f. dbcordata, nachweisbar an der verkehrt herzförmigen und breiteren Lamina, sowie dem wie dort fast gleichen Verlaufe der Tertiärnerven, und L. Procaccinii f. ineisa, übereinstimmend durch die tiefe Ausrandung der Spitze, die in scharfe Spitzen endigenden Blatthälften und angedeutet durch die rudimentären Seitenlappen, sowie die geringen Ausbuchtungen vor letzteren. 4. Recente Analogien von Liriodendron intermedium. Taf. IV Fig. 1, 2, 3. Was ich bereits in der Einleitung hervorhob, nämlich, dass die Zahl der uns bekannten verweltlichen Formen aller Wahrscheinlichkeit nach verschwindend klein ist gegen die Zahl der wirklich vorhandenen, und dass es dementsprechend als ein glücklicher Zufall zu bezeichnen ist, wenn eine atavistische Form gerade eine der uns bekannten vorweltlichen Formen nachahmt, gilt besonders für diese Stelle. In vielen Fällen müssen wir uns damit begnügen, eine blosse Annäherung an eine uns bekannte fossile Form oder auch an mehrere nachzuweisen. Immerhin haben wir uns bei diesem und den folgenden Formelementen besonders vor Augen zu halten, dass wir wohl unverkennbare Annäherungen, jedoch nirgends so bedeutende Übereinstimmung zu verzeichnen haben, wie etwa bei manchen Procacciuii-Formen. Wenngleich jenes Extrem des Lirioele//i/ro//-Blattes, wie es Lesquereux unter obigem Namen beschreibt, nicht in gleicher Wiedergabe von mir gefunden wurde, so ist die Annäherung an diese so charakteristische Form derart deutlich und unverkennbar, dass jeder Zweifel über die atavistische Beziehung der abgebildeten Blätter schwinden nutss. Auf Taf. IV sind drei Blätter in Fig. 1 3 abgebildet, die eine auffallende Annäherung zu L. intermedium zeigen. Dieselben wurden dem eben erwähnten, durch wiederholte Frostwirkung beschädigten Aste a entnommen. Fig. 3 nähert sich dem Liriodendron intermedium am meisten, und zwar durch den an seiner Basis stark verengten Mittellappen und die schmalen Seitenlappen und Hälften des Mittellappens, besitzt jedoch eine viel gedrungenere Gestalt, eine stumpfere Ausbuchtung des Mittellappens und wie es scheint auch viel spitzer endende Lappen, sowie eine geringere Anzahl von Secundärnerven. Einen eingehenden Vergleich anzustellen vereitelt die mangelhafte Erhaltung des fossilen Abdruckes. Auch die Fig. 1 nähert sich noch bedeutend L. intermedium, die Einengung des Mittellappens tritt bereits merklich zurück, die Seitenlappen werden breiter und sämmtliche Lappen enden spitz mit einer unverkennbaren Tendenz nach aufwärts. Durch letztgenannte Eigenschaften nähert sich dieses Blatt bereits den später zu behandelnden Formelementen L. giganteum und L. ertteiforme, und bildet so einen Übergangstypus von L. intermedium zu den genannten Formen. Fig. 2 derselben Tafel zeigt einen Übergang von L. intermedium zu dem tertiären Formelement L. Procaccinii, welch' letztere Form erkennbar ist an der mehr isodiametrischen Form des Blattes und den nahezu rechtwinklig eingeschnittenen Buchten, während die Form der Lappen, sowie die Nervation auf L intermedium verweisen. Obgleich die Nervation der atavistischen Blätter des Formelementes L. intermedium noch immer eine grosse Ähnlichkeit mit der des recenten Normalblattes besitzt, gehört dieses Formelement zu denen, welche sich in Bezug auf die Gestalt von dem
13 Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. 281 recenten Blatte am meisten entfernen. Unter dem mir vorliegenden Materiale traf ich noch grossere als die abgebildeten Exemplare an. 5. Recente Analogien von Liriodendron crueiforme. Tat'. III, Fig. 1, 2. Obschon ein genauer Vergleich wegen des Alangels einer Abbildung des fossilen Blattes hier unmöglich ist und ich mich einzig an die Beschreibung Lesquereux's halten muss, so glaube ich doch den oben stark erweiterten und an der Spitze abgeschnittenen Mittellappen, das charakteristische Merkmal nach der Beschreibung, an dem abgebildeten Blatte wiederzuerkennen. Einen Übergang zu Liriodendron intermedium stellt Taf. III, Fig. 2 dar. Hier sehen wir bereits einen ausgeprägten Ausschnitt an der Spitze des Blattes und die Ecken des Mittellappens merklich gespitzt. Auf Taf. II, Fig. 1 ist die Spitze eines recenten Normalblattes zum Vergleiche abgebildet. (3. Recente Analogie von Liriodendron giganteum. Taf. II, Fig. 2. Wie bereits in der Beschreibung der fossilen Formen von L. giganteum hervorgehoben wurde, ist die Beobachtung am atavistischen Blatte hier in der Lage, eine Correction der von Lesquereux gemachten Bestimmung vorzunehmen. Unter den im Garten der Frau v. Karajan gesammelten Blättern befinden sich Exemplare, die der Gesammtansicht nach den beiden vorher beschriebenen Formen gleichen, deren Seitenlappen jedoch mit dem L. giganteum genannten fossilen Blattfragmente eine auffallende Ähnlichkeit besitzen. Vergleichen wir z. B. die auf Taf. II, Fig. 2 und auch Taf. III, Fig. 2 abgebildeten Blätter mit dem Fossil, so finden wir hier wie dort, abgesehen von der Übereinstimmung der Grösse, dieselbe flügelarti^e Form, die gleichen bogiggekrümmten Ränder; nur scheinen die Spitzen der Seitenlappen bei der fossilen Form rundlicher gewesen zu sein, was sich wegen der Mangelhaftigkeit des Fossils nicht absolut genau sagen lässt. Wir finden auch den gleichen Verlauf der Secundärnerven, abgesehen davon, dass beim fossilen Blatte der oberste Secundärnerv des Seitenlappens, d. h. der vierte von unten gezählt, scharf und deutlich hervortritt und in einer den übrigen Secundärnerven annähernd gleichen Stärke ausgeprägt ist, während an unserem atavistischen Blatte der entsprechende Nerv nur durch eine schlingenläufige Verbindung der randläufigen Tertiärnerven angedeutet ist. Sonst zeigen die Secundärnerven hier wie dort dieselbe starke Ausbildung. Aus all dem zu schliessen, dürfen wir die oben aufgestellte Behauptung, dass das Liriodendron giganteum genannte Fossil der untere Seitenlappen und nicht wie Lesquereux annimmt die Hälfte des Mittellappens eines Liriodendron-Bl&ttes sei, als sicher gelten lassen. Das Blatt, zu dem es gehörte, dürfte eine dem von Liriodendron intermedium ähnliche Form gehabt haben und sehr gross gewesen sein. Auch die Seitenlappen des als eine Annäherung an L. crueiforme dargestellten Blattes (Taf. III, Fig. 2) weisen eine bedeutende Ähnlichkeit mit L. giganteum auf. Wenn schon die hier abgebildeten Blätter das Normalblatt um ein Beträchtliches an Grösse überschreiten, so habe ich dennoch ein Blatt gefunden, welches noch grössere Dimensionen aufwies und sich auch in Beziehung auf die Ausbildung des Mittellappens ganz an L. intermedium anschloss. Warum das citirte von Lesquereux beschriebene Blattfragment nicht etwa die Hälfte des Mittel- (Ober-)Lappens sein kann, geht aus der Form der atavistischen Blätter hervor, von denen keine einen derartigen Schluss erlauben würde, und aus dem Verlaufe des oberen Randes des fossilen Fragmentes, der in eine kleine Bucht endigt, die nur als zur Einengung der Basis des Mittellappens gedacht werden kann, jedoch nicht zur Ausrandung des Mittellappens. Auch ist der Verlauf der Secundärnerven im Oberlappen stets viel steiler als hier. 7. Recente Analogie von Liriodendron (Liriophyllumi populoides. Taf. IV, Fig. 4. Hier ist ein Blatt abgebildet, welches gewisse Anklänge an dieses Formelement verräth, nämlich die beiden Hälften des Mittellappens zeigen die Tendenz zu einer ohrförmigen Bildung. Das Blatt besitzt im Übrigen eine dem vorherbeschriebenen ähnliche Form. Es lässt sich unschwer von diesem Blatte ein Über- Denkschriften der mathem.-naturw. Ct. LXI. Bd. 36
14 : 282 A dolf Noe r. A rchenegg, gang zu Liriophyllum populoides denken, und ich glaube mit einer gewissen Berechtigung, diese Art bei Liriodendron unterbringen zu dürfen, natürlich nur auf Grund von Annahmen, die bei der Unsicherheit des Falles und der diesbezüglichen Schlüsse keine exacte Begründung zulassen. Jedenfalls dürfte aber nach dem Gesagten der Name Liriodendron passender sein als Liriophyllum. Es erübrigt uns noch die Verwerthung der im Vorhergehenden enthaltenen Thatsachen zur Beurtheilung der bisher aufgestellten fossilen Liriodendron-Avten. Manche Kreideformen, z.b. forma intermedia oder crueiformis, möchten von vielen Beobachtern, einzelnen Formelementen des Tertiärs, wie z. B. forma acutiloba und obtasifolia gegenübergestellt, als eigene Arten angesprochen werden; ziehen wir jedoch die übrigen bekannten Formen in Übergänge zwischen Kreide- und Tertiärformen. wir sie mit formaafem genuiua. Betracht, so ergeben sich zahlreiche Fassen wir z.b. forma intermedia ins Auge und vergleichen Abgesehen von derverschiedenheit in der Grösse ergeben sich bedeutende Ähnlichkeiten. Wir finden hier wie dort die in die Länge gezogene, in der Mitte stark verengte Lamina, die tief angesetzten Seitenlappen, sowie den tiefen Einschnitt an der Spitze des Blattes und die parallelen unter spitzem Winkel ausgehenden Secundärnerven, so dass sich beide Formen im Gesammteindruck des Blattes bedeutend nähern und den Übergang von Liriodendron Meekii zu L. intermedium veranschaulichen. Um von L. Meekii zu L. Procaccinii zu kommen, betrachten wir uns L. Meekii f. primaeva und L. Procaccinü f. omusifolia, von letzterer Form besonders das von Saporta und Marion 1. c. Taf. 33, Fig. 4 abgebildete Blatt. Auch hier fällt uns sofort eine ausserordentliche Übereinstimmung auf. Beide Formen zeichnen sich durch eine breite Lamina, stumpfe Lappen und seichte Buchten aus; allerdings sind letztere bei forma obtnsifolia näher gegen die Spitze geschoben, als bei forma primaeva des Afe^'/V-Blattes. Ebenso besitzen beide Formen unter spitzen Winkeln ausgehende parallele Secundärnerven. Wir haben hier wieder einen Übergang von L. Meekii der Kreide zu L. Procaccinii des Tertiärs. Da auch die Glieder der den einzelnen fossilen Arten angehörenden Formenkreise Übergänge untereinander besitzen, so stellen die fossilen Blattformen von Liriodendron eine continuirliche Reihe, deren typische Formen durch Übergänge verbunden sind, dar. Diese Thatsache berechtigt uns, sämmtliche fossile Liriodendron-Formen, die bis jetzt als selbständige Arten beschrieben und benannt werden, in eine einzige zusammenzuziehen, welche Urform des heutigen Tulpenbaumes wir nach dem ältesten von Unger aufgestellten Artnamen L. Procaccinii nennen können. Übergangsformen zwischen den einzelnen fossilen Formen bieten uns auch die atavistischen Blattformen, z. B. zwischen L. Procaccinii forma rotundata und forma intermedia u. s. w. Dieselben vermitteln jedoch auch den Übergang zwischen der recenten Normalform und den fossilen Formen, von welch' letzteren sich forma islandica ohnehin der jetztlebenden Form genugsam nähert. Es drängt sich naturgemäss die Frage auf, ob denn bei so innigen genetischen Beziehungen der Urform, L. Procaccinii zu L. tulipiferum (Normalblatt), beide Arten nicht in Eine zusammenzufassen wären. Eine bestimmte Antwort können wir bei dem relativ wenigen zur Verfügung stehenden Materiale, sowie dem Fehlen der übrigen Organe (Früchte wurden nur wenige gefunden) noch nicht ertheilen, obwohl dieselbe meiner Ansicht nach nur im bejahenden Sinne ausfallen könnte. finden Nachstehend möge noch eine kurze Zusammenstellung der gewonnenen Resultate ihren Platz 1. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Entwicklungshemmnisse zum Entstehen atavistischer Bildungen bei den Pflanzen Anlass geben. In einem Falle ist der Nachweis geliefert worden, dass die wiederholten Einwirkungen des Hemmnisses weiter zurückgreifende atavistische Erscheinungen hervorrufen. 2. Die atavistischen Bildungen führten in einigen Fällen zur richtigeren Auffassung der entsprechenden fossilen Formen,
15 Atavistische Blattformen des Tulpenbawmes Durch die untersuchten atavistischen Blattformen bei Liriodendron tulipiferum ist die phylogenetische Beziehung dieser Art zu ihrer vorweltlichen Stammart festgestellt worden. 4. Die vorweltliche Stammart gliedert sich in eine Anzahl von Formelementen, welche bisher meist als selbstständige Arten beschrieben worden sind. Es wird vorgeschlagen, dieselbe mit Liriodendron Procaccinii, als dem ältesten von Unger gegebenen Artnamen, zu bezeichnen. Zum Schlüsse erachte ich es für eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Chef und Lehrer, Herrn Regierungsrath Professor Dr.Constantin Freiherrn von Ettingshausen, meinen tiefgefühlten Dank für die meiner Arbeit angediehene grosse Förderung und die gütige Erlaubniss, seine reichen Lehrmittel verwenden zu dürfen, Ausdruck zu geben. 36*
16 284 Adolf Noe v. Archenegg, Atavistische Blattformeii des Tulpenbattmes. ERKLÄRUNG DER TAFELN. TAFEL I. Fig. 1. Liriodendron tulipiferum L., forma obtusifolia, entsprechend dem gleichnamigen Formelement von L. Prccaccinii Ung. der Tertiärflora.»2.»»»» aatlilöba, entsprechend dem gleichnamigen Formelement von L. Procaccinii. 3 u. 8.»»»» incisa, entsprechend dem gleichnamigen Formelement von L. Procaccinii. 4.»»» integrifolia. entsprechend dem gleichnamigen Formelement von L. Procaccinii. 5.»»» Meclüi, entsprechend dem Z. Meekii, Forma öbcordata der Kreideflora. 6.»»»» Laramiensis, entsprechend dem L. Laramiense der Tertiärflora. 7.»» j> rottmdata, entsprechend dem gleichnamigen Formelement von L. Procaccinii. Sämmtliche Exemplare aus dem Garten der Frau Baronin Wüllerstorff in Graz. TAFEL II. Fig. 1. Liriodendron tulipiferum L., Spitze des Normalblattes. 2.» forma gigantea, entsprechend dem L. giganteum Lesq. der Kreideflora. 3.»»»» rotundata, entsprechend dem gleichnamigen Formelement von L. Procaccinii der Tertiärflora. Fig. 1 stammt aus dem Garten der Frau Baronin Wüllerstorff; Fig. 2 und 3 wurden im Garten der Frau v. Karajan im Sommer 1891 gesammelt, und zwar Fig. 2 vom Aste a, welcher durch Frost wiederholt beschädigt worden ist; Fig. 3 vom nur einmal dadurch beschädigten Aste b. TAFEL III. Fig. 1. Liriodendron tulipiferum L., forma cniciformis, entsprechend dem X. crueiforme Lesq. der Kreideflora. 2.» Übergang der Forma crueiformis zur Forma intermedia. Beide Exemplare wurden im Garten der Frau v. Karajan vom Aste a im Sommer 1892 gesammelt. TAFEL IV. Fig. 1. Liriodendron tulipiferum L., forma intermedia, entsprechend dem L. inlermediuni Lesq. der Kreideflora, mit Tendenz zur Forma gigantea und crueiformis. 2.»» >» intermedia, mit ausgesprochener Tendenz zur Forma rotundata.» 3.» >» intermedia. 4. Analogie zu L. ( Liriophyllum) populoides Lesq. wegen der einförmigen Ausbildung der Hälften des Mittellappens. Alle Exemplare wurden im Garten der Frau v. Karajan vom Aste a im Sommer 1893 gesammelt. ^OC^X>^-
17 A. Noe V. Archenegg: Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. Taf. Nalurselbstdi uck. i v. fe. Hof- und Staatsdruckerei. Denkschriften d. k. Akad. d. W., math.-naturw. Gasse, Bd. LXI.
18
19 A. Noe v. Archenegg: Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. Taf. II. Naturselbstdruck. Aus t/n k. <-. Hof- uuj Staalsdrttckerei. Denkschriften d. k. Akad. d. \\'., math.-naturw. Gasse. Bd. LXJ.
20
21 A. Noe V. Archenegg: Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. Taf. III. Naturselbsidrttck. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei Denkschriften d. k. Akacl. d. W., math.-naturw. Classe, Bd. LXI.
22
23 A. Noe V. Archenegg: Atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. Taf. IV Natursclbstd Ans der lt. t. Hof- und Staatsdructcrei. Denkschriften d. k. Akad. d. W., math.-naturw. (lasse, Bd. LXI.
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein
 Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
FORMELEMENTE DER EUROPÄISCHEN TERTIÄRBUCHE.
 DIE FORMELEMENTE DER EUROPÄISCHEN TERTIÄRBUCHE. (FAGUS FERONIAE Ung.). VON Prof. Dr. CONSTANTIN Freih. v. ETTINGSH AUSEN, C. M. K. AKAD. (STCit 4 Saftln.) VORGELEGT IX DER SITZUNG AM 12. OCTOBER 1893.
DIE FORMELEMENTE DER EUROPÄISCHEN TERTIÄRBUCHE. (FAGUS FERONIAE Ung.). VON Prof. Dr. CONSTANTIN Freih. v. ETTINGSH AUSEN, C. M. K. AKAD. (STCit 4 Saftln.) VORGELEGT IX DER SITZUNG AM 12. OCTOBER 1893.
Studien über Quercetin und seine Derivate
 198 Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at Studien über Quercetin und seine Derivate (VI. Abhandlung) von Dr. J. Herzig. Aus dem I. Chemischen Universitätslaboratorium in
198 Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at Studien über Quercetin und seine Derivate (VI. Abhandlung) von Dr. J. Herzig. Aus dem I. Chemischen Universitätslaboratorium in
BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL.
 XXIII. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI 926. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL. Von Dr. LADISLAUS SZALAY. (Mit 3 Textfiguren.) In dem Moment, als eine Hydracarine aus
XXIII. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI 926. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL. Von Dr. LADISLAUS SZALAY. (Mit 3 Textfiguren.) In dem Moment, als eine Hydracarine aus
worden, zuerst von Boucher de Perthes; und dies ist die unentbehrliche Grundlage zum Verständnis seines Ursprungs. Ich werde daher diesen Beweis für
 worden, zuerst von Boucher de Perthes; und dies ist die unentbehrliche Grundlage zum Verständnis seines Ursprungs. Ich werde daher diesen Beweis für erbracht annehmen und darf wohl meine Leser auf die
worden, zuerst von Boucher de Perthes; und dies ist die unentbehrliche Grundlage zum Verständnis seines Ursprungs. Ich werde daher diesen Beweis für erbracht annehmen und darf wohl meine Leser auf die
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften?
 Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4)
 Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
FRANZ KRASAN. P LI OCÄN- BUCHE DER AUVERGNE DIE VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 14. DECEMP.ER 1893.
 45 DIE P LI OCÄN- BUCHE DER AUVERGNE VON FRANZ KRASAN. (9TUJ i Jafe-t.) VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 14. DECEMP.ER 1893. Durch freundliche Vermittlung des Herrn Prof. Freih. Const. v. Ettingshausen kam
45 DIE P LI OCÄN- BUCHE DER AUVERGNE VON FRANZ KRASAN. (9TUJ i Jafe-t.) VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 14. DECEMP.ER 1893. Durch freundliche Vermittlung des Herrn Prof. Freih. Const. v. Ettingshausen kam
Notizen Dessau. Interessante Funde Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora,
 Notizen Dessau Nr. 4 Interessante Funde 2015 Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora, Eryngium planum L. Das Grundstück Mannheimer Straße Ecke Junkers-Straße ist bis auf
Notizen Dessau Nr. 4 Interessante Funde 2015 Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora, Eryngium planum L. Das Grundstück Mannheimer Straße Ecke Junkers-Straße ist bis auf
. 2. Die Ebene. Der Strahlenbüschel und der Ebenenbüschel.
 7 die Fläche getrennt ist. Ein Halbstrahlenbündel wird durch eine Fläche der erwähnten Art in ein Paar Scheitelräume getheilt, welche einen gemeinschaftlichen Mantel haben, daher die beiden Hälften eines
7 die Fläche getrennt ist. Ein Halbstrahlenbündel wird durch eine Fläche der erwähnten Art in ein Paar Scheitelräume getheilt, welche einen gemeinschaftlichen Mantel haben, daher die beiden Hälften eines
Definitionen. 1. Ein Punkt ist, was keine Teile hat. 3. Die Enden einer Linie sind Punkte.
 Das erste der dreizehn Bücher von Euklids Elementen beginnt nach der Ausgabe in Ostwald s Klassikern der exakten Wissenschaften (Nr. 235), Leipzig 1933, folgendermaßen: Definitionen. 1. Ein Punkt ist,
Das erste der dreizehn Bücher von Euklids Elementen beginnt nach der Ausgabe in Ostwald s Klassikern der exakten Wissenschaften (Nr. 235), Leipzig 1933, folgendermaßen: Definitionen. 1. Ein Punkt ist,
Neuropathologie. und. Gynaekologie. Eine kritische Zusammenstellung ihrer. physiologischen und pathologischen Beziehungen. Von
 Neuropathologie und Gynaekologie. Eine kritische Zusammenstellung ihrer physiologischen und pathologischen Beziehungen. Von DR med. FRANZ WINDSCHEID Privatdocenten für Neuropathologie an der Universität
Neuropathologie und Gynaekologie. Eine kritische Zusammenstellung ihrer physiologischen und pathologischen Beziehungen. Von DR med. FRANZ WINDSCHEID Privatdocenten für Neuropathologie an der Universität
Pflanzenmerkmale. Überblick. Lernziele. Unterrichtsverlauf. Artenvielfalt
 MODUL 1: Lernblatt D 1/2/3/4/5 Artenvielfalt Pflanzenmerkmale Zeit 2 Stunden ORT Eine Grünfläche in der Nähe der Schule z. B. Park, Garten, Waldrand, Wiese Überblick Das erste Modul ist dazu gedacht, die
MODUL 1: Lernblatt D 1/2/3/4/5 Artenvielfalt Pflanzenmerkmale Zeit 2 Stunden ORT Eine Grünfläche in der Nähe der Schule z. B. Park, Garten, Waldrand, Wiese Überblick Das erste Modul ist dazu gedacht, die
und im Bau der Extremitäten hervortritt. Die mittleren Backzähne ihm entgegenarbeitende erste untere Molar als Reißzähne" mit
 SP a" CD f Q Ol o 2 p et- 199 Sinopa rapax Leidy. Mit 4 Abbildungen. Die Raubtiere der Gegenwart bilden, wenn man von den Omnivoren Bären absieht, trotz aller Mannigfaltigkeit eine einheitliche Gruppe,
SP a" CD f Q Ol o 2 p et- 199 Sinopa rapax Leidy. Mit 4 Abbildungen. Die Raubtiere der Gegenwart bilden, wenn man von den Omnivoren Bären absieht, trotz aller Mannigfaltigkeit eine einheitliche Gruppe,
. 4. Von den necken, nkanten und Polyedern.
 18 ebenenbüschel projicirt. Jedes begrenzte Stück der Geraden wird im erstem Falle durch einen Parallelstreifen, im letztern aber durch einen Parallelraum projicirt, welchen dasselbe spannt. Ein ebenes
18 ebenenbüschel projicirt. Jedes begrenzte Stück der Geraden wird im erstem Falle durch einen Parallelstreifen, im letztern aber durch einen Parallelraum projicirt, welchen dasselbe spannt. Ein ebenes
Kapitel 13. Lineare Gleichungssysteme und Basen
 Kapitel 13. Lineare Gleichungssysteme und Basen Matrixform des Rangsatzes Satz. Sei A eine m n-matrix mit den Spalten v 1, v 2,..., v n. A habe den Rang r. Dann ist die Lösungsmenge L := x 1 x 2. x n x
Kapitel 13. Lineare Gleichungssysteme und Basen Matrixform des Rangsatzes Satz. Sei A eine m n-matrix mit den Spalten v 1, v 2,..., v n. A habe den Rang r. Dann ist die Lösungsmenge L := x 1 x 2. x n x
Exkursion Bäume erkennen im Herbst am
 Exkursion Bäume erkennen im Herbst am 10.11.2018 Insgesamt 20 Personen trafen sich an der Friedhofskapelle Feldstraße im Schatten großer Hainbuchen zu dieser Exkursion, auf der unter Leitung von Dr. Agnes-M.
Exkursion Bäume erkennen im Herbst am 10.11.2018 Insgesamt 20 Personen trafen sich an der Friedhofskapelle Feldstraße im Schatten großer Hainbuchen zu dieser Exkursion, auf der unter Leitung von Dr. Agnes-M.
Alten Fliederstrauch verjüngen
 Alten Fliederstrauch verjüngen Im Allgemeinen blüht Flieder (Syringa vulgaris) jahrelang schön, vor allem wenn die abgeblühten Blütenstände raschest entfernt werden. Die verwelkten Blüten werden vorsichtig
Alten Fliederstrauch verjüngen Im Allgemeinen blüht Flieder (Syringa vulgaris) jahrelang schön, vor allem wenn die abgeblühten Blütenstände raschest entfernt werden. Die verwelkten Blüten werden vorsichtig
Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an
 Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar Sagen Sie dann Ihre Meinung Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein Reagieren Sie
Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar Sagen Sie dann Ihre Meinung Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein Reagieren Sie
Die wichtigsten Spalierformen
 Die wichtigsten Spalierformen im Überblick Doppelte U-Form Als Pflanzmaterial dient eine einjährige Veredlung. Der Trieb wird auf eine Länge von etwa 30 cm zurückgeschnitten (Abb. 1). Wichtig ist, dass
Die wichtigsten Spalierformen im Überblick Doppelte U-Form Als Pflanzmaterial dient eine einjährige Veredlung. Der Trieb wird auf eine Länge von etwa 30 cm zurückgeschnitten (Abb. 1). Wichtig ist, dass
dem hinteren Ende des Sinus petrosus inferior ausserhalb
 Über?ine constante Verbindung- des Sinus cavernosus etc. Über eine constante Verbindung des Sinus cavernosus mit dem hinteren Ende des Sinus petrosus inferior ausserhalb des Schädels. Von Dr. J. Englisch,
Über?ine constante Verbindung- des Sinus cavernosus etc. Über eine constante Verbindung des Sinus cavernosus mit dem hinteren Ende des Sinus petrosus inferior ausserhalb des Schädels. Von Dr. J. Englisch,
Untersuche, aus welchen Teilen eine Blüte aufgebaut ist und wie diese Teile angeordnet sind.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 1 Untersuchung von Pflanzen und Tieren (P8010000) 1.1 Untersuchung einer Blüte Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:01:04 intertess (Version
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 1 Untersuchung von Pflanzen und Tieren (P8010000) 1.1 Untersuchung einer Blüte Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:01:04 intertess (Version
3.3 Austauschsatz, Basisergänzungssatz und Dimension
 66 Kapitel III: Vektorräume und Lineare Abbildungen 3.3 Austauschsatz, Basisergänzungssatz und Dimension Montag, 15. Dezember 2003 Es sei V ein Vektorraum. Jedes Teilsystem eines linear unabhängigen Systems
66 Kapitel III: Vektorräume und Lineare Abbildungen 3.3 Austauschsatz, Basisergänzungssatz und Dimension Montag, 15. Dezember 2003 Es sei V ein Vektorraum. Jedes Teilsystem eines linear unabhängigen Systems
MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES
 161 MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES Botanisches Institut der Universität, Szeged (Eingegangen: 15. April, 1959).. Einleitung
161 MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES Botanisches Institut der Universität, Szeged (Eingegangen: 15. April, 1959).. Einleitung
1 Vektorrechnung als Teil der Linearen Algebra - Einleitung
 Vektorrechnung als Teil der Linearen Algebra - Einleitung www.mathebaustelle.de. Einführungsbeispiel Archäologen untersuchen eine neu entdeckte Grabanlage aus der ägyptischen Frühgeschichte. Damit jeder
Vektorrechnung als Teil der Linearen Algebra - Einleitung www.mathebaustelle.de. Einführungsbeispiel Archäologen untersuchen eine neu entdeckte Grabanlage aus der ägyptischen Frühgeschichte. Damit jeder
Mit Versuchen zur Bewurzelung von Eichen- und Buchenstecklingen
 (Aus dem Lehrforstamt Bramwald in HemelnIHann. Münden) Versuche zur Bewurzelung von Eichen- und Buchenstedrlingen Von J. KRAHL-URBAN (Eingegangen am 11. 6. 1957) Ziel der Versuche, die seit dem Jahre 1950
(Aus dem Lehrforstamt Bramwald in HemelnIHann. Münden) Versuche zur Bewurzelung von Eichen- und Buchenstedrlingen Von J. KRAHL-URBAN (Eingegangen am 11. 6. 1957) Ziel der Versuche, die seit dem Jahre 1950
Beobachtungen zum Einfluss der einheimischen Begleitvegetation auf die Entwicklung von jungen Ginkgo biloba Pflanzen
 Beobachtungen zum Einfluss der einheimischen Begleitvegetation auf die Entwicklung von jungen Ginkgo biloba Pflanzen Beobachtet auf dem Grundstück Mollesnejta(~2800m ü. NN) im Tal von Cochabamba, Bolivien
Beobachtungen zum Einfluss der einheimischen Begleitvegetation auf die Entwicklung von jungen Ginkgo biloba Pflanzen Beobachtet auf dem Grundstück Mollesnejta(~2800m ü. NN) im Tal von Cochabamba, Bolivien
StAAG DE02/0206/08 1. Departement Bildung, Kultur und Sport Staatsarchiv Aargau
 StAAG DE02/0206/08 1 StAAG DE02/0206/08 2 Nr. 407 Hochverehrter Herr Erziehungsdirektor! Nachdem ich diesen Winter neben meinen Vorlesungen an der Universität mich soviel es mir möglich war, für die Maturitätsprüfung
StAAG DE02/0206/08 1 StAAG DE02/0206/08 2 Nr. 407 Hochverehrter Herr Erziehungsdirektor! Nachdem ich diesen Winter neben meinen Vorlesungen an der Universität mich soviel es mir möglich war, für die Maturitätsprüfung
"EINFLÜSSE DER PSYCHE AUF DIE MATERIE":
 "EINFLÜSSE DER PSYCHE AUF DIE MATERIE": "Unerklärliche Einflüsse der Psyche auf die Materie": von Klaus-Dieter Sedlacek: Dass es unerklärliche Erscheinungen mit Beeinflussung 1 der Materie durch die Psyche
"EINFLÜSSE DER PSYCHE AUF DIE MATERIE": "Unerklärliche Einflüsse der Psyche auf die Materie": von Klaus-Dieter Sedlacek: Dass es unerklärliche Erscheinungen mit Beeinflussung 1 der Materie durch die Psyche
Über die Summation der Reihen, die in dieser Form enthalten sind
 Über die Summation der Reihen, die in dieser Form enthalten sind a + a 4 + a3 9 + a4 + a5 5 + a 3 + etc Leonhard Euler Aus diesen Dingen, welche ich einst als erster über die Summation der Potenzen der
Über die Summation der Reihen, die in dieser Form enthalten sind a + a 4 + a3 9 + a4 + a5 5 + a 3 + etc Leonhard Euler Aus diesen Dingen, welche ich einst als erster über die Summation der Potenzen der
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen
 Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen?
 Pflanzzeit Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen? Der richtige Zeitpunkt für die Pflanzung ist zum einen abhängig vom Typ der Pflanze. Dabei geht es weniger darum, ob es sich um eine Baumpflanzung
Pflanzzeit Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen? Der richtige Zeitpunkt für die Pflanzung ist zum einen abhängig vom Typ der Pflanze. Dabei geht es weniger darum, ob es sich um eine Baumpflanzung
Die Schüler arbeiten selbstständig mithilfe von gezielten Impulsen und Beobachtungsaufga- VORSCHAU
 Inhalt: für ihre Umwelt zu sensibilisieren. Das Erlebnis, selbst die Gemeinsamkeiten aller Blüten- Die Schüler arbeiten selbstständig mithilfe von gezielten Impulsen und Beobachtungsaufga- biologisch richtig
Inhalt: für ihre Umwelt zu sensibilisieren. Das Erlebnis, selbst die Gemeinsamkeiten aller Blüten- Die Schüler arbeiten selbstständig mithilfe von gezielten Impulsen und Beobachtungsaufga- biologisch richtig
Heft 2 Komplexaufgaben
 Heft 2 Komplexaufgaben Du musst vier Aufgaben bearbeiten. Eine Aufgabe wurde durchgestrichen und darf nicht bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt auf dem bereitliegenden, gestempelten
Heft 2 Komplexaufgaben Du musst vier Aufgaben bearbeiten. Eine Aufgabe wurde durchgestrichen und darf nicht bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt auf dem bereitliegenden, gestempelten
Gruppenstruktur und Gruppenbild
 Prom. Nr. 2155 Gruppenstruktur und Gruppenbild VON DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN ZÜRICH ZUR ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS DER MATHEMATIK GENEHMIGTE PROMOTIONSARBEIT VORGELEGT VON Hans
Prom. Nr. 2155 Gruppenstruktur und Gruppenbild VON DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN ZÜRICH ZUR ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS DER MATHEMATIK GENEHMIGTE PROMOTIONSARBEIT VORGELEGT VON Hans
gehen vom Stege v v über den Sattel
 008 a, Beschreibung einer neuen Harfe i q f n o /. Fig: 1:/ sind die Wände eines Resonanz - Kastens, die noch durch das feste Kreuzholz k p m s verbunden sind. i k l m n o und p q f s r sind zwei Resonanzböden,
008 a, Beschreibung einer neuen Harfe i q f n o /. Fig: 1:/ sind die Wände eines Resonanz - Kastens, die noch durch das feste Kreuzholz k p m s verbunden sind. i k l m n o und p q f s r sind zwei Resonanzböden,
24 KAPITEL 2. REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN
 24 KAPITEL 2. REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN x 2 = 0+x 2 = ( a+a)+x 2 = a+(a+x 2 ) = a+(a+x 1 ) = ( a+a)+x 1 = x 1. Daraus folgt dann, wegen x 1 = x 2 die Eindeutigkeit. Im zweiten Fall kann man für a 0 schreiben
24 KAPITEL 2. REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN x 2 = 0+x 2 = ( a+a)+x 2 = a+(a+x 2 ) = a+(a+x 1 ) = ( a+a)+x 1 = x 1. Daraus folgt dann, wegen x 1 = x 2 die Eindeutigkeit. Im zweiten Fall kann man für a 0 schreiben
1.1 Im Einzelstand mächtiger Baum, manchmal mit bogenförmigen Ästen an der Stammbasis; im Bestand gerader Stamm, Äste nur im oberen Teil (Abb.
 Populus nigra L. I. Alte Bäume am natürlichen Standort 1 Habitus 1.1 Im Einzelstand mächtiger Baum, manchmal mit bogenförmigen Ästen an der Stammbasis; im Bestand gerader Stamm, Äste nur im oberen Teil
Populus nigra L. I. Alte Bäume am natürlichen Standort 1 Habitus 1.1 Im Einzelstand mächtiger Baum, manchmal mit bogenförmigen Ästen an der Stammbasis; im Bestand gerader Stamm, Äste nur im oberen Teil
W o r k s h o p P r i m a r s t u f e 3-4
 Workshop 1 (WS1) : Bäume erkennen Es existieren zahlreiche unterschiedliche Bäume. In diesem Projekt wirst du dich auf eine einzige Art konzentrieren. Dazu musst du aber fähig sein deine Baumart zu erkennen
Workshop 1 (WS1) : Bäume erkennen Es existieren zahlreiche unterschiedliche Bäume. In diesem Projekt wirst du dich auf eine einzige Art konzentrieren. Dazu musst du aber fähig sein deine Baumart zu erkennen
David Hume zur Kausalität
 David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
71. Pontosphaera indooceanica Čepek (1973)
 71. Pontosphaera indooceanica Čepek (1973) Pl. 1, figs 1-4 Figs. 1-4. Pontosphaera indooceanica n. sp. Fig. 1. Distale Ansicht, Holotypus. Indischer Ozean ("Meteor"-Reise, 1965), Kolbenlotkern KK-167,
71. Pontosphaera indooceanica Čepek (1973) Pl. 1, figs 1-4 Figs. 1-4. Pontosphaera indooceanica n. sp. Fig. 1. Distale Ansicht, Holotypus. Indischer Ozean ("Meteor"-Reise, 1965), Kolbenlotkern KK-167,
ADOLF MICHAELIS. zum 22. Juni 1905.
 ADOLF MICHAELIS zum 22. Juni 1905. Συν τε όν ερχομένω και τε προ δ του ενόηοεν. Du hast es einst als Motto einer gemeinsamen Arbeit für unsern amico e compagno di viaggio gewählt. Der Freund und Gefährte
ADOLF MICHAELIS zum 22. Juni 1905. Συν τε όν ερχομένω και τε προ δ του ενόηοεν. Du hast es einst als Motto einer gemeinsamen Arbeit für unsern amico e compagno di viaggio gewählt. Der Freund und Gefährte
post modern Dresden Übersicht der Typen der Erstausgabe: Viererblock Frauenkirche 2002
 post modern Dresden Übersicht der Typen der Erstausgabe: Viererblock Frauenkirche 2002 Version 1.0 Stand: 02. 01. 2017 Seite 1 Impressum Diese Übersicht und alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen
post modern Dresden Übersicht der Typen der Erstausgabe: Viererblock Frauenkirche 2002 Version 1.0 Stand: 02. 01. 2017 Seite 1 Impressum Diese Übersicht und alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen
Kausalität: Verhältnis von Ursache und Wirkung
 Kausalität: Verhältnis von Ursache und Wirkung Einleitung Wenn jemand einen Ball fallen lässt wisst ihr sicherlich jedesmal ungefähr, wohin der Ball fällt. Wisst ihr das auch, wenn ein Blatt Papier fallengelassen
Kausalität: Verhältnis von Ursache und Wirkung Einleitung Wenn jemand einen Ball fallen lässt wisst ihr sicherlich jedesmal ungefähr, wohin der Ball fällt. Wisst ihr das auch, wenn ein Blatt Papier fallengelassen
Naturwiss.-med. Ver. Innsbruck; download unter
 lieber die geometrische Bedeutung der complexen Elemente der analytischen Geometrie. (Auszug aus dem Vortrage in der Sitzung v. 20. Februar 1890) von Prof. Dr. 0. Stolz. Genügen zweien algebraischen Gleichungen
lieber die geometrische Bedeutung der complexen Elemente der analytischen Geometrie. (Auszug aus dem Vortrage in der Sitzung v. 20. Februar 1890) von Prof. Dr. 0. Stolz. Genügen zweien algebraischen Gleichungen
Einige Beobachtungen über die Aufarbeitung und Verwahrung des Brennholzes.
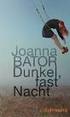 Einige Beobachtungen über die Aufarbeitung und Verwahrung des Brennholzes. Von O. Heikinheimo. Der Wassergehalt des Holzes übt öfters eine nachteilige Wirkung auf den Transport, die Aufbewahrung und die
Einige Beobachtungen über die Aufarbeitung und Verwahrung des Brennholzes. Von O. Heikinheimo. Der Wassergehalt des Holzes übt öfters eine nachteilige Wirkung auf den Transport, die Aufbewahrung und die
Danach drei oder vier Leitäste festlegen. Den Rest wegschneiden, dabei Saftwaage berücksichtigen.
 Schnittfehler und Schnittmaßnahmen Bei meinen vielen Rundgängen sind mir eine Vielzahl von Schnittfehlern aufgefallen. Jeder Besitzer möchte seinen Baum sicherlich richtig schneiden, aber im Laufe der
Schnittfehler und Schnittmaßnahmen Bei meinen vielen Rundgängen sind mir eine Vielzahl von Schnittfehlern aufgefallen. Jeder Besitzer möchte seinen Baum sicherlich richtig schneiden, aber im Laufe der
Langzeitbeobachtung 1
 Langzeitbeobachtung 1 1. Zur Auswahl des Baumes - der Baum sollte schon etwas länger (2-3 Jahre als Minimum) an dem Ort stehen und dort gut angewachsen sein - der Baum sollte den Eindruck erwecken, dass
Langzeitbeobachtung 1 1. Zur Auswahl des Baumes - der Baum sollte schon etwas länger (2-3 Jahre als Minimum) an dem Ort stehen und dort gut angewachsen sein - der Baum sollte den Eindruck erwecken, dass
DIE RADIOAKTIVITÄT VON BODEN UND QUELLEN. VoN DR. A. GOCKEL PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU FREIBURG. (SCHWEIZ) MIT 10 TEXTABBILDUNGEN
 DIE RADIOAKTIVITÄT VON BODEN UND QUELLEN VoN DR. A. GOCKEL PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU FREIBURG. (SCHWEIZ) MIT 10 TEXTABBILDUNGEN Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 1914 ISBN 978-3-663-19886-4 ISBN
DIE RADIOAKTIVITÄT VON BODEN UND QUELLEN VoN DR. A. GOCKEL PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU FREIBURG. (SCHWEIZ) MIT 10 TEXTABBILDUNGEN Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 1914 ISBN 978-3-663-19886-4 ISBN
BERGBAU PSL! INVENTAR! BLATT St. Johann! PUNKT ! AUSGABE 1! DATUM SEITE 1!
 A. B. D. BERGBAU PSL INVENTAR BLATT St. Johann PUNKT 6708.001 AUSGABE 1 DATUM 2015-04-03 SEITE 1 Bohrloch "Stuhlsatzenhaus". Heute im Bebauungsbereich der Universität R 25 76 130 H 54 58 240 Höhe 247 m
A. B. D. BERGBAU PSL INVENTAR BLATT St. Johann PUNKT 6708.001 AUSGABE 1 DATUM 2015-04-03 SEITE 1 Bohrloch "Stuhlsatzenhaus". Heute im Bebauungsbereich der Universität R 25 76 130 H 54 58 240 Höhe 247 m
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Mathematische Probleme, SS 2016 Freitag $Id: convex.tex,v /05/13 14:42:55 hk Exp $
 $Id: convex.tex,v.28 206/05/3 4:42:55 hk Exp $ 3 Konvexgeometrie 3. Konvexe Polyeder In der letzten Sitzung haben wir begonnen uns mit konvexen Polyedern zu befassen, diese sind die Verallgemeinerung der
$Id: convex.tex,v.28 206/05/3 4:42:55 hk Exp $ 3 Konvexgeometrie 3. Konvexe Polyeder In der letzten Sitzung haben wir begonnen uns mit konvexen Polyedern zu befassen, diese sind die Verallgemeinerung der
Die radioaktive Strahlung als Gegenstand wahrscheinlichkeitstheoretischer
 Die radioaktive Strahlung als Gegenstand wahrscheinlichkeitstheoretischer Untersuchungen Die radioaktive Strahlung als Gegenstand wahrscheinlichkeitstheoretischer Untersuchungen Von L. v. Bortkiewicz a.
Die radioaktive Strahlung als Gegenstand wahrscheinlichkeitstheoretischer Untersuchungen Die radioaktive Strahlung als Gegenstand wahrscheinlichkeitstheoretischer Untersuchungen Von L. v. Bortkiewicz a.
Erklärung und Kausalität. Antworten auf die Leitfragen zum
 TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 5.5.2009 Textgrundlage: C. G. Hempel, Aspekte wissenschaftlicher
TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 5.5.2009 Textgrundlage: C. G. Hempel, Aspekte wissenschaftlicher
Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1
 Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und
Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und
Wer ist mit wem verwandt? EVOLUTION befasst sich auch mit Verwandtschaftsverhältnissen!
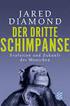 Wer ist mit wem verwandt? EVOLUTION befasst sich auch mit Verwandtschaftsverhältnissen! Du bist ein junger Wissenschaftler/ eine junge Wissenschaftlerin. Auf einer Reise hast du viele verschiedene Arten
Wer ist mit wem verwandt? EVOLUTION befasst sich auch mit Verwandtschaftsverhältnissen! Du bist ein junger Wissenschaftler/ eine junge Wissenschaftlerin. Auf einer Reise hast du viele verschiedene Arten
Taalfilosofie 2009/2010
 Taalfilosofie 2009/2010 Thomas.Mueller@phil.uu.nl 24 februari 2010: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.phil.uu.nl/taalfilosofie/2009/ Tractatus: Ontologie 1 Die Welt ist alles,
Taalfilosofie 2009/2010 Thomas.Mueller@phil.uu.nl 24 februari 2010: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.phil.uu.nl/taalfilosofie/2009/ Tractatus: Ontologie 1 Die Welt ist alles,
Ziel und Struktur der physikalischen Theorien
 PIERRE DUHEM Ziel und Struktur der physikalischen Theorien Autorisierte Übersetzung von FRIEDRICH ADLER Mit einem Vorwort von ERNST MACH Mit einer Einleitung und Bibliographie herausgegeben von LOTHAR
PIERRE DUHEM Ziel und Struktur der physikalischen Theorien Autorisierte Übersetzung von FRIEDRICH ADLER Mit einem Vorwort von ERNST MACH Mit einer Einleitung und Bibliographie herausgegeben von LOTHAR
4.21 Die zahlentheoretischen Bücher VII, VIII und IX der Elemente
 4.21 Die zahlentheoretischen Bücher VII, VIII und IX der Elemente Buch VII der Elemente behandelt auch heute noch aktuelle Begriffe wie Teiler, Vielfache, ggt, kgv und Primzahl und ihre Eigenschaften.
4.21 Die zahlentheoretischen Bücher VII, VIII und IX der Elemente Buch VII der Elemente behandelt auch heute noch aktuelle Begriffe wie Teiler, Vielfache, ggt, kgv und Primzahl und ihre Eigenschaften.
Vorlesung 15a. Quellencodieren und Entropie
 Vorlesung 15a Quellencodieren und Entropie 1 1. Volle Binärbäume als gerichtete Graphen und die gewöhnliche Irrfahrt von der Wurzel zu den Blättern 2 3 ein (nicht voller) Binärbaum Merkmale eines Binärbaumes:
Vorlesung 15a Quellencodieren und Entropie 1 1. Volle Binärbäume als gerichtete Graphen und die gewöhnliche Irrfahrt von der Wurzel zu den Blättern 2 3 ein (nicht voller) Binärbaum Merkmale eines Binärbaumes:
4.23 Buch XII der Elemente
 4.23 Buch XII der Elemente Buch XII behandelt den Flächeninhalt des Kreises und das Volumen von Pyramiden, Kegeln, Zylindern und Kugeln. Wichtiges Hilfsmittel ist dabei die erste Proposition von Buch X,
4.23 Buch XII der Elemente Buch XII behandelt den Flächeninhalt des Kreises und das Volumen von Pyramiden, Kegeln, Zylindern und Kugeln. Wichtiges Hilfsmittel ist dabei die erste Proposition von Buch X,
Subtile Strömungswirkungen
 Norbert Harthun Leipzig, im Juni 2005 Subtile Strömungswirkungen Es ist eindeutig, dass der Wechsel von einer Wasserlaufkrümmung in die andere besondere Wirkung auf die Umgebung hat. Im vergangenen PKS-Seminar
Norbert Harthun Leipzig, im Juni 2005 Subtile Strömungswirkungen Es ist eindeutig, dass der Wechsel von einer Wasserlaufkrümmung in die andere besondere Wirkung auf die Umgebung hat. Im vergangenen PKS-Seminar
EINIGE SÄTZE VOM SCHWERPUNKT. VON V. SOHLEGEL IN HAGEN I/W.
 EINIGE SÄTZE VOM SCHWERPUNKT. VON V. SOHLEGEL IN HAGEN I/W. Es soll im Folgenden an einigen Beispielen gezeigt werden, mit wie grosser Leichtigkeit die einfachsten Hilfsmittel der G r äs s - mann'schen
EINIGE SÄTZE VOM SCHWERPUNKT. VON V. SOHLEGEL IN HAGEN I/W. Es soll im Folgenden an einigen Beispielen gezeigt werden, mit wie grosser Leichtigkeit die einfachsten Hilfsmittel der G r äs s - mann'schen
Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts
 Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Übungen zu Splines Lösungen zu Übung 20
 Übungen zu Splines Lösungen zu Übung 20 20.1 Gegeben seien in der (x, y)-ebene die 1 Punkte: x i 6 5 4 2 1 0 1 2 4 5 6 y i 1 1 1 1 1 + 5 1 + 8 4 1 + 8 1 + 5 1 1 1 1 (a) Skizzieren Sie diese Punkte. (b)
Übungen zu Splines Lösungen zu Übung 20 20.1 Gegeben seien in der (x, y)-ebene die 1 Punkte: x i 6 5 4 2 1 0 1 2 4 5 6 y i 1 1 1 1 1 + 5 1 + 8 4 1 + 8 1 + 5 1 1 1 1 (a) Skizzieren Sie diese Punkte. (b)
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
1 Axiomatische Charakterisierung der reellen. 3 Die natürlichen, die ganzen und die rationalen. 4 Das Vollständigkeitsaxiom und irrationale
 Kapitel I Reelle Zahlen 1 Axiomatische Charakterisierung der reellen Zahlen R 2 Angeordnete Körper 3 Die natürlichen, die ganzen und die rationalen Zahlen 4 Das Vollständigkeitsaxiom und irrationale Zahlen
Kapitel I Reelle Zahlen 1 Axiomatische Charakterisierung der reellen Zahlen R 2 Angeordnete Körper 3 Die natürlichen, die ganzen und die rationalen Zahlen 4 Das Vollständigkeitsaxiom und irrationale Zahlen
Die komplementären Wirbel der Wirbelsäule
 Kapitel 1 Die komplementären Wirbel der Wirbelsäule Wie viele Entdeckungen hat auch dieses Buch oder besser gesagt diese ganze Wirbelsäulen-Regenerations-Methode mit einem Zufall angefangen. Und wie es
Kapitel 1 Die komplementären Wirbel der Wirbelsäule Wie viele Entdeckungen hat auch dieses Buch oder besser gesagt diese ganze Wirbelsäulen-Regenerations-Methode mit einem Zufall angefangen. Und wie es
ARTHUR SCHOPENHAUER KLEINERE SCHRIFTEN COTTA-VERLAG INS EL-VERLAG
 ?X ARTHUR SCHOPENHAUER KLEINERE SCHRIFTEN COTTA-VERLAG INS EL-VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 867 ÜBER DIE VIERFACHE WURZEL DES SATZES VOM ZUREICHENDENGRUNDE Forrede..... 7 Erstes Kapitel. Einleitung 1 Die Methode...
?X ARTHUR SCHOPENHAUER KLEINERE SCHRIFTEN COTTA-VERLAG INS EL-VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 867 ÜBER DIE VIERFACHE WURZEL DES SATZES VOM ZUREICHENDENGRUNDE Forrede..... 7 Erstes Kapitel. Einleitung 1 Die Methode...
Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella vectensis
 Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella vectensis Nachdem das Muskelgewebe in adulten Tieren von Nematostella identifiziert und beschrieben war, wurde die Entstehung der Muskulatur in
Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella vectensis Nachdem das Muskelgewebe in adulten Tieren von Nematostella identifiziert und beschrieben war, wurde die Entstehung der Muskulatur in
Die Eulergerade. Begrie. Spezialfälle. Konstruktion der Euler-Gerade
 Die Eulergerade Begrie In einem Dreieck liegen der Schwerpunkt S, der Höhenschnittpunkt H und der Umkreismittelpunkt U auf einer gemeinsamen Geraden, der Euler-Geraden (Bezeichnung: e). Zur Erinnerung:
Die Eulergerade Begrie In einem Dreieck liegen der Schwerpunkt S, der Höhenschnittpunkt H und der Umkreismittelpunkt U auf einer gemeinsamen Geraden, der Euler-Geraden (Bezeichnung: e). Zur Erinnerung:
Geometrische Darstellung der Theorie gruppen.
 Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at 418 der Polar Geometrische Darstellung der Theorie gruppen. Von Emil Waelsch, ord. H örer an der deutschen technischen Huchschule
Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at 418 der Polar Geometrische Darstellung der Theorie gruppen. Von Emil Waelsch, ord. H örer an der deutschen technischen Huchschule
2. Geometrie. Schotts Inhaltsangabe des 2. Fachs und Kirchers Anleitung zum Gebrauch der Täfelchen
 2. Geometrie Schotts Inhaltsangabe des 2. Fachs und Kirchers Anleitung zum Gebrauch der Täfelchen Aus: Kaspar Schott, Organum mathematicum, Nürnberg 1668 in der Übersetzung von P. Alban Müller SJ 1. Inhaltsangabe
2. Geometrie Schotts Inhaltsangabe des 2. Fachs und Kirchers Anleitung zum Gebrauch der Täfelchen Aus: Kaspar Schott, Organum mathematicum, Nürnberg 1668 in der Übersetzung von P. Alban Müller SJ 1. Inhaltsangabe
Hedera Newsletter der Deutschen Efeu-Gesellschaft
 Hedera Newsletter der Deutschen Efeu-Gesellschaft 31.12.2015 Mikroskopische Untersuchung der Haarformen der Gattung Hedera Text und Bilder von Wilfried Engesser Wozu benötigt ein Efeuliebhaber eine Lupe
Hedera Newsletter der Deutschen Efeu-Gesellschaft 31.12.2015 Mikroskopische Untersuchung der Haarformen der Gattung Hedera Text und Bilder von Wilfried Engesser Wozu benötigt ein Efeuliebhaber eine Lupe
Geisteswissenschaft. Carolin Wiechert. Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen.
 Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Die Quadratur des Kreises
 Die Quadratur des Kreises Häufig hört man Leute sagen, vor allem wenn sie vor großen Schwierigkeiten stehen, so was wie hier wird die Quadratur des Kreises versucht. Was ist mit dieser Redewendung gemeint?
Die Quadratur des Kreises Häufig hört man Leute sagen, vor allem wenn sie vor großen Schwierigkeiten stehen, so was wie hier wird die Quadratur des Kreises versucht. Was ist mit dieser Redewendung gemeint?
Unterrichtsplanung zur Einführung des Binomialkoeffizienten und der Binomialverteilung
 Unterrichtsplanung zur Einführung des Binomialkoeffizienten und der Binomialverteilung Einleitung: Im Folgenden soll ein Unterrichtskonzept zur Einführung der Begriffe Binomialkoeffizient und Binomialverteilung
Unterrichtsplanung zur Einführung des Binomialkoeffizienten und der Binomialverteilung Einleitung: Im Folgenden soll ein Unterrichtskonzept zur Einführung der Begriffe Binomialkoeffizient und Binomialverteilung
Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt. Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt
 Kategorie Ecolier Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 3. 4 595 36,3 4. 7 107 44,4 Kategorie Benjamin Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 5. 21 590 39,7 6. 22 414 47,8 Bei Untersuchung
Kategorie Ecolier Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 3. 4 595 36,3 4. 7 107 44,4 Kategorie Benjamin Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 5. 21 590 39,7 6. 22 414 47,8 Bei Untersuchung
Übung 5 Flusslängsprofile mit Python (Sawtooth Mountains, Idaho)
 Übung 5 Flusslängsprofile mit Python (Sawtooth Mountains, Idaho) Zur Berechnung von Flusslängsprofilen auf Basis von Höhenmodellen wurde im Zuge dieser Übungen die Programmiersprache Python verwendet,
Übung 5 Flusslängsprofile mit Python (Sawtooth Mountains, Idaho) Zur Berechnung von Flusslängsprofilen auf Basis von Höhenmodellen wurde im Zuge dieser Übungen die Programmiersprache Python verwendet,
Sprachen sind durch folgenden Aufbau gekennzeichnet:
 BNF UND SYNTAXDIAGRAMME 1. Allgemeines 1.1 Aufbau von Sprachen BNF und Syntaxdiagramme werden verwendet, um die Syntax einer Sprache darzustellen und graphisch zu veranschaulichen. Mit ihnen können entweder
BNF UND SYNTAXDIAGRAMME 1. Allgemeines 1.1 Aufbau von Sprachen BNF und Syntaxdiagramme werden verwendet, um die Syntax einer Sprache darzustellen und graphisch zu veranschaulichen. Mit ihnen können entweder
A K K O M M O D A T I O N
 biologie aktiv 4/Auge/Station 2/Lösung Welche Teile des Auges sind von außen sichtbar? Augenbraue, Augenlid, Wimpern, Pupille, Iris, Lederhaut, Hornhaut (durchsichtiger Bereich der Lederhaut) Leuchte nun
biologie aktiv 4/Auge/Station 2/Lösung Welche Teile des Auges sind von außen sichtbar? Augenbraue, Augenlid, Wimpern, Pupille, Iris, Lederhaut, Hornhaut (durchsichtiger Bereich der Lederhaut) Leuchte nun
Beschreibung von Versmassen
 Beschreibung von Versmassen Teil 1: In dieser Arbeitsreihe lernst du nicht, wie man ein Metrum herausfinden kann (das wird vorausgesetzt), sondern nur, wie man ein schon bekanntes Metrum beschreiben und
Beschreibung von Versmassen Teil 1: In dieser Arbeitsreihe lernst du nicht, wie man ein Metrum herausfinden kann (das wird vorausgesetzt), sondern nur, wie man ein schon bekanntes Metrum beschreiben und
ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN
 ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN UITGEGEVEN DOOR HET RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN (MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK) Deel 54 no. 5 14 augustus 1979 EINE NEUE ALBINARIA
ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN UITGEGEVEN DOOR HET RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN (MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK) Deel 54 no. 5 14 augustus 1979 EINE NEUE ALBINARIA
Abschnitt 1.2. Rechnen mit reellen Zahlen
 Abschnitt 1.2 Rechnen mit reellen Zahlen Addition und Multiplikation Zwei reelle Zahlen a und b kann man zu einander addieren, d. h., den beiden Zahlen wird eine dritte Zahl, a + b, zugeordnet, welche
Abschnitt 1.2 Rechnen mit reellen Zahlen Addition und Multiplikation Zwei reelle Zahlen a und b kann man zu einander addieren, d. h., den beiden Zahlen wird eine dritte Zahl, a + b, zugeordnet, welche
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ. Seminar aus Reiner Mathematik. Die Museumswächter. Krupic Mustafa Wintersemester 2013/14
 KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ Seminar aus Reiner Mathematik Die Museumswächter Krupic Mustafa Wintersemester 2013/14 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Museumswächter-Satz 6 2.1
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ Seminar aus Reiner Mathematik Die Museumswächter Krupic Mustafa Wintersemester 2013/14 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Museumswächter-Satz 6 2.1
Station 1 Der Baum. Frucht Blüte Stamm. Wurzeln Blatt Ast
 Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Die Dichte der Erde, berechnet aus der Schwerebeschleunigung
 152S Die Dichte der Erde, berechnet aus der Schwerebeschleunigung und der Abplattung Dr. O. Tumlirz, P r o f e s s o r i m t i c r k. k. l ' n i r r r s i l i i l in C.'w r n o ic ilz. Aus den Messungen
152S Die Dichte der Erde, berechnet aus der Schwerebeschleunigung und der Abplattung Dr. O. Tumlirz, P r o f e s s o r i m t i c r k. k. l ' n i r r r s i l i i l in C.'w r n o ic ilz. Aus den Messungen
D-MATH, D-PHYS, D-CHAB Analysis I HS 2017 Prof. Manfred Einsiedler. Lösung 4
 D-MATH, D-PHYS, D-CHAB Analysis I HS 017 Prof. Manfred Einsiedler Lösung 4 Hinweise 1. Zeigen Sie, dass inf X die kleinste obere Schranke von X ist.. Dass z 1, z Lösungen sind, kann man durch Einsetzen
D-MATH, D-PHYS, D-CHAB Analysis I HS 017 Prof. Manfred Einsiedler Lösung 4 Hinweise 1. Zeigen Sie, dass inf X die kleinste obere Schranke von X ist.. Dass z 1, z Lösungen sind, kann man durch Einsetzen
12 x 80 = = 5.960
 Bemerkungen Zu den Bemerkungen, welche in Nr. 44. dieses Journals 1807. zu dem Aufsatz über die Abschätzung des Werthes kleiner Waldstücke in Nr. 35, gemacht wurden. Für die gültige Mittheilung der Ansicht
Bemerkungen Zu den Bemerkungen, welche in Nr. 44. dieses Journals 1807. zu dem Aufsatz über die Abschätzung des Werthes kleiner Waldstücke in Nr. 35, gemacht wurden. Für die gültige Mittheilung der Ansicht
2 - Konvergenz und Limes
 Kapitel 2 - Folgen Reihen Seite 1 2 - Konvergenz Limes Definition 2.1 (Folgenkonvergenz) Eine Folge komplexer Zahlen heißt konvergent gegen, wenn es zu jeder positiven Zahl ein gibt, so dass gilt: Die
Kapitel 2 - Folgen Reihen Seite 1 2 - Konvergenz Limes Definition 2.1 (Folgenkonvergenz) Eine Folge komplexer Zahlen heißt konvergent gegen, wenn es zu jeder positiven Zahl ein gibt, so dass gilt: Die
Technische Universität München Zentrum Mathematik Propädeutikum Diskrete Mathematik. Weihnachtsblatt
 Technische Universität München Zentrum Mathematik Propädeutikum Diskrete Mathematik Prof. Dr. A. Taraz, Dipl-Math. A. Würfl, Dipl-Math. S. König Weihnachtsblatt Aufgabe W.1 Untersuchen Sie nachstehenden
Technische Universität München Zentrum Mathematik Propädeutikum Diskrete Mathematik Prof. Dr. A. Taraz, Dipl-Math. A. Würfl, Dipl-Math. S. König Weihnachtsblatt Aufgabe W.1 Untersuchen Sie nachstehenden
Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Absolute und relative en Wenn man mit Reißzwecken würfelt, dann können sie auf den Kopf oder auf die Spitze fallen. Was ist wahrscheinlicher? Ein Versuch schafft Klarheit. Um nicht immer wieder mit einer
Absolute und relative en Wenn man mit Reißzwecken würfelt, dann können sie auf den Kopf oder auf die Spitze fallen. Was ist wahrscheinlicher? Ein Versuch schafft Klarheit. Um nicht immer wieder mit einer
Zur Theorie des Stosses elastischer Körper
 52 Schneebeli, zur Theorie des Stosses elastischer Körper. Zur Theorie des Stosses elastischer Körper von Dr. Heinr. Schneebeli. In meinen experimentellen Untersuchungen über den Stoss elastischer Körper
52 Schneebeli, zur Theorie des Stosses elastischer Körper. Zur Theorie des Stosses elastischer Körper von Dr. Heinr. Schneebeli. In meinen experimentellen Untersuchungen über den Stoss elastischer Körper
Archimedische Spiralen
 Hauptseminar: Spiralen WS 05/06 Dozent: Prof. Dr. Deißler Datum: 31.01.2006 Vorgelegt von Sascha Bürgin Archimedische Spiralen Man kann sich auf zwei Arten zeichnerisch den archimedischen Spiralen annähern.
Hauptseminar: Spiralen WS 05/06 Dozent: Prof. Dr. Deißler Datum: 31.01.2006 Vorgelegt von Sascha Bürgin Archimedische Spiralen Man kann sich auf zwei Arten zeichnerisch den archimedischen Spiralen annähern.
47. Österreichische Mathematik-Olympiade Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene Lösungen
 47. Österreichische Mathematik-Olympiade Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene Lösungen 31. März 016 Aufgabe 1. Man bestimme alle positiven ganzen Zahlen k und n, die die Gleichung erfüllen. k 016 = 3
47. Österreichische Mathematik-Olympiade Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene Lösungen 31. März 016 Aufgabe 1. Man bestimme alle positiven ganzen Zahlen k und n, die die Gleichung erfüllen. k 016 = 3
Friedrich Brauer in Wien.
 VerAvaiidlungsgeschicIlte des Osinylus inaculatus. Von Friedrich Brauer in Wien. (Hierzu Taf. III. Fig. t. a. b. c.) 1. Beschreibung der Larve. An dem ovalen Kopf der Larve stehen, wie bei den Blalllauslöwen,
VerAvaiidlungsgeschicIlte des Osinylus inaculatus. Von Friedrich Brauer in Wien. (Hierzu Taf. III. Fig. t. a. b. c.) 1. Beschreibung der Larve. An dem ovalen Kopf der Larve stehen, wie bei den Blalllauslöwen,
Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen
 Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen Peter Feigl JKU Linz peter.feigl@students.jku.at 0055282 Claudia Hemmelmeir JKU Linz darja@gmx.at 0355147 Zusammenfassung Wir möchten in diesem Artikel die ganzen
Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen Peter Feigl JKU Linz peter.feigl@students.jku.at 0055282 Claudia Hemmelmeir JKU Linz darja@gmx.at 0355147 Zusammenfassung Wir möchten in diesem Artikel die ganzen
