Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, welches Sie hier erwerben können: Von Ingenieur.
|
|
|
- Götz Raske
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Der Uhrmacher Ein Lehrbuch für jeden Uhtmdcher, für den Gebrauch an Fdchschulen, in Lehrgemeinschaften, für die Vorbereitung auf die Gehilfen- und Meisterprüfung, für den Selbstunterricht und ein Nachschlagebuch für den Uhrmacher. Von Ingenieur Richard Reute buch vormals Baurat an der Ingenieurschule Gauß, Be r 1 in, Fachschule für feinmechanische Technik und Elektrotechnik 1. und 2. Aufl<:11ze 520 St ilen, 33b Abbildungen, Sb RPchenbcispiele, 8 Zahlenlafeln Reprint aus 1951 Historische Uhrenbücher Berlin 2012
2 Vorwort Das vorliegende Buch behandelt Wesen und Technik der Uhren. Es ist aus jahrelanger Unterrichtspraxis in Lehrlings-, Gehilfen- und Meisterklassen hervorgegangen und so geschrieben, daß es sowohl für den Selbstunterricht, als auch für die Hand des Berufs- und Fachschullehrers verwendet werden kann; außerdem soll es all denen von Nutzen sein, die sich in die Uhrentechnik einar,beiten wollen. Auch hilft es dem gelernten Uhrmacher die täglich an ihn herantretenden Aufgaben, zu deren Lösung es theoretischer Einsicht bedarf, zu lösen. Die Art, in der das umfangreiche Gebiet der Uhrentechnik dargestellt ist, unterscheidet sich von anderen Büchern über das gleiche Thema dadurch, daß ihm alles Wissenswerte für den Uhrmacher entnommen werden kann. Unter Weglassung alles unnötigen Ballastes hat sich der Verfasser bemüht, nur das Wesentliche darzustellen und sich dabei einer möglichst einfachen, klaren und leicht verständlichen Ausdrucksweise zu bedienen. Trotzdem setzt dieses Fachbuch gewisse praktische Kenntnisse und ein Mindestmaß an mathematischem Rüstzeug voraus. Sind diese vorhanden, dann kann der Uhrmacher oder derjenige, der es werden will, das vorliegende Buch mit größtem Nutzen für seine Tätigkeit und vor allem auch zur eigenen Vorbereitung auf die Gesellen- und Meisterprüfung verwenden. Eine Reihe von Vorgängen wurde durch zeichnerische Darstellungen verständlich gemacht, damit sich der Praktiker leichter in das Gebiet der Uhrentechnik einarbeiten kann. Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle dem Verlag für die Erfüllung aller meiner Wünsche aussprechen. Möge dieses Fachbuch, das ich meinem Vater - der 50 Jahre das Uhrenhandwerk ausübte - in Verehrung gewidmet habe, für recht viele Leser eine wertvolle Beihilfe zum Studium und für die Praxis sein. Schwenningen (Neckar), im Juni Ridzard Reutebuch
3 Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis 1. Grundzüge der astronomischen Zeitbestimmung A. Zeitmessung im allgemeinen 1. Sternzeit, Sternzeituhr 2. Unterschied zwischen Sternen- und Sonnenzeit Verhalten der Erdumdrehungen gegenüber den Sternen Die Bahn der Erde beim Umlauf um die Sonne uni! ihre Umlaufgeschwindigkeit Die Ekliptik 19 G. Die Einteilung clcr I-!irnrnelsk11gel Zenit und Zenitlinie Der Stundenwinkel Die Schiefe der Ekliptik Mittlerer Sonnentag, Zeitgleichung Ortszeit Beziehungen zwischen mittlerer und Sternzeit Längendifferenz und Zeitunterschied an verschiedenen Orten 33 B. Die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) 37 C. Kalenderangabe. 37 D. Welt-Zonenzeiten ( Normalzeiten") 39 E. Zeitdienstanlage der Sternwarte 39 F. Die Quarzuhr 42 G. Die drahtlose Einstellung der Uhren durch drahtlose Zeitzeichen 44 H. Die wirtschaitliche Wichtigkeit einer einheitlich genauen Zeitangabe 47 J. Die Prüiung nach Stand und Gang der Uhr 49 II. Die Zeitbestimmung durch Sonnenuhren A. Ortsieste Sonnenuhren Sonnenuhrenarten 54 a) Aquatorial-Sonnenuhr 55 b) Horizontal- bzw. Vertikalsonm nuhr Zifferblattkonstruktionen Bestimmung der wahren M.ttagslinie bei genauer Ost-Westrichtung der Zifferblattwand Bestimmung der wahren Mittagslinie bei Abweichung der Zifferblaltwand von der Ost-Westrichtung Sonstige Sonnenuhren-Konstruktionen
4 6 Inhaltsverzeidmis B. Tragbare Sonnenuhren l. Tragbare Sonnenuhr früherer Zeit 2. Heutige Verwendung tragbarer Sonnenuhren 3. Heutige Formen tragbarer Sonnenuhren 4. Entwicklung der tragbaren Sonnenuhr zum Kompaß C. Die Taschenuhr als Kompaß ScitP III. Die Entwicklung der Uhr 1. Die ersten Uhren G9 2. Die Spindelhemmung Die Räderuhren Vorrichtungen zum Ausgleichen der Unglteichheit der Kraftwirkung bei Zugfedern Tragbare Uhren 72 G. Die Erfindung des Pendels und der Unruh Verbesserungen der Hemmungen (Gänge) 75 a) Hakengang 75 b) Grahamgang 75 c) Brocotgang 75 d) Sonstige Gänge 75 e) Zylinderhemmung 76 f) Duplexgang Preisausschreiben des englischen Staates 7G 9. Sonstige berühmte Uhrmacher Der freie Ankergang Das Federhaus mit Verzahnung und die Anwendung von Lochsteinen Die Aufzugkrone und die Kronenzeigerstellung Sind Räderuhren Zeitrneßgeräte? Zusammenfassung 80 IV. Die Entstehung der Uhrenindustrie l. Entstehung der deutschen Uhrenindustrie 2. Entstehung der Schweizer Uhrenindustrie 3. Entstehung der Schwarzwälder Uhrenindustrie 4. Die Weiterentwicklung der Schwarzwälder Uhrenindustrie 5. Die Maschinen für die Uhrenfertigung. G. Die Großuhren-Produktionsstätte in Schlesien 7. Die Entwicklung der Taschen- und Armbanduhrenindustrie V. Der Stand der Uhrenfabrikation und ihre Fertigung vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg 1. Allgemeiner Uberblick Die Uhrenarten Die Uhrenfertigung Die Werkstoffe Die Fertigungstechnik Die absatzpolitische Lage Die Fabrikation in den Krieg>jahren 1939 bis Die Fabrikation nach Beendigung des Krieges 100 ~- Schlußhetrachtung
5 Inhaltsverzeichnis 7 VI. Begriff, Aufbau und Einteilung der Uhren 1. Begriff 2. Aufbau einer Uhr 3. Einteilung der Uhren nach Aulbdu, Crölie und Zweck Seite VII. Das Gehwerk 1. Allgemeines 2. Die Kraftübertragung in der Uhr 3. Der Einfluß der Reibung und ihre Verringerun9!()(} ~ VIII. Die Antriebe A. Gewichtsantriebe 1. Der Kettenantrieb 2. Der Saitenantrieb 3. Der Saitenantrieb mit Gegengesperr 4. Gewichtsantrieb mit endloser Kette 5. Gewichtsaufzug rrnt Planetenr<ldern G. Gewicbtsantriebe mit konstanter Kraft a) Indirekter Planetenradantrieb b) Bauart Hörz Ulm (Donau) B. Die Federantriebe 1. Antrieb mit festem Federhaus 2. Fliegendes Federhaus 3. Das doppelt wirkende Federhaus C. Umlauf- oder Planetengetriebe IX. Federhausberechnung von Gehwerken langer Laufdauer Anfangswindungszahl und Veränderung der Zugfederkraft 13'.l 2. Fec!erklingenstärke und Federkerndurchmesser Radius der inneren Federhauswandung Ermittlung des inneren Radius R' der Feder in1 cthgpiauh'n','11 ZusLlnd Ermittlung der Urnganqszahl des Federhauses l3g 6. Ermittlung der Zuqfederl~inge Ermittlun9 des Verdrehungswinkels 1'.l7 8. Ermittlung des Kraftmoments der Zugfeder l:l9 9. Ermittlunq des Kraftmoments der Zuqfeder am Ende des Aufzugs Anwendunq des Beispiels Federbefestiqunqen 147 X. Die Änderung der Federkraft (Die Stellungen) A. Das Malteserkreuz 1. Konstruktion 2. Wirkunqsweise J. Stellungsstörungen 4. Stützwirkunq 5. Stützwinkel ö. Verbesserung der Stützwirkung 7. Wahl der verschiedenen Verhältnisse l4il 14ß 15!
6 8 Inhaltsverzeichnis 8. Rechnerische Ermittlung der Größenverhältnisse 9. Angaben über Stellungskonstruktionen 10. Erprobte Größenverhältnisse der Stellungsteile Kreuz und ringer 11. Malteserkreuz älterer Bauart. B. Eppner'sche Stellung C. Zahnräderstellung D. Die Schnecke E. Stellungen für Marine-Chronometer F. Sonstige Antriebe Seite 15G !GO XI. Das Laufwerk A. Das Gestell B. Wellen, Zapien, Lager C. Die Wellenzapien D. Die Steinlager XII. Das Räderwerk A. Ubertragung umlauiender Bewegungen durch Reibungsräder 1. Ubersetzungsverhältnis 2. Hebelarm und Moment B. Ubertragung umlauiender Bewegungen durch Zahnräder 1. Ununterbrochene Bewegungsübertragung bei Zahnrädern a) Eingriffstrecke gleich Eingriffsteilung b) Eingriffstrecke größer als Eingriffsteilung c) Eingriffstrecke kleiner als Eingriffsteilung d) Oberdeckungsgrad oder Eingriffsdauer 2. Gleichmäßige und stoßfreie Bewegungsübertragung bei Zahnrädern IGS C. Die Zykloidenverzahnung Die Zahnkurven Geradf!anken-Zykloiden-Verzahnungen Die Zahnerzeugung. 205 a) das Form fräs- oder Teil verfahren 205 b) das Abwälzverfahren mit Schneckenfräser Vorteile der Uhrmacher-Zykloidenverzahnung Nachteile der Zykloidenverzahnung gegenüber der Evolventenverzahnung 209 G. Die Triebstock- oder Hohltriebverzahnung 209 D. Die Evolventenverzahnung 1. Allgemeine Grundbedingungen für Zahnradeingriffe 2. Grundlagen der Evolventenverzahnung a) Eingriffslinie b) Entwurf c) Grenzen des Eingriffs d) Geometrische zusammenhänge 3. Herabsetzung der Mindestzähnezahl 4. Vorteile der Evolventenverzahnung 5. Anwendung der Evolventenverzahnung G 218
7 Inhaltsverzeichnis 9 Seite XIII. Verzahnungen in der Uhren- und uhrentechnischen Feingeräteindustrie 1. Vorbemerkung Erläuterungen zu den einzelnen Tabellen 219 a) Begriffe, Benennungen, Kurzzeichen und Formeln 219 b) Modulreihen für Groß- und Kleinuhren 222 c) Räder für Rad-Triebeingriffe für Groß- und Kleinuhren 222 d) Volltriebe mit korrigierter Zykloidenverzahnung und Hohltriebe für Groß- und Kleinuhren 225 e) Räder für Rad-Rad-Eingriffe mit Evolventenverzahnung 225 f) Aufzug- und Zeigerstellräder mit korrigierter Zykloidenverzahnung für Kleinuhren 225 g) Aufzug- und Zeigerstellräder mit Evolventenverzahnung für Kleinuhren 225 XIV. Berechnung von Uhren und uhrentechnischen Feingeräten A. Berechnung von Rad- und Triebgrößen bei Eingriffen ins Schnelle und Volltrieben 232 B. Modul aus Zähnezahl und Außendurchmesser 234 C. Berechnung von Eingriffen 235 D. Berechnung von Gehwerken mit Geradflanken-Zykloidenverzahnung Berechnung der Ubersetzungsverhältnisse Beziehungen zwischen Ubersetzungsverhältnis und Zähnezahlen bei mehreren Eingriffen 237 a) Berechnung einer astronomischen Sekundenpendeluhr b) Berechnung e.iner Kurzpendeluhr c) Berechnung einer Junghans-Taschenuhr d) Berechnung einer!. W.C. (lnternational-watch-c:o.)-taschenuhr e) Berechnung einer billigsten Taschenuhr f) Berechnung einer Roskopfuhr E. Zähnezahlen und Modulteilungen einiger Armbanduhren 251 XV. Die Zeigerwerke A. Zeigerwerke für Großuhren Zeigerwerke für Massivuhren Zeigerwerke für Amerikaner-Uhren Zeigerwerke für amerikanische \"v'ecker Zeigerwerke für Schwarzwälder Uhren Zeigerwerke für Hausuhren 257 G. Zeigerwerke mit zentraler Stunde lür Präzisions-Pendeluhren Zeigerwerke mit exzentrischer Stunde für Präzisions-Pendeluhren Zeigerwerke mit zentrischer Sekunde für Präzisions-Pendeluhren Zeigerwerk mit zentraler Sekunde bei einer Mauthe-Gangreserve- Synchronuhr 260 B. Zeigerwerke für Taschen- und Armbanduhren Zeigerwerk mit durchbohrter Minutenwelle Zeigerwerk mit undurchbohrter Minutenwelle Zeigerwerk für Roskopfuhren
8 10 Inhaltsverzeichnis XVI. Zeigerstellungen der Taschen- und Armbanduhren 1. Druckstift-Zeigerstellung bei Kupplungsaufzug 2. Kronenzug-Zeigerstellung bei Kupplungsaufzug 3. Druckstiftzeigerstellung bei Wippenaufzug 4. Kronenzeigerstellung mit Wippcnaufzug 5. Kronenzeigerstellung mit Aufzug a vue Seite 2() (i() 267 XVII. Verzahnungen und Berechnungen der Zeigerwerke A. Auizug- und Zeigerstellräder mit korrigierter Zykloidenverzahnung iür Kleinuhren 2G9 B. Zeigerwerkberechnungen 269!. für Großuhren mit gleicher Teilung für beide Eingriffe für Kleinuhren 273 XVIII. Die Hemmungen oder Gänge A. Ubersicht B. Rückiührende Hemmungen (Pendelhemmungen)!. Hakengang a) Stockuhrgang (1-lakPngang) b) Schwarzwälder Blechankergan9 2. Brocot-Gang (Stiftanker<Jang) 3. Rollengang 4. Spindelgang 5. Stiften- oder ScherengcttHJ C. Ruhende Hemmungen 1. Grahamgang 2. Zylindergang 3. Duplexgang 4. Rollengang (siehe unter RücklührPnde llemmungl'n' J 5. Röllchengang D. Freie Ankergänge l. Englischer Ankergang (Spitzzahnankergang) 2. Schweizer Ankergang (Kolbenzahnankergiingel fl) gleicharmig /)) ung leicharmig y) halbungleicharmig 3. Deutscher oder Glashütter Ankergang (KolbPnLahnctnkcrqarHJJ 4. Allgemeines über die Ankergange a) Die Schwingungsbewegung des Ankers b) Die Schwingungsbewegungen c\er Unruh c) Die Abfalleinstellung d) Einstellung des Gangradeingrifres durch Klauenver.,tellunq e) Prüfung und Berichtigung der freien Ankergiinge f) Zwei hauptsächliche Fehler der Gan<Jkonstruktio11 5. Stiftankergänge a) für Wecker b) für Kleinuhren 'i 'i Tl! () 331; :nr; J B
9 Inhaltsverzeichnis 11 Seite c) lür R<"kopluhren 346 d) Vor- und Nachteile der Stiltankergänge 346 e) Einfluß der freien Ankergänge auf die Schwingungsdauer der Unruh 346 G. Chronometergänge 348 a) mit Feder 349 b) mit kurzer Wippe 355 c) mit langer Wippe 358 d) für billige Uhrwerke 358 E. Die freien Pendelhemmungen 362 (Hemmungen mit gleichem, unveränderlichem Antrieb) 1. Freie Federkrafthemmung von Riefler Freie Federkrafthemmung von Strasser Schwerkrafthemmung von Riefler Schwerkrafthemmung von Mannhardt 379 XIX. Die Gangregler (Pendel) A. Das ebene oder Kreispendel Allgemeines Richtkraft des Pendels und Ursache des mangelhaften Isochronismus beim mathematischen Pendel 3. Schwingungsdauer des freischwingenden, mathematischen Pendels kleinen Schwingungsweiten 4. Beispiele für die Berechnung cier Schwingungsdauer und Pendellänge a) Beispiele b) Beispiele für die angenäherte Berechnung von Schwingungsdauer PendeU_iinge c) Genaue Berechnung der Schwingungsciauer B. Das physische oda.r körperliche Pendel 1. Allgemeines 2. Berechnung der Gangänderung durch Längenäncierung des Pendels 3. Einfluß der Temperatur auf die Schwingungsdauer 4. Berechnung cier Dehnung bei Temperaturveränderung 5. Einfluß des Luftdruckes auf die Schwingungsdauer C. Das Nickelstahlpendel mit Kompensation 1. Allgemeines 2. Normales Nickelstahl-Kompensationspendel 3. Schichtungs-Kompensationspendel. 4. Berechnung der Kompensation 5. Pendelaufhängung und Pendelfederbock D. Die Luftdruckkompensation des Pendels E. Das Kegelpendel F. Das Torsions- oder Drehpendel 1. Allgemeines 2. Verbindung von Anker und Drehpendel a) Konstruktionsaufbau und Wirkungsweise b) Zusammenwirken von Nadel und Gabel. c) Die Pendelfeder a) Starre Art der Pendelfederauthängung /1) Bewegliche Pendelfederaufhängung bei und G
10 12 Inhaltsverzeichnis d) Pendelführung und Gabelhöhenstand e) Richten des Abfalles 3. Der Pendelkörper a) das Pendel ohne Kompensation b) Kompensationseinrichtungen «) Kompensationspendel von Huber, München tf) Kompensationspendel ;on Hauck, München G. Das Kugelpendel Seite () XX. Die Unruh und Spiralfeder (Regler der nicht ortsfesten und tragbaren Uhren) A. Allgemeines 421 B. Die flache Spirale Aussuchen und Aufsetzen einer flachen Spirale Das Aufbiegen der Breguetspirale Das Aussuchen und Aufsetzen einer Breguetspi rule Das Aussuchen der Spiralfedern nach dem C.G S.-System 42fi S. Berechnung einer Spiralfeder nach dem C.G.S.-System zu ein<:'r pa"cnden Unruh 427 C. Die Schraubenspirale 431 D. Die Kompensationsunruh Der sekundäre Fehler Die bimetallische Nickelstahlunruh mit Stahlspiralfehler Die Kompensationsspirale mit einmetallischer Unruh Die Elinvar-Spirale mit einmetallischer Unruh Nivarox-Spiralfedern 435 E. Der Rücker 436 F. Der Einfluß äußerer Krälte auf die Schwingungsdauer der Regler Außere Antriebe Außere Widerstände 441 G. Störung des Isochronismus bei nicht a.usgeglichener Unruh 442 H. Bestimmung des inneren Ansteckungspunktes einer Spiralfeder Die Konstruktion der Endkurven Konstruktion einer Endkurve nach Phillips Konstruktion einer Endkurve nach Grossmann Konstruktion einer Endkurve nach Strasser 452 XXI. Die Schlagwerke der Uhren A. Allgemeines B. Einteilung der Schlagwerke C. Schlußscheiben-Schlagwerke 1. Halbstunden-Schlußscheiben-Schlagwerke a) für Pariser- und Federzuguhren h) für Schwarzwälder und Eintag-Uhren c) für Amerikaner-Regulateure d) für Schwarzwälder Achttage-Uhren 2. V ierviertel-schl ußsc he i ben-schlagwer ke u) Das Viertelschlagwerk der Wachtel-Kuckucksuhren /)) Das Stundenschlagwerk der Wachtel-Kuckucksuhren
11 Inhaltsverzeichnis Vor- und Nachteile der Schlußscheiben-Schlagwerke 4. Richtigstellung des falschen Schlages D. Rechenschlagwerke 1. Rechenschlagwerke für Halb- und Stundenschlag a) Wiener Halbstunden-Rechenschlagwerk b) Halbstunden - Rechenschlagwerk mit französischem Fallrechen Federzuguhren c) Unterscheidende Kennzeichen des Wiener-Rechenschlagwerkes des französischen Fallrechens d) Geräuschloser Rechenhub mit französischem Fallrechen e) Geräuschloser Rechenhub mit Auslösung am Laufrad 2. Dreiviertel-Rechenschlagwerk 3. Wiener Vierviertel-Rechenschlagwerk mit Repetition 4. Vor- und Nachteile der Rechenschlagwerke E. Westminster-Schlagwerke 1. Westminsterschlagwerk Kienzle" für Federzuguhren 2. Westminsterschlagwerk Schlenker-Grusen" für Kettenzug-Hausuhren F. Der Windfang XXII. Die astronomischen Sekundenpendeluhren A. Präzisions-Sekundenpendeluhr System Riefler" 1. Allgemeines 2. Erweiterungen der Verwendungsmöglichkeiten 3. Beseitigung größerer Abweichungen des Uhrstandes 4. Aufzug der Uhr 5. Sondereinrichtungen 6. Die Luftdruck-Kompensations-Einrichtung 7. Graphische Gangtabelle. B. Präzisions-Sekundenpendeluhr System Riefler" in staubdichtem Holzgehäuse 1. Allgemeine~ 2. Aufstellung 3. Regulierung des Uhrganges C. Präzisions-Sekundenpendeluhr System Riefler" in luftdichtem Glasverschluß 1. Allgemeines 2. Aufstellung 3. Regulierung des Uhrganges D. Das Uhrwerk E. Die Photozelle im Dienste der Zeitmessung F. Der elektrische Aufzug der Uhren G. Der elektrische Sekundenkontakt, die Registrierung durch den Chronographen und die Synchronisation von Nebenuhren H. Die elektrische Ferneinstellung der Riefler-Uhren. 1. Die Genauigkeit des Ganges der Präzisions-Pendeluhren Sachwortregister Anzeigenanhang für und Seite
12 112 VIII. Die Antriebe VIII. Die Antriebe A. Gewichtsantriebe Bei den Gewichtsantrieben wird die durch ein herabsinkendes Gewicht erzeugte Bewegungsenergie dem Antrieb der Uhr dienstbar gemacht. Der Gewichtsantrieb ist der vollkommenste der gebräuchlichen Uhrenantriebe, weil er der unveränderlichste ist; denn es gibt ja keine konstantere Kraft als die Schwerkraft, die dabei wirksam ist. Bei den Präzisionspendeluhren wird daher ausschließlich der Gewichtsantrieb verwendet, jedoch ist er auch bei gewöhnlichen Pendeluhren anzutreffen, wenn genügende Fallhöhen für den Gewichtsablauf zur Verfügung stehen. Schließlich sprechen auch ab und zu ästhetische Gründe für seine Verwendung. Die Umformung der geradlinigen Fallbewegung des Gewichtes in die umlaufende Bewegung des Räderwerkes erfolgt mittels Kette, Schnur oder Saite. 1 Anl,feb.HJ~*'/C t ~ i<frr1rs ~.. ~. Bild 28 Kettenantrieb 1. Der Kettenantrieb Beim Kettenantrieb (Bild 28) hängt das Antriebsgewicht an dem einen Ende einer einfachen Gliederkette, die über den Kettenstern geschlungen und in ihm eingehängt ist, während das andere Kettenende frei herabhängt. Beim Ablauf der Uhr wird die Kette vom Kettenstern abgewickelt und dreht diesen. Vom Kettenstern wird die Bewegung durch ein Gesperr, bestehend aus Sperrad und Sperrkegel, auf das erste Antriebsrad (Kettenrad) der Uhr übertragen. Das Sperrad ist fest mit dem Kettenstern verbunden. Beide sind lose auf der Antriebswelle. Der Sperrkegel ist auf dem Kettenrad angelenkt, das Sperrad hingegen sitzt fest auf der Antriebswelle. Die Bewegungs- oder Kraftübertragung beim Ablauf der Uhr geht daher vom Gewicht über Kette,
13 Der Kettenantrieb 113 Kettenstern, Sperrad, Sperrkegel, Kettenrad. Beim Aufzug der Uhr oder des Gewichtes wird einfach der frei herabhängende Kettenteil niedergezogen. Dabei drehen sich Kettenstern und Sperrad entgegen ihrer Ablaufrichtung, wobei die Zähne des Sperrades am Sperrkegel vorbeigleiten und diesen beiseite drücken. Durch die dem Ablauf somit entgegengesetzte Drehung beim Aufzug erfährt der Antrieb der Uhr eine Unterbrechung, so daß die Uhr während des Aufzuges stillsteht. Wegen dieses offensichtlichen Nachteils kommt der Kettenantrieb in dieser Ausführung nur für gewöhnliche Uhren in Frage, von denen keine große Ganggenauigkeit verlangt wird. Er findet sich bei unseren altehrwürdigen Schwarzwälderuhren", ebenso bei den neuzeitlichen Haus- oder Dielenuhren. Die Beziehungen zwischen der Drehzahl des Kettenrades und der Fallhöhe des Gewichtes, die in erster Linie maßgebend für die Gestaltung des Gewichtsantriebes sind, ergeben sich aus folgender Ueberlegung: da die Kette sich vom Kettenstern abwickelt, ist die abgewickelte Länge oder Fallhöhe immer gleich dem Weg, den ein Punkt am wirksamen Umfang des Kettensterns zurücklegt, also bei einer Umdrehung des Kettensterns gleich dessen Umfang = d n (d wirksamer Durchmesser, siehe Bild 28). Bei n Umdrehungen ist daher die Fallhöhe h = d n n. Aus der Fallhöhe ergibt sich aber die Umdrehungszahl, indem man diese durch den Umfang dividiert: h n = -- d n Beispiel. Kettenantrieb einer Schwarzwälder Ein-Tage-Uhr. Gegeben: n = 23 Umdrehungen, h =? d = 30 mm h n d n 3, mm 2,16 m Beispiel. Kettenantrieb einer Hausuhr mit acht Tagen Gangdauer. Gegeben: h = 1,4 rn, d = 44,5 mm n =? h n n d ,14. 44,5 10 Umdrehungen
14 114 VIII. Die Antriebe 2. D e r S a i t e n a n t r i e b Beim S a i t e n a n t r i e b (Bild 29) ist das Antriebsgewicht mittels einer Rolle an einer Saite aufgehängt. Das Ende des einen von der Rolle abführenden Saitenteils ist im Gestell der Uhr eingehängt, der andere Saitenteil ist - im aufgezogenen Zustande der Uhr - in mehreren nebeneinanderliegenden Windungen um eine Walze geschlungen und mit seinem Ende in ihr festgehakt. Beim Sinken des Gewichtes rollt sich die Saite vo~ der Walze ab und setzt diese in Umlauf. Diese Drehbewegung der Walze wird, wie beim Kettenantrieb, durch ein Gesperr auf das Antriebsrad (Walzenrad) übertragen. Das Sperrad sitzt mit der Walze fest auf der Antriebswelle. Der Sperrkegel ist auf dem Walzenrad angelenkt, das lose auf t'w'*'''" der Antriebswelle sitzt. Die Bewegungs- oder Kraftübertragung geht vom Gewicht über Saite, Walze, Sperrad, Sperrkegel, Walzenrad. Die Anwendung dieser beweglichen Rolle" zum Einhängen des Gewichtes bringt gegenüber dem unmittelbaren Einhängen beim Kettenantrieb den Vorteil mit sich, daß man bei gleicher Fallhöhe und unter sonst gleichen Umständen eine doppelt so lange Gangdauer der Uhr - allerdings mit doppeltem Antriebs Bild 29 Saitenantrieb gewicht - erhält; denn beim Sinken des Gewichtes um eine bestimmte Fallhöhe müssen sich beide Seilteile um diese Höhe verlängern; es muß also eine Länge gleich der doppelten Fallhöhe von der Walze abgezogen werden, woraus sich die doppelte Umdrehungszahl der Walze und die verdoppelte Gangdauer der Uhr ergibt. Beim Aufzug werden Walze und Sperrad mittels einer auf das Vierkant der Aufzugswelle gestedc.ten Kurbel entgegen der Ablaufrichtung gedreht. Dadurch wird die abgelaufene Saite wieder auf die Walze gewidc.elt, wobei das Gewicht hochgezogen wird. Auch hier
15 Saitenantrieb mit Gegengesperr 115 tritt, wie beim Kettenrad, der Ubelstand auf, daß die Antriebskraft während des Aufzuges eine Unterbrechung erfährt. Da beim Kettenantrieb beim Abwickeln der Kette vom Kettenstern geringe Schwankungen des Hebelarmes, an dem die Kette angreift, unvermeidlich sind, wird für Präzisionsuhren ausschließlich der Saiten- oder Schnurantrieb gewählt. Die Unterbrechung der Antriebskraft während des Aufzuges wird dabei durch die Anordnung eines sogenannten Gegengesperrs verhindert. 3. Saiten antrieb mit Gegeng es per r Das Gegengesperr (Bild 30a und 30b) ist ein Hilfsantrieb mittels Feder, der den Antrieb der Uhr während des Aufzugs übernimmt. Das Gegengesperr ist zwischen Sperrad und Walzenrad des einfachen Saitenantriebes eingebaut und besteht aus: Gegensperrad, Gegensperrkegel und Gegensperrfeder. Das Gegensperrad hat entgegengesetzt geneigte Zähne Gegensperr-Keqel 6,gensperr-llod Geqensperr~FPder WolzP.nrod Wot;r ~perro1t "1:--"""'..._,,,..,t--,,lf-!.µPrr'ltPQf'I Bild 30a Saitenantrieb mit Gegengesperr Bild 30b Saitenantrieb mit Gegengesperr im Schnitt
16 116 VIII. Die Antriebe wie das Sperrad; in ersteres greift der am Gestell der Uhr angelenkte Gegensperrkegel ein. Das Gegensperrad trägt außerdem den Sperrkegel des ersten Gesperres. Die Gegensperrfeder (Mitnehmerfeder) ist auf dem Gegensperrad angeschraubt und drückt auf einen Arm des Walzenrades. Beim Antrieb findet daher folgende Bewegungs- bzw. Kraftübertragung statt: vom Gewicht über Saite-Walzenrad-Sperrad-Sperrkegel Gegensperrad gespannte Gegensperrfeder zum Walzenrad; dabei gleiten die Zähne des Gegensperrades am Gegensperrkegel vorbei. Beim Aufzug hört der Antrieb auf das Gegensperrad auf. Die gespannte Gegensperrfeder drückt daher das Gegensperrad gegen den Gegensperrkegel und treibt bei ihrer weiteren Entspannung das Walzenrad an. Ist der Aufzug beendet, so kehrt die Antriebskraft wieder und erteilt der Gegensperrfeder ihre ursprüngliche Spannung. Der Zusammenhang zwischen Fallhöhe und Umdrehungszahl der Walze ergibt sich beim Saitenantrieb aus der Tatsache, daß beim Sinken des Gewichts um eine gewisse Fallhöhe beide Seilstücke um diesen Betrag sich verlängern, so daß das von der Walze abgewikkelte Saitenstück immer gleich der doppelten Fallhöhe ist. Bei einer Umdrehung der Walze ist nun die von ihr abgewickelte Saitenlänge gleich dem Umfang der Walze = d n und die zuged. n n d n hörige Fallhöhe = - 2 -, bei n Umdrehungen aber h = 2 Die Umdrehungszahl berechnet sich dann als doppelte Fallhöhe 2 h dividiert durch den Umfang der Walze: n = d n Beispiel. Saitenantrieb einer Präzisions-Sekundenpendeluhr. Gegeben n = 20 Umdrehungen, d = 30 mm, h =? h = , = 940 mm = 0,94 m 2 Beispiel. Saitenantrieb eines Gewichtsregulators. Gegeben h = 0,485 m, d = 22 mm, n =? 2 h n = --- = = 14 Umdrehungen n d 3,14 22 Die beschriebene einfache Gestaltung des Gegengesperres läßt sich nur bei verhältnismäßig kleiner Gegensperrfeder erreichen; diese birgt aber auch im vollständig gespannten Zustand nur einen geringen Energievorrat in sich, der nur bei kurzen Aufzugszeiten zum
17 Gewichtsantrieb mit endloser Kette 117 Antrieb ausreicht. Beim Einbau einer größeren, etwa spiralig gewundenen Gegensperrfeder wären wohl größere Aufzugszeiten zulässig, aber derartige Anordnungen sind - wohl aus oben erwähntem Grunde - nicht üblich. Gewichtsantriebe, die größere Aufzugszeiten erfordern, finden sich hauptsächlich bei Turmuhren, ebenso bei elektrischen Uhren mit motorischem Gewichtsaufzug. Die Vermeidung der Kraftunterbrechung beim Aufzug erzielt man hier durch den Antrieb mit endloser Kette. 4. G e w i c h t s a n t r i e b m i t e n d 1 o s e r K e t t e Beim Antrieb mit endloser Kette (Bild 31) findet eine in sich geschlossene Kette Verwendung, die bei kleinen Antriebskräften eine einfache Gliederkette, bei größeren Kräften eine Fahrradkette ist. Das Antriebsgewicht ist mittels beweglicher Antriebsrad -- Rolle an der Kette aufgehängt, deren Kettenstern des Antriebsrades einer Teil über den auf der Aufzugswelle sitzenden Kettenstern, der andere über den Kettenstern des Antriebsrades geführt ist. Die frei herab- Endlose Kette hängende Kettenschlaufe wird durch ein kleines Spanngewicht - zur Er- Kettenstern zielung des Geradehängens - etwas des Aufzuges gestrafft. Beim Ablauf der Uhr wird durch das sinkende Gewicht die Kette vom Kettenstern des Antriebsrades abgewickelt und dieser sowie das mit ihm fest verbundene Antriebsrad gedreht. Beim Aufzug wird die Aufzugswelle von Hand mittels einer Kurbel oder durch elektromotorischen Antrieb ge- Bild 31 Gewichtsantrieb mit endloser Kette dreht; diese Bewegung wird durch ein Gesperr über Sperrad, Sperrklinke auf den Kettenstern übertragen, auf dem sich dann der das Gewicht tragende Kettenteil aufwickelt, so daß das Antriebsgewicht gehoben wird. Das Gesperr zwischen Aufzugswelle und Kettenstern ermöglicht jedoch auch ein Aufziehen des Antriebgewichtes durch Niederziehen des vom Aufzugsrad frei herabhängenden Kettenteils. Umdrehungszahl des Antriebsrades und Fallhöhe des Gewichtes weisen hier denselben Zusammenhang auf wie beim Schnurantrieb mit
18 Das Gestell (Werkplatten) 167 XI. Das Laufwerk Zum Laufwerk gehören 1. die Zähnräder und 2. die Kraftübertragung vom Kraftspender bis zum Gangregler bzw. den Zeigern, Schlag- oder Weckerwerken usw. A. Das Gestell (Werkplatten) Das Gestell dient zur Anbringung der Lager für die Räderachsen und zur Befestigung aller übrigen Werkteile. Es setzt sich in der Regel aus den ebenen, vollen oder durchbrochenen und mit besonderen Aussparungen versehenen (gewöhnlich aus hartem Plattenmessing bestehenden) Werkplatten (Platinen) und den sie zusammenhaltenden Werksäulen (Pfeiler) zusammen. Die Zapfenlager der Wellen sind unmittelbar in die Werkplatten gebohrt. Die Wellen bzw. Zapfen sind so verkürzt, daß sie mit der Außenseite der Werkplatten abschließen. Man bringt dann immer eine konische oder hohlkugelige Senkung an, um das 01 besser am Zapfen zu halten. Die Dicke der Werkplatten richtet sich jeweils nach der Größe des Uhrwerkes. Sie schw.ankt zwischen 1,0 und 5 mm und soll so gewählt sein, daß die Werkstücke eine sichere Befestigung erfahren und der Abstand der Wellenlageransätze voneinander unveränderlich erhalten wird. Die Form der Werkplatte richtet sich immer nach der Uhrenart, sie ist daher äußerst verschieden gestaltet. Bei Taschen- und Armbanduhren ist sie meist kreisförmig und mit verschiedenen Aussparungen und Vertiefungen versehen, um die Höhe des Werkes so nieder wie möglich zu gestalten. Oft wird bei Taschen- und Armbanduhren die obere Platine teilweise durch Brücke und Kloben ersetzt, welche je ein oder auch mehrere Zapfenlöcher enthalten, so d.aß man einzelne Räder für sich herausnehmen kann. W e r kp 1 a t t eng r ö ß e. Die Größe der Taschen- und Armbanduhrwerke wird nach dem Durchmesser der Unterplatte bezeichnet. Die Werkgröße wird sowohl in Linien als auch in mm angegeben. Bei den gangbarsten Uhren hat man etwa fünfzehn verschiedene Größen von 51/4 bis 19 Linien, bzw. von 11,8 bis 42,86 mm. (Siehe Tabelle Seite 429, Spiralfedern nach dem C.G.S-.System.) In England und Amerika herrscht die Abstufung nach englischem Zoll bzw. Linien noch immer vor.
19 168 XI. Das Laufwerk B. Wellen, Zapfen, Lager Die Wellen sind meist Radachsen. Sie dienen aber auch zur Aufnahme von Teilen, die nur eine hin- und hergehende, drehende Bewegung ausführen (Unruh, Anker, Pendel, Sperrkegel). Als Werkstoff verwendet man meist Triebstahl, der nach der Bearbeitung gehärtet und blau angelassen wird. In den Laufwerken steht fast immer ein Räderpaar im Eingriff, wobei ein Rad aus hartem Messing im Eingriff mit einem Stahltrieb steht. Das Trieb selbst bildet meist gleichzeitig Bild 65 Gebräuchlichste Lagerung von Rad und Trieb die Radwelle, so daß das Rad fest mit dieser verbunden werden muß. Bild 65 zeigt eine solche Anordnung. Hier ist das Rad R.auf das Trieb T geschlagen. Zuvor werden aber die Triebzähne auf etwa Radstärke soweit abgedreht, daß die noch verbleibenden Zahnstümpfe dem Rad eine sichere Auflage bieten; dann wird das Trieb für die Nietung unterstochen. Jetzt wird das Rad angestellt, mit Hilfe eines Punzens aufgeschlagen, wobei die Radstümpfe etwas in die Radbohrung eindringen und so das Rad gegen Verdrehung sichern, und genietet. Bei guten Uhren wird das Trieb mit einem Einstich U versehen, der das Vordringen des Oles von der Welle auf das Trieb verhindert. Die Welle selbst lagert mit ihren Zapfen in den Werkplatinen. Die Zapfenluft richtet sich dabei nach der Güte des Uhrwerkes. Es wird nicht nur radial, sondern auch achsial (Höhenluft) ein gewisses Spiel gegeben. Die Zapfenluft schwankt zwischen 0,05 bis 0, 1 mm, bei feinen Taschen- und Armbanduhren beträgt sie oft nur etwa 0,01 mm. Die Höhenluft (Achsialluft) schwankt zwischen 0, 1 bis 0,2 des Zapfendurchmessers. Gegen die Welle wird das Zapfenloch nur entgratet, außen jedoch erhält jedes Loch eine meist kugelige Olsenkung, damit das 01 besser am Zapfenloch haftet. Die Zapfenenden müssen etwas in die Olsenkung hineinragen. Die Kantenbrechung an der Zapfenanlauffläche verringert die Reibung und hält das 01 am Zapfenloch. Diese Formen haben sich aus der Beobachtung der Adhäsionserscheinung (Anhangskraft des Oles in Verengungen) ergeben. C. Die Wellenzapfen Ein Wellenzapfen muß folgende Forderungen erfüllen: 1. muß er genau zentrisch,
20 Die Wellenzapfen genau zylindrisch, 3. genügend fest (darf nicht brechen oder sich verbiegen), 4. möglichst dünn und kurz, 5. möglichst glatt sein. Von der Forderung 1 und 2 hängt der genaue Rundlauf der Räder und Triebe, der gute Eingriff und der leichte, wenig Reibung besitzende Lauf, von 4 und 5 die Größe der Reibung ab, während die 3. Forderung die 4. auf eine bestimmte Grenze beschränkt. Die Größe der Reibung, d. h. der durch Reibung entstehende Arbeitsverlust ist nach den Gesetzen der Mechanik von der Größe der Auflagefläche unabhängig. Sie wird nur von dem Lagerdruck., der Zapfenumlaufgeschwindigkeit und dem Reibungskoeffizienten µ, d. h. der materiellen Beschaffenheit der reibenden Flächen bestimmt. Um den Zapfen glatt zu machen, muß er poliert werden. Der Reibungskoeffizient beträgt bei weniger gut polierten Zapfen und für Stahl auf Messing oder Bronze und 01 etwa 0,1. Bei gut polierten Zapfen und glatten Lagerflächen geht er auf 0,03 bis 0,05 herunter und steigt bei trockenen, rauhen Flächen bis auf 0,2 und 0,3 an. Trotzdem die Reibung (als Kraft) R = Q µ nur von dem Lagerdruck. Q und dem Reibungskoeffizient µ abhängt, macht man die reibenden Flächen, die Dicke und Länge der Zapfen so klein wie möglich, da man die Lagerflächen besser bearbeiten kann und auch die verlorene Reibungsarbeit geringer ausfällt. Ist P = Zapfendruck., v = Zapfengeschwindigkeit, d = Zapfendurchmesser und N = Reibungsarbeit, so ergibt sich: Ni P v1 v1 n dt n d1 -- = ---- = N2 p. V2 V2 n d2 n Es verhalten sich demnach die zu leistenden Reibungsarbeiten wie die Zapfendurchmesser, d. h. wenn der Zapfen auf etwa den doppelten Durchmesser gebracht wird, so verdoppelt sich auch die Reibungsarbeit. 1. Best.immung von Zapfendurchmesser und Zapfenlänge Bei großen Uhren wird der Zapfendurchmesser durch Festigkeitsrechnung bee.timmt. Die Festigkeit muß so groß sein, daß der Zapfen durch den Lagerdruck. nicht verbogen oder gar abgebrochen wird. Die Länge ist so zu wählen, daß die Lagerfläche f = 1 d (Zapfenlänge Zapfendurchmesser) so groß wird, daß das 01 nicht ausgepreßt und die Abnutzung nicht zu groß wird. Je nach Lagerdruck.
Inhaltsverzeichnis. Seite. I. GrundzUge der astronomischen Zeitbestimmung. A. Zeitmessung im allgemeinen 15
 Inhaltsverzeichnis I. GrundzUge der astronomischen Zeitbestimmung A. Zeitmessung im allgemeinen 15 1. Sternzeit, Sternzeituhr 15 2. Unterschied zwischen Sternen- und Sonnenzeit...... 16 3. Verhalten der
Inhaltsverzeichnis I. GrundzUge der astronomischen Zeitbestimmung A. Zeitmessung im allgemeinen 15 1. Sternzeit, Sternzeituhr 15 2. Unterschied zwischen Sternen- und Sonnenzeit...... 16 3. Verhalten der
Inhaltsverzeichnis. Zeit und Zeitmessung 13. Vorwort 11. I. Teil
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15 Die scheinbaren" und die wirklichen"
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15 Die scheinbaren" und die wirklichen"
 Inhaltsverzeichnis 1. Die französische Grassuhrenindustrie 1 Seiten 1.1 Struktur................................................... 1 1.2 Entwicklung und Produktionsumfang......................... 1 2.
Inhaltsverzeichnis 1. Die französische Grassuhrenindustrie 1 Seiten 1.1 Struktur................................................... 1 1.2 Entwicklung und Produktionsumfang......................... 1 2.
Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr. Click here if your download doesn"t start automatically
 Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr Click here if your download doesn"t start automatically Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur
Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr Click here if your download doesn"t start automatically Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur
EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I. 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln
 EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln KLINKHARDT &: BIERMANN BRAUNSCHWEIG INHALTSVERZEICHNIS
EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln KLINKHARDT &: BIERMANN BRAUNSCHWEIG INHALTSVERZEICHNIS
Dokumentation. Fertigung einer. Gangreserveanzeige. für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag. Von Alexander Santore
 Dokumentation Fertigung einer Gangreserveanzeige für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag Von Alexander Santore 1 Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1: Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangreserveanzeige?
Dokumentation Fertigung einer Gangreserveanzeige für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag Von Alexander Santore 1 Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1: Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangreserveanzeige?
Hrsg. M. Stern. Professor W. Sander. Uhrenlehre HEEL
 Hrsg. M. Stern Professor W. Sander Uhrenlehre HEEL Hrsg. M. Stern Professor W. Sander Uhrenlehre HEEL UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau
Hrsg. M. Stern Professor W. Sander Uhrenlehre HEEL Hrsg. M. Stern Professor W. Sander Uhrenlehre HEEL UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau
Reprint 1952 Berlin 2014
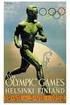 Reprint 1952 Berlin 2014 Vorwort des Verfassers Das vorliegende Fachrechenbuch bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben aus dem Gebiet der Klein- und Großuhren. Bei der Behandlung des Lehrstoffes
Reprint 1952 Berlin 2014 Vorwort des Verfassers Das vorliegende Fachrechenbuch bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben aus dem Gebiet der Klein- und Großuhren. Bei der Behandlung des Lehrstoffes
Koffer Getriebe- und Antriebsmodelle Best.- Nr. MD02709
 Koffer Getriebe- und Antriebsmodelle Best.- Nr. MD02709 1. Beschreibung und Auflistung des Materials Anhand der folgenden Auflistung können Sie Ihren Koffer auf Vollständigkeit überprüfen. Folgende Modelle
Koffer Getriebe- und Antriebsmodelle Best.- Nr. MD02709 1. Beschreibung und Auflistung des Materials Anhand der folgenden Auflistung können Sie Ihren Koffer auf Vollständigkeit überprüfen. Folgende Modelle
Vom Zugfeder-Antrieb. H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XXI, 1981, S. 71 ff
 H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XXI, 1981, S. 71 ff Vom Zugfeder-Antrieb Ein Blick auf die Kraftkurve (Abb. 1) einer Zugfeder, von einem modernen Dynamometer aufgezeichnet,
H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XXI, 1981, S. 71 ff Vom Zugfeder-Antrieb Ein Blick auf die Kraftkurve (Abb. 1) einer Zugfeder, von einem modernen Dynamometer aufgezeichnet,
Die Uhr und ihre Funktionen
 Die Uhr mit mechanischem Uhrwerk liegt seit einigen Jahren wieder im Trend. Aber dieses mechanische Innenleben der Uhr bedarf der Erklärung und Erläuterung. Und genau hier greift dieses Buch des Autors
Die Uhr mit mechanischem Uhrwerk liegt seit einigen Jahren wieder im Trend. Aber dieses mechanische Innenleben der Uhr bedarf der Erklärung und Erläuterung. Und genau hier greift dieses Buch des Autors
Secunda Accurata 1958
 Secunda Accurata 1958 Secunda Accurata 1958 verbesserte»freie Federkraft-Hemmung«nach Prof. Ludwig Strasser Dieses Modell verkörpert unseren hohen Anspruch, eine rein mechanische Präzisionspendeluhr zu
Secunda Accurata 1958 Secunda Accurata 1958 verbesserte»freie Federkraft-Hemmung«nach Prof. Ludwig Strasser Dieses Modell verkörpert unseren hohen Anspruch, eine rein mechanische Präzisionspendeluhr zu
Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen
 Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung Von Professor F. W. Hülle in Dortmund Zweiter Band Die wirtschaftliche Ausnutzung der Werkzeugmaschinen Vierte, vermehrte Auflage Mit 580 Abbildungen
Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung Von Professor F. W. Hülle in Dortmund Zweiter Band Die wirtschaftliche Ausnutzung der Werkzeugmaschinen Vierte, vermehrte Auflage Mit 580 Abbildungen
Abschlussprüfung Uhrenmacher: Formelsammlung
 Merkblatt Abschlussprüfung Uhrenmacher: Formelsammlung Ansprechpartner: Referat Prüfungswesen Sabine Frasiak Telefon: 0351 2802-684 Fax: 0351 2802-7684 frasiak.sabine@dresden.ihk.de Stand: 2018 Hinweis:
Merkblatt Abschlussprüfung Uhrenmacher: Formelsammlung Ansprechpartner: Referat Prüfungswesen Sabine Frasiak Telefon: 0351 2802-684 Fax: 0351 2802-7684 frasiak.sabine@dresden.ihk.de Stand: 2018 Hinweis:
Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup
 Bernd Mosel mosel(at)uni-muenster.de 24.8.2009 (10.03.2012) Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup Die Kirche von Westen im Jugendstil, Von NO: Erweiterung durch das östliche
Bernd Mosel mosel(at)uni-muenster.de 24.8.2009 (10.03.2012) Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup Die Kirche von Westen im Jugendstil, Von NO: Erweiterung durch das östliche
Mechanische Elemente: das Zahnrad
 Mechanische Elemente: das Zahnrad Mechanische Elemente: Zahnrad Zahnräder sind mit Zähnen ausgestattet, die in die Zähne anderer Zahnräder eingreifen. Weil die Zähne sich gegenseitig umschließen, können
Mechanische Elemente: das Zahnrad Mechanische Elemente: Zahnrad Zahnräder sind mit Zähnen ausgestattet, die in die Zähne anderer Zahnräder eingreifen. Weil die Zähne sich gegenseitig umschließen, können
Lehrbuch der Uhrmacherei Bd. 2
 Lehrbuch der Uhrmacherei Bd. 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15
Lehrbuch der Uhrmacherei Bd. 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15
Uhrwerktechnik und Feinwerktechnik
 Uhrwerktechnik und Feinwerktechnik (Chronométrophilia N o 66, Winter 2009) Einleitung Die Räderuhr ist der Urtyp der Maschine [1, Seite14], des Dings, das den Menschen ersetzt. Nachdem er sie gebaut und
Uhrwerktechnik und Feinwerktechnik (Chronométrophilia N o 66, Winter 2009) Einleitung Die Räderuhr ist der Urtyp der Maschine [1, Seite14], des Dings, das den Menschen ersetzt. Nachdem er sie gebaut und
Trigonometrie. für Maschinenbauer und Elektrotechniker. Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium. von. Dr.
 Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Sechste, verbesserte
Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Sechste, verbesserte
Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, welches Sie hier erwerben können: Dr. Karl Giebel. Gesamtwerk.
 Dr. Karl Giebel Gesamtwerk 1905 Der Einfluß der Hemmung auf den Gang der Uhr 1907 Der Isochronismus bei äußeren Störungen 1915 Anfertigung mathematischer Modelle 1926 Die Normung im Uhrengewerbe 1943 Trigonometrische
Dr. Karl Giebel Gesamtwerk 1905 Der Einfluß der Hemmung auf den Gang der Uhr 1907 Der Isochronismus bei äußeren Störungen 1915 Anfertigung mathematischer Modelle 1926 Die Normung im Uhrengewerbe 1943 Trigonometrische
von Professor W. SANDER t Diplom-Ingenieur, ehern. Vorstand der Württemb. Fachschule für Feinmechanik und Uhrmacherei in Schwenningen a. N.
 UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau der Uhrwerke in elementarer Darstellung für Fachschulen und zum Selbstunterricht, für Konstrukteure und
UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau der Uhrwerke in elementarer Darstellung für Fachschulen und zum Selbstunterricht, für Konstrukteure und
 H. JENDRITZKI Reparatur antiker Pendeluhren Reprint aus 1984 ~~PJ!1'~ istorische 'Uhrenbücher Berlin 200 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 1. Das Räderwerk...... Aufbau der Pendeluhren (Schema) Zapfen.....
H. JENDRITZKI Reparatur antiker Pendeluhren Reprint aus 1984 ~~PJ!1'~ istorische 'Uhrenbücher Berlin 200 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 1. Das Räderwerk...... Aufbau der Pendeluhren (Schema) Zapfen.....
Die Großuhr. PenDule, regulator & Co. HEEL. technik, GesChiChte, instandhaltung und reparatur
 Klaus DinGer Die Großuhr PenDule, regulator & Co. technik, GesChiChte, instandhaltung und reparatur standhaltung, Pflege und zu solchen Reparaturen, die vom handwerk HEEL Die Uhr, sie misst die Stunde,
Klaus DinGer Die Großuhr PenDule, regulator & Co. technik, GesChiChte, instandhaltung und reparatur standhaltung, Pflege und zu solchen Reparaturen, die vom handwerk HEEL Die Uhr, sie misst die Stunde,
Die Uhr und ihre Mechanik
 Klaus Menny Die Uhr und ihre Mechanik Für Sammler und Liebhaber Michael Stern (Hrsg.) Über den Autor Klaus Menny wurde 1930 in Potsdam geboren. Nach seinem Abitur studierte er das Fach Maschinenbau an
Klaus Menny Die Uhr und ihre Mechanik Für Sammler und Liebhaber Michael Stern (Hrsg.) Über den Autor Klaus Menny wurde 1930 in Potsdam geboren. Nach seinem Abitur studierte er das Fach Maschinenbau an
Leitfaden für den Fachunterricht
 Leitfaden für den Fachunterricht an Uhrmacher-Fachschulen und Fachklassen sowie zum Selbstunterricht Verfaßt unter beratender Mitarbeit hervorragender Schulmänner von Oberingenieur Gustav- Adolf-Krumm
Leitfaden für den Fachunterricht an Uhrmacher-Fachschulen und Fachklassen sowie zum Selbstunterricht Verfaßt unter beratender Mitarbeit hervorragender Schulmänner von Oberingenieur Gustav- Adolf-Krumm
22d. 22e. 19h* 19i* XIX. 20e. 20c 20d. Teile für dreibegrifiges Vorsignal. 24c d. 25b l. 24a 24b. 23m. 28f 28i ***
 4 4a* 1 1a 1b 1c 1d 1e 15 13a 13 15a 1f 1j 2g* 2d XVII 13k 2b 1g 1l 4m 2i 1m 2j 1h 1i 3 3b 2 2a 2e 2l 2m 2c 3a 4f 4j* 4k 4l 4e 4b 4c 8e 8f 8g 12b** 5d*** 5h** 5i* 5j* 12c 1k 8b 6b A 1r 6g* 6h 6i 12 8 8a
4 4a* 1 1a 1b 1c 1d 1e 15 13a 13 15a 1f 1j 2g* 2d XVII 13k 2b 1g 1l 4m 2i 1m 2j 1h 1i 3 3b 2 2a 2e 2l 2m 2c 3a 4f 4j* 4k 4l 4e 4b 4c 8e 8f 8g 12b** 5d*** 5h** 5i* 5j* 12c 1k 8b 6b A 1r 6g* 6h 6i 12 8 8a
Die Elektrotechnik und die elektromotorischen Antriebe
 Die Elektrotechnik und die elektromotorischen Antriebe Ein elementares Lehrbuch für technische Lehranstalten und zum Selbstunterricht von Dipl.-lng. Wilbeln1 Lebmann Mit 520 Textabbildungen und 116 Beispielen
Die Elektrotechnik und die elektromotorischen Antriebe Ein elementares Lehrbuch für technische Lehranstalten und zum Selbstunterricht von Dipl.-lng. Wilbeln1 Lebmann Mit 520 Textabbildungen und 116 Beispielen
 Reprint Verlag Historische Uhrenbücher Berlin 2017 nhalt 1. Einleitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Das Wesen des elektrischen Stromes 30 Der elektrische Stromkreis 4o Die Stromrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Reprint Verlag Historische Uhrenbücher Berlin 2017 nhalt 1. Einleitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Das Wesen des elektrischen Stromes 30 Der elektrische Stromkreis 4o Die Stromrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Gnomon bzw. Horizontalsonnenuhr mit austauschbaren Deckblättern
 Gnomon bzw. Horizontalsonnenuhr mit austauschbaren Deckblättern Aufbauanleitung Alle Stundenlinienraster der auswechselbaren Deckblätter sind für eine ebene Fläche in Recklinghausen (51 37 N, 7 11 O) berechnet.
Gnomon bzw. Horizontalsonnenuhr mit austauschbaren Deckblättern Aufbauanleitung Alle Stundenlinienraster der auswechselbaren Deckblätter sind für eine ebene Fläche in Recklinghausen (51 37 N, 7 11 O) berechnet.
Eine mechanische Uhr lebt über Ihren Herzschlag die Unruh! WIE FUNKTIONIERT EINE HANDAUFZUG-UHR? WIE FUNKTIONIERT EINE AUTOMATIK-UHR?
 WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER MECHANISCHEN UHR? Eine mechanische Uhr lebt über Ihren Herzschlag die Unruh! Bei einer mechanischen Uhr erfolgt der Antrieb über eine Aufzugfeder, die entweder per Hand über
WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER MECHANISCHEN UHR? Eine mechanische Uhr lebt über Ihren Herzschlag die Unruh! Bei einer mechanischen Uhr erfolgt der Antrieb über eine Aufzugfeder, die entweder per Hand über
Ein neuer Glashütter Anker
 Ein neuer Glashütter Anker Es ist ein seit langem anerkannter Grundsatz in der Präzisionsuhrmacherei, daß alle eigentlichen Hemmungsteile, also Gangrad und Anker nebst Gabel, möglichst leicht und abgeglichen
Ein neuer Glashütter Anker Es ist ein seit langem anerkannter Grundsatz in der Präzisionsuhrmacherei, daß alle eigentlichen Hemmungsteile, also Gangrad und Anker nebst Gabel, möglichst leicht und abgeglichen
Einführung in die. sphärisdu~ Astronomie. Dr. Adalbert Prey. Springer-Verlag Wien GmbH. Mit 123 Textabbildungen. Von
 Einführung in die sphärisdu~ Astronomie Von Dr. Adalbert Prey em. o. Professor an der Universität Wien Mit 123 Textabbildungen Springer-Verlag Wien GmbH 1949 Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung
Einführung in die sphärisdu~ Astronomie Von Dr. Adalbert Prey em. o. Professor an der Universität Wien Mit 123 Textabbildungen Springer-Verlag Wien GmbH 1949 Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung
Zahnformen in mechanischen Kleinuhren
 Fakultät Maschinenwesen, Institut für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion, Lehrstuhl Maschinenelemente Berechnung, Optimierung und Messung geometrischer und kinematischer Eigenschaften Feinwerktechnische
Fakultät Maschinenwesen, Institut für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion, Lehrstuhl Maschinenelemente Berechnung, Optimierung und Messung geometrischer und kinematischer Eigenschaften Feinwerktechnische
Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus. U. Krausch
 Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus U. Krausch Was ist Zeit? Vor über 2500 Jahren legt Heraklit die Grunddeutung Alles fließt. Augustinus (345-430 n. Chr.):
Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus U. Krausch Was ist Zeit? Vor über 2500 Jahren legt Heraklit die Grunddeutung Alles fließt. Augustinus (345-430 n. Chr.):
Neuanfertigung einer Globusuhr mit Mondanzeige
 Globusuhr Neuanfertigung einer Globusuhr mit Mondanzeige Die hier vorgestellte Globusuhr zeigt in der Mitte die Tageszeit auf einem Zwölfstunden-Zifferblatt mit Minuteneinteilung. Unter der Tageszeit ist
Globusuhr Neuanfertigung einer Globusuhr mit Mondanzeige Die hier vorgestellte Globusuhr zeigt in der Mitte die Tageszeit auf einem Zwölfstunden-Zifferblatt mit Minuteneinteilung. Unter der Tageszeit ist
Uhren-ABC 1/6. *Grossuhren: Energiequelle: Zugfeder oder Gewicht Schwingungsorgan: in der Regel ein Pendel
 Uhren-ABC 1/6 In der Schweiz werden heute zwei Hauptarten von Uhren hergestellt: Elektronische Quarzuhren mit Zeigeranzeige (auch kombiniert mit Digitalanzeige) und mechanische Uhren. Die mechanische Uhr
Uhren-ABC 1/6 In der Schweiz werden heute zwei Hauptarten von Uhren hergestellt: Elektronische Quarzuhren mit Zeigeranzeige (auch kombiniert mit Digitalanzeige) und mechanische Uhren. Die mechanische Uhr
Die Viskosekunstseidefabrik
 Monographien zur Chemischen Apparatur Begründet von Dr. A. j. Kieser Herausgegeben von Berthold Block Band 5 ==================== Die Viskosekunstseidefabrik ihre Maschinen und Apparate Von Ob.-Ing. Ed.
Monographien zur Chemischen Apparatur Begründet von Dr. A. j. Kieser Herausgegeben von Berthold Block Band 5 ==================== Die Viskosekunstseidefabrik ihre Maschinen und Apparate Von Ob.-Ing. Ed.
Trigonometrie. für Maschinenbauer und Elektrotechniker. Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium. von. Dr.
 Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Siebente, verbesserte
Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Siebente, verbesserte
 Reprint von 1923 Berlin 2018 Anmerkungen des Verlages Viele Besitzer alter mechanischer Groß- und Kleinuhren haben ein immer größeres Bedürfnis, mehr über die Technik ihrer Uhren zu erfahren. Der hier
Reprint von 1923 Berlin 2018 Anmerkungen des Verlages Viele Besitzer alter mechanischer Groß- und Kleinuhren haben ein immer größeres Bedürfnis, mehr über die Technik ihrer Uhren zu erfahren. Der hier
(a) In welcher Zeit nach einem Nulldurchgang ist der Betrag der Auslenkung
 Schwingungen SW1: 2 Ein Körper bewegt sich harmonisch. Bei einer Auslenkung aus der Ruhelage um x = 7,5 mm erfährt er eine Beschleunigung von a = 1,85 m s 2. Wie viele Schwingungen pro Sekunde führt er
Schwingungen SW1: 2 Ein Körper bewegt sich harmonisch. Bei einer Auslenkung aus der Ruhelage um x = 7,5 mm erfährt er eine Beschleunigung von a = 1,85 m s 2. Wie viele Schwingungen pro Sekunde führt er
Hilfsmittel sind nicht zugelassen, auch keine Taschenrechner! Heftung nicht lösen! Kein zusätzliches Papier zugelassen!
 Physik 1 / Klausur Anfang SS 0 Heift / Kurtz Name: Vorname: Matrikel-Nr.: Unterschrift: Formeln siehe letzte Rückseite! Hilfsmittel sind nicht zugelassen, auch keine Taschenrechner! Heftung nicht lösen!
Physik 1 / Klausur Anfang SS 0 Heift / Kurtz Name: Vorname: Matrikel-Nr.: Unterschrift: Formeln siehe letzte Rückseite! Hilfsmittel sind nicht zugelassen, auch keine Taschenrechner! Heftung nicht lösen!
Bedienungsanleitung. Die Feder
 MEINE ERSTE UHR Danke für Ihren Kauf von Meine erste Uhr. Meine erste Uhr ist ein neuartiges Lernspielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Sie werden viel Freude daran haben, da Meine erste Uhr leicht zu montieren
MEINE ERSTE UHR Danke für Ihren Kauf von Meine erste Uhr. Meine erste Uhr ist ein neuartiges Lernspielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Sie werden viel Freude daran haben, da Meine erste Uhr leicht zu montieren
PRESSE-INFORMATION. WEMPE CHRONOMETERWERKE Glashütte i/sa. Höchste Präzision auf kleinstem Raum
 PRESSE-INFORMATION WEMPE CHRONOMETERWERKE Glashütte i/sa Höchste Präzision auf kleinstem Raum Glashütte, 18. September 2006 Bei dieser Serie handelte es sich um eine besondere feinmechanische Herausforderung
PRESSE-INFORMATION WEMPE CHRONOMETERWERKE Glashütte i/sa Höchste Präzision auf kleinstem Raum Glashütte, 18. September 2006 Bei dieser Serie handelte es sich um eine besondere feinmechanische Herausforderung
RM RAFAEL NADAL
 RM 27-03 RAFAEL NADAL TECHNISCHE ANGABEN ZUR RM 27-03 TOURBILLON RAFAEL NADAL Limitierte Auflage von 50 Stück. KALIBER RM27-03: Tourbillon-Handaufzugswerk mit Stunden und Minuten. Abmessungen: 47,77 x
RM 27-03 RAFAEL NADAL TECHNISCHE ANGABEN ZUR RM 27-03 TOURBILLON RAFAEL NADAL Limitierte Auflage von 50 Stück. KALIBER RM27-03: Tourbillon-Handaufzugswerk mit Stunden und Minuten. Abmessungen: 47,77 x
8/13/2013 Selbsteinstellendes Kettenrad, Karl Herkenrath 1
 8/13/2013 Selbsteinstellendes Kettenrad, Karl Herkenrath 1 PATENT Selbsteinstellendes Kettenrad Patentschrift EP 12007544.5 Karl Herkenrath 2 Inhalt Ausgangssituation und Problemstellung Motivation und
8/13/2013 Selbsteinstellendes Kettenrad, Karl Herkenrath 1 PATENT Selbsteinstellendes Kettenrad Patentschrift EP 12007544.5 Karl Herkenrath 2 Inhalt Ausgangssituation und Problemstellung Motivation und
EINZELHEITEN ZUM T-34-85
 ZUSAMMENBAU STUFE 69 EINZELHEITEN ZUM T-34-85 Die Tankaufhängung erfolgt einzeln mit zylindrischen Spiralfedern. Dazu gehören die Teile, welche die Panzerkarosse mit den Laufrädern verbinden. Die Aufhängung
ZUSAMMENBAU STUFE 69 EINZELHEITEN ZUM T-34-85 Die Tankaufhängung erfolgt einzeln mit zylindrischen Spiralfedern. Dazu gehören die Teile, welche die Panzerkarosse mit den Laufrädern verbinden. Die Aufhängung
TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner
 TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner Das schweizer TAVARO-Uhrwerk wurde während des zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten und der Achsenmächte in Zeitzündern der Geschosskaliber ab 7,5 cm verwendet.
TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner Das schweizer TAVARO-Uhrwerk wurde während des zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten und der Achsenmächte in Zeitzündern der Geschosskaliber ab 7,5 cm verwendet.
KREUZSCHLAG-VARIANTEN
 H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XVII, 1978, S. 117 ff KREUZSCHLAG-VARIANTEN Auszugsweise Übersetzung aus dem Buch von Charles Gros: Echappements d'horloges et de Montres,
H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XVII, 1978, S. 117 ff KREUZSCHLAG-VARIANTEN Auszugsweise Übersetzung aus dem Buch von Charles Gros: Echappements d'horloges et de Montres,
Kreiselpumpen. Berechnung und Konstruktion. Adam T. Troskolaiiski und Stephan Lazarkiewicz. Geleitwort von Dr. Ing. h. c.
 Kreiselpumpen Berechnung und Konstruktion Adam T. Troskolaiiski und Stephan Lazarkiewicz Professor an der Technischen Vormals Leiter des Konstruktions- Universität Wroclaw büros der Pumpenfabrik Warszawa
Kreiselpumpen Berechnung und Konstruktion Adam T. Troskolaiiski und Stephan Lazarkiewicz Professor an der Technischen Vormals Leiter des Konstruktions- Universität Wroclaw büros der Pumpenfabrik Warszawa
 Helmut Mann Porträt einer Taschenuhr Kleine Uhrenkunde für Liebhaber Impressum HEEL Verlag GmbH Gut Pottscheidt 53639 Königswinter Telefon 0 22 23 / 92 30-0 Telefax 0 22 23 / 92 30 26 Mail: info@heel-verlag.de
Helmut Mann Porträt einer Taschenuhr Kleine Uhrenkunde für Liebhaber Impressum HEEL Verlag GmbH Gut Pottscheidt 53639 Königswinter Telefon 0 22 23 / 92 30-0 Telefax 0 22 23 / 92 30 26 Mail: info@heel-verlag.de
Toleranzprobleme an Spiralfedern in mechanischen Uhren
 Toleranzprobleme an Spiralfedern in mechanischen Uhren 1 AGENDA Die Lange Uhren GmbH Das Werk Der Gang einer Uhr Das Schwingsystem Herstellung der Spirale Toleranzbetrachtung Fertigung 2 Die Lange Uhren
Toleranzprobleme an Spiralfedern in mechanischen Uhren 1 AGENDA Die Lange Uhren GmbH Das Werk Der Gang einer Uhr Das Schwingsystem Herstellung der Spirale Toleranzbetrachtung Fertigung 2 Die Lange Uhren
Leibniz-Archiv (Arbeitsstelle Hannover der Göttinger Akademie der Wissenschaften)
 Konkordanz zwischen der und den von Onno herausgegebenen Leibniz: Werke Inhalt Leibniz-Archiv (Arbeitsstelle Hannover der Göttinger Akademie der Wissenschaften) Stand: 28.1.2009 Leibniz: Werke, Hrsg.:,
Konkordanz zwischen der und den von Onno herausgegebenen Leibniz: Werke Inhalt Leibniz-Archiv (Arbeitsstelle Hannover der Göttinger Akademie der Wissenschaften) Stand: 28.1.2009 Leibniz: Werke, Hrsg.:,
Praktisches Handbuch. Reparatur und Regulierung der Uhren
 Praktisches Handbuch für Uhrmacher Anleitung zur Kenntnis der in Anwendung kommenden Metalle, zur vorteilhaftesten Einrichtung der Werkzeuge und Maschinen, zur Anfertigung von Uhren und Uhrteilen und zur
Praktisches Handbuch für Uhrmacher Anleitung zur Kenntnis der in Anwendung kommenden Metalle, zur vorteilhaftesten Einrichtung der Werkzeuge und Maschinen, zur Anfertigung von Uhren und Uhrteilen und zur
Leistung und des Dampfverbrauches
 Berechnung der Leistung und des Dampfverbrauches der Eincylinder-Dampfmaschinen. Ein Taschenbuch zum Gebrauche in der Praxis von Josef Pechan, Maschinen-Ingenieur, Professor des Maschinenbaues und Fachvorstand
Berechnung der Leistung und des Dampfverbrauches der Eincylinder-Dampfmaschinen. Ein Taschenbuch zum Gebrauche in der Praxis von Josef Pechan, Maschinen-Ingenieur, Professor des Maschinenbaues und Fachvorstand
4.3 Schwingende Systeme
 Dieter Suter - 217 - Physik B3 4.3 Schwingende Systeme Schwingungen erhält man immer dann, wenn die Kraft der Auslenkung entgegengerichtet ist. Ist sie außerdem proportional zur Kraft, so erhält man eine
Dieter Suter - 217 - Physik B3 4.3 Schwingende Systeme Schwingungen erhält man immer dann, wenn die Kraft der Auslenkung entgegengerichtet ist. Ist sie außerdem proportional zur Kraft, so erhält man eine
Wiederholung Physik I - Mechanik
 Universität Siegen Wintersemester 2011/12 Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät Prof. Dr. M. Risse, M. Niechciol Department Physik 9. Übungsblatt zur Vorlesung Physik II für Elektrotechnik-Ingenieure
Universität Siegen Wintersemester 2011/12 Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät Prof. Dr. M. Risse, M. Niechciol Department Physik 9. Übungsblatt zur Vorlesung Physik II für Elektrotechnik-Ingenieure
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag
 Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
Repassage einer Zylinderuhr und des Ankerganges
 Repassage einer Zylinderuhr und des Ankerganges von Hermann Horrmann, Uhrma.chermeister in Leipzig. Dritte revidierte und bedeutend erweiterte Auflage der im Jahre 1880 preisgekrönten Abhandlung. Preisschrift..
Repassage einer Zylinderuhr und des Ankerganges von Hermann Horrmann, Uhrma.chermeister in Leipzig. Dritte revidierte und bedeutend erweiterte Auflage der im Jahre 1880 preisgekrönten Abhandlung. Preisschrift..
Über Maschinen. und. deren mögliche Übertragungsorgane
 Über Maschinen und deren mögliche Übertragungsorgane eine Zusammenfassung/Übersicht Inhaltsverzeichnis: 1 Definition und Einteilung von Maschinen... 2 2 Übertragungsorgane, Funktion, Darstellung und Nutzung
Über Maschinen und deren mögliche Übertragungsorgane eine Zusammenfassung/Übersicht Inhaltsverzeichnis: 1 Definition und Einteilung von Maschinen... 2 2 Übertragungsorgane, Funktion, Darstellung und Nutzung
Aufbau und Wirkungsweise
 1 2 Aufbau und Wirkungsweise Zahnräder übertragen Drehbewegungen von einer Welle auf eine andere durch Formschluss und damit ohne Schlupf. Dabei greifen die Zähne des Antriebs- und des Abtriebsrades ineinander.
1 2 Aufbau und Wirkungsweise Zahnräder übertragen Drehbewegungen von einer Welle auf eine andere durch Formschluss und damit ohne Schlupf. Dabei greifen die Zähne des Antriebs- und des Abtriebsrades ineinander.
Experimentalphysik 1. Aufgabenblatt 2
 Technische Universität München Fakultät für Physik Ferienkurs Experimentalphysik 1 WS 2017/18 Aufgabenblatt 2 Annika Altwein Maximilian Ries Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabe 1(zentraler Stoß elastisch, unelastisch)
Technische Universität München Fakultät für Physik Ferienkurs Experimentalphysik 1 WS 2017/18 Aufgabenblatt 2 Annika Altwein Maximilian Ries Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabe 1(zentraler Stoß elastisch, unelastisch)
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
- WÄRMEDEHNUNG - WÄRMEDEHNUNG
 - WÄRMEDEHNUNG - WÄRMEDEHNUNG Wie allgemein bekannt, ist es eine Eigenschaft von Metall, sich bei Erwärmung auszudehnen. Abhängig von der Temperatur des durchströmenden Dampfes oder Kondensats ändert sich
- WÄRMEDEHNUNG - WÄRMEDEHNUNG Wie allgemein bekannt, ist es eine Eigenschaft von Metall, sich bei Erwärmung auszudehnen. Abhängig von der Temperatur des durchströmenden Dampfes oder Kondensats ändert sich
Wirkungsweise der Motorzähler und Meßwandler mit besonderer Berücksichtigung der Blind-, Misch- und Scheinverbrauchsmessung
 Wirkungsweise der Motorzähler und Meßwandler mit besonderer Berücksichtigung der Blind-, Misch- und Scheinverbrauchsmessung Für Betriebsleiter von Elektrizitätswerken, Zählertechniker und Studierende Von
Wirkungsweise der Motorzähler und Meßwandler mit besonderer Berücksichtigung der Blind-, Misch- und Scheinverbrauchsmessung Für Betriebsleiter von Elektrizitätswerken, Zählertechniker und Studierende Von
Mechanische Uhrwerke
 Mechanische Uhrwerke SIE WERDEN SIE SO UMFASSEND ZUFRIEDENSTELLEN, WIE KAUM EIN ANDERER ZEITMESSER ES VERMAG. Die Vorteile mechanischer Uhren und wie man sie bewahrt Warum bieten die Longines Uhrmacher
Mechanische Uhrwerke SIE WERDEN SIE SO UMFASSEND ZUFRIEDENSTELLEN, WIE KAUM EIN ANDERER ZEITMESSER ES VERMAG. Die Vorteile mechanischer Uhren und wie man sie bewahrt Warum bieten die Longines Uhrmacher
2.0 Dynamik Kraft & Bewegung
 .0 Dynamik Kraft & Bewegung Kraft Alltag: Muskelkater Formänderung / statische Wirkung (Gebäudestabilität) Physik Beschleunigung / dynamische Wirkung (Impulsänderung) Masse Schwere Masse: Eigenschaft eines
.0 Dynamik Kraft & Bewegung Kraft Alltag: Muskelkater Formänderung / statische Wirkung (Gebäudestabilität) Physik Beschleunigung / dynamische Wirkung (Impulsänderung) Masse Schwere Masse: Eigenschaft eines
Die Zeitgleichung. Joachim Gripp, Lindau bei Kiel
 Die Zeitgleichung Joachim Gripp, Lindau bei Kiel Einleitung Den meisten Sonnenuhr- Freunden ist die Zeitgleichung gut bekannt. Sie ist als Unterschied zwischen der von einer Sonnenuhr angezeigten Sonnenzeit
Die Zeitgleichung Joachim Gripp, Lindau bei Kiel Einleitung Den meisten Sonnenuhr- Freunden ist die Zeitgleichung gut bekannt. Sie ist als Unterschied zwischen der von einer Sonnenuhr angezeigten Sonnenzeit
 Hans Hager Reparatur amerikanischer Pendeluhren und ihrer weltweiten Nachbauten Anleitung für Einsteiger und Uhrenliebhaber mit Interesse an der Technik Verlag Inhaltsverzeichnis 1 Definition einer Amerikaneruhr...
Hans Hager Reparatur amerikanischer Pendeluhren und ihrer weltweiten Nachbauten Anleitung für Einsteiger und Uhrenliebhaber mit Interesse an der Technik Verlag Inhaltsverzeichnis 1 Definition einer Amerikaneruhr...
Zahnradgetriebe und Riementrieb (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Zahnradgetriebe und Riementrieb (Artikelnr.: P1001300) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Mechanik Unterthema: Kräfte, einfache
Lehrer-/Dozentenblatt Zahnradgetriebe und Riementrieb (Artikelnr.: P1001300) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Mechanik Unterthema: Kräfte, einfache
DIE ENTDECKUNG DES KINDES
 \ MARIA MONTESSORI DIE ENTDECKUNG DES KINDES Herausgegeben und eingeleitet von Paul Oswald und Günter Schulz-Benesch Vierte Auflage HERDER Freiburg Basel Wien INHALT Vorwort der Herausgeber V Einführung
\ MARIA MONTESSORI DIE ENTDECKUNG DES KINDES Herausgegeben und eingeleitet von Paul Oswald und Günter Schulz-Benesch Vierte Auflage HERDER Freiburg Basel Wien INHALT Vorwort der Herausgeber V Einführung
Challenge BAUFAHRZEUGE. Konstruktionen 1 bis 35
 CONSTRUCTION Challenge BAUFAHRZEUGE Konstruktionen bis 5 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Überlagerung von zwei Balken Überlagerung von Balken mit zwei Stiften Verbindung von Balken Überlagerung von
CONSTRUCTION Challenge BAUFAHRZEUGE Konstruktionen bis 5 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Überlagerung von zwei Balken Überlagerung von Balken mit zwei Stiften Verbindung von Balken Überlagerung von
VAJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA ZA ŠTUDENTE STROJNIŠTVA
 Fakulteta za strojništvo VAJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA ZA ŠTUDENTE STROJNIŠTVA Tanja Županek Maribor, 2014 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 811.112.2:621(075.8)(076) ŽUPANEK,
Fakulteta za strojništvo VAJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA ZA ŠTUDENTE STROJNIŠTVA Tanja Županek Maribor, 2014 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 811.112.2:621(075.8)(076) ŽUPANEK,
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag
 Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
Beobachtungen am Himmel. Manuel Erdin Gymnasium Liestal, 2010
 Beobachtungen am Himmel Manuel Erdin Gymnasium Liestal, 2010 Grundsätze Alle am Himmel beobachtbaren Objekte befinden sich auf der Innenseite einer Kugel. Wir als Beobachter sind in Ruhe. Die Himmelskugel
Beobachtungen am Himmel Manuel Erdin Gymnasium Liestal, 2010 Grundsätze Alle am Himmel beobachtbaren Objekte befinden sich auf der Innenseite einer Kugel. Wir als Beobachter sind in Ruhe. Die Himmelskugel
Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, welches Sie hier erwerben können:
 Prof. Dipl. Ing. Ludwig Lehotzky TECHNISCHE GRUNDLAGEN DER MECHANISCHEN UHREN VON DER TURM- BIS ZUR ARMBANDUHR III Haftungsausschluss Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden von dem Autor damals
Prof. Dipl. Ing. Ludwig Lehotzky TECHNISCHE GRUNDLAGEN DER MECHANISCHEN UHREN VON DER TURM- BIS ZUR ARMBANDUHR III Haftungsausschluss Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden von dem Autor damals
Inhaltsverzeichnis.
 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Überblick 1 1.1 Zielsetzung 1 1.2 Übertragen der Drehbewegung durch Tangential- und Normalflächenschluß 2 1.3 Aufgaben der Zahnradpaarungen 6 1.4 Einteilung der Zahnradpaarungen
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Überblick 1 1.1 Zielsetzung 1 1.2 Übertragen der Drehbewegung durch Tangential- und Normalflächenschluß 2 1.3 Aufgaben der Zahnradpaarungen 6 1.4 Einteilung der Zahnradpaarungen
Versuch über den menschlichen Verstand
 JOHN LOCKE Versuch über den menschlichen Verstand In vier Büchern Band I: Buch I und II FELIX MEINER VERLAG HAMBURG INHALT BAND I Widmung i Sendschreiben an den Leser 5 Einleitung 22 ERSTES BUCH: WEDER
JOHN LOCKE Versuch über den menschlichen Verstand In vier Büchern Band I: Buch I und II FELIX MEINER VERLAG HAMBURG INHALT BAND I Widmung i Sendschreiben an den Leser 5 Einleitung 22 ERSTES BUCH: WEDER
Vorwort. 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3. 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4. 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8
 Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung V XXIII 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8 1.3 Kupferdruckgusslegierungen
Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung V XXIII 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8 1.3 Kupferdruckgusslegierungen
Antike Spindeltaschenuhr mit Viertelrepetition im Goldgehäuse
 Juwelier & Uhrmachermeister Jochen Tröger Antike Spindeltaschenuhr mit Viertelrepetition im Goldgehäuse Öffnungszeiten Mo. bis Sa. : 09:00-13:00 Mo., Di., Do. und Fr. : 13:30-18:30 Adresse Bahnstraße 7
Juwelier & Uhrmachermeister Jochen Tröger Antike Spindeltaschenuhr mit Viertelrepetition im Goldgehäuse Öffnungszeiten Mo. bis Sa. : 09:00-13:00 Mo., Di., Do. und Fr. : 13:30-18:30 Adresse Bahnstraße 7
Bearbeitungszeit: Name: Erklärung
 Ausgabe: Mittwoch, 05.05.2004 Abgabe: Freitag, 14.05.2004 Am Freitag den 14.05.2004 halte ich die Mathestunde. Bring deshalb auch dann dein Übungsblatt mit! Bearbeitungszeit: Name: Erklärung 1 2 3 Pflichtaufgabe
Ausgabe: Mittwoch, 05.05.2004 Abgabe: Freitag, 14.05.2004 Am Freitag den 14.05.2004 halte ich die Mathestunde. Bring deshalb auch dann dein Übungsblatt mit! Bearbeitungszeit: Name: Erklärung 1 2 3 Pflichtaufgabe
06/02/12. Matrikelnummer: Folgende Angaben sind freiwillig: Name, Vorname: Studiengang: Hinweise:
 Prof Dr-Ing Ams Klausur Technische Mechanik C 06/0/1 Matrikelnummer: Folgende Angaben sind freiwillig: Name, Vorname: Studiengang: Hinweise: - Die Prüfungszeit beträgt zwei Stunden - Erlaubte Hilfsmittel
Prof Dr-Ing Ams Klausur Technische Mechanik C 06/0/1 Matrikelnummer: Folgende Angaben sind freiwillig: Name, Vorname: Studiengang: Hinweise: - Die Prüfungszeit beträgt zwei Stunden - Erlaubte Hilfsmittel
Betriebsanleitung Universal-Teilapparat Bs-2 133mm Spitzenhöhe Art. Nr
 Betriebsanleitung Universal-Teilapparat Bs-2 133mm Spitzenhöhe Art. Nr. 6245-030 Standardzubehör: Reitstock Spitzen für Teilkopf und Reitstock Direkte Teilscheibe mit 24 Teilungen 3 indirekte Teilscheiben
Betriebsanleitung Universal-Teilapparat Bs-2 133mm Spitzenhöhe Art. Nr. 6245-030 Standardzubehör: Reitstock Spitzen für Teilkopf und Reitstock Direkte Teilscheibe mit 24 Teilungen 3 indirekte Teilscheiben
M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen
 M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
Verbrennungskraftmaschine
 Die Verbrennungskraftmaschine Herausgegeben von Prof. Dr. Hans List Graz Band 9 Die Steuerung der' Verbrennungskraftmaschinen Springer-Verlag Wien GmbH Die Steuerung der Verbrennungskraftmaschinen Von
Die Verbrennungskraftmaschine Herausgegeben von Prof. Dr. Hans List Graz Band 9 Die Steuerung der' Verbrennungskraftmaschinen Springer-Verlag Wien GmbH Die Steuerung der Verbrennungskraftmaschinen Von
Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Uhrenfabrik UNION # Fournituren
 Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Uhrenfabrik UNION 11.09.2017 # Fournituren Bemerkungen Werknummer Ident. Gehäusenr. Savonette Halbsavonette Lepine Mariage Gold
Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Uhrenfabrik UNION 11.09.2017 # Fournituren Bemerkungen Werknummer Ident. Gehäusenr. Savonette Halbsavonette Lepine Mariage Gold
Lösungen für die Aufgaben zum Zahntrieb
 Lösungen für die Aufgaben zum Zahntrieb 1) Abmessungen am Zahnrad Diese Aufgabe wird nachgereicht: 0 ) Zahnrad gegeben: a) m = 3mm; d = 75mm gesucht: a) z =? Zähnezahl berechnen: z = d m z = 75mm 3mm z
Lösungen für die Aufgaben zum Zahntrieb 1) Abmessungen am Zahnrad Diese Aufgabe wird nachgereicht: 0 ) Zahnrad gegeben: a) m = 3mm; d = 75mm gesucht: a) z =? Zähnezahl berechnen: z = d m z = 75mm 3mm z
Hydrostatische Führungen und Lager
 Hydrostatische Führungen und Lager Božina Perović Hydrostatische Führungen und Lager Grundlagen, Berechnung und Auslegung von Hydraulikplänen 2123 Prof. Dr.-Ing. Božina Perović Blohmstr. 3 12307 Berlin
Hydrostatische Führungen und Lager Božina Perović Hydrostatische Führungen und Lager Grundlagen, Berechnung und Auslegung von Hydraulikplänen 2123 Prof. Dr.-Ing. Božina Perović Blohmstr. 3 12307 Berlin
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Mechanik I: Geschwindigkeit, Kraft, Masse
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Mechanik I: Geschwindigkeit, Kraft, Masse Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Hinweise zur Arbeit mit diesen Unterrichtseinheiten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Mechanik I: Geschwindigkeit, Kraft, Masse Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Hinweise zur Arbeit mit diesen Unterrichtseinheiten
*DE A *
 (19) *DE102014015800A120160428* (10) DE 10 2014 015 800 A1 2016.04.28 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2014 015 800.4 (22) Anmeldetag: 24.10.2014 (43) Offenlegungstag: 28.04.2016 (71) Anmelder:
(19) *DE102014015800A120160428* (10) DE 10 2014 015 800 A1 2016.04.28 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2014 015 800.4 (22) Anmeldetag: 24.10.2014 (43) Offenlegungstag: 28.04.2016 (71) Anmelder:
DAS FACHZEICHNEN DES UHRMACHERS
 DAS FACHZEICHNEN DES UHRMACHERS Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt von C. Jos. Linnartz t Uhrmachermeister
DAS FACHZEICHNEN DES UHRMACHERS Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt von C. Jos. Linnartz t Uhrmachermeister
Plandrehen. Beispiel für eine Plansckeibe 108 Bestimmen der Laufzeit nach Koeffizienten 114. Bibliografische Informationen
 Inhaltsverzeichnis. Einleitung 11 Die Bedeutung der Kalkulation 21 Die Vorkalkulation 25 Erklärung der, Schnittgeschwindigkeit 26 Der Vorschub 31 I. Drehen. Formeln für Langdrehen 37 Formeln für Plandrehen
Inhaltsverzeichnis. Einleitung 11 Die Bedeutung der Kalkulation 21 Die Vorkalkulation 25 Erklärung der, Schnittgeschwindigkeit 26 Der Vorschub 31 I. Drehen. Formeln für Langdrehen 37 Formeln für Plandrehen
Archimedische Spiralen
 Hauptseminar: Spiralen WS 05/06 Dozent: Prof. Dr. Deißler Datum: 31.01.2006 Vorgelegt von Sascha Bürgin Archimedische Spiralen Man kann sich auf zwei Arten zeichnerisch den archimedischen Spiralen annähern.
Hauptseminar: Spiralen WS 05/06 Dozent: Prof. Dr. Deißler Datum: 31.01.2006 Vorgelegt von Sascha Bürgin Archimedische Spiralen Man kann sich auf zwei Arten zeichnerisch den archimedischen Spiralen annähern.
Übung zu Mechanik 1 Seite 65
 Übung zu Mechanik 1 Seite 65 Aufgabe 109 Gegeben ist das skizzierte System. a) Bis zu welcher Größe kann F gesteigert werden, ohne daß Rutschen eintritt? b) Welches Teil rutscht, wenn F darüber hinaus
Übung zu Mechanik 1 Seite 65 Aufgabe 109 Gegeben ist das skizzierte System. a) Bis zu welcher Größe kann F gesteigert werden, ohne daß Rutschen eintritt? b) Welches Teil rutscht, wenn F darüber hinaus
Zykloide. Lars Ehrenborg. 15. Januar Definition/Erzeugungsweise 2. 2 Herleitung der Parameterdarstellung 2. 4 Fläche eines Zykloidenbogens 4
 Zykloide Lars Ehrenborg 15. Januar 2017 Inhaltsverzeichnis 1 Definition/Erzeugungsweise 2 2 Herleitung der Parameterdarstellung 2 3 hübsche Eigenschaft 3 4 Fläche eines Zykloidenbogens 4 5 Normale und
Zykloide Lars Ehrenborg 15. Januar 2017 Inhaltsverzeichnis 1 Definition/Erzeugungsweise 2 2 Herleitung der Parameterdarstellung 2 3 hübsche Eigenschaft 3 4 Fläche eines Zykloidenbogens 4 5 Normale und
CLUB APOLLO 13, 12. Wettbewerb Aufgabe 4
 CLUB APOLLO 13, 12. Wettbewerb Aufgabe 4 Von Zahnrädern und Getrieben Die vierte Apollo-Aufgabe wird vom Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität
CLUB APOLLO 13, 12. Wettbewerb Aufgabe 4 Von Zahnrädern und Getrieben Die vierte Apollo-Aufgabe wird vom Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität
BERECHNUNG EINES STIRNZAHN-
 BH Ausführung: F. Blömer M. Hinkelammert Entwicklung und Konstruktion -Auslegung eines Getriebes zur Kraftübertragung- Klasse: FSBA 2 Technikerschule Hannover Fachlehrer: Hr. Rissiek 29..204 HB B BERECHNUNG
BH Ausführung: F. Blömer M. Hinkelammert Entwicklung und Konstruktion -Auslegung eines Getriebes zur Kraftübertragung- Klasse: FSBA 2 Technikerschule Hannover Fachlehrer: Hr. Rissiek 29..204 HB B BERECHNUNG
B Konstruktion. Werktstoff 16MnCr5 (1.7131): Vorgegebene Werte:
 B Konstruktion Tabelle1 Vorgegebene Werte: Drehzahl [1/min] Startleistung [kw] Planetengetriebe Eingang 3520 377 Planetengetriebe Ausgang 565 369 Eingriffswinkel α 20.00 0.3491 Verzahnungsqualität Q 5
B Konstruktion Tabelle1 Vorgegebene Werte: Drehzahl [1/min] Startleistung [kw] Planetengetriebe Eingang 3520 377 Planetengetriebe Ausgang 565 369 Eingriffswinkel α 20.00 0.3491 Verzahnungsqualität Q 5
Die Berechnung von rotierenden Scheiben und Schalen
 Die Berechnung von rotierenden Scheiben und Schalen Von Dr.-Ing. Kurt Loffler Leiter der Abteilung Triebwerksdynamik der Daimler-Benz A.G. Stuttgart Mit 92 Abbildungen und 4 Kurvenbliittern im Text sowie
Die Berechnung von rotierenden Scheiben und Schalen Von Dr.-Ing. Kurt Loffler Leiter der Abteilung Triebwerksdynamik der Daimler-Benz A.G. Stuttgart Mit 92 Abbildungen und 4 Kurvenbliittern im Text sowie
