Die Uhr und ihre Funktionen
|
|
|
- Michaela Bader
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Uhr mit mechanischem Uhrwerk liegt seit einigen Jahren wieder im Trend. Aber dieses mechanische Innenleben der Uhr bedarf der Erklärung und Erläuterung. Und genau hier greift dieses Buch des Autors Klaus Menny an, welches nun in einer überarbeiteten neuen Auflage vorliegt. Menny stellt die Technik in mechanischen Uhren sowohl die von Armbanduhren, als auch von Großuhren von ihren Anfängen bis heute umfassend dar und bietet eine hervorragende Einführung in das Thema. Am Anfang erklärt der Autor den grundsätzlichen Aufbau eines Uhrwerks und beschreibt die verschiedenen Arten der Antriebe und das Räderwerk. Den Gangreglern und Hemmungen, die das Herz jeder Uhr bilden, ist angemessener Raum gewidmet. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit den Zeigerwerken, Kalenderschaltungen und Chronographen. Berücksichtigt werden auch Schlagwerke, Musikwerke und Figurenautomaten bis hin zum ganz alltäglichen Wecker. Ein eigenes Kapitel bietet einen Überblick über Reparaturarbeiten, die auch von einem Nichtfachmann ausgeführt werden können, sowie Hinweise über das Zerlegen, Reinigen und Zusammensetzen von Uhren. Obgleich mechanische Uhren das eigentliche Thema des Buches bilden, wird in einem Exkurs kurz auf elektromechanische und elektronische Uhren eingegangen. Da vor allem der interessierte Laie angesprochen wird, ist in diesem Buch großer Wert auf eine anschauliche Darstellung gelegt worden. Alle beschriebenen Konstruktionen sind neben dem Text in klaren, übersichtlichen Zeichnungen festgehalten. Klaus Menny Die Uhr und ihre Funktionen Klaus Menny Die Uhr und ihre Funktionen Für Sammler und Liebhaber ISBN HEEL
2 Die Uhr und ihre Funktionen
3 Klaus Menny Die Uhr und ihre Funktionen Für Sammler und Liebhaber (Hrsg. Michael Stern) HEEL
4 Über den Autor Klaus Menny wurde 1930 in Potsdam geboren. Nach seinem Abitur studierte er das Fach Maschinenbau an der Berliner Technischen Universität. Als Diplom-Ingenieur arbeitete er dann bei der Firma Voith in Heidenheim, Baden-Württemberg. Danach lehrte er als Professor an der Fachhochschule in Hannover das Fach Maschinenbau. Sein Spezialgebiet waren die Strömungsmaschinen, über die er auch einige Bücher publizierte. Dem Hobby mechanische Uhren widmete er seine Freizeit. In diesem Rahmen übersetzte er Uhrenbücher und Fachartikel vom Englischen ins Deutsche (z. B. Penman Alte Uhren reparieren, Smith Standuhren reparieren ) und schrieb dieses Uhrenbuch. Leider blieb sein letztes Projekt die Konstruktion und der Bau einer Holzräderuhr unvollendet. Klaus Menny verstarb 2007 in Hannover.
5 Inhalt Vorwort... 9 Zeit und Zeitmessung Einleitung Aufbau und Funktionsweise einer einfachen mechanischen Uhr Bauteile von Uhren Antrieb Zahnräder Lager Werkgestell Gangregler Pendel Unruh und Feder Hemmungen Zweck Rückführende Hemmungen Ruhende Hemmungen Freie Hemmungen Freie Pendelhemmungen Tourbillons Zeiger- und Kalenderwerke Zeigerwerke Kalender Chronographen Schlagwerke und Weckeinrichtungen Übersicht Schlossscheibenschlagwerke Rechenschlagwerke Viertelstundenschlagwerke Melodieschlagwerke und Figurenautomaten Wecker Aufzugsysteme von Kleinuhren Einleitung Aufzug und Zeigerstellung Automatischer Aufzug Reparaturen Vorbemerkung Zerlegen Reinigen Zusammensetzen Reparieren Exkurs Von der mechanischen zur elektronischen Uhr Begriffserklärungen Abbildungen Literaturhinweis Abbildungsnachweis Register
6 Vorwort Jeder Mensch treibt seine Liebhabereien sehr ernsthaft, meistens ernsthafter als seine Geschäfte. (Goethe) Mechanische Uhren gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Sie gehören damit zu den ältesten Erzeugnissen moderner Technik. Der in ihnen verwirklichte Erfindungsreichtum, ihre komplizierte und sinnreiche Mechanik und nicht zuletzt ihre Schönheit haben von jeher nicht nur den Fachmann begeistert, sondern auch und gerade solche Menschen, deren berufliche Aufgaben nichts mit der Fertigung oder der Reparatur dieser Werke zu tun hatten. In unserer Zeit, da die mechanischen Uhren zunehmend von ihren elektronischen Nachfolgern verdrängt werden, hat diese Faszination eher noch zugenommen. Ja gerade dass sie beginnen, unmodern zu werden, verleiht den mechanischen Uhren einen nostalgischen Reiz. Es gibt eine ganze Reihe guter Bücher über die Geschichte der Zeitmessung. Mit diesen Standardwerken zu wetteifern, die durch ihre aufwendigen Bildteile auch meist sehr teuer sind, ist nicht meine Absicht. Vielmehr habe ich mich bemüht, den Umfang des vorliegenden Buches durch die Beschränkung auf den technischen Aspekt bewusst knapp zu halten. Ohne auf künstlerische oder stilkundliche Fragen zur Gestaltung der Gehäuse einzugehen, habe ich versucht, die Technik mechanischer Uhren einigermaßen vollständig zu behandeln, wenn auch wirkliche Vollständigkeit bei diesem Thema kaum zu erreichen ist. Ich denke, dass es Uhrenfreunde geben wird, die gerne verstehen möchten, welche mechanischen Abläufe in Uhren vorgehen, welche Gesichtspunkte bei ihrer Konstruktion und Fertigung beachtet worden sind und welche klugen Erfindungen gemacht wurden, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Zeitmesser zu verbessern oder auch den Komfort für den Benutzer zu erhöhen. Obgleich elektromechanische und elektronische Uhren nicht zum eigentlichen Thema gehören, ist ihnen ein kurzer Abschnitt im Anhang gewidmet worden. Irgendwelche Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, auch keine mathematischen. Lediglich im Kapitel über die Gangregler bin ich der Versuchung erlegen, einige wenige Formeln anzugeben. Einfacher als in der Sprache der Mathematik lassen sich manche Zusammenhänge nicht beschreiben. Aus Rücksicht auf solche Leser, die allein schon durch den Anblick von Gleichungen erschreckt und abgestoßen werden, habe ich aber versucht, wo immer mir das möglich war, theoretische Berechnungen durch anschauliche Zeichnungen oder Diagramme zu ersetzen. Einige Fachbegriffe habe ich im Anhang zum raschen Nachschlagen knapp erläutert. Ich hoffe, auch auf diese Weise einen vernünftigen Kompromiss zwischen der nötigen Klarheit und der erwünschten leichten Lesbarkeit gefunden zu haben. Herrn Uhrmachermeister Habinger in München danke ich für die kritische Durchsicht des Manuskripts und manche guten Ratschläge. In dieser korrigierten Auflage wurden Kleinigkeiten korrigiert und die neue deutsche Rechtschreibung verwendet. Klaus Menny Ronnenberg
7 Zeit und Zeitmessung Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. (Prediger 3. 1) Einleitung Eine Uhr dient dem Zweck, die Zeit zu messen. Aber was ist eigentlich Zeit, und wie kann man sie messen? Die erste dieser beiden Fragen macht überraschend große Schwierigkeiten. Obgleich bedeutende Philosophen, unter anderen Aristoteles, Kant und Heidegger, darüber nachgedacht haben, ist es nicht möglich, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was Zeit ist, möglicherweise weiß es auch niemand. Das ist um so erstaunlicher, als ja die Zeit eine Grunddimension des Lebens schlechthin ist und jedermann zu wissen glaubt, was sie ist. Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich s, will ich s aber einem Fragenden erklären, weiß ich s nicht, sagt Augustinus über die Zeit. In der Physik, wo sie zu den wichtigsten Grundgrößen zählt, war bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts die von Newton gegebene Beschreibung wohl unumstritten, der gesagt hat: Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. In der modernen relativistischen Physik gilt dieser Zeitbegriff nicht mehr. Die Zeit ist keine absolute Größe, sondern sie hängt vom Bezugssystem des Beobachters ab. Überdies ist der Zeitbegriff aufs engste mit dem des Raumes verwoben. Das geometrische Verhalten von Körpern und der Gang von Uhren sind von der Geometrie der Raum- Zeit abhängig. Albert Einstein wird der Ausspruch nachgesagt: Zeit ist, was mit Uhren gemessen wird. In der Tat hätten wir überhaupt keine Möglichkeit, Newtons absolute Zeit, wenn es sie gäbe, wahrzunehmen oder gar zu messen. Möglich ist es einzig und allein, die Dauer einer Bewegung mit irgendeiner anderen Bewegung zu vergleichen, zum Beispiel mit der Erdumdrehung oder der Drehung des Uhrzeigers. Man beachte aber den Unterschied zu anderen physikalischen Größen. Während etwa eine elektrische Spannung unter Ausnutzung bestimmter physikalischer Effekte den Zeiger des Voltmeters ausschlagen lässt, kann die Zeit selbst keine Uhr bewegen. Die Einteilung der Zeit in Jahre, Monate und Tage ergibt sich aus astronomischen Fakten und muss als naturgegeben hingenommen werden. Die weitere Unterteilung in Stunden, Minuten und Sekunden ist dagegen rein willkürlich und nicht einmal besonders zweckmäßig, da sie zu unserem dezimalen Zahlensystem nicht passt. Während es kinderleicht ist, einen Euro-Betrag in Cent umzurechnen, erfordert es schon etwas Kopfrechnen, um eine in Tagen, Stunden und Minuten gegebene Zeitspanne in Sekunden auszudrücken. Die aus dem babylonischen Kulturkreis stammende Unterteilung auf der Grundlage der Zahlen 12 und 60 ist indessen so alt und so fest in unserem Alltagsleben verwurzelt, dass es wohl keinen Sinn hätte, hieran etwas zu ändern. Während der Französischen Revolution hat es einen solchen Versuch gegeben, der aber nur vorübergehend erfolgreich war. Uhren aus dieser Zeit haben oft außer dem Dezimalzifferblatt noch eine Anzeige der konventionellen Art (Abb. 1.1, S. 12). Da zwar der Tag in beiden Fällen gleich lang ist, aber die Dezimalstunden länger sind als die herkömmlichen (2,4 h), kommt man mit einem gemeinsamen Stundenzeiger aus, für die Minuten sind dagegen zwei Zeiger nötig, ein schneller für die herkömmlichen und ein langsamer für die Dezimalminuten. 11
8 1.1 Zifferblatt einer Revolutionsuhr mit dezimaler und konventioneller Zeitangabe. Von innen nach außen: 10 Dezimalstunden, zwei mal 12 konventionelle Stunden, 100 Dezimalminuten, 60 konventionelle Minuten Die Sekunde als die Grundeinheit der Zeitmessung war bis zum Jahre 1967 als der Teil des mittleren Sonnentages definiert, wobei der Bezug auf einen mittleren Sonnentag deshalb nötig ist, weil die Eigendrehung der Erde relativ zur Sonne im Laufe eines Jahres bestimmten periodischen Schwankungen unterworfen ist. Diese Relativbewegung entsteht durch die Überlagerung der Erdrotation mit dem Umlauf der Erde um die Sonne. Die Letztere gehorcht dem zweiten Keplerschen Gesetz 1 und hat deshalb keine konstante Geschwindigkeit. So weicht die wahre Sonnenzeit, die von einer Sonnenuhr angezeigt wird, von der mittleren Zeit unserer Armbanduhren mehr oder weniger stark ab, bis zu etwa 16 Minuten. Diese als Zeitgleichung bezeichnete Differenz wird auf dem Zifferblatt manch einer alten Uhr angezeigt, um dem Benutzer jederzeit eine Kontrolle anhand einer Sonnenuhr zu ermöglichen. 1 s. Begriffserklärungen S. 87 Nun hat sich aber auch die Präzision der Erdumdrehung gegenüber dem Fixsternhimmel für genaueste physikalische Messungen als nicht ausreichend erwiesen. Auch hier gibt es mit dem Jahreszyklus periodische Schwankungen, und außerdem nimmt die Drehgeschwindigkeit der Erde stetig, wenn auch geringfügig ab. Deshalb ist die Sekunde heute als das fache der Schwingungsdauer einer bestimmten Strahlung des Cäsiumatoms festgelegt. Cäsiumatomuhren sind nämlich die genauesten Uhren, die heute verfügbar sind. So hat man ausgerechnet, dass die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig erst in 3 Millionen Jahren um eine Sekunde vom wahren, der Sekundendefinition entsprechenden Wert abweichen würden. Zur Angleichung der Zeitmessung mit unveränderlich langen Sekunden an die nicht konstante Erddrehung werden von Zeit zu Zeit, gewöhnlich in der Silvesternacht, Schaltsekunden eingefügt. 12
9 1.2 Baugruppen von Uhren Aufbau und Funktionsweise einer einfachen mechanischen Uhr Grundprinzip: In allen heute verwendeten Uhren bildet ein schwingungsfähiges System die Grundlage der Zeitmessung. Das muss bei weitem keine Atomschwingung sein, es kann ein Pendel, eine Unruh, eine Stimmgabel oder ein Quarzkristall sein. Wichtig ist nur, dass die Schwingungszeit des Gangreglers möglichst konstant ist, damit für die Zeitmessung ein Vergleichsnormal zur Verfügung steht. Ein weiteres Bauelement einer jeden Uhr ist ein Energiespeicher, aus welchem dem Schwinger so viel Energie zugeführt wird, dass er trotz der unvermeidlichen Reibungsverluste weiter arbeitet. Dies kann ein hochgezogenes Gewicht sein, eine gespannte Feder oder eine elektrische Batterie. Weiter ist eine Übersetzung notwendig, eine Einrichtung, welche die Energie vom Speicher bis zum Schwingungssystem überträgt, wofür ein Zahnradgetriebe oder auch eine elektronische Schaltung in Frage kommen. Schließlich ist eine Einrichtung nötig, um die Zahl der Schwingungen zu zählen und in geeigneter Weise anzuzeigen. Dazu gibt es analoge oder digitale Anzeigen. Auf dem bekannten Zifferblatt wird die Zeit auf eine analoge Größe, den Winkel zwischen der 12 und den Zeigern, abgebildet. Die Flüssigkristallanzeige einer elektronischen Uhr gibt die Zeit in festgelegten kleinsten Schritten, meist Sekunden, digital, also zahlenmäßig, an. In Abbildung 1.2 ist ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Verwirklichung der genannten Aufgaben gegeben. 13
10 Pendeluhr mit Gewichtsantrieb Bei dem Uhrwerk in Abbildung 1.3 treibt das Gewicht 1 mittels eines um die Walze 2 geschlungenen Seils das Räderwerk an, wobei die Kraft über die verschiedenen Radpaare bis auf das Gangrad oder Hemmungsrad 3 übertragen wird. Der Ablauf des Werkes wird dort durch das Zusammenspiel von Gangrad und Anker 4 gehemmt und durch die Schwingung des mit ihm verbundenen Pendels 5 gesteuert. Das Gangrad kann sich nur dann weiter bewegen, wenn das Pendel den Anker in eine solche Stellung gebracht hat, dass er einen Hemmradzahn freigibt. Zugleich greift aber die andere Ankerpalette in einen Zahnzwischenraum ein und begrenzt dadurch die Bewegung des Gangrades auf eine halbe Zahnteilung. Während nun das Pendel zurückschwingt, drückt der Hemmradzahn auf die schräge Fläche der Ankerpalette und übt so über die Ankergabel 6 eine Kraft in der Bewegungsrichtung des Pendels auf dieses aus und führt ihm einen kleinen Energiebetrag zu. Sobald auch diese Ankerpalette ihren Hemm- zahn freigegeben hat, kann sich das Spiel wiederholen. Die Schwingungsweite des Pendels wird sich auf einen Gleichgewichtszustand einstellen, bei dem die Reibungsverluste gerade durch die Energiezufuhr ausgeglichen werden. Ist auf diese Weise dafür gesorgt, dass sich das Gangrad im Takt der Pendelschwingung bewegt, müssen die Zähnezahlen des Räderwerkes unter Berücksichtigung der Pendellänge noch so berechnet werden, dass das Minutenrad 7 sich einmal in der Stunde dreht, also mit der Geschwindigkeit des Minutenzeigers. Die Übersetzung im Verhältnis 12:1 für den Stundenzeiger besorgt das Zeigerwerk. Zu ihm gehört das kleine Zahnrad 8, das auf ein Rohr, also eine Hohlwelle montiert ist und mit ihr zusammen das verzahnte Viertelrohr bildet. Weitere Bestandteile sind das Wechselrad 9 und das Stundenrad 10. Letzteres sitzt wiederum auf einem Rohr, damit beide Zeiger einen gemeinsamen Drehpunkt haben können. Mit den Zähnezahlen z st für das Stundenrad, z w für das Wechselrad, z w für das Wechselradtrieb und z v für das Viertelrohr ergibt sich die Übersetzung i: Gl Prinzipdarstellung einer Pendeluhr mit Gewichtsantrieb Um das Stellen der Zeiger zu ermöglichen, muss das gesamte Zeigerwerk gegenüber dem eigentlichen Uhrwerk verdreht werden können, denn dieses kann sich ja nur mit der vom Pendel aufgezwungenen Geschwindigkeit bewegen. Zwischen dem Minutenrad und seiner Welle ist deshalb eine Reibkupplung vorgesehen, die zum Beispiel darin besteht, dass das Minutenrad lose auf der Welle sitzt und durch eine Feder gegen einen Wellenabsatz gedrückt wird. Oder das Viertelrohr sitzt reibend auf der Minutenwelle, wie in der Zeichnung dargestellt. Die Reibung muss so groß sein, dass das Zeigerwerk im normalen Gang einwandfrei mitgenommen wird, und so gering, dass sich die Zeiger leicht stellen lassen. Die in Abbildung 1.3 freischwebend gezeichneten Wellen sind in Wirklichkeit mit ihren Lagerzapfen in einem Werkgestell gelagert. Dieses ist hier weggelassen worden, um die wesentlichen Teile deutlicher hervortreten zu lassen. In gleicher Weise wurde bei vielen anderen Abbildungen in diesem Buch verfahren. 14
11 Bauteile von Uhren Das Talent stellt nur Teile dar, das Genie das Ganze des Lebens. (Jean Paul) Antrieb Gewichtsantrieb Am einfachsten lässt sich eine Uhr durch ein langsam fallendes Gewicht mit der notwendigen Energie versorgen. Das ist nicht nur konstruktiv einfach, ein solcher Antrieb bietet auch einen ganz entscheidenden Vorteil für die Genauigkeit der Zeitmessung. Die Antriebskraft bleibt nämlich während des Ablaufens des Gewichtes unverändert. Dieser Vorteil ist so erheblich, dass Präzisionspendeluhren immer gewichtgetrieben sind. Nachteilig ist allerdings, dass die Uhr nur für einen ortsfesten Einsatz zu gebrauchen ist, und dass die Gewichte einen hinreichenden Fallweg benötigen. Für kleine und für transportable Uhren kommt der Gewichtsantrieb deshalb nicht in Frage. Die Gewichte können an Ketten oder an Seilen aufgehängt sein. Die Ketten, die es zum Beispiel bei Schwarzwalduhren gibt, werden über Kettenräder (Abb. 2.1) geführt. Zum Aufziehen zieht man einfach am entgegengesetzten Ende der Kette und dreht dadurch das Kettenrad im zur Ablaufrichtung entgegengesetzten Drehsinn. Doch dadurch entsteht bereits ein konstruktives Problem, denn das Uhrwerk kann sich ja nur vorwärts und übrigens auch nur mit der von der Hemmung aufgezwungenen Geschwindigkeit bewegen. Deshalb muss das Kettenrad in der Aufzugrichtung frei drehbar sein, während es in der Ablaufrichtung das Uhrwerk mitnehmen muss. Das Konstruktionsteil, das diese Aufgabe übernimmt, heißt Gesperr und besteht aus dem mit dem Kettenrad verbundenen Sperrrad mit sägezahnförmigen Zähnen und einer auf dem Antriebsrad sitzenden federbelasteten Klinke, die Sperrkegel heißt, obgleich ihre Form nicht an einen Kegel erinnert (Abb. 2.2). Unabhängig von der Art des Antriebes muss jede Uhr für den Aufzug ein solches Gesperr haben. Die Sperrzähne sind um den Winkel α leicht unterschnitten, damit die auf den Sperrkegel 2.1 Kettenantrieb: 1 Kettenrad, 2 Antriebsrad, Sperrrad, 4 Sperrkegel, 5 Sperrfeder 2.2 Gesperr einer federgetriebenen Großuhr: 1 Aufzugvierkant, 2 Sperrrad, 3 Sperrkegel, 4 Feder für Sperrkegel 15
Die Uhr und ihre Mechanik
 Klaus Menny Die Uhr und ihre Mechanik Für Sammler und Liebhaber Michael Stern (Hrsg.) Über den Autor Klaus Menny wurde 1930 in Potsdam geboren. Nach seinem Abitur studierte er das Fach Maschinenbau an
Klaus Menny Die Uhr und ihre Mechanik Für Sammler und Liebhaber Michael Stern (Hrsg.) Über den Autor Klaus Menny wurde 1930 in Potsdam geboren. Nach seinem Abitur studierte er das Fach Maschinenbau an
Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr. Click here if your download doesn"t start automatically
 Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr Click here if your download doesn"t start automatically Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur
Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr Click here if your download doesn"t start automatically Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur
Grundbegriffe zur Beschreibung von Kreisbewegungen
 Arbeitsanleitung I Kreisbewegung Grundbegriffe zur Beschreibung von Kreisbewegungen Beschreibung der Kreisbewegung 1 1.1 Das Bogenmass 1.2 Begriffe zur Kreisbewegung 1.3 Die Bewegung auf dem Kreis Lösungen
Arbeitsanleitung I Kreisbewegung Grundbegriffe zur Beschreibung von Kreisbewegungen Beschreibung der Kreisbewegung 1 1.1 Das Bogenmass 1.2 Begriffe zur Kreisbewegung 1.3 Die Bewegung auf dem Kreis Lösungen
EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I. 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln
 EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln KLINKHARDT &: BIERMANN BRAUNSCHWEIG INHALTSVERZEICHNIS
EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln KLINKHARDT &: BIERMANN BRAUNSCHWEIG INHALTSVERZEICHNIS
 Inhaltsverzeichnis 1. Die französische Grassuhrenindustrie 1 Seiten 1.1 Struktur................................................... 1 1.2 Entwicklung und Produktionsumfang......................... 1 2.
Inhaltsverzeichnis 1. Die französische Grassuhrenindustrie 1 Seiten 1.1 Struktur................................................... 1 1.2 Entwicklung und Produktionsumfang......................... 1 2.
Inhaltsverzeichnis. Zeit und Zeitmessung 13. Vorwort 11. I. Teil
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15 Die scheinbaren" und die wirklichen"
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15 Die scheinbaren" und die wirklichen"
M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen
 M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
3 Physikalische Größen
 3 Physikalische Größen Warum hat der Tag 24 Stunden? Warum drehen sich die Zeiger einer Uhr im Uhrzeigersinn? 3.1 Wert und Einheit Physikalische Größe = Zahlenwert Einheit G = { G } [ G ] Verknüpfung physikalischer
3 Physikalische Größen Warum hat der Tag 24 Stunden? Warum drehen sich die Zeiger einer Uhr im Uhrzeigersinn? 3.1 Wert und Einheit Physikalische Größe = Zahlenwert Einheit G = { G } [ G ] Verknüpfung physikalischer
Bedienungsanleitung. Die Feder
 MEINE ERSTE UHR Danke für Ihren Kauf von Meine erste Uhr. Meine erste Uhr ist ein neuartiges Lernspielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Sie werden viel Freude daran haben, da Meine erste Uhr leicht zu montieren
MEINE ERSTE UHR Danke für Ihren Kauf von Meine erste Uhr. Meine erste Uhr ist ein neuartiges Lernspielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Sie werden viel Freude daran haben, da Meine erste Uhr leicht zu montieren
Secunda Accurata 1958
 Secunda Accurata 1958 Secunda Accurata 1958 verbesserte»freie Federkraft-Hemmung«nach Prof. Ludwig Strasser Dieses Modell verkörpert unseren hohen Anspruch, eine rein mechanische Präzisionspendeluhr zu
Secunda Accurata 1958 Secunda Accurata 1958 verbesserte»freie Federkraft-Hemmung«nach Prof. Ludwig Strasser Dieses Modell verkörpert unseren hohen Anspruch, eine rein mechanische Präzisionspendeluhr zu
Dokumentation. Fertigung einer. Gangreserveanzeige. für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag. Von Alexander Santore
 Dokumentation Fertigung einer Gangreserveanzeige für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag Von Alexander Santore 1 Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1: Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangreserveanzeige?
Dokumentation Fertigung einer Gangreserveanzeige für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag Von Alexander Santore 1 Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1: Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangreserveanzeige?
Was ist Zeit? BA-Seminar Dienstags, Uhr c.t. Raum E006
 BA-Seminar Dienstags, 12-14 Uhr c.t. Raum E006 Wie sollten wir über die Zeit reden? Ist sie eine Substanz oder ein Subjekt? Können wir überhaupt die Zeit nicht-metaphorisch beschreiben? Ist die Zeit ein
BA-Seminar Dienstags, 12-14 Uhr c.t. Raum E006 Wie sollten wir über die Zeit reden? Ist sie eine Substanz oder ein Subjekt? Können wir überhaupt die Zeit nicht-metaphorisch beschreiben? Ist die Zeit ein
Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus. U. Krausch
 Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus U. Krausch Was ist Zeit? Vor über 2500 Jahren legt Heraklit die Grunddeutung Alles fließt. Augustinus (345-430 n. Chr.):
Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus U. Krausch Was ist Zeit? Vor über 2500 Jahren legt Heraklit die Grunddeutung Alles fließt. Augustinus (345-430 n. Chr.):
Anleitung zum Physikpraktikum für Oberstufenlehrpersonen Einführungsversuch (EV) Herbstsemester Physik-Institut der Universität Zürich
 Anleitung zum Physikpraktikum für Oberstufenlehrpersonen Einführungsversuch (EV) Herbstsemester 2017 Physik-Institut der Universität Zürich Inhaltsverzeichnis 1 Einführungsversuch (EV) 11 11 Einleitung
Anleitung zum Physikpraktikum für Oberstufenlehrpersonen Einführungsversuch (EV) Herbstsemester 2017 Physik-Institut der Universität Zürich Inhaltsverzeichnis 1 Einführungsversuch (EV) 11 11 Einleitung
10. Schwingungen Grundbedingungen Harmonische Schwingung
 Schwingungen 1 10. Schwingungen 10.1. Grundbedingungen Jedes System, das Schwingungen ausführt, besitzt zwei dafür notwendige Bedingungen. 1. Es besitzt eine Gleichgewichtslage. 2. Wenn das System aus
Schwingungen 1 10. Schwingungen 10.1. Grundbedingungen Jedes System, das Schwingungen ausführt, besitzt zwei dafür notwendige Bedingungen. 1. Es besitzt eine Gleichgewichtslage. 2. Wenn das System aus
mentor Abiturhilfe: Physik Oberstufe Weidl
 mentor Abiturhilfen mentor Abiturhilfe: Physik Oberstufe Relativitätstheorie, Quanten-, Atom- und Kernphysik von Erhard Weidl 1. Auflage mentor Abiturhilfe: Physik Oberstufe Weidl schnell und portofrei
mentor Abiturhilfen mentor Abiturhilfe: Physik Oberstufe Relativitätstheorie, Quanten-, Atom- und Kernphysik von Erhard Weidl 1. Auflage mentor Abiturhilfe: Physik Oberstufe Weidl schnell und portofrei
Mechanische Elemente: das Zahnrad
 Mechanische Elemente: das Zahnrad Mechanische Elemente: Zahnrad Zahnräder sind mit Zähnen ausgestattet, die in die Zähne anderer Zahnräder eingreifen. Weil die Zähne sich gegenseitig umschließen, können
Mechanische Elemente: das Zahnrad Mechanische Elemente: Zahnrad Zahnräder sind mit Zähnen ausgestattet, die in die Zähne anderer Zahnräder eingreifen. Weil die Zähne sich gegenseitig umschließen, können
Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup
 Bernd Mosel mosel(at)uni-muenster.de 24.8.2009 (10.03.2012) Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup Die Kirche von Westen im Jugendstil, Von NO: Erweiterung durch das östliche
Bernd Mosel mosel(at)uni-muenster.de 24.8.2009 (10.03.2012) Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup Die Kirche von Westen im Jugendstil, Von NO: Erweiterung durch das östliche
Uhren-ABC 1/6. *Grossuhren: Energiequelle: Zugfeder oder Gewicht Schwingungsorgan: in der Regel ein Pendel
 Uhren-ABC 1/6 In der Schweiz werden heute zwei Hauptarten von Uhren hergestellt: Elektronische Quarzuhren mit Zeigeranzeige (auch kombiniert mit Digitalanzeige) und mechanische Uhren. Die mechanische Uhr
Uhren-ABC 1/6 In der Schweiz werden heute zwei Hauptarten von Uhren hergestellt: Elektronische Quarzuhren mit Zeigeranzeige (auch kombiniert mit Digitalanzeige) und mechanische Uhren. Die mechanische Uhr
Kapitel 1 PUNKTMECHANIK LERNZIELE INHALT. Körper. Masse
 Kapitel 1 PUNKTMECHANIK LERNZIELE Definition der physikalischen Begriffe Körper, Masse, Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft. Newtons Axiome Die Benutzung eines Bezugssystems / Koordinatensystems.
Kapitel 1 PUNKTMECHANIK LERNZIELE Definition der physikalischen Begriffe Körper, Masse, Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft. Newtons Axiome Die Benutzung eines Bezugssystems / Koordinatensystems.
TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner
 TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner Das schweizer TAVARO-Uhrwerk wurde während des zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten und der Achsenmächte in Zeitzündern der Geschosskaliber ab 7,5 cm verwendet.
TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner Das schweizer TAVARO-Uhrwerk wurde während des zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten und der Achsenmächte in Zeitzündern der Geschosskaliber ab 7,5 cm verwendet.
EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS
 deutsch STANDARDEINSTELLUNGSANWEISUNGEN KLEINER SEKUNDENZEIGER EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES S 1. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass sie auf Position 2 steht. 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn
deutsch STANDARDEINSTELLUNGSANWEISUNGEN KLEINER SEKUNDENZEIGER EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES S 1. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass sie auf Position 2 steht. 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn
1Raum-Zeit-Materie-Wechselwirkungen
 1Raum-Zeit-Materie-Wechselwirkungen 1. 11 1.1 Der Raum 1.2 Raum und Metermaß 1.3 Die Zeit 1.4 Materie 1.5 Wechselwirkungen 1.1 Der Raum Wir sehen: Neben-, Über- und Hintereinander von Gegenständen Objektive
1Raum-Zeit-Materie-Wechselwirkungen 1. 11 1.1 Der Raum 1.2 Raum und Metermaß 1.3 Die Zeit 1.4 Materie 1.5 Wechselwirkungen 1.1 Der Raum Wir sehen: Neben-, Über- und Hintereinander von Gegenständen Objektive
Zweisprachiger Wettbewerb Physik 1. Schuljahr
 Zweisprachiger Wettbewerb Physik 1. Schuljahr Lieber Schüler, liebe Schülerin, Der Wettbewerb besteht aus 20 Fragen. Sie sollten von den vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten immer die einzige richtige Lösung
Zweisprachiger Wettbewerb Physik 1. Schuljahr Lieber Schüler, liebe Schülerin, Der Wettbewerb besteht aus 20 Fragen. Sie sollten von den vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten immer die einzige richtige Lösung
3. Kapitel Der Compton Effekt
 3. Kapitel Der Compton Effekt 3.1 Lernziele Sie können erklären, wie die Streuung von Röntgenstrahlen an Graphit funktioniert. Sie kennen die physikalisch theoretischen Voraussetzungen, die es zum Verstehen
3. Kapitel Der Compton Effekt 3.1 Lernziele Sie können erklären, wie die Streuung von Röntgenstrahlen an Graphit funktioniert. Sie kennen die physikalisch theoretischen Voraussetzungen, die es zum Verstehen
Prüfungsaufgaben der schriftlichen Matura 2010 in Physik (Profilfach)
 Prüfungsaufgaben der schriftlichen Matura 2010 in Physik (Profilfach) Klasse 7Na (Daniel Oehry) Name: Diese Arbeit umfasst vier Aufgaben Hilfsmittel: Dauer: Hinweise: Formelsammlung, Taschenrechner (nicht
Prüfungsaufgaben der schriftlichen Matura 2010 in Physik (Profilfach) Klasse 7Na (Daniel Oehry) Name: Diese Arbeit umfasst vier Aufgaben Hilfsmittel: Dauer: Hinweise: Formelsammlung, Taschenrechner (nicht
Einsteins Relativitätstheorie
 Dr. Michael Seniuch Astronomiefreunde 2000 Waghäusel e.v. Einsteins Relativitätstheorie 16. April 2010 Inhalt: I. Raum, Zeit und Geschwindigkeit im Alltag II. Die Spezielle Relativitätstheorie III. Die
Dr. Michael Seniuch Astronomiefreunde 2000 Waghäusel e.v. Einsteins Relativitätstheorie 16. April 2010 Inhalt: I. Raum, Zeit und Geschwindigkeit im Alltag II. Die Spezielle Relativitätstheorie III. Die
Koffer Getriebe- und Antriebsmodelle Best.- Nr. MD02709
 Koffer Getriebe- und Antriebsmodelle Best.- Nr. MD02709 1. Beschreibung und Auflistung des Materials Anhand der folgenden Auflistung können Sie Ihren Koffer auf Vollständigkeit überprüfen. Folgende Modelle
Koffer Getriebe- und Antriebsmodelle Best.- Nr. MD02709 1. Beschreibung und Auflistung des Materials Anhand der folgenden Auflistung können Sie Ihren Koffer auf Vollständigkeit überprüfen. Folgende Modelle
Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer (mit Lösungen) 1 Einleitung Misst man um die
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer (mit Lösungen) 1 Einleitung Misst man um die
Die Zeitgleichung. Joachim Gripp, Lindau bei Kiel
 Die Zeitgleichung Joachim Gripp, Lindau bei Kiel Einleitung Den meisten Sonnenuhr- Freunden ist die Zeitgleichung gut bekannt. Sie ist als Unterschied zwischen der von einer Sonnenuhr angezeigten Sonnenzeit
Die Zeitgleichung Joachim Gripp, Lindau bei Kiel Einleitung Den meisten Sonnenuhr- Freunden ist die Zeitgleichung gut bekannt. Sie ist als Unterschied zwischen der von einer Sonnenuhr angezeigten Sonnenzeit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die allgemeine Relativitätstheorie - einfach erklärt
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Die allgemeine Relativitätstheorie - einfach erklärt Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Die allgemeine Relativitätstheorie - einfach erklärt Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Musterprotokoll am Beispiel des Versuches M 12 Gekoppelte Pendel
 * k u r z g e f a s s t * i n f o r m a t i v * s a u b e r * ü b e r s i c h t l i c h Musterprotokoll am Beispiel des Versuches M 1 Gekoppelte Pendel M 1 Gekoppelte Pendel Aufgaben 1. Messen Sie für
* k u r z g e f a s s t * i n f o r m a t i v * s a u b e r * ü b e r s i c h t l i c h Musterprotokoll am Beispiel des Versuches M 1 Gekoppelte Pendel M 1 Gekoppelte Pendel Aufgaben 1. Messen Sie für
120 Gekoppelte Pendel
 120 Gekoppelte Pendel 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die Schwingungsdauer zweier gekoppelter Pendel bei gleichsinniger und gegensinniger Schwingung. 1.2 Messen Sie die Schwingungs- und Schwebungsdauer bei
120 Gekoppelte Pendel 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die Schwingungsdauer zweier gekoppelter Pendel bei gleichsinniger und gegensinniger Schwingung. 1.2 Messen Sie die Schwingungs- und Schwebungsdauer bei
Dr. Alfred Recknagel. em.ord. Professor der Technischen Universität Dresden. PH i SIlv. Mechanik. 17., unveränderte Auflage VERLAG TECHNIK BERLIN
 Dr. Alfred Recknagel em.ord. Professor der Technischen Universität Dresden PH i SIlv Mechanik 17., unveränderte Auflage VERLAG TECHNIK BERLIN Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten Buchstabensymbole 7 1. Einleitung
Dr. Alfred Recknagel em.ord. Professor der Technischen Universität Dresden PH i SIlv Mechanik 17., unveränderte Auflage VERLAG TECHNIK BERLIN Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten Buchstabensymbole 7 1. Einleitung
Physik I für Chemiker, Biochemiker und Geowissenschaftler. Vorlesung 01b (24. Okt. 2007)
 Physik I für Chemiker, Biochemiker und Geowissenschaftler Vorlesung 01b (24. Okt. 2007) Prof. D. Hägele Übungsgruppen A bis G Chemiker, Biochemiker 1 Stunde / Woche A Di 8-9 Uhr, Jürgen Gibkes, NB 6/99
Physik I für Chemiker, Biochemiker und Geowissenschaftler Vorlesung 01b (24. Okt. 2007) Prof. D. Hägele Übungsgruppen A bis G Chemiker, Biochemiker 1 Stunde / Woche A Di 8-9 Uhr, Jürgen Gibkes, NB 6/99
marcel koller. riss team ag samedan
 marcel koller. riss team ag. 0 samedan beschreibung zum zeitmesser (seit 0.0.0 auf youtube) / time. art. time / zeit. kunst. zeit / swissmade / das neue digitale uhrwerk / eine zeit - kunst - zeit performance
marcel koller. riss team ag. 0 samedan beschreibung zum zeitmesser (seit 0.0.0 auf youtube) / time. art. time / zeit. kunst. zeit / swissmade / das neue digitale uhrwerk / eine zeit - kunst - zeit performance
Begriffe nnd Gesetze der Physik
 Die wichtigsten Begriffe nnd Gesetze der Physik unter alleiniger Anwendung der gesetzlichen und der damit zusammenhängenden Mafseinheiten. Von Dr. 0. Lebmann, Professor der Physik an der Technischen Hochteluale
Die wichtigsten Begriffe nnd Gesetze der Physik unter alleiniger Anwendung der gesetzlichen und der damit zusammenhängenden Mafseinheiten. Von Dr. 0. Lebmann, Professor der Physik an der Technischen Hochteluale
Wir bauen eine Zeitmaschine
 Zeitmaschinen Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts glaubten die Physiker, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was Zeit ist: Sie verläuft kontinuierlich, in eine Richtung und ist absolut, also unabhängig
Zeitmaschinen Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts glaubten die Physiker, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was Zeit ist: Sie verläuft kontinuierlich, in eine Richtung und ist absolut, also unabhängig
zum Thema Lissajous-Figuren
 Ratsgymnasium Rotenburg Gerberstraße 14 27356 Rotenburg Wümme Facharbeit im Leistungskurs Physik zum Thema Lissajous-Figuren Verfasser: Christoph Siemsen Fachlehrer: Herr Konrad Abgabetermin: 24.05.04
Ratsgymnasium Rotenburg Gerberstraße 14 27356 Rotenburg Wümme Facharbeit im Leistungskurs Physik zum Thema Lissajous-Figuren Verfasser: Christoph Siemsen Fachlehrer: Herr Konrad Abgabetermin: 24.05.04
Wir werden folgende Feststellungen erläutern und begründen: 2. Gravitationskräfte sind äquivalent zu Trägheitskräften. 1 m s. z.t/ D. g t 2 (10.
 10 Äquivalenzprinzip Die physikalische Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) ist das von Einstein postulierte Äquivalenzprinzip 1. Dieses Prinzip besagt, dass Gravitationskräfte äquivalent
10 Äquivalenzprinzip Die physikalische Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) ist das von Einstein postulierte Äquivalenzprinzip 1. Dieses Prinzip besagt, dass Gravitationskräfte äquivalent
14. Mechanische Schwingungen und Wellen
 14. Mechanische Schwingungen und Wellen Schwingungen treten in der Technik in vielen Vorgängen auf mit positiven und negativen Effekten (z. B. Haarrisse, Achsbrüche etc.). Deshalb ist es eine wichtige
14. Mechanische Schwingungen und Wellen Schwingungen treten in der Technik in vielen Vorgängen auf mit positiven und negativen Effekten (z. B. Haarrisse, Achsbrüche etc.). Deshalb ist es eine wichtige
Mechanische Schwingungen Aufgaben 1
 Mechanische Schwingungen Aufgaben 1 1. Experiment mit Fadenpendel Zum Bestimmen der Fallbeschleunigung wurde ein Fadenpendel verwendet. Mit der Fadenlänge l 1 wurde eine Periodendauer von T 1 =4,0 s und
Mechanische Schwingungen Aufgaben 1 1. Experiment mit Fadenpendel Zum Bestimmen der Fallbeschleunigung wurde ein Fadenpendel verwendet. Mit der Fadenlänge l 1 wurde eine Periodendauer von T 1 =4,0 s und
Partielle Differentialgleichungen
 http://www.free background wallpaper.com/background wallpaper water.php Partielle Differentialgleichungen 1 E Partielle Differentialgleichungen Eine partielle Differentialgleichung (Abkürzung PDGL) ist
http://www.free background wallpaper.com/background wallpaper water.php Partielle Differentialgleichungen 1 E Partielle Differentialgleichungen Eine partielle Differentialgleichung (Abkürzung PDGL) ist
Thema: Schwingung eines Hohlkörpers
 Abitur 9 Physik Klausur Hannover, 75 arei LK Semester Bearbeitungszeit: 9 min Thema: Schwingung eines Hohlkörpers 1 Aufgabe In einem Hohlkörper befindet sich ein Magnet (Abb1) In seiner Ruhelage schwebt
Abitur 9 Physik Klausur Hannover, 75 arei LK Semester Bearbeitungszeit: 9 min Thema: Schwingung eines Hohlkörpers 1 Aufgabe In einem Hohlkörper befindet sich ein Magnet (Abb1) In seiner Ruhelage schwebt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: - 5 Unterrichtseinheiten mit fix und fertigen Stundenbildern Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: - 5 Unterrichtseinheiten mit fix und fertigen Stundenbildern Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Zeit naturwissenschaftlich
 Zeit naturwissenschaftlich Das Thema zum Gegenstand im Unterricht machen Dr. Maja Brückmann Dozentin Ein Experiment Schliessen Sie bitte Ihre Augen und öffnen Sie Ihre Augen wieder nach 60 Sekunden? 2
Zeit naturwissenschaftlich Das Thema zum Gegenstand im Unterricht machen Dr. Maja Brückmann Dozentin Ein Experiment Schliessen Sie bitte Ihre Augen und öffnen Sie Ihre Augen wieder nach 60 Sekunden? 2
Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer Einleitung Misst man um die Zeit der Jupiteropposition
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer Einleitung Misst man um die Zeit der Jupiteropposition
Spezielle Relativität
 Spezielle Relativität Gleichzeitigkeit und Bezugssysteme Thomas Schwarz 31. Mai 2007 Inhalt 1 Einführung 2 Raum und Zeit Bezugssysteme 3 Relativitätstheorie Beginn der Entwicklung Relativitätsprinzip Lichtausbreitung
Spezielle Relativität Gleichzeitigkeit und Bezugssysteme Thomas Schwarz 31. Mai 2007 Inhalt 1 Einführung 2 Raum und Zeit Bezugssysteme 3 Relativitätstheorie Beginn der Entwicklung Relativitätsprinzip Lichtausbreitung
Labor zur Vorlesung Physik
 Labor zur Vorlesung Physik 1. Zur Vorbereitung Die folgenden Begriffe sollten Sie kennen und erklären können: Gravitationsgesetz, Gravitationswaage, gedämpfte Torsionsschwingung, Torsionsmoment, Drehmoment,
Labor zur Vorlesung Physik 1. Zur Vorbereitung Die folgenden Begriffe sollten Sie kennen und erklären können: Gravitationsgesetz, Gravitationswaage, gedämpfte Torsionsschwingung, Torsionsmoment, Drehmoment,
Die Erweiterung vom Satz des Pythagoras anhand der resultierenden Kraft FR
 Michael B. H. Middendorf 1 Die Erweiterung vom Satz des Pthagoras anhand der resultierenden Kraft FR Bei meinen Überlegungen als Maschinenbauer bzgl. eines Impulsantriebes, stieß ich auf das Problem, ständig
Michael B. H. Middendorf 1 Die Erweiterung vom Satz des Pthagoras anhand der resultierenden Kraft FR Bei meinen Überlegungen als Maschinenbauer bzgl. eines Impulsantriebes, stieß ich auf das Problem, ständig
2 Mechanik des Massenpunktes
 2 Mechanik des Massenpunktes Wir beginnen deshalb in Kapitel 2 mit der Beschreibung der Bewegung von Massenpunkten, kommen dann in Kapitel 4 zum starren Körper und schließlich in Kapitel 5 zur Mechanik
2 Mechanik des Massenpunktes Wir beginnen deshalb in Kapitel 2 mit der Beschreibung der Bewegung von Massenpunkten, kommen dann in Kapitel 4 zum starren Körper und schließlich in Kapitel 5 zur Mechanik
In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg:
 Werkstatt: Arbeit = Kraft Weg Viel Kraft für nichts? In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg: W = * = F * s FII bezeichnet dabei die Kraftkomponente in Wegrichtung s. Die
Werkstatt: Arbeit = Kraft Weg Viel Kraft für nichts? In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg: W = * = F * s FII bezeichnet dabei die Kraftkomponente in Wegrichtung s. Die
Das führt zu einer periodischen Hin- und Herbewegung (Schwingung) Applet Federpendel (http://www.walter-fendt.de)
 Elastische SCHWINGUNGEN (harmonische Bewegung) Eine Masse sei reibungsfrei durch elastische Kräfte in einer Ruhelage fixiert Wenn aus der Ruhelage entfernt wirkt eine rücktreibende Kraft Abb. 7.1 Biologische
Elastische SCHWINGUNGEN (harmonische Bewegung) Eine Masse sei reibungsfrei durch elastische Kräfte in einer Ruhelage fixiert Wenn aus der Ruhelage entfernt wirkt eine rücktreibende Kraft Abb. 7.1 Biologische
Physik 2. Schwingungen.
 2 Physik 2. Schwingungen. SS 18 2. Sem. B.Sc. CH Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz
2 Physik 2. Schwingungen. SS 18 2. Sem. B.Sc. CH Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz
Übungen zu Experimentalphysik 1 für MSE
 Physik-Department LS für Funktionelle Materialien WS 214/15 Übungen zu Experimentalphysik 1 für MSE Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum, Dr. Volker Körstgens, Daniel Moseguí González, Pascal Neibecker, Nitin
Physik-Department LS für Funktionelle Materialien WS 214/15 Übungen zu Experimentalphysik 1 für MSE Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum, Dr. Volker Körstgens, Daniel Moseguí González, Pascal Neibecker, Nitin
Solution V Published:
 1 Reibungskraft I Ein 25kg schwerer Block ist zunächst auf einer horizontalen Fläche in Ruhe. Es ist eine horizontale Kraft von 75 N nötig um den Block in Bewegung zu setzten, danach ist eine horizontale
1 Reibungskraft I Ein 25kg schwerer Block ist zunächst auf einer horizontalen Fläche in Ruhe. Es ist eine horizontale Kraft von 75 N nötig um den Block in Bewegung zu setzten, danach ist eine horizontale
Zum Fahrstuhl-Gedankenexperiment von ALBERT EINSTEIN
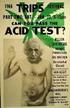 Zum Fahrstuhl-Gedankenexperiment von ALBERT EINSTEIN HORST TIWALD 16. 01. 2008 (mit Nachtrag 13. 05. 2008 und 23. 10. 2011) I. Wenn ich den wissenschaftlichen Diskurs über ALBERT EINSTEIN richtig verstanden
Zum Fahrstuhl-Gedankenexperiment von ALBERT EINSTEIN HORST TIWALD 16. 01. 2008 (mit Nachtrag 13. 05. 2008 und 23. 10. 2011) I. Wenn ich den wissenschaftlichen Diskurs über ALBERT EINSTEIN richtig verstanden
Feder-, Faden- und Drillpendel
 Dr Angela Fösel & Dipl Phys Tom Michler Revision: 30092018 Eine Schwingung (auch Oszillation) bezeichnet den Verlauf einer Zustandsänderung, wenn ein System auf Grund einer Störung aus dem Gleichgewicht
Dr Angela Fösel & Dipl Phys Tom Michler Revision: 30092018 Eine Schwingung (auch Oszillation) bezeichnet den Verlauf einer Zustandsänderung, wenn ein System auf Grund einer Störung aus dem Gleichgewicht
8/13/2013 Selbsteinstellendes Kettenrad, Karl Herkenrath 1
 8/13/2013 Selbsteinstellendes Kettenrad, Karl Herkenrath 1 PATENT Selbsteinstellendes Kettenrad Patentschrift EP 12007544.5 Karl Herkenrath 2 Inhalt Ausgangssituation und Problemstellung Motivation und
8/13/2013 Selbsteinstellendes Kettenrad, Karl Herkenrath 1 PATENT Selbsteinstellendes Kettenrad Patentschrift EP 12007544.5 Karl Herkenrath 2 Inhalt Ausgangssituation und Problemstellung Motivation und
Bestimmung der Erdbeschleunigung g
 Laborbericht zum Thema Bestimmung der Erdbeschleuni Erdbeschleunigung g Datum: 26.08.2011 Autoren: Christoph Winkler, Philipp Schienle, Mathias Kerschensteiner, Georg Sauer Friedrich-August Haselwander
Laborbericht zum Thema Bestimmung der Erdbeschleuni Erdbeschleunigung g Datum: 26.08.2011 Autoren: Christoph Winkler, Philipp Schienle, Mathias Kerschensteiner, Georg Sauer Friedrich-August Haselwander
Physik für Biologen und Zahnmediziner
 Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 1: Kinematik Dr. Daniel Bick 02. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 02. November 2016 1 / 24 Übersicht 1 Kinematik Daniel Bick
Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 1: Kinematik Dr. Daniel Bick 02. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 02. November 2016 1 / 24 Übersicht 1 Kinematik Daniel Bick
4.3 Schwingende Systeme
 Dieter Suter - 217 - Physik B3 4.3 Schwingende Systeme Schwingungen erhält man immer dann, wenn die Kraft der Auslenkung entgegengerichtet ist. Ist sie außerdem proportional zur Kraft, so erhält man eine
Dieter Suter - 217 - Physik B3 4.3 Schwingende Systeme Schwingungen erhält man immer dann, wenn die Kraft der Auslenkung entgegengerichtet ist. Ist sie außerdem proportional zur Kraft, so erhält man eine
Newton-Beschreibung: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Oberfläche
 Newton-Beschreibung: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Oberfläche R. Mahnke (Univ. Rostock), J. Kaupužs (Lettische Univ. Riga) 3. Mai 24 Zusammenfassung Ziel dieses Kommentars ist es, die Newtonschen
Newton-Beschreibung: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Oberfläche R. Mahnke (Univ. Rostock), J. Kaupužs (Lettische Univ. Riga) 3. Mai 24 Zusammenfassung Ziel dieses Kommentars ist es, die Newtonschen
Ingenieur-Mathematik
 Ingenieur-Mathematik Von Rohert Sauer Dr. techno Dr.-Ing. E. h. Professor an der Technischen Hochschule München Zweiter Band Differentialgleichungen und Funktionentheorie Zweite durchgesehene Auflage Mit
Ingenieur-Mathematik Von Rohert Sauer Dr. techno Dr.-Ing. E. h. Professor an der Technischen Hochschule München Zweiter Band Differentialgleichungen und Funktionentheorie Zweite durchgesehene Auflage Mit
1.2 Schwingungen von gekoppelten Pendeln
 0 1. Schwingungen von gekoppelten Pendeln Aufgaben In diesem Experiment werden die Schwingungen von zwei Pendeln untersucht, die durch eine Feder miteinander gekoppelt sind. Für verschiedene Kopplungsstärken
0 1. Schwingungen von gekoppelten Pendeln Aufgaben In diesem Experiment werden die Schwingungen von zwei Pendeln untersucht, die durch eine Feder miteinander gekoppelt sind. Für verschiedene Kopplungsstärken
Wie fließt der Impuls?
 Wie fließt der Impuls? Thomas Wilhelm 1. Unterschiedliche Beschreibungen Ein physikalischer Themenbereich kann fachlich auf unterschiedliche Weise beschrieben werden, wobei jede der verschiedenen Beschreibungen
Wie fließt der Impuls? Thomas Wilhelm 1. Unterschiedliche Beschreibungen Ein physikalischer Themenbereich kann fachlich auf unterschiedliche Weise beschrieben werden, wobei jede der verschiedenen Beschreibungen
2.0 Dynamik Kraft & Bewegung
 .0 Dynamik Kraft & Bewegung Kraft Alltag: Muskelkater Formänderung / statische Wirkung (Gebäudestabilität) Physik Beschleunigung / dynamische Wirkung (Impulsänderung) Masse Schwere Masse: Eigenschaft eines
.0 Dynamik Kraft & Bewegung Kraft Alltag: Muskelkater Formänderung / statische Wirkung (Gebäudestabilität) Physik Beschleunigung / dynamische Wirkung (Impulsänderung) Masse Schwere Masse: Eigenschaft eines
Versuchsdurchführung:
 1 Erzwungene Schwingungen Resonanz Federpendel, Faden, Stativ, einen Motor mit regelbarer Drehzahl und einer Exzenterscheibe zur Anregung der Schwingungen Wir haben den Versuch wie in der Anleitung beschrieben
1 Erzwungene Schwingungen Resonanz Federpendel, Faden, Stativ, einen Motor mit regelbarer Drehzahl und einer Exzenterscheibe zur Anregung der Schwingungen Wir haben den Versuch wie in der Anleitung beschrieben
Die harmonische Schwingung
 Joachim Stiller Die harmonische Schwingung Alle Rechte vorbehalten Die harmonische Schwingung Beschreibung von Schwingungen 1. Das Federpendel zeigt, worauf es ankommt Eine Kugel hängt an einer Schraubenfeder
Joachim Stiller Die harmonische Schwingung Alle Rechte vorbehalten Die harmonische Schwingung Beschreibung von Schwingungen 1. Das Federpendel zeigt, worauf es ankommt Eine Kugel hängt an einer Schraubenfeder
Einleitung 19. Teil I Einführung in die Technische Mechanik 23. Kapitel 1 Einführung 25
 Inhaltsverzeichnis Einleitung 19 Über dieses Buch 19 Vereinbarungen in diesem Buch 19 Was Sie nicht lesen müssen 19 Törichte Annahmen über den Leser 19 Wie dieses Buch aufgebaut ist 20 Teil II: Statik
Inhaltsverzeichnis Einleitung 19 Über dieses Buch 19 Vereinbarungen in diesem Buch 19 Was Sie nicht lesen müssen 19 Törichte Annahmen über den Leser 19 Wie dieses Buch aufgebaut ist 20 Teil II: Statik
Fadenpendel (M1) Ziel des Versuches. Theoretischer Hintergrund
 Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
2. Kinematik. Inhalt. 2. Kinematik
 2. Kinematik Inhalt 2. Kinematik 2.1 Grundsätzliche Bewegungsarten 2.2 Modell Punktmasse 2.3 Mittlere Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.4 Momentane Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.5 Beschleunigung (1-dimensional)
2. Kinematik Inhalt 2. Kinematik 2.1 Grundsätzliche Bewegungsarten 2.2 Modell Punktmasse 2.3 Mittlere Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.4 Momentane Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.5 Beschleunigung (1-dimensional)
Gedehnt und gemessen, erinnert und vergessen: Die Zeit aus physikalischer Sicht
 Gedehnt und gemessen, erinnert und vergessen: Die Zeit aus physikalischer Sicht Uwe-Jens Wiese Albert Einstein Center for Fundamental Physics Institut für Theoretische Physik, Universität Bern Senioren
Gedehnt und gemessen, erinnert und vergessen: Die Zeit aus physikalischer Sicht Uwe-Jens Wiese Albert Einstein Center for Fundamental Physics Institut für Theoretische Physik, Universität Bern Senioren
2. Kinematik. Inhalt. 2. Kinematik
 2. Kinematik Inhalt 2. Kinematik 2.1 Arten der Bewegung 2.2 Mittlere Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.3 Momentane Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.4 Beschleunigung (1-dimensional) 2.5 Bahnkurve 2.6 Bewegung
2. Kinematik Inhalt 2. Kinematik 2.1 Arten der Bewegung 2.2 Mittlere Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.3 Momentane Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.4 Beschleunigung (1-dimensional) 2.5 Bahnkurve 2.6 Bewegung
Arbeitsblatt IV/1: Version für die Lehrkraft
 Arbeitsblatt IV/1: Version für die Lehrkraft Eigenschaften eingesperrter Wellen In den vorherigen Abschnitten haben Sie zwei wichtige Sachverhalte kennen gelernt: 1. Elektronen weisen Wellencharakter auf.
Arbeitsblatt IV/1: Version für die Lehrkraft Eigenschaften eingesperrter Wellen In den vorherigen Abschnitten haben Sie zwei wichtige Sachverhalte kennen gelernt: 1. Elektronen weisen Wellencharakter auf.
Physik für Oberstufenlehrpersonen. Frühjahrssemester Schwingungen und Wellen
 Physik für Oberstufenlehrpersonen Frühjahrssemester 2018 Schwingungen und Wellen Zum Einstieg in das neue Semester Schwingungen Schwingungen spielen bei natürlichen Prozessen bedeutende Rolle: -Hören und
Physik für Oberstufenlehrpersonen Frühjahrssemester 2018 Schwingungen und Wellen Zum Einstieg in das neue Semester Schwingungen Schwingungen spielen bei natürlichen Prozessen bedeutende Rolle: -Hören und
2. Kinematik. Inhalt. 2. Kinematik
 2. Kinematik Inhalt 2. Kinematik 2.1 Arten der Bewegung 2.2 Mittlere Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.3 Momentane Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.4 Beschleunigung (1-dimensional) 2.5 Bahnkurve 2.6 Bewegung
2. Kinematik Inhalt 2. Kinematik 2.1 Arten der Bewegung 2.2 Mittlere Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.3 Momentane Geschwindigkeit (1-dimensional) 2.4 Beschleunigung (1-dimensional) 2.5 Bahnkurve 2.6 Bewegung
Beleg Getriebelehre II
 Beleg Getriebelehre II Name, Vorname: Thön, Fabian Matrikelnummer: 631387 Studiengang: Maschinenbau (Master) Semester: Wintersemester 2009/2010 Einrichtung: Fachhochschule Jena Lehrbeauftragter: Herr Prof.
Beleg Getriebelehre II Name, Vorname: Thön, Fabian Matrikelnummer: 631387 Studiengang: Maschinenbau (Master) Semester: Wintersemester 2009/2010 Einrichtung: Fachhochschule Jena Lehrbeauftragter: Herr Prof.
Physik III im Studiengang Elektrotechnik
 Physik III im Studiengang Elektrotechnik - Schwingungen und Wellen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 28 Mechanik elastische Wellen Schwingung von Bauteilen Wasserwellen Akustik Elektrodynamik Schwingkreise elektromagnetische
Physik III im Studiengang Elektrotechnik - Schwingungen und Wellen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 28 Mechanik elastische Wellen Schwingung von Bauteilen Wasserwellen Akustik Elektrodynamik Schwingkreise elektromagnetische
8. Periodische Bewegungen
 8. Periodische Bewegungen 8.1 Schwingungen 8.1.1 Harmonische Schwingung 8.1.2 Schwingungsenergie 9.1.3 Gedämpfte Schwingung 8.1.4 Erzwungene Schwingung 8. Periodische Bewegungen Schwingung Zustand y wiederholt
8. Periodische Bewegungen 8.1 Schwingungen 8.1.1 Harmonische Schwingung 8.1.2 Schwingungsenergie 9.1.3 Gedämpfte Schwingung 8.1.4 Erzwungene Schwingung 8. Periodische Bewegungen Schwingung Zustand y wiederholt
Aufgabe 34 (Mechanik, Drehbewegung) Die Spitze des Minutenzeigers einer Turmuhr hat die Geschwindigkeit 1,50 mms -1. Wie lang ist der Zeiger?
 zu 2.2 / IV. Wiederholung zur Drehbewegung (Rotation) Aufgabe 31 (Mechanik, Drehbewegung) Fach: Physik/ L. Wenzl Datum:. Der Erdradius beträgt etwa 6370 km. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich ein
zu 2.2 / IV. Wiederholung zur Drehbewegung (Rotation) Aufgabe 31 (Mechanik, Drehbewegung) Fach: Physik/ L. Wenzl Datum:. Der Erdradius beträgt etwa 6370 km. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich ein
Gleichförmige Kreisbewegung, Bezugssystem, Scheinkräfte
 Aufgaben 4 Translations-Mechanik Gleichförmige Kreisbewegung, Bezugssystem, Scheinkräfte Lernziele - die Grössen zur Beschreibung einer Kreisbewegung und deren Zusammenhänge kennen. - die Frequenz, Winkelgeschwindigkeit,
Aufgaben 4 Translations-Mechanik Gleichförmige Kreisbewegung, Bezugssystem, Scheinkräfte Lernziele - die Grössen zur Beschreibung einer Kreisbewegung und deren Zusammenhänge kennen. - die Frequenz, Winkelgeschwindigkeit,
Energie und Energieerhaltung
 Arbeit und Energie Energie und Energieerhaltung Es gibt keine Evidenz irgendwelcher Art dafür, dass Energieerhaltung in irgendeinem System nicht erfüllt ist. Energie im Austausch In mechanischen und biologischen
Arbeit und Energie Energie und Energieerhaltung Es gibt keine Evidenz irgendwelcher Art dafür, dass Energieerhaltung in irgendeinem System nicht erfüllt ist. Energie im Austausch In mechanischen und biologischen
Albert Einstein. Leben und Werk
 Albert Einstein Leben und Werk Kindheit und Jugend Am 14.03.1879 wird Albert Einstein in Ulm (Donau) geboren. In München, wo seine Eltern eine Elektrotechnische Fabrik besitzen, geht er zur Schule. Als
Albert Einstein Leben und Werk Kindheit und Jugend Am 14.03.1879 wird Albert Einstein in Ulm (Donau) geboren. In München, wo seine Eltern eine Elektrotechnische Fabrik besitzen, geht er zur Schule. Als
Vorbereitung der Klausur Grundkurs Physik11-1 Mechanik
 Vorbereitung der Klausur Grundkurs Physik11-1 Mechanik Themenschwerpunkte der Klausur 2014 Reibung und Reibungsarbeit Anwendungen des Energieerhaltungssatzes Grundlagen der Kinematik Definition der Bewegung,
Vorbereitung der Klausur Grundkurs Physik11-1 Mechanik Themenschwerpunkte der Klausur 2014 Reibung und Reibungsarbeit Anwendungen des Energieerhaltungssatzes Grundlagen der Kinematik Definition der Bewegung,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Mechanik der Bewegungen - Eine Einführung
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mechanik der Bewegungen - Eine Einführung Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Mechanik
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mechanik der Bewegungen - Eine Einführung Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Mechanik
 Helmut Mann Porträt einer Taschenuhr Kleine Uhrenkunde für Liebhaber Impressum HEEL Verlag GmbH Gut Pottscheidt 53639 Königswinter Telefon 0 22 23 / 92 30-0 Telefax 0 22 23 / 92 30 26 Mail: info@heel-verlag.de
Helmut Mann Porträt einer Taschenuhr Kleine Uhrenkunde für Liebhaber Impressum HEEL Verlag GmbH Gut Pottscheidt 53639 Königswinter Telefon 0 22 23 / 92 30-0 Telefax 0 22 23 / 92 30 26 Mail: info@heel-verlag.de
9 ANHANG 4: UMBRA DOCET. DER SCHATTEN LEHRT?
 9 ANHANG 4: UMBRA DOCET. DER SCHATTEN LEHRT? 9.4 Iindividuelle Leistungen: Ein naturwissenschaftlich und v. a. mathematisch interessierter Schüler entdeckte schon bald nach Projektbeginn seine Vorliebe
9 ANHANG 4: UMBRA DOCET. DER SCHATTEN LEHRT? 9.4 Iindividuelle Leistungen: Ein naturwissenschaftlich und v. a. mathematisch interessierter Schüler entdeckte schon bald nach Projektbeginn seine Vorliebe
Willi Bohl Strömungsmaschinen 2 Berechnung und Konstruktion
 Willi Bohl Strömungsmaschinen 2 Berechnung und Konstruktion Kamprath-Reihe Prof. Dipl.-Ing. Willi Bohl Strömungsmaschinen 2 Berechnung und Konstruktion 8., korrigierte Auflage Vogel Buchverlag Prof. Dipl.-Ing.
Willi Bohl Strömungsmaschinen 2 Berechnung und Konstruktion Kamprath-Reihe Prof. Dipl.-Ing. Willi Bohl Strömungsmaschinen 2 Berechnung und Konstruktion 8., korrigierte Auflage Vogel Buchverlag Prof. Dipl.-Ing.
Reprint 1952 Berlin 2014
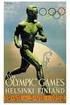 Reprint 1952 Berlin 2014 Vorwort des Verfassers Das vorliegende Fachrechenbuch bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben aus dem Gebiet der Klein- und Großuhren. Bei der Behandlung des Lehrstoffes
Reprint 1952 Berlin 2014 Vorwort des Verfassers Das vorliegende Fachrechenbuch bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben aus dem Gebiet der Klein- und Großuhren. Bei der Behandlung des Lehrstoffes
Prüfungsvorbereitung Physik: Bewegungen und Kräfte
 Prüfungsvorbereitung Physik: Bewegungen und Kräfte Theoriefragen: Diese Begriffe müssen Sie auswendig in ein bis zwei Sätzen erklären können. a) Vektor/Skalar b) Woran erkennt man eine Kraft? c) Welche
Prüfungsvorbereitung Physik: Bewegungen und Kräfte Theoriefragen: Diese Begriffe müssen Sie auswendig in ein bis zwei Sätzen erklären können. a) Vektor/Skalar b) Woran erkennt man eine Kraft? c) Welche
Physik mit einer Prise Mathe
 Rainer Dohlus Physik mit einer Prise Mathe Basiswissen für Studierende technischer Fachrichtungen 4 } Springer Vieweg egal aber 1 Mechanik 1 11 Wie es sich bewegt warum 1 111 Zwei unmittelbar im Alltag
Rainer Dohlus Physik mit einer Prise Mathe Basiswissen für Studierende technischer Fachrichtungen 4 } Springer Vieweg egal aber 1 Mechanik 1 11 Wie es sich bewegt warum 1 111 Zwei unmittelbar im Alltag
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
 Eric und Brian Smith Standuhren reparieren Hinweis des Verlages Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, Wir möchten uns ganz herzlich bei der Familie von Klaus Menny bedanken, die freundlicherweise diesem
Eric und Brian Smith Standuhren reparieren Hinweis des Verlages Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, Wir möchten uns ganz herzlich bei der Familie von Klaus Menny bedanken, die freundlicherweise diesem
Periodendauer eines Fadenpendels 9/10
 1. Bezeichnung des Materials Periodendauer eines Fadenpendels 2. Autor(en) 3. Doppeljahrgangsstufe / Fach 9/10 Physik 4. Rahmlehrplanbezug 5. Einsatz der Aufgabe im Unterricht Lernaufgabe Hauptsächliche
1. Bezeichnung des Materials Periodendauer eines Fadenpendels 2. Autor(en) 3. Doppeljahrgangsstufe / Fach 9/10 Physik 4. Rahmlehrplanbezug 5. Einsatz der Aufgabe im Unterricht Lernaufgabe Hauptsächliche
K1PH-4h/2 Stundenprotokoll der ersten Physikstunde ( ) im 1. Halbjahr 2012/13
 K1PH-4h/2 Stundenprotokoll der ersten Physikstunde (12.09.2012) im 1. Halbjahr 2012/13 Thema: Einstieg in die Physik anhand eines kleinen Wagens (s. Abb. unten), Wiederholung Kinematik (Bewegungslehre)
K1PH-4h/2 Stundenprotokoll der ersten Physikstunde (12.09.2012) im 1. Halbjahr 2012/13 Thema: Einstieg in die Physik anhand eines kleinen Wagens (s. Abb. unten), Wiederholung Kinematik (Bewegungslehre)
Gleichgewicht am Punkt
 Gleichgewicht am Punkt 3.1 Gleichgewichtsbedingung für einen Massenpunkt.. 52 3.2 Freikörperbild................................... 52 3.3 Ebene Kräftesysteme............................ 55 3.4 Räumliche
Gleichgewicht am Punkt 3.1 Gleichgewichtsbedingung für einen Massenpunkt.. 52 3.2 Freikörperbild................................... 52 3.3 Ebene Kräftesysteme............................ 55 3.4 Räumliche
Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Click here if your download doesn"t start automatically
 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie Click here if your download doesn"t start automatically Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie Albert Einstein Über die spezielle
Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie Click here if your download doesn"t start automatically Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie Albert Einstein Über die spezielle
Prüfungs-= und Übungsaufgaben aus der Memanik des Punktes und des starren Körpers
 Prüfungs-= und Übungsaufgaben aus der Memanik des Punktes und des starren Körpers Von Karf Federhofer o. Professor an der Tedmismen Hornsmute Graz In drei Teilen I. Teil: Statik 165 Aufgaben nebst Lösungen
Prüfungs-= und Übungsaufgaben aus der Memanik des Punktes und des starren Körpers Von Karf Federhofer o. Professor an der Tedmismen Hornsmute Graz In drei Teilen I. Teil: Statik 165 Aufgaben nebst Lösungen
