Hrsg. M. Stern. Professor W. Sander. Uhrenlehre HEEL
|
|
|
- Johannes Dieter Esser
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hrsg. M. Stern Professor W. Sander Uhrenlehre HEEL
2
3 Hrsg. M. Stern Professor W. Sander Uhrenlehre HEEL
4 UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau der Uhrwerke in elementarer Darstellung für Fachschulen und zum Selbstunterricht, für Konstrukteure und Reparateure von Professor W. SANDER t Diplom-Ingenieur, ehern. Vorstand der Württemb. Fachschule für Feinmechanik und Uhrmacherei in Schwenningen a. N. Bearbeitet, ergänzt und herausgegeben von M. LOESKE, Berlin M i t 152 Ab b i 1 d u n g e n LEIPZIG Verlag der Uhrmacher-Woche Wilhelm Diebener 192 3
5 Inhalts-Verzeichnis Vorwort des Herausgebers. Einleitung I. Kap i t e 1 Das Gehwerk Allgemeines Die Kraftübertragung in der Uhr.... Der Einfluß der Reibung II. Kapitel Die Antrlebvorrichtungen Der Gewichtszug. Gangdauer und Fallhöhe.... Die bewegliche Rolle Der Kettenaufzug Das Gegengesperr mit Hilfsaufzug.... Sperräder und Sperrkegel oder Sperrklinken III. Kapitel Der Federaufzug Das bewegliche Federhaus..... Das feste Federhaus Vergleich der beiden Anordnungen. Aufzugeinrichtungen bei Taschenuhren Der Kronenaufzug Die Kraftübertragung beim Aufzuge.... Die geometrischen Verhältnisse des Federhauses Die Länge der Feder Die Gangdauer der Federzuguhr.... IV. K api t e 1 Die Kraft der Zugfeder und ihre Berechnung Die freie Feder Formfehler der Zugfeder.... Versuche an einem Federhause.. Federkraftkurven Die mechanische Arbeit der Feder.. Vorausberechnung eines Federhauses. V. Kap i t e 1 Die Änderung der Federkraft Die Stellung.. Die Schnecke. Verschiedene Antriebe
6
7
8 Vorwort des Herausgebers Das vorliegende Werk, eine nachgelassene Arbeit des viel zu früh verstorbenen früheren Leiters der Schwenninger Fachschule, ist in gleicher Weise für den Schulgebrauch, wie für den Selbstunterricht jener jungen Kollegen geeignet, die sich in den für den Bau, den Betrieb und die Erhaltung der Uhrwerke gültigen Grundsätzen fortbilden wollen, ohn.e die Unterstützung genießen zu können, die der Besuch einer Fachschule gewähren kann. Die Zeit ist vorüber, in der der Uhrmacher sich ganz allein auf sein Können am Werktisch verlassen durfte. Täglich können an jeden Praktiker Aufgaben herantreten, zu deren Bewältigung er theoretischer Einsicht bedarf, die er sich, wenn er sie nicht auf einer Fachschule erworben hat, bei festem Willen und einer gewissen Ausdauer auch durch den Selbstunterricht verschaffen kann, und die durch fortgesetztes Beschäftigen mit dem Stoff in seiner Ganzheit wachgehalten und vertieft werden muß. Dazu bietet das vorliegende Werk eine vortreffliche Unterlage. Einer besonderen Empfehlung bedarf es nicht; die vielen Abbildungen sprechen gleichfalls für sich. Die in kleineren Lettern gesetzten Textteile können, da sie eine gewisse weitergehende Kenntnis der Mechanik bedingen, bei einer ersten Durcharbeitung noch beiseite gelassen werden; sie sind jedoch keineswegs entbehrlich. Die vom Fachlehrertag in Hannover am 26. Juni 1922 angenommenen einheitlichen Bezeichnungen sind nach Möglichkeit angewendet worden, zumal dort, wo es sich nicht um besondere Untersuchungen handelt, bei denen eine geringfügige Abweichung hier und da unerläßlich war, um Mißverständnisse zu verhüten. Wie selbstverständlich, mußte der unterzeichnete Herausgeber den Verfasser in der vor jeder Drucklegung eines Werkes notwendigen eingehenden Durchsicht, einheitlichen Überarbeitung und in gewissen Ergänzungen zu ersetzen suchen. Er gibt sich der Hoffnung hin, daß seine Tätigkeit erfolgreich gewesen sein wird, und daß vor allem das Werk selbst die Anerkennung finden wird, die es seiner Überzeugung nach in vollem Maße verdient. Berlin, Ende M. Loeske.
9 Einleitung Begriff der Uhr. - Jede Vorrichtung, die zur Messung der Zeit dient, sei es durch Teile mit gleichförmiger Bewegung oder durch Teile, die nach gleichen Zeitzwischenräumen in Bewegung kommen, heißt Uhrwerk. In diesem Buche werden nur diejenigen Zeitmesser behandelt, deren Teile durch Räder in Bewegung gesetzt werden, also die Räderuhren im Gegensatz zu den Sonnenuhren, Wasseruhren usw. Allgemeiner Aufbau der Uhren. - Der wichtigste Teil des Uhrwerkes ist derjenige, welcher die zur Zeitmessung benutzte gleichförmige Bewegung erzeugt, also das Geh werk. Mit diesem ist meist unmittelbar das Zeiger werk verbunden, das durch Zeiger und Zifferblatt, Zahlenscheiben und andere Mittel den Ablauf der Zeit auffällig anzeigt. Das Uhrwerk kann auch noch andere Werke enthalten: ein Schlagwerk, das den Ablauf bestimmter Zeitabschnitte hörbar bezeichnet, ein W eckerwerk, das für einen beliebig einstellbaren Zeitpunkt ein weithin hörbares Zeichen (Glockensignal, Musikstück) abgibt, Signal- und Schaltwerke, die zu bestimmten, beliebig vielen Zeitpunkten elektrische Kontakte schließen, ein Laufwerk auslösen, um Läutewerke, elektrische Lampen und andere mechanische und elektrische Apparate und Mechanismen in Tätigkeit zu setzen, Datum werke, die auch größere Zeiträume, Tage, Wochen, Monate, Jahre anzeigen, endlich Kalenderwerke, welche die in den Kalendern enthaltenen Angaben (Schalttage, kirchliche Feste, Stand der Sonne, die Jahreszeiten, die Mondphasen, Sternstellungen und andere astronomische Angaben) sichtbar machen. Alle diese Werke erhalten ihre bewegende Kraft entweder unmittelbar vom Gehwerk, oder sie werden nur rechtzeitig vom Gehwerk, der Seele der ganzen Uhr, ausgelöst. Einteilung der Uhren nach Aufbau, Größe, Zweck. - Wohl keine mechanische Vorrichtung wird in so verschiedenen Größen und in so verschiedenen Formen ausgeführt wie die Uhren. Die Bezeichnungen zeigen deshalb auch eine sinnverwirrende Mannigfaltigkeit. Der Uhrmacher unterscheidet Großuhren und Taschenuhren, wobei Großuhren alle Uhren genannt werden, welche nicht als Taschenzeitmesser gebraucht werden. Das Zifferblatt z. B. kann alle Durch-
10 -8- messer von etwa 15 mm bis zu 8 m erhalten! Die Taschenuhren haben Zifferblätter bis zu etwa 50 mm Durchmesser. Die kleineren Uhren mit Zifferblättern bis zu einem äußeren Durchmesser von etwa 30 mm heißen Damenuhren, die größeren werden als Herrenuhren bezeichnet. Hieran schließen sich der Größe nach Nippuhren, Baby-Wecker, Amerikaner-Wecker, Kamin- und Tischuhren, Wand- und Zimmeruhren, Dielenuhren, Hausuhren, Turmuhren. Nach ihrer Verwendung gelten für gewisse Arten größerer Uhren die Bezeichnungen: Marine-, astronomische, N ormal-, Haupt-, Neben-, Registrier-, Kontroll-, Schaltund Signal-Uhr. Chronometer sind Präzisionsuhren mit sehr vollkommenem Gang. Nach dem Gangregler unterscheidet man Pendel- und Unruhuhren, nach der Hemmung Spindel-, Zylinder-, Duplex-, Anker- und Chrono - m et er gang-taschenuhren. Die Großuhren werden selten nach der Hemmung bezeichnet. Nach der Aufzugsvorrichtung sind die Schlüssel- und Kronenaufzug-Taschenuhren benannt. Wenn die Werkplatten und andere wichtige Teile (Kloben, Triebe) voll gelassen oder vielmehr aus dem Vollen herausgearbeitet sind, so spricht man von massiven Uhren, von Amerikanerwerken dagegen, wenn diese Teile zwecks Materialersparnis durchbrochen und durch Ausstanzen hergestellt und sogenannte Hohltriebe angewendet sind. Scha - blonenuhren sind solche Taschenuhren, die in großer Anzahl in genau gleichmäßiger Werkführung mit genau passenden Ersatzteilen hergestellt sind. Spieluhren, Kuckucksuhren, Datumuhren, Arnerikanerwecker sind nach der besonderen Werkeigenart benannt; Jockele- und Schottenuhren heißen die alten kleinen und mittleren Schwarzwälder Wand-(Pendel-)uhren. Je nachdem das Schlagwerk ausgeführt ist, spricht man von Uhren mit Stundenschlag, mit Halbschlag, mit Viertelschlag und mit Wiederholungsschlag (Repetierschlagwerk). Kunstuhren werden solche Uhren genannt, die sich durch komplizierten Aufbau, Ver - einigung vieler Werke usw. auszeichnen (große und kleine Standuhren, Turmuhren).
11 -9- I. Kapitel. Das Gehwerk. Allgemeines. Das Gehwerk enthält immer die Hauptteile: Antriebrad, Laufwerk, Hemmung oder Gang und Gangregler. Der Antrieb, der von einem Gewicht oder einer Zugfeder erteilt wird, liefert die bewegende Kraft; das Laufwerk leitet die Bewegung zu den übrigen Teilen, in der Regel unter Steigerung der Geschwindigkeit. Die Hemmung hindert den unmittelbaren schroffen Ablauf, indem der Gangregler durch die Hemmung das Laufwerk nur in genau gleichen Zeitzwischenräumen auslöst. Der Gangregler erhält seinen Antrieb unmittelbar durch die Hemmung selbst. Die Abbildung 1 zeigt, schematisch in gerader Linie angeordnet, ein Gehwerk. Das Zuggewicht Q hängt an einer Schnur (Darmsaite, Kette), die um die Walze mit dem Halbmesser r aufgewickelt ist. Auf der gleichen Achse sitzt das Zahnrad W mit dem Halbmesser r 1 und greift in das Trieb (Halbmesser r' 1 ) auf der höher liegenden Achse ein, so daß auch das Rad B, das auf der Triebachse sitzt, angetrieben wird. In gleicher Weise erfolgt die Kupplung der übrigen Räder. Die Verzahnung ist in der Zeichnung weggelassen. Das letzte Rad G gehört schon zur Hemmung, die hier aus eben diesem Gangr ade und dem (Graham-) Anker A besteht. Mit der Achse W von A ist das Pendel verbunden, von dem nur die Pendelstange St zu erkennen ist. Das Gewicht wirkt auf den Umfang der Trommel mit der Kraft Q, welche jene zu drehen sucht; am Gangrade G besteht die Umfangskraft P. Wäre der Anker A nicht vorhanden, so würde sich das ganze Räderwerk in Bewegung setzen und mit im allgemeinen ungleichförmiger Geschwindigkeit ablaufen. Die links- Abb. 1
12 seitige Klaue des Ankers sperrt das Gangrad und damit auch die übrigen Räder. Das Pendel befindet sich im rechtsseitigen Umkehrpunkt; kehrt es zurück, so läßt die linke Klaue des Ankers den Zahn des Gangrades los, und das Rad G dreht sich dann in der Richtung der Uhrzeigerbewegung, bis ein Zahn auf die rechte Ankerklaue fällt, worauf das Räderwerk wieder still steht. Bei jeder der Schwingungen des Pendels, die in genau gleichen Zeiten ausgeführt werden sollen, kann das Gangrad um eine halbe Teilung weiter gehen. An dieser Drehung nehmen alle übrigen Räder teil, jedoch ist ihr Weg im V erhältnis zur Übersetzung entsprechend kleiner. Die Ankerklauen sind schief abgeschliffen, so daß durch den vordrängenden Gangradzahn auf den Anker und damit auf die Pendelachse ein Drehmoment ausgeübt wird, das den Schwingungen des Pendels immer von neuem einen Antrieb erteilt. Man bezeichnet die Räder wie folgt: W Walzenrad, B Beisatzrad, M Minutenrad, Z Zwischenrad, S Sekundenrad oder zweites Zwischenrad, G Gangrad. Die auf den Achsen sitzenden Triebe, welche in der Regel aus Stahl gefertigt sind, haben die entsprechenden Benennungen: Beisatz-, Minuten-, Zwischen-, Sekunden- und Gang-Trieb. Die Zahl der Räder ist allerdings verschieden, je nach der Hemmung und der Gangdauer der Uhr. Bei geringer Gangdauer (Taschenuhren, Wecker) kann das Beisatzrad wegfallen, bei großer Gangdauer (Monats-, Jahresuhren) können auch 2 oder gar 3 Beisatzräder und -Triebe vorhanden sein. Ist kein besonderer Sekundenzeiger vorhanden, so kann S oder auch Z wegfallen. Bei alten Turmuhren findet man manchmal nur W, M, G. Die Kraftübertragung in der Uhr. - Am Umfang der Walze mit dem Halbmesser r wirkt die Kraft des Zuggewichtes Q; am Umfang des Walzenrades mit dem Halbmesser r 1 ist nach dem bekannten Hebelgesetz noch die Kraft P 1 = Q!... wirksam. '1 Diese Kraft überträgt sich ungeändert auf den Umfang des Beisatztriebes (Halbmesser r' 1 ). Am Umfang des Beisatzrades 11 wirkt die Kraft P 2 = P 1 ' = Q!_ ~ 1 = Q r r' 1 Diese Kraft '2 '1 l 2 r1 r2 wird wieder ungeändert auf den Umfang des Minutentriebes übertragen. Am Umfang des Minutenrades wirkt r' 1 1 's P 8 = P = Q r r 1 r 2, r1. f2. Tg so daß wir schließlich für den Um- fang des Gangrades (Halbmesser R) durch Fortsetzung dieser Schlußfolge erhalten:
13 -11 - P=Qr r', r'.-r'. r', r'.. (1) R r1 r2 r3 r, r5 In diese Formel hätten anstatt der Halbmesser auch die entsprechenden Radumfänge u 11 u 2, und die Triebumfänge u'h u' 2, eingesetzt werden können, denn da beispiels-., u', 2 :n: r' r', weise U 1 =2:n:r' 1, U 1 =2:n:r 1, so hat man: -=-1 2 =- u 1 :n: r, r, Bezeichnet man die Zahnteilungen mit 1 bezw. f 1, die Zähnezahlen der Triebe mit z' 11 z' 2, z' 5, die der Räder mit Z1, z 2, Zr so gilt für das erste Räderpaar "Walzenrad-Beisatz- ' 1 t' trieb«die Proportion: u = s_.: t,' 1 und da die Teilung für mitu1 z,. ' einander arbeitende Zahnungen gleich sein muß, also f 1 = f 1, so haben wir: u', = z'i_ Es ist aber, wie eben gezeigt worden, u, z, ~ r' ~ r' ---.! = --2, also auch ---.! = --2, und man kann also in der Formel u, r, z 1 r 1 (1) anstattr',, r\... das Verhältnis der Zähnezahlen zur1 r2 einander einsetzen; man erhält dann Z I I I I I p = Q!_. 1 z 2 z. z. z.. (la) R z1 Z2 Zs r, Z Z2 Z3 z, Z Der Ausdruck, z h d 1, ;,, ist die gesamte a nra - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Übersetzung und mag zur Unterscheidung von der obigen Umfangsbezeichnung mit U bezeichnet werden, so daß sich aus Gleichung (la) ergibt: r 1 P=Q - - RU Zahlen bei spiel: Wie groß ist das Zuggewicht Q zu wählen, wenn am Gangrade ein Zahndruck P von 1 g zulässig ist, der Walzendurchmesser 37 mm, der Gangraddurchmesser 38 mm mißt und die Zähnezahlen zu Z 1 = 180, Z 2 = 96, z 3 = 90, z' 1 = 12, z' 2 = 10, z' 3 = 8 gezählt werden'? (Es sind also nur 3 Räder und 3 Triebe vorhanden bezw. berücksichtigt; die Zähnezahl des Gangrades bleibt außer Betracht, da der Zahndruck am Umfange des Rades von der Zahl der Zähne unabhängig ist.) Wir haben nach Gleichung (la): P= Q.!_. z'1 z'2 z'3 = Q. 18, = 1 R Z1 Z2. Z = Q. 0, ; Q = = 1663,78 g. ' D. R d b. U l ie gesamte a eru ersetzung ist = = ' (2)
14 -12- so daß man auch auf bequemere Weise erhält: 1=Q 1 :~ 5-1 : Q = 18 5 = 1663,78 g wie oben. ' Der Einfluß der Reibung.*) - Da in den Zähnen der Räder und besonders in den Zapfenlöchern Reibung auftritt, so wird obige Rechnung nicht genau stimmen. Das Zuggewicht wird vergrößert werden müssen, wenn der angenommene Zahndruck am Gangrad beibehalten werden soll, oder aber, wenn das Gewicht nur den obigen Wert von rund 1664 g erhält, so wird P kleiner als 1 g sein. Die Reibung, d. h. die Größe des durch sie bedingten Kraftverlustes, hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche der reibenden Teile und von dem darauf lastenden Drucke ab. Je besser die Zahnflächen und Zapfen poliert sind, um so geringer ist die Reibung. Das Öl hat auch den Zweck, die Druckflächen glatt zu machen. Es wirkt jedoch nur so lange, als es nicht durch zu großen Druck fortgedrängt wird. Man gibt deshalb bei starken Drucken dickeres Öl. Für die Zapfen spielt auch der Durchmesser eine wichtige Rolle: je kleiner derselbe, um so geringer ist der Reibungsverlust. Mau wird die Zapfen deshalb immer so dünn machen, als es die nötige Festigkeit zuläßt. Rechnung und Versuch zeigen, daß die Reibung mit der Zahl der Räder (und Zapfen) wächst und daß in normalen Ausführungen durch die Reibung etwa l-2 / 0 der Kraft in den Zähnen, 2-5 / 0 in jedem Zapfenpaar verloren gehen. Für beide Reibungen sind also 3-7 / 0 in Rechnung zu setzen, im Mittel etwa 6 / 0 Obige Formeln müssen also noch mit einem Korrektionsfaktor versehen werden, für den bei einem Räderpaar im Mittel 1-0,06 = 0,94 zu setzen ist. Für zwei Räderpaare ist 0,94 0,94 = 0,94 2, für drei Paare 0,94 3 usf. zu setzen. Arbeiten n Räderpaare zusammen, so muß man ansetzen: r 1 P = Q. R. u. o,94 n (3) In obigem Beispiel also würde der tatsächliche Zahndruck am Gangrad zu P= 1663, ,94 4 werden, weil 4 Räder: W, M, Z, G vorhanden sind, also haben wir, da 0,94 4 = 0,781: P= 1663,78 0, ,781=0,793 g (anstatt 1 g). *) Bei der Besprechung der W ellenzapfen und der Hemmungen wird dieses wichtige Thema eingehender behandelt werden.
15 - 13 Bemerkt muß werden, daß obige Zahlenwerte nur annähernd richtig sind und glatte Zahnfl#chen, gute Eingriffe, gut polierte Zapfen und ausreichende Olung derselben voraussetzen. Sind, wie in der Abbildung 1, 6 Räderpaare vorhanden, so ist die Korrektion 0,94 6 = 0,69; es gehen also schon 31 / 0 an Kraft verloren. Nach den Lehren der Mechanik kann man die genauere Nachrechnung in folgender Weise vornehmen: In der Abbildung 2 sind wieder ein Walzenrad W, ein Beisatzrad B mit einem Trieb und ein Minutentrieb M veranschaulicht. Für B ist noch die M Dicke des Zapfens d dargestellt. Am Umfange von W wirkt die Kraft P,, die sich unverändert auf den Umfang des Beisatztriebes überträgt, wenn vorläufig von der Zahnreibung abgesehen wird. Am Umfange des Rades B wird dann die Kraft P 2 weiter übertragen. Damit das System in Ruhe bleibt, muß der im Eingriff stehende Zahn des Minutentriebes M offenbar einen gleichgroßen Widerstand leisten: P 2' = P 2 Auf den Zapfen des Beisatzrades wirkt demnach die Summe der Kräfte P, + P 2 und erzeugt dort Reibung, wenn eine Bewegung eintritt. Heißt d~r Reibungskoeffizientµ, so ist die zur Uberwindung der Reibung am Umfange des Zapfens notwendige Kraft R=(P, + P 2) fl. Das Drehmoment (Kraft X Hebelarm), das die Kraft P, ausübt, muß gleich sein 1 i i 1 i Abb. 2 dem Drehmoment der Kraft P 2, ver- d mehrt um das Drehmoment der Reibung, also P, r, = P 2 R 2 + R 2, da die Reibung am Hebelarm ~ wirkt. Man erhält somit: d P, r, =P2 R2 + (P, + P2) 2.,u; daraus ergibt sich durch eine leicht zu übersehende Umformung: d r1-9 lu P 2 = P, -~-. (4) R, +2.u Zur Auswertung müssen die Größen r R,, d und der Wert von f1 gegeben sein. Der Reibungskoeffizient µ ist nur bei äußerst sorgfältiger Ausführung kleiner als 0,1, welche Größe als guter Mittelwert für geölte, leichtlaufende Zapfen verwendet werden kann. In einem Uhrwerk seien r, = 3 mm, d = 2,5 mm, R 2 = 30 mm. Dann ergibt sich: d 2,5 0 r, - 2 µ 3--2,l 287" R +!!_. 30+~ o 1 = 30'.12~ =0, ,u 2 ' Ohne Zapfenreibung wäre die Gleichung der Drehmomente P, r, = P 2 R 2 ; ß
16 daraus P 2 =Pi~:= Pi :o =Pi 0,1. Es ist also durch die Reibung die. V h. 0,0954 0,954 95,4 d 4 60/ kl. KraftP 2 1m er ältmsvon01 =- 1 -= 100 o erum, 0 einer geworden. ' Da die Verhältnisse bei den anderen Räderpaaren gleich oder ähnlich liegen, so sind die oben ohne Ableitung gegebenen Zahlenwertefgerechtfertigt, wenn noch für jedes Räderpaar 1 bis 2 / 0 Kraftverlust auf die Zahnreibung in Ansatz gebracht werden. II. Kapitel Die Antriebvorrichtungen Der Gewichtszug Der Gewichtszug bildet die einfachste Antriebvorrichtung; die bewegende Kraft wird, wie in der Abbildung 1 dargestellt ist, durch ein sinkendes Gewicht Q erzeugt. Das Gewichtsstück ist zylindrisch glatt, kanelliert oder in anderer Art geziert. Für feine Uhrwerke werden massive Messinggewichte angewendet, für andere Uhren Gewichte aus mit Blei gefüllten Messinghülsen oder aus Gußeisen. Die geometrischen Verhältnisse sind nicht ganz gleichgültig, da zu dicke Gewichte das Pendel behindern können, zu dünne aber unschön wirken und auch oft zu viel Platz in der Länge wegnehmen. Angemessen findet man das ~=:~sintlährev zwischen 2 bis 5 (Abbildung 3). Ist s das spezifische Gewicht, so wird n d Q = -- 2 [. s. Wenn das Material bestimmt ist 4 Abb. 3 (Gußeisen: s= 7,6; Messing: S=8,5; Blei: S= 11,3) und entweder l oder d als fest angenommen wird, so ergibt sich die andere Abmessung aus obiger Formel. Ist z. B. der zulässige Durchmesser d = 40 mm und Q = 1662 g, so erhält man aus obiger Formel die Gleichung: l 4 Q d f" M. l = -d~ un ur essmg = =, cm, was 11;. S IT, eine gute Form ergibt. (Da wir das Gewicht in g angegeben haben, mußten alle Abmessungen in cm eingesetzt werden, weil 1 ccm Messing 8,5 g wiegt.) Für Gußeisen erhält man l =!_:_ 4 ~, 62 6 = 17,4 cm, für Blei l = 11,7 cm. Will man die n - 7, notwendige Messingbüchse noch berücksichtigen, und wird deren Wandstärke zu etwa 1 mm angenommen, so erhält man bei einer lichten Weite von 40 mm für diese Büchse ca. 128 g; das Gewicht würde dann aber = 1790 g betragen.
Inhaltsverzeichnis. Zeit und Zeitmessung 13. Vorwort 11. I. Teil
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15 Die scheinbaren" und die wirklichen"
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I. Teil Zeit und Zeitmessung 13 Was ist die Zeit? 13 Wie wird die Zeit bestimmt? 13 Der Sternenhimmel 14 Die verschiedenen Himmelskörper 15 Die scheinbaren" und die wirklichen"
Dokumentation. Fertigung einer. Gangreserveanzeige. für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag. Von Alexander Santore
 Dokumentation Fertigung einer Gangreserveanzeige für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag Von Alexander Santore 1 Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1: Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangreserveanzeige?
Dokumentation Fertigung einer Gangreserveanzeige für ein Mauthe Großuhrwerk mit ½ Stundenschlag Von Alexander Santore 1 Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1: Was versteht der Uhrmacher unter einer Gangreserveanzeige?
 Inhaltsverzeichnis 1. Die französische Grassuhrenindustrie 1 Seiten 1.1 Struktur................................................... 1 1.2 Entwicklung und Produktionsumfang......................... 1 2.
Inhaltsverzeichnis 1. Die französische Grassuhrenindustrie 1 Seiten 1.1 Struktur................................................... 1 1.2 Entwicklung und Produktionsumfang......................... 1 2.
EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I. 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln
 EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln KLINKHARDT &: BIERMANN BRAUNSCHWEIG INHALTSVERZEICHNIS
EIN HANDBUCH FÜR SAMMLER UND LIEBHABER REINHARD MEIS DIE ALTE UHR GESCHICHTE - TECHNIK - STIL BAND I 474 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbtafeln KLINKHARDT &: BIERMANN BRAUNSCHWEIG INHALTSVERZEICHNIS
Vom Zugfeder-Antrieb. H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XXI, 1981, S. 71 ff
 H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XXI, 1981, S. 71 ff Vom Zugfeder-Antrieb Ein Blick auf die Kraftkurve (Abb. 1) einer Zugfeder, von einem modernen Dynamometer aufgezeichnet,
H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XXI, 1981, S. 71 ff Vom Zugfeder-Antrieb Ein Blick auf die Kraftkurve (Abb. 1) einer Zugfeder, von einem modernen Dynamometer aufgezeichnet,
Versuchprotokoll A07 - Maxwell-Rad
 Versuchprotokoll A07 - Maxwell-Rad 4. GRUNDLAGEN, FRAGEN 1. Welchen Zusammenhang gibt es hier zwischen der Winkelgeschwindigkeit ω des Rades und der Translationsgeschwindigkeit v seines Schwerpunktes?
Versuchprotokoll A07 - Maxwell-Rad 4. GRUNDLAGEN, FRAGEN 1. Welchen Zusammenhang gibt es hier zwischen der Winkelgeschwindigkeit ω des Rades und der Translationsgeschwindigkeit v seines Schwerpunktes?
KREUZSCHLAG-VARIANTEN
 H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XVII, 1978, S. 117 ff KREUZSCHLAG-VARIANTEN Auszugsweise Übersetzung aus dem Buch von Charles Gros: Echappements d'horloges et de Montres,
H. Jendritzki, Hamburg, Schriften der Freunde alter Uhren, Bd. XVII, 1978, S. 117 ff KREUZSCHLAG-VARIANTEN Auszugsweise Übersetzung aus dem Buch von Charles Gros: Echappements d'horloges et de Montres,
5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment
 5.3. DREHIMPULS UND DREHMOMENT IM EXPERIMENT 197 5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment Wir besprechen nun einige Experimente zum Thema Drehimpuls und Drehmoment. Wir betrachten ein System von N Massenpunkten,
5.3. DREHIMPULS UND DREHMOMENT IM EXPERIMENT 197 5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment Wir besprechen nun einige Experimente zum Thema Drehimpuls und Drehmoment. Wir betrachten ein System von N Massenpunkten,
Grundbegriffe zur Beschreibung von Kreisbewegungen
 Arbeitsanleitung I Kreisbewegung Grundbegriffe zur Beschreibung von Kreisbewegungen Beschreibung der Kreisbewegung 1 1.1 Das Bogenmass 1.2 Begriffe zur Kreisbewegung 1.3 Die Bewegung auf dem Kreis Lösungen
Arbeitsanleitung I Kreisbewegung Grundbegriffe zur Beschreibung von Kreisbewegungen Beschreibung der Kreisbewegung 1 1.1 Das Bogenmass 1.2 Begriffe zur Kreisbewegung 1.3 Die Bewegung auf dem Kreis Lösungen
Fadenpendel (M1) Ziel des Versuches. Theoretischer Hintergrund
 Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel (M1) Ziel des Versuches. Theoretischer Hintergrund
 Fadenpendel M) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel M) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Gleichgewicht am Punkt
 Gleichgewicht am Punkt 3.1 Gleichgewichtsbedingung für einen Massenpunkt.. 52 3.2 Freikörperbild................................... 52 3.3 Ebene Kräftesysteme............................ 55 3.4 Räumliche
Gleichgewicht am Punkt 3.1 Gleichgewichtsbedingung für einen Massenpunkt.. 52 3.2 Freikörperbild................................... 52 3.3 Ebene Kräftesysteme............................ 55 3.4 Räumliche
Mechanische Uhrwerke
 Mechanische Uhrwerke SIE WERDEN SIE SO UMFASSEND ZUFRIEDENSTELLEN, WIE KAUM EIN ANDERER ZEITMESSER ES VERMAG. Die Vorteile mechanischer Uhren und wie man sie bewahrt Warum bieten die Longines Uhrmacher
Mechanische Uhrwerke SIE WERDEN SIE SO UMFASSEND ZUFRIEDENSTELLEN, WIE KAUM EIN ANDERER ZEITMESSER ES VERMAG. Die Vorteile mechanischer Uhren und wie man sie bewahrt Warum bieten die Longines Uhrmacher
1.Klausur LK Physik 12/2 - Sporenberg Datum:
 1.Klausur LK Physik 12/2 - Sporenberg Datum: 28.03.2011 1.Aufgabe: I. Eine flache Spule (n 500, b 5 cm, l 7 cm, R 280 Ω) wird mit v 4 mm in der Abbildung aus der Lage I durch das scharf begrenzte Magnetfeld
1.Klausur LK Physik 12/2 - Sporenberg Datum: 28.03.2011 1.Aufgabe: I. Eine flache Spule (n 500, b 5 cm, l 7 cm, R 280 Ω) wird mit v 4 mm in der Abbildung aus der Lage I durch das scharf begrenzte Magnetfeld
Klausur. zur Vorlesung Experimentalphysik für Studierende der Biologie, Gartenbauwissenschaften, Pflanzenbiotechnologie und Life Science
 Klausur zur Vorlesung Experimentalphysik für Studierende der Biologie, Gartenbauwissenschaften, Pflanzenbiotechnologie und Life Science Leibniz Universität Hannover 03.02.2010 Barthold Name, Vorname: Matrikelnummer:
Klausur zur Vorlesung Experimentalphysik für Studierende der Biologie, Gartenbauwissenschaften, Pflanzenbiotechnologie und Life Science Leibniz Universität Hannover 03.02.2010 Barthold Name, Vorname: Matrikelnummer:
Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus. U. Krausch
 Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus U. Krausch Was ist Zeit? Vor über 2500 Jahren legt Heraklit die Grunddeutung Alles fließt. Augustinus (345-430 n. Chr.):
Turmuhren der Jakobuskirche, der Schule und der Strasser & Rhode - Uhr im Rathaus U. Krausch Was ist Zeit? Vor über 2500 Jahren legt Heraklit die Grunddeutung Alles fließt. Augustinus (345-430 n. Chr.):
Trigonometrie. für Maschinenbauer und Elektrotechniker. Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium. von. Dr.
 Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Sechste, verbesserte
Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Sechste, verbesserte
Antike Spindeltaschenuhr mit Viertelrepetition im Goldgehäuse
 Juwelier & Uhrmachermeister Jochen Tröger Antike Spindeltaschenuhr mit Viertelrepetition im Goldgehäuse Öffnungszeiten Mo. bis Sa. : 09:00-13:00 Mo., Di., Do. und Fr. : 13:30-18:30 Adresse Bahnstraße 7
Juwelier & Uhrmachermeister Jochen Tröger Antike Spindeltaschenuhr mit Viertelrepetition im Goldgehäuse Öffnungszeiten Mo. bis Sa. : 09:00-13:00 Mo., Di., Do. und Fr. : 13:30-18:30 Adresse Bahnstraße 7
von Professor W. SANDER t Diplom-Ingenieur, ehern. Vorstand der Württemb. Fachschule für Feinmechanik und Uhrmacherei in Schwenningen a. N.
 UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau der Uhrwerke in elementarer Darstellung für Fachschulen und zum Selbstunterricht, für Konstrukteure und
UHRENLEHRE Die wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätze für den Bau der Uhrwerke in elementarer Darstellung für Fachschulen und zum Selbstunterricht, für Konstrukteure und
Lösungblatt III Veröentlichung
 Aufgabe 1 a) Ein Block der Masse m = 0.5Kg hängt am unteren Ende einer vertikal aufgehängten Feder. Aufgrund des Blocks streckt sich die Feder um eine Distanz d = 5cm aus ihrer Gleichgewichtslage (vgl.
Aufgabe 1 a) Ein Block der Masse m = 0.5Kg hängt am unteren Ende einer vertikal aufgehängten Feder. Aufgrund des Blocks streckt sich die Feder um eine Distanz d = 5cm aus ihrer Gleichgewichtslage (vgl.
Reprint 1952 Berlin 2014
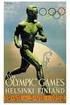 Reprint 1952 Berlin 2014 Vorwort des Verfassers Das vorliegende Fachrechenbuch bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben aus dem Gebiet der Klein- und Großuhren. Bei der Behandlung des Lehrstoffes
Reprint 1952 Berlin 2014 Vorwort des Verfassers Das vorliegende Fachrechenbuch bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben aus dem Gebiet der Klein- und Großuhren. Bei der Behandlung des Lehrstoffes
Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems
 THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup
 Bernd Mosel mosel(at)uni-muenster.de 24.8.2009 (10.03.2012) Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup Die Kirche von Westen im Jugendstil, Von NO: Erweiterung durch das östliche
Bernd Mosel mosel(at)uni-muenster.de 24.8.2009 (10.03.2012) Die modernisierte Turmuhrenanlage der evangelischen Kirche Ochtrup Die Kirche von Westen im Jugendstil, Von NO: Erweiterung durch das östliche
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag
 Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
2.0 Dynamik Kraft & Bewegung
 .0 Dynamik Kraft & Bewegung Kraft Alltag: Muskelkater Formänderung / statische Wirkung (Gebäudestabilität) Physik Beschleunigung / dynamische Wirkung (Impulsänderung) Masse Schwere Masse: Eigenschaft eines
.0 Dynamik Kraft & Bewegung Kraft Alltag: Muskelkater Formänderung / statische Wirkung (Gebäudestabilität) Physik Beschleunigung / dynamische Wirkung (Impulsänderung) Masse Schwere Masse: Eigenschaft eines
Neuanfertigung einer Globusuhr mit Mondanzeige
 Globusuhr Neuanfertigung einer Globusuhr mit Mondanzeige Die hier vorgestellte Globusuhr zeigt in der Mitte die Tageszeit auf einem Zwölfstunden-Zifferblatt mit Minuteneinteilung. Unter der Tageszeit ist
Globusuhr Neuanfertigung einer Globusuhr mit Mondanzeige Die hier vorgestellte Globusuhr zeigt in der Mitte die Tageszeit auf einem Zwölfstunden-Zifferblatt mit Minuteneinteilung. Unter der Tageszeit ist
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag
 Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
Mechanische Uhrwerke Sie werden Sie so umfassend zufriedenstellen, wie kaum ein anderer Zeitmesser es vermag Warum bieten die Longines Uhrmacher in ihren Uhrenkollektionen Zeitmesser an, die mit mechanischen
CLUB APOLLO 13, 12. Wettbewerb Aufgabe 4
 CLUB APOLLO 13, 12. Wettbewerb Aufgabe 4 Von Zahnrädern und Getrieben Die vierte Apollo-Aufgabe wird vom Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität
CLUB APOLLO 13, 12. Wettbewerb Aufgabe 4 Von Zahnrädern und Getrieben Die vierte Apollo-Aufgabe wird vom Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität
Zahnformen in mechanischen Kleinuhren
 Fakultät Maschinenwesen, Institut für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion, Lehrstuhl Maschinenelemente Berechnung, Optimierung und Messung geometrischer und kinematischer Eigenschaften Feinwerktechnische
Fakultät Maschinenwesen, Institut für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion, Lehrstuhl Maschinenelemente Berechnung, Optimierung und Messung geometrischer und kinematischer Eigenschaften Feinwerktechnische
Trägheitsmoment (TRÄ)
 Physikalisches Praktikum Versuch: TRÄ 8.1.000 Trägheitsmoment (TRÄ) Manuel Staebel 3663 / Michael Wack 34088 1 Versuchsbeschreibung Auf Drehtellern, die mit Drillfedern ausgestattet sind, werden die zu
Physikalisches Praktikum Versuch: TRÄ 8.1.000 Trägheitsmoment (TRÄ) Manuel Staebel 3663 / Michael Wack 34088 1 Versuchsbeschreibung Auf Drehtellern, die mit Drillfedern ausgestattet sind, werden die zu
Auswertung. A07: Maxwellsches Rad
 Auswertung zum Seminarversuch A07: Maxwellsches Rad Alexander FufaeV Partner: Jule Heier Gruppe 334 Einleitung Beim Experiment mit dem Maxwellschen Rad werden Translations- und Rotationsbewegung untersucht.
Auswertung zum Seminarversuch A07: Maxwellsches Rad Alexander FufaeV Partner: Jule Heier Gruppe 334 Einleitung Beim Experiment mit dem Maxwellschen Rad werden Translations- und Rotationsbewegung untersucht.
Kraft- und Drehmomentsensoren von CLA
 Kraft- und Drehmomentsensoren von CLA SC-002 LC-01 LC-10 TSF-000 TSF-05 TSF-1 TSF-100 Mikro-Kraftsensor Kraftsensor Mikro-Drehmomentsensor Drehmomentsensor Tel. +41 32 421 44 90, Fax +41 32 421 44 91,
Kraft- und Drehmomentsensoren von CLA SC-002 LC-01 LC-10 TSF-000 TSF-05 TSF-1 TSF-100 Mikro-Kraftsensor Kraftsensor Mikro-Drehmomentsensor Drehmomentsensor Tel. +41 32 421 44 90, Fax +41 32 421 44 91,
Ein neuer Glashütter Anker
 Ein neuer Glashütter Anker Es ist ein seit langem anerkannter Grundsatz in der Präzisionsuhrmacherei, daß alle eigentlichen Hemmungsteile, also Gangrad und Anker nebst Gabel, möglichst leicht und abgeglichen
Ein neuer Glashütter Anker Es ist ein seit langem anerkannter Grundsatz in der Präzisionsuhrmacherei, daß alle eigentlichen Hemmungsteile, also Gangrad und Anker nebst Gabel, möglichst leicht und abgeglichen
Solution V Published:
 1 Reibungskraft I Ein 25kg schwerer Block ist zunächst auf einer horizontalen Fläche in Ruhe. Es ist eine horizontale Kraft von 75 N nötig um den Block in Bewegung zu setzten, danach ist eine horizontale
1 Reibungskraft I Ein 25kg schwerer Block ist zunächst auf einer horizontalen Fläche in Ruhe. Es ist eine horizontale Kraft von 75 N nötig um den Block in Bewegung zu setzten, danach ist eine horizontale
Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr. Click here if your download doesn"t start automatically
 Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr Click here if your download doesn"t start automatically Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur
Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur Armbanduhr Click here if your download doesn"t start automatically Technische Grundlagen der Mechanischen Uhren: Von der Turm- bis zur
Uhren-ABC 1/6. *Grossuhren: Energiequelle: Zugfeder oder Gewicht Schwingungsorgan: in der Regel ein Pendel
 Uhren-ABC 1/6 In der Schweiz werden heute zwei Hauptarten von Uhren hergestellt: Elektronische Quarzuhren mit Zeigeranzeige (auch kombiniert mit Digitalanzeige) und mechanische Uhren. Die mechanische Uhr
Uhren-ABC 1/6 In der Schweiz werden heute zwei Hauptarten von Uhren hergestellt: Elektronische Quarzuhren mit Zeigeranzeige (auch kombiniert mit Digitalanzeige) und mechanische Uhren. Die mechanische Uhr
Bauen Sie sich Ihr persönliches Stück Zeitgeschichte. Entdecken Sie die Faszination einer Präzisions-Tischuhr
 M E C H A N I C A M 2 Bauen Sie sich Ihr persönliches Stück Zeitgeschichte Entdecken Sie die Faszination einer Präzisions-Tischuhr Begegnen Sie der faszinierenden Technik klassischer Uhrmacherei Alles
M E C H A N I C A M 2 Bauen Sie sich Ihr persönliches Stück Zeitgeschichte Entdecken Sie die Faszination einer Präzisions-Tischuhr Begegnen Sie der faszinierenden Technik klassischer Uhrmacherei Alles
M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen
 M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
Mechanische Elemente: das Zahnrad
 Mechanische Elemente: das Zahnrad Mechanische Elemente: Zahnrad Zahnräder sind mit Zähnen ausgestattet, die in die Zähne anderer Zahnräder eingreifen. Weil die Zähne sich gegenseitig umschließen, können
Mechanische Elemente: das Zahnrad Mechanische Elemente: Zahnrad Zahnräder sind mit Zähnen ausgestattet, die in die Zähne anderer Zahnräder eingreifen. Weil die Zähne sich gegenseitig umschließen, können
Physik. Federkombinationen
 Physik Federkombinationen Feststellung der Federkonstanten Versuchsaufbau Versuchsdurchführung Um die Federkonstanten festzustellen, wird an die Federn ein Gewicht von bekannter Gewichtskraft angehängt
Physik Federkombinationen Feststellung der Federkonstanten Versuchsaufbau Versuchsdurchführung Um die Federkonstanten festzustellen, wird an die Federn ein Gewicht von bekannter Gewichtskraft angehängt
 Helmut Mann Porträt einer Taschenuhr Kleine Uhrenkunde für Liebhaber Impressum HEEL Verlag GmbH Gut Pottscheidt 53639 Königswinter Telefon 0 22 23 / 92 30-0 Telefax 0 22 23 / 92 30 26 Mail: info@heel-verlag.de
Helmut Mann Porträt einer Taschenuhr Kleine Uhrenkunde für Liebhaber Impressum HEEL Verlag GmbH Gut Pottscheidt 53639 Königswinter Telefon 0 22 23 / 92 30-0 Telefax 0 22 23 / 92 30 26 Mail: info@heel-verlag.de
Trigonometrie. für Maschinenbauer und Elektrotechniker. Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium. von. Dr.
 Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Siebente, verbesserte
Trigonometrie für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. Adolf Heß Professor am kantonalen Technikum in Winterthur Siebente, verbesserte
BERECHNUNG EINES STIRNZAHN-
 BH Ausführung: F. Blömer M. Hinkelammert Entwicklung und Konstruktion -Auslegung eines Getriebes zur Kraftübertragung- Klasse: FSBA 2 Technikerschule Hannover Fachlehrer: Hr. Rissiek 29..204 HB B BERECHNUNG
BH Ausführung: F. Blömer M. Hinkelammert Entwicklung und Konstruktion -Auslegung eines Getriebes zur Kraftübertragung- Klasse: FSBA 2 Technikerschule Hannover Fachlehrer: Hr. Rissiek 29..204 HB B BERECHNUNG
Zifferblatt. Kunstuhr aus Metall. So wird s gemacht:
 So wird s gemacht: Schneide alle 35 Kärtchen an den dicken schwarzen Linien aus und lege sie so in einer langen Reihe aneinander, dass das Kärtchen mit der Bezeichnung START das erste, dasjenige mit der
So wird s gemacht: Schneide alle 35 Kärtchen an den dicken schwarzen Linien aus und lege sie so in einer langen Reihe aneinander, dass das Kärtchen mit der Bezeichnung START das erste, dasjenige mit der
Dr. Alfred Recknagel. em.ord. Professor der Technischen Universität Dresden. PH i SIlv. Mechanik. 17., unveränderte Auflage VERLAG TECHNIK BERLIN
 Dr. Alfred Recknagel em.ord. Professor der Technischen Universität Dresden PH i SIlv Mechanik 17., unveränderte Auflage VERLAG TECHNIK BERLIN Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten Buchstabensymbole 7 1. Einleitung
Dr. Alfred Recknagel em.ord. Professor der Technischen Universität Dresden PH i SIlv Mechanik 17., unveränderte Auflage VERLAG TECHNIK BERLIN Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten Buchstabensymbole 7 1. Einleitung
0.1 Versuch 4C: Bestimmung der Gravitationskonstante mit dem physikalischen Pendel
 0.1 Versuch 4C: Bestimmung der Gravitationskonstante mit dem physikalischen Pendel 0.1.1 Aufgabenstellung Man bestimme die Fallbeschleunigung mittels eines physikalischen Pendels und berechne hieraus die
0.1 Versuch 4C: Bestimmung der Gravitationskonstante mit dem physikalischen Pendel 0.1.1 Aufgabenstellung Man bestimme die Fallbeschleunigung mittels eines physikalischen Pendels und berechne hieraus die
Wasseruhren Schon etwa 1400 Jahre vor der Geburt Christi gab es Wasseruhren.
 Sonnenuhren Die Menschen haben sich zuerst nach dem Sonnenstand gerichtet. Das war natürlich nur eine grobe Einteilung. Schon vor 4000 Jahren bauten die Ägypter Sonnenuhren, diese hatten bereits eine Stundeneinteilung.
Sonnenuhren Die Menschen haben sich zuerst nach dem Sonnenstand gerichtet. Das war natürlich nur eine grobe Einteilung. Schon vor 4000 Jahren bauten die Ägypter Sonnenuhren, diese hatten bereits eine Stundeneinteilung.
Experimentalphysik 1. Aufgabenblatt 2
 Technische Universität München Fakultät für Physik Ferienkurs Experimentalphysik 1 WS 2017/18 Aufgabenblatt 2 Annika Altwein Maximilian Ries Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabe 1(zentraler Stoß elastisch, unelastisch)
Technische Universität München Fakultät für Physik Ferienkurs Experimentalphysik 1 WS 2017/18 Aufgabenblatt 2 Annika Altwein Maximilian Ries Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabe 1(zentraler Stoß elastisch, unelastisch)
Physik für Biologen und Zahnmediziner
 Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Impuls und Drehungen Dr. Daniel Bick 22. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 22. November 2017 1 / 36 Hinweise zur Klausur Sa,
Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Impuls und Drehungen Dr. Daniel Bick 22. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 22. November 2017 1 / 36 Hinweise zur Klausur Sa,
Physik für Biologen und Zahnmediziner
 Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Impuls und Drehungen Dr. Daniel Bick 22. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 22. November 2017 1 / 24 Hinweise zur Klausur Sa,
Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Impuls und Drehungen Dr. Daniel Bick 22. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 22. November 2017 1 / 24 Hinweise zur Klausur Sa,
6 Mechanik des Starren Körpers
 6 Mechanik des Starren Körpers Ein Starrer Körper läßt sich als System von N Massenpunkten m (mit = 1,...,N) auffassen, die durch starre, masselose Stangen miteinander verbunden sind. Dabei ist N M :=
6 Mechanik des Starren Körpers Ein Starrer Körper läßt sich als System von N Massenpunkten m (mit = 1,...,N) auffassen, die durch starre, masselose Stangen miteinander verbunden sind. Dabei ist N M :=
Physikunterricht 11. Jahrgang P. HEINECKE.
 Physikunterricht 11. Jahrgang P. HEINECKE Hannover, Juli 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Kinematik 3 1.1 Gleichförmige Bewegung.................................. 3 1.2 Gleichmäßig
Physikunterricht 11. Jahrgang P. HEINECKE Hannover, Juli 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Kinematik 3 1.1 Gleichförmige Bewegung.................................. 3 1.2 Gleichmäßig
Die Gesetze des Wasserund I_Juftwiderstandes
 Die Gesetze des Wasserund I_Juftwiderstandes und ihre Anwendung in der Flugtechnik Von Dr. Oscar luartienssen Kiel Mit 7 5 Textfiguren Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1913 ISBN 978-3-642-50601-7
Die Gesetze des Wasserund I_Juftwiderstandes und ihre Anwendung in der Flugtechnik Von Dr. Oscar luartienssen Kiel Mit 7 5 Textfiguren Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1913 ISBN 978-3-642-50601-7
Übungsblatt 9. a) Wie groß ist der Impuls des Autos vor und nach der Kollision und wie groß ist die durchschnittliche Kraft, die auf das Auto wirkt?
 Aufgabe 32: Impuls Bei einem Crash-Test kollidiert ein Auto der Masse 2000Kg mit einer Wand. Die Anfangsund Endgeschwindigkeit des Autos sind jeweils v 0 = (-20m/s) e x und v f = (6m/s) e x. Die Kollision
Aufgabe 32: Impuls Bei einem Crash-Test kollidiert ein Auto der Masse 2000Kg mit einer Wand. Die Anfangsund Endgeschwindigkeit des Autos sind jeweils v 0 = (-20m/s) e x und v f = (6m/s) e x. Die Kollision
Achslastberechnungen. Scania Distributoren und Händler haben ein Kalkulationsprogramm, das die optimierte Last- und Achslastverteilung erleichtert.
 Allgemeine Informationen zu Achslastberechnungen Für sämtliche Arten von Transportarbeiten mit Lkws muss das ab Werk gelieferte Fahrgestell mit einem Aufbau ausgerüstet werden. Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen zu Achslastberechnungen Für sämtliche Arten von Transportarbeiten mit Lkws muss das ab Werk gelieferte Fahrgestell mit einem Aufbau ausgerüstet werden. Allgemeine Informationen
Bruchrechnen Erweitern heißt:
 Bruchrechnen Erweitern heißt: Kürzen heißt: Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl vervielfachen. Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl teilen. Beim Erweitern und Kürzen bleibt der Wert eines Bruches
Bruchrechnen Erweitern heißt: Kürzen heißt: Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl vervielfachen. Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl teilen. Beim Erweitern und Kürzen bleibt der Wert eines Bruches
Polarisationsapparat
 1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
RPS-ZAHNSTANGEN. Auswahlprozess Zahnstange Anwendungsdaten Berechnungen Spezifikationen Maßblätter Produktnummern...
 PATETED RPS-ZAHSTAGE exen bietet modulare und kundenspezifische größen für unbegrenzte Systemlängen. Wählen Sie aus fünf modellen das perfekte Material für jede Anwendung. Auswahlprozess... 10 Anwendungsdaten...
PATETED RPS-ZAHSTAGE exen bietet modulare und kundenspezifische größen für unbegrenzte Systemlängen. Wählen Sie aus fünf modellen das perfekte Material für jede Anwendung. Auswahlprozess... 10 Anwendungsdaten...
Die Dichte der Erde, berechnet aus der Schwerebeschleunigung
 152S Die Dichte der Erde, berechnet aus der Schwerebeschleunigung und der Abplattung Dr. O. Tumlirz, P r o f e s s o r i m t i c r k. k. l ' n i r r r s i l i i l in C.'w r n o ic ilz. Aus den Messungen
152S Die Dichte der Erde, berechnet aus der Schwerebeschleunigung und der Abplattung Dr. O. Tumlirz, P r o f e s s o r i m t i c r k. k. l ' n i r r r s i l i i l in C.'w r n o ic ilz. Aus den Messungen
Versuch 4 Messung der dynamischen Viskosität mit dem Rotationsviskosimeter (Grundlagen DIN 53018)
 Versuch 4 Messung der dynamischen Viskosität mit dem Rotationsviskosimeter (Grundlagen DIN 53018) Versuch 4 Messung der dynamischen Viskosität mit dem Rotationsviskosimeter (Grundlagen DIN 53018) 4.1 Begriff
Versuch 4 Messung der dynamischen Viskosität mit dem Rotationsviskosimeter (Grundlagen DIN 53018) Versuch 4 Messung der dynamischen Viskosität mit dem Rotationsviskosimeter (Grundlagen DIN 53018) 4.1 Begriff
1. Klausur ( )
 EI K1PH-4 2012-13 PHYSIK 1. Klausur (15.10.2012) 1. Aufgabe (2 Punkte) Gib ein Beispiel für eine Bewegung an, bei der die Geschwindigkeit negativ, die Beschleunigung aber positiv ist. Skizziere ein entsprechendes
EI K1PH-4 2012-13 PHYSIK 1. Klausur (15.10.2012) 1. Aufgabe (2 Punkte) Gib ein Beispiel für eine Bewegung an, bei der die Geschwindigkeit negativ, die Beschleunigung aber positiv ist. Skizziere ein entsprechendes
Elektrische Antriebe in der Kältetechnik
 Kapitel 8 Elektrische Antriebe in der Kältetechnik In diesem Kapitel sollen die elektromotorischen Antriebe, die im Kälteanlagenbau eine wichtige Stellung einnehmen, näher betrachtet werden. Einen wesentlichen
Kapitel 8 Elektrische Antriebe in der Kältetechnik In diesem Kapitel sollen die elektromotorischen Antriebe, die im Kälteanlagenbau eine wichtige Stellung einnehmen, näher betrachtet werden. Einen wesentlichen
TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner
 TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner Das schweizer TAVARO-Uhrwerk wurde während des zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten und der Achsenmächte in Zeitzündern der Geschosskaliber ab 7,5 cm verwendet.
TAVARO-Uhrwerk von Ingo Kaim Exner Das schweizer TAVARO-Uhrwerk wurde während des zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten und der Achsenmächte in Zeitzündern der Geschosskaliber ab 7,5 cm verwendet.
Mathematik. Technik. Programmieren. Physik. Mechanik. Elektronik. Getriebeverhältnisse. Sensoren Antwort/ Feedback. Einfache Maschinen
 Robotics ist angewandte Mathematik und fördert das forschende Lernen Physik Elektronik Sensoren Antwort/ Feedback Mathematik Technik Programmieren Mechanik Getriebeverhältnisse Einfache Maschinen Geometrie
Robotics ist angewandte Mathematik und fördert das forschende Lernen Physik Elektronik Sensoren Antwort/ Feedback Mathematik Technik Programmieren Mechanik Getriebeverhältnisse Einfache Maschinen Geometrie
Aufgabe 1: A. 7.7 kj B kj C. 200 kj D kj E. 770 J. Aufgabe 2:
 Aufgabe 1: Ein Autoreifen habe eine Masse von 1 kg und einen Durchmesser von 6 cm. Wir nehmen an, dass die gesamte Masse auf dem Umfang konzentriert ist (die Lauffläche sei also viel schwerer als die Seitenwände
Aufgabe 1: Ein Autoreifen habe eine Masse von 1 kg und einen Durchmesser von 6 cm. Wir nehmen an, dass die gesamte Masse auf dem Umfang konzentriert ist (die Lauffläche sei also viel schwerer als die Seitenwände
Lösung IV Veröffentlicht:
 Fx = mg sin θ = ma x 1 Konzeptionelle Frage I Welche der der folgenden Aussagen über Kraft Bewegung ist korrekt? Geben sie Beispiele an (a) Ist es für ein Objekt möglich sich zu bewegen, ohne dass eine
Fx = mg sin θ = ma x 1 Konzeptionelle Frage I Welche der der folgenden Aussagen über Kraft Bewegung ist korrekt? Geben sie Beispiele an (a) Ist es für ein Objekt möglich sich zu bewegen, ohne dass eine
EXPOSÉ LOUIS SEIZE REGULATOR FERDINAND BERTHOUD - PARIS RESTAURIERUNGSATELIER JÜRGEN EHRT - ARCHIV-NUMMER
 EXPOSÉ LOUIS SEIZE REGULATOR FERDINAND BERTHOUD - PARIS RESTAURIERUNGSATELIER JÜRGEN EHRT - ARCHIV-NUMMER 504-2014 URHEBERSCHUTZ Das folgende Exposé ist Eigentum des Restaurierungsateliers Jürgen Ehrt.
EXPOSÉ LOUIS SEIZE REGULATOR FERDINAND BERTHOUD - PARIS RESTAURIERUNGSATELIER JÜRGEN EHRT - ARCHIV-NUMMER 504-2014 URHEBERSCHUTZ Das folgende Exposé ist Eigentum des Restaurierungsateliers Jürgen Ehrt.
Bedienungsanleitung. Die Feder
 MEINE ERSTE UHR Danke für Ihren Kauf von Meine erste Uhr. Meine erste Uhr ist ein neuartiges Lernspielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Sie werden viel Freude daran haben, da Meine erste Uhr leicht zu montieren
MEINE ERSTE UHR Danke für Ihren Kauf von Meine erste Uhr. Meine erste Uhr ist ein neuartiges Lernspielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Sie werden viel Freude daran haben, da Meine erste Uhr leicht zu montieren
LK Lorentzkraft. Inhaltsverzeichnis. Moritz Stoll, Marcel Schmittfull (Gruppe 2) 25. April Einführung 2
 LK Lorentzkraft Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Magnetfeld dünner Leiter und Spulen......... 2 2.2 Lorentzkraft........................
LK Lorentzkraft Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Magnetfeld dünner Leiter und Spulen......... 2 2.2 Lorentzkraft........................
Drehpendel. Praktikumsversuch am Gruppe: 3. Thomas Himmelbauer Daniel Weiss
 Drehpendel Praktikumsversuch am 10.11.2010 Gruppe: 3 Thomas Himmelbauer Daniel Weiss Abgegeben am: 17.11.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Versuchsaufbau 2 3 Eigenfrequenzbestimmung 2 4 Dämpfungsdekrementbestimmung
Drehpendel Praktikumsversuch am 10.11.2010 Gruppe: 3 Thomas Himmelbauer Daniel Weiss Abgegeben am: 17.11.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Versuchsaufbau 2 3 Eigenfrequenzbestimmung 2 4 Dämpfungsdekrementbestimmung
Physik für Biologen und Zahnmediziner
 Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 4: Arbeit, Energie und Meachnik starrer Körper Dr. Daniel Bick 17. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 17. November 2017 1 / 39
Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 4: Arbeit, Energie und Meachnik starrer Körper Dr. Daniel Bick 17. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 17. November 2017 1 / 39
TECHNISCHE MECHANIK III (DYNAMIK)
 Klausur im Fach TECHNISCHE MECHANIK III (DYNAMIK) WS 2014 / 2015 Matrikelnummer: Vorname: Nachname: Ergebnis Klausur Aufgabe: 1 2 3 4 Summe Punkte: 15 7 23 15 60 Davon erreicht Bearbeitungszeit: Hilfsmittel:
Klausur im Fach TECHNISCHE MECHANIK III (DYNAMIK) WS 2014 / 2015 Matrikelnummer: Vorname: Nachname: Ergebnis Klausur Aufgabe: 1 2 3 4 Summe Punkte: 15 7 23 15 60 Davon erreicht Bearbeitungszeit: Hilfsmittel:
Joachim Stiller. Über die Stoßgesetze. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Über die Stoßgesetze Alle Rechte vorbehalten Über die Stoßgesetze Der Impulssatz 1. Der Impulssatz für abgeschlossene Systeme Zwei Billardkugeln stoßen aufeinander. Will man die Geschwindigkeit
Joachim Stiller Über die Stoßgesetze Alle Rechte vorbehalten Über die Stoßgesetze Der Impulssatz 1. Der Impulssatz für abgeschlossene Systeme Zwei Billardkugeln stoßen aufeinander. Will man die Geschwindigkeit
Hilfsmittel sind nicht zugelassen, auch keine Taschenrechner! Heftung nicht lösen! Kein zusätzliches Papier zugelassen!
 Physik 1 / Klausur Anfang SS 0 Heift / Kurtz Name: Vorname: Matrikel-Nr.: Unterschrift: Formeln siehe letzte Rückseite! Hilfsmittel sind nicht zugelassen, auch keine Taschenrechner! Heftung nicht lösen!
Physik 1 / Klausur Anfang SS 0 Heift / Kurtz Name: Vorname: Matrikel-Nr.: Unterschrift: Formeln siehe letzte Rückseite! Hilfsmittel sind nicht zugelassen, auch keine Taschenrechner! Heftung nicht lösen!
Physik für Biologen und Zahnmediziner
 Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Drehmoment, Gleichgewicht und Rotation Dr. Daniel Bick 16. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 16. November 2016 1 / 39 Impuls
Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Drehmoment, Gleichgewicht und Rotation Dr. Daniel Bick 16. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 16. November 2016 1 / 39 Impuls
Wirkungslinie einer Kraft, Drehmoment, Einfache Maschinen
 Übung 4 Rotations-Mechanik Wirkungslinie einer Kraft, Drehmoment, Einfache Maschinen Lernziele - wissen, dass sich die Wirkung einer Kraft nicht ändert, wenn man die Kraft auf ihrer Wirkungslinie verschiebt.
Übung 4 Rotations-Mechanik Wirkungslinie einer Kraft, Drehmoment, Einfache Maschinen Lernziele - wissen, dass sich die Wirkung einer Kraft nicht ändert, wenn man die Kraft auf ihrer Wirkungslinie verschiebt.
Physikprotokoll: Fehlerrechnung. Martin Henning / Torben Zech / Abdurrahman Namdar / Juni 2006
 Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
1 Die drei Bewegungsgleichungen
 1 Die drei Bewegungsgleichungen Unbeschleunigte Bewegung, a = 0: Hier gibt es nur eine Formel, nämlich die für den Weg, s. (i) s = s 0 + v t s ist der zurückgelegte Weg, s 0 der Ort, an dem sich der Körper
1 Die drei Bewegungsgleichungen Unbeschleunigte Bewegung, a = 0: Hier gibt es nur eine Formel, nämlich die für den Weg, s. (i) s = s 0 + v t s ist der zurückgelegte Weg, s 0 der Ort, an dem sich der Körper
Zweisprachiger Wettbewerb Physik 1. Schuljahr
 Zweisprachiger Wettbewerb Physik 1. Schuljahr Lieber Schüler, liebe Schülerin, Der Wettbewerb besteht aus 20 Fragen. Sie sollten von den vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten immer die einzige richtige Lösung
Zweisprachiger Wettbewerb Physik 1. Schuljahr Lieber Schüler, liebe Schülerin, Der Wettbewerb besteht aus 20 Fragen. Sie sollten von den vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten immer die einzige richtige Lösung
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
1. Federwaage 5 Punkte
 1. Federwaage 5 Punkte Experiment Du hast folgendes Material zur Verfügung: Gummifaden, 5 kleinere Beilagscheiben mit bekannter Masse (1,4g) und 1 Beilagscheibe, deren Masse du nicht weißt. Maßband, Klebestreifen,
1. Federwaage 5 Punkte Experiment Du hast folgendes Material zur Verfügung: Gummifaden, 5 kleinere Beilagscheiben mit bekannter Masse (1,4g) und 1 Beilagscheibe, deren Masse du nicht weißt. Maßband, Klebestreifen,
Sehr geehrter Kunde, Ihr Klaus Botta Firmengründer und Inhaber
 Sehr geehrter Kunde, von den Dingen, die wir täglich benutzen, steht wohl keines so sehr für Langlebigkeit und Präzision wie unsere Armbanduhren. Bei richtiger Behandlung und Pflege wird eine Armbanduhr
Sehr geehrter Kunde, von den Dingen, die wir täglich benutzen, steht wohl keines so sehr für Langlebigkeit und Präzision wie unsere Armbanduhren. Bei richtiger Behandlung und Pflege wird eine Armbanduhr
1. Anhang: Spline-Funktionen
 C:\D\DOKU\NUM KURS\SPLINE.TEX C:\UG\.AI 20. Juli 1998 Vorbemerkung: Wenn der Satz stimmt, daß jede Formel eines Textes die Leserzahl halbiert, dann brauche ich bei grob geschätzt 40 Formeln etwa 2 40 =
C:\D\DOKU\NUM KURS\SPLINE.TEX C:\UG\.AI 20. Juli 1998 Vorbemerkung: Wenn der Satz stimmt, daß jede Formel eines Textes die Leserzahl halbiert, dann brauche ich bei grob geschätzt 40 Formeln etwa 2 40 =
Gravitationskonstante
 M05 Gravitationskonstante Unter Verwendung der Gravitationsdrehwaage als hochempfindliches Kraftmessgerät wird die Gravitationskonstante γ experimentell ermittelt. Eine auftretende systematische Abweichung
M05 Gravitationskonstante Unter Verwendung der Gravitationsdrehwaage als hochempfindliches Kraftmessgerät wird die Gravitationskonstante γ experimentell ermittelt. Eine auftretende systematische Abweichung
a) Stellen Sie das Diagramm Geschwindigkeits Zeit Diagramm für eine geeignete Kombination von Massen und dar.
 Atwood sche Fallmaschine Die kann zum Bestimmen der Erdbeschleunigung und zum Darstellen der Zusammenhänge zwischen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung verwendet werden. 1) Aufgaben a) Stellen Sie
Atwood sche Fallmaschine Die kann zum Bestimmen der Erdbeschleunigung und zum Darstellen der Zusammenhänge zwischen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung verwendet werden. 1) Aufgaben a) Stellen Sie
Im abgebildeten rechtwinkligen Dreieck ( ein Winkel ist 90 groß ) ist β = 40. Wie groß ist Winkel γ?
 LM Gleichungen Seite 30 Übergang Schule - Betrieb Beispiel 1: γ α β Im abgebildeten rechtwinkligen Dreieck ( ein Winkel ist 90 groß ) ist β = 40. Wie groß ist Winkel γ? gegeben: α = 90 β = 40 Winkelsumme
LM Gleichungen Seite 30 Übergang Schule - Betrieb Beispiel 1: γ α β Im abgebildeten rechtwinkligen Dreieck ( ein Winkel ist 90 groß ) ist β = 40. Wie groß ist Winkel γ? gegeben: α = 90 β = 40 Winkelsumme
Übungen Theoretische Physik I (Mechanik) Blatt 8 (Austeilung am: , Abgabe am )
 Übungen Theoretische Physik I (Mechanik) Blatt 8 (Austeilung am: 14.09.11, Abgabe am 1.09.11) Hinweis: Kommentare zu den Aufgaben sollen die Lösungen illustrieren und ein besseres Verständnis ermöglichen.
Übungen Theoretische Physik I (Mechanik) Blatt 8 (Austeilung am: 14.09.11, Abgabe am 1.09.11) Hinweis: Kommentare zu den Aufgaben sollen die Lösungen illustrieren und ein besseres Verständnis ermöglichen.
Technische Grundlagen zur Berechnung von Förderketten
 1. Berechnungsfaktoren Folgende Faktoren sind für die Berechnung einer Förderkette wichtig: 1.1 Kettenbruchkraft F B [N] 1.2 Kettenzugkraft F Z [N] 1.3 Gelenkflächenpressung P BB [N/cm 2 ] 1.4 Kettengeschwindigkeit
1. Berechnungsfaktoren Folgende Faktoren sind für die Berechnung einer Förderkette wichtig: 1.1 Kettenbruchkraft F B [N] 1.2 Kettenzugkraft F Z [N] 1.3 Gelenkflächenpressung P BB [N/cm 2 ] 1.4 Kettengeschwindigkeit
*EP A1* EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (43) Veröffentlichungstag: Patentblatt 2000/43
 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001046897A1* (11) EP 1 046 897 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: 25.10.2000 Patentblatt 2000/43
(19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001046897A1* (11) EP 1 046 897 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: 25.10.2000 Patentblatt 2000/43
Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik
 Schriftliche Maturitätsprüfung 2014 Kantonsschule Reussbühl Luzern Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik Prüfende Lehrpersonen Klasse Hannes Ernst (hannes.ernst@edulu.ch) Luigi Brovelli
Schriftliche Maturitätsprüfung 2014 Kantonsschule Reussbühl Luzern Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik Prüfende Lehrpersonen Klasse Hannes Ernst (hannes.ernst@edulu.ch) Luigi Brovelli
Geometrische Optik Die Linsen
 1/1 29.09.00,19:40Erstellt von Oliver Stamm Geometrische Optik Die Linsen 1. Einleitung 1.1. Die Ausgangslage zum Experiment 2. Theorie 2.1. Begriffe und Variablen 3. Experiment 3.1.
1/1 29.09.00,19:40Erstellt von Oliver Stamm Geometrische Optik Die Linsen 1. Einleitung 1.1. Die Ausgangslage zum Experiment 2. Theorie 2.1. Begriffe und Variablen 3. Experiment 3.1.
Eine mechanische Uhr lebt über Ihren Herzschlag die Unruh! WIE FUNKTIONIERT EINE HANDAUFZUG-UHR? WIE FUNKTIONIERT EINE AUTOMATIK-UHR?
 WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER MECHANISCHEN UHR? Eine mechanische Uhr lebt über Ihren Herzschlag die Unruh! Bei einer mechanischen Uhr erfolgt der Antrieb über eine Aufzugfeder, die entweder per Hand über
WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER MECHANISCHEN UHR? Eine mechanische Uhr lebt über Ihren Herzschlag die Unruh! Bei einer mechanischen Uhr erfolgt der Antrieb über eine Aufzugfeder, die entweder per Hand über
Entwicklung und Konstruktion -Auslegung einer Getriebekombination. Gewindespindel zur Kraftübertra- gung- Klasse: FSBA 12 B&H
 B&H Berechnung einer Getriebekombination 22.02.2014 Inhalt 1 Vorwort... 1 2 Aufgabenstellung... 3 3 Skizze... 3 4 Berechnung... 4 4.1 Berechnung aufzubringende Kraft... 4 4.2 Tragsicherheitsnachweis...
B&H Berechnung einer Getriebekombination 22.02.2014 Inhalt 1 Vorwort... 1 2 Aufgabenstellung... 3 3 Skizze... 3 4 Berechnung... 4 4.1 Berechnung aufzubringende Kraft... 4 4.2 Tragsicherheitsnachweis...
Aufgabenübersicht für tägliche Übungen mit zugehörigen Klassenstufen:
 Aufgabenübersicht für tägliche Übungen mit zugehörigen Klassenstufen: Größen mit Formelzeichen, Einheiten und Umrechnungen: Bsp.: 520 mm : 10 = 52 cm Bsp.: 120 h : 24 = 5 d 6 Weg FZ: s Einheiten: mm; cm;
Aufgabenübersicht für tägliche Übungen mit zugehörigen Klassenstufen: Größen mit Formelzeichen, Einheiten und Umrechnungen: Bsp.: 520 mm : 10 = 52 cm Bsp.: 120 h : 24 = 5 d 6 Weg FZ: s Einheiten: mm; cm;
Raum- und Flächenmessung bei Körpern
 Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-
Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-
Protokoll. zum Physikpraktikum. Versuch Nr.: 3 Gekoppelte Schwingungen. Gruppe Nr.: 1
 Protokoll zum Physikpraktikum Versuch Nr.: 3 Gekoppelte Schwingungen Gruppe Nr.: 1 Theoretische Grundlagen Mathematisches Pendel: Bei einem mathematischen Pendel ist ein Massepunkt an einem Ende eines
Protokoll zum Physikpraktikum Versuch Nr.: 3 Gekoppelte Schwingungen Gruppe Nr.: 1 Theoretische Grundlagen Mathematisches Pendel: Bei einem mathematischen Pendel ist ein Massepunkt an einem Ende eines
2. Lagrange-Gleichungen
 2. Lagrange-Gleichungen Mit dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Bewegungsgleichungen für komplexe Systeme einfach aufstellen. Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Lagrange-Gleichungen
2. Lagrange-Gleichungen Mit dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Bewegungsgleichungen für komplexe Systeme einfach aufstellen. Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Lagrange-Gleichungen
1. Die treibende Kraft
 1. Driving Force Gewicht & Riemenscheiben, Zugfedern & Sperrkegel, Ketten, Saiten & Batterien. STANDUHREN BLEIGEWICHTE Für englische Standuhren. Durchmesser 64mm. STANDUHREN BLEIGEWICHTE 4,5KG Höhe 150mm.
1. Driving Force Gewicht & Riemenscheiben, Zugfedern & Sperrkegel, Ketten, Saiten & Batterien. STANDUHREN BLEIGEWICHTE Für englische Standuhren. Durchmesser 64mm. STANDUHREN BLEIGEWICHTE 4,5KG Höhe 150mm.
Versuch 3 Das Trägheitsmoment
 Physikalisches A-Praktikum Versuch 3 Das Trägheitsmoment Praktikanten: Julius Strake Niklas Bölter Gruppe: 17 Betreuer: Hendrik Schmidt Durchgeführt: 10.07.2012 Unterschrift: Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Physikalisches A-Praktikum Versuch 3 Das Trägheitsmoment Praktikanten: Julius Strake Niklas Bölter Gruppe: 17 Betreuer: Hendrik Schmidt Durchgeführt: 10.07.2012 Unterschrift: Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
