Erwägungsorientierte Pyramidendiskussion
|
|
|
- Kai Franke
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schmidt, Christiane (2013): Erwägungsorientierte Pyramidendiskussion. Eine Methode für die Auswertung qualitativer Interviews im Team. In: Friebertshäuser, Barbara; Seichter, Sabine (Hrsg.): Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung. Beltz Juventa, Weinheim u. Basel, S Barbara Friebertshäuser / Sabine Seichter (Hrsg.) Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft Eine praxisorientierte Einführung EUR 16,95 Grundlagentexte Methoden. ISBN Auflage Seiten. Broschiert. (Cover und Cover-Feindaten:
2 Christiane Schmidt Erwägungsorientierte Pyramidendiskussion Eine Methode für die Auswertung qualitativer Interviews im Team 1. Einführung in die Thematik Von der Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion hörte ich das erste Mal 1997 auf einer erziehungswissenschaftlichen Tagung in einem Vortrag Bettina Blancks über Erwägen in Forschung und Lehre. Blanck entwickelte in der Forschungsgruppe Erwägungskultur Paderborn erwägungsdidaktische Methoden zum Erschließen von Vielfalt im schulischen Unterricht und in universitären Seminaren, darunter auch eine besondere Variante der Methode Pyramidendiskussion. In meinen Lehrveranstaltungen, in denen Studierende qualitative Forschungsmethoden in Studienprojekten praktisch erprobten, war mir damals immer wieder aufgefallen, wie wenig von den unterschiedlichen Ideen, kontroversen Diskussionen und offenen Fragen der studentischen Teams übrig blieb, wenn die Studierenden ihre Ergebnisse vorstellten. So tauchten beispielsweise bei der gemeinsamen Entwicklung von Kategorien am erhobenen Material häufig gerade die interessantesten Ideen in den von den Teams anschließend präsentierten Kategorieentwürfen nicht auf. Die Pyramidendiskussion und besonders deren erwägungsorientierte Variante klang für einen alternativen, reflektierenden Umgang mit dem Erarbeiteten vielversprechend. Eine Pyramidendiskussion ist wie folgt strukturiert: Zuerst werden in Einzelarbeit Vorschläge in schriftlicher Form erstellt, dies können etwa Antworten auf eine Frage oder Ideen zur Lösung eines Problems sein. Die Vorschläge werden dann in stufenweise erweiterten Gruppen diskutiert und bearbeitet. Das Erarbeitete wird entsprechend in Form von Stufen einer Pyramide repräsentiert. Eine solche Pyramidendiskussion erwägungsorientiert zu gestalten, bedeutet, dass dabei mit den zusammen kommenden unterschiedlichen Sichtweisen und vielfältigen Positionen in einer speziel- 176
3 len Weise reflektierend, integrierend und wertschätzend, kreativitäts- und klärungsförderlich umgegangen wird. Im Folgenden werde ich diese spezifische Form der Pyramidendiskussion und den dahinter stehenden philosophischen Ansatz, das sogenannte Erwägungskonzept näher beschreiben. Am Beispiel einer Auswertungsstrategie für Leitfadeninterviews schlage ich vor, die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion für qualitative Forschung zu nutzen. Das komplexe Zusammenspiel von Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher Methoden möchte ich hier verdeutlichen, indem ich an den theoretischen Hintergrund der Methode und ihrer Entwicklung anknüpfend, diese durch ein Anwendungsbeispiel veranschauliche und, dann hieran wiederum anknüpfend, methodische und theoretische Überlegungen zu Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen dieser Methode für die qualitative Auswertung von Leitfadeninterviews erörtere. Für diese Darstellung nutze ich Beispiele und Ideen aus zwei Forschungsprojekten: Aus einem Studienprojekt im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen Methodenausbildung, in dem Studierende bei der Auswertung von Leitfadeninterviews mit dieser Erwägungsmethode gearbeitet haben (Schmidt 2008; Schmidt/Ortner 2010) und aus einem Projekt zum Thema erwägungsorientierte qualitative Forschung, in dessen Rahmen ich zur Zeit über die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion und die damit gesammelten Erfahrungen forsche (Schmidt 2010 a). Damit zeichne ich zugleich meinen eigenen Weg zu einer neuen Methode nach: Vom rezipierenden Kennenlernen einer spannenden didaktischen Methode und ihres theoretischen Hintergrundes, über erste Erfahrungen mit deren Verwendung als Teamarbeitsmethode in meinen Lehrveranstaltungen zur Methodenausbildung, aus deren Reflexion sich Ideen für eine Weiterentwicklung und Integration der Methode als Forschungsmethode in eine Auswertungsstrategie für Leitfadeninterviews ergeben haben, bis hin zu theoretischen Verknüpfungen des hinter ihr stehenden Erwägungskonzepts mit qualitativer Sozialforschung. 2. Historische und theoretische Verortung der Forschungsmethode Die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion basiert auf einem philosophischen Konzept, dem Erwägungskonzept, das von der eingangs schon erwähnten Forschungsgruppe Erwägungskultur Paderborn initiiert worden ist. Ansetzend an Unzufriedenheit über den kulturwissenschaftlichen Umgang mit Vielfalt (Benseler et al. 1994, S. 7) wurde von der 177
4 Forschungsgruppe 1, die sich Ende der 1980er Jahren gründete, ein erwägender Umgang mit Vielfalt erforscht und gefördert. Der Ansatz ist inzwischen international bekannt, vor allem durch die interdisziplinäre Zeitschrift Erwägen Wissen Ethik (EWE), die seit 1990 erscheint 2 ; damals noch unter dem Titel Ethik und Sozialwissenschaften. Diese neuartige wissenschaftliche Diskussionszeitschrift ist als ein Forum der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Schulen, Strömungen und Richtungen konzipiert und versteht sich zugleich auch als ein Forum der Erfindung, Erprobung und Verbesserung von Regeln für den Umgang mit dieser Vielfalt. (Forschungsredaktion Erwägen Wissen Ethik o. J., o. S.; Wikipedia-Artikel: Erwägen Wissen Ethik o. J.) In den 1990er Jahren bildete sich ein noch heute aktiver und inzwischen erweiterter interdisziplinärer Kreis von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die das Konzept einer Erwägungsorientierung in Forschung, Lehre und Praxis diskutieren und weiterentwickeln. Das Konzept zielt auf einen alternativen Umgang mit Alternativen besonders in wissenschaftlicher Forschung und Lehre, der sich als erwägungsorientierter Umgang beschreiben lässt. Erwägen, verstanden als Denken in Möglichkeiten, bildet den zentralen Gegenstand des Konzepts. Erwägen ist nichts Neues, sondern aus dem Alltag, auch aus dem wissenschaftlichen Arbeitsalltag, geläufig. Hier wie dort stellen uns Fragen und Probleme vor die Aufgabe, zu erwägen, d. h. verschiedene Möglichkeiten zu durchdenken. Erwägen findet in Verbindung mit einem Auswahlgedanken, (z. B. einer Frage oder einem Problem) statt, für den unterschiedliche Antwort- bzw. Lösungsmöglichkeiten (Hervorhebung im Original) zu bedenken sind, welche unterschiedlich bewertet werden können. [ ] Wo Menschen keine Vorgaben (z. B. Traditionen, Routinen, Gewohnheiten) haben oder diesen nicht folgen, werden sie zu solchen auf jeweilige Auswahlgedanken bezogene Erwägungen herausgefordert. Diese Herausforderung mag als Freiheit und Chance zur Mit- oder Selbstbestimmung geschätzt oder aber auch als Überforderung empfunden werden und hilflos machen [ ] (Blanck 2012, S. 17f.). In einer Vorbemerkung zum ersten Band der Reihe Erwägungskultur in Forschung, Lehre und Praxis schreibt deren Herausgeber Loh: Erwägen ist ein konstitutiver Bestandteil menschlicher Problembewältigung als Entscheidungsprozess (Loh 2001a, o. S.). Entscheidung wird nach Bettina Blanck als Erwägen von mindestens einer Möglichkeit sowie die positive oder auch negative Bewertung des Erwogenen definiert (Blanck 2002, S. 237). Lösungssetzung und die Realisierung einer Lösung werden als Folgehandlungen verstanden 1 Zur Forschungsgruppe gehörten damals Frank Benseler, Bettina Blanck, Rainer Greshoff und Werner Loh. 2 Mitherausgeber ist seit 1995 auch Reinhard Keil. 178
5 und nicht zur Entscheidung dazu gerechnet, [ ] Ergebnis einer Entscheidung mag sein, dass man keine Lösung setzen kann. Hat man dagegen eine Lösung gesetzt, so kann deren Realisierung gelingen oder aber auch misslingen. (Blanck 2012, S. 19). Auf dieser Grundlage wird im Erwägungskonzept zwischen Erwägungs-, Lösungs- und Realisierungsebenen differenziert. Der Kerngedanke des Erwägungskonzeptes besteht darin, daß sich die in einem Entscheidungszusammenhang erwogenen und dann bewahrten Alternativen als eine Geltungsbedingung für die schließlich gesetzte Lösung und zur Einschätzung und Darlegung der Begründungs- und Verantwortbarkeitsqualität jeweiliger gesetzter Lösungen nutzen lassen. (Blanck 2002, S. 9) Mit dieser Erwägungsgeltungsbedingung wird Alternativen ein wichtiger Stellenwert zugewiesen, indem man sich nicht nur in der Vorgeschichte der Lösung eines Problems oder einer Frage auf sie bezieht. Werden die erwogenen Alternativen für andere zugänglich und nachvollziehbar dokumentiert, wird der erreichte Erwägungsstand der mehr oder weniger entfaltet sein kann einschätzbar, dies kann auch einen selbstkritischen Umgang mit den gesetzten Lösungen unterstützen oder bewusst werden lassen, dass der Erwägungsstand nicht ausreicht, um eine Alternative den anderen begründet vorzuziehen. Dieser veränderte Stellenwert von Alternativen kann auch den Umgang Einzelner mit ihren jeweiligen eigenen (wissenschaftlichen) Positionen verändern: Erwägungsorientierung verändert Diskussionskultur, weil sich die Einzelnen weniger lösungsfixiert an einmal eingenommene Positionen klammern, deren Aufgabe häufig als Niederlage und Reputationsverlust empfunden wird. Die Identifikation mit und das Engagement für eine bestimmte Position wird vielmehr vom jeweiligen Stand der erwogenen Alternativen abhängig gemacht. Kann dieser verbessert werden und führt zu einer Veränderung in der Bewertung der bisher bevorzugten Position, so ist deren Aufgabe keine Niederlage, sondern ein Fortschritt. Eine negativ bewertete Position trägt dann mit zur Geltung der neuen Position bei und ist gleichermaßen auch für diejenigen relevant und ein Gewinn, die bisher schon die neue Position vertreten haben. Denn auch sie können nun ihre Position noch besser als zuvor gegenüber Alternativen begründen. (Blanck/Schmidt 2005, S. 68) Ein erwägungsorientierter Umgang mit Alternativen ist so lässt sich zusammenfassen ein die Erwägungsgeltungsbedingung beachtender Umgang. Auf der Erwägungsebene können auch widersprüchliche Alternativen integriert werden. 3 Für einen klärungsförderlichen Umgang mit einer Viel- 3 Der vom Konzept einer Erwägungsorientierung verfolgte radikale Pluralismus auf der Erwägungsebene kann Befürchtungen vor einem Beliebigkeitspluralismus auslösen, wenn die Unterscheidung zwischen Erwägungs- und Lösungsebene nicht beach- 179
6 falt von Ideen und Positionen bedeutet dies herauszufinden, ob Alternativen vorliegen oder ausgearbeitet werden können und ob es sich dabei um Alternativen in Entscheidungszusammenhängen handelt, die vor eine Auswahl-Aufgabe stellen 4. Aus der Vielfalt von Ideen und Positionen kann etwa durch die Betrachtung von Ähnlichkeiten und Unterschieden, durch Zusammenfassungen etc. versucht werden, solche Alternativen zu erarbeiten und näher zu bestimmen. In dieser erwägungsorientierten Umgangsweise mit Vielfalt und insbesondere Alternativen unterscheidet sich das Erwägungskonzept von anderen wissenschaftlichen Umgangsweisen mit Vielfalt. Da das Erwägungskonzept selber erwägungsorientiert entwickelt worden ist und weiterentwickelt wird, gibt es in Untersuchungen zum Erwägungskonzept zu solchen anderen Umgangsweisen mit Vielfalt zahlreiche Erörterungen von forschungsförderlichen Anknüpfungspunkten und Unterschieden. Hier sei beispielhaft verwiesen auf Werner Lohs Arbeiten zur Logik des Erwägens (Loh 2001 b; Loh 2007; Loh 2008; Loh 2009) und zu erwägungsorientierter Hermeneutik (Loh 2004) sowie auf Bettina Blancks Anknüpfungen des philosophischen Konzepts einer Erwägungsorientierung an vielfaltsbewusste Pädagogiken und Didaktiken (Blanck 2002, S. 23 f.; Blanck 2006; Blanck 2012) sowie auf Diskussionen von Ansätzen, in denen Konkurrenz von Alternativen als relevant für wissenschaftliche Weiterentwicklung betont wird, wie etwa Hans Albert, Karl R. Popper, Paul K. Feyerabend und Thomas S. Kuhn (Blanck 1994, S. 49 ff.; Blanck 2002, S. 12 ff.). Die erwägungsorientierte Entwicklung des Erwägungskonzeptes ist vom Anspruch her selbstreflexiv. Die Frage nach den erwogenen Alternativen ist schließlich für das Erwägungskonzept selbst zu stellen: Ob und in welchem Ausmaß zu erwägen sei, ist selbst zu erwägen. (Blanck 2002, S. 10) Ein erwägungsorientierter Umgang mit Vielfalt kann durch spezielle Methoden unterstützt werden, durch sog. Erwägungsmethoden, die im Kontext des Erwägungskulturprojektes zusammen mit Lernenden, Lehrenden und Forschenden (weiter)entwickelt und erprobt worden sind (z. B. tet wird. [ ] die Beachtung dieser Unterscheidung [ermöglicht, C. S.] hingegen eine Verbindung von einem radikalen Pluralismus mit einem eingeschränkten Pluralismus. [ ] Es geht eben nicht darum [ ] alles zuzulassen und gut zu heißen! Im Gegenteil muss das, was als Lösung gesetzt und realisiert wird, insbesondere, wenn sie nicht nur die entscheidungstreffende Person, sondern auch andere Menschen berührt, gegenüber zu erwägenden Alternativen verantwortet werden können. (Blanck 2012, S. 46) 4 Weiterführend zum Terminus Alternative und zum Umgang mit disjunkten Alternativen sind viele Arbeiten von Loh und Blanck (z. B. Loh 2008; Loh 2009; Blanck 2012, S. 19 und S. 49 ff.). 180
7 Blanck 2004; Blanck 2005; Blanck 2007; Gostmann/Messer 2007; Schmidt 2007 a; Schmidt 2007 b). Erwägungsmethoden sollen als didaktische Methoden einen erwägungsorientierten forschenden Umgang mit Vielfalt im schulischen Unterricht und universitärer Lehre fördern. Sie sind zugleich auch Forschungsmethoden zur Weiterentwicklung einer erwägungsorientierten Umgangsweise mit Vielfalt. Eine dieser Methoden ist die erwägungsorientierte Pyramidendiskussion. Es handelt sich, wie einleitend schon erwähnt, um Diskussionen, bei der die Mitglieder eines Teams ihre Ideen, Vorschläge, Positionen zu einer verabredeten Frage oder einem ausgewählten Problem beschreiben, begründen und diskutieren, meist in schriftlicher Form. Es wird zuerst in Einzelarbeit, dann in stufenweise erweiterten Gruppen gearbeitet, wobei sich die Anzahl der Diskutierenden pro Stufe solange verdoppelt, bis das gesamt Team wieder vereint ist. Die auf den Diskussionsstufen in den Subteams entstehenden Texte werden als Stufen einer Pyramide dargestellt und dokumentiert (siehe Abb. 1); daher die Bezeichnung Pyramidendiskussion. Die Teamgröße bestimmt die Anzahl der Stufen: Im Viererteam ergeben sich drei Stufen (Einzelarbeit, zwei Subteams mit zwei Mitgliedern, Gesamtteam), im Achterteam vier Stufen (Einzelarbeit, vier Subteams mit zwei Mitgliedern, zwei Subteams mit vier Mitgliedern, Gesamtteam). Für die Teams sind vier oder acht Mitglieder eine bewährte Anzahl, andere Teamgrößen sind möglich, so kann etwa bei ungerader Mitgliederzahl auf der zweiten Pyramidenebene eines der Subteams drei statt zwei Mitglieder haben. Das Besondere einer erwägungsorientierten Pyramidendiskussion ist, dass die systematische Reflexion der Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt steht. Ziel ist die Integration jeweils zu erwägender Alternativen (Blanck 2006, S. 1). Hierfür ist zu erkunden, welche alternativen Positionen es gibt und ob es sich um echte, einander ausschließende oder nur scheinbare und vereinbare >Alternativen< handelt (Blanck 2006, S. 1). Es gibt keinen Einigungszwang. Es soll ein Spektrum von Alternativen erschlossen werden, hierzu gehört auch die unintegrierbaren Aspekte zu dokumentieren. In dem oben abgebildeten Modell (siehe Abb. 1) wird diese erwägende Integration durch Kreise symbolisiert, die auf den oberen Pyramidenstufen an Umfang zunehmen. Das Bild der nach oben schlanker werdenden Pyramide wäre ohne diese wachsenden Kreise für die erwägungsorientierte Pyramidendiskussion insofern irreführend, als diese Methode gerade kein Verschlankungs- oder Beschleunigungsinstrument für Teamdiskussionen ist, sondern eine Reflexionsmethode für das Erwägen von Vielfalt, die eher Entschleunigung fördert. Die Besonderheiten dieser Methode lassen sich an Ähnlichkeiten und Unterschieden zur bekannten Technik des Brainwriting, einer schriftlichen Form des Brainstorming, verdeut- 181
8 lichen: Neben der schriftlichen Form ist beiden gemeinsam, dass die Ideen zunächst in Einzelarbeit formuliert und dann zusammengetragen werden. Während es jedoch bei der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion um das genaue Herausarbeiten von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Vorschläge geht, mit dem Ziel durch erwägendes Zusammenführen und Festhalten von Differenzen, ein Spektrum von Alternativen zu erarbeiten, geht es beim Brainwriting meist darum, aus der Sammlung der Vorschläge, bei der keine Kritik an den Vorschlägen Anderer geübt werden soll, sortierend und bewertend einzelne gute Ideen zu entwickeln. Stufe 3 neue Vorschläge/Reflexionen plus unintegrierbare Aspekte ABCD Gesamtteam Stufe 2 neue Vorschläge/Reflexionen plus unintegrierbare Aspekte A/B C/D Subteam Stufe 1 Vorschläge (mit Begründungen) A B C D Einzelarbeit Abb. 1: In Form einer Pyramide repräsentierte Positionen, die Buchstaben kennzeichnen deren AutorInnen (vgl. zum Pyramidenmodell Blanck 2005, S. 546; Schmidt 2007a, S. 330). 3. Darstellung des Forschungsprojektes Das Studienprojekt, an dem hier nun die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion konkretisiert werden soll, fand im Rahmen einer zweisemestrigen Einführung in Interview- und Auswertungstechniken für qualitative Forschung an der Universität Innsbruck statt. Im jeweils ersten Semester der am hochschuldidaktischen Ansatz des forschenden Lernens orientierten Seminare, die von mir als Lehrauftrag durchgeführt wurden, ging es um Interviewtechniken, im jeweiligen Folgeseminar um Auswertungstechniken. Eingebunden in eine allgemeine theoretische und praxisbezogene Einführung in qualitative Interviews als Erhebungstechnik, bildeten die Studierenden im ersten Teil Forschungsteams zu selbst ausdifferenzier- 182
9 ten Fragestellungen aus dem Bereich Studentische Erfahrungen im erziehungswissenschaftlichen Studium und bereiteten in Studienprojekten Leitfadeninterviews vor und führten sie durch 5. Wiederum in Verbindung mit einer allgemeinen Einführung, nun in Auswertungstechniken für qualitative Interviews, wurde dann im jeweils zweiten Semester eine Auswertungsstrategie an Auszügen aus den Transkripten in etwa zehn studentischen Teams, mit jeweils meist vier oder fünf Mitgliedern, erprobt. Der Auswertungsstrategie für qualitative Leitfadeninterviews (Schmidt 2009; Schmidt 2010 b) folgend, wurden von den Studierenden zunächst, nach dem intensiven Lesen der Transkripte, in Auseinandersetzung mit dem Material Auswertungskategorien entwickelt (erster Schritt) und auf der Basis des bis dahin entwickelten Kategorienverständnisses zu einem Kodierleitfaden-Teilentwurf zusammengestellt (zweiter Schritt). Dann wurde an Materialauszügen erprobt, diese zu kodieren, d. h. unter ausgewählten Auswertungskategorien zu verschlüsseln (dritter Schritt). An den erarbeiteten Kodierungen beispielhaft anknüpfend wurde die Funktion von Fallübersichten (vierter Schritt) als Auswahlbasis für die vertiefende Analyse ausgewählter Fälle (fünfter Schritt) erläutert. Die Auswertungsteams arbeiteten bei der Kategorienbildung am Material (erster Schritt) mit erwägungsorientierten Pyramidendiskussionen. 6 Am Beginn der Auswertungsphase standen die Teams vor der Aufgabe, Kategorien für die Auswertung zu entwickeln. Für die Analyse der Leitfadeninterviews gab es wie in der qualitativen Forschung üblich 7 keinen vorgefertigten kategorialen Rahmen. Die Kategorien sollten am erhobenen Material, vor allem an den Interviewtranskripten, er- und überarbeitet werden. Dabei galt es, der Offenheit der qualitativen Erhebungsmethode Leitfadeninterview bei der Analyse Rechnung zu tragen. Nach intensivem Lesen und An- 5 Hierbei befragte ein Team die Mitglieder eines anderen Teams, so dass jede/jeder Teilnehmende Erfahrungen in der Rolle des/der Befragten und in der Rolle des Interviewers/der Interviewerin sammeln konnte. Für den Rollenwechsel gab es nicht einfach einen Rollentausch zwischen den beiden Interviewpartnern, sondern die Teamkonstellation wechselte. Die Interviews wurden dann in der Semesterpause jeweils von denen, die sie geführt hatten, transkribiert. Die Mitglieder der Auswertungsteams im Folgesemester kamen teilweise aus dem vorangegangenen Semester und hatten die Interviews durchgeführt, teilweise kamen neue Studierende hinzu. 6 Die erwägungsorientierten Pyramidendiskussionen der Auswertungsteams wurden in einem der Seminare online durchgeführt (Schmidt/Ortner 2010). 7 In kategorienbasierten Analysen soll das erhobene Material anhand von Kategorien kodiert und geordnet werden. In der qualitativen Forschung wird dabei besonderer Wert darauf gelegt, den kategorialen Bezugsrahmen hierfür nicht nur aus Vorabüberlegungen, sondern insbesondere auch aus dem erhobenen Material zu entwickeln (Schmidt 2009; Schmidt 2010 b). 183
10 notieren der Transkripte entwickelten die Studierenden an ausgewählten Transkripten Kategorie-Entwürfe im Team. Für das Entwerfen und die reflexive Auseinandersetzung mit den Ideen, Zweifeln und Formulierungsvorschlägen im Team wurde die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion verwendet. Die folgende konkrete Beschreibung bezieht sich auf ein Viererteam zu einem der Studienprojekte. Zu einem verabredeten Interviewausschnitt formulierte und begründete zuerst jedes Teammitglied schriftlich in Einzelarbeit Kategorie-Entwürfe in Form von Überschriften zu Transkriptpassagen. Die erstellten Entwürfe mit Begründungen wurden auf der untersten Ebene der Pyramide des jeweiligen Auswertungsteams dargestellt. Dann schlossen sich je zwei der Mitglieder zu Subteams zusammen und verglichen und diskutierten ihre auf der ersten Ebene repräsentierten Kategorie- Entwürfe und formulierten gemeinsam mehr oder weniger neue Kategorie- Entwürfe. Die ursprünglichen Entwürfe und Begründungen wurden hierfür wiederholt, verändert oder erwägend integriert. Diese neuen Entwürfe wurden auf der zweiten Ebene der jeweiligen Teampyramide schriftlich festgehalten. Nun schlossen sich die beiden Subteams zusammen, die vier Mitglieder des Teams waren damit wieder vereint, verglichen und diskutierten ihre Entwürfe und Begründungen von der zweiten Pyramidenebene und stellten die neuen Entwürfe auf der dritten, in diesem Fall höchsten Ebene der Pyramide dar. Die Erfahrungen mit den erwägungsorientierten Pyramidendiskussionen in den Studienprojekten zeigten, dass diese besondere Form von Pyramidendiskussion für kreative Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse in Teams unterstützend wirken kann. Von den Studierenden wurde in Kritikrunden zu fast allen Pyramidendiskussionen in den Auswertungsseminaren an der Zusammenarbeitsform vor allem hervorgehoben, dass kein Beitrag ignoriert werden konnte und darüber hinaus durch die schriftliche Form der eigene Beitrag sichtbar blieb und auch dessen Integration oder Nicht- Integration nachvollzogen werden konnte (vgl. z. B. Schmidt/Ortner 2010, S. 208). In Bezug auf die inhaltliche Arbeit an den Kategorie-Entwürfen, führten vor allem die geforderten Begründungen für die Vorschläge zu einer besseren Konzentration auf die Texte (Schmidt 2008, S. 117). Es kamen viele gegenstandsangemessene Ideen für Auswertungskategorien zusammen. Es gab allerdings auch einige nicht begründete bzw. in den Begründungen nicht nachvollziehbare Entwürfe. Neben der mehr oder weniger guten Begründetheit am Material, zeigten sich Unterschiede in der Qualität der Entwürfe an der mehr oder weniger respektierten für die Kategorienentwicklung am Material wichtigen Begrenzung auf textimmanente Interpretationen. Unterschiede wurden auch am reflektierten Umgang mit Zweifeln an den gefundenen Kategorien sichtbar. 184
11 4. Möglichkeiten und Grenzen der Forschungsmethode Praxiserfahrungen mit dem Einsatz von Erwägungsorientierten Pyramidendiskussionen für Auswertungsteams, wie ich sie hier an einem Beispiel zum Schritt der Kategorienentwicklung am Material vorgestellt habe, ermutigen dazu, qualitative Auswertungsprozesse mit Hilfe dieser Methode erwägungsorientiert zu gestalten. Auch für weitere Schritte der oben nur kurz beschriebenen Auswertungsstrategie für qualitative Leitfadeninterviews, wäre nach meiner Einschätzung eine Ergänzung mit dieser oder anderen Erwägungsmethoden angemessen. Zum einen für die Kodierung im Team, hier könnte etwa durch einen erwägungsorientierten Umgang mit Zuordnungsalternativen das konsensuelle Kodieren unterstützt werden oder zu einem erwägungsorientierten Kodieren verändert werden. Zum anderen für die vertiefenden Fallinterpretationen. Hier könnten Deutungsalternativen ein stärkeres Gewicht bekommen und auch in der Ergebnisdarstellung sichtbar werden (Schmidt 2008, S. 116 ff.; Schmidt 2010 a; Schmidt 2010 b, S. 480). Ein erwägungsorientierter Umgang mit Alternativen bei der Auswertung qualitativer Interviews, d. h. also ein die Erwägungsgeltungsbedingung beachtender Umgang etwa mit Deutungs- und Zuordnungsalternativen, kann zwar durch die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion unterstützt werden, nimmt aber viel Zeit in Anspruch; auch durch die Anforderung der schriftlichen Diskussion und der Dokumentation des Erwogenen. Eine offene Forschungsfrage hierzu ist, nach welchen Kriterien aus umfangreichem Material einzelne Textpassagen für eine erwägungsorientierte Kategorienbildung begründet auszuwählen wären. Erwägungsmethoden wie die erwägungsorientierte Pyramidendiskussion setzen zudem voraus, dass mindestens zwei Personen gemeinsam an der Auswertung arbeiten; dies ist für kleinere Forschungsprojekte und insbesondere für wissenschaftliche Abschlussarbeiten häufig nicht gegeben. Der hohe zeitliche Aufwand setzt einerseits Grenzen der Anwendbarkeit der Erwägungsmethoden, andererseits kann gerade die Entschleunigung und die genaue Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei erwägungsorientierter Kategorienbildung im Team dazu beitragen, dass die Auswertung von Leitfadeninterviews dem für qualitative Forschung zentralen Offenheitspostulat besser gerecht wird, sowohl auf der Ebene der technischen Offenheit als auch auf der Ebene der theoretischen Offenheit. Mit technischer Offenheit ist gemeint, dass die Auswertung der offenen Fragetechnik des qualitativen Leitfadeninterviews entsprechend, dem erhobenen Material keine vorab festgelegten deutenden und ordnenden Kategorien von außen aufdrängen und überstülpen soll. Mit der Forderung nach theoretischer Offenheit wird an den theoretischen Zugang zum Untersuchungs- 185
12 gegenstand der Anspruch gestellt, offen zu sein. Für die Auswertung bedeutet dies, dass Auswertungskategorien nicht einfach aus den an Theorietraditionen und dem Stand der Forschung orientierten theoretischem Vorverständnis abgeleitet werden sollen. Sie lassen sich nur teilweise vor der Erhebung entwerfen und müssen im Verlauf der Erhebung verfeinert und überarbeitet oder durch neue Kategorien ersetzt werden (Schmidt 2009, S. 447; Schmidt 2010b, S. 474). Erwägungsalternativen können aufdecken helfen, wenn bei der Auswertung die selbst gewählten, alltagssprachlichen Formulierungen der Befragten vorschnell eingeordnet und ohne ihren Sinngehalt zu beachten den theoretischen Vorüberlegungen subsumiert werden (Schmidt 2008, S. 118). Die Erwägungsgeltungsbedingung als Gütekriterium für Auswertungsentscheidungen fördert so meine These, die ich zurzeit in einem Projekt zu erwägungsorientierter qualitativer Sozialforschung untersuche (Schmidt 2010a), eine reflektierte Offenheit im Auswertungsprozess. Weiterführende Literatur Blanck, B. (2012): Vielfaltsbewusste Pädagogik und Denken in Möglichkeiten. Theoretische Grundlagen und Handlungsperspektiven. Lucius und Lucius: Stuttgart. Schmidt, C. (2008): Erwägungsmethoden für die Auswertung qualitativer Interviews. In: Jüttemann, G.. (Hrsg.) (2008): Suchprozesse der Seele. Die Psychologie des Erwägens. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen, S Literatur Benseler, F./Blanck, B./Greshoff, R./Loh, W. (Hrsg.) (1994): Alternativer Umgang mit Alternativen. Aufsätze zu Philosophie und Sozialwissenschaften. Westdeutscher Verlag: Opladen. Blanck, B. (1994): Erwägen von Alternativen und Wissenschaft. In: Benseler, F./Blanck, B./Greshoff, R./Loh, W. (Hrsg.) (1994): Alternativer Umgang mit Alternativen. Aufsätze zu Philosophie und Sozialwissenschaften. Westdeutscher Verlag: Opladen, S Dies. (2002): Erwägungsorientierung, Entscheidung und Didaktik. Lucius und Lucius: Stuttgart. Dies. (2004): Man sollte meinen, die hätten völlig verschiedene Artikel gelesen Seminarbericht zur Suche nach einem Erwägungsforschungsstand Eine Auseinandersetzung mit einer EuS-Diskussionseinheit zur Koedukation. In: Erwägen Wissen Ethik 15, S Dies. (2005): Erwägungsmethoden. Umgang mit Vielfalt und Alternativen als Herausforderung für Forschung, Lehre und Praxis. In: Erwägen Wissen Ethik. 16, S
13 Dies. (2006): Erwägungsdidaktik für Politische Bildung. In: Politisches Lernen 24, H. 3-4, S Dies. (2007): Denken in Möglichkeiten mit der 3-Fach-Schüttelbox. Ein bekanntes Arbeitsmittel weiterentwickelt. In: Praxis Grundschule 30, H. 3, S Dies. (2012): Vielfaltsbewusste Pädagogik und Denken in Möglichkeiten. Theoretische Grundlagen und Handlungsperspektiven. Lucius und Lucius: Stuttgart. Blanck, B./Schmidt, C. (2005): Erwägungsorientierte Pyramidendiskussionen im virtuellen Wissensraum open-steam. In: Tavangarian, D./Nölting, K. (Hrsg.) (2005): Auf zu neuen Ufern! E-Learning heute und morgen. Waxmann: Münster, S Forschungsredaktion Erwägen Wissen Ethik: Programm. iug.uni-paderborn.de/ ewe/index. html (/>Konzept />Programm) (Abruf: ). Gostmann, P./Messer, S. (2007): Kultur erwägen oder Das Seminar als narratives Netzwerk. In: Erwägen Wissen Ethik 18, S Loh, W. (2001a): Erwägungsorientierung in Philosophie und Sozialwissenschaften. Reihe Erwägungskultur in Forschung, Lehre und Praxis. Band 1. Lucius und Lucius: Stuttgart. Ders. (2001b): Erwägungsdisjunktion und klassische Aussagenlogik. In: Loh, W. (Hrsg.) (2001a): Erwägungsorientierung in Philosophie und Sozialwissenschaften. Lucius und Lucius: Stuttgart, S Ders. (2004): Erwägungsorientierte Hermeneutik am Beispiel der kritischen Philosophie Kants. In: Schönecker, D./Zwenger, T. (Hrsg.) (2004): Kant verstehen, Understanding Kant Über die Interpretation philosophischer Texte. 2. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, S Ders. (2007): Editorial. Erwägung, Forschung und Lehre. In: Erwägen Wissen Ethik 18, S Ders. (2008): Erwägungslogik und Psychologie. In: Jüttemann, G.. (Hrsg.) (2008): Suchprozesse der Seele. Die Psychologie des Erwägens. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S Ders. (2009): Logiken der Geschichten als Geschichtlichkeiten der Logiken: Disjunktionen über Disjunktionen. In: Loh, W./Mall, R. A./Zimmermann, R. (Hrsg.) (2009): Interkulturelle Logik. Zur Wahrnehmung und Modellierung der geschichtlichen Welt. Mentis: Paderborn, S Schmidt, C. (2007a): Erfahrungen mit der Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion bei der Konstruktion von Interviewleitfäden im Rahmen der Einführung in qualitative Forschung. Seminarbericht. In: Erwägen Wissen Ethik 18, S Dies. (2007b): Small Steps Towards a Culture of Deliberative Learning: Media Supported Pyramid Discussions. In: Hug, T. (Hrsg.) (2007): Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses and Examples. Waxmann: Münster, S Dies. (2008): Erwägungsmethoden für die Auswertung qualitativer Interviews. In: Jüttemann, G.. (Hrsg.) (2008): Suchprozesse der Seele. Die Psychologie des Erwägens. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen, S Dies. (2009): Analyse von Leitfadeninterviews. In: Flick, U./Kardorff, E./Steinke, I.(Hrsg.) (2009): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 6. Auflage. Rowohlt: Reinbek, S Dies. (2010a): Erwägungskonzept als neue methodologische Grundlage theoretischer Offenheit in der qualitativen Forschung. Arbeitspapier. Erscheint voraussichtlich: In: Schmidt, C. (i. E): Erwägungsorientierte qualitative Sozialforschung. 187
14 Dies. (2010b): Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In: Friebertshäuser, B./ Langer, A./Prengel, A. (Hrsg.) (2010): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Juventa: Weinheim, S Schmidt, C./Ortner, G. (2010): Erwägungsorientierte Pyramidendiskussion zur Analyse qualitativer Interviews in virtuellen Projektteams. In: Hug, T./Maier, R. (Hrsg.) (2010): Medien Wissen Bildung. Explorationen visualisierter und kollaborativer Wissensräume. Innsbruck university press, S [online unter: media. brainity.com/uibk2/amab2010/images/down/mwb09_proceedings.pdf (Abruf: )]. Wikipedia-Artikel: Erwägen Wissen Ethik. %C3 %A4gen_Wissen_Ethik (Abruf: ). 188
Forschungs- und Jahresbericht 2007
 Frau PD Dr. Bettina Blanck Seite 1 Frau PD Dr. Bettina Blanck Erwaegen Wissen Ethik Zur Person Raum: N 2.141 Telefon: 05251-60-2322 E-Mail: ewepad@upb.de E-Mail 2: bettina.blanck@upb.de Homepage: http://iug.upb.de/ewe
Frau PD Dr. Bettina Blanck Seite 1 Frau PD Dr. Bettina Blanck Erwaegen Wissen Ethik Zur Person Raum: N 2.141 Telefon: 05251-60-2322 E-Mail: ewepad@upb.de E-Mail 2: bettina.blanck@upb.de Homepage: http://iug.upb.de/ewe
Forschungs- und Jahresbericht 2009
 Frau Dr. Bettina Blanck Seite 1 Frau Dr. Bettina Blanck Institut für Humanwissenschaften (Philosophie, Psychologie, Soziologie) Zur Person Raum: N 2.141 Telefon: 05251-60-2322 E-Mail: ewepad@upb.de Homepage:
Frau Dr. Bettina Blanck Seite 1 Frau Dr. Bettina Blanck Institut für Humanwissenschaften (Philosophie, Psychologie, Soziologie) Zur Person Raum: N 2.141 Telefon: 05251-60-2322 E-Mail: ewepad@upb.de Homepage:
Zusammenfassung des Buches: Vielfaltsbewusste Pädagogik und Denken in Möglichkeiten Theoretische Grundlagen und Handlungsperspektiven
 Zusammenfassung des Buches: Vielfaltsbewusste Pädagogik und Denken in Möglichkeiten Theoretische Grundlagen und Handlungsperspektiven Gegenstand zahlreicher pädagogischer, erziehungswissenschaftlicher
Zusammenfassung des Buches: Vielfaltsbewusste Pädagogik und Denken in Möglichkeiten Theoretische Grundlagen und Handlungsperspektiven Gegenstand zahlreicher pädagogischer, erziehungswissenschaftlicher
Forschungs- und Jahresbericht 2008
 Erwaegen Wissen Ethik Seite 1 Erwaegen Wissen Ethik Institutsübersicht Adresse Raum: N 2.141 Homepage http://iug.upb.de/ewe Leitung Frau Dr. Bettina Blanck und Herr Dr. Werner Loh Sekretariat Raum: N 2.141
Erwaegen Wissen Ethik Seite 1 Erwaegen Wissen Ethik Institutsübersicht Adresse Raum: N 2.141 Homepage http://iug.upb.de/ewe Leitung Frau Dr. Bettina Blanck und Herr Dr. Werner Loh Sekretariat Raum: N 2.141
Wie verläuft eine Diskussion mit Thesen-Kritik-Replik-Verfahren?
 Didaktische Hinweise zum Thesen-Kritik-Replik-Verfahren Bettina Blanck, Mai 2006 Kurzcharakterisierung der Methode Das Thesen-Kritik-Replik-Verfahren ist eine Methode zur vor allem schriftlichen Gestaltung
Didaktische Hinweise zum Thesen-Kritik-Replik-Verfahren Bettina Blanck, Mai 2006 Kurzcharakterisierung der Methode Das Thesen-Kritik-Replik-Verfahren ist eine Methode zur vor allem schriftlichen Gestaltung
Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz
 Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Deliberation Knowledge Ethics. vormals / previously Ethik und Sozialwissenschaften (EuS) Streitforum für Erwägungskultur
 Erwägen Wissen Ethik Deliberation Knowledge Ethics vormals / previously Ethik und Sozialwissenschaften (EuS) Streitforum für Erwägungskultur EWE 18 (2007) Heft 2 / Issue 2 I N H A L T / C O N T E N T EDITORIAL
Erwägen Wissen Ethik Deliberation Knowledge Ethics vormals / previously Ethik und Sozialwissenschaften (EuS) Streitforum für Erwägungskultur EWE 18 (2007) Heft 2 / Issue 2 I N H A L T / C O N T E N T EDITORIAL
Erwägungsorientierte Pyramidendiskussionen
 Erwägungsorientierte Pyramidendiskussionen Bettina Blanck, Mai 2005 Ob online oder offline oder als Mischform aus Online- und Offlinephasen eingesetzt, die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion
Erwägungsorientierte Pyramidendiskussionen Bettina Blanck, Mai 2005 Ob online oder offline oder als Mischform aus Online- und Offlinephasen eingesetzt, die Methode der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion
Workshop. Erwägungsorientierte Bildung an der PH
 Workshop Erwägungsorientierte Bildung an der PH Netzwerktreffen Bildung für Nachhaltige Entwicklung am 25. Januar 2017 in Brugg 1 Einstimmung mit einem Zitat Welcher Konsens über Erziehung und Bildung
Workshop Erwägungsorientierte Bildung an der PH Netzwerktreffen Bildung für Nachhaltige Entwicklung am 25. Januar 2017 in Brugg 1 Einstimmung mit einem Zitat Welcher Konsens über Erziehung und Bildung
Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse
 Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen Bearbeitet von Jochen Gläser, Grit Laudel 4. Auflage 2010. Buch. 347 S. Softcover ISBN 978 3 531 178 5
Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen Bearbeitet von Jochen Gläser, Grit Laudel 4. Auflage 2010. Buch. 347 S. Softcover ISBN 978 3 531 178 5
III. Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Jochen Gläser Grit Laudel. als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. 4.
 Jochen Gläser Grit Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen 4. Auflage III VS VERLAG Inhalt Vorbemerkung zur dritten Auflage 9 1. Einführung
Jochen Gläser Grit Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen 4. Auflage III VS VERLAG Inhalt Vorbemerkung zur dritten Auflage 9 1. Einführung
Master of Arts Philosophie
 Bachelor of Science 06-003-311-3 Wahl Modultitel Modultitel (englisch) Young Researcher Young Researcher 1./3. Semester 2 Semester unregelmäßig Seminar "Forschungsseminar" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und
Bachelor of Science 06-003-311-3 Wahl Modultitel Modultitel (englisch) Young Researcher Young Researcher 1./3. Semester 2 Semester unregelmäßig Seminar "Forschungsseminar" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und
(I) Vorschau Wintersemester. Open Ear Sommersemester 17. Inhalt. I. Vorschau Wintersemester II. Masterarbeit: Vorbereitung und formale
 Open Ear Sommersemester 17 Prof. Dr. Marion Möhle Studiengangleitung MSA, MSB, MPW Inhalt I. Vorschau Wintersemester II. : Vorbereitung und formale Informationen III. Ausrichtung der IV. Inhaltliche Aspekte
Open Ear Sommersemester 17 Prof. Dr. Marion Möhle Studiengangleitung MSA, MSB, MPW Inhalt I. Vorschau Wintersemester II. : Vorbereitung und formale Informationen III. Ausrichtung der IV. Inhaltliche Aspekte
Teilstudiengang Pädagogik im Master Education Themen und Anforderungen von Masterarbeiten sowie Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung
 Teilstudiengang Pädagogik im Master Education Themen und Anforderungen von Masterarbeiten sowie Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung Informationsveranstaltung im Rahmen des Mastertags des Centrums
Teilstudiengang Pädagogik im Master Education Themen und Anforderungen von Masterarbeiten sowie Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung Informationsveranstaltung im Rahmen des Mastertags des Centrums
Biografie - Partizipation - Behinderung
 Klinkhardt forschung Biografie - Partizipation - Behinderung Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie von 1. Auflage Julius Klinkhardt 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Klinkhardt forschung Biografie - Partizipation - Behinderung Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie von 1. Auflage Julius Klinkhardt 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Bettina Blanck Erwägungspädagogik
 Bettina Blanck Erwägungspädagogik Überblick Erwägungspädagogik ist eine Pädagogik, die einen spezifischen bewahrenden Umgang mit Vielfalt (insbesondere mit qualitativen Alternativen) in Bildung(swissenschaft),
Bettina Blanck Erwägungspädagogik Überblick Erwägungspädagogik ist eine Pädagogik, die einen spezifischen bewahrenden Umgang mit Vielfalt (insbesondere mit qualitativen Alternativen) in Bildung(swissenschaft),
Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen
 Jochen Gläser Grit Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden Inhalt 1. Einführung 9 1.1 Was
Jochen Gläser Grit Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden Inhalt 1. Einführung 9 1.1 Was
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Masterstudiengang Philosophie Modulbeschreibungen nach den verabschiedeten Fassungen der Studien- und Prüfungsordnung
 Masterstudiengang Philosophie Modulbeschreibungen nach den verabschiedeten Fassungen der Studien- und Prüfungsordnung 1. Modul Theoretische Philosophie 2. Modul Praktische Philosophie 3. Modul Spezielle
Masterstudiengang Philosophie Modulbeschreibungen nach den verabschiedeten Fassungen der Studien- und Prüfungsordnung 1. Modul Theoretische Philosophie 2. Modul Praktische Philosophie 3. Modul Spezielle
Kommentierter Reader»Forschungsmethoden in der Logopädie«
 Kommentierter Reader»Forschungsmethoden in der Logopädie«-Qualitative Methoden- Aufbau des weiterbildenden Masterstudiengangs "Evidenzbasierte Logopädie" im Rahmen des BMBF-Teilprojektes PuG Prof. Dr.
Kommentierter Reader»Forschungsmethoden in der Logopädie«-Qualitative Methoden- Aufbau des weiterbildenden Masterstudiengangs "Evidenzbasierte Logopädie" im Rahmen des BMBF-Teilprojektes PuG Prof. Dr.
oder Klausur (60-90 Min.) Päd 4 Päd. Arbeitsfelder und Handlungsformen*) FS Vorlesung: Pädagogische Institutionen und Arbeitsfelder (2 SWS)
 Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Erziehungswissenschaftliche Module B Allgemeine Pädagogik. Modulübersicht
 Erziehungswissenschaftliche Module B Modulübersicht Erziehungswissenschaftliche Module B in Allgemeiner Pädagogik Modulbezeichnung Signatur LP SWS Mögliche Lehrformen Mastermodul Allgemeine Grundlagen
Erziehungswissenschaftliche Module B Modulübersicht Erziehungswissenschaftliche Module B in Allgemeiner Pädagogik Modulbezeichnung Signatur LP SWS Mögliche Lehrformen Mastermodul Allgemeine Grundlagen
Lesen dürfen alle! Schreiben auch! Forschendes Lernen im Kontext von e-science: Das studentische Online-Journal `forsch!
 Lesen dürfen alle! Schreiben auch! Forschendes Lernen im Kontext von e-science: stellt sich vor Gliederung Was ist FLiF und forschendes Lernen? e-science als Herausforderung für forschendes Lernen. als
Lesen dürfen alle! Schreiben auch! Forschendes Lernen im Kontext von e-science: stellt sich vor Gliederung Was ist FLiF und forschendes Lernen? e-science als Herausforderung für forschendes Lernen. als
Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen
 Geisteswissenschaft Katharina Spohn Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen Examensarbeit Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung
Geisteswissenschaft Katharina Spohn Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen Examensarbeit Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung
Jüdische Sozialarbeit
 Jüdische Sozialarbeit Modul. Einführung in die Geschichte und Ethik der Sozialen Arbeit.-.März 0 Max Willner Heim, Bad Sobernheim Donnerstag,.0.0 09:00-0:00 Einführung in das Seminar zu Entwicklungslinien
Jüdische Sozialarbeit Modul. Einführung in die Geschichte und Ethik der Sozialen Arbeit.-.März 0 Max Willner Heim, Bad Sobernheim Donnerstag,.0.0 09:00-0:00 Einführung in das Seminar zu Entwicklungslinien
Selbst bestimmt es Lernen
 Grundlagen der Schulpädagogik Band 41 Selbst bestimmt es Lernen Freie Arbeit an selbst gewählten Themen Von Michael Bannach Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis lll Inhaltsverzeichnis Vorwort
Grundlagen der Schulpädagogik Band 41 Selbst bestimmt es Lernen Freie Arbeit an selbst gewählten Themen Von Michael Bannach Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis lll Inhaltsverzeichnis Vorwort
Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik"
 Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Humanistisch. Nachhaltig. Handlungsorientiert. Eine öffentliche Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts
 Humanistisch. Nachhaltig. Handlungsorientiert. Eine öffentliche Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts 1 Die Leuphana Universität Lüneburg wagt eine radikale Neuausrichtung und eine
Humanistisch. Nachhaltig. Handlungsorientiert. Eine öffentliche Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts 1 Die Leuphana Universität Lüneburg wagt eine radikale Neuausrichtung und eine
Theorien der Erziehungswissenschaft
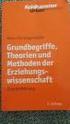 Eckard König / Peter Zedler Theorien der Erziehungswissenschaft Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen 2. Auflage Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Vorwort zur
Eckard König / Peter Zedler Theorien der Erziehungswissenschaft Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen 2. Auflage Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Vorwort zur
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Jörg Dieterich. Zur zentralen Frage einer wissenschaftlichen Pädagogik. Geisteswissenschaftliche und empirische Überlegungen
 Jörg Dieterich Zur zentralen Frage einer wissenschaftlichen Pädagogik Geisteswissenschaftliche und empirische Überlegungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2007 Inhaltverzeichnis Einleitung/Abstract XIII Teil
Jörg Dieterich Zur zentralen Frage einer wissenschaftlichen Pädagogik Geisteswissenschaftliche und empirische Überlegungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2007 Inhaltverzeichnis Einleitung/Abstract XIII Teil
Rezension zu Helsper/Krüger: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft
 Pädagogik Christian Hochmuth Rezension zu Helsper/Krüger: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft Rezension / Literaturbericht Technische Universität Dresden Fakultät Erziehungswissenschaften
Pädagogik Christian Hochmuth Rezension zu Helsper/Krüger: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft Rezension / Literaturbericht Technische Universität Dresden Fakultät Erziehungswissenschaften
Ivonne Küsters. Narrative Interviews
 Ivonne Küsters Narrative Interviews Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe Hagener Studientexte zur Soziologie will eine
Ivonne Küsters Narrative Interviews Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe Hagener Studientexte zur Soziologie will eine
Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft
 Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der
Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten. Form:
 Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten Name der_des Student_in: Veranstaltung und Semester: Hausarbeitstitel: Länge: Datum: Form: Deckblatt 2 Auflistung aller notwendigen Informationen 1 Angemessene
Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten Name der_des Student_in: Veranstaltung und Semester: Hausarbeitstitel: Länge: Datum: Form: Deckblatt 2 Auflistung aller notwendigen Informationen 1 Angemessene
EV 3.3 Unterrichtsvideos zur Entwicklung hermeneutischer Fallkompetenz in der Lehrer/innenbildung
 Teilprojekt 3.3 von TUD-sylber ( Synergetische Lehrerbildung im exzellenten Rahmen ) EV 3.3 Unterrichtsvideos zur Entwicklung hermeneutischer Fallkompetenz in der Lehrer/innenbildung Dresden, 13.07.2016
Teilprojekt 3.3 von TUD-sylber ( Synergetische Lehrerbildung im exzellenten Rahmen ) EV 3.3 Unterrichtsvideos zur Entwicklung hermeneutischer Fallkompetenz in der Lehrer/innenbildung Dresden, 13.07.2016
Schreiben in Unterrichtswerken
 Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Master of Arts Philosophie
 Bachelor of Science 06-003-311-3 Wahl Modultitel Modultitel (englisch) Young Researcher Young Researcher 1./3. Semester 2 Semester unregelmäßig Seminar "Forschungsseminar" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und
Bachelor of Science 06-003-311-3 Wahl Modultitel Modultitel (englisch) Young Researcher Young Researcher 1./3. Semester 2 Semester unregelmäßig Seminar "Forschungsseminar" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend
 Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit. Studienabschnitt. 1./2. Semester
 BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit 1./2. Semester 12 LP 360 h Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ SWS 1 Einführung in die Soziale Arbeit V 4 LP 2 2 Einführung
BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit 1./2. Semester 12 LP 360 h Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ SWS 1 Einführung in die Soziale Arbeit V 4 LP 2 2 Einführung
Interdisziplinäre Anthropologie
 Master of Arts Interdisziplinäre Modulhandbuch ab WS 2012/13 Stand: 20.02.2014 Modul Theorien der 1 Theorien der I VL/S P 8 2 schriftlich jährlich 1 Theorien der II Das Modul vermittelt einen Überblick
Master of Arts Interdisziplinäre Modulhandbuch ab WS 2012/13 Stand: 20.02.2014 Modul Theorien der 1 Theorien der I VL/S P 8 2 schriftlich jährlich 1 Theorien der II Das Modul vermittelt einen Überblick
Fachanhang zur Studienordnung des Bachelorstudiengangs der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. B 10: Philosophie. Vom 30.
 Fachanhang zur Studienordnung des Bachelorstudiengangs der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock B 10: Philosophie Vom 30. März 2012 Inhaltsübersicht 1 Ziele des Studiums 2 Umfang und Aufbau
Fachanhang zur Studienordnung des Bachelorstudiengangs der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock B 10: Philosophie Vom 30. März 2012 Inhaltsübersicht 1 Ziele des Studiums 2 Umfang und Aufbau
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen. 29. Oktober 2018 Methodeninput - Datenerhebung
 Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen 29. Oktober 2018 Methodeninput - Datenerhebung Wissensmanagement im Gesundheitswesen Prozesse in der Arztpraxis
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen 29. Oktober 2018 Methodeninput - Datenerhebung Wissensmanagement im Gesundheitswesen Prozesse in der Arztpraxis
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
PHI-M 30. In zwei Semestern
 PHI-M 30 1. Name des Moduls: Kernmodul Klassische Texte und Begriffsanalysen 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Philosophie / Prof. Dr. Hans Rott, Prof. Dr. Rolf Schönberger, Prof. Dr. Weyma Lübbe 3. Inhalte
PHI-M 30 1. Name des Moduls: Kernmodul Klassische Texte und Begriffsanalysen 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Philosophie / Prof. Dr. Hans Rott, Prof. Dr. Rolf Schönberger, Prof. Dr. Weyma Lübbe 3. Inhalte
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen. 05. November 2018 Methodeninput - Datenauswertung
 Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen 05. November 2018 Methodeninput - Datenauswertung Leitfaden 2 Rückblick letzte Veranstaltung Was waren Auffälligkeiten
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen 05. November 2018 Methodeninput - Datenauswertung Leitfaden 2 Rückblick letzte Veranstaltung Was waren Auffälligkeiten
Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen
 Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer. Studiensemester bzw
 Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Strukturvorschläge für wissenschaftliche Arbeiten
 Strukturvorschläge für wissenschaftliche Arbeiten Aufbau allgemein Aufbau nach Ausrichtung Quantitative Studie Qualitative Studie Literaturstudie Forschungsgestützte Entwicklungsarbeit Sie verwenden mit
Strukturvorschläge für wissenschaftliche Arbeiten Aufbau allgemein Aufbau nach Ausrichtung Quantitative Studie Qualitative Studie Literaturstudie Forschungsgestützte Entwicklungsarbeit Sie verwenden mit
Studien zur Theorie der Erziehung und Bildung
 Dietrich Benner Studien zur Theorie der Erziehung und Bildung Pädagogik als Wissenschaft, Handlungstheorie und Reformpraxis Band 2 Juventa Verlag Weinheim und München 1995 Inhalt A Studien zur Theorie
Dietrich Benner Studien zur Theorie der Erziehung und Bildung Pädagogik als Wissenschaft, Handlungstheorie und Reformpraxis Band 2 Juventa Verlag Weinheim und München 1995 Inhalt A Studien zur Theorie
Staatsexamen Lehramt an Grundschulen Ethik/Philosophie
 06-003-401-GS Grundlagen der Ethik Introduction to Ethics 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Grundlagen
06-003-401-GS Grundlagen der Ethik Introduction to Ethics 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Grundlagen
Burkhard Fuhs Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft
 Burkhard Fuhs Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft Grundwissen Erziehungswissenschaft Die Reihe Grundwissen Erziehungswissenschaft stellt Studierenden, Lehrenden und pädagogisch Interessierten
Burkhard Fuhs Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft Grundwissen Erziehungswissenschaft Die Reihe Grundwissen Erziehungswissenschaft stellt Studierenden, Lehrenden und pädagogisch Interessierten
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Neue Theorien entwickeln
 Friedrich Krotz Neue Theorien entwickeln Eine Einführung in die Grounded Theory, die Heuristische Sozialforschung und die Ethnographie anhand von Beispielen aus der Kommunikationsforschung Herbert von
Friedrich Krotz Neue Theorien entwickeln Eine Einführung in die Grounded Theory, die Heuristische Sozialforschung und die Ethnographie anhand von Beispielen aus der Kommunikationsforschung Herbert von
Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit
 Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Gemeinsames Lernen online mit Wikis und Co. unterstützen
 Gemeinsames Lernen online mit Wikis und Co. unterstützen Kooperatives & kollaboratives Lernen Kooperatives Lernen: zwei o. mehr lernen zusammen in einer bestimmten Umgebung, teilen die Aufgaben, lösen
Gemeinsames Lernen online mit Wikis und Co. unterstützen Kooperatives & kollaboratives Lernen Kooperatives Lernen: zwei o. mehr lernen zusammen in einer bestimmten Umgebung, teilen die Aufgaben, lösen
Georg-August-Universität Göttingen Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse
 Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse English title: Music and Cultural Analysis Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse kulturwissenschaftlicher (im Sinne der cultural studies) und kulturanalytischer
Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse English title: Music and Cultural Analysis Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse kulturwissenschaftlicher (im Sinne der cultural studies) und kulturanalytischer
Stellungnahme zur Öffentlichen Konsultation Schulen für das 21. Jahrhundert
 Stellungnahme zur Öffentlichen Konsultation Schulen für das 21. Jahrhundert Erwägungskultur in der Erziehung als Grundlage der Fähigkeit lebenslangen Lernens und verantwortlichen Handelns in pluralistischen
Stellungnahme zur Öffentlichen Konsultation Schulen für das 21. Jahrhundert Erwägungskultur in der Erziehung als Grundlage der Fähigkeit lebenslangen Lernens und verantwortlichen Handelns in pluralistischen
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
FB02 Kriterienkatalog zur Prämierung von Studierendenarbeiten
 FB02 Kriterienkatalog r Prämierung von Studierendenarbeiten Institut für Erziehungswissenschaft: In der Erziehungswissenschaft werden Arbeiten aus dem Bereich der Schulpädagogik/Schulforschung sowie aus
FB02 Kriterienkatalog r Prämierung von Studierendenarbeiten Institut für Erziehungswissenschaft: In der Erziehungswissenschaft werden Arbeiten aus dem Bereich der Schulpädagogik/Schulforschung sowie aus
Literatur zur Vorlesung Praktische Philosophie (1), Methodische Grundlagen:
 Literatur zur Vorlesung Praktische Philosophie (1), Methodische Grundlagen: Zur Phänomenologie Edmund Husserl. Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Hrsg. v. Elisabeth Ströker.
Literatur zur Vorlesung Praktische Philosophie (1), Methodische Grundlagen: Zur Phänomenologie Edmund Husserl. Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Hrsg. v. Elisabeth Ströker.
Bildung durch die reflektierte Verknüpfung von Wissenschaft mit Engagement
 Bildung durch die reflektierte Verknüpfung von Wissenschaft mit Engagement Petra Kleinser Was ist Service Learning? Grundidee: Einbindung von Engagement in das Studium Definition (Universität Tübingen):
Bildung durch die reflektierte Verknüpfung von Wissenschaft mit Engagement Petra Kleinser Was ist Service Learning? Grundidee: Einbindung von Engagement in das Studium Definition (Universität Tübingen):
Kolloquium: Europa-Studien
 Timm Beichelt Kolloquium: Europa-Studien Gläser, Jochen / Laudel, Grit, 3 2009: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden: VS Verlag Wintersemester 2010/11 Sitzung 5 Struktur des Buches
Timm Beichelt Kolloquium: Europa-Studien Gläser, Jochen / Laudel, Grit, 3 2009: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden: VS Verlag Wintersemester 2010/11 Sitzung 5 Struktur des Buches
Inklusion - nur ein Märchen?
 Pädagogik Regina Weber Inklusion - nur ein Märchen? Examensarbeit Inklusion nur ein Märchen? Schriftliche Hausarbeit mit Video-Anhang im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik,
Pädagogik Regina Weber Inklusion - nur ein Märchen? Examensarbeit Inklusion nur ein Märchen? Schriftliche Hausarbeit mit Video-Anhang im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik,
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden)
 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden) Voraussetzungen für Zeugnis Regelmäßige Teilnahme (80%) (11,2 Montage) schreiben von kleinen Texten (1 ECTS) kleine
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden) Voraussetzungen für Zeugnis Regelmäßige Teilnahme (80%) (11,2 Montage) schreiben von kleinen Texten (1 ECTS) kleine
Interpretation qualitativer Daten
 Auswertung Darstellung von Wirklichkeit = immer auch Wirklichkeitskonstruktion wie Daten angeordnet, analysiert und dargestellt werden erzeugt eine bestimmte Form der Interpretation Interpretation qualitativer
Auswertung Darstellung von Wirklichkeit = immer auch Wirklichkeitskonstruktion wie Daten angeordnet, analysiert und dargestellt werden erzeugt eine bestimmte Form der Interpretation Interpretation qualitativer
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I. Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik
 Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung
 Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
Vorwort. Einleitung. Aufbau der Arbeit
 LESEPROBE Vorwort Einleitung Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses entstand auch die Notwendigkeit vergleichende Leistungen und Qualifikationen innerhalb der jeweiligen nationalen Bildungssysteme
LESEPROBE Vorwort Einleitung Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses entstand auch die Notwendigkeit vergleichende Leistungen und Qualifikationen innerhalb der jeweiligen nationalen Bildungssysteme
Netzwerk Bildung für Nachhaltige Entwicklung der Dozierenden / Deutsche Schweiz. am Mittwoch, den 25. Januar 2017 an der PH FHNW Campus Brugg-Windisch
 Netzwerk Bildung für Nachhaltige Entwicklung der Dozierenden / Deutsche Schweiz am Mittwoch, den 25. Januar 2017 an der PH FHNW Campus Brugg-Windisch Handout zum Workshop Erwägungsorientierte Bildung an
Netzwerk Bildung für Nachhaltige Entwicklung der Dozierenden / Deutsche Schweiz am Mittwoch, den 25. Januar 2017 an der PH FHNW Campus Brugg-Windisch Handout zum Workshop Erwägungsorientierte Bildung an
1. Doppelstunde: Zieht ein Magnet überall gleich stark an? Die Entdeckung der Pole als Orte der stärksten Anziehung
 Unterrichtsentwurf 1. Unterrichtseinheit zum Thema: Magnetismus 1. Doppelstunde: Zieht ein Magnet überall gleich stark an? Die Entdeckung der Pole als Orte der stärksten Anziehung Zweite Klasse Mitglieder:
Unterrichtsentwurf 1. Unterrichtseinheit zum Thema: Magnetismus 1. Doppelstunde: Zieht ein Magnet überall gleich stark an? Die Entdeckung der Pole als Orte der stärksten Anziehung Zweite Klasse Mitglieder:
Qualitative Inhaltsanalyse. Philipp Mayring (2000)
 Qualitative Inhaltsanalyse Philipp Mayring (2000) Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse kann jegliche festgehaltene Kommunikation sein. (Gesprächsprotokolle,
Qualitative Inhaltsanalyse Philipp Mayring (2000) Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse kann jegliche festgehaltene Kommunikation sein. (Gesprächsprotokolle,
Polyvalenter Bachelor Lehramt Ethik/ Philosophie
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
Pragmatistische Perspektiven für Konzepte der Hochschuldidaktik Potenziale des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse
 Pragmatistische Perspektiven für Konzepte der Hochschuldidaktik Potenziale des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse Prof. Dr. Uwe Elsholz, Dr. Rüdiger Wild (FernUniversität in Hagen)
Pragmatistische Perspektiven für Konzepte der Hochschuldidaktik Potenziale des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse Prof. Dr. Uwe Elsholz, Dr. Rüdiger Wild (FernUniversität in Hagen)
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN
 Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung
 Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung Master of Arts Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ruprecht Mattig Systematische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ulrike Mietzner Historische Bildungsforschung
Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung Master of Arts Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ruprecht Mattig Systematische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ulrike Mietzner Historische Bildungsforschung
Interpretationshilfe zu Ihrem Evaluationsergebnis Zusammengestellt vom Lehrstuhl für Psychologie und der Qualitätsagentur
 Interpretationshilfe zu Ihrem Evaluationsergebnis Zusammengestellt vom Lehrstuhl für Psychologie und der Qualitätsagentur Vorbemerkungen Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise zur Interpretation
Interpretationshilfe zu Ihrem Evaluationsergebnis Zusammengestellt vom Lehrstuhl für Psychologie und der Qualitätsagentur Vorbemerkungen Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise zur Interpretation
Durch gemeinsamen Austausch Lernen. Die Praxisforschungswerkstatt des Studienganges Soziale Arbeit & Diakonie Frühkindliche Bildung stell sich vor
 Durch gemeinsamen Austausch Lernen Die Praxisforschungswerkstatt des Studienganges Soziale Arbeit & Diakonie Frühkindliche Bildung stell sich vor Ablauf der Fachtagung 9.30 Uhr Begrüßung und Einführung
Durch gemeinsamen Austausch Lernen Die Praxisforschungswerkstatt des Studienganges Soziale Arbeit & Diakonie Frühkindliche Bildung stell sich vor Ablauf der Fachtagung 9.30 Uhr Begrüßung und Einführung
Thema des Unterrichtsvorhabens: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie. Kompetenzerwartungen
 Schulcurriculum Philosophie EF Leibniz Gymnasium 2014 Erstes Unterrichtsvorhaben: Inhaltsfeld: Der Mensch und sein Handeln Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Metaphysische Probleme als Herausforderung
Schulcurriculum Philosophie EF Leibniz Gymnasium 2014 Erstes Unterrichtsvorhaben: Inhaltsfeld: Der Mensch und sein Handeln Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Metaphysische Probleme als Herausforderung
Modulhandbuch zum Master-Studium für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen Unterrichtsfach Deutsch
 Modulhandbuch zum Master-Studium für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen Modul: Vermittlungsperspektiven der Germanistik (MLS 1 ) Studiengänge: Master-Studiengang für ein Lehramt an Haupt-,
Modulhandbuch zum Master-Studium für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen Modul: Vermittlungsperspektiven der Germanistik (MLS 1 ) Studiengänge: Master-Studiengang für ein Lehramt an Haupt-,
Master of Arts. Philosophie
 Master of Arts Philosophie Philosophie in Göttingen Seit den Anfängen der Universität im Jahr 1737 ist die Göttinger Philosophie den Idealen der Aufklärung verpflichtet. Persönlichkeiten wie Edmund Husserl
Master of Arts Philosophie Philosophie in Göttingen Seit den Anfängen der Universität im Jahr 1737 ist die Göttinger Philosophie den Idealen der Aufklärung verpflichtet. Persönlichkeiten wie Edmund Husserl
Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7
 Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Modul W4511: Fachdidaktik: Didaktik in und für sozialökonomische Handlungsfelder. Modulinformationen
 Universität Paderborn 33100 Paderborn Telefon: 05251-603362 Fax: 05251-603563 Prof. Dr. Professur für Wirtschaftspädagogik, insbesondere Mediendidaktik und Weiterbildung hkremer@notes.uni-paderborn.de
Universität Paderborn 33100 Paderborn Telefon: 05251-603362 Fax: 05251-603563 Prof. Dr. Professur für Wirtschaftspädagogik, insbesondere Mediendidaktik und Weiterbildung hkremer@notes.uni-paderborn.de
Didaktisch-methodische Gestaltung interkultureller Erkundungen
 4. qualiko Kolloquium: Didaktisch-methodische Gestaltung interkultureller Erkundungen Elke Bosse Inst. für Interkulturelle Kommunikation Universität Hildesheim bossee@uni-hildesheim.de Interkulturelles
4. qualiko Kolloquium: Didaktisch-methodische Gestaltung interkultureller Erkundungen Elke Bosse Inst. für Interkulturelle Kommunikation Universität Hildesheim bossee@uni-hildesheim.de Interkulturelles
Aufbaumodul Antike und Mittelalter
 Aufbaumodul Antike und Mittelalter 0100 240 h Modulbeauftragter Prof. Dr. Konrad Vössing Alten und Mittelalterlichen Geschichte Themen zur Alten und Mittelalterlichen Geschichte Vorlesung zur Alten oder
Aufbaumodul Antike und Mittelalter 0100 240 h Modulbeauftragter Prof. Dr. Konrad Vössing Alten und Mittelalterlichen Geschichte Themen zur Alten und Mittelalterlichen Geschichte Vorlesung zur Alten oder
Konzept zur Diplomarbeit von Johannes Wippel
 Johannes Kepler Universität Linz Institut für Soziologie Abteilung für Wirtschaftsoziologie Konzept zur Diplomarbeit von Johannes Wippel Geplantes Thema der Diplomarbeit/Arbeitstitel Verbesserungsmanagement
Johannes Kepler Universität Linz Institut für Soziologie Abteilung für Wirtschaftsoziologie Konzept zur Diplomarbeit von Johannes Wippel Geplantes Thema der Diplomarbeit/Arbeitstitel Verbesserungsmanagement
Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Dokumentation einer Unterrichtseinheit (Stand )
 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Dokumentation einer Unterrichtseinheit (Stand 01.08.2012) Erläuterung Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Dokumentation
Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Dokumentation einer Unterrichtseinheit (Stand 01.08.2012) Erläuterung Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Dokumentation
Die Geschichte der entwicklungspolitischen Bildung. Zur pädagogischen Konstruktion der Dritten Welt"
 2 o- 5-7'3 Annette Scheunpflug Klaus Seitz Die Geschichte der entwicklungspolitischen Bildung Zur pädagogischen Konstruktion der Dritten Welt" Band I: Entwicklungspolitische Unterrichtsmaterialien Literatur
2 o- 5-7'3 Annette Scheunpflug Klaus Seitz Die Geschichte der entwicklungspolitischen Bildung Zur pädagogischen Konstruktion der Dritten Welt" Band I: Entwicklungspolitische Unterrichtsmaterialien Literatur
1./2. Semester. 1 Modulstruktur: Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte
 MA Modul 1: BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik Studiengänge: Master Lehramt an Berufskollegs 2 Semester 1./2. Semester 7 LP : 210 Std. 1 Vorbereitungsseminar Seminar 2 2 Begleitseminar Seminar
MA Modul 1: BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik Studiengänge: Master Lehramt an Berufskollegs 2 Semester 1./2. Semester 7 LP : 210 Std. 1 Vorbereitungsseminar Seminar 2 2 Begleitseminar Seminar
Klausurrelevante Zusammenfassung WS Kurs Teil 2 Modul 1A B A 1 von
 Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Workshop. Workshop. Die Schulpraxis durch den Einsatz von Unterrichtsvideos forschend erkunden
 Workshop Fakultät Erziehungswissenschaften Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken Professur für Gesundheit und Pflege/Berufliche Didaktik Workshop Die Schulpraxis durch den Einsatz von
Workshop Fakultät Erziehungswissenschaften Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken Professur für Gesundheit und Pflege/Berufliche Didaktik Workshop Die Schulpraxis durch den Einsatz von
Inverted Classroom Model (ICM) Erklärung / aktueller Stand des Projekts:
 Fachhochschule St. Pölten Fortbildungsprogramm zum Projekt Inverted Classroom Model (ICM) Erklärung / aktueller Stand des Projekts: http://skill.fhstp.ac.at/2014/06/aktueller-stand-inverted-classroom/)
Fachhochschule St. Pölten Fortbildungsprogramm zum Projekt Inverted Classroom Model (ICM) Erklärung / aktueller Stand des Projekts: http://skill.fhstp.ac.at/2014/06/aktueller-stand-inverted-classroom/)
