Familiengrab und Gedenkstätte Aron-Saalberg, Jüdischer Friedhof (Foto: G. Möllers)
|
|
|
- Lars Knopp
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Familie Aron/Saalberg Die Geschichte der Familie Aron in Recklinghausen beginnt 1894 mit dem Zuzug der Eheleute Hermann und Dina Aron während der Industrialisierungsphase und endet mit dem Tod ihrer Schwiegertochter Minna Aron, geb. Saalberg Der Kaufmann Hermann Aron (* in Kose/Pommern) und seine Frau Dina (*1867) betrieben ein Geschäft an der Breite Str. 8, später im Wohn- und Geschäftshaus der Firma Tillmann am Kaiserwall 16. Nach dem Tod von Dina Aron heiratete Hermann Lydia Aron (* in Stuttgart). Im März 1936 zog das Ehepaar nach Wiesbaden, wo sie ihren letzten Lebensabschnitt verleben wollten. Hermann und Lydia Aron wurden 1942 vor dort nach Frankfurt am Main gebracht und am 1. September in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Vier Wochen später wurden sie am 29. September 1942 von dort aus in das Vernichtungslager Treblinka gebracht und ermordet. Familiengrab und Gedenkstätte Aron-Saalberg, Jüdischer Friedhof (Foto: G. Möllers) Adolf, der älteste Sohn von Hermann und Dina Aron wurde am in Trzebuhn/ Krs.Berent/Westpreußen geboren. Die drei jüngeren waren gebürtige Recklinghäuser: Kurt (* ), Hildegard (* ) und Alfred (* ). Adolf und Kurt wurden im Ersten Weltkrieg eingezogen und kämpften für Kaiser, Volk und Vaterland ; dem schwer verwundeten Kurt Aron musste ein Bein amputiert worden. Das Elternhaus der Arons am Kaiserwall 16 galt als zugleich religiös und sehr tolerant. Um die Osterzeit haben wir [mit Alfred] Matzen gegessen, um die Weihnachtszeit haben wir zusammen den Nikolaus empfangen und die Weihnachtsbäume in unsere christlichen Häuser getragen 1, erinnert sich Helene Kuhlmann an die Kinderzeit mit Alfred Aron. Alfred, der jüngste Bruder wohnte nach dem Wegzug der Eltern zuletzt bei seinem Bruder Adolf, Paulusstraße /35 wurde er für ein Jahr in das KZ Esterwegen 1 Helene Kuhlmann, Alfred Aron zum Gedächtnis, in: Werner Scheider, Jüdische Heimat im Vest, Recklinghausen 1983, S. 172; vgl. insgesamt zur Biographie: Möllers/Pohl, Abgemeldet nach unbekannt Die Deportation der Juden aus dem Vest Recklinghausen nach Riga, Essen 2013
2 eingeliefert. Danach wurde sein musikalisches Talent entdeckt und es gelang ihm 1939, nach Palästina zu emigrieren. Er entwickelte sich als Pianist und Fagottist zu einem angesehenen Musiker in Israel. Bis zu seinem Tod 1970 in Jerusalem besuchte er mehrfach Recklinghausen. Ebenfalls 1939 flohen Hildegard Aron und ihr Ehemann Egon Abraham (*1904), Bochumer Str. 139 nach Kuba. Dagegen durchlebten Adolf und Kurt mit ihren Familien Ausgrenzung, Diskriminierung, wirtschaftliche Existenzvernichtung, Isolierung und schließlich die Deportation nach Riga in Recklinghausen. Beide waren mit Töchtern der Süder Kaufmannsfamilie Selmar ( ) und Clara Caroline Saalberg, geb. Rosenbaum (* ) verheiratet. Adolf hatte Else Saalberg (* ) und sein Bruder Kurt ihre Schwester Minna Saalberg (* ) geheiratet. Die Schwestern hatten bzw die private Evangelische höhere Mädchenschule besucht, die seit 1908 im ehemaligen Augustinessenkloster in der Altstadt untergebracht war. Kurt und Minna Aron waren in das Haus der Schwiegereltern, Bochumer Str. 73 eingezogen, in dem sie seit 1930 mit der inzwischen verwitweten Clara Saalberg und ihrem einzigen Sohn Gerd (* ) lebten. Adolf und Else Aron, geb. Saalberg hatten einen florierenden Tabakgroßhandel aufgebaut. Ihr eigenes Wohnhaus, Paulusstr. 6, war zuletzt 1932 umgebaut und um ein Tabaklager und Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge des Großhandels erweitert worden. Der erstgeborene Sohn Heinz ( ) starb früh; Rolf (* ), Hans-Fred (* ) und Günther (* ) erlebten ihre kurze Kindheit bereits unter dem Druck und Eindruck der NS-Diktatur. Als Folge der Nürnberger Gesetze wurde der katholische Kindergarten am Paulusstift gezwungen, Hans-Fred Aron den Besuch zu verbieten, da ansonsten mit der Schließung der Einrichtung gedroht wurde. 2 Firmenpost des Tabakhandels Aron Die Verdrängung jüdischer Kaufleute aus dem Wirtschaftsleben begann bereits mit dem Boykott-Tag vom 1. April So veröffentlichte das Komitee gegen Lügenabwehr. Ortsgruppe Recklinghausen-Mitte eine Liste jüdischer Geschäfte, die in einigen Zeitungen erschien. Ausführlich hieß es am Schluss: Die Zigarrenhändler und Gastwirte werden noch besonders darauf hingewiesen, daß die Zigarrengroßhandlung Adolf Aron einem Juden gehört und auch boykottiert werden muss (RZ ). Die Hetze gegen jüdische Geschäfte und der Aufruf zur Denunzierung von Käufern ging soweit, dass die National-Zeitung am 25. August 1935 die Autokennzeichen der Firma des Tabakjuden Aron, dessen Bruder vor einigen Wochen aus dem Konzentrationslager zurückgekehrt ist, veröffentlichte. An die Pogromnacht erinnerte sich eine Anwohnerin der Paulusstraße: Da waren die Leute in das Haus eingedrungen und hatten sogar das Klavier auf die Straße geworfen, wie mir erzählt wurde. Wie sie das gemacht haben, ist mir zwar rätselhaft; 2 Pfarrchronik St. Paulus, S. 82
3 jedenfalls hat es unten im Garten gelegen. Alles war zerstört und in den Garten geworfen worden. Und dann ist Frau Aron noch in derselben Nacht bei dem Kaplan Günther [gemeint ist wohl sein Nachfolger ab 1937 Kpl. Nordhues, Paulusstr. 17 Anm. des Verfassers] gewesen und hat um Tassen gebeten, damit sie ihren Kindern überhaupt etwas zu trinken geben konnte. Sie hatte kleine Kinder. Da war alles zerstört; da war nichts mehr heil. 3 Gerade die traumatische Erfahrung der damals elf-, sechs- und zweijährigen Söhne muss furchtbar gewesen sein. Für Rolf bedeutete die Folge der Pogromnacht auch das Ende seiner Schulzeit an der Hittorf- Oberrealschule, denn bis Ende 1938 folgten die Verbote zum Besuch öffentlicher Schulen, Universitäten und kultureller Veranstaltungen, übrigens auch der Einzug der Führerscheine und das Verbot der Kfz-Haltung. Mit dem Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. April 1939 wurde der Prozess der Isolierung und Entrechtung auch auf die Wohnverhältnisse ausgedehnt. In zunehmendem Maße führte die Aufhebung des Mieterschutzes zur gewünschten Trennung von arischen und nicht arischen Familien. Die jüdischen Familien aus Marl waren bereits unmittelbar nach dem Pogrom 1938 ausgewiesen worden, um die Stadt für judenfrei zu erklären. So nahm Familie Aron zunächst Arthur und Else Abrahamsohn mit ihren drei Söhnen in einem fensterloses Notquartier an der Paulusstr. 6 auf, ehe diese später zur Hubertusstraße und dann zur Bismarckstraße 1 zogen. Judenhaus Aron, Ernst-vom-Rath-Straße 6 Am 24. Mai 1941 forderte die Gestapo-Leitstelle Münster im Benehmen mit der Stadtgemeinde, der zugleich eine Enteignungsaktion durch das Reich in Aussicht gestellt wurde, die Räumung der Juden aus allen Häusern, in denen sie noch mit arischen Familien zusammen wohnen. 4 In dem Schreiben werden 13 zu räumende Häuser genannt. Der Jüdischen Kultusgemeinde wurde bis zum 1. Juli die Zusammenlegung der Juden in nur jüdischen Häusern auferlegt. Direkt betroffen waren auch Minna und Kurt Aron, die mit Sohn Gerd und Mutter Clara Saalberg ihr Haus an der Bochumer Straße verlassen mussten. Sie zogen nun ebenfalls zum Haus Paulusstraße 6, das sich zu einem der fünf Judenhäuser der Stadt entwickelte: Die Gestapo hatte am eine Durchschnittsgröße von 1-2 Räumen pro Familie angeordnet: Zur Not genügt jedoch 1 Wohnraum. Im Ergebnis drängten sich in den verbliebenen fünf Häusern im Stadtgebiet 91 Personen auf 44 Zimmern, 5 Mansarden und 11 Küchen. 5 Die offizielle Hausadresse hieß seit der großen Straßenumbenennungsaktion zum 50. Führergeburtstag am Ernst-vom-Rath-Straße 6. NSDAP- Reichsschulungsleiter Alfred Rosenberg hatte schon 1930 in seiner antichristlichen und antisemitischen Kampfschrift Mythus des 20. Jahrhunderts den Völkerapostel Paulus aus Tarsos für die Verbastardierung, Verorientalisierung und Verjudung des Christentums verantwortlich gemacht. Stattdessen erhielten Straße und Volksschule nun ausgerechnet den Namen jenes Legationsrats, dessen Erschießung in Paris durch den verzweifelten jüdischen Jugendlichen Herschel Grünspan den propagandistischen Vorwand zur reichsweiten Pogromaktion 1938 gedient hatte. 3 Möllers/Mannel, Pogrom in Recklinghausen 1938, 5. verbesserte und ergänzte Auflage, Recklinghausen 2001, S StA RE III 6519 = Möllers/Mannel, Zwischen Integration und Verfolgung. Die Juden in Recklinghausen, Recklinghausen 1988, Dok StA RE III 6519: Aufstellung der Reichsvereinigung der Juden, Bezirksstelle Westfalen, Bismarckstr. 3, für das Wohnungsamt Recklinghausen,
4 Blick in die untere Paulusstraße mit Haus Nr. 6 rechts, StA RE Nun teilten sich 25 Personen neun Räume, zwei Küchen und zwei Mansarden im Haus der Familie Aron: Der Familienverband Adolf und Else Aron mit ihren Kindern Rolf, Hans-Fred und Günther, Bruder Kurt Aron mit Frau Minna und Sohn Gerd sowie Clara Caroline Saalberg lebte im 1. Stock in vier Räumen mit Gemeinschaftsküche. Julia und Felix Markus mit Tochter Martha hatten an der Bochumer Str. 111 gewohnt. Zusammen mit Julias alleinstehendem Bruder Heinrich Hanau teilten sich einen Raum in Parterre und eine Mansarde. Hannah Zahler wohnte mit Sohn Frank (*1933) in einem Zimmer mit einer provisorischen Küche im Flur; ihr Mann hatte emigrieren können. Isidor Mühlstein-Tanne und Ehefrau Rahel, die Eltern von Frau Zahler, waren in der Schlussphase aus Wesel zugezogen. In einem Zimmer lebten der Tiefbauarbeiter und Handelsvertreter Alfred Friedenberg (*1890) und seine Schwester Friederike (*1886), vorher Hubertusstr. 2.; Friederike wurde nach dem Tod am auf dem Jüdischen Friedhof beigesetzt. 6 Die Geschwister Mia und Dagobert Menschenfreund ( Mutter z. Zt. abwesend ) lebten in Parterre in einem Raum, in einem anderen Feige/Fanny Jäckel mit ihren Kindern Max (*1930), Joachim (*1932) und Johanna (*1937). Ihr Mann - so die Hausliste war z. Zt. nicht hier : Der Kaufmann Oskar Jäckel, bis zur Kündigung durch die Stadtverwaltung wohnhaft Friedhofstr. 13, 7 war am durch die Gestapo verhaftet worden und wurde 1942 in der Euthanasie-Tötungsanstalt Bernburg durch Gas erstickt. 8 Einen Raum ohne Tageslicht mussten sich Nathan (*1887) und Johanna Michel (*1885) teilen, die früher ein Lebensmittelgeschäft an der Bochumer Str. 158 geführt hatten. Ihre in Recklinghausen geborene Tochter Jenny Marianne ( vorübergehend abwesend ), verheiratet mit Artur Heilbronn, war nach Wolbeck umgezogen. Das Ehepaar wurde dort von der Deportationsmaschinerie erfasst und bereits am von Münster aus nach Riga deportiert. Max Libmannn wohnte ohne eigenen Haushalt in einer Mansarde. 6 Inschrift der kleinen Grabplatte: Frieda Friedenberg Der siebenköpfigen Familie ist von der Stadtverwaltung gekündigt vermerkt eine offizielle Liste Ende 1938: StA RE Lt. schriftl. Auskunft des ITS Arolsen vom : ID , , , , ; lt. Auskunft der Gedenkstätte KZ Buchenwald vom wurde auch er Opfer der Aktion 14f13.
5 Isolation und Deportation (Abmeldung nach unbekannt ) Die Lebenssituation der Familien Aron/Saalberg und ihrer Mitbewohner war erbärmlich. Viele lebten zusätzlich in Sorge um geflüchtete oder inhaftierte Familienmitglieder. Der Besitz von Zeitungen, Radios, Schreibmaschinen, Fahrrädern, Haustieren etc. war ebenso verboten wie die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Fernsprecher. Dazu kam seit Kriegsbeginn 1939 die Zuteilung von Lebensmittel- und Kleidungskarten. Diese Berechtigungsabschnitte zum Einkauf lagen deutlich unter den Rationen für arische Deutsche. Zudem war der Einkauf nur noch zu festgelegten Zeiten in zugeteilten Geschäften gestattet. Nach ihrer Deportation aus den fünf Häusern erinnerten nur noch Akten und Hausrat an diese Recklinghäuser Bürger: In den städtischen Abmeldebescheinigungen, die sonst penibel die neuen Wohnadressen vermerkten, hieß es hinter den Namen mit dem Datum nun lapidar nach unbekannt. Auf dem Dokument für Felix Markus 9 z.b. ist vermerkt, dass er zuvor ab in der Ernst-v.-Rath-Str. 6 gemeldet war. Der Hausrat aller fünf Häuser wurde zur Verfügung des Finanzamtes in der Ernst-v.- Rath-Straße 6 deponiert. Über den Besitz aus diesem Haus heißt es dort: Ernst-v.-Rath-Str. 6 Aron, der kombinierte Küchenherd, Aron, Kurt, Schlafzimmer aus Birkenholz, bestehend aus 2 Betten mit Auflegematratze, 2 Nachttischen, 1 Kleiderschrank, 1 Frisiertoilette und 3 Stühlen, Menschenfreund, der gesamte Inhalt der Wohnung Gegen einen Betrag von ,80 Reichsmark an die Finanzkasse gingen Inventar, Textilien und Wäsche an die Stadt Recklinghausen über. Die Häuser wurden zur Vermietung freigegeben. Deportation nach Riga und brutale Exekution des Ghettos am Zusammen mit den anderen Bewohnern wurden auch die Familienmitglieder Aron/Saalberg am 24. Januar 1942 mit Lastkraftwagen in das Sammellager nach Gelsenkirchen transportiert, von dort mit dem Zug nach Dortmund. Am 27. Januar 1942 begann der Transport Dortmund die Fahrt in das Ghetto Riga. Die Bewohnerzahl des Ghettos ging nicht nur durch Hunger, Erschöpfungen und gezielte Selektions-Aktionen gegen Arbeitsunfähige zurück, sondern auch die im Sommer eingeleiteten Großkasernierungen an ihren Arbeitsorten oder im inzwischen errichteten Durchgangslager KZ Kaiserwald. Der Himmler-Befehl vom 21. Juni 1943 ordnete die Auflösung aller Ghettos und die Errichtung von Konzentrationslagern mit kasernierten Außenlagern an, in denen nur noch die Arbeitsfähigen einzusetzen sein. Ausdrücklich einbezogen war auch das Ghetto Riga mit seinen etwa Bewohnern (September 1943). Das Ende des Ghettos wurde am 2. November 1943 exekutiert. 10 Als morgens die Arbeitskommandos abrückten wurden, 9 StA RE Melderegister F. IV. 18 Film-Nr Das Datum 2. November nennen: Angrick/Klein, S Katz, S. 130f - Wolff, Bibel, S. 42f - Buch der Erinnerung. S. 39 Kugler, S. 345, 351; dagegen den 1.November: Schmalhausen, S. 84f; Abrahamsohn, S. 27 nennt den 3. November wie auch Rolf Aron in den Angaben über den Tod seiner Angehörigen in den Dokumenten von Yad Vashem. Vgl. zu einer möglichen Erklärung Schneider, Reise, S. 169, die von zwei Transporten am 2. und nach Auschwitz spricht.
6 wurde Kurt Aron, der als Kriegsteilnehmer 1914/18 ein Bein verloren hatte, und andere aus der Gruppe heraus geholt. 11 Für die Kinder unter 12 Jahren, darunter Hans-Fred und Günther Aron, wurde um 7.45 Uhr wegen einer angeblichen Typhusimpfung das Antreten am Blechplatz angeordnet worden. Die Dortmunderin Jeanette Wolff berichtet: Auch ich hatte ein kleines, goldblondes, entzückendes Mädel angenommen, als es 16 Monate alt war. Der Vater des Kindes war in Salaspils gestorben, die Mutter hatte den Verstand verloren. Es war gerade im Oktober drei Jahre alt geworden. Ich selbst musste das aufgeweckte Kind zum Blechplatz bringen, dem Ort, von dem das Blut des 10. Oktober noch nicht weggewaschen war. Mit seinem Täschchen in der Hand ging es totenbleich neben mir her und sagte immer: `Mutti, du gehst doch mit?` Das Herz blutete mir [...]. Inzwischen war der Blechplatz schon voller Kinder, die alle wussten, dass sie einem schrecklichen Schicksal entgegengingen. Mütter und Großmütter flehten die SS an, die Kinder begleiten zu dürfen, und soweit es sich nicht um Facharbeiterinnen handelte, wurde den leiblichen Mütter gestattet, mitzugehen. 12 Dem Abtransport der Kinder auf Lastkraftwagen folgte ab 10 Uhr eine Selektion aller verbliebenen Ghettobewohner unter Leitung der Lagerführer Krause; Ältere und nicht Arbeitsfähige mussten durch das Prager Tor gehen und ebenfalls Lastkraftwagen besteigen. Anschließend wurde auch das Lazarett geräumt und die Schwerstkranken auf Bahren auf die Ladeflächen verladen. Diese Gewaltaktion entriss der überlebenden Minna Aron ihren Ehemann Kurt Aron, Mutter Clara Caroline Saalberg, Schwager und Schwester Adolf und Else Aron sowie deren Kinder Hans Fred (11 Jahre) und Günther (7 Jahre). Zwei Fotoausschnitte dieser jungen Mordopfer, die im Dokumentationszentrum Yad Vashem in Jerusalem aufbewahrt werden, konnten jetzt wieder zusammengefügt werden. Sie sind ein ergreifendes Dokument unbeschwerter Kindheitstage, wie Hans Fred und Günther nicht viele in ihrem kurzen Leben genießen durften. Hans Fred und Günther, ermordet bei der Ghettoräumung (Yad Vashem, Rekonstruktion: Foto Chahhy) 11 Abrahamsohn, Was machen wir, wenn der Krieg zu Ende ist? Lebensstationen , Essen 2010, S. 27; in der Erinnerung von Rolf Aron wurde er 1944 in Kaiserwald ermordet: Yad Vashem. Gedenkblatt 12 Jeanette Wolff, Mit Bibel und Bebel. Ein Gedenkbuch, hg. v. Hans Lamm, Bonn 1981, S. 43
7 Überlebt hatten mit Minna Aron nur ihr Sohn Gerd (14) und ihr Neffe Rolf Aron (16). Das genaue Schicksal aller ca Opfer der Ghetto-Räumung ist nicht bekannt; sicher ist, dass die meisten nicht in Bikernieki ermordet wurden. Stattdessen wurden die Opfer in Viehwagen ohne Stroh bei 32 Grad Kälte nur mit Brot ausgestattet in das Massenvernichtungslager Auschwitz verschickt. Dabei geriet der erste Transport ( ) in einen Fliegerangriff, dem die Hälfte der Deportierten sofort zum Opfer fiel. Von den 596 Ankömmlingen wurden die meisten in Auschwitz sofort vergast; nur 120 erhielten Lagernummern. Letztlich sind nur zwei Überlebende aus beiden Transporten bekannt. 13 Über den zweiten Zug ( ) wurde im KZ Auschwitz notiert: Mit einem Transport des RSHA sind 1000 Juden aus dem Lager Riga eingetroffen. Nach der Selektion wurden 120 Männer, die die Nummern bis erhalten, und 30 Frauen, die mit den Nummern bis gekennzeichnet werden, als Häftlinge ins Lager eingewiesen. Die übrigen 850 Männer und Frauen werden in den Gaskammern getötet. 14 Verschiffung ins KZ Stutthof Angesichts des Vorrückens der sowjetischen Truppen wurden die Lager aufgelöst, die noch arbeitsfähigen Häftlinge im Spätsommer 1944 zum Abtransport in den Hafen Riga gebracht und von dort über die gefährliche Ostsee, die selbst Kriegsgebiet war, nach Danzig verschifft. Von dort wurden sie in Schleppkähnen, die sonst für Kohle- und Steintransporte genutzt wurden, in der stickigen Sommerluft bei unzureichender Trinkwasser-Versorgung über die Weichsel zum KZ Stutthof transportiert. Das Lager war in keiner Weise auf die Zuführung von ca Juden, darunter etwa aus Lettland im Zeitraum vorbereitet. 15 Die Unterbringungs- und Versorgungs- und Hygieneverhältnisse waren unbeschreiblich; im Herbst 1944 stieg die Todesrate durch die hinzu kommende Flecktyphus-Epidemie so an, dass außerhalb des Krematoriums große Scheiterhaufen angelegt wurden. Da zudem die vorhandenen Zwangsarbeitsplätze bei weitem nicht ausreichten, war auch die Arbeitsfähigkeit kein Überlebensgrund. Die tägliche Auslese 16, so Rolf Abrahamsohn, und das heißt regelmäßige Mordaktionen in der Gaskammer waren das Charakteristikum des Lagers. Im KZ Stutthof wurden die Ankömmlinge bürokratisch registriert. So erreichten am 8./9. August 1944 auch Rolf Abrahamsohn sowie Minna Aron mit Sohn Gerd und Neffe Rolf das Lager. Bereits am wurden Rolf Abrahamsohn, Rolf Aron unter den Häftlingsnummern und in Buchenwald registriert. Gerd Aron dagegen musste im KZ Stutthof bleiben. Bei der Zusammenstellung ihres Arbeitskommandos nach Buchenwald fehlten nach dem Duschen viele paar Schuhe, darunter die von Gerd Aron. Auch der Besitz oder Verlust von Schuhen konnte über Leben und Tod entscheiden: Man hat diese Leute einfach erschossen. Man brauchte sie nicht mehr. 17 So wurde der 15jährige Gerd am in einem Transport nach Auschwitz in den Tod geschickt. 13 Vgl. Schneider, Reise, S. 169ff.; Wolff, Bibel, a.a.o., S. 39, 43f 14 Czech, Kalendarium Auschwitz, S. 645 zitiert nach Schmalhausen, S Vgl. Angrick/Klein, Die Endlösung in Riga. Ausbeutung und Vernichtung , Darmstadt 2006, S. 432ff. 16 Bei Abrahamsohn, a.a.o., S. 31 ist das der Titel des Kapitels über Stutthof. 17 Abrahamsohn, a.a.o., S. 31 berichtet auch über später Gespräche mit Minna Aron, Gerds Mutter, die überlebte: Ich konnte ihr nie erzählen, dass er keine Schuhe mehr abbekommen hat ; vgl. zur Rolle von Schuhen auch Schneider, Reise, S. 190.
8 Häftlings-Personal-Karte KZ Buchenwald Rolf Aron mit dem Verweis auf seine evakuierten Eltern (Listenmaterial Buchenwald: ITS, Rolf Aron, CD #1, Archiv Nr. 3390) Der Überlebenskampf von Rolf Abrahamsohn und Rolf Aron führte sie über das KZ Buchenwald zurück in das Ruhrgebiet zum Außenlager Bochumer Verein an der Brüllstraße. Dort mussten sie unter schlimmen Arbeitsbedingungen im zwölfstündigen Schichtbetrieb Granaten bauen; Kranke oder Arbeitsunfähige wurden auch hier selektiert. Da es für Häftlinge keine Schutzräume gab, kamen viele bei Bombenangriffen ums Leben oder mussten in Bombenentschärfkommandos. Wenige Wochen vor der Befreiung des Ruhrgebiets durch die US-Armee Ostern 1945, wurde die nur noch 20 Menschen der Gruppe im Februar 1945 zurück nach Buchenwald transportiert, wo die Häftlinge im Steinbruch eingesetzt wurden. Im Chaos der letzten Monate hing das Überleben nicht nur wie bisher von Willkür, sondern auch von Beziehungsgeflechten und glücklichen Zufällen oder Fügungen ab. Im März 1945 wurde Rolf Aron zusammen mit Rolf Abrahamsohn und anderen Häftlingen nach einem Fußmarsch zum Bahnhof Weimar in einen Zug in das KZ Dachau verschleppt. Der Zug mit den zusammengepferchten Menschen in geschlossenen Waggons wurde bei Marienbad von Tieffliegern angegriffen, gestoppt und beschädigt; diejenigen, die später weiter mit ihm nach Dachau gebracht wurden, kamen auf dem dortigen Bahnhof ums Leben, da niemand die Wagen öffnete. Den beiden Recklinghäusern war in dem Angriffschaos der Umstieg in einen Zug in das KZ Theresienstadt gelungen. Hier waren Häftlinge in offenen Waggons, in denen auch schon Verhungerte und Erschossene lagen. Die Befreiung in Theresienstadt am 8. Mai 1945 erlebten sie vor Erschöpfung nicht mehr bewusst.
9 Rolf Aron (li) mit Rolf Abrahamsohn 1993 (Foto: Abrahamsohn) Das Konzentrationslager Stutthof verfügte über 39 Außenlager. Minna Aron kam mit Herta Salomons nach Bruss-Sophienwalde und wurde am befreit. 18 Wiederaufbau der Synagogengemeinde Die wenigen Überlebenden, die in das Vest Recklinghausen zurück kehrten, waren für ihren weiteren Lebensweg mit der unauslöschlichen Hypothek ihrer schrecklichen Erlebnisse gezeichnet. Verluste, traumatische Erfahrungen, Ängste, furchtbare Erinnerungen zeichneten sie für ihr Leben. Die meisten emigrierten in der unmittelbaren Nachkriegszeit, weil ihnen ein Leben in der früheren Heimat angesichts dieser Last nicht mehr möglich erschien. Rolf Aron hat uns mitgeteilt, daß seine Eltern und seine beiden Brüder irgendwo im Wald grausam ermordet wurden. Viele Juden wurden getötet durch Vergasung oder mußten sich selbst ein Grab schaufeln und wurden dann erschossen. Die Feder sträubt sich, die mitgeteilten Grausamkeiten schriftlich festzuhalten, hielt Pfarrer Theodor Pasch in der Pfarrchronik St. Paul nach seiner Begegnung erschüttert fest. Rolf Aron emigrierte nach London, blieb aber bis zu seinem Tod in Kontakt mit der neuen Jüdischen Gemeinde und der Stadt Recklinghausen. Minna Aron, Mitbegründerin und Gemeindeleiterin ( ) (Foto: Archiv G. Möllers) 18 ITS, T/D
10 1947 lebten in Recklinghausen, Haltern, Herten und Datteln 24 Juden, darunter die Riga- Überlebenden Rolf Abrahamsohn, Herta und Irma Salomons (Bochumer Str. 138), Minna Aron (Paulusstr. 6), Elly und Ruth Eichenwald (Elper Weg 92). 19 Martha Markus hatte 1946 Ludwig de Vries aus Lathen geheiratet und am 2. August 1947 Tochter Inge geboren; die Familien Salomons und Eichenwald emigrierten. v.r. n. l.: Rolf Abrahamsohn, Rolf und Minna Aron mit Familie de Vries und OB Erich Wolfram Kristallisationsort neuen jüdischen Gemeindelebens in Recklinghausen war zunächst das Haus Bismarckstraße 3, in dem nun Familie de Vries wohnte. 20 Nur mit größter Mühe konnte der Minjan, die notwendige Zahl von zehn Männern für einen Sabbatgottesdienst organisiert werden. Angesichts der kleinen Gruppe der Überlebenden umfasste 1953 die neu gegründete Jüdische Gemeinde die Städte Bochum, Herne und Recklinghausen. Ihre 70 Mitglieder setzten unter dem Vorsitzenden Ludwig de Vries 1955 mit der Weihe einer kleinen Synagoge als Anbau am wieder hergestellten Jüdischen Gemeinde- und Jugendheim von 1930 ein beeindruckendes Zeichen jüdischen Lebens im Vest. Das 1948 errichtete Mahnmal auf dem Jüdischen Friedhof verzeichnet die Namen von 215 Mordopfern aus Recklinghausen anderen vestischen Städten; seit 1945 gedenkt die Gemeinde der Holocaust-Opfer am Tag der Ghettoräumung. Nach dem Tod von Ludwig de Vries übernahm Minna Aron die Leitung. Ihre Wohnung im Gemeindehaus war gleichzeitig Büro und Treffpunkt des Gemeindelebens, das sie auch mit eigenem finanziellen Einsatz unterstützte. Sie gehörte 1961 zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und engagierte sich auch dort bis 1978 als jüdische Vorsitzende. Als eine schwere Erkrankung Minna Aron zur Aufgabe des Vorsitzes der Kultusgemeinde zwang, gelang es der 78jährigen, Rolf Abrahamsohn als Nachfolger in die Verantwortung zu nehmen - als Vermächtnis der Toten: Rolf, den Toten gegenüber hast du dieselbe Verpflichtung, wie ich sie hatte. 21 Bis zur Niederlegung des Vorsitzes durch Rolf Abrahamsohn Liste der gegenwärtigen Gemeindemitglieder, nach ITS Arolsen, ID Mitgezählt sind auch vier Ausländer im D.P.Camp ( Displaced Persons ) in Haltern. 20 Namenliste der Jüdischen Gemeinde, : ITS, Archiv Nr. 3390, Erfassung von Befreiten Abrahamsohn, a.a.o., S. 58
11 später waren es also Riga-Überlebende, die das jüdische Leben in Recklinghausen und die christlich-jüdische Verständigung prägten. Mit dem Tod von Minna Aron am 20. Juli 1987 endete die Familientradition in unserer Stadt. Angehörige von Rolf Aron und Alfred Aron aus Großbritannien und Israel besuchten Recklinghausen zuletzt im Jahre (Georg Möllers) Diese PDF-Datei ist ein Anhang zur biographischen Datei ( Opferbuch ) im Gedenkbuch Opfer und Stätten der Herrschaft, der Verfolgung und des Widerstandes in Recklinghausen Link:
15 Minuten Orientierung im Haus und Lösung der Aufgaben, 30 Minuten Vorstellung der Arbeitsergebnisse durch die Gruppensprecher/innen.
 Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Inhaltsverzeichnis. Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) 3 Ghetto Kauen. 3 Besetzung. 4 Ghetto. 4 KZ-Stammlager
 Inhaltsverzeichnis Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) 3 Ghetto Kauen 3 Besetzung 4 Ghetto 4 KZ-Stammlager Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) Ghetto Kauen Das Konzentrationslager (KZ) Kauen entstand
Inhaltsverzeichnis Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) 3 Ghetto Kauen 3 Besetzung 4 Ghetto 4 KZ-Stammlager Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) Ghetto Kauen Das Konzentrationslager (KZ) Kauen entstand
Hannover-Mühlenberg (Hanomag/Linden)
 Hannover-Mühlenberg (Hanomag/Linden) Zwischen dem 3. Februar und dem 6. April 1945 wurden etwa 500 Häftlinge aus dem Lager Laurahütte einem Außenlager des KZ Auschwitz III (Monowitz) in Hannover-Mühlenberg
Hannover-Mühlenberg (Hanomag/Linden) Zwischen dem 3. Februar und dem 6. April 1945 wurden etwa 500 Häftlinge aus dem Lager Laurahütte einem Außenlager des KZ Auschwitz III (Monowitz) in Hannover-Mühlenberg
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Ihr. Familienstammbaum
 As Ihr Familienstammbaum Sein Vater Seine Mutter Ihr Vater Ihre Mutter Ignaz Stiassny Cecilie Stiassny (geb. Hochwald) gestorben 1928 Moritz Wolf Marie Wolf (geb. Rosenberg) Vater des Interviewten Karel
As Ihr Familienstammbaum Sein Vater Seine Mutter Ihr Vater Ihre Mutter Ignaz Stiassny Cecilie Stiassny (geb. Hochwald) gestorben 1928 Moritz Wolf Marie Wolf (geb. Rosenberg) Vater des Interviewten Karel
Am Mittwoch, den 06.05.15, informierte uns Herr Dauber in einem einstündigen Unterrichtsgang über das Schicksal jüdischer Bürger in Blieskastel.
 Juden in Blieskastel 2015 Nicht alle waren Mitläufer Es gab auch Mutige in der Zeit des NS, das erfuhren wir - die evang. Religionsgruppe der Klassen 10 der ERS Blieskastel mit unserer Religionslehrerin
Juden in Blieskastel 2015 Nicht alle waren Mitläufer Es gab auch Mutige in der Zeit des NS, das erfuhren wir - die evang. Religionsgruppe der Klassen 10 der ERS Blieskastel mit unserer Religionslehrerin
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe
 Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
 Ergänzungen zu den Aufzeichnungen der israelitischen Gemeinde von Bürstadt Die Aufzeichnungen und Berichte von Herrn Hans Goll sind in hervorragender Weise verfasst und niedergeschrieben worden, die Niederschrift
Ergänzungen zu den Aufzeichnungen der israelitischen Gemeinde von Bürstadt Die Aufzeichnungen und Berichte von Herrn Hans Goll sind in hervorragender Weise verfasst und niedergeschrieben worden, die Niederschrift
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Dov? -? Information Salomon Leib Kesten? - 1943 Rifka Kesten 1875 -?
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Dov? -? Information Salomon Leib Kesten? - 1943 Rifka Kesten 1875 -?
Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends
 VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
Livia Fränkel (links) und Hédi Fried
 Livia Fränkel (links) und Hédi Fried 1946 (Privatbesitz Hédi Fried) Hédi Fried, geb. Szmuk * 15.6.1924 (Sighet/Rumänien) April 1944 Getto Sighet; 15.5.1944 Auschwitz; von Juli 1944 bis April 1945 mit ihrer
Livia Fränkel (links) und Hédi Fried 1946 (Privatbesitz Hédi Fried) Hédi Fried, geb. Szmuk * 15.6.1924 (Sighet/Rumänien) April 1944 Getto Sighet; 15.5.1944 Auschwitz; von Juli 1944 bis April 1945 mit ihrer
Stolpersteine für Georg Beerwald und Sidonie Beerwald
 Verfolgung psychisch kranker Menschen während des Nationalsozialismus Stolpersteine für Georg Beerwald und Sidonie Beerwald Recherche Die Psychosozialen Hilfen Bochum e.v. sind Teil der sozialpsychiatrischen
Verfolgung psychisch kranker Menschen während des Nationalsozialismus Stolpersteine für Georg Beerwald und Sidonie Beerwald Recherche Die Psychosozialen Hilfen Bochum e.v. sind Teil der sozialpsychiatrischen
Die am Mittwoch, 10. März, in Saarbrücken verlegten Stolpersteine erinnern an:
 Biografien Die am Mittwoch, 10. März, in Saarbrücken verlegten Stolpersteine erinnern an: Dr. med. Max Haymann geb. 11.05.1896 in Saarburg Sohn von Sophie und Siegmund Haymann Arzt und Geburtshelfer Er
Biografien Die am Mittwoch, 10. März, in Saarbrücken verlegten Stolpersteine erinnern an: Dr. med. Max Haymann geb. 11.05.1896 in Saarburg Sohn von Sophie und Siegmund Haymann Arzt und Geburtshelfer Er
Rechtsanwalt und Notar in Marburg, zuletzt Berater aller Juden in Marburg.
 Hermann Reis1 geb. 16.9.1896 in Allendorf gest. wahrscheinlich am 30.9.1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau Eltern2: Viehhändler Moses Reis (1864-1937) und Bertha, geb. Lazarus (1865-1922) Geschwister:
Hermann Reis1 geb. 16.9.1896 in Allendorf gest. wahrscheinlich am 30.9.1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau Eltern2: Viehhändler Moses Reis (1864-1937) und Bertha, geb. Lazarus (1865-1922) Geschwister:
HAUSAUFGABEN ANNE FRANK UND DER HOLOCAUST
 HAUSAUFGABEN ANNE UND LEKTION 1 / HAUSAUFGABE 1. Denk an den Film, den du mit der Geschichtslehrerin gesehen hast. Welche Emotionen hat eine Person, die keine Familie, kein Haus, keine Freunde, kein Essen
HAUSAUFGABEN ANNE UND LEKTION 1 / HAUSAUFGABE 1. Denk an den Film, den du mit der Geschichtslehrerin gesehen hast. Welche Emotionen hat eine Person, die keine Familie, kein Haus, keine Freunde, kein Essen
Ein Kirchhainer Mädchen - eine Kirchhainer Familie. Die Familie stammt aus Hatzbach, wo es noch Verwandtschaft gibt und wo ihr Vater Adolf, Tante
 1 Familie Wertheim Präsentation anlässlich der Informationsveranstaltung Stolpersteine in Kirchhain Stolpersteine gegen das Vergessen am 23. Januar 2015 im Bürgerhaus Kirchhain, erarbeitet von Anna-Lena
1 Familie Wertheim Präsentation anlässlich der Informationsveranstaltung Stolpersteine in Kirchhain Stolpersteine gegen das Vergessen am 23. Januar 2015 im Bürgerhaus Kirchhain, erarbeitet von Anna-Lena
Aufgabe 4. Wie war der holocaust möglich? Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert.
 Aufgabe 4 Wie war der holocaust möglich? Lies dir die folgenden Textkarten aufmerksam durch. Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert. Fasse nach der
Aufgabe 4 Wie war der holocaust möglich? Lies dir die folgenden Textkarten aufmerksam durch. Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert. Fasse nach der
Erich Jacobs und Familie 1
 Erich Jacobs und Familie 1 Erich Jacobs wurde am 19.12.1906 in Nuttlar im Kreis Unna geboren. Er wuchs in einer stark religiös geprägten Familie auf. Zwei ältere Brüder, David und Alfred, bekamen eine
Erich Jacobs und Familie 1 Erich Jacobs wurde am 19.12.1906 in Nuttlar im Kreis Unna geboren. Er wuchs in einer stark religiös geprägten Familie auf. Zwei ältere Brüder, David und Alfred, bekamen eine
Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck.
 Einleitung Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck. Anna ist ein liebes und ruhiges Mädchen. Aber
Einleitung Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck. Anna ist ein liebes und ruhiges Mädchen. Aber
Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod
 Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Samuel Schwarz 1860-1926. Amalia Schwarz (geb. Goldmann) 1856-1923. Hermine Scheuer (geb. Fischer) 1850-1928. Adolf Scheuer?
 Ihr Familienstammbaum Sein Vater Seine Mutter Ihr Vater Ihre Mutter Adolf Scheuer? - 1915 Hermine Scheuer (geb. Fischer) 1850-1928 Samuel Schwarz 1860-1926 Amalia Schwarz (geb. Goldmann) 1856-1923 Vater
Ihr Familienstammbaum Sein Vater Seine Mutter Ihr Vater Ihre Mutter Adolf Scheuer? - 1915 Hermine Scheuer (geb. Fischer) 1850-1928 Samuel Schwarz 1860-1926 Amalia Schwarz (geb. Goldmann) 1856-1923 Vater
Braunschweig-Vechelde
 Braunschweig-Vechelde Etwa 1000 bis 2000 KZ-Häftlinge, die zuvor im KZ Auschwitz für die Arbeit ausgesucht worden waren, kamen zwischen September und November 1944 in drei Transporten in Braunschweig an,
Braunschweig-Vechelde Etwa 1000 bis 2000 KZ-Häftlinge, die zuvor im KZ Auschwitz für die Arbeit ausgesucht worden waren, kamen zwischen September und November 1944 in drei Transporten in Braunschweig an,
ARBEITSBLÄTTER 13/16 ANNE FRANK UND DER HOLOCAUST
 ARBEITSBLÄTTER 13/16 ANNE UND ARBEITSBLATT 13 / Sätze ausschneiden Arbeitet in Gruppen. Schneidet die Sätze aus, ordnet sie und klebt sie unter den richtigen Text. Sätze zu Text 1 Sätze zu Text 2 Sätze
ARBEITSBLÄTTER 13/16 ANNE UND ARBEITSBLATT 13 / Sätze ausschneiden Arbeitet in Gruppen. Schneidet die Sätze aus, ordnet sie und klebt sie unter den richtigen Text. Sätze zu Text 1 Sätze zu Text 2 Sätze
Transkript»Reden und Schweigen«Wie spreche ich über meine Geschichte? NEUE HEIMAT ISRAEL
 Transkript»«Wie spreche ich über meine Geschichte? NEUE HEIMAT ISRAEL Zu den Transkripten Im Verlauf der Transkription von Interviews wird Gesprochenes in eine schriftliche Form verwandelt. Während wir
Transkript»«Wie spreche ich über meine Geschichte? NEUE HEIMAT ISRAEL Zu den Transkripten Im Verlauf der Transkription von Interviews wird Gesprochenes in eine schriftliche Form verwandelt. Während wir
Es gilt das gesprochene Wort
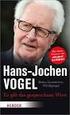 Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Sinti und Roma im KZ Neuengamme
 Sinti und Roma im KZ Neuengamme Die erste Inhaftierungswelle von Sinti und Roma fand im Rahmen der im Sommer 1938 von der Polizei durchgeführten Aktion Arbeitsscheu Reich statt. Zunächst wurden Sinti und
Sinti und Roma im KZ Neuengamme Die erste Inhaftierungswelle von Sinti und Roma fand im Rahmen der im Sommer 1938 von der Polizei durchgeführten Aktion Arbeitsscheu Reich statt. Zunächst wurden Sinti und
Josefine: Und wie wollte Hitler das bewirken, an die Weltherrschaft zu kommen?
 Zeitensprünge-Interview Gerhard Helbig Name: Gerhard Helbig geboren: 19.09.1929 in Berteroda lebt heute: in Eisenach Gesprächspartner: Josefine Steingräber am 21. April 2010 Guten Tag. Stell dich doch
Zeitensprünge-Interview Gerhard Helbig Name: Gerhard Helbig geboren: 19.09.1929 in Berteroda lebt heute: in Eisenach Gesprächspartner: Josefine Steingräber am 21. April 2010 Guten Tag. Stell dich doch
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Joachim Engler Sophie Engler (geb. Friedmann)? cirka 1900 Paul Winternitz?
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Joachim Engler Sophie Engler (geb. Friedmann)? cirka 1900 Paul Winternitz?
Salzgitter-Drütte. KZ-Gedenkstätte Neuengamme Reproduktion nicht gestattet
 Salzgitter-Drütte Für die Granatenproduktion der Hütte Braunschweig richteten die Reichswerke Hermann Göring im Herbst 1942 ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme auf dem Werksgelände in Salzgitter
Salzgitter-Drütte Für die Granatenproduktion der Hütte Braunschweig richteten die Reichswerke Hermann Göring im Herbst 1942 ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme auf dem Werksgelände in Salzgitter
Im Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Andorra von Max Frisch haben wir befunden, dass wir uns mit der Kultur der
 Projekt: Spaziergang durch das Jüdische Viertel Leitung: Ursula Stoff Führung: Gabriela Kalinová Klasse: 5.b 13. Mai 2009 Im Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Andorra von
Projekt: Spaziergang durch das Jüdische Viertel Leitung: Ursula Stoff Führung: Gabriela Kalinová Klasse: 5.b 13. Mai 2009 Im Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Andorra von
Dokumentation Salomon Lichtenstein Stolperstein-Verlegung in Darmstadt am Adelungstr. 49 (Mackensenstr. 49)
 HIER WOHNTE SALAOMON LICHTENSTEIN JG 1877 DEPORTIERT 1943 AUSCHWITZ 9.7.1943 ERMORDET Salomon Lichtenstein war ein Darmstädter Kaufmann, der von Darmstadt aus im Frühjahr 1943 nach Auschwitz deportiert
HIER WOHNTE SALAOMON LICHTENSTEIN JG 1877 DEPORTIERT 1943 AUSCHWITZ 9.7.1943 ERMORDET Salomon Lichtenstein war ein Darmstädter Kaufmann, der von Darmstadt aus im Frühjahr 1943 nach Auschwitz deportiert
Zur Deportation der Guxhagener Juden in das Ghetto Riga vor 65 Jahren
 Zur Deportation der Guxhagener Juden in das Ghetto Riga vor 65 Jahren Ansprache anlässlich der Gedenkfeier am 9. November 2006 in der ehemaligen Guxhagener Synagoge Sehr geehrte Damen und Herren, von Gunnar
Zur Deportation der Guxhagener Juden in das Ghetto Riga vor 65 Jahren Ansprache anlässlich der Gedenkfeier am 9. November 2006 in der ehemaligen Guxhagener Synagoge Sehr geehrte Damen und Herren, von Gunnar
GEDENKSTÄTTE THERESIENSTADT
 GEDENKSTÄTTE THERESIENSTADT KLEINE FESTUNG UND NATIONALFRIEDHOF GHETTO-MUSEUM EHEMALIGE MAGDEBURGER KASERNE BETRAUM AUS DER ZEIT DES GHETTOS JÜDISCHER FRIEDHOF MIT KREMATORIUM RUSSISCHER FRIEDHOF SOWJETISCHER
GEDENKSTÄTTE THERESIENSTADT KLEINE FESTUNG UND NATIONALFRIEDHOF GHETTO-MUSEUM EHEMALIGE MAGDEBURGER KASERNE BETRAUM AUS DER ZEIT DES GHETTOS JÜDISCHER FRIEDHOF MIT KREMATORIUM RUSSISCHER FRIEDHOF SOWJETISCHER
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Markus Landesmann geb.? Nagymihaly gest. 1942 Budapest Großmutter väterlicherseits Julia Landesmann, geb. Moskovits, gest. 1914 Budapest Großvater mütterlicherseits
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Markus Landesmann geb.? Nagymihaly gest. 1942 Budapest Großmutter väterlicherseits Julia Landesmann, geb. Moskovits, gest. 1914 Budapest Großvater mütterlicherseits
Ihnen heute die Humanitätsmedaille der Stadt Linz zu verleihen, ist mir nicht nur ein Anliegen, sondern eine ganz besondere Ehre.
 Frau Ceija Stojka (Humanitätsmedaille) Sehr geehrte Frau Stojka! Ihnen heute die Humanitätsmedaille der Stadt Linz zu verleihen, ist mir nicht nur ein Anliegen, sondern eine ganz besondere Ehre. Lassen
Frau Ceija Stojka (Humanitätsmedaille) Sehr geehrte Frau Stojka! Ihnen heute die Humanitätsmedaille der Stadt Linz zu verleihen, ist mir nicht nur ein Anliegen, sondern eine ganz besondere Ehre. Lassen
Grabower Juden im 1. Weltkrieg
 Grabower Juden im 1. Weltkrieg Mitten im Ersten Weltkrieg, am 11. Oktober 1916, verfügte der preußische Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn die statistische Erhebung des Anteils von Juden an den Soldaten
Grabower Juden im 1. Weltkrieg Mitten im Ersten Weltkrieg, am 11. Oktober 1916, verfügte der preußische Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn die statistische Erhebung des Anteils von Juden an den Soldaten
Übersicht über die Orte, die Namen und die Lebensdaten.
 Zachor! Erinnere dich! Hennefer Stolpersteine Übersicht über die Orte, die Namen und die Lebensdaten. Herausgegeben vom Stadtarchiv Hennef in Zusammenarbeit mit dem Ökumenekreis der Evangelischen und Katholischen
Zachor! Erinnere dich! Hennefer Stolpersteine Übersicht über die Orte, die Namen und die Lebensdaten. Herausgegeben vom Stadtarchiv Hennef in Zusammenarbeit mit dem Ökumenekreis der Evangelischen und Katholischen
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL
 CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Inoffizielle Übersetzung des englischen Originaltextes. Die englische Fassung ist massgebend.] In re Holocaust Victim Assets Litigation Aktenzeichen: CV96-4849 Übermittelter
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Inoffizielle Übersetzung des englischen Originaltextes. Die englische Fassung ist massgebend.] In re Holocaust Victim Assets Litigation Aktenzeichen: CV96-4849 Übermittelter
Befragung von Frau Fw. (Displaced Person) über das Leben im Lager Reckenfeld. Schülerarbeit aus dem Jahr 2000 von Kathrin Haves
 Schülerarbeit aus dem Jahr 2000 von Kathrin Haves Frau Fw. wurde mit 19 Jahren aus Polen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Zuerst arbeitete sie in Rheine. Danach kam sie durch das Arbeitsamt
Schülerarbeit aus dem Jahr 2000 von Kathrin Haves Frau Fw. wurde mit 19 Jahren aus Polen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Zuerst arbeitete sie in Rheine. Danach kam sie durch das Arbeitsamt
Die Reise nach Jerusalem Bilder von Michaela Classen
 Die Reise nach Jerusalem Bilder von Michaela Classen Die Malerin Michaela Classen gibt mit ihren Porträts Kindern, die der nationalsozialistischen Judenverfolgung zum Opfer fielen, eine Lebensgeschichte.
Die Reise nach Jerusalem Bilder von Michaela Classen Die Malerin Michaela Classen gibt mit ihren Porträts Kindern, die der nationalsozialistischen Judenverfolgung zum Opfer fielen, eine Lebensgeschichte.
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Simon Suschny 1850-1936 Cilli Suschny (geb. Fischer)? -? Leopold Schafer?
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Simon Suschny 1850-1936 Cilli Suschny (geb. Fischer)? -? Leopold Schafer?
Bremen-Obernheide (Bremen-Behelfswohnbau)
 Bremen-Obernheide (Bremen-Behelfswohnbau) Nach der Zerstörung des Außenlagers Bremen-Hindenburgkaserne transportierte die SS am 26. September 1944 die weiblichen KZ-Gefangenen nach Bremen-Obernheide, wo
Bremen-Obernheide (Bremen-Behelfswohnbau) Nach der Zerstörung des Außenlagers Bremen-Hindenburgkaserne transportierte die SS am 26. September 1944 die weiblichen KZ-Gefangenen nach Bremen-Obernheide, wo
Boykott aller jüdischen Geschäfte, initiiert und überwacht durch die SA; Aktionen gegen jüdische Ärzte, Juristen und Studierende.
 01.04.1933 Boykott aller jüdischen Geschäfte, initiiert und überwacht durch die SA; Aktionen gegen jüdische Ärzte, Juristen und Studierende. April 1933 Juden dürfen nicht mehr als Lehrer, Rechtsanwalt,
01.04.1933 Boykott aller jüdischen Geschäfte, initiiert und überwacht durch die SA; Aktionen gegen jüdische Ärzte, Juristen und Studierende. April 1933 Juden dürfen nicht mehr als Lehrer, Rechtsanwalt,
Frau Pollak ist an Parkinson erkrankt und konnte deshalb unserer Einladung zur heutigen Stolpersteinverlegung nicht folgen.
 Biographie Johanna Reiss, geb. Pollak wurde am 13. Oktober 1932 in Singen geboren. Hier in der Ekkehardstr. 89 bewohnte Sie mit Ihrer Familie die Wohnung im 2. Stock auf der linken Seite. An Singen selbst
Biographie Johanna Reiss, geb. Pollak wurde am 13. Oktober 1932 in Singen geboren. Hier in der Ekkehardstr. 89 bewohnte Sie mit Ihrer Familie die Wohnung im 2. Stock auf der linken Seite. An Singen selbst
Familie Menschenfreund: Sie trug den Namen zu Recht
 Familie Menschenfreund: Sie trug den Namen zu Recht Die Eheleute Julius und Berta Menschenfreund, geb. Birnbaum waren nach dem Krieg nach Recklinghausen gezogen. Sie waren beide im österreichisch-ungarischen
Familie Menschenfreund: Sie trug den Namen zu Recht Die Eheleute Julius und Berta Menschenfreund, geb. Birnbaum waren nach dem Krieg nach Recklinghausen gezogen. Sie waren beide im österreichisch-ungarischen
D GESCHICHTSORT HUMBERGHAUS GESCHICHTE EINER DEUTSCHEN FAMILIE
 D GESCHICHTSORT HUMBERGHAUS GESCHICHTE EINER DEUTSCHEN FAMILIE Didaktische Materialien D: Fragebogen zur Gruppenarbeit Herausgeber und v.i.s.d.p Heimatverein Dingden e. V. Hohe Straße 1 46499 Hamminkeln
D GESCHICHTSORT HUMBERGHAUS GESCHICHTE EINER DEUTSCHEN FAMILIE Didaktische Materialien D: Fragebogen zur Gruppenarbeit Herausgeber und v.i.s.d.p Heimatverein Dingden e. V. Hohe Straße 1 46499 Hamminkeln
Leoni Grundmann (verh. Warschauer)
 36 Leoni Grundmann (verh. Warschauer) Von Leoni haben wir ein Foto, das sie als feingliedriges 12jähriges Mädchen zeigt. Das Bild wurde 1929 bei der Bar- Mitzwah-Feier Hans Loebs aufgenommen. In den Loeb-Briefen
36 Leoni Grundmann (verh. Warschauer) Von Leoni haben wir ein Foto, das sie als feingliedriges 12jähriges Mädchen zeigt. Das Bild wurde 1929 bei der Bar- Mitzwah-Feier Hans Loebs aufgenommen. In den Loeb-Briefen
Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen
 Vernichtungsort Malyj Trostenez Geschichte und Erinnerung Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen Zur Erinnerung an die Deportation
Vernichtungsort Malyj Trostenez Geschichte und Erinnerung Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen Zur Erinnerung an die Deportation
Arno Stern in Paris, Sohn von Isidor Stern [Schotten-175.4] aus Schotten
![Arno Stern in Paris, Sohn von Isidor Stern [Schotten-175.4] aus Schotten Arno Stern in Paris, Sohn von Isidor Stern [Schotten-175.4] aus Schotten](/thumbs/63/49495743.jpg) 1 Arno Stern in Paris, Sohn von Isidor Stern [Schotten-175.4] aus Schotten Arno Stern wurde 1924 als Sohn des Isidor Stern (geb. 1895 in Schotten, gest. 1978 in Montbeliard in Frankreich) in Kassel geboren.
1 Arno Stern in Paris, Sohn von Isidor Stern [Schotten-175.4] aus Schotten Arno Stern wurde 1924 als Sohn des Isidor Stern (geb. 1895 in Schotten, gest. 1978 in Montbeliard in Frankreich) in Kassel geboren.
Wir erinnern an Caroline und Feibusch Klag
 Sehr geehrte Damen und Herren, Wir begrüßen Sie alle und freuen uns sehr, dass so viele Menschen gekommen sind, an dieser Stolpersteinverlegung teilzunehmen, die ja eine Totenehrung ist. Ganz besonders
Sehr geehrte Damen und Herren, Wir begrüßen Sie alle und freuen uns sehr, dass so viele Menschen gekommen sind, an dieser Stolpersteinverlegung teilzunehmen, die ja eine Totenehrung ist. Ganz besonders
Jüdische Einwohner von Hüttengesäß 1933 Arbeitsstand 2014
 Jüdische Einwohner von Hüttengesäß 1933 Arbeitsstand 2014 Name, Vorname Ggf. Geb. Name Geb. am Geb. Ort Wohnung Hüttengesäß Wegzug am/ nach Weiteres Schicksal Adler, Adolf 28.8.1893 Schlüchtern Schulstr.
Jüdische Einwohner von Hüttengesäß 1933 Arbeitsstand 2014 Name, Vorname Ggf. Geb. Name Geb. am Geb. Ort Wohnung Hüttengesäß Wegzug am/ nach Weiteres Schicksal Adler, Adolf 28.8.1893 Schlüchtern Schulstr.
Bad Laaspher. Freundeskreis für christlich - jüdische
 Bad Laaspher Freundeskreis für christlich - jüdische Zusammenarbeit e.v. Der Verein wurde in 1991 am Jahrestag der Pogromnacht des 9./10. November 1938 gegründet. Auslöser dazu war der 50. Jahrestag dieses
Bad Laaspher Freundeskreis für christlich - jüdische Zusammenarbeit e.v. Der Verein wurde in 1991 am Jahrestag der Pogromnacht des 9./10. November 1938 gegründet. Auslöser dazu war der 50. Jahrestag dieses
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Pesel Silberberg? -? Jakob Beck? - 1928 Marie Beck (geb. Ribner) 1867
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Großmutter väterlicherseits Großvater mütterlicherseits Großmutter mütterlicherseits Pesel Silberberg? -? Jakob Beck? - 1928 Marie Beck (geb. Ribner) 1867
Konzentrationslager Dachau
 Konzentrationslager Dachau Am 25.10.2016 gingen wir die Klasse 10,9a und 9b in das Konzentrationslager (KZ )nach Dachau. Bevor wir ins KZ gefahren sind, haben wir uns noch in München aufgehalten. Wir haben
Konzentrationslager Dachau Am 25.10.2016 gingen wir die Klasse 10,9a und 9b in das Konzentrationslager (KZ )nach Dachau. Bevor wir ins KZ gefahren sind, haben wir uns noch in München aufgehalten. Wir haben
Tschernobyl und Ilulissat verbindet
 . global news 3462 25-04-16: Was Auschwitz, Leningrad, Tschernobyl und Ilulissat verbindet Vier Plätze, die mich heute noch im Gedenken umtreiben: Auschwitz, der Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof im damaligen
. global news 3462 25-04-16: Was Auschwitz, Leningrad, Tschernobyl und Ilulissat verbindet Vier Plätze, die mich heute noch im Gedenken umtreiben: Auschwitz, der Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof im damaligen
Richard Baer. KZ-Gedenkstätte Neuengamme Reproduktion nicht gestattet
 Richard Baer (BArch, BDC/RS, Baer, Richard, 9.9.1911) * 9.9.1911 (Floss bei Weiden/Oberpfalz) 17.6.1963 (Frankfurt am Main) Konditor; 1930/31 NSDAP, 1932 SS; KZ Dachau, Columbia-Haus Berlin, KZ Buchenwald;
Richard Baer (BArch, BDC/RS, Baer, Richard, 9.9.1911) * 9.9.1911 (Floss bei Weiden/Oberpfalz) 17.6.1963 (Frankfurt am Main) Konditor; 1930/31 NSDAP, 1932 SS; KZ Dachau, Columbia-Haus Berlin, KZ Buchenwald;
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt
 Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Liste der Patenschaften
 1 von 6 01.07.2013 Liste der Patenschaften Quellen: Beiträge zur Geschichte der Juden in Dieburg, Günter Keim / mit den Ergänzungen von Frau Kingreen Jüdische Bürgerinnen und Bürger Strasse Ergänzungen
1 von 6 01.07.2013 Liste der Patenschaften Quellen: Beiträge zur Geschichte der Juden in Dieburg, Günter Keim / mit den Ergänzungen von Frau Kingreen Jüdische Bürgerinnen und Bürger Strasse Ergänzungen
Der Bordesholmer Damen-Kaffee-Club
 Barbara Rocca Der Bordesholmer Damen-Kaffee-Club Etwa in den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trafen sich diese Damen der Bordesholmer Gesellschaft einmal wöchentlich zum Kaffeeklatsch: 1 Obere
Barbara Rocca Der Bordesholmer Damen-Kaffee-Club Etwa in den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trafen sich diese Damen der Bordesholmer Gesellschaft einmal wöchentlich zum Kaffeeklatsch: 1 Obere
Leseprobe. Ilse Weber. Wann wohl das Leid ein Ende hat. Briefe und Gedichte aus Theresienstadt. Herausgegeben von Ulrike Migdal
 Leseprobe Ilse Weber Wann wohl das Leid ein Ende hat Briefe und Gedichte aus Theresienstadt Herausgegeben von Ulrike Migdal ISBN: 978-3-446-23050-7 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-23050-7
Leseprobe Ilse Weber Wann wohl das Leid ein Ende hat Briefe und Gedichte aus Theresienstadt Herausgegeben von Ulrike Migdal ISBN: 978-3-446-23050-7 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-23050-7
Stadtplan und Hintergrundinformationen zu den Standorten der Stolpersteine in der Gemeinde Uedem
 Stadtplan und Hintergrundinformationen zu den Standorten der Stolpersteine in der Gemeinde Uedem Alex Devries Hilde Devries Jüdische Opfer: 2-4, 6-13, 15-19, 21-32, 34-42 Behinderte: 5, 14, 20, 33, 44-46
Stadtplan und Hintergrundinformationen zu den Standorten der Stolpersteine in der Gemeinde Uedem Alex Devries Hilde Devries Jüdische Opfer: 2-4, 6-13, 15-19, 21-32, 34-42 Behinderte: 5, 14, 20, 33, 44-46
ANNE FRANK TAG JAHRE TAGEBUCH
 ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
Aus: Inge Auerbacher, Ich bin ein Stern, 1990, Weinheim Basel: Beltz & Gelberg
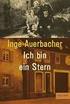 Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Stolpersteine - Zehn Steine an vier Orten. Lion Levy
 Stolpersteine - Zehn Steine an vier Orten STOLPERSTEINE DILLINGEN In Dillingen lebten spätestens seit dem 18. Jahrhundert jüdische Familien. Mit dem Erstarken der Industrie seit Ende des 19. Jahrhunderts
Stolpersteine - Zehn Steine an vier Orten STOLPERSTEINE DILLINGEN In Dillingen lebten spätestens seit dem 18. Jahrhundert jüdische Familien. Mit dem Erstarken der Industrie seit Ende des 19. Jahrhunderts
BM.I REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES EINLADUNG MAUTHAUSEN
 BM.I REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES EINLADUNG DIE BUNDESMINISTERIN FÜR INNERES MAG. a JOHANNA MIKL-LEITNER LÄDT ZUR BUCHPRÄSENTATION BORN SURVIVORS. THREE YOUNG MOTHERS AND THEIR EXTRAORDINARY
BM.I REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES EINLADUNG DIE BUNDESMINISTERIN FÜR INNERES MAG. a JOHANNA MIKL-LEITNER LÄDT ZUR BUCHPRÄSENTATION BORN SURVIVORS. THREE YOUNG MOTHERS AND THEIR EXTRAORDINARY
Frau Anna Lausch, Mein Beruf war Büroangestellte. Ich arbeitete in der Lohnverrechnung und Buchhaltung.
 Frau Anna Lausch, war verheiratet. Ihr Mann ist 1944 gefallen. 1945 wurde der Vater eingezogen und ist vermisst. Mein Beruf war Büroangestellte. Ich arbeitete in der Lohnverrechnung und Buchhaltung. Wir
Frau Anna Lausch, war verheiratet. Ihr Mann ist 1944 gefallen. 1945 wurde der Vater eingezogen und ist vermisst. Mein Beruf war Büroangestellte. Ich arbeitete in der Lohnverrechnung und Buchhaltung. Wir
In ewiger Erinnerung. Von Frankfurt aus deportierte jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihren Wohnsitz ehemals in Bergen hatten A - G
 In ewiger Erinnerung Name Von Frankfurt aus deportierte jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihren Wohnsitz ehemals in Bergen hatten ALTHEIMER, (Sara) Sophie A - G Geburtstag Letzte Wohnung in Bergen
In ewiger Erinnerung Name Von Frankfurt aus deportierte jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihren Wohnsitz ehemals in Bergen hatten ALTHEIMER, (Sara) Sophie A - G Geburtstag Letzte Wohnung in Bergen
Brief 1 ( David liest, pantomimisch) - Vera spricht den Text im Dunkel
 David auf der einen Seite der Bühne im Zimmer, eine Kerze, sitzt auf dem Bettrand und schreibt. Vera auf einem Podium abseits, hinter Gittern und Stacheldraht Immer wenn einer liest, wird er mit Scheinwerfer
David auf der einen Seite der Bühne im Zimmer, eine Kerze, sitzt auf dem Bettrand und schreibt. Vera auf einem Podium abseits, hinter Gittern und Stacheldraht Immer wenn einer liest, wird er mit Scheinwerfer
Unterwegs bei Kriegsende
 Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften am Beispiel der Konzentrationslager Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Gedenkstätte Bergen-Belsen Seminar für interessierte Erwachsene
Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften am Beispiel der Konzentrationslager Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Gedenkstätte Bergen-Belsen Seminar für interessierte Erwachsene
Bruno Kitt. KZ-Gedenkstätte Neuengamme Reproduktion nicht gestattet
 1944 (BArch, BDC/RS, Kitt, Bruno, 9.8.1908) * 9.8.1908 (Heilsberg/Ostpreußen) 8.10.1946 (Hinrichtung in Hameln) Vertrauensarzt in der Ruhr-Knappschaft; 1933 SS und NSDAP, 1942 Waffen-SS; Truppenarzt und
1944 (BArch, BDC/RS, Kitt, Bruno, 9.8.1908) * 9.8.1908 (Heilsberg/Ostpreußen) 8.10.1946 (Hinrichtung in Hameln) Vertrauensarzt in der Ruhr-Knappschaft; 1933 SS und NSDAP, 1942 Waffen-SS; Truppenarzt und
Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium
 Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium Niveaukonkretisierung für Geschichte Klasse Landesinstitut für Schulentwicklung Qualitätsentwicklung und Evaluation Weimarer Republik und Nationalsozialismus
Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium Niveaukonkretisierung für Geschichte Klasse Landesinstitut für Schulentwicklung Qualitätsentwicklung und Evaluation Weimarer Republik und Nationalsozialismus
Jüdische Bevölkerung Kuchenheim Stand 20.07.2012
 Verwandtschaftsverhältnis Jüdische Bevölkerung Stand 20.07.2012 Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum Beruf Geburtsort Wohnort letzter Ort Transport Todesdatum Bemerkung Verweis 5.1. Rolef 5 Simon 5 01.12.1862
Verwandtschaftsverhältnis Jüdische Bevölkerung Stand 20.07.2012 Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum Beruf Geburtsort Wohnort letzter Ort Transport Todesdatum Bemerkung Verweis 5.1. Rolef 5 Simon 5 01.12.1862
Jüdisches Leben am westlichen Bodensee am Beispiel von Bohlingen
 Jüdisches Leben am westlichen Bodensee am Beispiel von Bohlingen Eine Spurensuche nach Frau Johanna Schwarz, geb. Michel, der evangelischen Kirche Böhringen Stand: 16.03.2011 1. Kurze Geschichte der Deportierten
Jüdisches Leben am westlichen Bodensee am Beispiel von Bohlingen Eine Spurensuche nach Frau Johanna Schwarz, geb. Michel, der evangelischen Kirche Böhringen Stand: 16.03.2011 1. Kurze Geschichte der Deportierten
Fred Löwenberg. Januar 2000. (ANg, 2000-1231)
 Januar 2000 (ANg, 2000-1231) * 19.4.1924 (Breslau), 30.5.2004 (Berlin) Sozialistische Arbeiterjugend; 1942 Verhaftung; Gefängnis Breslau; KZ Buchenwald; 26.10.1944 KZ Neuengamme; Dezember 1944 Außenlager
Januar 2000 (ANg, 2000-1231) * 19.4.1924 (Breslau), 30.5.2004 (Berlin) Sozialistische Arbeiterjugend; 1942 Verhaftung; Gefängnis Breslau; KZ Buchenwald; 26.10.1944 KZ Neuengamme; Dezember 1944 Außenlager
Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung)
 Erinnerungsstätte Rathaus Attendorn Tafel: Die Verfolgung der Juden Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung) In der Wasserstraße
Erinnerungsstätte Rathaus Attendorn Tafel: Die Verfolgung der Juden Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung) In der Wasserstraße
Im Krematorium wurden 1942 zwei Öfen zur Verbrennung der Leichen gebaut, allerdings wurden auch immer weiter Leichen offen im Freien verbrannt.
 Besuch in Stutthof In Kooperation mit Paper Press Studienreisen lud der Landesverband der Berliner SPD vom 19. bis 23. Oktober 2009 zu seiner jährlichen Gedenkstättenfahrt ein. In diesem Jahr führte die
Besuch in Stutthof In Kooperation mit Paper Press Studienreisen lud der Landesverband der Berliner SPD vom 19. bis 23. Oktober 2009 zu seiner jährlichen Gedenkstättenfahrt ein. In diesem Jahr führte die
Walter wassermann. ein film von. Riccardo Biasibetti, Hüseyin Calikbasi, Daniel Norkus
 Walter wassermann O H N D I G U T N H ÄT T I C H N I C H T Ü B R L B T ein film von Riccardo Biasibetti, Hüseyin Calikbasi, Daniel Norkus 2 1 0 2 R B O T K O 9. R I M R P M L FI NTIS KINO ATLA 32 18 UHR
Walter wassermann O H N D I G U T N H ÄT T I C H N I C H T Ü B R L B T ein film von Riccardo Biasibetti, Hüseyin Calikbasi, Daniel Norkus 2 1 0 2 R B O T K O 9. R I M R P M L FI NTIS KINO ATLA 32 18 UHR
1806 Moisling wird ein Teil des Lübecker Stadtgebiets, aber die rund 300 Juden werden keine gleichberechtigten Bürger/innen der Hansestadt.
 Chronik 1656 Ansiedlung erster Juden in Moisling; in dem dänischen Dorf vor den Toren Lübecks entwickelt sich einen aschkenasisch-jüdische Gemeinde, die spätestens ab 1723 einen eigenen Rabbiner hat. Ab
Chronik 1656 Ansiedlung erster Juden in Moisling; in dem dänischen Dorf vor den Toren Lübecks entwickelt sich einen aschkenasisch-jüdische Gemeinde, die spätestens ab 1723 einen eigenen Rabbiner hat. Ab
Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen aus Bonn und Warschau
 Was war was wird? Projekt des Lyceums im Adama Mickiewicza (Warschau) und der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel Projektarbeit 2004 (Teil 2) Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen
Was war was wird? Projekt des Lyceums im Adama Mickiewicza (Warschau) und der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel Projektarbeit 2004 (Teil 2) Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen
Chronologie zur jüdischen Geschichte Nürnbergs
 Chronologie zur jüdischen Geschichte Nürnbergs 1146-1945 1146 erste urkundliche Erwähnung von Juden in Nürnberg (Niederlassungserlaubnis für Flüchtlinge aus dem Rheinland) 1288 erste Erwähnung eines jüdischen
Chronologie zur jüdischen Geschichte Nürnbergs 1146-1945 1146 erste urkundliche Erwähnung von Juden in Nürnberg (Niederlassungserlaubnis für Flüchtlinge aus dem Rheinland) 1288 erste Erwähnung eines jüdischen
Die Vergabe von Häftlingsnummern im KZ Neuengamme
 Die Vergabe von Häftlingsnummern im KZ Neuengamme Ende 1938 errichtete die SS in einer stillgelegten Ziegelei in Hamburg-Neuengamme ein Außenlager des KZ Sachsenhausen, das im Frühjahr 1940 zum eigenständigen
Die Vergabe von Häftlingsnummern im KZ Neuengamme Ende 1938 errichtete die SS in einer stillgelegten Ziegelei in Hamburg-Neuengamme ein Außenlager des KZ Sachsenhausen, das im Frühjahr 1940 zum eigenständigen
Ereignis-Chronologie
 www.juedischesleipzig.de Ereignis-Chronologie Zusammengestellt von Steffen Held 13. 17. Jahrhundert Um 1250 Existenz einer jüdischen Siedlung ( Judenburg ) außerhalb der Stadtmauern 1349 Judenverfolgungen
www.juedischesleipzig.de Ereignis-Chronologie Zusammengestellt von Steffen Held 13. 17. Jahrhundert Um 1250 Existenz einer jüdischen Siedlung ( Judenburg ) außerhalb der Stadtmauern 1349 Judenverfolgungen
Hamburg-Veddel (Dessauer Ufer, Frauen)
 Hamburg-Veddel (Dessauer Ufer, Frauen) Mitte Juli 1944 wurde das erste Frauenaußenlager des KZ Neuengamme in einem Speicher in Veddel am Dessauer Ufer im Hamburger Freihafen errichtet. Die ersten 1000
Hamburg-Veddel (Dessauer Ufer, Frauen) Mitte Juli 1944 wurde das erste Frauenaußenlager des KZ Neuengamme in einem Speicher in Veddel am Dessauer Ufer im Hamburger Freihafen errichtet. Die ersten 1000
KLASSENARBEIT ANNA FRANK UND DER HOLOCAUST
 KLASSENARBEIT ANNA FRANK UND DER HOLOCAUST Goethe-Institut Italien NAME KLASSE DATUM ANNE FRANK DER HOLOCAUST ANNE FRANK UND DER HOLOCAUST - KLASSENARBEIT Teil 1: Kenntnis Aufgabe: Lies die Fragen und
KLASSENARBEIT ANNA FRANK UND DER HOLOCAUST Goethe-Institut Italien NAME KLASSE DATUM ANNE FRANK DER HOLOCAUST ANNE FRANK UND DER HOLOCAUST - KLASSENARBEIT Teil 1: Kenntnis Aufgabe: Lies die Fragen und
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Oskar Wonsch, geb. 11.3.1879 in Polen, gest. 5.3.1944 in Theresienstadt Großmutter väterlicherseits Helene(Scheje) Wonsch geb. Felder, geb. 14.4.1874 in
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Oskar Wonsch, geb. 11.3.1879 in Polen, gest. 5.3.1944 in Theresienstadt Großmutter väterlicherseits Helene(Scheje) Wonsch geb. Felder, geb. 14.4.1874 in
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
 Rede von Bürgermeister Olaf Cunitz bei der Gedenkfeier zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2013 um 10.30 Uhr in der Henry- und Emma-Budge-Stiftung, Wilhelmshöher Straße
Rede von Bürgermeister Olaf Cunitz bei der Gedenkfeier zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2013 um 10.30 Uhr in der Henry- und Emma-Budge-Stiftung, Wilhelmshöher Straße
verfolgung und deportation Fotos und Dokumente
 verfolgung und deportation Fotos und Dokumente verfolgung und deportation Fotos und Dokumente Die Nationalsozialisten hatten nach der Machtübernahme 1933 die jüdischen Deutschen nach und nach aus der
verfolgung und deportation Fotos und Dokumente verfolgung und deportation Fotos und Dokumente Die Nationalsozialisten hatten nach der Machtübernahme 1933 die jüdischen Deutschen nach und nach aus der
Es gilt das gesprochene Wort!
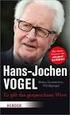 Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen
 GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen Moritz Stetter, geboren 1983, ist freiberuflicher Trickfilmzeichner und Illustrator. Er hat an der Akademie für Kommunikation und an
GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen Moritz Stetter, geboren 1983, ist freiberuflicher Trickfilmzeichner und Illustrator. Er hat an der Akademie für Kommunikation und an
Ihr Familienstammbaum
 Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Ignaz Barchelis (Mähren- 1929 in Wien) Großmutter väterlicherseits Juli Barchelis (geb. Neubauer) (Mähren 1938 in Wien) Großvater mütterlicherseits Theodor
Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Ignaz Barchelis (Mähren- 1929 in Wien) Großmutter väterlicherseits Juli Barchelis (geb. Neubauer) (Mähren 1938 in Wien) Großvater mütterlicherseits Theodor
Arbeitsmaterialien Antisemitismus/Holocaust. Raum 3.07 Die Situation der jüdischen Bevölkerung bis 1933
 Arbeitsmaterialien Antisemitismus/Holocaust Raum 3.07 Die Situation der jüdischen Bevölkerung bis 1933 1933 leben in Dortmund etwa 4.200 jüdische Bürger bei einer Gesamtzahl von 540.000 Einwohnern. Die
Arbeitsmaterialien Antisemitismus/Holocaust Raum 3.07 Die Situation der jüdischen Bevölkerung bis 1933 1933 leben in Dortmund etwa 4.200 jüdische Bürger bei einer Gesamtzahl von 540.000 Einwohnern. Die
Kurzbiografie für. Erich Kahn. * 6. April 1913 in Paderborn 2. Juni Diese Kurzbiografie wurde verfasst von Frau Hellwig
 Kurzbiografie für Erich Kahn * 6. April 1913 in Paderborn 2. Juni 1990 Diese Kurzbiografie wurde verfasst von Frau Hellwig Kindheit und Studium in Münster Erich Kahn wurde am 6. April 1913 in Paderborn
Kurzbiografie für Erich Kahn * 6. April 1913 in Paderborn 2. Juni 1990 Diese Kurzbiografie wurde verfasst von Frau Hellwig Kindheit und Studium in Münster Erich Kahn wurde am 6. April 1913 in Paderborn
HIER WOHNTE SELMA ABRAHAM GEB. CAHN JG. 1886 DEPORTIERT 1941 GHETTO RIGA TOT 1942
 HIER WOHNTE SELMA ABRAHAM GEB. CAHN JG. 1886 DEPORTIERT 1941 GHETTO RIGA TOT 1942 Page of Testimony Selma Abraham, geb. Cahn 1 Selma Abraham, geb. Cahn, wurde am 7. Juli 1886 als Tochter des jüdischen
HIER WOHNTE SELMA ABRAHAM GEB. CAHN JG. 1886 DEPORTIERT 1941 GHETTO RIGA TOT 1942 Page of Testimony Selma Abraham, geb. Cahn 1 Selma Abraham, geb. Cahn, wurde am 7. Juli 1886 als Tochter des jüdischen
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL
 CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Inoffizielle Übersetzung des englischen Originaltextes. Die englische Fassung ist massgebend.] In re Holocaust Victim Assets Litigation Aktenzeichen CV96-4849 Auszahlungsentscheid
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Inoffizielle Übersetzung des englischen Originaltextes. Die englische Fassung ist massgebend.] In re Holocaust Victim Assets Litigation Aktenzeichen CV96-4849 Auszahlungsentscheid
Olga und Salomon Cohn Dokumentation zweier Schicksale
 Olga und Salomon Cohn Dokumentation zweier Schicksale Die Eheleute Olga und Salomon Cohn, beide jüdischen Glaubens, waren von1935 bis zu ihrer Deportation 1943 Mieter und Ladeninhaber in unserem Haus Suarezstraße
Olga und Salomon Cohn Dokumentation zweier Schicksale Die Eheleute Olga und Salomon Cohn, beide jüdischen Glaubens, waren von1935 bis zu ihrer Deportation 1943 Mieter und Ladeninhaber in unserem Haus Suarezstraße
Unser Weg zu den Stolpersteinen
 Unser Weg zu den Stolpersteinen An einem kalten Herbsttag vor ca. 1 ½ Jahren haben wir auf einem Spaziergang durch Kreuzberg die erste Bekanntschaft mit Stolpersteinen gemacht. Sie waren vielen aus unserem
Unser Weg zu den Stolpersteinen An einem kalten Herbsttag vor ca. 1 ½ Jahren haben wir auf einem Spaziergang durch Kreuzberg die erste Bekanntschaft mit Stolpersteinen gemacht. Sie waren vielen aus unserem
Das kurze Leben von Anna Lehnkering
 Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
Lilly Menczel. Vom Rhein nach Riga. Deportiert von Köln: Bericht einer Überlebenden des Holocaust V VS. Herausgegeben von Gine Elsner
 Lilly Menczel Vom Rhein nach Riga Deportiert von Köln: Bericht einer Überlebenden des Holocaust V VS Herausgegeben von Gine Elsner Lilly Menczel Vom Rhein nach Riga Lilly Menczel, geboren 1925 in Köln,
Lilly Menczel Vom Rhein nach Riga Deportiert von Köln: Bericht einer Überlebenden des Holocaust V VS Herausgegeben von Gine Elsner Lilly Menczel Vom Rhein nach Riga Lilly Menczel, geboren 1925 in Köln,
