B.Sc. Chemie- und Bioingenieurwesen Vertiefung Material. Prof. Dr. habil. Günter Tovar
|
|
|
- Edmund Graf
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 B.Sc. Chemie- und Bioingenieurwesen Vertiefung Material Prof. Dr. habil. Günter Tovar
2 Universität Stuttgart
3 Materialwissenschaft (Materials Science)
4 Materialwissenschaft was ist das?
5 Atomare Bindung Kristallgitter Gefüge Versuchsprobe Bauteil m 10-8 m 10-6 m 10-4 m 10-2 m 10 0 m Al3+ O 2- Ionenbindung z.b. Aluminiumoxid Atombindung z.b. Diamant z.b. Siliziumnitrid z.b. Siliziumnitrid z.b. Biegeprobe z.b. Ventil Naturwissenschaft Materialwissenschaft Ingenieurwissenschaft
6 Chemie Physik Materialwissenschaft Ingenieurwesen
7 Entwicklung der Materialwissenschaft relative Bedeutung GoldKupfer Bronze Holz Häute Fasern Papier Stroh-Ziegel Knochen Eisen Stein Ton Glas Zement/ Feuerstein Mörtel Gußeisen Polymere Verbunde Stähle Gummi Keramiken Metalle mikrolegierte Stähle neue Superlegierungen metallische Gläser Al-Li-Legierungen legierte Stähle Al Leichtmetalllegierungen Superlegierungen Polymere Bakelit Hochtemperatur- Polymere Ti steife Polymere Zr CMC Nylon PE. PMMA PP. PS. PC Ẹpoxy Polyester GFRP CFRPMMC Quarzglas Hartmetall Al 2 O 3 Si 3 N 4 PSZ leitende
8 Strukturmaterialien (Leichtbau) Then and now!
9 Hochtemperaturanwendung Beispiel: Flugzeugturbine (T = C)
10 Hochtemperaturanwendung Technologie: Weiterentwicklung/Optimierung Forschung
11 Energieproblematik (Direkte Stromerzeugung durch Wärme) Thermoelektrische Generatoren: Elect r. curre nt cold e- e- e- e- p n p ne- p e- n pp e- + e- n p+ + e- e- e- hot e- e- R L e- Voyager
12 Energieproblematik (Funktionsmaterialien/Speicherung) Problem: niedrige Energiedichte langsame Ladegeschwindigkeit Lösung: Elektroden ohne Trägermaterial Bioinspiration: Perlmutt Anwendung:
13 Energieproblematik (Funktionsmaterialien/Speicherung) Glancing angle incidence in sputtering Solid state reactions in core-shell nanowires Ti wires for hydrogen storage Substrate holder
14 Funktionsmaterialien (Mikro/Nano-Technologie) AMD-Prozessor 8. Generation Cu-Chip von IBM MEMX MEMS-Aktuator Lambdarouter Lucent Technologies Wechselstrom-Ermüdung, R. Mönig MPI Stuttgart SAW-Ermüdung, C.Eberl MPI Stuttgart
15 Untersuchungsmethoden 100 nm 2D single ion detector 3D analysis in single atom sensitivity tipshaped sample needle pin 0.15 m APT sample e.g. thermal degradation of a metallic
16 Strukturmaterialien (Bruchzähe Keramik) Keramiken müssen nicht spröde sein: Optimierung der Mikrostruktur führt zur Erhöhung der Bruchzähigkeit z.b: Siliciumnitridkristalle (Si 3 N 4 ) in Glasphase aus Aluminium- und Yttriumoxid Glasphase aus Al 2 O 3 und Y 2 O 3 Si 3 N 4 -Kristalle
17 Funktionsmaterialien (Haftsysteme) Fliegenfuß Polymerstruktur
18 Medizintechnik/Implantatwerkstoffe
19 Materialwissenschaftler Forscher/Ingenieure für alle Fälle Mega Bio Nano
20 Universität Stuttgart
21 Ressourcenschonung mit Kunststoffen Kunststoffe / Polymere in der Brennstoffzellentechnik Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 21
22 Biokunststoffe Beispiel: Nutzung in der Landwirtschaft [Bilder: FKuR Kunststoff GmbH und deren Kunden, European Bioplastics] Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 22
23 Herkunft der Monomere Herstellung biobasierter Polymere Stärke, Lignin, Naturkautschuk, Cellulose Chitin, Kasein, Spinnenseide Bakterium Aeromonas hydrophila: PHA Milchsäurebakterium: LA Bioethanol Bio-PE Rizinusöl Bio-PA Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 23
24 Biopolymere und Biokunststoffe Nachhaltigkeit mit Zukunftspotenzial Biokunststoffe in unterschiedlichsten Anwendungen [Quelle: European Bioplastics, IfBB, nova-institut, 2015] Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 24
25 Selektives Lasersintern Beispiel komplexes Bauteil Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 27
26 Selektives Lasersintern Auspacken der Bauteile aus dem Pulverkuchen Bildquellen: Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 28
27 Selektives Lasersintern Individualität trotz Massenfertigung Bildquelle: Kegelmann Technik Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 29
28 Ressourcenschonung mit Kunststoffen Energieeinsparung durch Leichtbau i3 und i8 [Quelle: BMW Group] [Quelle: Kunststoffe, Porsche] CFK: ca. 50 % leichter als herkömmliche Bauweise Kohlenstofffaser-Monocoque Porsche 918 Spyder Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten 30
29 Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Institut für Textil- und Fasertechnologien 31
30 Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Europas größte Textilforschungseinrichtung gegründet 1921, Stiftung des öffentlichen Rechts 3 Forschungseinrichtungen, 1 Produktionsgesellschaft (ITVP) Anwendungsorientierte Forschung vom Molekül bis zum Produkt auf m 2 Forschung mit industriellen Pilotanlagen, Fokus Technische Textilien und Life Science Anbindung an Uni Stuttgart und Hochschule Reutlingen über 3 Lehrstühle und 2 Professuren 32 32
31 Einsatzgebiete von Textilien Bekleidung - Oberbekleidung - Unterbekleidung - Sportbekleidung Heimtextilien - Teppiche, Bodenbeläge - Vorhänge - Möbelstoffe - Bettwäsche usw. Technische Textilien - Automobiltextilien - Medizin-Textilien - Bautextilien - Textilien für Biomedizin - Geotextilien- Textilien für Umweltschutz - Schutzbekleidung - Faserverbundwerkstoffe - Outdoor-Textilien usw
32 Faserbasierte Produktenwicklungen Kostengünstige Carbonfasern aus nachwachsenden Rohstoffen Energieunabhängiges Gebäude mit flexiblen solarthermischen 3D-Textilkollektoren Endkonturnahe 3D-Textilien für Faserverbundbauteile 34 34
33 Textilien für die Medizin Schläuche - Gefäßprothesen - Trachea, Oesophagus Separation Dura Patches Occluder Wundheilung Verbandsmaterial Nahtmaterial Verstärkung Osteosynthese Sehnen Herniennetze Trägermaterialien Tissue Engineering Drug Delivery Diagnostische Systeme Smart Textiles 35 35
34 Die Zukunft ist Textil 36
35 Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie Technik, Wissen und Bildung für den Menschen
36 Forschungsbereiche des IGVP Biologisch-medizinische Grenzflächen Chemisch-physikalische Grenzflächen Grenzflächenverfahrenstechnisc he Prozesse Plasmatechnologie Mikrowellentechnologie Plasmadynamik und -diagnostik Fraunhofer IGB Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 38
37 Chemisch-physikalische Grenzflächen Kompositmaterialien, Hybridmaterialien, auch in ionischen Flüssigkeiten Biomaterialien und Nanobiomaterialien und die Interaktion mit Zellen Nano- und mikrostrukturierte (bio-)funktionale Oberflächen Biomimetische Funktionsschichten für Medizin und Biotechnik Kern-Schale-Nano- und Mikropartikel, insbesondere mit biomimetischer Schale Verfahren zur Dispersion von Nanomaterialien Aufbau von künstlichen Geweben (Bioprinting) 3D Tissue Engineering Aufbau vaskularisierter Gewebe Gewebespezifische Bioreaktorentwicklung Fraunhofer IGB Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 39 Isotherme Durchflusskalorimetrie
38 SynElast Desmosin- und Elastin-Mimetika Di- und tetrafunktionelle Quervernetzer auf Basis von Pyridin, vergleichbar mit Desmosin Wasserlösliche und seitengruppenfunktionalisierte Polymerrückgrate auf Basis von PEG Synthetisches Polymer Elastinmimetika Desmosinmimetikum R m 2 R o R p N R i R m 6 R o Mechanische Eigenschaften einstellbar über Vernetzungsgrad Wahl von Polymer und Vernetzer Quellvermögen Laufzeit: 08/ /2012 Wasserlöslichkeit Funktionelle Gruppen für Quervernetzung Fraunhofer IGB Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 40
39 Biologisch-medizinische Grenzflächen Identifizierung von Biomarkern Enzym- und Mikroorganismen-Screening Microarray-Technologien für Diagnostik und biomedizinische Forschung Wechselwirkungen von Mikroorganismen mit Oberflächen Wirt-Pathogen-Interaktionen (Viren, Bakterien, Pilze) Virus-basierte Therapien Synthetische Biologie Entwicklung von zellbasierten Assays und 3D Gewebemodellen Zellfreie Proteinsynthese Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 41
40 Microarraytechnologien und Diagnostik»Komplettes Labor auf wenigen Quadratzentimetern«Fungal Yeast Identification FYI-Chip Komplette Analyse im Minilabor anvisiert, Größe 25 mm x 75 mm Nachweis aller klinisch relevanten Hefe- und Schimmelpilzerreger Nachweis relevanter Resistenzen Forschungsschwerpunkte IGVP: Entwicklung diagnostischer DNA- Microarrays für Lab-on-Chip-Systeme Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 42
41 Plasmatechnologie Entwurf und Entwicklung linear ausgedehnter und großflächiger Plasmaquellen bei Nieder- und Atmosphärendruck Mikroplasmen Plasmabeschichtung und Oberflächenfunktionalisierung Plasmadiagnostik und Plasmacharakterisierung Modellierung und Simulation der Plasmen Untersuchungen zur Plasmaphysik und Plasmachemie Entwicklung von Plasmaprozessen für industrielle Anwendungen Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 43
42 Optimierung der Gasausnutzung bei Atmosphärendruck-Plasmaprozessen Atmosphärendruck-Plasmatechnologie für die Oberflächenbehandlungen und -beschichtungen Minimierung des Gaseinsatzes und Maximierung der Precursorenausnutzung Forschungsschwerpunkte IGVP: Mikrowellen-Plasmabrennergeometrien Modellierung der Mikrowellenfeldverteilungen Modellierung des Gasmanagements Verdampfung von Partikeln für chemische Hochrateprozesse Universität Stuttgart Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie IGVP 44
43 HERZLICH WILLKOMMEN Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB Fraunhofer IGB
44 Kernkompetenzen / Abteilungen Fraunhofer IGB Grenzflächentechnologie und Materialwissenschaften Grenzflächen Partikel Membranen Plasmatechnologie Umweltbiotechnologie und Bioverfahrenstechnik Bioenergie und Bioprozesstechnik Algentechnologie Integriertes Wassermanagement Grenzflächenbiologie und Hygiene Molekulare Biotechnologie Funktionale Genomanalysen Infektionsbiologie und Arraytechnologie Molekulare Zell-technologien Enzym-, Stamm- und Prozessentwicklung Zell- und Tissue Engineering In-vitro-Testsysteme Zell-Material-Interaktionen, Biomaterialien Kardiovaskuläres Tissue Engineering Implantate Organ-on-a-Chip Physikalische Prozesstechnik Wärme- und Sorptionsprozesse Elektrophysikalische Prozesse Komponenten- und Systementwicklung für aseptische Prozesse
45 Grenzflächentechnologie und Materialwissenschaft Ultradünne Schichten Molekular definierte und schaltbare Oberflächen, Molekulares Prägen Biomimetische und biofunktionale Grenzflächen, Nanobiotechnologie Nanopartikel, Nanotubes, NANOCYTES Organische und anorganische Trennmembranen Grenzflächenanalytik Plasmaverfahrenstechnik Fraunhofer IGB
46 Forschungshighlights aus dem Fraunhofer IGB Gesundheit Chemie und Prozessindustrie Umwelt und Energie Zellfreie»Off-the-shelf«- Herzklappe aus elektrogesponnenen Fasern. RIBOLUTION Plattform zur Identifizierung ncrna-basierter Diagnostika. Anti-Eis-Beschichtung zur Reduzierung der Eishaftung um mehr als 90 %. Polymere Adsorber-partikel für die selektive Abtrennung oder Aufkonzentrierung. Toxikomb Gefahrstoff-detektion in Trinkwasser. Molecular Sorting Rückgewinnung von Metallen. Suche nach Immun-modulatoren mit zellbasiertem TLR-Screening- Assay. BioSurf Neue Produktions-methoden für Biotenside. Membran für die Energieumwandlung durch Osmose. Fraunhofer-Leitprojekt»Zellfreie Bioproduktion«. Lignocellulose-Bioraffinerie Erfolgreiche Umsetzung in den Pilotmaßstab. Stärke aus Mikroalgen Rohstoff zur Herstellung von Biokraftstoffen. Fraunhofer IGB
47 Universität Stuttgart
48 Vertiefung Material [330] Ausgewählte Themen der Physikalischen Chemie [69110] 6 LP 3. Sem. Einführung Materialwissenschaft II [69100] 6 LP 4. Sem. Physikalische Materialeigenschaften [68850] 6 LP oder Strukturanalyse und Materialmikroskopie [68880] 6 LP 5. Sem. Semesterarbeit 5. Sem. Praktikum Materialwissenschaft für Nebenfach-Studierende [69090] 3 LP 6. Sem. Bachelorarbeit 6. Sem.
49 3. Sem. (WiSe) Ausgewählte Themen der Physikalischen Chemie Prof. Frank Gießelmann Institut für Physikalische Chemie Lernziele: Die Studierenden verstehen an ausgewählten Beispielen die Arbeitsweise und die Konzepte der Physikalischen Chemie können Modelle und Gesetze der Physikalischen Chemie zur Lösung ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen anwenden können physikalisch-chemische Messungen durchführen und deren Ergebnisse mit den Methoden der Physikalischen Chemie analysieren
50 Inhalte der Vorlesung Ausgewählte Themen der Physikalischen Chemie Thermodynamik von Festkörpern Thermodynamische Potentiale, Flüsse, Kräfte und Suszeptibilitäten, elastische, elektrische und magnetische Arbeit, thermodynamische Behandlung des elastischen Festkörpers im elektrischen Feld, Phasenumwandlungen erster und zweiter Ordnung, kritisches Verhalten, Landau-Regeln Dielektrische und optische Eigenschaften Polarisierbarkeit und Dipolmoment, induzierte Polarisation (inneres Feld, Clausius- Mosotti-Beziehung, Debye-Gleichung), Dispersion und Absorption (quasielastisch gebundenes Elektron, Debye-Relaxation, Orientierungs-, Atom- und elektronische Polarisation, dielektrische Spektroskopie, Kramers-Kronig-Relation), spontane Polarisation (Piezo-, Pyro- und Ferroelektrika, Landau-Theorie ferroelektrischer Phasenumwandlungen) Grenzflächen und Kolloide Thermodynamik der Grenzflächen, Oberflächenspannung, Kontaktwinkel und Benetzung, zweidimensionale Oberflächenfilme, Mizellbildung, kolloiddisperse Systeme, Adsorption an Festkörperoberflächen (Physi- und Chemisorption, Langmuir-, Freundlich- und BET- Isothermen, isostere Adsorptionsenthalpie)
51 4. Sem. (SoSe) Einführung Materialwissenschaft II Ralf Schacherl Marc Widenmeyer Prof. Anke Weidenkaff Institut für Materialwissenschaft Lernziele: Die Studierenden verstehen Konzepte des Aufbaus von Festkörpern sowie deren Eigenschaften beherrschen das Lesen und die Anwendung von binären Phasendiagrammen können Eigenschaften und Eigenschaftsänderungen in Beziehung zur Konstitution und zu Phasenumwandlungsvorgängen in behandelten Materialsystemen betrachten und beurteilen verstehen grundlegende Mechanismen, welche Materialeigenschaften auf mikrostruktureller und atomistischer Skala beeinflussen, auf einer phänomenologischen Basis Können über Grundbegriffe von Materialeigenschaften u. -herstellung kommunizieren.
52 Inhalte der Vorlesung Einführung Materialwissenschaft II Atomarer Transport Generische Lösungen der Fick schen Gleichungen, Ionenleitung, Elektrotransport Phasenumwandlungen homogene Keimbildung, Erstarrungsreaktionen, Ausscheidungsreaktionen, spinodale Entmischung Metallische Werkstoffe Fe-C Zustandsdiagramme und Mikrostruktur von Fe-C Legierungen Snoek-Effekt; Ledeburit-, Perlitt-, Sorbit-, Trostit-Gefuege; Zwischenstufengefuege, Martensit; Isothermes ZTU Diagramm; Phasenumwandlungen in Al-Cu Legierungen Hybridmaterialien Materialien in der Anwendung
53 5. Sem. (WiSe) Strukturanalyse und Materialmikroskopie Prof. Dr. Guido Schmitz Institut für Materialwissenschaft Lernziele: Die Studierenden können Phasendiagramme physikalisch begründen können Leitfähigkeit und Magnetismus mittels Kontinuums-Modellen beschreiben können Aspekte mechanischen Verhaltens voneinander abgrenzen und erklären können strukturelle Ursachen makroskopischer Verformung erklären verstehen die grundlegenden Strategien zur Härtung von Materialien. kennen Fragestellungen aktueller wissenschaftlicher Forschung in der Mechanik nanoskalierter Materialien
54 Inhalte der Vorlesung Strukturanalyse und Materialmikroskopie Thermodynamik und physikalische Ableitung von binären Phasendiagrammen, Theorie des mittleren Feldes und reguläre Lösungsmodelle Wärmeleitungsgleichung und Ficksche Gleichungen, ihre mathematischen Lösungsverfahren und typische Lösungen, Statistische Deutung der Diffusion Drude Modell der elektronischen Leitung, Einführung in die Bändervorstellung Dia, Para- und Ferromagnetismus, Grundzüge ihrer physikalischen Beschreibung, Magnetisierungskurven, Hysterese, Koerzitivfeldstärke Phänomenologie mechanischer Eigenschaften: Elastizität, Anelastizität, Pseudoelastitizität, Viskosität, Plastizität, Härte, Zähigkeit, Ermüdung, Bruch Mechanische Prüfverfahren Elastizitätstheorie: Spannung, Verzerrung, Elastische Moduli, Tensorformalismus Messung elastischer Moduli Energie- und Entropie-Elastizität Plastische Verformung und Versetzungen Grundzüge der Versetzungstheorie Prinzipien des mechanischen Materialdesigns Materialversagen durch Bruch, Fraktographie Materialermüdung unter Wechselbelastung Mechanische Eigenschaften Nanostrukturierter Materialien Prinzipien der Materialauswahl
55 5. Sem. (WiSe) Physikalische Materialeigenschaften Prof. Dr. Guido Schmitz Institut für Materialwissenschaft Lernziele: Die Studierenden kennen Methoden zur Bestimmung der Mikrostruktur von Materialien verstehen den Aufbau und die Funktionsweise eines Lichtmikroskops können die Grundzüge der Wellenoptik und gängige Beugungsverfahren erläutern können einfache Diffraktogramme interpretieren kennen den Aufbau eines Raster- und Transmissions-Elektronenmikroskops können die Funktionsprinzipen der Atomsondentomographie und der Rastersondenmikroskopie erklären
56 Inhalte der Vorlesung Physikalische Materialeigenschaften Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung Quantitative Metallographie Grundzüge der Strahlenoptik, Linsen und Linsenfehler Aufbau eines Lichtmikroskops, Prinzip des Phasenkontrasts und der konfokalen Mikroskopie Grundzüge der Wellenoptik, Beugung und Abbildung Verfahren und Kontraste der Röntgen und Neutronenbeugung Symmetrie von Kristallen, Punktgruppensymmetrie (Hermann-Mauguin-Symbolik), Translationsymmetrie/Bravaisgitter, Raumgruppen, Kristallklassen, Reziproker Raum, Laue-Klassen Umgang mit Kristallstrukturinformationen, Datenbanken Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie, Grundlegende Kontrastverfahren der Transmissionsmikroskopie und Interpretation der Abbildungen Analytische Elektronenmikroskopie Atomsondentomographie Rastersondenmikroskopien
57 6. Sem. (SoSe) Praktikum Materialwissenschaft für Nebenfach-Studierende Prof. Joachim Bill Prof. Michael Buchmeiser Prof. Sabine Ludwigs Prof. Dr. Guido Schmitz Prof. Anke Weidenkaff Lernziele: Die Studierenden kennen Funktionsweise und Bedienung der einschlägigen Messinstrumente können selbständig Experimente u. Versuche durchzuführen, können Messergebnisse aufbereiten, interpretieren und schriftlich darstellen, kennen grundlegende statistische Werkzeuge zur Einschätzung und Verbesserung der Messgenauigkeit
58 Inhalte des Praktikums Materialwissenschaft für Nebenfach-Studierende Durchführung von 4 Labor-Experimenten nach Wahl zur Struktur-Eigenschaftsbeziehung von Keramiken, Metallen und polymeren Werkstoffen. Im folgenden sind Beispiele möglicher Versuche angegeben Anwendung thermodynamischer Datenbanken und Modellierung von Phasendiagrammen Untersuchung der Gefügeumwandlungen in Fe-C Legierungen Messung des Spannungsdehnungsverhaltens von fcc Metallen Kaltverformung, Erholung und Rekristallisation von Aluminium Sinterversuch/Dilatometrie Gefriergießen Herstellung von Polystyrol über freie radikalische Polymerisation & Herstellung eines Polyurethans über eine Polyadditionsreaktion Bestimmung des Molekulargewichtes und seiner Verteilung mittels Gelpermeationschromatographie (GPC) Untersuchung der thermischen Eigenschaften von Polymeren mittels Wärmeflusskalorimetrie (DSC)
59 Voraussetzungen Interesse in den folgenden Fächern: Physik Chemie Biologie Mathematik Englisch Motivation
60 B.Sc. Chemie- und Bioingenieurwesen Vertiefung Material Prof. Dr. habil. Günter Tovar
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Metalle. Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen. Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont
 Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont überarbeitet 2006. Buch. xi, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 540 34010 2 Format (B x L): 15,5
Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont überarbeitet 2006. Buch. xi, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 540 34010 2 Format (B x L): 15,5
MODUL 6: Grundlagen und Theorie
 Wahlfachkatalog Materialwissenschaften 36 ECTS MODUL 6: Grundlagen und Theorie 85.5 ECTS MODUL 7: Modellierung und Simulation 82.8 ECTS MODUL 8: Materialcharakterisierung 78.0 ECTS MODUL 9: Struktur- und
Wahlfachkatalog Materialwissenschaften 36 ECTS MODUL 6: Grundlagen und Theorie 85.5 ECTS MODUL 7: Modellierung und Simulation 82.8 ECTS MODUL 8: Materialcharakterisierung 78.0 ECTS MODUL 9: Struktur- und
Unternehmenscamp F 11
 Unternehmenscamp F 11 04. Mai 2012 Beginn: 10:00 Uhr BayKomm, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen Ein Gemeinschaftsprojekt von gefördert durch 1 Mit der in Leverkusen angesiedelten Fakultät für Angewandte
Unternehmenscamp F 11 04. Mai 2012 Beginn: 10:00 Uhr BayKomm, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen Ein Gemeinschaftsprojekt von gefördert durch 1 Mit der in Leverkusen angesiedelten Fakultät für Angewandte
Vom Molekül zum Material
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Chemie Abteilung Anorganische Festkörperchemie Vorlesung CH23 Anorganische Chemie V-A Vom Molekül zum Material 1 Materialien - Werkstoffe Ein Werkstoff
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Chemie Abteilung Anorganische Festkörperchemie Vorlesung CH23 Anorganische Chemie V-A Vom Molekül zum Material 1 Materialien - Werkstoffe Ein Werkstoff
Universitätsstadt Erlangen
 Universitätsstadt Erlangen ca. 100 000 Einwohner ca. 26 000 Studenten 20 km nördlich von Nürnberg 50 km südlich von Bamberg Erlangen - Mittelfranken Dürerstadt Nürnberg Christkindlesmarkt Franken-Jura
Universitätsstadt Erlangen ca. 100 000 Einwohner ca. 26 000 Studenten 20 km nördlich von Nürnberg 50 km südlich von Bamberg Erlangen - Mittelfranken Dürerstadt Nürnberg Christkindlesmarkt Franken-Jura
Begrüßungsveranstaltung SS Erstsemester Studiengang Verfahrenstechnik Master of Science
 15.04.2016 1 Begrüßungsveranstaltung SS 2016 Erstsemester Studiengang Verfahrenstechnik Master of Science Fakultät für Energie-, Verfahrens- und Biotechnik (Fakultät 04) Studiendekan Verfahrenstechnik
15.04.2016 1 Begrüßungsveranstaltung SS 2016 Erstsemester Studiengang Verfahrenstechnik Master of Science Fakultät für Energie-, Verfahrens- und Biotechnik (Fakultät 04) Studiendekan Verfahrenstechnik
Methoden. Spektroskopische Verfahren. Mikroskopische Verfahren. Streuverfahren. Kalorimetrische Verfahren
 Methoden Spektroskopische Verfahren Mikroskopische Verfahren Streuverfahren Kalorimetrische Verfahren Literatur D. Haarer, H.W. Spiess (Hrsg.): Spektroskopie amorpher und kristalliner Festkörper Steinkopf
Methoden Spektroskopische Verfahren Mikroskopische Verfahren Streuverfahren Kalorimetrische Verfahren Literatur D. Haarer, H.W. Spiess (Hrsg.): Spektroskopie amorpher und kristalliner Festkörper Steinkopf
BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS. Jan SWITTEN 2014
 BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS Jan SWITTEN 2014 1 Was sind Biokunststoffe Definition European Bioplastics Kunststoffe entstanden aus nachwachsenden Rohstoffen oder Abbaubare oder kompostierbare Kunststoffe
BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS Jan SWITTEN 2014 1 Was sind Biokunststoffe Definition European Bioplastics Kunststoffe entstanden aus nachwachsenden Rohstoffen oder Abbaubare oder kompostierbare Kunststoffe
Physikalische Chemie 1 Struktur und Materie Wintersemester 2016/17
 Physikalische Chemie 1 Struktur und Materie Wintersemester 2016/17 Vorlesung: Hörsaal 10.01 Daran anschließend Physikalische Chemie 2 (Prof. Falcaro, TU): Materie im elektr./magn. Feld, Wechselwirkungen,
Physikalische Chemie 1 Struktur und Materie Wintersemester 2016/17 Vorlesung: Hörsaal 10.01 Daran anschließend Physikalische Chemie 2 (Prof. Falcaro, TU): Materie im elektr./magn. Feld, Wechselwirkungen,
Masterstudium Technische Chemie - Synthese
 Umfassende Ausbildung in präparativer Chemie Theoretische und praktische Kenntnisse aller wichtigen Synthesemethoden auf dem Gebiet der Organischen Chemie Anorganischen Chemie Makromolekularen Chemie Charakterisierung
Umfassende Ausbildung in präparativer Chemie Theoretische und praktische Kenntnisse aller wichtigen Synthesemethoden auf dem Gebiet der Organischen Chemie Anorganischen Chemie Makromolekularen Chemie Charakterisierung
Metallkunde. E. Hornbogen, H. Warlimont. Aufbau und Eigenschaften von Metallen und Legierungen. Mit einem Beitrag von Th. Ricker
 E. Hornbogen, H. Warlimont 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Metallkunde Aufbau und Eigenschaften von
E. Hornbogen, H. Warlimont 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Metallkunde Aufbau und Eigenschaften von
Äquivalenzlisten für die Masterstudien:
 Äquivalenzlisten für die Masterstudien: 066 491 Masterstudium Technische Chemie - Synthese 066 492 Masterstudium Werkstofftechnologie u. -analytik 066 493 Masterstudium Technische Chemie - Materialchemie
Äquivalenzlisten für die Masterstudien: 066 491 Masterstudium Technische Chemie - Synthese 066 492 Masterstudium Werkstofftechnologie u. -analytik 066 493 Masterstudium Technische Chemie - Materialchemie
DEUS 21: Wasser im Kreislauf
 DEUS 21: Wasser im Kreislauf Frankfurt am Main, 18.01.2013 Dr.-Ing. Marius Mohr Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 280 Mitarbeiter Betriebshaushalt 2011 von 18 Mio Ca. 7200
DEUS 21: Wasser im Kreislauf Frankfurt am Main, 18.01.2013 Dr.-Ing. Marius Mohr Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 280 Mitarbeiter Betriebshaushalt 2011 von 18 Mio Ca. 7200
Inhaltsverzeichnis. Vorwort. Wie man dieses Buch liest. Periodensystem der Elemente
 Inhaltsverzeichnis Vorwort Wie man dieses Buch liest Periodensystem der Elemente v vii xiv 1 Flüssigkristalle 1 1.1 Motivation und Phänomenologie.................. 1 1.2 Was ist ein Flüssigkristall?.....................
Inhaltsverzeichnis Vorwort Wie man dieses Buch liest Periodensystem der Elemente v vii xiv 1 Flüssigkristalle 1 1.1 Motivation und Phänomenologie.................. 1 1.2 Was ist ein Flüssigkristall?.....................
Physik für Mediziner im 1. Fachsemester
 Physik für Mediziner im 1. Fachsemester Hörsaal P Dienstag Freitag 9:00-10:00 Vladimir Dyakonov Experimentelle Physik VI dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de Ich besuche diese Vorlesung, weil... alle Wissenschaften
Physik für Mediziner im 1. Fachsemester Hörsaal P Dienstag Freitag 9:00-10:00 Vladimir Dyakonov Experimentelle Physik VI dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de Ich besuche diese Vorlesung, weil... alle Wissenschaften
Schwerpunkt 36: Polymer-Engineering
 Schwerpunkt 36: Polymer-Engineering Werkstoffkunde (WK) INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MATERIALIEN - WERKSTOFFKUNDE IAM-WK KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der
Schwerpunkt 36: Polymer-Engineering Werkstoffkunde (WK) INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MATERIALIEN - WERKSTOFFKUNDE IAM-WK KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der
Werkstoffe des Maschinenbaus MIT-Wahlpflichtmodul B-PM1
 Werkstoffe des Maschinenbaus MIT-Wahlpflichtmodul B-PM1 Johannes Schneider Institut für Angewandte Materialien Computational Materials Science () INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MATERIALIEN - COMPUTATIONAL MATERIALS
Werkstoffe des Maschinenbaus MIT-Wahlpflichtmodul B-PM1 Johannes Schneider Institut für Angewandte Materialien Computational Materials Science () INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MATERIALIEN - COMPUTATIONAL MATERIALS
61 Bachelorstudiengang Industrial Materials Engineering
 61 Bachelorstudiengang Industrial Materials Engineering (1) Im Studiengang Industrial Materials Engineering umfasst das Grundstudium zwei Lehrplansemester, das Hauptstudium fünf Lehrplansemester. () Der
61 Bachelorstudiengang Industrial Materials Engineering (1) Im Studiengang Industrial Materials Engineering umfasst das Grundstudium zwei Lehrplansemester, das Hauptstudium fünf Lehrplansemester. () Der
Studienplan. Im einzelnen bedeuten
 1 Studienplan Im einzelnen bedeuten Stoffgebiet des Studiums der Pharmazie nach Anlage 1 [zu 2 (2)] der AAppO*): A B C D E F G H I K Allgemeine Chemie der Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe Pharmazeutische
1 Studienplan Im einzelnen bedeuten Stoffgebiet des Studiums der Pharmazie nach Anlage 1 [zu 2 (2)] der AAppO*): A B C D E F G H I K Allgemeine Chemie der Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe Pharmazeutische
Formen aktiver Teilnahme. Bearbeitung von Übungsaufgaben, Diskussionsbeiträge
 3c Chemie Modul: Grundlagen der Organische Chemie Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten sind mit den Grundlagen der Organischen Chemie vertraut. Sie besitzen Kenntnisse über Nomenklatur,
3c Chemie Modul: Grundlagen der Organische Chemie Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten sind mit den Grundlagen der Organischen Chemie vertraut. Sie besitzen Kenntnisse über Nomenklatur,
Fakultät für Chemie Universität Duisburg-Essen. Prof. Dr. Carsten Schmuck Dekan der Fakultät (Version: Januar 2016)
 Universität Duisburg-Essen Prof. Dr. Carsten Schmuck Dekan der Fakultät (Version: Januar 2016) Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Fakultät für Chemie Übersicht Kennzahlen / Kurzporträt Struktur
Universität Duisburg-Essen Prof. Dr. Carsten Schmuck Dekan der Fakultät (Version: Januar 2016) Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Fakultät für Chemie Übersicht Kennzahlen / Kurzporträt Struktur
Grenzflächenphänomene. Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie. J m. N m. 1. Oberflächenspannung
 Grenzflächenphänomene 1. Oberflächenspannung Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie Grenzflächenphänomene Phase/Phasendiagramm/Phasenübergang Schwerpunkte: Oberflächenspannung
Grenzflächenphänomene 1. Oberflächenspannung Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie Grenzflächenphänomene Phase/Phasendiagramm/Phasenübergang Schwerpunkte: Oberflächenspannung
Festkörperphysik. Aufgaben und Lösun
 Festkörperphysik. Aufgaben und Lösun von Prof. Dr. Rudolf Gross Dr. Achim Marx Priv.-Doz. Dr. Dietrich Einzel Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Kristallstruktur 1 ALI Tetraederwinkel
Festkörperphysik. Aufgaben und Lösun von Prof. Dr. Rudolf Gross Dr. Achim Marx Priv.-Doz. Dr. Dietrich Einzel Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Kristallstruktur 1 ALI Tetraederwinkel
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)
 Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Engineering Science. mit den Schwerpunkten Biologische und chemische Verfahrenstechnik, Energie- und Umwelttechnik und Mechatronik und Automotive
 Studienplan für den Bachelorstudiengang Engineering Science mit den Schwerpunkten Biologische und chemische Verfahrenstechnik, Energie- und Umwelttechnik und Mechatronik und Automotive an der Fakultät
Studienplan für den Bachelorstudiengang Engineering Science mit den Schwerpunkten Biologische und chemische Verfahrenstechnik, Energie- und Umwelttechnik und Mechatronik und Automotive an der Fakultät
Kernlehrpläne ab Schuljahr 2014/15 Schuleigener Lehrplan / FMG / Sekundarstufe II CHEMIE
 CHEMIE QUALIFIKATIONSSPHASE 2 LEISTUNGSKURS Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Vom fossilen Rohstoff zum Anwendungsprodukt Organische Reaktionsabläufe Oxidationsreihe der Alkohole
CHEMIE QUALIFIKATIONSSPHASE 2 LEISTUNGSKURS Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Vom fossilen Rohstoff zum Anwendungsprodukt Organische Reaktionsabläufe Oxidationsreihe der Alkohole
WERK. Werkstofftechnik Grundlagen. Diese Unterlagen dienen gemäß 53, 54 URG ausschließlich der Ausbildung an der Hochschule Bremen.
 WERK Werkstofftechnik Grundlagen Diese Unterlagen dienen gemäß 53, 54 URG ausschließlich der Ausbildung an der Hochschule Bremen. M + ENTEC - Vorlesung im SS - Klausur am Ende des SS - Klausurteilnahme
WERK Werkstofftechnik Grundlagen Diese Unterlagen dienen gemäß 53, 54 URG ausschließlich der Ausbildung an der Hochschule Bremen. M + ENTEC - Vorlesung im SS - Klausur am Ende des SS - Klausurteilnahme
Plasmatechnologie für Medizin und Pharmazie
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/plasmatechnologie-fuermedizin-und-pharmazie/ Plasmatechnologie für Medizin und Pharmazie In der Medizin kommen häufig
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/plasmatechnologie-fuermedizin-und-pharmazie/ Plasmatechnologie für Medizin und Pharmazie In der Medizin kommen häufig
Klein aber oho. Quelle/Publication: Farbe und Lack Ausgabe/Issue: 10/2010 Seite/Page: 1
 Seite/Page: 1 Klein aber oho Mit dem Einsatz von Nanotechnologie haben Forscher in der Lackindustrie in den letzten Jahren neue Entwicklungen und Anwendungsfelder von Lacksystemen entdeckt. Die Verwendung
Seite/Page: 1 Klein aber oho Mit dem Einsatz von Nanotechnologie haben Forscher in der Lackindustrie in den letzten Jahren neue Entwicklungen und Anwendungsfelder von Lacksystemen entdeckt. Die Verwendung
Kompetenzfeld Nanotechnologie / Grenzflächenverfahrenstechnik Prof. Dr. Günter Tovar / Prof. Dr. Thomas Hirth
 Bachelorstudiengang Medizintechnik Kompetenzfeld Nanotechnologie / Grenzflächenverfahrenstechnik Prof. Dr. Günter Tovar / Prof. Dr. Thomas Hirth Berufsfeld: Was kann ich später damit machen? Therapie Geräte
Bachelorstudiengang Medizintechnik Kompetenzfeld Nanotechnologie / Grenzflächenverfahrenstechnik Prof. Dr. Günter Tovar / Prof. Dr. Thomas Hirth Berufsfeld: Was kann ich später damit machen? Therapie Geräte
Erkläre was in dieser Phase des Erstarrungsprozesses geschieht. 1) Benenne diesen Gittertyp. 2) Nenne typische Werkstoffe und Eigenschaften.
 Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre die Bindungsart der Atome 1) Benenne diesen Gittertyp. 2) Nenne typische Werkstoffe und Eigenschaften. 1) Benenne diesen Gittertyp.
Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre die Bindungsart der Atome 1) Benenne diesen Gittertyp. 2) Nenne typische Werkstoffe und Eigenschaften. 1) Benenne diesen Gittertyp.
Anlage zur Studienordnung des Studienganges Master of Science Biochemie, Schwerpunkt Biomedizin Studienablaufplan/ Modulübersichtstabelle
 Master of Science Biochemie, Schwerpunkt Biomedizin (Seite 1 von 5) Anlage zur Studienordnung des Studienganges Master of Science Biochemie, Schwerpunkt Biomedizin Studienablaufplan/ Modulübersichtstabelle
Master of Science Biochemie, Schwerpunkt Biomedizin (Seite 1 von 5) Anlage zur Studienordnung des Studienganges Master of Science Biochemie, Schwerpunkt Biomedizin Studienablaufplan/ Modulübersichtstabelle
Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie
 Hans Fischer, Hansgeorg Hofmann, Jürgen Spindler Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie ISBN-10: 3-446-40707-3 ISBN-13: 978-3-446-40707-7
Hans Fischer, Hansgeorg Hofmann, Jürgen Spindler Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie ISBN-10: 3-446-40707-3 ISBN-13: 978-3-446-40707-7
MA-CH-MRBO 04. Biophysikalische Chemie A: Methoden
 MA-CH-MRBO 04 Biophysikalische Chemie A: Methoden Prof. M. Stamm (IPF)/Prof. Arndt (PC) 5 CP, 3 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar/Praktikum Modulbeschreibung Das Modul vermittelt Kenntnisse zum Stand der biophysikalischchemischen
MA-CH-MRBO 04 Biophysikalische Chemie A: Methoden Prof. M. Stamm (IPF)/Prof. Arndt (PC) 5 CP, 3 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar/Praktikum Modulbeschreibung Das Modul vermittelt Kenntnisse zum Stand der biophysikalischchemischen
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
 DIE ATTRAKTIVSTEN ARBEITGEBER FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS WISSEN SCHAFFT ZUKUNFT DEINE KARRIERE MIT FRAUNHOFER IN STUTTGART VIER FORSCHUNGSINSTITUTE AN EINEM
DIE ATTRAKTIVSTEN ARBEITGEBER FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS WISSEN SCHAFFT ZUKUNFT DEINE KARRIERE MIT FRAUNHOFER IN STUTTGART VIER FORSCHUNGSINSTITUTE AN EINEM
Elektrische und magnetische Materialeigenschaften
 Die elektrischen Eigenschaften von Dielektrika und Paraelektrika sind keine speziellen Eigenschaften fester oder kristalliner Substanzen. So sind diese Eigenschaften z.b. auch in Molekülen und Flüssigkeiten
Die elektrischen Eigenschaften von Dielektrika und Paraelektrika sind keine speziellen Eigenschaften fester oder kristalliner Substanzen. So sind diese Eigenschaften z.b. auch in Molekülen und Flüssigkeiten
Methoden. Spektroskopische Verfahren. Mikroskopische Verfahren. Streuverfahren. Kalorimetrische Verfahren
 Methoden Spektroskopische Verfahren Mikroskopische Verfahren Streuverfahren Kalorimetrische Verfahren Literatur D. Haarer, H.W. Spiess (Hrsg.): Spektroskopie amorpher und kristtiner Festkörper Steinkopf
Methoden Spektroskopische Verfahren Mikroskopische Verfahren Streuverfahren Kalorimetrische Verfahren Literatur D. Haarer, H.W. Spiess (Hrsg.): Spektroskopie amorpher und kristtiner Festkörper Steinkopf
Bernd Tieke. Makromolekulare Chemie. Eine Einführung. Dritte Auflage. 0 0 l-u: U. WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
 Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung Dritte Auflage 0 0 l-u: U WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur dritten
Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung Dritte Auflage 0 0 l-u: U WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur dritten
Der neue Lehrplan für Realschulen Das Grundwissen im Fach Physik I und II/III
 Der neue Lehrplan für Realschulen Das Grundwissen im Fach Physik I und II/III (c) 2001 ISB Abt. Realschule Referat M/Ph/TZ Jahrgangsstufen übergreifendes Grundwissen Fähigkeit, Phänomene und Vorgänge unter
Der neue Lehrplan für Realschulen Das Grundwissen im Fach Physik I und II/III (c) 2001 ISB Abt. Realschule Referat M/Ph/TZ Jahrgangsstufen übergreifendes Grundwissen Fähigkeit, Phänomene und Vorgänge unter
Übergangsbestimmungen und Äquivalenzlisten für die Masterstudien:
 Übergangsbestimmungen und Äquivalenzlisten für die Masterstudien: 066 491 Masterstudium Technische Chemie - Synthese 066 492 Masterstudium Werkstofftechnologie u. -analytik 066 493 Masterstudium Technische
Übergangsbestimmungen und Äquivalenzlisten für die Masterstudien: 066 491 Masterstudium Technische Chemie - Synthese 066 492 Masterstudium Werkstofftechnologie u. -analytik 066 493 Masterstudium Technische
Fraunhofer IGB. Chemische Energiespeicher Katalyse und Prozess. Projektgruppe BioCat Straubing Sommersymposium am 27. Juni Dr.
 Fraunhofer IGB Projektgruppe BioCat Straubing Sommersymposium am 27. Juni 2013 Chemische Energiespeicher Katalyse und Prozess Dr. Tobias Gärtner AGENDA 1. Fraunhofer IGB 2. Kompetenzzentrum für nachwachsende
Fraunhofer IGB Projektgruppe BioCat Straubing Sommersymposium am 27. Juni 2013 Chemische Energiespeicher Katalyse und Prozess Dr. Tobias Gärtner AGENDA 1. Fraunhofer IGB 2. Kompetenzzentrum für nachwachsende
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL Modul: Versuch: Physikalische Eigenschaften I. VERSUCHSZIEL Die
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL Modul: Versuch: Physikalische Eigenschaften I. VERSUCHSZIEL Die
Bachelor-Studiengang Mechatronik und Informationstechnik (MIT) Modulvorstellung B-PE2 Bauelemente der Elektrotechnik
 Bachelor-Studiengang Mechatronik und Informationstechnik (MIT) der Fakultäten ETIT & MACH Modulvorstellung B-PE2 Bauelemente der Elektrotechnik FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK / FAKULTÄT
Bachelor-Studiengang Mechatronik und Informationstechnik (MIT) der Fakultäten ETIT & MACH Modulvorstellung B-PE2 Bauelemente der Elektrotechnik FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK / FAKULTÄT
Kantonsschule Ausserschwyz. Mathematik. Kantonsschule Ausserschwyz 83
 Kantonsschule Ausserschwyz Mathematik Kantonsschule Ausserschwyz 83 Bildungsziele Für das Grundlagenfach Die Schülerinnen und Schüler sollen über ein grundlegendes Orientierungs- und Strukturwissen in
Kantonsschule Ausserschwyz Mathematik Kantonsschule Ausserschwyz 83 Bildungsziele Für das Grundlagenfach Die Schülerinnen und Schüler sollen über ein grundlegendes Orientierungs- und Strukturwissen in
Fachgruppe Informatik. Anwendungsfächer. im Bachelor-Studiengang Informatik. Fachstudienberatung Bachelor Informatik Dr.
 Fachgruppe Informatik in der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der RWTH Aachen Einführungsveranstaltung zur Wahl der Anwendungsfächer im Bachelor-Studiengang Informatik Fachstudienberatung
Fachgruppe Informatik in der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der RWTH Aachen Einführungsveranstaltung zur Wahl der Anwendungsfächer im Bachelor-Studiengang Informatik Fachstudienberatung
Magnetische Moleküle sind die Bits von morgen aus Kunststoff?
 Magnetische Moleküle sind die Bits von morgen aus Kunststoff? Jürgen Schnack Fachbereich Physik - Universität Osnabrück http://obelix.physik.uni-osnabrueck.de/ schnack/ 25. Juni 2002 unilogo-m-rot.jpg
Magnetische Moleküle sind die Bits von morgen aus Kunststoff? Jürgen Schnack Fachbereich Physik - Universität Osnabrück http://obelix.physik.uni-osnabrueck.de/ schnack/ 25. Juni 2002 unilogo-m-rot.jpg
1.Semester Bachelor Chemie
 1.Semester Bachelor Chemie 1 Modul: 08-AC1 Anorganische Chemie 1 23 S Studentischer Arbeitsaufwand: 600 h 20 ECTS Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 1.1 Teilmodul: 08-AC1-1 Grundlagen
1.Semester Bachelor Chemie 1 Modul: 08-AC1 Anorganische Chemie 1 23 S Studentischer Arbeitsaufwand: 600 h 20 ECTS Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 1.1 Teilmodul: 08-AC1-1 Grundlagen
Gymnasium Köln-Nippes Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 8
 Fachlicher Kontext: Optik hilft dem Auge auf die Sprünge Inhaltsfeld: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichts Unterrichtswochen 6 2 fachlicher Kontext Konkretisierung Vorschlag für zentrale Versuche,
Fachlicher Kontext: Optik hilft dem Auge auf die Sprünge Inhaltsfeld: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichts Unterrichtswochen 6 2 fachlicher Kontext Konkretisierung Vorschlag für zentrale Versuche,
Physikalische Chemie II (PCII) Thermodynamik/Elektrochemie Vorlesung und Übung (LSF# & LSF#101277) - SWS: SoSe 2013
 Physikalische Chemie II (PCII) Thermodynamik/Elektrochemie Vorlesung und Übung (LSF#105129 & LSF#101277) - SWS: 4 + 2 SoSe 2013 Prof. Dr. Petra Tegeder Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Fachbereich
Physikalische Chemie II (PCII) Thermodynamik/Elektrochemie Vorlesung und Übung (LSF#105129 & LSF#101277) - SWS: 4 + 2 SoSe 2013 Prof. Dr. Petra Tegeder Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Fachbereich
Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie Von
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie Von
Physik für Ingenieure
 Physik für Ingenieure von Prof. Dr. Ulrich Hahn OldenbourgVerlag München Wien 1 Einführung 1 1.1 Wie wird das Wissen gewonnen? 2 1.1.1 Gültigkeitsbereiche physikalischer Gesetze 4 1.1.2 Prinzipien der
Physik für Ingenieure von Prof. Dr. Ulrich Hahn OldenbourgVerlag München Wien 1 Einführung 1 1.1 Wie wird das Wissen gewonnen? 2 1.1.1 Gültigkeitsbereiche physikalischer Gesetze 4 1.1.2 Prinzipien der
Projekte und Projektleiter im Forschungsprogramm Bioinspirierte Materialsynthese
 Projekte und Projektleiter im Forschungsprogramm Bioinspirierte Materialsynthese Synthetische Polymere auf der Grundlage der makromolekularen Assemblierung von Nesselkapseln bei Cnidariern (Nesseltieren)
Projekte und Projektleiter im Forschungsprogramm Bioinspirierte Materialsynthese Synthetische Polymere auf der Grundlage der makromolekularen Assemblierung von Nesselkapseln bei Cnidariern (Nesseltieren)
Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie Freising-Weihenstephan, 17. Juli 2015
 Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie Freising-Weihenstephan, 17. Juli 2015 Unser interdisziplinäres Studienangebot Studiengänge Bioprozesstechnik Brauwesen und Getränketechnologie Technologie
Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie Freising-Weihenstephan, 17. Juli 2015 Unser interdisziplinäres Studienangebot Studiengänge Bioprozesstechnik Brauwesen und Getränketechnologie Technologie
Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik
 Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Studieren! In Oldenburg!
 Studieren! In Oldenburg! 1 Warum studieren? Steigender Bedarf an akademisch gut ausgebildeten Personen Qualifizierte Ausbildung mit der Chance auf eine interessante und gut bezahlte Tätigkeit Erwerb von
Studieren! In Oldenburg! 1 Warum studieren? Steigender Bedarf an akademisch gut ausgebildeten Personen Qualifizierte Ausbildung mit der Chance auf eine interessante und gut bezahlte Tätigkeit Erwerb von
Propädeutische Physik und Chemie (2. Klasse)
 Propädeutische Physik und Chemie (2. Klasse) Stundendotation Physik und Chemie auf der Unterstufe 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse HS FS HS FS HS FS HS FS HS FS HS FS 2 2 Bildungsziele
Propädeutische Physik und Chemie (2. Klasse) Stundendotation Physik und Chemie auf der Unterstufe 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse HS FS HS FS HS FS HS FS HS FS HS FS 2 2 Bildungsziele
Grundlagenmodul Naturwissenschaften
 Grundlagenmodul Naturwissenschaften Modulverantwortlicher: Dr. Harald Kullmann Zentrum für Didaktik der Biologie Schlossplatz 34, Raum 236 Email: h.kullmann@uni muenster.de Tel.: 0251 83 39407 Sprechstunden:
Grundlagenmodul Naturwissenschaften Modulverantwortlicher: Dr. Harald Kullmann Zentrum für Didaktik der Biologie Schlossplatz 34, Raum 236 Email: h.kullmann@uni muenster.de Tel.: 0251 83 39407 Sprechstunden:
2.8.1 Modul Physik I: Dynamik der Teilchen und Teilchensysteme. Die Studiendekanin/der Studiendekan des Fachbereichs Physik.
 2.8 Nebenfach Physik 2.8.1 Modul Physik I: Dynamik der Teilchen und Teilchensysteme Status Wahlpflichtmodul. Modulverantwortliche(r) Die Studiendekanin/der Studiendekan des Fachbereichs Physik. Modulbestandteile
2.8 Nebenfach Physik 2.8.1 Modul Physik I: Dynamik der Teilchen und Teilchensysteme Status Wahlpflichtmodul. Modulverantwortliche(r) Die Studiendekanin/der Studiendekan des Fachbereichs Physik. Modulbestandteile
Life Science B.Sc. Bachelor of Science
 Life Science B.Sc. Bachelor of Science Auf einen Blick Abschluss: Bachelor of Science Studienbeginn: Wintersemester Erstsemesterplätze: 52 Lehrsprachen: Deutsch / Englisch Regelstudienzeit: 6 Semester
Life Science B.Sc. Bachelor of Science Auf einen Blick Abschluss: Bachelor of Science Studienbeginn: Wintersemester Erstsemesterplätze: 52 Lehrsprachen: Deutsch / Englisch Regelstudienzeit: 6 Semester
Einführung in Werkstoffkunde
 Einführung in Werkstoffkunde Magnesium Innovations Center (MagIC) GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH Dr.-Ing. Norbert Hort norbert.hort@gkss.de Inhalte Über mich Einführung Aufbau von Werkstoffen Physikalische
Einführung in Werkstoffkunde Magnesium Innovations Center (MagIC) GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH Dr.-Ing. Norbert Hort norbert.hort@gkss.de Inhalte Über mich Einführung Aufbau von Werkstoffen Physikalische
Laborversuche und Wahlpflichtfächer
 Laborversuche und Wahlpflichtfächer Wärmeleitung Lernziele: Verständnis und Erfahrung in Bezug auf Wärmeleitung sammeln. Ingenieurtechnisches Gespür für Größenordnungen und den Einfluss der Parameter entwickeln.
Laborversuche und Wahlpflichtfächer Wärmeleitung Lernziele: Verständnis und Erfahrung in Bezug auf Wärmeleitung sammeln. Ingenieurtechnisches Gespür für Größenordnungen und den Einfluss der Parameter entwickeln.
Inhalt. Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii
 Inhalt Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii 1 Phänomenologische Thermodynamik 1 1.1 Die grundlegenden Größen und Konzepte 1 1.1.1 Reduktion des Systems auf wenige ausgewählte Zustandsgrößen
Inhalt Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii 1 Phänomenologische Thermodynamik 1 1.1 Die grundlegenden Größen und Konzepte 1 1.1.1 Reduktion des Systems auf wenige ausgewählte Zustandsgrößen
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Chemische Technologie ICT Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen Vor dem Hintergrund einer rasant wachsenden Weltbevölkerung und knapper werdender
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Chemische Technologie ICT Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen Vor dem Hintergrund einer rasant wachsenden Weltbevölkerung und knapper werdender
Nanostrukturierte thermoelektrische Materialien
 Abschließende Ergebnisse im Projektverbund Umweltverträgliche Anwendungen der Nanotechnologie 3rd International Congress Next Generation Solar Energy Meets Nanotechnology 23-25 November 2016, Erlangen
Abschließende Ergebnisse im Projektverbund Umweltverträgliche Anwendungen der Nanotechnologie 3rd International Congress Next Generation Solar Energy Meets Nanotechnology 23-25 November 2016, Erlangen
Biotechnologie und chemische Verfahrenstechnik
 Studienplan für den Masterstudiengang Biotechnologie und chemische Verfahrenstechnik mit den Vertiefungsrichtungen Chemische Verfahrenstechnik, Bioinspirierte Materialien und Bioprozesstechnik an der Fakultät
Studienplan für den Masterstudiengang Biotechnologie und chemische Verfahrenstechnik mit den Vertiefungsrichtungen Chemische Verfahrenstechnik, Bioinspirierte Materialien und Bioprozesstechnik an der Fakultät
Daten der schriftlichen Modulprüfungen Herbstsemester 2015, Frühjahrssemester 2016 und der Repetitionsprüfungen
 Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät Studiendekanat Daten der schriftlichen Modulprüfungen Herbstsemester 2015, Frühjahrssemester 2016 und der Repetitionsprüfungen Modul Datum Modulprüfung Datum
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät Studiendekanat Daten der schriftlichen Modulprüfungen Herbstsemester 2015, Frühjahrssemester 2016 und der Repetitionsprüfungen Modul Datum Modulprüfung Datum
Teil 3: Verfahrenstechnik ist eine Wissenschaft
 GVC: Gesellschaft für und Chemieingenieurwesen Teil 3: ist eine Wissenschaft 1 GVC: Gesellschaft für und Chemieingenieurwesen GVC: Gesellschaft für und Chemieingenieurwesen Rohstoffe GVC: Gesellschaft
GVC: Gesellschaft für und Chemieingenieurwesen Teil 3: ist eine Wissenschaft 1 GVC: Gesellschaft für und Chemieingenieurwesen GVC: Gesellschaft für und Chemieingenieurwesen Rohstoffe GVC: Gesellschaft
Vom Molekül zum Material. Thema heute: Nanostrukturierte Materialien
 Vorlesung Anorganische Chemie V-A Vom Molekül zum Material Thema heute: Nanostrukturierte Materialien 17 Ansichten der Natur 18 Ansichten der Natur 19 Ansichten der Natur 20 Selbstreinigungseffekt Kleine
Vorlesung Anorganische Chemie V-A Vom Molekül zum Material Thema heute: Nanostrukturierte Materialien 17 Ansichten der Natur 18 Ansichten der Natur 19 Ansichten der Natur 20 Selbstreinigungseffekt Kleine
Physik für Mediziner Technische Universität Dresden
 Technische Universität Dresden Inhalt Manuskript: Prof. Dr. rer. nat. habil. Birgit Dörschel Inst. für Strahlenschutzphysik WS 2005/06: PD Dr. rer. nat. habil. Michael Lehmann Inst. für Strukturphysik
Technische Universität Dresden Inhalt Manuskript: Prof. Dr. rer. nat. habil. Birgit Dörschel Inst. für Strahlenschutzphysik WS 2005/06: PD Dr. rer. nat. habil. Michael Lehmann Inst. für Strukturphysik
UNIVERSITÄT ZU KÖLN INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE LEHRSTUHL I UND II
 UNIVERSITÄT ZU KÖLN INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE LEHRSTUHL I UND II Für das Sommersemester 2003 kündigen wir an: 6361 "Rechtskunde für Studierende der Chemie" Responsible Care: Umwelt Sicherheit -
UNIVERSITÄT ZU KÖLN INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE LEHRSTUHL I UND II Für das Sommersemester 2003 kündigen wir an: 6361 "Rechtskunde für Studierende der Chemie" Responsible Care: Umwelt Sicherheit -
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik
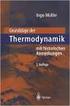 Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Materialklassen. Keramiken / Gläser. Polymere. Cu-, Al-, Ti-, Zn-, Mg- Legierungen, Stähle, Superlegierungen, Metall- Metall-Verbund
 E. Arzt, UdS/INM 2015 Materialklassen M e t a l l e Cu-, Al-, Ti-, Zn-, Mg- Legierungen, Stähle, Superlegierungen, Metall- Metall-Verbund Hochleistungskeramik, Zement, Beton, Porzellan, Fensterglas, Kera-
E. Arzt, UdS/INM 2015 Materialklassen M e t a l l e Cu-, Al-, Ti-, Zn-, Mg- Legierungen, Stähle, Superlegierungen, Metall- Metall-Verbund Hochleistungskeramik, Zement, Beton, Porzellan, Fensterglas, Kera-
Bachelorstudiengang Medizintechnik. Kompetenzfeld Nanotechnologie / Grenzflächenverfahrenstechnik
 Bachelorstudiengang Medizintechnik Kompetenzfeld Nanotechnologie / Grenzflächenverfahrenstechnik Berufsfeld: Was kann ich später damit machen? Therapie Geräte Diagnostik Forschung und Entwicklung Module
Bachelorstudiengang Medizintechnik Kompetenzfeld Nanotechnologie / Grenzflächenverfahrenstechnik Berufsfeld: Was kann ich später damit machen? Therapie Geräte Diagnostik Forschung und Entwicklung Module
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur. Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités)
 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums
 Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums Zentrale Inhalte in Klasse 9 1. Inhaltsfeld: Elektrizität Schwerpunkte: Elektrische Quelle und elektrischer Verbraucher Einführung von
Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums Zentrale Inhalte in Klasse 9 1. Inhaltsfeld: Elektrizität Schwerpunkte: Elektrische Quelle und elektrischer Verbraucher Einführung von
Physik II. SS 2006 Vorlesung Karsten Danzmann
 Physik II SS 2006 Vorlesung 1 13.4.2006 Karsten Danzmann Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) und Universität Hannover Physik bis zum Vordiplom Physik I RdP I Mechanik,
Physik II SS 2006 Vorlesung 1 13.4.2006 Karsten Danzmann Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) und Universität Hannover Physik bis zum Vordiplom Physik I RdP I Mechanik,
- PDF-Service
 www.biotechnologie.de - PDF-Service www.biotechnologie.de - PDF-Service Table of Contents Verfahrenstechnik (mit den Schwerpunkten Biotechnik, Umwelttechnik, Energietechnik)...1 Allgemeines...1 Bachelor-Studium...1
www.biotechnologie.de - PDF-Service www.biotechnologie.de - PDF-Service Table of Contents Verfahrenstechnik (mit den Schwerpunkten Biotechnik, Umwelttechnik, Energietechnik)...1 Allgemeines...1 Bachelor-Studium...1
Auswirkungen der Symmetrien auf physikalische Effekte
 Auswirkungen der Symmetrien auf physikalische Effekte Teil 1 Elektrische Polarisation 1. Elektrische Polarisation In einem elektrisch nicht leitenden Körper also in einem Dielektrikum verschieben sich
Auswirkungen der Symmetrien auf physikalische Effekte Teil 1 Elektrische Polarisation 1. Elektrische Polarisation In einem elektrisch nicht leitenden Körper also in einem Dielektrikum verschieben sich
5. Semester Bachelor Chemie
 5. Semester Bachelor Chemie 1 Modul: 08-AC3 Anorganische Chemie 3 15 S Studentischer Arbeitsaufwand: 270 h 9 ECTS 08-AC1-1, 08-AC1-3, 08-AN1-1 Sonstige Vorkenntnisse: 08-AC1-2, 08-AC2, 08-AN1-2, 08-TC,
5. Semester Bachelor Chemie 1 Modul: 08-AC3 Anorganische Chemie 3 15 S Studentischer Arbeitsaufwand: 270 h 9 ECTS 08-AC1-1, 08-AC1-3, 08-AN1-1 Sonstige Vorkenntnisse: 08-AC1-2, 08-AC2, 08-AN1-2, 08-TC,
2.5 Nebenfach Chemie. Modulbezeichnung 2 ANLAGEN Modul Allgemeine Chemie. Allgemeine Chemie. Status. Wahlpflichtmodul im Nebenfach Chemie.
 2.5 Nebenfach Chemie 2.5.1 Modul Allgemeine Chemie Modulbezeichnung Status Allgemeine Chemie Modulverantwortliche Modulbestandteile Semester Wahlpflichtmodul im Nebenfach Chemie. Der Studiendekan des Fachbereichs
2.5 Nebenfach Chemie 2.5.1 Modul Allgemeine Chemie Modulbezeichnung Status Allgemeine Chemie Modulverantwortliche Modulbestandteile Semester Wahlpflichtmodul im Nebenfach Chemie. Der Studiendekan des Fachbereichs
Entsorgung von Nanoabfällen
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Abfall, Stoffe, Biotechnologie Entsorgung von Nanoabfällen André Hauser Nanomaterialien,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Abfall, Stoffe, Biotechnologie Entsorgung von Nanoabfällen André Hauser Nanomaterialien,
Zellulose-Synthese. künstlich: enzymatische Polymerisation von Zellobiose-Fluorid
 18 Zellulose-Synthese künstlich: enzymatische Polymerisation von Zellobiose-Fluorid biologisch: Enzymkomplexe in der Zellmembran (terminal complexes, TCs) sphärulitische Kristalle außen S. Kobayashi et
18 Zellulose-Synthese künstlich: enzymatische Polymerisation von Zellobiose-Fluorid biologisch: Enzymkomplexe in der Zellmembran (terminal complexes, TCs) sphärulitische Kristalle außen S. Kobayashi et
4. Strukturänderung durch Phasenübergänge
 4. Strukturänderung durch Phasenübergänge Phasendiagramm einer reinen Substanz Druck Phasenänderung durch Variation des Drucks und/oder der Temperatur Klassifizierung Phasenübergänge 1. Art Phasenübergänge
4. Strukturänderung durch Phasenübergänge Phasendiagramm einer reinen Substanz Druck Phasenänderung durch Variation des Drucks und/oder der Temperatur Klassifizierung Phasenübergänge 1. Art Phasenübergänge
Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8
 Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8 1. Physik als Naturbeobachtung unter bestimmten Aspekten a) zwischen Beobachtung und physikalischer Erklärung unterscheiden
Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8 1. Physik als Naturbeobachtung unter bestimmten Aspekten a) zwischen Beobachtung und physikalischer Erklärung unterscheiden
Die weitergehende Analyse Mehr Informationen über Schadenspotential und Herkunft von Partikeln
 Die weitergehende Analyse Mehr Informationen über Schadenspotential und Herkunft von Partikeln Die VDA 19 VDA 19 (2004): Zu wenig praxisorientiert Zu wenig Parameter Zu unkonkret Mehr Beispiele und Bilder
Die weitergehende Analyse Mehr Informationen über Schadenspotential und Herkunft von Partikeln Die VDA 19 VDA 19 (2004): Zu wenig praxisorientiert Zu wenig Parameter Zu unkonkret Mehr Beispiele und Bilder
Physik I im Studiengang Elektrotechnik
 Physik I im Studiengang Elektrotechnik - Einführung in die Physik - Prof. Dr. Ulrich Hahn WS 2015/2016 Physik eine Naturwissenschaft Natur leblos lebendig Physik Chemie anorganisch Chemie organisch Biochemie
Physik I im Studiengang Elektrotechnik - Einführung in die Physik - Prof. Dr. Ulrich Hahn WS 2015/2016 Physik eine Naturwissenschaft Natur leblos lebendig Physik Chemie anorganisch Chemie organisch Biochemie
Institut für Eisen- und Stahl Technologie. Seminar 2 Binäre Systeme Fe-C-Diagramm. www.stahltechnologie.de. Dipl.-Ing. Ch.
 Institut für Eisen- und Stahl Technologie Seminar 2 Binäre Systeme Fe-C-Diagramm Dipl.-Ing. Ch. Schröder 1 Literatur V. Läpple, Wärmebehandlung des Stahls, 2003, ISBN 3-8085-1308-X H. Klemm, Die Gefüge
Institut für Eisen- und Stahl Technologie Seminar 2 Binäre Systeme Fe-C-Diagramm Dipl.-Ing. Ch. Schröder 1 Literatur V. Läpple, Wärmebehandlung des Stahls, 2003, ISBN 3-8085-1308-X H. Klemm, Die Gefüge
Osmotische textile Pumpen ein Beitrag zur Klimatisierung. von Bekleidung und technischen Textilien
 Osmotische textile Pumpen ein Beitrag zur Klimatisierung von Bekleidung und technischen Textilien Klaus Richter richter + partner GmbH Weimar Projektmanager des SmartTex-Netzwerkes Osmose Osmose wird in
Osmotische textile Pumpen ein Beitrag zur Klimatisierung von Bekleidung und technischen Textilien Klaus Richter richter + partner GmbH Weimar Projektmanager des SmartTex-Netzwerkes Osmose Osmose wird in
Keramische Materialien in ANDRE BLEISE
 Keramische Materialien in Lichtquellen 08.06.2009 ANDRE BLEISE Inhalt Was sind Keramiken? Einsatzbereiche in Lichtquellen Keramiken als Bauteile Beispiele & Herstellung Keramiken als Emitter Beispiele
Keramische Materialien in Lichtquellen 08.06.2009 ANDRE BLEISE Inhalt Was sind Keramiken? Einsatzbereiche in Lichtquellen Keramiken als Bauteile Beispiele & Herstellung Keramiken als Emitter Beispiele
Dip-Pen Nanolithography. Ramona Augustin Einführung in die Biophysik SoSe 2013
 Ramona Augustin Einführung in die Biophysik SoSe 2013 Gliederung Was ist DPN und wie funktioniert es? Welche Versuche wurden mit DPN durchgeführt? Wofür kann man DPN einsetzen? Was zeichnet DPN gegenüber
Ramona Augustin Einführung in die Biophysik SoSe 2013 Gliederung Was ist DPN und wie funktioniert es? Welche Versuche wurden mit DPN durchgeführt? Wofür kann man DPN einsetzen? Was zeichnet DPN gegenüber
Kleben - erfolgreich und fehlerfrei
 Gerd Habenicht Kleben - erfolgreich und fehlerfrei Handwerk, Praktiker, Ausbildung, Industrie 4., überarbeitete und ergänzte Auflage Mit 76 Abbildungen Vieweg VII Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1
Gerd Habenicht Kleben - erfolgreich und fehlerfrei Handwerk, Praktiker, Ausbildung, Industrie 4., überarbeitete und ergänzte Auflage Mit 76 Abbildungen Vieweg VII Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1
Robert Hausner AEE INTEC Institut für Nachhaltige Technologien A-8200 Gleisdorf, Feldgasse 19
 Berechnung von Kunststoffkollektoren mit Überhitzungsschutz Robert Hausner AEE INTEC Institut für Nachhaltige Technologien A-8200 Gleisdorf, Feldgasse 19 Katharina Resch Montanuniversität Leoben A-8700
Berechnung von Kunststoffkollektoren mit Überhitzungsschutz Robert Hausner AEE INTEC Institut für Nachhaltige Technologien A-8200 Gleisdorf, Feldgasse 19 Katharina Resch Montanuniversität Leoben A-8700
Magnetochemie. Eine Einführung in Theorie und Anwendung. Von Prof. Dr. rer. nat. Heiko Lueken Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
 Magnetochemie Eine Einführung in Theorie und Anwendung Von Prof. Dr. rer. nat. Heiko Lueken Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen B. G.Teubner Stuttgart Leipzig 1999 Inhalt s Verzeichnis
Magnetochemie Eine Einführung in Theorie und Anwendung Von Prof. Dr. rer. nat. Heiko Lueken Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen B. G.Teubner Stuttgart Leipzig 1999 Inhalt s Verzeichnis
Studiengang: Maschinenbau. Abschlussart: Bachelor. Studienprüfungsordnung: StuPO Datum der Studienprüfungsordnung:
 Studiengang: Maschinenbau Abschlussart: Bachelor Studienprüfungsordnung: StuPO 25.01.2006 Datum der Studienprüfungsordnung: 25.01.2006 generiert am: 02.10.2015 15:58 Uhr Maschinenbau Fakultät: Fakultät
Studiengang: Maschinenbau Abschlussart: Bachelor Studienprüfungsordnung: StuPO 25.01.2006 Datum der Studienprüfungsordnung: 25.01.2006 generiert am: 02.10.2015 15:58 Uhr Maschinenbau Fakultät: Fakultät
Anorganische Strukturchemie
 Ulrich Müller Anorganische Strukturchemie 5., überarbeitete und erweiterte Auflage Teubner Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 9 2 Beschreibung chemischer Strukturen 11 2.1 Koordinationszahl und Koordinationspolyeder
Ulrich Müller Anorganische Strukturchemie 5., überarbeitete und erweiterte Auflage Teubner Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 9 2 Beschreibung chemischer Strukturen 11 2.1 Koordinationszahl und Koordinationspolyeder
Masterstudiengang Chemie Fakultät für Naturwissenschaften Stand: Juni 2011
 Masterstudiengang Chemie Fakultät für Naturwissenschaften Stand: Juni 2011 Universität Ulm Viele gute Gründe sprechen für ein Masterstudium an der Universität Und unabhängig vom Studiengang profitieren
Masterstudiengang Chemie Fakultät für Naturwissenschaften Stand: Juni 2011 Universität Ulm Viele gute Gründe sprechen für ein Masterstudium an der Universität Und unabhängig vom Studiengang profitieren
Einführung und Grundlagen
 Christian Bonten Kunststofftechnik Einführung und Grundlagen HANSER Inhalt Vorwort Der Autor: Prof. Christian Bonten Hinweise zur Benutzung des Buches V vii vm 1 Einleitung 1 1.1 Kunststoff - Werkstoff
Christian Bonten Kunststofftechnik Einführung und Grundlagen HANSER Inhalt Vorwort Der Autor: Prof. Christian Bonten Hinweise zur Benutzung des Buches V vii vm 1 Einleitung 1 1.1 Kunststoff - Werkstoff
Modul Modulverantwortung VAK Lehrveranstaltung Art. Wintersemester 2013/14
 Wintersemester 2013/14 AlC 02-03-1-ALC-1 Allgemeine Chemie V, Ü, P AC-1/ AC-K A Prof. Jens Beckmann 02-03-1-AC1-1 Chemie der Hauptgruppenelemente V 02-03-ACF-1 Festkörperchemie V AC-F Prof. Thorsten Gesing
Wintersemester 2013/14 AlC 02-03-1-ALC-1 Allgemeine Chemie V, Ü, P AC-1/ AC-K A Prof. Jens Beckmann 02-03-1-AC1-1 Chemie der Hauptgruppenelemente V 02-03-ACF-1 Festkörperchemie V AC-F Prof. Thorsten Gesing
Vom Biegen und Brechen Wie Zink Stahl bricht. Klaus-Dieter Bauer Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik Johannes Kepler Universität Linz
 Vom Biegen und Brechen Wie Zink Stahl bricht Klaus-Dieter Bauer Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik Johannes Kepler Universität Linz Die Motivation aus der Industrie Die Motivation aus der Industrie
Vom Biegen und Brechen Wie Zink Stahl bricht Klaus-Dieter Bauer Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik Johannes Kepler Universität Linz Die Motivation aus der Industrie Die Motivation aus der Industrie
