Gerd-Rüdiger Koretzki und Rudolf Tammeus (Hg.) ElfZwölf Werkbuch. Materialien für Lehrerinnen und Lehrer. E-Book. Vandenhoeck & Ruprecht
|
|
|
- Adam Koenig
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gerd-Rüdiger Koretzki und Rudolf Tammeus (Hg.) ElfZwölf Werkbuch Materialien für Lehrerinnen und Lehrer E-Book Vandenhoeck & Ruprecht
2 ElfZwölf Werkbuch Materialien für Lehrerinnen und Lehrer Herausgegeben von Gerd-Rüdiger Koretzki und Rudolf Tammeus Vandenhoeck & Ruprecht Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2008
3 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. eisbn , Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/ Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. 2 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
4 Inhalt Vorwort der Herausgeber Gerd-Rüdiger Koretzki / Rudolf Tammeus Lehren und Lernen im kompetenzorientierten RU Gabriele Obst Glaubensvielfalt und Wahrheitssuche Christian Marker Religion wahrnehmen und deuten Alfred Weymann Glaube und Naturwissenschaft Beate Wenzel Atheismus und Gotteserfahrung Christian Marker Gott in Lebensgeschichten Beate Wenzel Die Bibel bekannt und fremd Beate Wenzel Jesus von Nazareth der Christus Alfred Weymann Zur Freiheit befreit!? Alfred Weymann Himmel und Hölle Johannes Kubik Credo heute Christian Marker Kirche in der Moderne moderne Kirche Johannes Kubik Diakonie praktizierte Nächstenliebe Christian Marker Ethisch handeln: Sterbehilfe? Johannes Kubik Menschenwürde und Menschenrechte Johannes Kubik Sehnsucht nach dem Paradies Alfred Weymann Rätsel Mensch Beate Wenzel Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
5 Vorwort der Herausgeber Bildungspolitische Rahmenbedingungen: Pisa und der Religionsunterricht Die internationalen Vergleichsstudien von Sch.leistungen haben in den letzten zehn Jahren zu einem grundlegenden Systemwechsel in der deutschen Bildungs- und Schulpolitik geführt. Bildungsstandards sind dabei zu einer der wichtigsten Optionen deutscher Bildungspolitik und -reform geworden. PISA hat auch den Religionsunterricht in Deutschland deutlich verändert. Zwar wurden die Leistungen im Fach Religion nicht überprüft, zu vermuten ist aber, dass auch hier die Ergebnisse nicht besser ausgefallen wären als in den evaluierten Fächern, zumal der Religionsunterricht ebenfalls ein überwiegend leseorientiertes Unterrichtsfach ist. Auch für das Fach Religion bleibt festzuhalten: Was Sch. am Ende ihrer Schulzeit können, entspricht häufig nicht dem, was sie nach den Richtlinien bzw. Kerncurricula können sollten. Böse Zungen sprechen mit Blick auf die geltenden Lehrpläne gar von Behauptungspapieren. Der Religionsunterricht spielt in der PISA-Diskussion ähnlich wie andere sog. soft sciences eine eher randständige Rolle. Schon die Rede von den Kernfächern macht deutlich, dass Fächer wie Deutsch, Mathematik und die modernen Fremdsprachen im Vordergrund des bildungspolitischen Interesses stehen. Umso dringlicher ist es, deutlich zu machen, dass der Religionsunterricht nach seinem Selbstverständnis einen unverzichtbaren Teil zur allgemeinen Bildung beiträgt. Der Berliner Pädagoge Dietrich Benner hat in einem bemerkenswerten Aufsatz zum Thema Bildung und Religion (in: A. Battke, u.a. (Hg.): Schulentwicklung Religion Religionsunterricht, Herder, Freiburg / Basel / Wien 2002, 51 70) eine bildungstheoretische Begründung von Religion in der Schule exemplarisch entfaltet. Nach Benner hat der Religionsunterricht im Kanon der Schulfächer nur dann einen angemessenen Ort, wenn er von einer kritischen Bestimmung des Propriums der Religion ausgeht und seine Aufgabe darin sieht, in den Heranwachsenden ein Bewusstsein von Möglichkeiten, Aufgaben, Schwierigkeiten und Grenzen religiöser Weltinterpretation zu entwickeln. Religion selbst, verstanden als Sinn und Geschmack fürs Unendliche (Schleiermacher), müsse wieder stärker ins Zentrum des Religionsunterrichts rücken. Standards auch für den Religionsunterricht? Kritisch zu fragen bleibt trotzdem, ob für den evangelischen Religionsunterricht ebenfalls Standards formuliert, die zu erreichenden Kompetenzen definiert und empirisch überprüft werden sollen. Die Meinungen hierüber gehen weit auseinander. Während Skeptiker eine ökonomische Funktionalisierung des Religionsunterricht beschwören, weisen andere wie etwa der Paderborner Seminarleiter Hartmut Lenhard im Loccumer Pelikan 3/07 darauf hin, dass der Religionsunterricht (durch Standards erst) ein erkennbares Profil im Fächerkanon an der Schule (gewinnt), da er auf Kompetenzen religiöser Bildung bezogen ist, die in keinem anderen Fach erworben werden können. Er legt öffentlich Rechenschaft ab über den erzielten Lernertrag und damit auch über die Qualität der Lehr- und Lernprozesse, in denen die Sch. Kompetenzen erworben haben. 4 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
6 Maße des Menschlichen Schon 2003 hat der Rat der EKD mit der Denkschrift Maße des Menschlichen evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft in den öffentlichen Bildungsdiskurs eingebracht. Nachdrücklich weist er darauf hin, dass Bildung mehr ist als Wissen und Lernen. Bildung fragt umfassender nach der Substanz und den Zielen von Wissen und Lernen und damit grundlegend nach dem Selbst- und Weltverständnis des Menschen. Die religiöse Dimension darf dabei nicht ausgeblendet werden. Bei aller Zweck- und Zeitoptimierung muss Raum für die Reflexion über das Woher, Warum und Wohin bleiben. Eine Marginalisierung der nicht verrechenbaren Seiten menschlichen Lebens wäre im Spiegel der Maße des Menschlichen" unverantwortlich. Deshalb ist darauf zu achten, dass Verfügungswissen und Orientierungs- bzw. Lebenswissen in schulischen Bildungsprozessen nicht auseinandergerissen werden. Der Tübinger Religionspädagoge Friedrich Schweitzer stellt vor dem Hintergrund dieser Überlegungen deshalb pointiert fest: Das Beste am Religionsunterricht lässt sich nicht mit Standards messen aber es ist gut, wenn das, was sich messen lässt, auch tatsächlich gemessen wird. Zwei autorisierte Modelle grundlegender Kompetenzen religiöser Bildung werden seit 2006 länderübergreifend intensiv diskutiert und bei der Erstellung länderspezifischer Kerncurricula berücksichtigt: 1. die von einer Expertengruppe am Comenius-Institut der EKD entwickelten Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I: Dietlind Fischer / Volker Elsenbast (Red.): Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung. Zur Entwicklung des evangelischen Religionsunterrichts durch Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I, Comenius-Institut, Münster 2006 und 2. die von der Kultusministerkonferenz vorgelegten grundlegenden Kompetenzen religiöser Bildung für den Abschluss in der Sekundarstufe II: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. Evangelische Religionslehre. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i.d.f. vom In beiden Dokumenten gehen die Verfasser/innen davon aus, dass der evangelische Religionsunterricht aus bildungstheoretischen, bildungspolitischen, pädagogischen wie pragmatischen Gründen weit stärker als bisher klären, verdeutlichen und überprüfbar machen sollte, was es in diesem Unterricht zu lernen gibt und welche Kompetenzen der Unterricht vermittelt. Sie (sind) davon überzeugt, dass die Klärung von Bildungsstandards sowie die Bestimmung von Kompetenzen, die die Sch. bis zum Ende einer bestimmten Schulstufe erworben haben sollen, einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung des Religionsunterrichts sowie zur Förderung seiner Akzeptanz im Kanon der Unterrichtsfächer der Schule leistet. (Vorwort der Comenius-Expertise). Kompetenzorientierung auch in den Schulbüchern Folgerichtig formuliert die Expertengruppe des Comenius-Instituts auch Anforderungen an die Schulbuchentwicklung: Die Orientierung des Religionsunterrichts an Kompetenzen erfordert entsprechende Schulbücher und Unterrichtsmedien. Dies gilt vor allem von Arbeitsbüchern, die als Leitmedien für den Unterricht konzipiert werden und somit den gesamten Unterricht eines Jahrgangs oder einer Jahrgangsstufe ausrichten wollen. Für solche Unterrichtswerke ist grundsätzlich zu empfehlen, dass sie über die Präsentation der wesentlichen Inhalte eines Kerncurriculums hinaus die Kompetenzorientierung auf der Oberfläche des Buches sichtbar machen und so zu einem nachhaltigen Lernen anregen. (Ebd., 74f.) Empfohlen wird u.a., die leitenden Kompetenzen im Sch./innenbuch auszuweisen, individualisierendes Lernen zu ermöglichen, Zugänge für eine eigenständige, aktive Auseinanderset- Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
7 zung mit den Inhalten des Kerncurriculums zu eröffnen, Wege aufzuzeigen, wie neben allgemeinen auch religionsspezifische Methoden angeeignet werden können, und zu prüfen, ob und wie grundlegende kognitive Wissensbestände herausgestellt und angeeignet werden sollen. ELFZWÖLF RELIGION ist das neue kompakte Unterrichtswerk für die gesamte Oberstufe, das der veränderten pädagogisch-didaktischen Situation sowie der gewandelten verkürzten wie konzentrierten Sekundarstufe II Rechnung trägt. Es handelt sich um eine vollständige Neubearbeitung auf der Basis der bewährten Konzeption von RELIGION entdecken verstehen gestalten. Die Themenbereiche und Inhalte der neuen Lehrpläne und Kerncurricula der verschiedenen Bundesländer werden berücksichtigt. Gegenüber RELIGION entdecken, verstehen, gestalten 11+ ist ELFZWÖLF RELIGION von bisher 12 auf 16 Kapitel angewachsen. Zusätzlich zu den bewährten Themen sind vier zentrale Kernthemen neu aufgenommen: Zur Freiheit befreit; Atheismus und Gotteserfahrung; Glaube und Naturwissenschaft; Menschenwürde und Menschenrechte. Die bisherigen Kapitel sind entsprechend den gültigen Bildungsstandards für das Fach Evangelische Religion überarbeitet. Mit seinen kompetenzorientierten Aufgaben und strukturierten Zusammenfassungen gewährleistet das neue Lehrbuch den Erwerb soliden Grundwissens. ELFZWÖLF RELIGION verbindet somit Bewährtes und religionspädagogisch wie bildungspolitisch Neues zu einem attraktiven Gesamtangebot für einen kreativen und nachhaltigen RU in der gymnasialen Oberstufe. -Bewährtes Dem Konzept entdecken, verstehen, gestalten bleibt der neue Band verpflichtet. Religion entdecken: Eine Religion zu haben ist für Heranwachsende heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Im RU geht es deshalb darum, die vielfältigen neuen Formen von Religion in Phänomenen und Problemen der eigenen Lebens- und Alltagswelt Jugendlicher, aber auch die häufig fremd gewordene christliche Religion und ihre Tradition neu oder wieder zu entdecken. Im Kontext ökumenischen und interreligiösen Lernens kommen dabei auch nichtchristliche Religionen durchgehend aus der Binnensicht selbst zu Wort. Religion verstehen: Das sorgfältig ausgewählte und erprobte Materialangebot schafft Lernsituationen, die auf eine wachsende Kompetenz im Verständnis religiöser Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen zielen und solides religiöses Wissen vermitteln. Neben der Erschließung der biblischen Tradition wird auch eine Reflexion der Alltagsreligiosität und der Dialog mit den Nachbarschaftsreligionen angebahnt. Dies ermöglicht auch das positionelle Gespräch über den religiösen Wahrheitsanspruch. Religion gestalten: Religion wird erfahrbar im gestaltenden Umgang mit ihren Traditionen, Liedern, Symbolen und Ritualen. Erst recht verlangt der weitgehende Wegfall einer familiären und/oder kirchlichen religiösen Sozialisation einen RU, der neben der intellektuell-kognitiven Reflexion von Religion auch die rituell-gestalthafte Dimension berücksichtigt und den Sch. ermöglicht, religiöse Sprach- und Ausdrucksformen erprobend zu gestalten. Für die Erarbeitung der einzelnen Themen stellt ELFZWÖLF RELIGION ein breit gefächertes Spektrum sorgfältig ausgewählter, unverbrauchter Materialien bereit: Texte, Bilder und Lieder ermöglichen in ihrer Kombination unterschiedliche methodische Zugangs- und Erschließungsweisen. Herausgeber und Autorenteam haben sich bei der Auswahl und Präsentation der Materialien von folgenden Grundsätzen leiten lassen: 6 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
8 - Offenheit ohne Beliebigkeit: Das heißt, mit ihrem jeweiligen unterschiedlichen Aussage- und Bedeutungspotenzial wie auch in ihrer spannungsreichen, Multiperspektivität eröffnenden, Anordnung und Verknüpfung sollen die Materialien zur Auseinandersetzung anregen und positionelle Beliebigkeit verhindern. Nur solche Materialien finden Aufnahme, die in unterrichtlichen Situationen und in verschiedenen (altersgleichen) Lerngruppen praktisch erprobt sind. - Alle Materialien werden, soweit nur irgend möglich, in ihrem Eigenwert, d.h. ohne Beschränkung ihres Aussage- und Bedeutungspotenzials, dargeboten. Das Lehrwerk soll die Unterrichtenden in ihrer fachlichen und didaktischen Kompetenz unterstützen, sie aber nicht gängeln. Der Spielraum für eigenverantwortliche Entscheidungen soll durch das Lehrwerk erweitert, nicht eingeengt werden. Die Materialien des Lehrbuchs sollen die Sch. motivieren und sie zu einer eigenständigen Auseinandersetzung anregen sowie solides fachliches Lernen und Arbeiten ermöglichen. Diesen Grundsätzen entsprechend werden Bilder möglichst großformatig und zur Wahrung ihres ästhetischen Eigenwertes ohne verräterische Angaben, etwa des Titels, wiedergegeben. werden religiöse Texte, die der christlichen Religion ebenso wie der Nachbarschaftsreligionen, prinzipiell aus der Innensicht dargeboten. wird den Unterrichtenden die Möglichkeit offengehalten, Materialien kapitelübergreifend und in anderen thematischen Zusammenhängen zu verwenden. Querverweise fordern hierzu ausdrücklich auf. Neues ELFZWÖLF RELIGION orientiert sich konsequent an Kompetenzen. Da es im RU um religiöse Bildung von Sch. geht, sind es die grundlegenden religiösen Kompetenzen, auf deren Erwerb das neue Lehrbuch zielt. Für das Verständnis dessen, was als religiöse Kompetenz zu gelten hat, folgt der Band ausdrücklich den durch KMK bzw. EKD autorisierten Kompetenzmodellen. Der Kompetenzbezug wird durchgehend deutlich: Die mit den Lerninhalten angezielten Kompetenzen werden im Sch.band ausgewiesen und am Ende jedes Kapitels auf einer eigenen Seite Entdeckt verstanden gestaltet übersichtlich zusammengestellt. Ihre Formulierung sorgt dafür, dass die Sch. in die Lage versetzt werden, ihren individuellen Lernzuwachs, den Erwerb der angezielten Kompetenzen, selbst einzuschätzen. Wie jedes Kompetenzmodell bedarf auch das unsere konkreter Aufgabenstellungen, an deren Lösung die Sch. zeigen können, ob und in welchem Umfang sie über die angestrebten Kompetenzen verfügen. Den Arbeitsaufträgen kommt mithin eine erhebliche Bedeutung für den intendierten Kompetenzerwerb zu. Die Arbeitsaufträge zu den einzelnen Materialien sind entsprechend den EPA- Operatoren so formuliert, dass sie den primären Adressaten den Sch. eindeutige und klare Handlungsanweisungen geben. Dabei wechseln sich gezielt Arbeitsaufträge für Partner- und Gruppenarbeit mit solchen ab, die von den Sch. in Einzelarbeit bearbeitet werden sollen und können. ELFZWÖLF RELIGION gibt dem gemeinschaftlichen Lernen der Sch. damit ebenso eine Grundlage wie dem eigenständigen, individualisierten Lernen und Arbeiten. Ihren Ort haben die in einem Block zusammengefassten Arbeitsaufträge am Ende eines jeden Kapitels. Diese Platzierung erreicht zweierlei: Dass die Arbeitsaufträge ihren Platz nicht in Blickweite direkt Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
9 neben den dargebotenen Materialien Bildern oder Texten haben, schützt deren Bedeutungsvielfalt und ästhetischen Eigenwert vor vorschnellen Steuerungen und sichert den Sch. Raum für eigene Zugänge und für eine eigenständige Auseinandersetzung mit den Materialien. Dass die Arbeitsaufträge andererseits in greifbarer Nähe der Materialien platziert sind und nicht am Ende des Buches, verdeutlicht, dass sie integraler Bestandteil des Kapitels sind, und erleichtert den Sch. die aufgabengeleitete Bearbeitung der einzelnen Themen oder auch die häusliche Nacharbeit. Dem programmatischen Titel entdecken, verstehen, gestalten entsprechend, decken die bewusst diversifizierten Aufgabenstellungen ein breites Spektrum von Methoden und methodischen Möglichkeiten ab: Fernab von jedem Methodenmonismus findet sich in dem neuen Lehrbuch eine Fülle methodischer Möglichkeiten: von kreativer Gestaltung und spielerischen Handlungselementen zu kognitiven Arbeitstechniken und zu Projekten bzw. projektartigen Lernformen. Im Rahmen eines erweiterten Lernverständnisses zeigt ELFZWÖLF RELIGION Wege auf, wie neben allgemeinen insbesondere auch religionsspezifische Methoden angeeignet werden können: z.b. die Fähigkeit, biblische Texte auszulegen oder eine Meditation durchzuführen. Aus diesem Grund enthält das Buch eine gesonderte Abteilung mit sieben elementaren Arbeitsmethoden des RU. Sie können gezielt erarbeitet oder auch je bei Bedarf zu Rate gezogen werden. Zusatzmaterialien Eine CD ELFZWÖLF RELIGION Basistexte ergänzt dieses neue Religionsbuch fakultativ. Sie enthält 187 bewährte Basistexte für den RU in der gymnasialen Oberstufe, die mit Erschließungsfragen versehen in Form ästhetisch gestalteter Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt werden. Ohne großen Aufwand können so wichtige theologische Texte parallel zu einzelnen Unterrichtseinheiten rezipiert werden. Durch ein doppeltes Navigationssystem sind die Texte leicht und gezielt auffindbar: zum einen nach Themen geordnet, zum anderen entlang den Kapiteln des Schulbuches. Mit ELFZWÖLF RELIGION liegt ein ästhetisch ansprechendes und religionspädagogisch anspruchsvolles Lehrbuch vor für den Religionsunterricht in der Oberstufe für das achtjährige Gymnasium. Unser Dank richtet sich an die Autorinnen und Autoren, die mit Sachverstand, Engagement und Fleiß Sch.- und Werkbuch neu bearbeitet bzw. ergänzt haben. Gabriele Obst danken wir für den informativen Beitrag Lehren und Lernen im kompetenzorientierten RU. Gerd-Rüdiger Koretzki / Rudolf Tammeus 8 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
10 Lehren und Lernen im kompetenzorientierten RU Kompetenzorientiert unterrichten wie macht man das? Gabriele Obst These 1: Kompetenzorientiertes Unterrichten unterscheidet sich von herkömmlichem Unterricht durch den konsequenten Blick auf das, was Sch. am Ende einer Lernzeit wissen, können und wozu sie bereit sind. Die Fokussierung auf zentrale, langfristig aufgebaute Lernergebnisse bedeutet einen einschneidenden Perspektivenwechsel. Wenn die langfristigen Ziele des Unterrichts verbindlich vorgegeben sind, sind die Wege dahin variabel und können den Bildungsgängen der Sch. vor Ort angepasst werden. Kompetenzorientierung enthält den didaktischen Imperativ, den Bildungsgang der Sch. vom Ende her zu denken. Aus dieser Perspektive stellt sich die Aufgabe zu formulieren, welche Kompetenzen religiöser Bildung Sch. auf welcher Niveaustufe an bestimmten markanten Punkten ihrer Bildungsbiografie erreicht haben sollen. Ein wichtiges Kennzeichen eines solchen RUs ist daher seine langfristige Anlage. Er geht davon aus, dass erst in einem fortschreitenden und sich allmählich anreichernden Lernprozess Kompetenzen religiöser Bildung aufgebaut und ausdifferenziert werden. Natürlich werden kompetenzorientierte Kerncurricula den Kolleginnen und Kollegen viele Hilfen bei der Ausarbeitung schulinterner Lehrpläne bieten, aber die entscheidende Arbeit die in den Lerngruppen vorgesehenen Unterrichtsreihen und Projekte am Leitfaden des Kompetenzerwerbs miteinander zu verbinden bedarf der Zusammenarbeit der Fachkollegen. Sie sind es, die festzulegen haben, wie Kompetenzen sukzessive und mit wachsendem Niveau von den Sch. erworben werden können, und die Lehr- und Lernangebote auf den unterschiedlichen Stufen miteinander verbinden und aufeinander aufbauen müssen, so dass sequentielles, vertiefendes Lernen möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt Es könnte den Anschein haben, als schließe die Ausrichtung des Unterrichts an Kompetenzen und Standards ein eher technokratisches Prozedere ein, das mit der Bildung des Einzelnen nicht vereinbar sei, sondern dessen problemlose Integration in die gesellschaftlichen Subsysteme befördern solle (Wermke 2007, 56). Dieser Verdacht könnte sich bestätigen, wenn der Unterricht nur darauf angelegt wäre, Qualifikationen zu vermitteln, die in pragmatistischer Weise zur Erledigung bestimmter Aufgaben erforderlich sind. Zur Bearbeitung eines Werkstücks oder zur Erstellung einer geordneten Buchführung mögen solche Qualifikationen ausreichen im RU geht es um mehr und anderes (vgl. Dressler 2007a, 28). Der Unterricht zielt darauf, den Sch. einen besonderen Erfahrungs- und Handlungsraum zu erschließen, der für ihr Leben schlechthin entscheidend sein kann, und ihnen zu ermöglichen, ihr eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen. Um eine solche Souveränität und Mündigkeit erreichen und ausüben zu können, sind sie auf Kompetenzen angewiesen. Diese dienen deshalb im Bildungskonzept des RUs der Subjektwerdung und des Subjektseins der Sch. These 2: Im Mittelpunkt des kompetenzorientierten RUs steht die Person der Sch., ihre Entwicklung und die Ausbildung und Förderung ihrer Fähigkeiten. Dass diese Mittelpunktstellung zutiefst theologisch und pädagogisch zugleich begründet ist, ist nichts Neues. Auch der didaktische Ansatz, die Themen und Gegenstände, die im RU zur Sprache kommen, mit dem Leben der Sch. zu verklammern, bestätigt den bestehenden Konsens in der Religi- Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
11 onspädagogik. Ungewohnt ist dagegen zum einen die Betonung, die das zu erwerbende Wissen als Voraussetzung für das Handeln und Reflektieren in existenziell bedeutsamen Situationen und angesichts von unausweichlichen Herausforderungen in religiösen Kontexten erfährt. Zum anderen ist Wissen nicht schon an sich und als Anhäufung isolierter Kenntnisse wertvoll, sondern kommt nur dann ins Spiel, wenn Sch. die Fähigkeit erwerben, es zu strukturieren, zu verbinden und es in sinnvoller Weise bei der Bearbeitung von Fragen, Aufgaben und Problemen zu nutzen. Schließlich sind auch Emotionalität, soziale Fähigkeiten und die Einstellungen der Sch. angesprochen, wenn Kompetenzen effizient und verantwortungsvoll genutzt werden sollen. Nur wenn alle drei Ebenen ins Spiel kommen, lässt sich behaupten, dass der RU dazu beiträgt, Sch. zu einer eigenen religiösen Position zu verhelfen, über die sie sachkundig, gesprächs- und urteilsfähig Auskunft geben können. Das Lernen fördern Kompetenzen erwirbt man in komplexen Lernprozessen. Dadurch dass der Blick der Lehrerin bzw. des Lehrers sich auf das Ziel richtet und von dort her der Unterricht entworfen wird, stehen der Lehrkraft vielfältige Möglichkeiten offen. Das Motto Viele Wege führen nach Rom gilt mutatis mutandis auch für den Evangelischen RU. Die Wege sind in diesem Zusammenhang allerdings als Lehr- und Lernwege auszulegen. Dass es außerhalb dieser Wege auch noch Trampelpfade, Spazierwege, Erlebnisstege, Holzwege, Sackgassen und viele andere Unterrichtsrouten gibt, steht außer Frage; im RU sollte Gelegenheit sein, auch solche Wege zu beschreiten und zu prüfen, was sie an Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn erbringen. Hier aber kommt es darauf an, das Lehr- und Lernbare besonders zu betonen. These 3: Kompetenzorientiertes Unterrichten legt auf das Lernen der Sch. im Evangelischen RU ein besonderes Gewicht. Die Fokussierung auf das Lernen verleiht dem Unterricht Verbindlichkeit, wirkt dem religiösen Analphabetismus entgegen, sichert ein einheitliches Basisniveau und macht die Ergebnisse des RUs überprüfbar. Die Förderung des Lernens ist daher die zentrale Aufgabe der Lehrenden im Evangelischen RU. Die Planung des Unterrichts konzentriert sich auf die Frage, wie ergiebige Lernprozesse inszeniert, motivierende Lernarrangements entwickelt und Lernergebnisse gesichert und überprüft werden können. Dazu gehört eine ausreichende Breite von Lernkontexten, Aufgabenstellungen und Transfersituationen. Der besondere Brennpunkt des Lernens liegt auf dem Erwerb elementaren Wissens und grundlegender Fähigkeiten im Umgang und in der Auseinandersetzung mit Religion. RU kompetenzorientiert planen: ein Modell im Überblick Es empfiehlt sich, noch einmal die Definition des Kompetenzbegriffs in Erinnerung zu rufen, so wie sie in der Klieme-Expertise vorliegt: Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Kompetenz ist nach diesem Verständnis eine Disposition, die Personen befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen. (Klieme et al. 2003, 72) Der Begriff der Anforderungssituation eignet sich als didaktischer Widerhaken für die Planung 10 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
12 des Unterrichts in besonderer Weise. Er unterstellt die allgemeine Erfahrung, dass sich jeder Mensch Zeit seines Lebens unterschiedlichen Aufgaben ausgesetzt sieht, für deren Bewältigung er sich gezielt und systematisch also nicht nur auf dem Wege impliziten, beiläufigen Lernens bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten angeeignet haben muss. Zwar kann er solchen Herausforderungen hin und wieder aus dem Wege gehen oder sie verleugnen, verdrängen oder überspielen, aber eine gelingende und verantwortungsvolle Lebenskonzeption geht einher mit der Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit lebensbedeutsamen Fragen und Problemen auseinanderzusetzen. Vor allem im RU kann diese Einsicht genutzt und zu einem Planungsmodell erweitert werden. Dazu ein Beispiel (vgl. Obst / Lenhard 2006, 57): Im Februar 2006 wurde die islamische Welt durch eine Welle der Empörung über Karikaturen erschüttert, die in einer dänischen Zeitung im September 2005 abgedruckt worden waren und den Propheten Mohammed mit der terroristischen Gewalttätigkeit islamistischer Kreise in Verbindung brachten. 1. Anforderungssituationen identifizieren Dass die geschilderte Situation in bedrückender Weise den aktuellen Konflikt zwischen westlicher und islamischer Zivilisation spiegelt, liegt auf der Hand. In ihr bündeln sich wie in einem Brennglas eine Vielzahl von Fragen und Problemen, deren Reichweite sich auf unterschiedliche Segmente des gesellschaftlichen Lebens erstrecken. In einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, vor welchen Fragen, Aufgaben und Problemen die Sch. stehen, wenn sie sich auf die Bearbeitung dieses Konfliktes einlassen. Das Ergebnis einer solchen didaktischen Analyse fällt je nach Lerngruppe und Stufe unterschiedlich aus. 2. Die Bedeutung für die Lebens- und Lerngeschichte der Sch. analysieren In einem zweiten Schritt ist zu klären, welchen Stellenwert die Anforderungssituationen für die Sch. haben. Nur dann, wenn die Sch. die Lebensrelevanz eines Themas wahrnehmen und einschätzen können, wenn ihnen also der Gegenstand des RU etwas bedeutet, werden sie sich auf Lernprozesse einlassen. Sinnhaftes Lernen zu ermöglichen, ist zwar die Aufgabe aller Fächer, sie ist aber die besondere Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
13 Chance des RUs, da er mit dem Anspruch antritt, die Lebensbedeutsamkeit seiner Inhalte in exponierter Weise zu bedenken. 3. Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen der Sch. erheben Der dritte Schritt diagnostiziert die Lernausgangslage. Dabei kommen im Wesentlichen vier Dimensionen ins Spiel: zum einen die lebensgeschichtlich bedeutsamen Erfahrungen der Sch., die weil emotionale und soziale Tiefenschichten berührend oft prägend sind für Grundhaltungen und (Vor-) Urteile, zum anderen die fachlichen Kenntnisse der Sch., also das, was sie aus ihrem Umfeld bereits mitbringen, und vor allem das Wissen, das sie sich in vorgängigen Unterrichtseinheiten angeeignet haben. An dritter Stelle sind wertorientierte und auch emotional bestimmte Einstellungen zu nennen, die die Sch. im Laufe ihrer Sozialisation und Erziehung gewonnen haben und die bei der Bearbeitung des in Rede stehenden Problems virulent werden können. Schließlich ist danach zu fragen, über welche Kompetenzen die Sch. für die Bearbeitung der Anforderungssituation bereits verfügen und auf welcher Niveaustufe diese angesiedelt sind. 4. Erforderliche Kompetenzen bestimmen Wenn Sch. in die Lage versetzt werden sollen, in sachgemäßer Weise über den entstandenen Konflikt urteilen und im öffentlichen Diskurs mitreden zu können, benötigen sie spezifische Kompetenzen, die auf gesicherten Kenntnissen beruhen und letztlich auch zur Veränderung von Bewertungen und Einstellungen führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kompetenzen langfristig erworben werden und nicht Ergebnis einer Unterrichtsreihe, geschweige denn Resultat einer Unterrichtsstunde sein können. Es wäre daher verfehlt, wollte man als Zielebene jeweils übergeordnete Kompetenzen angeben, ohne auf der Mikroebene der Planung die jeweiligen Lernprozesse, Operationen, Aktions- und Teilziele zu konkretisieren. Auf der Makroebene der Planung einer Unterrichtsreihe oder eines Halbjahrs ist dann jedoch genau zu bestimmen, was die Unterrichtseinheiten zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von fachspezifischen und fachübergreifenden Kompetenzen beitragen können. 5. Kompetenzförderliche Lehr- und Lernprozesse planen Erst an dieser Stelle des didaktischen Planungsprozesses ist zu erörtern, wie Lehr- und Lernprozesse zu gestalten sind, die zum Aufbau der notwendigen Kompetenzen beitragen können. Dabei ist von der Einsicht auszugehen, dass die Aneignung von Kompetenzen umso besser gelingt, je mehr die Sch. sich aktiv und konstruktiv mit Unterrichtsgegenständen auseinandersetzen. Allerdings garantiert das Postulat selbstständigen und sogar selbstregulierten Lernens, das gern als Ausweis moderner Lernkultur propagiert wird, noch nicht, dass dies auch de facto im Unterricht stattfindet. Vielmehr müssen geeignete Lernarrangements inszeniert werden, die einerseits schwächeren Sch. genügend Anleitung und Orientierung für die Bearbeitung von Lernaufgaben bieten, andererseits stärkeren Sch. Freiräume für eine größere Selbstständigkeit zumuten. In jedem Fall ist eine Vielfalt an Lerngelegenheiten bereitzustellen, die Lernprozesse auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen. Kennzeichen kompetenzorientierten Lernens ist, dass die ermittelten Anforderungssituationen auch in didaktisch transformierter Weise in den Unterricht eingeführt werden, damit den Sch. klar wird, wofür sie Kompetenzen benötigen. Wo immer es möglich ist, sollten deshalb Lernanlässe situativ eingebettet und Kompetenzen in Anwendungskontexten erprobt werden. 6. Ergebnisse überprüfen Die Überprüfung von Lernergebnissen ist integraler Bestandteil der Unterrichtsplanung. Ihr kommt in einem kompetenzorientierten RU ein hoher Stellenwert zu. Denn nur wenn gesichert ist, dass Sch. kontinuierlich nachhaltige Lernerträge erzielen, können die erforderlichen Kompetenzen sukzessive 12 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
14 erworben werden. Bei der Überprüfung von Lernergebnissen spielen Standards eine besondere Rolle, die jeweils auf der Ebene von Jahrgangsstufen hinsichtlich ihres Niveaus zu konkretisieren sind. Dabei wird jeder Religionslehrer und jede Religionslehrerin testtheoretisch abgesicherte Instrumente, die eine Vergleichbarkeit von Leistungen ermöglichen, gern in Anspruch nehmen. Der Alltag sieht jedoch anders aus: Hier sind Lehrerinnen und Lehrer darauf angewiesen, mit selbst erstellten Materialien, denen eine möglichst hohe professionelle Plausibilität eignet, den Erfolg ihres Unterrichts zu überprüfen. Dabei können auch Selbsteinschätzungen der Sch. sowie alternative Formen der Leistungsüberprüfung herangezogen werden. Der Fokus einer solchen Überprüfung liegt auf der Frage: In welchem Maße hat der Unterricht zur Entwicklung und Ausdifferenzierung von Kompetenzen beigetragen? In unserem Beispiel könnten auf der Ebene der Kompetenz Wahrnehmungs- und Darstellungsfähigkeit der Kern des Konfliktes dargestellt und die grundlegenden Referenzstellen für die Bildlosigkeit Gottes, aber auch für die Gottebenbildlichkeit des Menschen erfragt werden. Auf der Ebene der Kompetenz Deutungsfähigkeit sollten Sch. erläutern können, warum sich die Bildlosigkeit Allahs auch auf den Propheten Mohammed erstreckt und warum umgekehrt Christus in der christlichen Ikonografie bildhaft dargestellt werden kann. Im Blick auf die Kompetenz Dialogfähigkeit sollten Sch. ansatzweise erörtern können, welche Konsequenzen sich aus den Grundrechten Religionsfreiheit (Art. 4 GG) und Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) für das Miteinander-Leben von Angehörigen verschiedener Religionen ergeben. Die Form der Lernerfolgsüberprüfung ist dabei nicht unwichtig. Sie soll Auskunft darüber geben, ob Sch. einen Kompetenzgewinn erzielt haben. Eine bloße Abfrage von isolierten Kenntnissen ist daher ausgeschlossen. Vielmehr sollten Überprüfungen darauf abheben, den Umgang mit Wissen zur Lösung von Problemen zu erheben. Rechenschaft ablegen Kompetenzorientierter RU legt Rechenschaft ab über den Lernertrag und damit auch über die Lehrund Lernprozesse, in denen die Sch. Kompetenzen erworben haben. Er stellt sich damit denselben Anforderungen, die jedes Fach an einer öffentlichen Schule erfüllen muss. Er braucht diese Anforderungen nicht zu scheuen, denn die im RU als Ziel definierten Kompetenzen sind integraler Bestandteil einer anspruchsvollen Allgemeinbildung, die dem Vergleich mit Kompetenzen anderer Fächer standhalten. Rechenschaft abzulegen ist eine Aufgabe, die Lehrkräfte und Sch. gleichermaßen betrifft: Sch. sollen mit dem Abschluss der Schulstufen also am Ende der Grundschule, der Sekundarstufe I und zum Abitur nachweisen, welche Kompetenzen religiöser Bildung sie erworben haben, Lehrkräfte erhalten mit Hilfe von Methoden des Feedback und der Evaluation eine Rückmeldung über die Güte des RUs. Den Bedenken gegenüber einer Überprüfung von Kompetenzen sollte insofern Rechnung getragen werden, als die Grenze zwischen dem, was überprüft werden kann und soll, und dem, was sich einer Kontrolle entzieht, möglichst scharf gezogen wird. Ein schlichtes, aber wirkungsvolles Kriterium für eine solche Grenze könnte sein, dass Kompetenzen in dem beschriebenen begrenzten Sinn sich auf das beziehen, was durch organisierten Unterricht erlernbar ist, nicht aber auf das, was in den Bereich persönlicher Identitätsentwicklung, individueller Überzeugungen und religiöser Glaubens- und Lebenspraxis hineinreicht, ebenso wenig natürlich wie in die entsprechenden Optionen für atheistische oder agnostische Positionen oder in andere religiöse Präferenzen. Diese Grenze ist zwar prinzipiell zu bestimmen, muss aber jeweils neu ausgelotet werden. Sie impliziert auch, dass der Unterricht selbst nicht vollständig von dem Erwerb von Kompetenzen dominiert Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
15 wird, sondern Raum bietet für Kommunikation und Interaktion, für das zweckfreie Gespräch über Glauben und Leben und für den Austausch über Erfahrungen, Träume und Hoffnungen. Im RU muss Platz bleiben für bewertungsfreie Zonen. Literatur Bernhard Dressler, Performanz und Kompetenz. Überlegungen zu einer Didaktik des Perspektivenwechsels, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 6/2007, H. 2, Eckhart Klieme et al, Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise, hg. vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung, DIPF, Bonn 2003 Gabriele Obst / Hartmut Lenhard, Kompetenzen und Standards. Was zeichnet einen kompetenz- und standardorientierten evangelischen RU aus? Thesen zu einem notwendigen Perspektivenwechsel, in: entwurf. Religionspädagogische Mitteilungen 2/2006, Michael Wermke, Bildungsstandards im evangelischen RU, in: ders. (Hg.): Bildungsstandards und RU. Perspektiven aus Thüringen, IKS Garamond, Jena 2007, Text (gekürzt) aus: Obst, Gabriele: Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, Vandenhoeck & Ruprechat, Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
16 Glaubensvielfalt und Wahrheitssuche 1. Theologische und didaktische Aspekte Die Tatsache, dass in Deutschland, vor allem bedingt durch die verschiedenen Migrationsbewegungen des 20. Jahrhunderts, Menschen unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse und kultureller Prägungen leben, stellt ohne Zweifel eine besondere gesellschaftliche Herausforderung dar. Angesichts rechtsextremistischer Gewalttaten und immer wieder zu beobachtender Tendenzen von Fremdenfeindlichkeit stellt sich die Frage, ob und inwiefern Deutsche und Nicht-Deutsche, Christen und Nichtchristen friedlich und konstruktiv zusammenleben können. Oft genug sind Urteile über den Fremden oder das Fremde, dem wir direkt in unserer Lebenswelt oder in den Informationsmedien begegnen, von Voreinstellungen und Vorurteilen, Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen geprägt und schwanken zwischen Faszination, Unverständnis und Angst. Kinder und Jugendliche angesichts dieser Situation zu einer verständnisvollen, offenen Haltung und zu Toleranz zu erziehen, erscheint von daher als eine vordringliche Aufgabe, nicht nur für den RU. Allerdings ist die (religiöse) Vielfalt nicht nur als gesellschaftspolitisches Thema von Belang. Angesichts des Verbindlichkeits- und Ausschließlichkeitsanspruchs des christlichen Glaubens, wie er etwa durch Joh 14,6 ( Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. ) oder Apg 4,12 ( In keinem anderen ist Heil. ) biblisch begründet wird aber auch angesichts des Wahrheitsanspruchs anderer Religionen z.b. des Islam wird hier ein ernstes theologisches Problem erkennbar. Letztlich geht es dabei um die Frage, wie es im religiösen Pluralismus unserer Zeit mit der Wahrheit steht. Dieser Frage kann und darf der RU nicht ausweichen. Seit Beginn der 80er Jahre hat es sich in den Diskussionen über dieses Problem eingebürgert, zwischen drei religionstheologischen Grundmodellen zu unterscheiden. Der Exklusivismus geht davon aus, dass der christliche Glaube der einzige Weg zum Heil, das Christentum also die einzig wahre Religion ist. Die anderen Religionen haben keinen Zugang zur erlösenden Offenbarung Gottes und stehen außerhalb der Wahrheit. Der inklusivistische Ansatz behauptet demgegenüber nicht die Ausschließlichkeit, sondern die Überlegenheit des christlichen Glaubens. Den nichtchristlichen Religionen wird eine partielle Wahrheitserkenntnis zugestanden; sie können dementsprechend als Vorstufen des wahren Glaubens auch positiv gewürdigt werden. Für die pluralistische Religionstheologie schließlich, als deren wichtigste Vertreter John Hick, Paul Knitter und Leonard Swidler gelten, steht fest, dass die traditionellen Absolutheitsansprüche gegenüber anderen Religionen nicht mehr berechtigt sind. Da der Mensch in allen Religionen ein und derselben göttlichen bzw. transzendenten Realität begegne, seien die nichtchristlichen Religionen trotz aller Unterschiede grundsätzlich als gleichwertige Wege zum Heil zu betrachten. Weiterhin ist festzuhalten, dass in den letzten Jahren die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Religionen angesichts der allgegenwärtigen Bedrohungen und Probleme unserer Zeit immer stärker ins Bewusstsein getreten ist. In seinem 1990 erschienenen Buch Projekt Weltethos schrieb der Theologe Hans Küng: Immer deutlicher wurde mir in den letzten Jahren, dass die eine Welt, in der wir leben, nur dann eine Chance zum Überleben hat, wenn in ihr nicht länger Räume unterschiedlicher, widersprüchlicher oder gar sich bekämpfender Ethiken existieren. Diese eine Welt braucht das eine Grundethos; diese eine Weltgesellschaft braucht gewiss keine Einheitsreligion und Einheitsideologie, wohl aber einige verbindende und verbindliche Normen, Werte, Ideale und Ziele. (H. Küng, 14). Dementsprechend werden in der Erklärung zum Weltethos, die vom Parlament der Weltreligionen am in Chicago, USA verabschiedet wurde, die verschiedenen Religionen dazu aufgerufen, sich auf die gemeinsamen ethischen Grundwerte zu besinnen und durch die Verpflichtung auf ein Weltethos einen Beitrag zum Frieden zu leisten. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
17 Interreligiöses Lernen erscheint also in mehrfacher Hinsicht als notwendig und wichtig. Dennoch ist festzustellen, dass im Schulalltag interreligiöses Lernen noch nicht überall gängige Praxis ist und in manchen Lehrwerken überhaupt nicht vorkommt. Unter Praktikern wird gern der Einwand formuliert, dass die Sch. doch erst den eigenen Glauben erfahren und verstehen sollten; durch ein Lernen im Vergleich würden sie nur verwirrt. Zuzugeben ist, dass religiöses bzw. interreligiöses Lernen die Sch. nicht überfordern darf. Allerdings gilt nach Wolfgang Pöhlmann (in: M. Kwiran u.a., 21): Lernprozesse werden komplexer. Sie fordern ein Lernen im Dialog. Es wird immer dringlicher, dass religiöse Lernprozesse nicht auf einen binnentheologischen und innerkirchlichen Rahmen beschränkt bleiben. Wenn unser Zusammenleben auch in Zukunft menschlich gestaltet sein soll, brauchen wir das Gespräch der Religionen, muss Lernen Kommunikation zwischen Kulturen sein, müssen wir aufhören, die anderen Kulturen, die nicht unmittelbar zu unserer westlichen Gesellschaft gehören, zu ignorieren. Dieser Aussage weiß sich der folgende Unterrichtsvorschlag, mit dem ein Zugang zu interreligiösem Lernen versucht werden soll, verpflichtet. Keineswegs geht es darum, vorschnell Parallelen oder Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Religionen zu behaupten oder synkretistischen Tendenzen Vorschub zu leisten. Das Trennende zwischen den Religionen lässt sich nicht wegdiskutieren, aber um das Zusammenleben der Menschen auch in Zukunft menschlich und friedlich gestalten zu können, ist in der Tat das Gespräch der Religionen, so schwierig es auch sein mag, auf allen Ebenen auch im Rahmen der Schule unverzichtbar. In der Anfangsphase der Unterrichtseinheit sollten die Sch. ihre Erfahrungen und ihre Einstellungen gegenüber fremden Religionen wahrnehmen und austauschen. Dabei erscheint es sinnvoll, mit den Sch. auf konkrete Beispiele, zum Beispiel aus dem Bereich Schule (vgl. SB, 6 / 7) einzugehen. Auch ist es möglich, dass sich die Lerngruppe ausgehend von den entsprechenden Materialien des SB mit dem Hinduismus (SB, 7) oder dem Buddhismus (SB, 8 / 9), ggf. mit dem Islam näher beschäftigt. Im Idealfall lernen die Sch. Vorurteile und Fehlwahrnehmungen zu korrigieren und so Achtung vor dem Fremden einzuüben. Wenn irgend möglich, sollte das Fremde aber nicht nur in Texten und Bildern begegnen. Wichtig wäre die tatsächliche Begegnung, die ein echtes Kennenlernen und die unmittelbare Auseinandersetzung mit der fremden Religion ermöglicht. Wo dies nicht durchführbar ist, könnte man den Film Abrahams Großstadtkinder einsetzen. Das Video zeigt, wie Sch. eines Kölner Gymnasiums den Kontakt zu jüdischen und muslimischen Studentinnen und Studenten aufnehmen. Anhand des Films ist es möglich, Chancen und Schwierigkeiten des interreligiösen Dialogs zu verdeutlichen, da die beteiligten Personen sich einerseits um ein konstruktives Gespräch bemühen, andererseits aber auch aneinander vorbeireden. In einem weiteren Lernschritt sollte dann mit den Sch. erarbeitet werden, wie das Verhältnis zwischen Christentum und nichtchristlichen Religionen beschrieben werden kann. Dabei sollten sowohl der traditionelle Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens als auch neuere religionstheologische Ansätze in den Blick genommen werden. Die drei religionstheologischen Grundmodelle (SB, 10 / 11) können wie unterrichtliche Erfahrungen zeigen auch von Sch. der Oberstufe nachvollzogen werden und ermöglichen zumindest ansatzweise eine Auseinandersetzung mit den Wahrheitsansprüchen anderer Religionen und Weltanschauungen. Wichtig erscheint es auch, Modelle und Initiativen interreligiöser Begegnungen vorzustellen und mit den Sch. zu erörtern. In dem SB werden hier die Erklärung zum Weltethos und die Aktivitäten der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden (SB, 12 / 13) angesprochen. Abschließend könnte mit den Sch. überlegt werden, nach welchen Spielregeln der Dialog zwischen Menschen verschiedener Religionen gestaltet werden sollte (vgl. dazu die Materialien im SB, 14 / 15). 16 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
18 2. Unterrichtsziele Die Sch. nehmen die religiöse Vielfalt der heutigen Zeit wahr und können sich konstruktiv mit ihr auseinandersetzen kennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Christentum und nichtchristlichen Religionen können eigene religiöse Vorstellungen und Maßstäbe im Gespräch mit Menschen anderer religiöser Überzeugungen begründet vertreten kennen verschiedene Ansätze, wie sich das Verhältnis der Religionen bestimmen lässt, und sind in der Lage, sich mit diesen Ansätzen auseinanderzusetzen können Menschen mit anderen religiösen Überzeugungen in einer Haltung des Respekts begegnen und mit anderen über religiöse Fragen und Überzeugungen respektvoll kommunizieren 3. Kompetenzbezüge Die UE leistet schwerpunktmäßig Beiträge zur Entwicklung folgender Kompetenzen: Wahrnehmungs- und Darstellungsfähigkeit: religiöse Spuren und Dimensionen in der Lebenswelt aufdecken Deutungsfähigkeit: Glaubenszeugnisse in Beziehung zum eigenen Leben und zur gesellschaftlichen Wirklichkeit setzen und ihre Bedeutung aufweisen Urteilsfähigkeit: Formen theologischer Argumentation vergleichen und bewerten Gemeinsamkeiten von Konfessionen und Religionen sowie deren Unterschiede erklären und kriteriengeleitet bewerten im Kontext der Pluralität einen eigenen Standpunkt zu religiösen und ethischen Fragen einnehmen und argumentativ vertreten Dialogfähigkeit: die Perspektive eines anderen einnehmen und in Bezug zum eigenen Standpunkt setzen Gemeinsamkeiten von religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sowie Unterschiede benennen und im Blick auf mögliche Dialogpartner kommunizieren sich aus der Perspektive der eigenen Religion mit anderen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen argumentativ auseinandersetzen Kriterien für eine konstruktive Begegnung, die von Verständigung, Respekt und Anerkennung von Differenz geprägt ist, in dialogischen Situationen berücksichtigen Gestaltungsfähigkeit: religiös relevante Inhalte und Positionen medial und adressatenbezogen präsentieren Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
19 4. Literatur zur Vorbereitung Hans-Christoph Goßmann / André Ritter (Hg.), Interreligiöse Begegnungen. Ein Lernbuch für Schule und Gemeinde, E.B., Hamburg 2000 Glaube und Lernen. Zeitschrift für theologische Urteilsbildung, 11. Jg. Heft 1/1996: Interkulturelle Begegnung und religiöse Vergewisserung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996 Werner Haussmann / Johannes Lähnemann (Hg.), Dein Glaube- mein Glaube. Interreligiöses Lernen in Schule und Gemeinde, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005 Hans Küng, Projekt Weltethos, Piper, München / Zürich 1990 Karl-Josef Kuschel (Hg.), Christentum und nichtchristliche Religionen. Theologische Modelle im 20. Jahrhundert, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994 Manfred Kwiran / Peter Schreiner / Herbert Schultze (Hg.), Dialog der Religionen im Unterricht. Theoretische und praktische Beiträge zu einem Bildungsziel, Comenius Institut, Münster 1996 Johannes Lähnemann, Evangelische Religionspädagogik in interreligiöser Perspektive, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998 Stephan Leimgruber, Interreligiöses Lernen, Kösel, München 2007 Religionsunterricht an höheren Schulen, 41. Jg. Heft 2/1998: Pluralistische Religionstheologie, Patmos, Düsseldorf 1998 Peter Schreiner / Christoph Th. Scheilke (Hg.), Interreligiöses Lernen. Ein Lesebuch, Comenius Institut, Münster 1998 Peter Schreiner / Ursula Sieg / Volker Elsenbast (Hg.), Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh Unterrichtsideen A. Meinungen / Einstellungen gegenüber fremden Religionen Bild: Keith Haring, Untitled, May 29, 1989 (SB, 5) Der amerikanische Maler und Bildhauer Keith Haring ( ) hat die Pop-Art zu einer wirklich populären Kunst gemacht, seine Bildsprache ist nicht zuletzt dank der kommerziellen Verwertung seiner Kunst auf der ganzen Welt verbreitet. Typisch für ihn sind seine abstrahierten Figuren und eingängigen Logos, die der Alltagswelt entlehnt sind und mit denen er die Komplexität des Lebens auf charakteristische Zeichen und Bilder reduziert. Das vorliegende Bild zeigt menschliche Figuren in unterschiedlicher Farbe, deren Körper zum Teil ineinander übergehen. Das Bild strahlt eine starke Dynamik aus, die Figuren sind in Bewegung. Die Sch. beschreiben das Bild. Mögliche Impulse: Wie wird das Zusammentreffen von Menschen in dem Bild von Keith Haring dargestellt? Wie gehen die Figuren auf dem Bild miteinander um? Spiegelt das Bild die Wirklichkeit wider? Impuls: Notieren Sie Gedanken, die Ihnen zum Thema Menschen verschiedener Religionen begegnen sich einfallen. In einer Gesprächsrunde tauschen sich die Sch. über ihre Gedanken aus. Weitere Fragen: Welche Erfahrungen haben wir mit fremden Religionen? Welche Einstellungen gegenüber fremden Religionen sind bei uns in der Lerngruppe vorhanden? Welche Einstellungen gegenüber fremden Religionen beobachten wir in der Gesellschaft? 18 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
20 Text: Begegnungen (SB, 6) Der Autor des Textes, John Hick (*1922), war Professor für Theologie und Religionsphilosophie. Er gilt als einer der bekanntesten Vertreter der pluralistischen Religionstheologie. Fragen zur Texterschließung: Was sind die Lieder, Geschichten und Slogans, von denen im Text die Rede ist? Warum wissen die einzelnen Gruppen nicht voneinander? Wie kann sich eine Begegnung der verschiedenen Gruppen in der Ebene abspielen? Denkbar ist es, verschiedene Formen der Begegnung in der Lerngruppe spielen zu lassen. Weiterführender Impuls: Welche Formen der Begegnung zwischen verschiedenen Religionen sind denkbar? Kennen Sie Beispiele? Die von den Sch. genannten Formen der Begegnung werden an der Tafel notiert und ggf. ergänzt: Um die verschiedenen Formen der Begegnung weiter zu verdeutlichen, könnten die Sch. diese in Form von Comics visualisieren. Die Ergebnisse der Einzelarbeit (oder Partnerarbeit) werden der Lerngruppe präsentiert und dabei erläutert. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Sch. die verschiedenen Formen der Begegnung in Standbildern durch Gestik, Mimik, Körperhaltung usw. darstellen zu lassen. Dabei werden die Standbilder jeweils von einer Kleingruppe vorgestellt und von der Lerngruppe gedeutet. Bild: Cartoon aus den Niederlanden (SB, 6) Die Sch. beschreiben den Cartoon. Mögliche Impulsfragen: Wie verhält sich die Lehrerin in der dargestellten Situation? Ist das Verhalten der Lehrerin verständlich? Was will der Karikaturist mit seiner Zeichnung ausdrücken? Entspricht das, was in dem Cartoon dargestellt ist, den eigenen Erfahrungen? Text: Ein Unterrichtsgespräch in einer 6. Klasse (SB, 7) Es handelt sich um ein Unterrichtsgespräch in einer 6. Klasse einer Grund-, Haupt- und Realschule in Hamburg, der 24 Kinder aus neun Nationen angehören. Die Sch. äußern sich spontan zum Text. Mögliche Fragen: Welche Beobachtungen machen die Kinder? Welche Bedeutung haben die beobachteten religiösen Bräuche? Wie gehen die Kinder mit der für sie fremden Religion um? Möglichkeit der Weiterarbeit: Die Elemente des hinduistischen Glaubens bzw. der hinduistischen Frömmigkeit, die in dem Text genannt werden, könnten von den Sch. (evtl. in Gruppenarbeit) genauer untersucht werden (Nachschlagewerke, Fachbücher): Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen
21 Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt. Auf diese Art und Weise bekommen die Sch. einen ersten Eindruck von einer nichtchristlichen Religion (hier: Hinduismus). Im abschließenden Unterrichtsgespräch könnte herausgearbeitet werden, dass ggf. vorhandene Vorurteile und Fehlwahrnehmungen zum Teil auch durch Informationsvermittlung korrigiert werden können. B. Zwischen Faszination und Abwehr: Das Beispiel Buddhismus Text: Faszination Buddhismus (SB, 8) Der deutsche Arzt Dr. Helmut Klar (Jahrgang 1914) kam als 18-Jähriger zum Buddhismus. Die Sch. lesen das Interview und erläutern, was Helmut Klar am Buddhismus fasziniert. Im Anschluss daran überlegen die Sch., welche weiteren Gründe für die Faszination des Buddhismus eine Rolle spielen. Dabei können u. a. genannt werden: Vernachlässigung der spirituellen Dimension in den christlichen Kirchen / Schwierigkeiten mit der christlichen Gottesvorstellung / Attraktivität praktischer Methoden wie Zen und Yoga / Bedeutung von Frieden und Toleranz im Buddhismus. Weiterführende Aufgabenstellung: Entwerfen Sie einen Antwortbrief an Herrn Klar, in dem Sie sich mit seiner Einstellung auseinander setzen! Foto: Der Dalai Lama unterrichtet in seinem Kloster (SB, 9) Der Dalai Lama ist das politische und religiöse Oberhaupt der Tibeter/innen. Der heutige 14. Dalai Lama (*1935) lebt seit der Besetzung Tibets durch China (1959) im Exil in Dharamsala (Nordindien), wo er die tibetische Tradition pflegt und sich im Rahmen der von ihm geleiteten Exilregierung für die Sache Tibets einsetzt. Häufig ist er unterwegs und verkündet als buddhistischer Lehrer auf der ganzen Welt seine Botschaft vom Frieden, von der Liebe, vom Mitgefühl und von der Zusammenarbeit der Religionen erhielt der Dalai Lama den Friedensnobelpreis. Die Sch. beschreiben das Foto. Impulse: Welchen Eindruck vermittelt das Foto des Dalai Lama? Was fasziniert Menschen im Westen am Dalai Lama und am tibetischen Buddhismus? 20 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Co. KG, Göttingen 2010
Der Mensch Martin Luther
 Marita Koerrenz Der Mensch Martin Luther Eine Unterrichtseinheit für die Grundschule Vandenhoeck & Ruprecht Martin Luther Leben, Werk und Wirkung Herausgegeben von Michael Wermke und Volker Leppin Bibliografische
Marita Koerrenz Der Mensch Martin Luther Eine Unterrichtseinheit für die Grundschule Vandenhoeck & Ruprecht Martin Luther Leben, Werk und Wirkung Herausgegeben von Michael Wermke und Volker Leppin Bibliografische
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6
 Unterrichtsvorhaben A Die Zeit Jesu kennen lernen Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF4); Bibel Aufbau, Inhalte, Gestalten (IF 3) identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser
Unterrichtsvorhaben A Die Zeit Jesu kennen lernen Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF4); Bibel Aufbau, Inhalte, Gestalten (IF 3) identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser
Studienseminar für Lehrämter an Schulen Seminar für das Lehramt für die Sekundarstufe I Lüdenscheid. Ausbildungsdurchgang 2006 / 2008
 Sabine Schmidt Studienseminar für Lehrämter an Schulen Seminar für das Lehramt für die Sekundarstufe I Lüdenscheid Ausbildungsdurchgang 2006 / 2008 Themenplan für die Ausbildung im Fachseminar Evangelische
Sabine Schmidt Studienseminar für Lehrämter an Schulen Seminar für das Lehramt für die Sekundarstufe I Lüdenscheid Ausbildungsdurchgang 2006 / 2008 Themenplan für die Ausbildung im Fachseminar Evangelische
Curriculum Religion. Klasse 5 / 6
 Wesentliches Ziel des Religionsunterrichts am Ebert-Gymnasium ist, dass sich Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung mit anderen religiösen und
Wesentliches Ziel des Religionsunterrichts am Ebert-Gymnasium ist, dass sich Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung mit anderen religiösen und
Zentralabitur 2017 Katholische Religionslehre
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Katholische Religionslehre I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Katholische Religionslehre I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen
Curriculum für das Fach Katholische Religionslehre KLASSE 5: 1. Ich und die Gruppe: 12 Stunden. 2. Die Bibel: 12 Stunden
 1 Curriculum für das Fach Katholische Religionslehre KLASSE 5: 1. Ich und die Gruppe: 12 Stunden - Menschen leben in Beziehungen und spielen verschiedene Rollen - Orientierung für den Umgang miteinander
1 Curriculum für das Fach Katholische Religionslehre KLASSE 5: 1. Ich und die Gruppe: 12 Stunden - Menschen leben in Beziehungen und spielen verschiedene Rollen - Orientierung für den Umgang miteinander
tun. ist unser Zeichen.
 Das Leitbild der DiakonieVerband Brackwede Gesellschaft für Kirche und Diakonie mbh (im Folgenden Diakonie genannt) will Orientierung geben, Profil zeigen, Wege in die Zukunft weisen. Wir in der Diakonie
Das Leitbild der DiakonieVerband Brackwede Gesellschaft für Kirche und Diakonie mbh (im Folgenden Diakonie genannt) will Orientierung geben, Profil zeigen, Wege in die Zukunft weisen. Wir in der Diakonie
Qualitätsanalyse NRW an Evangelischen Schulen. Präambel
 Qualitätsanalyse NRW an Evangelischen Schulen Präambel Evangelische Schulen verstehen sich als öffentliche Schulen, indem sie sich an der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung für Kinder und Jugendliche
Qualitätsanalyse NRW an Evangelischen Schulen Präambel Evangelische Schulen verstehen sich als öffentliche Schulen, indem sie sich an der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung für Kinder und Jugendliche
Lothar Kuld, Bruno Schmid (Hg.) Islamischer Religionsunterricht in Baden-Württemberg
 Lothar Kuld, Bruno Schmid (Hg.) Islamischer Religionsunterricht in Baden-Württemberg Ökumenische Religionspädagogik herausgegeben von Prof. Dr. Astrid Dinter (Pädagogische Hochschule Weingarten) Prof.
Lothar Kuld, Bruno Schmid (Hg.) Islamischer Religionsunterricht in Baden-Württemberg Ökumenische Religionspädagogik herausgegeben von Prof. Dr. Astrid Dinter (Pädagogische Hochschule Weingarten) Prof.
Bildungsstandards konkret formulierte Lernergebnisse Kompetenzen innen bis zum Ende der 4. Schulstufe in Deutsch und Mathematik
 Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Leitfaden zur Abfassung des Portfolios am Lehrstuhl. für Religionspädagogik und Katechetik
 Katholisch-theologische Fakultät Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik Prof. Bernhard Grümme WM Stephanie Dahm M.Ed. Leitfaden zur Abfassung des Portfolios am Lehrstuhl für Religionspädagogik
Katholisch-theologische Fakultät Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik Prof. Bernhard Grümme WM Stephanie Dahm M.Ed. Leitfaden zur Abfassung des Portfolios am Lehrstuhl für Religionspädagogik
Die DFG Projekte RU Bi Qua und KERK an der Humboldt Universität zu Berlin und der neue Rahmenlehrplan RU. Kern der gegenwärtigen Bildungsreform:
 Die DFG Projekte RU Bi Qua und KERK an der Humboldt Universität zu Berlin und der neue Rahmenlehrplan RU 1. Was sind Standards und Kompetenzen? 2. Beschreibung religiöser Kompetenz 3. Erhebung religiöser
Die DFG Projekte RU Bi Qua und KERK an der Humboldt Universität zu Berlin und der neue Rahmenlehrplan RU 1. Was sind Standards und Kompetenzen? 2. Beschreibung religiöser Kompetenz 3. Erhebung religiöser
Ulrich Köpf, Martin Luther: Wie man beten soll
 Ulrich Köpf / Peter Zimmerling (Hg.) Martin Luther Wie man beten soll Für Meister Peter den Barbier Vandenhoeck & Ruprecht Umschlagabbildung: Ulrich Köpf, Martin Luther: Wie man beten soll akg images 1-L76-E1544
Ulrich Köpf / Peter Zimmerling (Hg.) Martin Luther Wie man beten soll Für Meister Peter den Barbier Vandenhoeck & Ruprecht Umschlagabbildung: Ulrich Köpf, Martin Luther: Wie man beten soll akg images 1-L76-E1544
Ethik- Lehrplan Gymnasium
 Ethik- Lehrplan Gymnasium Zur Kompetenzentwicklung im Ethikunterricht 1 Beim Urteilen ist der Mensch als Einzelner immer unvollkommen. (Aristoteles) Kernstück des Ethikunterrichts ist die gemeinsame Reflexion,
Ethik- Lehrplan Gymnasium Zur Kompetenzentwicklung im Ethikunterricht 1 Beim Urteilen ist der Mensch als Einzelner immer unvollkommen. (Aristoteles) Kernstück des Ethikunterrichts ist die gemeinsame Reflexion,
RHETORIK SEK. Entwickelt an den docemus Privatschulen
 RHETORIK SEK Entwickelt an den docemus Privatschulen Erarbeitet: Dr. Ramona Benkenstein Idee/Layout: Brandung. Ideen, Marken, Strategien www.brandung-online.de ISBN 978-3-942657-01-3 1. Auflage 2010 Polymathes
RHETORIK SEK Entwickelt an den docemus Privatschulen Erarbeitet: Dr. Ramona Benkenstein Idee/Layout: Brandung. Ideen, Marken, Strategien www.brandung-online.de ISBN 978-3-942657-01-3 1. Auflage 2010 Polymathes
Katholische Kindertagesstätten. Qualitätsmerkmale religiöser Bildung und Erziehung
 Katholische Kindertagesstätten Mit Kindern Glauben leben Qualitätsmerkmale religiöser Bildung und Erziehung ERZDIÖZESE MÜNCHEN UND FREISING Mit Kindern Glauben leben Qualitätsmerkmale religiöser Bildung
Katholische Kindertagesstätten Mit Kindern Glauben leben Qualitätsmerkmale religiöser Bildung und Erziehung ERZDIÖZESE MÜNCHEN UND FREISING Mit Kindern Glauben leben Qualitätsmerkmale religiöser Bildung
Religionen oder viele Wege führen zu Gott
 Religionen oder viele Wege führen zu Gott Menschen haben viele Fragen: Woher kommt mein Leben? Warum lebe gerade ich? Was kommt nach dem Tod? Häufig gibt den Menschen ihre Religion Antwort auf diese Fragen
Religionen oder viele Wege führen zu Gott Menschen haben viele Fragen: Woher kommt mein Leben? Warum lebe gerade ich? Was kommt nach dem Tod? Häufig gibt den Menschen ihre Religion Antwort auf diese Fragen
Kompetenzorientierter Unterricht in den modernen Fremdsprachen
 1 Kompetenzorientierter Unterricht in den modernen Fremdsprachen A. Was ist eine Kompetenz? Referenzdefinition von Franz Weinert (2001): Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
1 Kompetenzorientierter Unterricht in den modernen Fremdsprachen A. Was ist eine Kompetenz? Referenzdefinition von Franz Weinert (2001): Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
Fachbereich Geisteswissenschaften Fachgruppe Katholische Theologie Campus Essen
 Fachbereich Geisteswissenschaften Fachgruppe Katholische Theologie Campus Essen Studienordnung für das Fach Katholische Theologie an der Universität Duisburg-Essen im Studiengang für das Lehramt für Grund-,
Fachbereich Geisteswissenschaften Fachgruppe Katholische Theologie Campus Essen Studienordnung für das Fach Katholische Theologie an der Universität Duisburg-Essen im Studiengang für das Lehramt für Grund-,
Heinrich Hemme, Der Mathe-Jogger 2
 Heinrich Hemme Der Mathe-Jogger 2 100 mathematische Rätsel mit ausführlichen Lösungen Vandenhoeck & Ruprecht Mit zahlreichen Abbildungen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die
Heinrich Hemme Der Mathe-Jogger 2 100 mathematische Rätsel mit ausführlichen Lösungen Vandenhoeck & Ruprecht Mit zahlreichen Abbildungen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die
Computer im Unterricht. Konzept zum Einsatz des Computers im Unterricht in der Volksschule
 Computer im Unterricht Konzept zum Einsatz des Computers im Unterricht in der Volksschule 1. Computer im Unterricht 1.1 Einleitende Gedanken Der Umgang mit dem Computer hat sich zu einer Kulturtechnik
Computer im Unterricht Konzept zum Einsatz des Computers im Unterricht in der Volksschule 1. Computer im Unterricht 1.1 Einleitende Gedanken Der Umgang mit dem Computer hat sich zu einer Kulturtechnik
Berührt von Gott, der allen Menschen Gutes will... 2 Wer sich von Gott geliebt weiß, kann andere lieben... 2 In wacher Zeitgenossenschaft die
 Berührt von Gott, der allen Menschen Gutes will... 2 Wer sich von Gott geliebt weiß, kann andere lieben... 2 In wacher Zeitgenossenschaft die Menschen wahrnehmen... 3 Offen für alle Menschen, die uns brauchen...
Berührt von Gott, der allen Menschen Gutes will... 2 Wer sich von Gott geliebt weiß, kann andere lieben... 2 In wacher Zeitgenossenschaft die Menschen wahrnehmen... 3 Offen für alle Menschen, die uns brauchen...
G A N Z H E I T L I C H Z U V E R L Ä S S I G R E S P E K T V O L L L E I S T U N G S O R I E N T I E R T S O Z I A L V E R A N T W O R T L I C H
 An der Gustav-Freytag-Schule lernen, heißt G A N Z H E I T L I C H Z U V E R L Ä S S I G R E S P E K T V O L L L E I S T U N G S O R I E N T I E R T S O Z I A L V E R A N T W O R T L I C H F R Ö H L I
An der Gustav-Freytag-Schule lernen, heißt G A N Z H E I T L I C H Z U V E R L Ä S S I G R E S P E K T V O L L L E I S T U N G S O R I E N T I E R T S O Z I A L V E R A N T W O R T L I C H F R Ö H L I
dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen stehen:
 Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Lehrplan. Grundschule
 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Lehrplan Grundschule - 21 - EVANGELISCHE RELIGION Seite 1 Der Beitrag des Faches zur grundlegenden Bildung, zur
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Lehrplan Grundschule - 21 - EVANGELISCHE RELIGION Seite 1 Der Beitrag des Faches zur grundlegenden Bildung, zur
für den Religionsunterricht Argumente an öffentlichen Schulen! Religion in der Schule: Eine Initiative der katholischen Kirche.
 für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen! Religion in der Schule: Eine Initiative der katholischen Kirche. 1 Die religiösen Fragen der Kinder ernst nehmen Schon kleine Kinder stellen die großen
für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen! Religion in der Schule: Eine Initiative der katholischen Kirche. 1 Die religiösen Fragen der Kinder ernst nehmen Schon kleine Kinder stellen die großen
Impulse zur Gestaltung kompetenzorientierten Sportunterrichts
 Impulse zur Gestaltung kompetenzorientierten Sportunterrichts nach dem Lehr-Lern-Modell von Josef Leisen (Studienseminar Koblenz) StD Stefan Nitsche Fachberater Sport, Dez. 43 und Fachleiter Sport am ZfsL
Impulse zur Gestaltung kompetenzorientierten Sportunterrichts nach dem Lehr-Lern-Modell von Josef Leisen (Studienseminar Koblenz) StD Stefan Nitsche Fachberater Sport, Dez. 43 und Fachleiter Sport am ZfsL
Inhaltsverzeichnis. 1 Leitbild Grundlagen eines evangelischen Bildungsverständnisses. Kapitel 1
 Inhaltsverzeichnis 1 Leitbild Grundlagen eines evangelischen Bildungsverständnisses 1 Leitbild Grundlagen eines evangelischen Bildungsverständnisses Die EKHN hat ihr Selbstverständnis der Kindertagesstättenarbeit
Inhaltsverzeichnis 1 Leitbild Grundlagen eines evangelischen Bildungsverständnisses 1 Leitbild Grundlagen eines evangelischen Bildungsverständnisses Die EKHN hat ihr Selbstverständnis der Kindertagesstättenarbeit
I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein?
 I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein? In seiner Hausmitteilung vom 20. 12. 1997 schreibt Der Spiegel: «Unbestreitbar bleibt, daß die großen Kirchen in einer Zeit, in der alle Welt den Verlust
I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein? In seiner Hausmitteilung vom 20. 12. 1997 schreibt Der Spiegel: «Unbestreitbar bleibt, daß die großen Kirchen in einer Zeit, in der alle Welt den Verlust
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus AUFGABENFORMATE IN DEN ABITURPRÜFUNGEN DES ACHTJÄHRIGEN GYMNASIUMS DEUTSCH Der Prüfling bearbeitet eine aus 5 Aufgaben. Zur Auswahl stehen: Aufgabe
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus AUFGABENFORMATE IN DEN ABITURPRÜFUNGEN DES ACHTJÄHRIGEN GYMNASIUMS DEUTSCH Der Prüfling bearbeitet eine aus 5 Aufgaben. Zur Auswahl stehen: Aufgabe
RHETORIK SEK. Entwickelt an den docemus Privatschulen
 RHETORIK SEK Entwickelt an den docemus Privatschulen Erarbeitet: Dr. Ramona Benkenstein und Anemone Fischer Idee/Layout: Brandung. Ideen, Marken, Strategien www.brandung-online.de ISBN 978-3-942657-00-6
RHETORIK SEK Entwickelt an den docemus Privatschulen Erarbeitet: Dr. Ramona Benkenstein und Anemone Fischer Idee/Layout: Brandung. Ideen, Marken, Strategien www.brandung-online.de ISBN 978-3-942657-00-6
Lehrplan. Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - Fachschule für Sozialpädagogik - Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur
 Lehrplan Vorbereitungskurs im Rahmen des einjährigen beruflichen Vorpraktikums in der Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher/ zur Staatlich anerkannten Erzieherin Akademie für Erzieher und Erzieherinnen
Lehrplan Vorbereitungskurs im Rahmen des einjährigen beruflichen Vorpraktikums in der Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher/ zur Staatlich anerkannten Erzieherin Akademie für Erzieher und Erzieherinnen
Thesen zu einer zeitgemäßen Fortbildung und Personalentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern in den MINT-Fächern
 Nationales MINT Forum (Hrsg.) Thesen zu einer zeitgemäßen Fortbildung und Personalentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern in den MINT-Fächern Empfehlungen des Nationalen MINT Forums (Nr. 4) aus der Arbeitsgruppe
Nationales MINT Forum (Hrsg.) Thesen zu einer zeitgemäßen Fortbildung und Personalentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern in den MINT-Fächern Empfehlungen des Nationalen MINT Forums (Nr. 4) aus der Arbeitsgruppe
Merkmale guten und schlechten Unterrichts
 HS Diagnostik des Unterrichts Merkmale guten und schlechten Unterrichts Stellenausschreibung 2 Stellen als studentische Hilfskraft und eine Tutorenstelle: (40Std./Monat) Aufgaben am Lehrstuhl: Unterstützung
HS Diagnostik des Unterrichts Merkmale guten und schlechten Unterrichts Stellenausschreibung 2 Stellen als studentische Hilfskraft und eine Tutorenstelle: (40Std./Monat) Aufgaben am Lehrstuhl: Unterstützung
Modul A (Master of Education)
 Modul A Religiöses Lernen und schulische Praxis 9 CP 270 Std. (75 Präsenz; 195 der SWS: 5 Pflichtmodul jedes Semester/ 3semstr. Dieses Modul integriert religionspädagogisches und juristisches Wissen zum
Modul A Religiöses Lernen und schulische Praxis 9 CP 270 Std. (75 Präsenz; 195 der SWS: 5 Pflichtmodul jedes Semester/ 3semstr. Dieses Modul integriert religionspädagogisches und juristisches Wissen zum
Karl-Jaspers-Klinik. Führungsgrundsätze August 2009
 Karl-Jaspers-Klinik Führungsgrundsätze August 2009 Vorwort Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Führungskräfte, wir haben in der Karl-Jaspers-Klinik begonnen, uns mit dem Thema Führung aktiv auseinanderzusetzen.
Karl-Jaspers-Klinik Führungsgrundsätze August 2009 Vorwort Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Führungskräfte, wir haben in der Karl-Jaspers-Klinik begonnen, uns mit dem Thema Führung aktiv auseinanderzusetzen.
Erziehung für das Militär? Erziehung für den Frieden!
 Erziehung für das Militär? Erziehung für den Frieden! Eine Handreichung für den Unterricht zur Auseinandersetzung mit der vormilitärischen Erziehung in der DDR 1 Hinweis 1. Wir danken allen Verlagen, die
Erziehung für das Militär? Erziehung für den Frieden! Eine Handreichung für den Unterricht zur Auseinandersetzung mit der vormilitärischen Erziehung in der DDR 1 Hinweis 1. Wir danken allen Verlagen, die
Didaktisches Grundlagenstudium Mathematik
 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen Fächerspezifische Vorgaben Didaktisches Grundlagenstudium Mathematik für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie den
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen Fächerspezifische Vorgaben Didaktisches Grundlagenstudium Mathematik für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie den
ICT und Medien fächerübergreifend und kompetenzorientiert unterrichten
 Pädagogische Tagung «Kompetenzorientierte Förderung und Beurteilung» Workshop 3: ICT und Medien - fächerübergreifend und kompetenzorientiert unterrichten Basel, Mittwoch, 11. September 2013 ICT und Medien
Pädagogische Tagung «Kompetenzorientierte Förderung und Beurteilung» Workshop 3: ICT und Medien - fächerübergreifend und kompetenzorientiert unterrichten Basel, Mittwoch, 11. September 2013 ICT und Medien
Damit Würde Wirklichkeit wird
 Evangelisch-lutherisches Missionswerk in Niedersachsen Stiftung privaten Rechts Georg-Haccius-Straße 9 29320 Hermannsburg Postfach 1109 29314 Hermannsburg Damit Würde Wirklichkeit wird Grundsätze der Entwicklungsarbeit
Evangelisch-lutherisches Missionswerk in Niedersachsen Stiftung privaten Rechts Georg-Haccius-Straße 9 29320 Hermannsburg Postfach 1109 29314 Hermannsburg Damit Würde Wirklichkeit wird Grundsätze der Entwicklungsarbeit
Interkulturelle Kompetenz als Herausforderung für die Schule
 Interkulturelle Kompetenz als Herausforderung für die Schule Baustein 2 der Standpunkte-Reihe Schule in Berlin heißt: Schule in der Einwanderungsgesellschaft am 18.04.07 in der Friedrich-Ebert-Stiftung
Interkulturelle Kompetenz als Herausforderung für die Schule Baustein 2 der Standpunkte-Reihe Schule in Berlin heißt: Schule in der Einwanderungsgesellschaft am 18.04.07 in der Friedrich-Ebert-Stiftung
un-üb-er-sichtlich! Welche konzeptionellen Antworten hat die Politische Bildung auf die Herausforderungen des Alltags?
 Vortrag im Rahmen der Veranstaltung: un-üb-er-sichtlich! Welche konzeptionellen Antworten hat die Politische Bildung auf die Herausforderungen des Alltags? Die Idee diese Veranstaltung mit der Überschrift
Vortrag im Rahmen der Veranstaltung: un-üb-er-sichtlich! Welche konzeptionellen Antworten hat die Politische Bildung auf die Herausforderungen des Alltags? Die Idee diese Veranstaltung mit der Überschrift
Ist Gott eine Person?
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Ist Gott eine Person? 1. Schwierigkeiten mit dem Begriff Person Karl Rahner: Die Aussage, daß Gott Person, daß er ein persönlicher Gott sei, gehört zu den grundlegenden
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Ist Gott eine Person? 1. Schwierigkeiten mit dem Begriff Person Karl Rahner: Die Aussage, daß Gott Person, daß er ein persönlicher Gott sei, gehört zu den grundlegenden
Die Thüringer Gemeinschaftsschule. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Die Thüringer Gemeinschaftsschule Ziel einer guten Schule ist es, allen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen. Dazu gehört die Integration von leistungsschwächeren und sozial benachteiligten
Die Thüringer Gemeinschaftsschule Ziel einer guten Schule ist es, allen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen. Dazu gehört die Integration von leistungsschwächeren und sozial benachteiligten
Lehrplan Schwerpunktfach Italienisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Schwerpunktfach Italienisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden - - 4 4 3 4
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Schwerpunktfach Italienisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden - - 4 4 3 4
Ulrike Kuschel, Anna-Fee Neugebauer, Karsten H. Petersen (Hg.) Punktierungen des Bösen
 Ulrike Kuschel, Anna-Fee Neugebauer, Karsten H. Petersen (Hg.) Punktierungen des Bösen IMAGO Ulrike Kuschel, Anna-Fee Neugebauer, Karsten H. Petersen (Hg.) Punktierungen des Bösen Das Werk Menschen. von
Ulrike Kuschel, Anna-Fee Neugebauer, Karsten H. Petersen (Hg.) Punktierungen des Bösen IMAGO Ulrike Kuschel, Anna-Fee Neugebauer, Karsten H. Petersen (Hg.) Punktierungen des Bösen Das Werk Menschen. von
9. Sozialwissenschaften
 9. Sozialwissenschaften 9.1 Allgemeines Die Lektionendotation im Fach Sozialwissenschaft beträgt 200 Lektionen. Davon sind 10% für den interdisziplinären Unterricht freizuhalten. (Stand April 2005) 9.2
9. Sozialwissenschaften 9.1 Allgemeines Die Lektionendotation im Fach Sozialwissenschaft beträgt 200 Lektionen. Davon sind 10% für den interdisziplinären Unterricht freizuhalten. (Stand April 2005) 9.2
Megatrend Esoterik. Das große Geschäft mit der Spiritualität
 Megatrend Esoterik. Das große Geschäft mit der Spiritualität Dimensionen die Welt der Wissenschaft Gestaltung: Sabrina Adlbrecht Sendedatum: 12. September 2013 Länge: ca. 25 Minuten Aktivitäten 1) Esoterik
Megatrend Esoterik. Das große Geschäft mit der Spiritualität Dimensionen die Welt der Wissenschaft Gestaltung: Sabrina Adlbrecht Sendedatum: 12. September 2013 Länge: ca. 25 Minuten Aktivitäten 1) Esoterik
Evaluation der Erprobungsphase des Projekts MUS-E Modellschule - Kurzfassung des Evaluationsberichts -
 Evaluation der Erprobungsphase des Projekts MUS-E Modellschule - Kurzfassung des Evaluationsberichts - Kontakt: Dr. Ingo Diedrich Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.v. Weender Landstraße
Evaluation der Erprobungsphase des Projekts MUS-E Modellschule - Kurzfassung des Evaluationsberichts - Kontakt: Dr. Ingo Diedrich Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.v. Weender Landstraße
Punktierungen des Bösen
 Imago Punktierungen des Bösen Das Werk Menschen. von Bernd Fischer mit Beiträgen aus Psychoanalyse, Strafrecht, Kunstwissenschaft, Theologie und Philosophie Bearbeitet von Bernd Fischer, Ulrike Kuschel,
Imago Punktierungen des Bösen Das Werk Menschen. von Bernd Fischer mit Beiträgen aus Psychoanalyse, Strafrecht, Kunstwissenschaft, Theologie und Philosophie Bearbeitet von Bernd Fischer, Ulrike Kuschel,
Fachschaft Chemie Steinbruch: Bewertungskriterien für Abschlussarbeiten (Gymnasium und Fachmittelschule)
 Fachschaft Chemie Steinbruch: Bewertungskriterien für Abschlussarbeiten (Gymnasium und Fachmittelschule) Basierend auf den Vorschlägen für ein Bewertungssystem von Abschlussarbeiten in: Bonati, Peter und
Fachschaft Chemie Steinbruch: Bewertungskriterien für Abschlussarbeiten (Gymnasium und Fachmittelschule) Basierend auf den Vorschlägen für ein Bewertungssystem von Abschlussarbeiten in: Bonati, Peter und
Schriftliches Staatsexamen EWS SCHULPÄDAGOGIK
 Dr. Wolf-Thorsten Saalfrank Lehrstuhl für Schulpädagogik LehramtPRO-Das Professionalisierungsprogramm des MZL Schriftliches Staatsexamen EWS SCHULPÄDAGOGIK Staatsprüfung EWS -Alles was man wissen muss!
Dr. Wolf-Thorsten Saalfrank Lehrstuhl für Schulpädagogik LehramtPRO-Das Professionalisierungsprogramm des MZL Schriftliches Staatsexamen EWS SCHULPÄDAGOGIK Staatsprüfung EWS -Alles was man wissen muss!
LehrplanPLUS Bayern. ... die Reise beginnt! Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
 Neu! LehrplanPLUS Bayern... die Reise beginnt! Liebe Lehrerinnen und Lehrer, zum Schuljahr 2014/2015 tritt für Bayerns Grundschulen ein neuer Lehrplan in Kraft. Das stellt Sie vor neue und höchst spannende
Neu! LehrplanPLUS Bayern... die Reise beginnt! Liebe Lehrerinnen und Lehrer, zum Schuljahr 2014/2015 tritt für Bayerns Grundschulen ein neuer Lehrplan in Kraft. Das stellt Sie vor neue und höchst spannende
Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften. Chemie Marcus Mössner
 Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Bildungsabschluss (Beschluss vom 16.12.2004) Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche
Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Bildungsabschluss (Beschluss vom 16.12.2004) Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan am Ruhr-Gymnasium Witten. Physik. Teil I
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan am Ruhr-Gymnasium Witten Physik Teil I Inhaltsverzeichnis Seite Schulische Rahmenbedingungen im Fach Physik 3 Grundsätze fachmethodischer und fachdidaktischer Arbeit
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan am Ruhr-Gymnasium Witten Physik Teil I Inhaltsverzeichnis Seite Schulische Rahmenbedingungen im Fach Physik 3 Grundsätze fachmethodischer und fachdidaktischer Arbeit
Franz Wester Individualisierung als Grundbegriff in der Unterrichtsentwicklung - Klärungen
 Franz Wester Individualisierung als Grundbegriff in der Unterrichtsentwicklung - Klärungen Individualisierung Unterrichtsentwicklung als Grundbegriff in der UE Kompetenzraster Individualisierung Lernbüro
Franz Wester Individualisierung als Grundbegriff in der Unterrichtsentwicklung - Klärungen Individualisierung Unterrichtsentwicklung als Grundbegriff in der UE Kompetenzraster Individualisierung Lernbüro
Whittaker, Holtermann, Hänni / Einführung in die griechische Sprache
 $ 8. Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
$ 8. Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
Michael Diener Steffen Kern (Hrsg.) Ein Impuls für die Zukunft der Kirche
 Michael Diener Steffen Kern (Hrsg.) Ein Impuls für die Zukunft der Kirche Inhalt Vorwort... 7 Zeit zum Aufstehen Ein Impuls für die Zukunft der Kirche... 11 These 1: Jesus Christus ist der Sohn Gottes.
Michael Diener Steffen Kern (Hrsg.) Ein Impuls für die Zukunft der Kirche Inhalt Vorwort... 7 Zeit zum Aufstehen Ein Impuls für die Zukunft der Kirche... 11 These 1: Jesus Christus ist der Sohn Gottes.
Master of Arts in Religionslehre mit Lehrdiplom für Maturitätsschulen im Schulfach Religionslehre
 Theologische Fakultät INFORMATIONEN ZUM STUDIENGANG Master of Arts in Religionslehre mit Lehrdiplom für Maturitätsschulen im Schulfach Religionslehre (Master of Arts in Secondary Education Religion) Willkommen
Theologische Fakultät INFORMATIONEN ZUM STUDIENGANG Master of Arts in Religionslehre mit Lehrdiplom für Maturitätsschulen im Schulfach Religionslehre (Master of Arts in Secondary Education Religion) Willkommen
Zusatzstudiengang Religionspädagogik und gemeindepädagogische Zusatzqualifikation an der EFH Darmstadt
 Zusatzstudiengang Religionspädagogik und gemeindepädagogische Zusatzqualifikation an der EFH Darmstadt An der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt (EFHD) wird seit dem Wintersemester 2002/2003 der Zusatzstudiengang
Zusatzstudiengang Religionspädagogik und gemeindepädagogische Zusatzqualifikation an der EFH Darmstadt An der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt (EFHD) wird seit dem Wintersemester 2002/2003 der Zusatzstudiengang
Alfred Töpper (Hg.) Qualität von Weiterbildungsmaßnahmen. Einflussfaktoren und Qualitätsmanagement im Spiegel empirischer Befunde
 Alfred Töpper (Hg.) Qualität von Weiterbildungsmaßnahmen Einflussfaktoren und Qualitätsmanagement im Spiegel empirischer Befunde Alfred Töpper (Hg.) Qualität von Weiterbildungsmaßnahmen Einflussfaktoren
Alfred Töpper (Hg.) Qualität von Weiterbildungsmaßnahmen Einflussfaktoren und Qualitätsmanagement im Spiegel empirischer Befunde Alfred Töpper (Hg.) Qualität von Weiterbildungsmaßnahmen Einflussfaktoren
Internationaler Arbeitsbogen für Schüler/Auszubildende INtheMC
 Internationaler Arbeitsbogen für Schüler/Auszubildende INtheMC BOGEN Nr./Titel: 6. ARBEITEN IM AUSLAND - Arbeitspraktiken Name d. Schüler/in EQR-Stufe AUSGEGEBEN AM: FÄLLIG AM: 2 3 4 PRÜFUNGS- VERSUCHE
Internationaler Arbeitsbogen für Schüler/Auszubildende INtheMC BOGEN Nr./Titel: 6. ARBEITEN IM AUSLAND - Arbeitspraktiken Name d. Schüler/in EQR-Stufe AUSGEGEBEN AM: FÄLLIG AM: 2 3 4 PRÜFUNGS- VERSUCHE
Aufnahme in die Vorstufe
 Profiloberstufe Die gymnasiale Oberstufe besteht bei uns aus : Vorstufe (Jahrgang 11) S1-S4 (Jahrgang 12 und 13) Grundinformationen: Die endet mit den Abiturprüfungen. Für alle Schulformen gelten die gleichen
Profiloberstufe Die gymnasiale Oberstufe besteht bei uns aus : Vorstufe (Jahrgang 11) S1-S4 (Jahrgang 12 und 13) Grundinformationen: Die endet mit den Abiturprüfungen. Für alle Schulformen gelten die gleichen
Neuer Artikel 8 a im Schulgesetz Ba-Wü:
 Neuer Artikel 8 a im Schulgesetz Ba-Wü: Gemeinschaftsschule (1) Die Gemeinschaftsschule vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang Schülern der Sekundarstufe I je nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten
Neuer Artikel 8 a im Schulgesetz Ba-Wü: Gemeinschaftsschule (1) Die Gemeinschaftsschule vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang Schülern der Sekundarstufe I je nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten
Wichtige Merkmale der Erzieher/innenausbildung
 Wichtige Merkmale der Erzieher/innenausbildung Lehrplangeleitet Enge Theorie-Praxisverzahnung Verknüpfung von fachpraktischen und fachtheoretischen Fächern Generalistische Ausbildung Entwicklung einer
Wichtige Merkmale der Erzieher/innenausbildung Lehrplangeleitet Enge Theorie-Praxisverzahnung Verknüpfung von fachpraktischen und fachtheoretischen Fächern Generalistische Ausbildung Entwicklung einer
Mit. ernim RU arbeiten
 Mit ernim RU arbeiten Bildsorten Bilder Abbilder: Foto, Zeichnung (Film, Video) Sinn-Bilder: z.b. Kunstbild, Symbol, Karikatur logische analytische Bilder: Diagramme, Tabellen, Schemata Der Mehr-Wert eines
Mit ernim RU arbeiten Bildsorten Bilder Abbilder: Foto, Zeichnung (Film, Video) Sinn-Bilder: z.b. Kunstbild, Symbol, Karikatur logische analytische Bilder: Diagramme, Tabellen, Schemata Der Mehr-Wert eines
Mathematik. Erich und Hildegard Bulitta. Nachhilfe Mathematik. Teil 5: Zins- und Promillerechnen Gesamtband (Band 1 + 2) Übungsheft
 Mathematik Erich und Hildegard Bulitta Nachhilfe Mathematik Teil 5: Zins- und Promillerechnen (Band 1 + 2) Übungsheft Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Mathematik Erich und Hildegard Bulitta Nachhilfe Mathematik Teil 5: Zins- und Promillerechnen (Band 1 + 2) Übungsheft Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Abiturjahrgang 2014 / 2016. Katholische Religionslehre
 Meldung bei der Oberstufenkoordination: Kursversion: Dienstag, 15. Oktober 2013 Langversion: Montag, 02.12.2013 Abiturjahrgang 2014 / 2016 P-Seminar Leitfach: Katholische Religionslehre 1. Studien- und
Meldung bei der Oberstufenkoordination: Kursversion: Dienstag, 15. Oktober 2013 Langversion: Montag, 02.12.2013 Abiturjahrgang 2014 / 2016 P-Seminar Leitfach: Katholische Religionslehre 1. Studien- und
Interreligiöse Dialogkompetenz M.A. Dreijähriger Weiterbildungsmaster
 Interreligiöse Dialogkompetenz M.A. Dreijähriger Weiterbildungsmaster INTERRELIGIÖSE DIALOGKOMPETENZ Bildungseinrichtungen, Träger Sozialer Arbeit, Seelsorgeanbieter, aber auch Institutionen der öffentlichen
Interreligiöse Dialogkompetenz M.A. Dreijähriger Weiterbildungsmaster INTERRELIGIÖSE DIALOGKOMPETENZ Bildungseinrichtungen, Träger Sozialer Arbeit, Seelsorgeanbieter, aber auch Institutionen der öffentlichen
Aus dem Bericht zur Qualitätsanalyse:
 Aus dem Bericht zur Qualitätsanalyse: In ihrem Leitbild bezieht sich die Schule auf ein Zitat Janusz Korczaks: Wir wollen gemeinsames Leben und Lernen sowie den respektvollen Umgang von Kindern mit unterschiedlichem
Aus dem Bericht zur Qualitätsanalyse: In ihrem Leitbild bezieht sich die Schule auf ein Zitat Janusz Korczaks: Wir wollen gemeinsames Leben und Lernen sowie den respektvollen Umgang von Kindern mit unterschiedlichem
Kompetenzorientiert Unterrichten
 Kompetenzorientiert Unterrichten Manuela Paechter Pädagogische Psychologie Karl-Franzens-Universität Graz manuela.paechter@uni-graz.at Themen 1.Kognitionspsychologische Grundlagen: Welches Wissen soll
Kompetenzorientiert Unterrichten Manuela Paechter Pädagogische Psychologie Karl-Franzens-Universität Graz manuela.paechter@uni-graz.at Themen 1.Kognitionspsychologische Grundlagen: Welches Wissen soll
Mag. a Doris Hummer Landesrätin für Bildung, Forschung und Wissenschaft, Jugend und Frauen
 I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz am 29. Oktober 2010 Campus Bildung Zukunft Denken Qualitätsmanagement in der Schule Mag. a Doris Hummer Landesrätin für Bildung, Forschung und Wissenschaft, Jugend
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz am 29. Oktober 2010 Campus Bildung Zukunft Denken Qualitätsmanagement in der Schule Mag. a Doris Hummer Landesrätin für Bildung, Forschung und Wissenschaft, Jugend
Die Führungskraft als Coach eine Illusion?
 Die Führungskraft als Coach eine Illusion? Karin Pape Metrion Management Consulting GbR Martinskirchstraße 74 60529 Frankfurt am Main Telefon 069 / 9 39 96 77-0 Telefax 069 / 9 39 96 77-9 www.metrionconsulting.de
Die Führungskraft als Coach eine Illusion? Karin Pape Metrion Management Consulting GbR Martinskirchstraße 74 60529 Frankfurt am Main Telefon 069 / 9 39 96 77-0 Telefax 069 / 9 39 96 77-9 www.metrionconsulting.de
BILDUNGSSTANDARDS PRIMARBEREICH DEUTSCH
 BILDUNGSSTANDARDS PRIMARBEREICH DEUTSCH 1. Kompetenzbereiche des Faches Deutsch In der Grundschule erweitern die Kinder ihre Sprachhandlungskompetenz in den Bereichen des Sprechens und Zuhörens, des Schreibens,
BILDUNGSSTANDARDS PRIMARBEREICH DEUTSCH 1. Kompetenzbereiche des Faches Deutsch In der Grundschule erweitern die Kinder ihre Sprachhandlungskompetenz in den Bereichen des Sprechens und Zuhörens, des Schreibens,
Kompetenzerweiternde Unterrichtsplanung der Europäischen Volksschule
 Kompetenzerweiternde Unterrichtsplanung der Europäischen Volksschule Schlüsselkompetenzen Kompetenzen sind definiert als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die an das jeweilige
Kompetenzerweiternde Unterrichtsplanung der Europäischen Volksschule Schlüsselkompetenzen Kompetenzen sind definiert als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die an das jeweilige
Merkblatt für das Wirtschaftsgymnasium - Profil Wirtschaft (WGW) -
 Herdstraße 7/2 * 78050 Villingen-Schwenningen * 07721 9831-0 * Fax 07721 9831-50 E-Mail info@ks1-vs.de * Homepage www.ks1-vs.de Merkblatt für das Wirtschaftsgymnasium - Profil Wirtschaft (WGW) - Aufnahmevoraussetzungen
Herdstraße 7/2 * 78050 Villingen-Schwenningen * 07721 9831-0 * Fax 07721 9831-50 E-Mail info@ks1-vs.de * Homepage www.ks1-vs.de Merkblatt für das Wirtschaftsgymnasium - Profil Wirtschaft (WGW) - Aufnahmevoraussetzungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Der Kreislauf unseres Geldes. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Kreislauf unseres Geldes Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Sekundarstufe Klaus Ruf & A. Kalmbach-Ruf Der
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Kreislauf unseres Geldes Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Sekundarstufe Klaus Ruf & A. Kalmbach-Ruf Der
2235.1.1.1-UK. Seminare in den Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
 2235.1.1.1-UK Seminare in den Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. Juni 2008 Az.: VI.9-5 S 5610-6.64 089 Die Schülerinnen
2235.1.1.1-UK Seminare in den Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. Juni 2008 Az.: VI.9-5 S 5610-6.64 089 Die Schülerinnen
Leistung fördern und bewerten
 Leistung fördern und bewerten an der I. Einleitung II. Rechtliche Grundlagen III. Standpunkt und Ideen des Grundschulverbandes IV. das Konzept der Liebig-Grundschule I. Einleitung Es ist evangelisches
Leistung fördern und bewerten an der I. Einleitung II. Rechtliche Grundlagen III. Standpunkt und Ideen des Grundschulverbandes IV. das Konzept der Liebig-Grundschule I. Einleitung Es ist evangelisches
Untersuchung eines beispielhaft formulierten Studien- bzw. Unterrichtprojekts im Fachverbund Informatik
 Untersuchung eines beispielhaft formulierten Studien- bzw. Unterrichtprojekts im Fachverbund Informatik Beispielfragestellung/Beispielaufgabe für ein Studienprojekt: Wie können Lernplattformen wie Moodle
Untersuchung eines beispielhaft formulierten Studien- bzw. Unterrichtprojekts im Fachverbund Informatik Beispielfragestellung/Beispielaufgabe für ein Studienprojekt: Wie können Lernplattformen wie Moodle
Inklusion an der Erich Kästner Schule
 Inklusion an der Erich Kästner Schule Vorbemerkung Als ehemalige Grund- und Gesamtschule Farmsen-Berne steht die heutige Erich Kästner Schule seit ihrer Gründung 1979 in einer inklusiven Tradition. Von
Inklusion an der Erich Kästner Schule Vorbemerkung Als ehemalige Grund- und Gesamtschule Farmsen-Berne steht die heutige Erich Kästner Schule seit ihrer Gründung 1979 in einer inklusiven Tradition. Von
Handlungsfeld 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen
 Welche Methoden, Arbeits- und Kommunikationsformen kennen Sie? Beobachten und dokumentieren Sie, welche in Ihrer Ausbildungsklasse realisiert werden. Planen und skizzieren Sie in knapper Form eine Unterrichtsstunde
Welche Methoden, Arbeits- und Kommunikationsformen kennen Sie? Beobachten und dokumentieren Sie, welche in Ihrer Ausbildungsklasse realisiert werden. Planen und skizzieren Sie in knapper Form eine Unterrichtsstunde
der Katholischen Kindertagesstätten St. Peter, Grünstadt und St. Nikolaus, Neuleiningen
 der Katholischen Kindertagesstätten St. Peter, Grünstadt und St. Nikolaus, Neuleiningen Christliches Menschenbild Jedes einzelne Kind ist, so wie es ist, unendlich wertvoll! 2 Wir sehen in jedem Kind ein
der Katholischen Kindertagesstätten St. Peter, Grünstadt und St. Nikolaus, Neuleiningen Christliches Menschenbild Jedes einzelne Kind ist, so wie es ist, unendlich wertvoll! 2 Wir sehen in jedem Kind ein
(1) Rahmenbedingungen der Behörde für Schule und Berufsbildung
 Handreichung zur -Europaschule - Gymnasium Hamm- Inhalt: (1) Rahmenbedingungen von der Behörde für Schule und Berufsbildung 1 (2) Konkretisierung der 1 (2.1.) Was ist eine Präsentationsleistung? 1 (2.2.)
Handreichung zur -Europaschule - Gymnasium Hamm- Inhalt: (1) Rahmenbedingungen von der Behörde für Schule und Berufsbildung 1 (2) Konkretisierung der 1 (2.1.) Was ist eine Präsentationsleistung? 1 (2.2.)
20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität
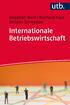 20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität Artefakte Auf der obersten Ebene befinden sich die Artefakte. Darunter fasst man jene Phänomene, die unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar sind.
20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität Artefakte Auf der obersten Ebene befinden sich die Artefakte. Darunter fasst man jene Phänomene, die unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar sind.
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern. Rahmenplan. Kunst. für die Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule
 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Rahmenplan Kunst für die Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule 2009 2 Inhaltsverzeichnis 1 Rechtliche Grundlagen... 2 2 Didaktische
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Rahmenplan Kunst für die Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule 2009 2 Inhaltsverzeichnis 1 Rechtliche Grundlagen... 2 2 Didaktische
ProMosaik e.v. ein junger Verein
 ProMosaik e.v. ein junger Verein ProMosaik e.v. ist ein junger Verein, der 2014 in Leverkusen gegründet wurde und das Ziel verfolgt, sich weltweit für den interkulturellen und interreligiösen Dialog und
ProMosaik e.v. ein junger Verein ProMosaik e.v. ist ein junger Verein, der 2014 in Leverkusen gegründet wurde und das Ziel verfolgt, sich weltweit für den interkulturellen und interreligiösen Dialog und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Bildungsstandards Englisch - Was 10-Jährige wissen und können sollten!
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bildungsstandards Englisch - Was 10-Jährige wissen und können sollten! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 4.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bildungsstandards Englisch - Was 10-Jährige wissen und können sollten! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 4.
Zentralabitur 2017 Lateinisch
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Lateinisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Lateinisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
MOSE-EXODUS JUDENTUM DIE BIBEL
 GESAMTSCHULE ELSE LASKER-SCHÜLER SEKUNDARSTUFEN I UND II ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30 42107 WUPPERTAL ELTERNINFORMATION ÜBER UNTERRICHTSINHALTE IM FACH RELIGION... JAHRGANGSTUFE 5 ERWARTUNGEN/HOFFNUNGEN
GESAMTSCHULE ELSE LASKER-SCHÜLER SEKUNDARSTUFEN I UND II ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30 42107 WUPPERTAL ELTERNINFORMATION ÜBER UNTERRICHTSINHALTE IM FACH RELIGION... JAHRGANGSTUFE 5 ERWARTUNGEN/HOFFNUNGEN
Einführung in die Erziehungswissenschaft. Bildungstheorien. Vorlesungsplan. Einführende Bemerkungen, riskante Definitionen
 SoSe 06 Prof. Dr. Gerhard de Haan Vorlesungsplan Einführung in die Erziehungswissenschaft Bildungstheorien 1. (20.04.06) Organisatorisches / Einführung: Wissensgesellschaft 2. (27.04.06) Anthropologie
SoSe 06 Prof. Dr. Gerhard de Haan Vorlesungsplan Einführung in die Erziehungswissenschaft Bildungstheorien 1. (20.04.06) Organisatorisches / Einführung: Wissensgesellschaft 2. (27.04.06) Anthropologie
Informationsabend 8.10.2013 18.30. Neue Anforderungen im Bildungsbereich Tipps zur Hilfestellung und Unterstützung der Kinder/Jugendlichen
 Informationsabend 8.10.2013 18.30 Neue Anforderungen im Bildungsbereich Tipps zur Hilfestellung und Unterstützung der Kinder/Jugendlichen Programm Information allgemein Was ist NEU ( neuer Lehrplan, Standards,
Informationsabend 8.10.2013 18.30 Neue Anforderungen im Bildungsbereich Tipps zur Hilfestellung und Unterstützung der Kinder/Jugendlichen Programm Information allgemein Was ist NEU ( neuer Lehrplan, Standards,
IT-Controlling für die Praxis
 Martin Kütz IT-Controlling für die Praxis Konzeption und Methoden 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Martin Kütz kuetz.martin@tesycon.de Lektorat: Christa Preisendanz & Vanessa Wittmer Copy-Editing:
Martin Kütz IT-Controlling für die Praxis Konzeption und Methoden 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Martin Kütz kuetz.martin@tesycon.de Lektorat: Christa Preisendanz & Vanessa Wittmer Copy-Editing:
Familienklassen an Grundschulen
 Familienklassen an Grundschulen Familienklassen an Grundschulen Soziale Gruppe nach 29 SGB VIII Ansprechpartnerin: Karin Bracht 017611010604 familie e.v. Paul Lincke Ufer 34 10999 Berlin 030 / 6110106
Familienklassen an Grundschulen Familienklassen an Grundschulen Soziale Gruppe nach 29 SGB VIII Ansprechpartnerin: Karin Bracht 017611010604 familie e.v. Paul Lincke Ufer 34 10999 Berlin 030 / 6110106
Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci & Ryan
 Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci & Ryan Lernmotivation intrinsische extrinsische Gegenstands- Bezogene (Interesse) Tätigkeits- Bezogene (tb Anreizen) Intrinsische Motivation effektives
Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci & Ryan Lernmotivation intrinsische extrinsische Gegenstands- Bezogene (Interesse) Tätigkeits- Bezogene (tb Anreizen) Intrinsische Motivation effektives
Evangelische Sozialethik
 Ulrich HJ. Körtner Evangelische Sozialethik Grundlagen und Themenfelder Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12 Einleitung:
Ulrich HJ. Körtner Evangelische Sozialethik Grundlagen und Themenfelder Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12 Einleitung:
offene Netzwerke. In diesem Sinn wird auch interkulturelle Kompetenz eher als Prozess denn als Lernziel verstanden.
 correct zu verstehen. Ohne Definitionen von interkultureller Kompetenz vorwegnehmen zu wollen: Vor allem gehört dazu, einen selbstbewussten Standpunkt in Bezug auf kulturelle Vielfalt und interkulturelles
correct zu verstehen. Ohne Definitionen von interkultureller Kompetenz vorwegnehmen zu wollen: Vor allem gehört dazu, einen selbstbewussten Standpunkt in Bezug auf kulturelle Vielfalt und interkulturelles
Leitbild Hospiz Luise 1/ 6. Leitbild des Hospiz Luise Hannover Kongregation der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim
 Leitbild Hospiz Luise 1/ 6 Leitbild des Hospiz Luise Hannover Kongregation der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim 20.08.2008 Leitbild Hospiz Luise 2/ 6 Präambel Hochachtung
Leitbild Hospiz Luise 1/ 6 Leitbild des Hospiz Luise Hannover Kongregation der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim 20.08.2008 Leitbild Hospiz Luise 2/ 6 Präambel Hochachtung
Themenbereich 1: Das Individuum im Erziehungsprozess I
 Inhaltsfeld: IF 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse Das pädagogische Verhältnis Anthropologische Grundannahmen Erziehung und Bildung im Verhältnis zu Enkulturation Erziehungsstile Erziehungsziele Bildung
Inhaltsfeld: IF 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse Das pädagogische Verhältnis Anthropologische Grundannahmen Erziehung und Bildung im Verhältnis zu Enkulturation Erziehungsstile Erziehungsziele Bildung
