Schwimmsandphänomen im Altbergbau an ausgewählten Beispielen Mitteldeutschlands und Nordböhmens *
|
|
|
- Michael Thomas
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ingenieurbüro Dr. G. Meier GmbH Ingenieurgeologie - Geotechnik - Bergbau Onlineartikel Dr.-Ing. habil. G. Meier Oberschöna OT Wegefarth Schwimmsandphänomen im Altbergbau an ausgewählten Beispielen * Quicksand phenomena in abandoned mines selected examples from Central Germany and Northern Bohemia Günter Meier Zusammenfassung: Die häufig in den tertiären und quartären Schichten Mitteldeutschlands sowie Nordböhmens vorkommenden Schwimmsande führten seit dem 19. Jahrhundert für die Bergleute im Untertagebereich zu sehr schwierigen und gefährlichen Situationen. Plötzliche Wasser-Feinsand-Einbrüche aus der Firste und Sohle beim Streckenvortrieb sowie im Abbau brachten vor allem im Braunkohlentiefbau große Schadensereignisse im Unter- und Übertagebereich mit sich. Gegenwärtig stellt sich nun die Frage, ob Schwimmsande im Altbergbau auch während und nach der Flutung des Grubengebäudes zu Veränderungen der Standsicherheit des Deckgebirges führen und schadensrelevante Einwirkungen auf die Tagesoberfläche insbesondere Tagesbrüche verursachen können. Anhand von ausgewählten Beispielen werden historische und aktuelle Schwimmsandereignisse diskutiert sowie Schlussfolgerungen gezogen. Summary: Since the 19 th century common quicksands, interbedded in tertiary and quaternary strata, were very difficult to control and enormously dangerous for the miners in lignite basins of Central Germany and Northern Bohemia. Sudden water and fine sand floodings led to considerable damages in the mine workings and at the surface above. The leaks happen in the roof and on the floor mostly during drifting galleries. The question is whether quicksands lead to alterations in abandoned mines even after their flooding. It should be clarified, which influence the redeposition have on the stability of the overburden and which impacts on the earth s surface can be occurring. Historic and recent quicksand events are discussed and conclusions are drawn using selected examples from Central Germany and Northern Bohemia. 1 Veranlassung Bei der Risikobewertung und Sanierung von tages- sowie oberflächennahen altbergbaulichen Grubenbauen im Locker-, Halbfest- und Festgestein stellt sich immer wieder die Frage nach einem möglichen schadensrelevanten Einfluss von Schwimmsandschichten. So ist aus Archivund Literaturquellen bekannt, dass beim Stollenvortrieb, bei der Vorrichtung von neuen Tiefbaugruben, beim Abteufen von Schächten und beim Abbau von Flözen, Gängen sowie sonstigen Erz- und Gesteinskörpern im Tiefbau erhebliche Verbruch- und Deformationsereignisse durch Schwimmsand eintraten. Vor allem dann, wenn mächtige * Veröffentlicht in: Tagungsband 15. Altbergbau-Kolloquium, Leoben, 05. bis , S. 57 bis 99, Wagner Digitaldruck und Medien GmbH, Nossen
2 wassergesättigte Schwimmsandlinsen angezapft wurden, kam es zu schadensrelevanten Havarien oder sogar zu Katastrophen. Aber auch beim Anfahren von Schwimmsandlinsen in großen und tiefen Erosionsrinnen sind verheerende Schwimmsandeinbrüche im Fels belegt. Verbrüche von Wasserlösestollen des Altbergbaues im Zusammenhang mit Schwimmsanden haben in den letzten Jahren ebenfalls zu größeren Havarien geführt. Grundsätzlich wurde Schwimmsand von den Bergleuten mit großem Respekt behandelt, da es zu zahlreichen Schadensereignissen mit tödlichem Ausgang kam. So ist beispielsweise bekannt, dass bei Gerlebogk (Sachsen-Anhalt) 18 Bergleute in der Braunkohlengrube Franzkohlenwerke durch einen Schwimmsandeinbruch am 6. Oktober 1904 den Tod fanden (Abb. 1). Abb. 1 Denkmal für die verunglückten Bergleute in Folge eines Schwimmsandeinbruches in der Grube Franzkohlenwerke bei Gerlebogk Bei der Erarbeitung von Bergschadenkundlichen Analysen sind grundsätzlich immer das Auftreten von tiefreichenden Tagesbrüchen und eine mögliche Aktivierung von untertägigen Schwimmsandumlagerungen mit und nach der Flutung der Gruben, insbesondere verursacht durch Grundwasserströme sowie unsachgemäßen Bohrungen, zu klären. Bohrlochverbrüche und andere Deformationsschäden an der Tagesoberfläche sind dann in der Regel die Schadensfolgen. Im Rahmen dieser Ausarbeitung sollen deshalb ausgewählte historische und aktuelle Schadensereignisse in Zusammenhang mit Schwimmsanden analysiert werden. Im Ergebnis dessen sollen schließlich Gesetzmäßigkeiten und mögliche Beziehungen zu aktuellen sowie zukünftigen Schadensentwicklungen an der Tagesoberfläche in altbergbaulichen Gebieten abgeleitet und potentielle Einwirkungsbereiche ausgegrenzt werden, um diese rechtzeitig sanieren zu können. Die Verflüssigung von Schwimmsanden ist nicht nur eine mitteldeutsche Angelegenheit. Das Phänomen des Fließens von Lockermassen ist unter bestimmten hydraulischen Bedingungen weltweit stark verbreitet. Unzählige Ereignisse, Schäden und sogar Katastrophen lassen sich in Verbindung mit dem Schwimmsandphänomen nachweisen. Insbesondere traten und treten diese schadensrelevanten altbergbaulichen Erscheinungsbilder bei - 2 -
3 bergtechnischen Aktivitäten, aber auch bei Naturereignissen, wie z. B. bei Extremniederschlägen, Überschwemmungen oder untertägigen Verbrüchen im Altbergbau in Zusammenhang mit Wasserrückstau auf. So ist es kein Wunder, dass bereit 1932 in der Fachliteratur [1] darauf verwiesen wurde, dass ein fast unübersehbares Schrifttum zu den Ursachen der Schwimmsanderscheinungen existiert. Schwerpunkte dieser Thematik stellten insbesondere tertiäre und quartäre Schwimmsande im Braunkohlentief- und -tagebau, Steinkohlen- sowie Kali- und Salzbergbau dar. Aber auch in vielen anderen Bergbauzweigen, in Erosionsrinnen und im Karst sind Schadensereignisse in Verbindung mit quartären Schwimmsanden bekannt. Schadenswirksame Erscheinungsbilder von Schwimmsanden nach dem aktiven Bergbau und damit im Altbergbau sind nur sehr begrenzt belegt. Sie treten in der Regel nur in Verbindung mit nachträglich abgeteuften Bohrungen und mit Tagebaueinwirkungen sowie Flutungen von angrenzenden Tagebauen oder an Verbrüchen in Wasserlösestollen auf. 2 Wichtige geotechnische Zusammenhänge und Quellenbezüge zum Schwimmsand Aus ingenieurgeologischer Sicht verändern die geodynamischen Prozesse die oberen Schichten der Erdkruste und damit auch die tages- und oberflächennahen Grubenbaue sowie übertägige Relikte des Altbergbaues (Abb. 2). Abb. 2 Bestandteile der geodynamischen Prozesse Die gravitativen Massenumlagerungen (z. B. Rutschungen, Verbrüche, Verflüssigungen, Bildung von abflusslosen Senken durch die Durchbiegung von hangenden Tonschichten) und die physikalisch-chemischen Verwitterungsarten nehmen als Hauptbestandteile der exogengeodynamischen Prozesse zunehmend sicherheitsrelevanten Einfluss auf die unterschiedlichen altbergbaulichen Hinterlassenschaften. Im Rahmen der Schwimmsandproblematik ist vor allem die Verflüssigung von tonig-schluffig-sandigen Sedimenten von besonderem Interesse. Weiterhin sind im Braunkohlentiefbau mit zunehmender Tiefe wirkende endogen-dynamische Prozesse durch die Vergrößerung der Konvergenzen von Tonschichten im Bereich von bergbaulichen Resthohlräumen zu berücksichtigen. Aus ingenieurgeologischer Sicht wird das Fließen wie folgt definiert: Fließen ist das Verschieben und eine kontinuierliche Relativbewegung von Feinbestandteilen (Körner) in einer Lockermasse mit Änderung der äußeren Form. Die Geschwindigkeitsverteilung der bewegten Masse entspricht der einer viskosen Flüssigkeit. Fließen kann in trockenem oder - 3 -
4 nassem Zustand erfolgen. Es muss stets die innere Reibung der Lockermassen überwunden werden, das innere Gefüge bricht zusammen und die Lockermassen verlieren vorübergehend ihre Festigkeit. [4], [15], [16] Die gesichtete Fachliteratur zu den Schwimmsanden bezieht sich schwerpunktbezogen auf Schadensereignisse, die während des aktiven Braunkohlentiefbaues auftraten. Vorrangig werden Ereignisse aus den Vorrichtungs- und Abbauphasen beschrieben und Deckgebirgsmächtigkeiten von tonigen sowie sandigen Lockergesteinen mit unterschiedlichen Dicken bewertet. Die fachlichen Inhalte dieser Archivalien sind vor allem auf markscheiderische Aspekte und weniger auf geotechnische Inhalte ausgerichtet. Es wird deshalb versucht, belastbare Informationen zu den geotechnischen Gebirgseigenschaften und dem Deformationsverhalten des Deckgebirges in Verbindung mit den Schwimmsanden aus den recherchierten Veröffentlichungen zu verschiedenen bergbaulichen Aktivitäten herauszufiltern. 3 Definition von Schwimmsand und seine schadensrelevanten Eigenschaften In dem einschlägigen fachlichen Literaturfundus ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten durch die zahllosen Namen für Schwimmsand, wodurch ein Auffinden von Literaturquellen erschwert wird. Folgende Namen sind für Schwimmsand als Äquivalent bekannt (Auswahl): Fließsand, Treibsand, Triebsand, Schwemmsand, Schleichsand, Schlämmsand, tixotroper Sand, Mo (Feinsand), Quicksand, Wassersand, Fließschlamm, Fließ, Kurzawka (in Oberschlesien), Feinsand, Egelner Grünsand, Setzungsfließen, Sandmuren und schwimmendes Gebirge. KLEIN [7] verweist darauf, dass feinkörnige ( mulmige ) und wasserreiche Braunkohle ebenfalls als schwimmend bezeichnet werden muss. SINGER [1], KNAUPE [2], KEIL [3] u. a. sprechen von Schwimmsanderscheinungen bzw. von Schwimmsandphänomenen als Sammelbegriff bei Einbrüchen von wassergesättigten Schichten in Zusammenhang mit Bergbau, Tiefbaumaßnahmen und Baugruben. PRINZ & STRAUSS [4] definieren Fließsand wie folgt: Als Fließsand wirken alle körnigen Böden, wenn der Strömungsdruck bzw. die Schleppkraft ausreichen, die Körner in Schwebe zu halten. Besonders anfällig sind feinkörnige und gleichkörnige Sande lockerer Lagerung. KÖHLER [4] weist bereits 1900 auf folgende Beobachtungen hin: Häufig sind Braunkohlenflötze, Salzlager und auch das Steinkohlengebirge mittelbar oder unmittelbar von mehlförmigen, zum Teil thonigen Sandmassen bedeckt, welche mehr oder weniger wasserreich sind und dann die Namen Schwimmsand, Fließ und (in Oberschlesien) Kurzawka führen. Ist der Schwimmsand wasserarm, so bietet er dem Abteufen keine wesentlichen Schwierigkeiten, denn er steht dann gut und ist leicht zu gewinnen. Je mehr aber der Wassergehalt steigt, um so mehr nimmt der Schwimmsand die Eigenschaften einer dick- oder dünnflüssigen Masse an, in welcher das Abteufen von Schächten zu den schwierigsten bergmännischen Arbeiten gehört. Auch NIESS [6] hat sich sehr ausführlich mit den Schwimmsandgefahren im Braunkohlentiefbau beschäftigt und 1907 dazu eine Dissertationsschrift veröffentlicht. Er unterscheidet zwei Arten von Schwimmsand: 1. Reiner Quarzsand: Trotz durchführbarer Entwässerung der Wassersande verändert sich nicht das Volumen. Bei Umlagerungen ist durch die Neueinregelung der Sandkörner ein kleineres Volumen zu erwarten. Durch eine gezielte Entwässerung kann der scharfe Sand unschädlich gemacht werden. 2. Toniger Schwimmsand: Die Räume zwischen den einzelnen Sandkörnern sind nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Tonteilchen ausgefüllt. fast ihr gesamter Wassergehalt ist als dauernd gebunden anzusehen. Eine Entwässerung solcher Schichten ist darum praktisch so gut wie ausgeschlossen
5 NIESS [6] kommt durch die beiden Eigenschaftsunterschiede zu folgendem Ergebnis: Als ein sehr ungünstiger Umstand für die tonigen Schwimmsande gegenüber den reinen Wassersanden muß es gelten, daß erstere, da sie im Schichtenverbande so gut wie unentwässerbar sind, ihre Gefährlichkeit für den Grubenbetrieb dauernd beibehalten, während wasserreiche, scharfe Sande durch Zäpfung des hohen freien Wassergehaltes nahezu unschädlich gemacht werden können. KLEIN [7] hat in seinem umfangreichen Handbuch sehr detailliert die Schwimmsandproblematik beim Abteufen von Schächten und beim Abbau der Braunkohle beschrieben. Er verwies auf die erheblichen geotechnischen und bergmännischen Schwierigkeiten, insbesondere bei der Gewährleistung der Standsicherheit der Grubenbaue. Als Beispiel sei hier folgendes aufgeführt: Zwischen Eisleben und Helfta hat man versucht, ein beim Kupferschiefer-Bergbau erschlossenes Kohlenvorkommen abzubauen. Wenn man bei Zincken liest, daß hier unter 60 m Deckgebirge, wovon 40 m Schwimmsand, 3 m Kohle gebaut worden, so muß man die Aufnahme dieses Betriebes mehr bewundern als sein Erliegen. [7] Die wechselnden Mächtigkeiten von tertiären Schwimmsandlinsen von wenigen cm bis über 40 m (maximal 60 bis 80 m) sind keine Seltenheit. Die Braunkohlenflöze erreichen je nach Lagerstättentyp revierspezifische Mächtigkeiten bis zu über 100 m. Im Allgemeinen sind Mächtigkeiten der Kohlenflöze von 1 bis 10 m vorherrschend. Auch Tone in unterschiedlichen Beschaffenheiten sind mit Mächtigkeiten von wenigen cm bis zu 50 m (Grube Marie bei Preußlitz) Bestandteil der tertiären Braunkohlenlagerstätten Mitteldeutschlands. Nach KEIL [3] ist die Schwimmsanderscheinung gekennzeichnet durch die Empfindlichkeit fester Lockergesteine gegenüber auflockernden Einflüssen, insbesondere durch die Unfähigkeit körniger Lockergesteine im Gegensatz zu den veränderlichfesten Lockergesteinen bei Wasseraufnahme und Wasserauftrieb (Grundwasseranstieg!), ihre Form kontinuierlich zu verändern. Das Schwimmsandphänomen beschränkt sich auf die nicht haftfesten Lockergesteine. Es gilt hierfür die Beziehung: Auftrieb > Schwerkraft, und zwar muß der Auftrieb beträchtlich größer sein. Je stärker daher der Auftrieb als hydrodynamischer Strömungsdruck ist, um so größere und damit schwerere Körnungen (Kiessand, Gerölle) werden davon erfaßt. Schwimmsandbildung ist also unabhängig von der Korngröße und nur durch die Stärke des aufwärts gerichteten Wasserstromes bedingt. Kennzeichnend hierfür sind die Wasserübersättigung (Auftrieb) und die Nullreibung (hydrodynamische Reibung!) besonders an den weniger durchlässigen feinkörnigen Massen. Die feinkörnigen Sande neigen daher eher zu Schwimmsandbildung, besonders auch deshalb, da sie leichter sind als schwere Kieskörnchen. Sie sind beweglicher. Sie verlieren bei mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Erschütterungen, die Gefügefestigkeit und werden daher leicht flüssig. Sie reagieren auf Gleichgewichtsstörungen wie zähe Flüssigkeiten. Daher gilt nach Terzaghi: Der typische Schwimmsand ist dadurch gekennzeichnet, daß er sich im Grundwasserbereich beim Anschneiden nicht wie eine den Gesetzen der Erddrucktheorie gehorchende körnige Masse, sondern wie eine zähe, breiige Flüssigkeit verhält. Grundwasserabsenkung ist eine der wirksamen Sicherungsmaßnahmen. Wo diese nicht möglich ist, muß man versuchen, den Sand zu verfestigen, z. B. beim Durchteufen von Schwimmsandschichten im Bergbau. Die verschiedenen Definitionen und Beschreibungen des Schwimmsandphänomens verweisen auf erhebliche hydraulische Druckunterschiede als auslösender Ereignisfaktor zwischen den lufterfüllten Grubenbauen und den wassergesättigten hangenden oder liegenden Schwimmsanden. Vor allem beim Abteufen von Schächten, bei der Vorrichtung des Abbaufeldes und bei der Kohlengewinnung selbst kam es zu Schwimmsandanzapfungen mit z. T. katastrophalen Schadenswirkungen. Als initiale Faktoren für ein Schadensereignis werden Erschütterungen der verschiedensten Art (z. B. Sprengung, Abbaueinwirkung, Setzen von - 5 -
6 Ausbau) genannt. In vielen Fällen traten Schwimmsande im Sohlenbereich mit gespanntem Wasser auf. Ungeklärt ist derzeit die mögliche positive Wirkung der Konvergenzen von Tonschichten mit zunehmender Tiefe der Hohlräume. Offene Probleme sind auch die Einflüsse der gestörten Deckgebirgsschichten durch den meist mehretagigen Bruchbau und die schwerkraftbedingten Materialumlagerungen bei Schwimmsandeinspülungen ( Verschlammungen ). 4 Ausgewählte Beispiele von Havarien durch Schwimmsand Zum Verständnis von Schwimmsandeinbrüchen und deren Auswirkungen werden nachfolgend einige markante Schadensereignisse beispielhaft aufgeführt. Von einem besonders großen Schadensereignis mit Schwimmsand berichtete TACHTULEC (1963) [8] aus dem Braunkohlengebiet Nordböhmens. Das sich am Fuße des Erzgebirges erstreckende Braunkohlenbecken ist ca. 70 km lang und 1 bis 18 km breit. Im mittleren und westlichen Revier sind Schwimmsande im Hangenden des Braunkohlenflözes mit einer mittleren Mächtigkeit von 20 m (maximal 60 bis 80 m) eingelagert. Durch die Beckenstruktur der Lagerstätte erreichen die Sande Tiefen bis zu 250 m. Die Mächtigkeit und Durchlässigkeit der Sande verringert sich generell vom Ausbiß in Richtung zum Muldentiefsten, wo die Sande auskeilen oder in sandhaltige Tone übergehen. Die Sande treten in zusammenhängenden Schichtpaketen oder auch als Einzellinsen auf. Ihre Durchlässigkeit schwankt zwischen 1-30 m³/24 Std. und erreicht max. bis zu 50 m³/24 Std. Im westlichen Abschnitt des Braunkohlenbeckens sind die Sande höher gelegen. Der mittlere Filtrationskoeffizient beträgt 1-15 m³/std. Der Großteil der wasserführenden Sande erweist sich beim Anbohren oder Anfahren beim Streckenvortrieb bzw. beim Abbau als sehr flußfähig; Zu den ersten Eingriffen in den Wasserhaushalt dieser Sandhorizonte kam es in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch den verstärkten Abbau. Da es sich um Eingriffe in feinkörnige, nicht entwässerte Sande handelte, waren die Veränderungen immer markant und von Schwimmsandeinbrüchen begleitet. Dabei kam es in ausgedehnten Gebieten zur heftigen Entwässerung der Sande. Nicht selten wurde ein späteres Absinken des Hangenden über den entwässerten und z. T. ausgeschwemmten Sanden beobachtet. Bekannt ist der Schwimmsandeinbruch von 1895 auf dem Annaschachte bei Sous. Die in die Grubenabbaue eingedrungene Sandmenge betrug schätzungsweise m³. Geländesenkungen und Pingenbildung wurden auf einer Fläche von ca. 6 ha festgestellt, wobei ein ganzes Stadtviertel von Most /Brüx/ zerstört wurde. Es sei noch erwähnt, daß innerhalb von 3 Jahren das Gelände noch mehrmals abgesunken ist, und daß Bodendeformationen und Senkungen in kleinerem Ausmaße noch heute /1963/ zu verzeichnen sind. Es sei noch darauf hingewiesen, dass nach dieser Schwimmsandkatastrophe von 1895 eine Vorentwässerung der Sande vorgenommen wurde und damit erfolgreich sichere Abbaubedingungen geschaffen werden konnten. Durch diese Arbeiten kam es zu einer vorübergehenden Belebung der Grundwasserzirkulation, die mit der Entwässerung der Sande abklang. Nach Beendigung der Entwässerungsarbeiten kommt es in den Sanden gewöhnlich zu erneuter langsamer Wasseransammlung. Nach den in unserem Revier gemachten Erfahrungen kann dieser Prozeß einige Jahrzehnte andauern. Ein schnelleres Wiederauffüllen der Sande mit Wasser kann dort auftreten, wo Oberflächenwasser unmittelbar in die Schwimmsande einsickern kann. TREPTOW; WÜST; BORCHERS [9] berichten ebenfalls von diesem Ereignis vom 19. und 20. Juli 1895 im Nahbereich der Stadt Brüx. Bei dem Betriebe eines neuen Schachtes unmittelbar nördlich von der Stadt war die erste Abbaukammer in gewohnter Weise abgebaut worden und das Deckgebirge ging zu Bruche, dabei entleerte sich jedoch ein bis dahin unbekanntes - 6 -
7 Schwimmsandlager (feiner Sand mit viel Wasser) in die Grube und erfüllte deren sämtliche Räume, so daß der Betrieb eingestellt werden mußte; zugleich aber stürzten in der Bahnhofsvorstadt von Brüx eine größere Anzahl Häuser ein, andere wurden durch Rutschung des Bodens stark beschädigt, außerdem bildeten sich an vielen Stellen in den Straßen klaffende Risse und offene Erdtrichter. So schnell trat das Unglück ein, daß aus den zusammenbrechenden Häusern kaum etwas gerettet werden konnte. POKORNÁ [10] berichtet über dieses Brüxer Schadensereignis, dass ca Einwohner ihre Wohnungen verloren und ein Toter sowie ein Verletzter zu beklagen waren. (Abb. 3) Solche Schwimmsanddurchbrüche in Most wiederholten sich noch im August und September 1896, allerdings mit nicht so großen Schäden an der Tagesoberfläche. Abb. 3 Verbruch der nördlichen Vorstadt von Brüx /Most/ am 20. Juli 1895 als Folge eines Schwimmsandeinbruches (historische Aufnahme von Karl Pietzner, Teplitz) [9] HÄRTIG [21] berichtet über Deformationen in Form von Tagesbrüchen, Rutschungen und Muldenbildungen im Tagebau Großkayna. In dem Gelände südlich der Reichsbahn, das beim Abbau des Schwalbennestes weggebaggert wurde, und auch westlich davon sind eine Reihe von Erdfällen aufgetreten, woraus mit Sicherheit auf Massendefekte im Untergrund zu schließen ist. Die meisten Erdfälle traten bei der Frühjahrsüberschwemmung 1947 auf, und die Förderung des Tagebaues war dadurch aufs höchste gefährdet, daß die von den Erdfällen verschluckten Wassermengen plötzlich mit elementarer Gewalt in der Grube hervorbrachen. (Abb. 4) - 7 -
8 Abb. 4 Tagesbrüche nach der Frühjahrsüberschwemmung durch Liquefaktion (Tagesbruchtyp Piping ) entstanden. (Quelle: HÄRTIG [21]) Die ausgewählten Beispiele zeigen deutlich, dass einige Berichte zu größeren Schwimmsandereignissen aus dem aktiven Bergbaugeschehen vorliegen. Es fehlen dagegen geotechnisch belastbare Beobachtungen oder lückenlose markscheiderische Messungen auch während des Grundwasserwiederanstieges. Die Einflussfaktoren des Altbergbaues beginnen mit der Dominanz der geodynamischen Prozesse auf die Standsicherheit der sanierten, gefluteten, aber auch teilgefluteten und teilweise noch lufterfüllten Grubenbaue einschließlich auf das gesamte gestörte Deckgebirge. Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind bei Schwimmsanden im Braunkohlentiefbau folgende Zusammenhänge zu beachten: 1. Schadensereignisse treten durch tiefgreifende Auflockerungseinwirkungen beim Braunkohlenabbau (Pfeilerbruchbau) von der untersten Sohle der Grubenbaue bis zur Tagesoberfläche auf. Großflächige, ungleichförmige Setzungen der Tagesoberfläche sind an Grundwasserabsenkung gebunden. Schwimmsandeinwirkungen in der Erkundungs-, Vorrichtungs- und Abbauepoche erschwerten die bergbaulichen Tätigkeiten. Bei mehreren Abbauscheiben war die zeitliche Reihenfolge zwischen den einzelnen Scheiben noch von Interesse, da zwischenzeitlich die deformierten bzw. verbrochenen Deckschichten durch eine Verfestigungsphase überprägt wurden. Dadurch konnten potentielle Fließwege des Schwimmsandes verschlossen werden oder es trat auch eine Verfestigung des tonigen Bruchgebirges ein. Häufig wird von einer Verschlammung der tiefsten Grubenbaue berichtet. 2. Durch Eigenflutung der Grubenbaue und bei Extremniederschlägen tritt eine Intensivierung der Schadensereignisse im Deckgebirge auf. Mit dem Grundwasserwiederanstieg ist auch eine ungleichförmige Hebung der Tagesoberfläche verbunden. In dieser Epoche wurde auch ein großer Anteil der Sanierung der bergbaulichen Hinterlassenschaften in ihrer Einheit von Erkundung und dauerhafter Sicherung bzw. Verwahrung durchgeführt
9 3. Altbergbauliche Erscheinungsbilder (Schäden) treten auch nach der Beendigung des Grundwasserwiederanstieges ohne zeitliche Begrenzung auf. Dabei ist in der Regel längerfristig eine Abnahme der Ereignisanzahl mit der Zeitachse sehr wahrscheinlich. Es wirken im Wesentlichen die geodynamischen Prozesse in ihrem Zusammenspiel von endogenen, exogenen und anthropogenen Prozessen auf die unter- und übertägigen altbergbaulichen Hinterlassenschaften. Die dabei gebildeten unterschiedlichen Bereiche gleicher hydraulischer und geotechnischer Eigenschaften sowie ihrer räumlichen Verzahnung als offene instabile und metastabile Gleichgewichtssysteme wirken in vielen Fällen langzeitstabil. Insbesondere ist dies dann zu erwarten, wenn das Grundwasser in seinem Δu (Eigenschaftsunterschied zwischen verschiedenen Gleichgewichtssystemen) nur geringfügige räumliche Veränderungen bzw. Differenzen aufweist. 4. Durch sich ändernde und wirksame Massenströme (Grundwasserströme), Konvergenzen bei Überlagerungsdrücken und der Dominanz von tonigen Deckschichten können lokal Initiale für Lageveränderungen im Bruchgebirge wirksam werden, wodurch Umlagerungen von Schwimmsand möglich sind. 5. Schwimmsandschichten und Tonlinsen sind als geotechnische und hydraulische Einheiten zu betrachten. Sie sind bestimmend für das schadensrelevante Deformationsverhalten des gesamten bergbaulich überprägten Deckgebirges. Auch bei der Auffahrung von Wasserlösestollen, beim oberflächennahen Gangbergbau, beim Schachtteufen oder Streckenvortrieb in den unterschiedlichsten Bergbauzweigen kam es durch das Anfahren vor allem von wassergesättigten Schwimmsandsedimenten zu erheblichen Havarien. In der Mehrzahl der Fälle sind diese Ablagerungen meist an Gesteinswechsel, Störungszonen in Flusstälern oder Karststrukturen gebunden. Ein Beispiel ist der Verbruch des begonnenen Rothschönberger Stollens am 30. Januar 1851 etwa 200 m nordöstlich des 1. Lichtloches. [19] Es wurde in ca. 54 m Tiefe eine spaltenartige Erosionsrinne angefahren. Die wassergesättigten Sedimente und starken Wasserzuläufe führten zum längeren Stillstand des Stollenvortriebes und zu erheblichen Mehraufwendungen. Die Ablagerungen aus Schlamm, Sand und Geröll hatten sich in einem Bereich eines Gesteinswechsels von Rotgneis zu Schiefer und mehreren Störungsstrukturen eingelagert. Starke Wasserzuläufe aus dem Verbruch erschwerten zusätzlich die bergmännischen Arbeiten zur Havariebeseitigung. Durch das Auslaufen bildete sich in wenigen Stunden ein trompetenartiger, vertikaler Schlot mit einer Öffnungsweite von ca. 14 m Durchmesser unmittelbar neben einer Straße. Der Wasserstand pegelte sich im 1. Lichtloch und im Tagesbruch bei ca. 42,8 m über der Stollensohle ein. Die schlammartigen Schwimmsande stellten sich bei ca. 14 m über der Stollensohle in beiden Hohlräumen ein. Diese Situation ergab sich auch dadurch, da der Stollen im 1. Lichtloch im Gegenortbetrieb aufgefahren wurde. Eine durchgängige Verbindung in Richtung Mundloch bestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Bei der Beräumung mussten durch den starken Wasserzulauf zusätzlich erhebliche Wassermassen mittels hölzerner Pumpensätze, angetrieben durch Wasserräder, gehoben werden. Es zeigte sich, dass der Stollen auf ca. 40 m Länge mit Sand und Schlamm zugeschoben war. Beim weiteren Vortrieb mit starker Getriebezimmerung wurde ersichtlich, dass die Erosionsrinne eine Breite von 35 m aufwies. Erst 1864 wurde ein elliptisches Sandsteingewölbe auf eine Länge von 40 m und mit einer Stärke von 18 Zoll als dauerhafte Sicherung des Stollens eingebaut. Eine Stabilisierung des geschwächten Gewölbes wurde 2009 durch den Einbau einer zusätzlichen Stahlbetonschale durchgeführt, wodurch jedoch eine Verengung des Querschnittes erfolgte. Der Heinitz Stollen bei Könnern ist ca m lang. Dieser tiefe Wasserlösestollen wurde 1795 angeschlagen und im nicht standfesten Gebirge mit Natursteinmauerung ausgebaut. Er entwässert mehrere Reviere des Kupferschieferbergbaues an der Ostflanke der Halle-Hettstädter Gebirgsbrücke. Im Bereich der Verbruchstelle steht eine stark verkarstete, steil stehende Zechstein-Anhydritschicht an, deren Hohlräume durch tertiären Schwimmsand und Höhlenlehm - 9 -
10 ausgefüllt sind. Die Stollentrasse und zwei weitere, ältere Wasserlösestollen verlaufen mit ihren Lichtlöchern zu einem Großteil ebenfalls unter dem Ort Strenznaundorf entlang. An mehreren Stellen bestehen Verbindungen zwischen den Stollen. Zahlreiche Schadensereignisse in den zurückliegenden Jahren markieren in der Ortslage den tagesnahen Bergbau mit den drei, unterschiedlich tiefen Stollenauffahrungen. Im Bereich der mehrere Meter mächtigen Karstzone hatten sich am Rande der Saaleaue tertiäre Schwemmsande abgelagert. Im Bereich der aktiven Karstzone und den Gesteinswechseln kam es in den letzten Tagen des Jahres 2010 zum Verbruch des ausgemauerten Stollens unweit des 6. Lichtloches. (Abb. 5) Abb. 5 Tagesbruch über dem Heinitz Stollen im Bereich tertiärer Schwimmsande (Durchmesser ca. 10 m, Tiefe ca. 9 m, Stollensohle - GOK ca. 29 m) Es kam dadurch zum Rückstau des Grubenwassers auf einer Höhe von ca. 17 m über der Stollenfirste, wodurch der ältere, höherliegende Naundorfer Stollen vollständig aktiviert wurde. Sein verschüttetes Mundloch spülte sich auf einem Feld frei. Das Stollenwasser trat artesisch aus. Um weitere Schäden zu verhindern, wurde eine stationäre Pumpstation an einem Lichtloch eingerichtet. Es galt jetzt, den Stollen ab der Verbruchstelle bis zum Mundloch zu beräumen und somit funktional wiederherzustellen. Der Stollen war auf eine Länge von ca. 675 m vollständig mit Schwimmsand und schluffig-tonigen Sedimenten ausgefüllt. (Abb. 6 und Abb. 7) Erst nach der Aufwältigung der Verbruchstelle und der vollständigen Stollenberäumung konnten die Pumpen abgeschaltet werden. Ab diesen Zeitpunkt floss das Wasser wieder im freien Gefälle über die Rösche dem Vorfluter Saale zu
11 Abb. 6 Vollständig verfüllter Querschnitt des Heinitz Stollens durch die tertiären Sedimente, Höhlenlehm, Löß und Feinbestandteile der Kupferschieferlagerstätte
12 Abb. 7 Kornverteilungskurven von verflüssigungsfähigen Lockergesteinen bei dynamischer Belastung [20] (ergänzt), (Rote Kurve: Material des Schwimmsandeinbruches aus dem Heinitz Stollen) Im östlichen Teil von Sachsen, unweit der Stadt Görlitz, befindet sich die ehemalige Bauschuttdeponie Ludwigsdorf. Seit Jahrhunderten wurde hier in Steinbrüchen Kalkstein abgebaut, die bis zu 70 m tiefe Restlöcher hinterlassen haben. Ab 1957 begann die untertägige Kalksteingewinnung im Kammerbau mit Magazinierung des Haufwerkes. Dieser Tiefbau wurde 1984 eingestellt. Auf der Sohle des Bruches I war ein Förderstollen aufgefahren, von dem seitlich die Magazinabbaue in regelmäßigen Abständen angelegt wurden. Die Kammern erreichten Höhen von 20 bis 40 m. Sie waren etwa 8 m breit und bis zu 130 m lang. Die verbliebenen Pfeiler hatten eine Mindeststärke von 8 m. Das Deckgebirge erreichte Mächtigkeiten von etwa 25 bis 35 m. Im geologischen Profil stehen an der Geländeoberfläche quartäre sandig-schluffige Lockergesteine von mehreren Metern Mächtigkeit an. Darunter folgt kaolinisierter Porphyr geringer Festigkeit und kambrischer Kalkstein, der große, röhrenartige Verkarstungserscheinungen aufweist. Die Karsthohlräume sind mit Höhlenlehm (Schwimmsand) ausgefüllt. Bei Wassersättigung neigen diese Karstsedimente zur Verflüssigung. Aufgrund dieser ingenieurgeologischen Situation mussten beim untertägigen Kalksteinabbau bereits durch Lehmeinspülungen zahlreiche Abbaumagazine vorzeitig aufgegeben werden. Teilweise entstanden dabei Tagesbrüche mit erheblichen Ausmaßen. Nach der Stilllegung der untertägigen Kalkgewinnung im Jahre 1984 wurde die Wasserhaltung bis 1994 aufrecht erhalten. Gutachterliche Prognosen verwiesen beim Wasseranstieg auf ein sich aktivierendes Tagesbruchgeschehen und Bewegungen in bereits mit Müll und industriellen Abprodukten (Schleifschlamm) verfüllten Tagebaurestlöchern und großdimensionierten Pingen. Im Jahr 1999 kam es dann zu einer plötzlichen Reaktivierung des Bruchgeschehens. Das aufgehende Grundwasser erreichte die ersten Karströhren und es kam zur Verflüssigung sowie zum Auslaufen der schluffig-sandigen Höhlensedimente einschließlich der überlagernden, nicht tragfähigen Lockergesteinsschichten. Über einem bereits beim Abbau abgeworfenen Magazin
13 entstand ein Verbruchtrichter mit einem Durchmesser von ca. 28 m und einem Volumen von ca m³. Dieses Ereignis riss einen Teil der Zufahrtsstraße zur Deponie mit in die Tiefe. Wenige Monate später folgten im unmittelbaren Deponiekörper weitere Deformationsereignisse, die einer Aktivierung von alten Verbrüchen zuzuordnen waren. Durch das extreme Gefährdungspotential für die Bewirtschaftung musste der Deponiebetrieb eingestellt werden. Geotechnische Untersuchungen ergaben, dass die untertägigen Grubenbaue zwar standsicher sind, es aber 1999 zu einer Reaktivierung der Verflüssigung des Höhlenlehmes durch das ansteigende Grundwasser gekommen war. Erreichte das aufsteigende Wasser die alten, mit Lehm gefüllten Karströhren, so verflüssigten sich zunehmend die lehmigen Massen und es kam zum Ausfluss einschließlich der Deckschichten aus Lockergesteinen und Deponiegut in die wassererfüllten Abbaukammern. Abb. 8 Aktiver Tagesbruch im Deponiekörper über einer Abbaukammer im Oktober Die äußeren konzentrischen Risse erreichen bereits Durchmesser von bis zu 50 m
14 Abb. 9 Der Grundwasserwiederanstieg hat die Lockergesteinsdeckschichten erreicht (Stand: April 2015). Die ineinander gehenden Tagesbrüche weisen insgesamt Durchmesser bis zu ca. 100 m auf. Neue Verbrüche wurden seit November 2009 nicht mehr beobachtet, jedoch verändern sich ständig die Tagesbruchränder. 5 Geotechnische und hydrogeologische Betrachtungen zum Schwimmsandphänomen Die Verflüssigung von Lockergesteinen (Liquefaktion) ist von mehreren Faktoren abhängig. Folgende Einflussgrößen und Parameter sind beteiligt: Korngrößenverteilung Wassersättigung Porenwasserüberdruck Geologische und hydrogeologische Verhältnisse Bergmännischer oder/und natürlicher Hohlraum mit seinem Dauerstandsverhalten (Holzproblem, Konvergenz, Materialumlagerung, Karst) Bei der Bewertung der Randbedingungen beim Auftreten des Schwimmsandphänomens beispielsweise im Braunkohlentiefbau sind die erheblichen Druckunterschiede zwischen wassergesättigtem Schwimmsand im Hangenden über dem Braunkohlenflöz bzw. über der Tonschicht und die darunter aufgefahrenen lufterfüllten Grubenbaue die entscheidenden Einflussgrößen. Auch Liegendaufbrüche von Schwimmsanden sind hinreichend bekannt. Je größer der Druckunterschied und je mächtiger die hangenden Schwimmsandschichten sowie die freien Hohlräume sind, umso schadenswirksamere Ereignisse sind zu erwarten. KEGEL [11] unterscheidet bei seinen Betrachtungen bei der Aus- und Vorrichtung sowie beim Abbau des Braunkohlenflözes in Abhängigkeit von den geologischen, bergbaulichen und hydrogeologischen Verhältnissen folgende Entwässerungsmöglichkeiten von wassergesättigten Schwimmsandschichten:
15 Entwässerungsstrecken im Flöz: Wasserführendes Gebirge liegt direkt am Flöz. Bei Schwimmsandeinbrüchen kann es zur Verschlämmung größerer Grubenteile kommen. Entwässerungsstrecke im Hangenden: Bei mächtigen wassertragenden Deckschichten oder durchlässigen Sandschichten ohne Einlagerung von wassertragenden Sandschichten. Entwässerungsbrüche: Bei einer geringmächtigen wassertragenden oder harten hangenden Schicht. Diese Schicht darf sich beim Verbruch nicht schließen. Entwässerungsschächte bzw. -bohrlöcher: Wenn das Deckgebirge aus Wechsellagerungen von wasserführenden und wasserstauenden Schichten besteht oder wenn die Wasserdurchlässigkeit im gesamten Deckgebirge groß ist. Förderschächte und Hauptschächte: Bei feinkörnigem, tonigem und gering durchlässigem Hangenden oder Liegenden für ein größeres Grubenfeld nicht geeignet. Jedoch als Ausgangspunkt einer systematischen Entwässerung gut nutzbar. Hochgebohrte Entwässerungsbohrlöcher: Lassen sich an ausgemauerte Grubenbaue sicher anbinden. Geringe Tiefenwirkung vor allem bei Gerölleinlagerungen. Kleinere Schwimmsandeinbrüche sind häufig. Tiefbohrlöcher und Entwässerungsschächte: Bei Anschluss an die Grubenbaue nicht immer ungefährlich, da Schwimmsandeinbruch möglich. Häufig Entwässerung durch Pumpeneinsatz im Bohrlochtiefsten bzw. im Pumpensumpf. Überhauen (Überbrechen): Ungeeignet, da häufig Schwimmsandeinbruch, Verschlammung und Verstopfung. Strecken, Tiefbohrlöcher und Schächte zur Entwässerung im Liegenden: Strecken werden nicht zur Anwendung empfohlen. Tiefbohrlöcher sind von Vorteil, wenn geringdurchlässiger Schwimmsand durchbohrt wird. Entwässerungsschächte sind günstig bei grobkörnigen Sanden mit guter Durchlässigkeit. Die Wahl der Entwässerungsart des mit sehr unterschiedlicher Mächtigkeit an Schwimmsandschichten durchzogenen Deckgebirges fiel sehr verschieden aus. Durch die Mobilität des Sandes kam es zu erheblichen Havarien in den Bergwerken und an der Tagesoberfläche. Aktiviert wurden die Schwimmsandeinbrüche vor allem durch die bergbaubedingten Erschütterungen. KEGEL [11] verweist auf die Schwierigkeiten der systematischen Entwässerung der hangenden Gebirgsschichten. Grundvoraussetzungen für effiziente Abbaumethoden sind die systematische Entwässerung bei hinreichender Kenntnis der geotechnischen Eigenschaften des Deckgebirges. Insbesondere die Verteilung der bindigen und nicht bindigen Schichten. Auf der Grundlage von Erfahrungswerten wird darauf hingewiesen, daß die Mächtigkeit eines guten, zähen Tones mindestens um 4 bis 6 m größer sein muß als die Abbauhöhe bei dem im deutschen Braunkohlenbergbau gewöhnlichen Pfeilerbruchbau, um einigermaßen gegen Wasserdurchbrüche sicher zu sein. [11] Bei sehr mächtigen Schwimmsandschichten ist auch eine Abwehr von Wasser zu erwarten, da die kapillaren Bindungen des Wassers zu einer Wasserundurchlässigkeit führen. CHLEBUS [14] analysierte Bruchereignisse in Braunkohlentiefbaurevieren von Niederhessen, Norddeutschland, Nordwestböhmen und in der Lausitz sowie im Forster Revier anhand von Erfahrungen. Die Ergebnisse zeigen aber eine sehr unterschiedliche Herangehensweise und Interpretation der Parameter bezüglich des Auflockerungsfaktors, der notwendigen Dicke von tragenden Tonschichten sowie Bruchwinkel von Abbaukanten
16 6 Risikobewertung Die vorliegenden Erfahrungen zur Schwimmsandproblematik verweisen deutlich auf drei grundlegende Schadensperioden: a) Schadensereignisse während des aktiven Bergbaues, insbesondere während der Vorrichtung und des Kohlenabbaues bis zum Abbauende. b) Ereignisse nach der Stilllegung des Grubenbetriebes mit einer angemessenen Verzögerungszeit, altbergbauliche Erscheinungsbilder bis zum Ende der Sanierung und bis zum vollständigen Grundwasserwiederanstieg. c) Ereignisse nach der abgeschlossenen über- und untertägigen Sanierung. Geodynamische Prozesse im Unter- und Übertagebereich des Altbergbaues führen zu sehr langfristigen Veränderungen von Gleichgewichtsunterschieden vor allem der im Bereich des Grubengebäudes mit seinem bergbaulich überprägten Deckgebirge. Bei der Analyse der Ereignisse dominieren in der Häufigkeit, Intensität und im Schadensausmaß eindeutig die Vorkommnisse innerhalb des aktiven Bergbaues. Man kann davon ausgehen, dass diese Phase weitestgehend abgeschlossen ist und sich Gleichgewichte der unterschiedlichsten Art eingestellt haben (Abb. 10), wenn keine größeren initialen Einflüsse von außen einwirken (z. B. Extremniederschläge, Hochwasser, Sprengungen, Absenkung des Grundwasserspiegels, Bohrungen). Abb. 10 Gleichgewichtsformen in geotechnischen und geologischen Systemen (ergänzt) [17] Bei der Bewertung ist auch zu beachten, dass zahlreiche Reviere und Gruben mehrfach aktiviert wurden oder in den Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkung von Tagebauen reichen und damit die o. g. Schadensperioden auch mehrfach durchlaufen haben. Mit der Flutung kann es auch zu Hebungen und Wasseraufnahmen von den anstehenden tonigen Deckgebirgsschichten kommen. Die daraus resultierenden Geländebewegungen müssen als langzeitwirksam eingeordnet werden, worauf beispielsweise die Schadensentwicklung des Braunkohlentiefbaues
17 im cm-bereich pro Jahr in Most mit ca. 70 Jahren und in Gerlebogk mit ca. 80 Jahren verweist. Deutlich sind die aktiv anhaltenden Geländeveränderungen an den Standwasserbildungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und an randlichen Zerrungsbereichen von bebauten Senkungsmulden zu erkennen. Grundsätzlich kann es auch zu aktuellen altbergbaulichen Schadensereignissen an der Tagesoberfläche kommen, die auf Schwimmsand zurückzuführen sind. Diese Schadenswirkungen sind vor allem dann zu beobachten, wenn Bohrungen in offene bergmännische Hohlräume stoßen (z. B. Strecken) und dabei zwischen Bohrwerkzeug und Bohrgestänge ein unverrohrter, offener Ringraum verbleibt. Diese neue vertikale Verbindung zwischen den isolierten Schwimmsandlagern und den offenen oder teilweise offenen Grubenbauen reicht für einen schwerkraftbedingten Materialfluss in den gefluteten Grubenbauen aus, was dann zu einem meist größeren Bohrlochverbruch führen kann. Solche Beispiele sind nach mündlichen Informationen in der Tiefbaugrube Preußlitz bei einer Mächtigkeit des Tones von 80 m mit Tagesbruchdurchmessern von ca. 8 m aufgetreten. Eine numerische Tagesbruchabschätzung nach FENK oder MEIER ist hierbei nicht anwendbar. 7 Schlussfolgerungen Anhand einer ausgewählten Literaturanalyse zum Schwimmsandphänomen zeigen sich in der Regel folgende Sachverhalte: In tertiären Braunkohlenlagerstätten kann man Deckgebirge mit vorwiegend tonigschluffig-sandiger oder sandig-kiesiger Fazies unterscheiden. Sie zeigen in der Regel unterschiedliches Tagesbruch- bzw. Deformationsverhalten. Schwimmsande und Tone sind in sehr unterschiedlichen Mächtigkeiten und in ihren horizontalen Ausdehnungen in Fest- und Lockergesteinsbereichen sehr wechselhaft anzutreffen. Die einzelnen Schichtglieder sind durch den Bruchbau in ihrer Lagerung und in der hydrogeologischen Funktionalität tiefgreifend gestört. Schwimmsand ist im Grundwasserbereich wassergesättigt, gering durchlässig und verhält sich in der Regel wie eine Flüssigkeit, was ihre Mobilität unterstreicht. Schadenswirksame Schwimmsandereignisse sind hauptsächlich der Vorrichtungs- und Abbauphase des Braunkohlentiefbaues zuzuordnen. Im Altbergbau des Braunkohlentiefbaues wurden nach den verfügbaren Quellen nur Tagesbrüche an Bohrungen beobachtet, die Schwimmsand und Ton durchstoßen haben. Mächtiges tonig-schluffiges Deckgebirge zeigt über einen sehr langen Zeitraum Deformationen an der Tagesoberfläche, was in zahlreichen Fällen zunehmend zu Vernässungen und Standwasserbildungen führt. Häufig bilden sich in einer welligen Geländeoberfläche abflusslose Senkungsmulden. In den Randbereichen dieser Mulden treten Zerrungszonen auf, deren Bewegungsgröße im cm/a-bereich liegt und zu erheblichen Schadensbildern an Gebäuden (z. B. Schieflagen, Rissbildungen) führen kann. Bei anstehendem Schwimmsand, Grundwasserströmen und vertikalen sowie horizontalen Fließbahnen im gestörten Deckgebirge und in den verbrochenen Grubenbauen kommt es zu ständigen, geringfügigen Materialumlagerungen durch die Wirkung der Schwerkraft und Einwirkungen von Konvergenzen. Im tiefsten Grubenbereich muss deshalb mit einer Anhäufung von schlammartigen Ablagerungen und mit einer Verringerung von Hohlräumen gerechnet werden, was zu einer Reduzierung der Verbruchprozesse führt
18 Eine numerische Abschätzung von Schwimmsandphänomen ist anhand der Formeln der HBB-Bilanz nach MEIER nicht möglich, da hierfür der Geltungsbereich der benötigten geotechnischen Kennwerte und die erforderlichen Randbedingungen nicht gegeben sind. Bohrungen durch Schwimmsand- und Tonschichten sind technisch so auszuführen, dass keine offene, vertikale Verbindung zwischen den hangenden Schichten und dem bergmännischen Hohlraum hergestellt wird. Trotz umfangreicher historischer und aktueller Fachliteratur zum Schwimmsandphänomen und anhand gegenwärtiger Schadensereignisse bleibt ein vielschichtiger geotechnischer Fragenkomplex, insbesondere zum Langzeitverhalten des Schwimmsandes im Bereich des gestörten Deckgebirges und der grundhaft gestörten Grundwasserleiter derzeit unbeantwortet. 8 Quellenverzeichnis [1] SINGER, M. (1932): Der Baugrund. - Verlag von Julius Springer Wien [2] KNAUPE, W. (1983): Baugrubensicherung und Wasserhaltung Aufl., VEB Verlag für Bauwesen Berlin [3] KEIL, K. (1954): Ingenieurgeologie und Geotechnik. - 2., erweiterte Aufl., VEB Wilhelm Knapp Verlag, Halle (Saale) [4] PRINZ, H.; STRAUSS, R. (2006): Abriss der Ingenieurgeologie. - 4., bearbeitete und erweiterte Aufl., Elsevier GmbH, München [5] KÖHLER, G. (1900): Lehrbuch der Bergbaukunde. - 5., verbesserte Auflage, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig [6] NIESS, H. (1907): Die Bekämpfung der Wassersand-(Schwimmsand-)Gefahr beim norddeutschen Braunkohlenbergbau. - Verlag von Craz & Gerlach (Joh. Stettner), Freiberg [7] KLEIN, G. (1907): Handbuch für den Deutschen Braunkohlenbergbau. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. [8] TRACHTULEC, J. (1963): Bergmännisch-hydrogeologische Probleme im Nordböhmischen Braunkohlenrevier. - Ber. Geol. Ges. DDR, Bd. 8, H. 1, S , Akademie-Verlag Berlin [9] TREPTOW, E.; WÜST, F.; BORCHERS, W. (1900): Bergbau und Hüttenwesen. -Verlag und Druck von Otto Spamer, Leipzig [10] POKORNÁ, L. (2005): Unglücksfälle und Katastrophen im Bergbau und Braunkohlenbergbau, verbunden mit sozialgeschichtlichen Untersuchungen. - Tagungsband, 8. Internationaler Bergbau-Workshop in Most (CS) S , Druck: Papierflieger Sankt Andreasberg/Most Nov [11] KEGEL, K. (1912): Bergmännische Wasserwirtschaft. - Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S
19 [12] WAGENBRETH, O. (2011): Die Braunkohlenindustrie in Mitteldeutschland. Geologie, Geschichte, Sachzeugen.- Sax-Verlag, Beucha, Markkleeberg [13] HÜNEFELD, v. E. B. F. (2014): Der mitteldeutsche Braunkohlentiefbau und seine altbergbaulich bedingten Erscheinungsbilder unter Berücksichtigung der Fließsandproblematik. - TU Bergakademie Freiberg, Bachelorarbeit, Fak. Geowiss., Geotechnik und Bergbau (unveröff.) [14] CHLEBUS, P. (1951): Abbaudynamische Entscheidung über die Entwässerungsfrage von Wassersand (Schwimmsand) beim Mehrscheibenverhieb mächtiger Braunkohlenflöze. - Braunkohle, Wärme und Energie, Bd. 3, Düsseldorf, H. 13/14, S [15] WITT, K. J. (HRSG.) (2008): Grundbau-Taschenbuch, Teil 1: Geotechnische Grundlagen Aufl., Ernst & Sohn GmbH & Co. KG, Berlin [16] DACHROTH, W. R. (2002): Handbuch der Baugeologie und Geotechnik, 3. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York [17] EISBACHER, G. H.; KLEY, J. (2001): Grundlagen der Umwelt- und Rohstoffgeologie. - Enke im Georg Thieme Verlag Stuttgart [18] KUGLER, J. (2010): Fotodokumentation der Sanierung des Schluchtengewölbes am I. Lichtloch des Rothschönberger Stollns. - EasyBook prixum (unveröff.) [19] MÜLLER, H. (1878): Die Ausführung des fiscalischen Rothschönberger Stollns in den Jahren Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1878, Freiberg, in Commission bei Graz & Gerlach [20] KUTZNER, CH. (1996): Erd- und Steinschüttdämme für Stauanlagen. - Enke Stuttgart [21] HÄRTIG, H. (1953): Die Rutschung am Reichsbahn-Sicherheitspfeiler Großkayna und der Bau einer 140 m hohen Dammkippe. - Freiberger Forschungshefte, Reihe A Bergbau, H. 12, Akademie Verlag, Berlin
Ewigkeitslasten im Bergbau Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen
 8. Internationale Bergbaukonferenz 2012 Ewigkeitslasten im Bergbau Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen Technische Fachhochschule Georg Agricola für Rohstoff, Energie und Umwelt zu Bochum Dr. Christian
8. Internationale Bergbaukonferenz 2012 Ewigkeitslasten im Bergbau Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen Technische Fachhochschule Georg Agricola für Rohstoff, Energie und Umwelt zu Bochum Dr. Christian
Fachbeitrag Altlasten
 Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Zur Bestimmung von altbergbaulich bedingten Einwirkungsbereichen. Dr.-Ing. habil. Günter Meier
 Zur Bestimmung von altbergbaulich bedingten Einwirkungsbereichen Dr.-Ing. habil. Günter Meier Ingenieurbüro Dr. G. Meier, Wegefarth/Freiberg www.dr-gmeier.de Zusammenfassung Eine Voraussetzung für geotechnisch-markscheiderische
Zur Bestimmung von altbergbaulich bedingten Einwirkungsbereichen Dr.-Ing. habil. Günter Meier Ingenieurbüro Dr. G. Meier, Wegefarth/Freiberg www.dr-gmeier.de Zusammenfassung Eine Voraussetzung für geotechnisch-markscheiderische
Bauvorhaben Erweiterung Kita Gropiusweg in Bochum Gutachterliche Stellungnahme zu den oberflächennahen bergbaulichen Verhältnisse
 Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom mein Zeichen Datum 11188/11-ku 16. Februar 2012 11188gu3_bb.odt Bauvorhaben Erweiterung Kita Gropiusweg in Bochum Gutachterliche Stellungnahme zu den oberflächennahen bergbaulichen
Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom mein Zeichen Datum 11188/11-ku 16. Februar 2012 11188gu3_bb.odt Bauvorhaben Erweiterung Kita Gropiusweg in Bochum Gutachterliche Stellungnahme zu den oberflächennahen bergbaulichen
Bergwerk Asse II wird ein Forschungsbergwerk für radioaktiven Abfall zum Endlager?
 Schacht KONRAD ein geeignetes Endlager für radioaktiven Abfall? Bergwerk Asse II wird ein Forschungsbergwerk für radioaktiven Abfall zum Endlager? Dipl.-Ing. Udo Dettmann Salzgitter, 24. September 2007
Schacht KONRAD ein geeignetes Endlager für radioaktiven Abfall? Bergwerk Asse II wird ein Forschungsbergwerk für radioaktiven Abfall zum Endlager? Dipl.-Ing. Udo Dettmann Salzgitter, 24. September 2007
Ingenieurgeologische Stellungnahme zur Erdabsenkung in Kirchheim am Neckar vom Dezember 2013
 - Präsentation LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU Ingenieurgeologische Stellungnahme zur Erdabsenkung in Kirchheim am Neckar vom Dezember 2013 7. Sitzung der Informationskommission zum Kernkraftwerk
- Präsentation LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU Ingenieurgeologische Stellungnahme zur Erdabsenkung in Kirchheim am Neckar vom Dezember 2013 7. Sitzung der Informationskommission zum Kernkraftwerk
Stockwerksbau - Aufbau geologischer Einheiten - Ingo Schäfer Geologischer Dienst NRW
 Stockwerksbau - Aufbau geologischer Einheiten - Ingo Schäfer Geologischer Dienst NRW Bau und Betrieb von Erdwärmesonden Jedes geothermische Vorhaben hat Auswirkungen, wobei zu unterscheiden ist zwischen
Stockwerksbau - Aufbau geologischer Einheiten - Ingo Schäfer Geologischer Dienst NRW Bau und Betrieb von Erdwärmesonden Jedes geothermische Vorhaben hat Auswirkungen, wobei zu unterscheiden ist zwischen
Frank Burkhardt Bauingenieur (B.Eng), Brunnenbauer
 Herausforderungen im kritischen kritischen Stockwerksbau Lösungen und Hintergründe Fachgespräch Erdwärmenutzung Hessen 18.09.2014 Frank Burkhardt Bauingenieur (B.Eng), Brunnenbauer Burkhardt GmbH& Co.KG
Herausforderungen im kritischen kritischen Stockwerksbau Lösungen und Hintergründe Fachgespräch Erdwärmenutzung Hessen 18.09.2014 Frank Burkhardt Bauingenieur (B.Eng), Brunnenbauer Burkhardt GmbH& Co.KG
Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden
 Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden Uwe Büttner, Dipl.-Hydrologe, Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Das Gebiet Hinsichtlich seiner Gewässernetzstruktur und Lage innerhalb des zentraleuropäischen
Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden Uwe Büttner, Dipl.-Hydrologe, Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Das Gebiet Hinsichtlich seiner Gewässernetzstruktur und Lage innerhalb des zentraleuropäischen
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
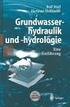 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Altbergbau im Land Brandenburg
 Geologie und Rohstoffe Altbergbau im Land Dipl.- Ing. Holger Vöhl Erdbauseminar des VSVI Berlin- am 12. Februar 2015 in Frankfurt(Oder) Geologie und Rohstoffe Inselstraße 26 03046 Cottbus Früher: Tuchfabrik
Geologie und Rohstoffe Altbergbau im Land Dipl.- Ing. Holger Vöhl Erdbauseminar des VSVI Berlin- am 12. Februar 2015 in Frankfurt(Oder) Geologie und Rohstoffe Inselstraße 26 03046 Cottbus Früher: Tuchfabrik
ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement. Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A
 ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A Dr. AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 1 Fallbeispiel A: Chemische
ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A Dr. AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 1 Fallbeispiel A: Chemische
Versickern statt ableiten
 Hinweise und Tips für private Grundstückseigentümer zur Versickerung von Niederschlagswasser Regenwasser gehört nicht in die Kanalisation, sondern soll dem Naturhaushalt möglichst direkt wieder zugeführt
Hinweise und Tips für private Grundstückseigentümer zur Versickerung von Niederschlagswasser Regenwasser gehört nicht in die Kanalisation, sondern soll dem Naturhaushalt möglichst direkt wieder zugeführt
Geothermische Nutzung von Grubenwässern: Potentiale & Herausforderungen
 Geothermische Nutzung von Grubenwässern: Potentiale & Herausforderungen Die Grubenlandschaft in Sachsen Geothermieanlage Reiche Zeche /Freiberg Potentiale der Forschungsbohrung Zwickau Kolloquium Neue
Geothermische Nutzung von Grubenwässern: Potentiale & Herausforderungen Die Grubenlandschaft in Sachsen Geothermieanlage Reiche Zeche /Freiberg Potentiale der Forschungsbohrung Zwickau Kolloquium Neue
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Projekttag zum Thema Leben am Fluss. Gewässerstruktur
 Projekttag zum Thema Leben am Fluss Caspar David Friedrich Das Große Gehege Gewässerstruktur Idee, Konzeption und Umsetzung: R. Herold, LfULG Sachsen Mitwirkung: A. Goerigk, M. Grafe, LfULG Sachsen Zusammenarbeit
Projekttag zum Thema Leben am Fluss Caspar David Friedrich Das Große Gehege Gewässerstruktur Idee, Konzeption und Umsetzung: R. Herold, LfULG Sachsen Mitwirkung: A. Goerigk, M. Grafe, LfULG Sachsen Zusammenarbeit
Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen
 Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen Dipl.-Geologe Marcus Richter HGC Hydro-Geo-Consult GmbH Gliederung 1.
Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen Dipl.-Geologe Marcus Richter HGC Hydro-Geo-Consult GmbH Gliederung 1.
Grundwassermodell. 4.2 Wasserkreislauf. Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf:
 4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
U-Bahnhof Marienplatz München, Bahnsteigerweiterung Vortrieb unter Eis
 U-Bahnhof Marienplatz München, Bahnsteigerweiterung Vortrieb unter Eis U-Bahnhof Marienplatz Visualisierung Marienplatz Der U-Bahnhof Marienplatz ist der mit Abstand am stärksten frequentierte Knotenpunkt
U-Bahnhof Marienplatz München, Bahnsteigerweiterung Vortrieb unter Eis U-Bahnhof Marienplatz Visualisierung Marienplatz Der U-Bahnhof Marienplatz ist der mit Abstand am stärksten frequentierte Knotenpunkt
Hygienische Anforderungen. an Trinkwasser im österreichischen Lebensmittelbuch. Hygienische Anforderungen. Hygienische Anforderungen
 ÖLMB Kapitel B1 Trinkwasser (3) Alle Einrichtungen der Förderung, des Transportes, der Speicherung, der Aufbereitung und der Verteilung des Wassers (Wasserversorgungsanlage) müssen so errichtet, betrieben
ÖLMB Kapitel B1 Trinkwasser (3) Alle Einrichtungen der Förderung, des Transportes, der Speicherung, der Aufbereitung und der Verteilung des Wassers (Wasserversorgungsanlage) müssen so errichtet, betrieben
ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen:
 Sehr geehrter Herr Reuter, ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen: Wie soll man den SGS beurteilen, was ist er in Ihren Augen?
Sehr geehrter Herr Reuter, ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen: Wie soll man den SGS beurteilen, was ist er in Ihren Augen?
Baugrubenherstellung für das Schloßpark-Center in Schwerin
 Baugrubenherstellung für das Schloßpark-Center in Schwerin Dipl.-Ing. H. Mellech, Rostock und Dipl.-Ing. H. Zehe, Hamburg GKT Spezialtiefbau GmbH, Winsbergring 3, 22525 Hamburg Internet: http://www.gktspezi.de
Baugrubenherstellung für das Schloßpark-Center in Schwerin Dipl.-Ing. H. Mellech, Rostock und Dipl.-Ing. H. Zehe, Hamburg GKT Spezialtiefbau GmbH, Winsbergring 3, 22525 Hamburg Internet: http://www.gktspezi.de
Studie. Potenzielle Standorte für Hochwasserpolder und Deichrückverlegungen an den Gewässern Elbe, Mulde, Saale und Weiße Elster
 Studie Potenzielle Standorte für Hochwasserpolder und Deichrückverlegungen an den Gewässern Elbe, Mulde, Saale und Weiße Elster Halle (Saale), 31. August 2014 2 1 Veranlassung und Zielstellung In der Vergangenheit
Studie Potenzielle Standorte für Hochwasserpolder und Deichrückverlegungen an den Gewässern Elbe, Mulde, Saale und Weiße Elster Halle (Saale), 31. August 2014 2 1 Veranlassung und Zielstellung In der Vergangenheit
Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien
 Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien Jochen Stark Referat Boden und Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung Workshop der MAGPlan - Begleitgruppe 28./29. Juni
Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien Jochen Stark Referat Boden und Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung Workshop der MAGPlan - Begleitgruppe 28./29. Juni
Die neue Gefahrstoffverordnung
 FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Die neue Gefahrstoffverordnung Herausgeber: Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Die neue Gefahrstoffverordnung Herausgeber: Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
Grundzüge der Salzabwasserversenkung
 Hessisches Ministerium Landesamt für Umwelt, für ländlichen Umwelt Raum und und Geologie Verbraucherschutz Grundzüge der Salzabwasserversenkung - Verhalten im Versenkhorizont Plattendolomit - Auswirkungen
Hessisches Ministerium Landesamt für Umwelt, für ländlichen Umwelt Raum und und Geologie Verbraucherschutz Grundzüge der Salzabwasserversenkung - Verhalten im Versenkhorizont Plattendolomit - Auswirkungen
Betreff: Untersuchungen der Auswirkungen von wasserspeichernden Zusatzstoffen
 Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft Fa. Aquita z.hd. Herrn Ludwig FÜRST Pulvermühlstr. 23 44 Linz Wien, 9. Juni 9 Betreff: Untersuchungen
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft Fa. Aquita z.hd. Herrn Ludwig FÜRST Pulvermühlstr. 23 44 Linz Wien, 9. Juni 9 Betreff: Untersuchungen
Wasserdurchlässigkeit und Kapillaraufstieg
 Wasserdurchlässigkeit und Kapillaraufstieg Kurzinformation Um was geht es? Regenwasser versickert in verschiedenen Böden unterschiedlich. Ihr untersucht in diesem Versuch den Einfluss auf die Versickerung
Wasserdurchlässigkeit und Kapillaraufstieg Kurzinformation Um was geht es? Regenwasser versickert in verschiedenen Böden unterschiedlich. Ihr untersucht in diesem Versuch den Einfluss auf die Versickerung
Aktuelles zum Wettergeschehen
 Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
Baugebiet Makartstraße in Pforzheim
 BUC Immobilien GmbH Bleichstraße 13-17 75173 Pforzheim Baugebiet Makartstraße in Pforzheim Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Karlsruhe Hans-Sachs-Straße 9 76133 Karlsruhe 31.10.2012 Telefon 0721 98453-0
BUC Immobilien GmbH Bleichstraße 13-17 75173 Pforzheim Baugebiet Makartstraße in Pforzheim Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Karlsruhe Hans-Sachs-Straße 9 76133 Karlsruhe 31.10.2012 Telefon 0721 98453-0
Geotop Lange Wand bei Ilfeld
 Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
Kristallhöhle Kobelwald
 Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Spezialtiefbau und Erdwärme-Gewinnung auf höchstem Niveau beim Projekt Austria Campus
 Spezialtiefbau und Erdwärme-Gewinnung auf höchstem Niveau beim Projekt Austria Campus Autoren des Fachartikels: Jürgen Feichtinger, Christian Marchsteiner, Markus Weiss Porr Bau GmbH - Abteilung Grundbau
Spezialtiefbau und Erdwärme-Gewinnung auf höchstem Niveau beim Projekt Austria Campus Autoren des Fachartikels: Jürgen Feichtinger, Christian Marchsteiner, Markus Weiss Porr Bau GmbH - Abteilung Grundbau
Multitemporale 3D-Visualisierung des Bergbaugebietes Teutschenthal
 Multitemporale 3D-Visualisierung des Bergbaugebietes Teutschenthal Rekonstruktion und Analyse anthropogener Überformungen in einem Altbergbaugebiet Bachelorarbeit von Thomas Walther Gliederung 1. Einleitung
Multitemporale 3D-Visualisierung des Bergbaugebietes Teutschenthal Rekonstruktion und Analyse anthropogener Überformungen in einem Altbergbaugebiet Bachelorarbeit von Thomas Walther Gliederung 1. Einleitung
Experimente zu Geothermie
 Hintergrundinformation Vor langer Zeit war die Erde eine glühend heiße Kugel. Langsam hat sie sich an der Oberfläche abgekühlt, im Inneren jedoch ist sie immer noch sehr heiß. Die nutzt diese Erdwärme
Hintergrundinformation Vor langer Zeit war die Erde eine glühend heiße Kugel. Langsam hat sie sich an der Oberfläche abgekühlt, im Inneren jedoch ist sie immer noch sehr heiß. Die nutzt diese Erdwärme
Temperatur des Grundwassers
 Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Die ehemalige Zeche "Kleine Windmühle" liegt in Obersprockhövel am Sirrenberg.
 1 Oliver Glasmacher / Daniel Göbelshagen. Die Zeche Kleine Windmühle Die ehemalige Zeche "Kleine Windmühle" liegt in Obersprockhövel am Sirrenberg. In der Gegend am Sirrenberg ist wie überall in südlichen
1 Oliver Glasmacher / Daniel Göbelshagen. Die Zeche Kleine Windmühle Die ehemalige Zeche "Kleine Windmühle" liegt in Obersprockhövel am Sirrenberg. In der Gegend am Sirrenberg ist wie überall in südlichen
Schildvortriebe im Lockergestein und Leitungstunnelbau
 Übung Schildvortriebe im Lockergestein/Leitungstunnelbau 1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau Schildvortriebe im Lockergestein und Leitungstunnelbau 1 Allgemeines zum Schildvortrieb
Übung Schildvortriebe im Lockergestein/Leitungstunnelbau 1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau Schildvortriebe im Lockergestein und Leitungstunnelbau 1 Allgemeines zum Schildvortrieb
Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier
 Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
NORDAMERIKA und wir 2/2. Naturgeographische Gunst- und Ungunsträume
 Klasse: 10 Station 2: Thema 2: Naturgeographische Gunst- und Ungunsträume Debby, Florence, Sandy und Co. Aufgaben: 1. Werte die Informationen aus dem Text im Buch auf den Seiten 90, 91 und 95 sowie die
Klasse: 10 Station 2: Thema 2: Naturgeographische Gunst- und Ungunsträume Debby, Florence, Sandy und Co. Aufgaben: 1. Werte die Informationen aus dem Text im Buch auf den Seiten 90, 91 und 95 sowie die
14 Allgemeine Informationen. Juristische Aspekte
 14 Allgemeine Informationen Juristische Aspekte Unter Notfällen sind aus juristischer Sicht solche Ereignisse zu verstehen, die außerplanmäßige Behandlungen erforderlich machen. Grundsätzlich beinhaltet
14 Allgemeine Informationen Juristische Aspekte Unter Notfällen sind aus juristischer Sicht solche Ereignisse zu verstehen, die außerplanmäßige Behandlungen erforderlich machen. Grundsätzlich beinhaltet
Interpretation von Wolkenbildern und Wetterphänomenen für Piloten und Ballonfahrer Dr. Manfred Reiber
 Es gibt nichts Praktischeres, als eine gute Theorie. Immanuel Kant Interpretation von Wolkenbildern und Wetterphänomenen für Piloten und Ballonfahrer Dr. Manfred Reiber Teil 4: Welche Hinweise können uns
Es gibt nichts Praktischeres, als eine gute Theorie. Immanuel Kant Interpretation von Wolkenbildern und Wetterphänomenen für Piloten und Ballonfahrer Dr. Manfred Reiber Teil 4: Welche Hinweise können uns
Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten am Jakob Adolph Stollen ein wasserführender Stollen unter der Stadt Hettstedt (Sachsen Anhalt)
 Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten am Jakob Adolph Stollen ein wasserführender Stollen unter der Stadt Hettstedt (Sachsen Anhalt) Günter Meier 1), Gerhard Jost, Angelika Dauerstedt 2) 1) Ingenieurbüro
Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten am Jakob Adolph Stollen ein wasserführender Stollen unter der Stadt Hettstedt (Sachsen Anhalt) Günter Meier 1), Gerhard Jost, Angelika Dauerstedt 2) 1) Ingenieurbüro
GEOTECHNIK (Ingenieurgeologie / Bodenmechanik I) Prof. Dr.-Ing. habil Jens Engel
 GEOTECHNIK (Ingenieurgeologie / Bodenmechanik I) Prof. Dr.-Ing. habil Jens Engel Übersicht über das Gesamtlehrgebiet Geotechnik Umfang V/Ü/P (ECTS) - 2/1/0 (3) 2/1/0 2/1/0-2*/0/0 - Diplom Vertiefung Geotechnik
GEOTECHNIK (Ingenieurgeologie / Bodenmechanik I) Prof. Dr.-Ing. habil Jens Engel Übersicht über das Gesamtlehrgebiet Geotechnik Umfang V/Ü/P (ECTS) - 2/1/0 (3) 2/1/0 2/1/0-2*/0/0 - Diplom Vertiefung Geotechnik
Wesentliche Aspekte des Gutachtens Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier und Schlussfolgerungen daraus.
 Wesentliche Aspekte des Gutachtens Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier und Schlussfolgerungen daraus. Im Rheinischen Revier wird seit mehr als 100 Jahren Braunkohle gewonnen.
Wesentliche Aspekte des Gutachtens Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier und Schlussfolgerungen daraus. Im Rheinischen Revier wird seit mehr als 100 Jahren Braunkohle gewonnen.
WS 2013/2014. Vorlesung Strömungsmodellierung. Prof. Dr. Sabine Attinger
 WS 2013/2014 Vorlesung Strömungsmodellierung Prof. Dr. Sabine Attinger 29.10.2013 Grundwasser 2 Was müssen wir wissen? um Grundwasser zu beschreiben: Grundwasserneubildung oder Wo kommt das Grundwasser
WS 2013/2014 Vorlesung Strömungsmodellierung Prof. Dr. Sabine Attinger 29.10.2013 Grundwasser 2 Was müssen wir wissen? um Grundwasser zu beschreiben: Grundwasserneubildung oder Wo kommt das Grundwasser
Bodenschätze. Aufgabe 2: Der neue Weg Chinas bei den Seltenen Erden. Germanium (Ge) Wolfram (W) Molybdän (Mo) Seltene Erden
 Delitzsch Aufgabe : Die größten Förderländer für Ge, Mo, W und Seltene Erden Analysiere die Diagramme auf der Internetseite Wenn seltene gebraucht werden und erstelle eine Reihenfolge der Förderländer
Delitzsch Aufgabe : Die größten Förderländer für Ge, Mo, W und Seltene Erden Analysiere die Diagramme auf der Internetseite Wenn seltene gebraucht werden und erstelle eine Reihenfolge der Förderländer
Projektbeschreibung VODAMIN ( )
 Projektbeschreibung VODAMIN (2010 2013) In Regionen mit aktivem Bergbau sowie in Bergbaufolgelandschaften ist der natürliche Gewässerhaushalt stark beeinträchtigt. Negative Auswirkungen sind großflächige
Projektbeschreibung VODAMIN (2010 2013) In Regionen mit aktivem Bergbau sowie in Bergbaufolgelandschaften ist der natürliche Gewässerhaushalt stark beeinträchtigt. Negative Auswirkungen sind großflächige
Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen Stoffliche Zusammensetzung von RC-Baustoffen: Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
 Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen : Erkenntnisse aus Forschung und Praxis Inhalt Motivation Grundlagen Zusammenfassung 2 Motivation Anfragen/Bedenken der Produzenten bezüglich Auswirkungen auf die
Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen : Erkenntnisse aus Forschung und Praxis Inhalt Motivation Grundlagen Zusammenfassung 2 Motivation Anfragen/Bedenken der Produzenten bezüglich Auswirkungen auf die
BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz
 BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz MHW Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung und Untersuchungsumfang... 2 2 Schurf und hydrogeologische Verhältnisse... 2 3 Grundwasserstände... 3 4 Mittlerer Grundwasserhochstand...
BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz MHW Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung und Untersuchungsumfang... 2 2 Schurf und hydrogeologische Verhältnisse... 2 3 Grundwasserstände... 3 4 Mittlerer Grundwasserhochstand...
Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser
 Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser Questions due to Water-Soil-Interaction in unsaturated soils below water table H.-J. Köhler Bundesanstalt für Wasserbau
Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser Questions due to Water-Soil-Interaction in unsaturated soils below water table H.-J. Köhler Bundesanstalt für Wasserbau
Sanierung von Hauptkanälen: Risikoanalyse eines Mischwasserkanals Fallbeispiel Arnheim
 Fallbeispiel Arnheim IKT-Praxistage Neubau, Sanierung und Reparatur 10. September 2015 Dr. Götz Vollmann (Ruhr-Universität Bochum) Ing. Erik Laurentzen (Gemeente Arnhem) Trassenverlauf Zentrum Rhein 20.000
Fallbeispiel Arnheim IKT-Praxistage Neubau, Sanierung und Reparatur 10. September 2015 Dr. Götz Vollmann (Ruhr-Universität Bochum) Ing. Erik Laurentzen (Gemeente Arnhem) Trassenverlauf Zentrum Rhein 20.000
Geotechnische Eigenschaften von Permafrostböden
 SLF Davos, 1. Oktober 2009 Geotechnische Eigenschaften von Permafrostböden Lukas Arenson, Dr. Sc. Techn. ETH larenson@bgcengineering.ca +1.604.684.5900 ext. 116 Übersicht Einführung Gefrorene Böden Klassifikation
SLF Davos, 1. Oktober 2009 Geotechnische Eigenschaften von Permafrostböden Lukas Arenson, Dr. Sc. Techn. ETH larenson@bgcengineering.ca +1.604.684.5900 ext. 116 Übersicht Einführung Gefrorene Böden Klassifikation
Regenwasserversickerung
 Regenwasserversickerung Mit der Veröffentlichung des ATV-DVWK Arbeitsblattes 138 vom Januar 2002 haben sich eine Reihe von Veränderungen bei der Planung und Bemessung von Versickerungsanlagen ergeben.
Regenwasserversickerung Mit der Veröffentlichung des ATV-DVWK Arbeitsblattes 138 vom Januar 2002 haben sich eine Reihe von Veränderungen bei der Planung und Bemessung von Versickerungsanlagen ergeben.
Erläuterungen. Geologischen Karte von Hessen 1: Blatt Nr Frankfurt a.m. West
 Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1:25000 Blatt Nr. 5817 Frankfurt a.m. West 3., neu bearbeitete Auflage Von EBERHARD KÜMMERLE & GÜNTER SEIDENSCHWANN Mit Beiträgen von HANS-JÜRGEN ANDERLE,
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1:25000 Blatt Nr. 5817 Frankfurt a.m. West 3., neu bearbeitete Auflage Von EBERHARD KÜMMERLE & GÜNTER SEIDENSCHWANN Mit Beiträgen von HANS-JÜRGEN ANDERLE,
Institut für Geotechnik. TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau Institut für Geotechnik http://tu-freiberg.de/fakult3/gt Der Diplomingenieur für Geotechnik Berufsbild
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau Institut für Geotechnik http://tu-freiberg.de/fakult3/gt Der Diplomingenieur für Geotechnik Berufsbild
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel
 Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 5: Klimawandel Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 5: Klimawandel Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
Wie weit gehen wir, um Bodenverdichtungen auf zu brechen?
 Wie weit gehen wir, um Bodenverdichtungen auf zu brechen? Vorhaben: Mit einem Erdbohrer, die Bodenstruktur zu Gunsten der Pflanzen verändern. Verwendetes Material: > gewaschener Kies 0-3 mm > reiner Kompost
Wie weit gehen wir, um Bodenverdichtungen auf zu brechen? Vorhaben: Mit einem Erdbohrer, die Bodenstruktur zu Gunsten der Pflanzen verändern. Verwendetes Material: > gewaschener Kies 0-3 mm > reiner Kompost
5. Verluste aus Kapitalanlagen
 47 5. Verluste aus Kapitalanlagen Es ist nichts Neues, das mit Kapitalanlagen nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste erzielt werden können. Die Verlustverrechnung ist daher für jeden Steuerpflichtigen
47 5. Verluste aus Kapitalanlagen Es ist nichts Neues, das mit Kapitalanlagen nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste erzielt werden können. Die Verlustverrechnung ist daher für jeden Steuerpflichtigen
Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration
 8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
Wahrnehmung von Sprengungen, Senkungen an der Tagesoberfläche
 K+S KALI GmbH Abbauvorhaben von K+S im Bereich des Ortsteils Lautenhausen Wahrnehmung von Sprengungen, Senkungen an der Tagesoberfläche 2.11.2015, Lautenhausen Dr. Tonn, K+S KALI GmbH K+S Gruppe DIN 4150
K+S KALI GmbH Abbauvorhaben von K+S im Bereich des Ortsteils Lautenhausen Wahrnehmung von Sprengungen, Senkungen an der Tagesoberfläche 2.11.2015, Lautenhausen Dr. Tonn, K+S KALI GmbH K+S Gruppe DIN 4150
WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG Kreisstr Warstein-Suttrop
 Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.v. Annastrasse 67-71 50968 Köln D CLJ ~RSCHUNG Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-72 Telefax: +49 (0) 22 1/9346 74-14 Datum: 08.06.2016- Ho/AB Prüfbericht: 37111200416114
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.v. Annastrasse 67-71 50968 Köln D CLJ ~RSCHUNG Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-72 Telefax: +49 (0) 22 1/9346 74-14 Datum: 08.06.2016- Ho/AB Prüfbericht: 37111200416114
Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken
 Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken Glückliche Gesichter nach einer Woche Arbeit mit der Installation
Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken Glückliche Gesichter nach einer Woche Arbeit mit der Installation
Geologische Untersuchungen von Baugrundhebungen im nördlichen Stadtgebiet von Böblingen (Hebungsgebiet Nord )
 - Präsentation LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU Geologische Untersuchungen von Baugrundhebungen im nördlichen Stadtgebiet von Böblingen (Hebungsgebiet Nord ) Dr. Rupert Prestel, Dr. Clemens
- Präsentation LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU Geologische Untersuchungen von Baugrundhebungen im nördlichen Stadtgebiet von Böblingen (Hebungsgebiet Nord ) Dr. Rupert Prestel, Dr. Clemens
TERRAFIRMA. Europaweiter InSAR Monitoring Service mit Beteiligung der DMT. Karsten Zimmermann DMT GmbH & Co. KG. www.terrafirma.eu.
 Europaweiter InSAR Monitoring Service mit Beteiligung der DMT Karsten Zimmermann DMT GmbH & Co. KG 06. 07.05.2010 Karsten Zimmermann Geokinematischer Tag - TU Bergakademie Freiberg Seite 1 www.dmt.de Einführung
Europaweiter InSAR Monitoring Service mit Beteiligung der DMT Karsten Zimmermann DMT GmbH & Co. KG 06. 07.05.2010 Karsten Zimmermann Geokinematischer Tag - TU Bergakademie Freiberg Seite 1 www.dmt.de Einführung
Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt Brandenburgs
 Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt Brandenburgs Unter Berücksichtigung der Jahre 2009-2011 Dipl.-Umweltw. Stephan Reimann Verbandsingenieur 17.11.2011, Kurtschlag Auswirkungen der Klimaentwicklungen?
Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt Brandenburgs Unter Berücksichtigung der Jahre 2009-2011 Dipl.-Umweltw. Stephan Reimann Verbandsingenieur 17.11.2011, Kurtschlag Auswirkungen der Klimaentwicklungen?
28. Februar Geologischer Dienst für Bremen. Praktische Hinweise zur optimalen. Wiedervernässung von Torfabbauflächen. Joachim Blankenburg.
 Geologischer Dienst für Bremen 28. Februar 2012 1 / 17 Übersicht 1 2 3 4 5 6 7 8 2 / 17 Ziel: wachsendes Hochmoor 3 / 17 Entstehungsbedingungen torfbildende Vegetation ständiger Wasserüberschuss konservieren
Geologischer Dienst für Bremen 28. Februar 2012 1 / 17 Übersicht 1 2 3 4 5 6 7 8 2 / 17 Ziel: wachsendes Hochmoor 3 / 17 Entstehungsbedingungen torfbildende Vegetation ständiger Wasserüberschuss konservieren
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur
 Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Ein Strom wird gezähmt
 Ein Strom wird gezähmt Gruppe 2 Wasserbautechnische Eingriffe am Oberrhein Rheinregulierung bei Breisach Wasserbautechnische Eingriffe am Oberrhein Staustufe = Wehr + Schleuse + Kraftwerk Ein Strom wird
Ein Strom wird gezähmt Gruppe 2 Wasserbautechnische Eingriffe am Oberrhein Rheinregulierung bei Breisach Wasserbautechnische Eingriffe am Oberrhein Staustufe = Wehr + Schleuse + Kraftwerk Ein Strom wird
Erläuterungsbericht. zu den wasserrechtlichen Unterlagen
 Unterlage 13.1 zu den wasserrechtlichen Unterlagen Planfeststellung Kreisstraße ED 18 St 2086 (Lappach) B 15 (St. Wolfgang) Ausbau nördlich Sankt Wolfgang ED 18 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+577 ED 18_100_2,706
Unterlage 13.1 zu den wasserrechtlichen Unterlagen Planfeststellung Kreisstraße ED 18 St 2086 (Lappach) B 15 (St. Wolfgang) Ausbau nördlich Sankt Wolfgang ED 18 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+577 ED 18_100_2,706
Hydrostatik auch genannt: Mechanik der ruhenden Flüssigkeiten
 Hydrostatik auch genannt: Mechanik der ruhenden Flüssigkeiten An dieser Stelle müssen wir dringend eine neue physikalische Größe kennenlernen: den Druck. SI Einheit : Druck = Kraft Fläche p = F A 1 Pascal
Hydrostatik auch genannt: Mechanik der ruhenden Flüssigkeiten An dieser Stelle müssen wir dringend eine neue physikalische Größe kennenlernen: den Druck. SI Einheit : Druck = Kraft Fläche p = F A 1 Pascal
Bodenschätze. Aufgabe 2: Die rheinischen Braunkohlentagebaue 1984 und 2009
 Aufgabe 1: Das Rheinische Braunkohlenrevier Unten ist der Ausdruck einer Datei zu sehen, die dir ein Braunkohleunternehmen zugeschickt hat. Leider fehlen Wörter. Fülle den Lückentext mithilfe der vorgegebenen
Aufgabe 1: Das Rheinische Braunkohlenrevier Unten ist der Ausdruck einer Datei zu sehen, die dir ein Braunkohleunternehmen zugeschickt hat. Leider fehlen Wörter. Fülle den Lückentext mithilfe der vorgegebenen
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Landschaft und Windturbinen. Ein Vorgehen für die gesamte Schweiz Yves Leuzinger / bureau Natura
 Landschaft und Windturbinen Ein Vorgehen für die gesamte Schweiz Yves Leuzinger / bureau Natura Landschaft - Begriffsdefinition Die Landschaft bildet die heutigen wie die früheren Beziehungen zwischen
Landschaft und Windturbinen Ein Vorgehen für die gesamte Schweiz Yves Leuzinger / bureau Natura Landschaft - Begriffsdefinition Die Landschaft bildet die heutigen wie die früheren Beziehungen zwischen
Ingenieurgeologische Bewertung von Gefahren und Risiken im Altbergbau
 Ingenieurgeologische Bewertung von Gefahren und Risiken im Altbergbau Geological engineering valuation of danger and risk in the field of abandoned mining Dr.-Ing. habil. Günter Meier 1 Zusammenfassung
Ingenieurgeologische Bewertung von Gefahren und Risiken im Altbergbau Geological engineering valuation of danger and risk in the field of abandoned mining Dr.-Ing. habil. Günter Meier 1 Zusammenfassung
Gefährdung von Bauwerken durch Hoch-, Grund- und Oberflächenwasser
 Gefährdung von Bauwerken durch Hoch-, Grund- und Oberflächenwasser Dipl.Ing. Dr. Stefan Haider Büro Pieler ZT GmbH, Eisenstadt äußere Wassergefahren Hochwasser Hangwasser Grundwasser Rückstau aus Abwasserentsorgung
Gefährdung von Bauwerken durch Hoch-, Grund- und Oberflächenwasser Dipl.Ing. Dr. Stefan Haider Büro Pieler ZT GmbH, Eisenstadt äußere Wassergefahren Hochwasser Hangwasser Grundwasser Rückstau aus Abwasserentsorgung
Teil 6: Grundwasserabsenkung. Viktor Mechtcherine Institut für Baustoffe. Modul BIW3-04, SS 2015 LV Baustofftechnik im Grundbau
 Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe, Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine Modul BIW3-04, SS 2015 LV Baustofftechnik im Grundbau Teil 6: Holzschäden infolge Grundwasserabsenkung Viktor Mechtcherine
Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe, Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine Modul BIW3-04, SS 2015 LV Baustofftechnik im Grundbau Teil 6: Holzschäden infolge Grundwasserabsenkung Viktor Mechtcherine
15. Tagung für Ingenieurgeologie Erlangen 2005
 Risiko- und Gefahrenanalyse an Altbergbauanlagen unter Verwendung geotechnischer Untersuchungsverfahren Risk- and hazard analysis of old mining plants by using geotechnical methods of investigation Meier,
Risiko- und Gefahrenanalyse an Altbergbauanlagen unter Verwendung geotechnischer Untersuchungsverfahren Risk- and hazard analysis of old mining plants by using geotechnical methods of investigation Meier,
Funktionsansprüche an die Hinterfüllung einer Erdwärmesonde
 Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Modell zur Veranschaulichung der Meeresströmungen. Best.- Nr
 Modell zur Veranschaulichung der Meeresströmungen Best.- Nr. 2015483 1. Beschreibung 1.1 Pädagogische Zielsetzungen Mit diesem einfachen und sehr anschaulichen Modell lässt sich der Einfluss der Temperatur
Modell zur Veranschaulichung der Meeresströmungen Best.- Nr. 2015483 1. Beschreibung 1.1 Pädagogische Zielsetzungen Mit diesem einfachen und sehr anschaulichen Modell lässt sich der Einfluss der Temperatur
B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z
 B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z Band 13 Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 13: 151-156 (2005) Manuskriptannahme am 28. 2. 2005
B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z Band 13 Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 13: 151-156 (2005) Manuskriptannahme am 28. 2. 2005
Abschnitt 5 - Tonrohstoffe im Umweltschutz
 Seite 5-1 Abschnitt 5 - Tonrohstoffe im Umweltschutz Haupteinsatzgebiete im Umweltschutz Geologische Barriere: Tonschichten aller Art in geologischen Bildungen als natürliche Barrieren zum Schutz des Grundwassers.
Seite 5-1 Abschnitt 5 - Tonrohstoffe im Umweltschutz Haupteinsatzgebiete im Umweltschutz Geologische Barriere: Tonschichten aller Art in geologischen Bildungen als natürliche Barrieren zum Schutz des Grundwassers.
Gefahren für den Boden
 1 Seht euch die Schnellstraße an. Was fällt euch dabei zum Boden ein? Exkursionseinheit 7 / Seite S 1 Was bedeutet "Flächen verbrauchen"? Spontan denkt man: Flächen kann man doch gar nicht verbrauchen!
1 Seht euch die Schnellstraße an. Was fällt euch dabei zum Boden ein? Exkursionseinheit 7 / Seite S 1 Was bedeutet "Flächen verbrauchen"? Spontan denkt man: Flächen kann man doch gar nicht verbrauchen!
TU Bergakademie Freiberg Forschungs- und Lehrbergwerk. Arbeitsanweisung Grubenalarm
 TU Bergakademie Freiberg Forschungs- und Lehrbergwerk Arbeitsanweisung Grubenalarm AAW Nr. 12/2012 vom 14.12.2012 1 Gegenstand Die vorliegende Arbeitsanweisung regelt die Warnung sowie das Verhalten aller
TU Bergakademie Freiberg Forschungs- und Lehrbergwerk Arbeitsanweisung Grubenalarm AAW Nr. 12/2012 vom 14.12.2012 1 Gegenstand Die vorliegende Arbeitsanweisung regelt die Warnung sowie das Verhalten aller
5 EMV-Maßnahmen in Gebäuden und Anlagen
 Mehr Informationen zum Titel 5 EMV-Maßnahmen in Gebäuden und Anlagen 5.1 EMV-gerechter Aufbau von iederspannungsversorgungs systemen DIPL.-IG. ATO KOHLIG Die elektrische Sicherheit von und in iederspannungsversorgungssystemen
Mehr Informationen zum Titel 5 EMV-Maßnahmen in Gebäuden und Anlagen 5.1 EMV-gerechter Aufbau von iederspannungsversorgungs systemen DIPL.-IG. ATO KOHLIG Die elektrische Sicherheit von und in iederspannungsversorgungssystemen
Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002
 Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden
Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden
Übung 4, Lösung. Frage 7) In welcher Tiefe ab Geländeoberkante GOK treffen Sie bei der Bohrung auf die Schichtgrenze C-D?
 Übung 4, Lösung Frage 7) In welcher Tiefe ab Geländeoberkante GOK treffen Sie bei der Bohrung auf die Schichtgrenze C-D? Streichlinien Bohrung Streichlinien Übung 4, Lösung 1) Streichrichtung: ca. 135
Übung 4, Lösung Frage 7) In welcher Tiefe ab Geländeoberkante GOK treffen Sie bei der Bohrung auf die Schichtgrenze C-D? Streichlinien Bohrung Streichlinien Übung 4, Lösung 1) Streichrichtung: ca. 135
Der Heißbrand bei Fohlen
 BADEN- WÜRTTEMBERG Der Heißbrand bei Fohlen MLR-14-99 MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM Bedeutung des Brandes Pferde können sowohl durch den Schenkelbrand als auch durch das Einpflanzen von Respondern gekennzeichnet
BADEN- WÜRTTEMBERG Der Heißbrand bei Fohlen MLR-14-99 MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM Bedeutung des Brandes Pferde können sowohl durch den Schenkelbrand als auch durch das Einpflanzen von Respondern gekennzeichnet
Unfallarten, Unfallursachen, Unfallfolgen
 Unfallarten, Unfallursachen, Unfallfolgen Unfallarten Unfall als Begriff Das Wort Unfall hat eine lange Entwicklungsgeschichte. Schon früher verstand man unter dem Begriff Unfall soviel wie Unglück, Missgeschick,
Unfallarten, Unfallursachen, Unfallfolgen Unfallarten Unfall als Begriff Das Wort Unfall hat eine lange Entwicklungsgeschichte. Schon früher verstand man unter dem Begriff Unfall soviel wie Unglück, Missgeschick,
CDM Consult GmbH. Grundbruch an der Düne Süd in Spreetal-Bluno vom : Untersuchungen zur Ursachenermittlung. Dr. - Ing.
 CDM Consult GmbH Grundbruch an der Düne Süd in Spreetal-Bluno vom 12.10.2010: Untersuchungen zur Ursachenermittlung Dr. - Ing. Michael Dennhardt Workshop Geländebrüche auf Lausitzer Kippen des LBGR Brandenburg
CDM Consult GmbH Grundbruch an der Düne Süd in Spreetal-Bluno vom 12.10.2010: Untersuchungen zur Ursachenermittlung Dr. - Ing. Michael Dennhardt Workshop Geländebrüche auf Lausitzer Kippen des LBGR Brandenburg
Hochwasser in Sachsen aus Sicht des Historikers
 Hochwasser in Sachsen aus Sicht des Historikers Dr. Mathias Deutsch M.A. Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Dresden, 4. April 2011 Gliederung 1. Vorbemerkungen 2. Quellen zu historischen
Hochwasser in Sachsen aus Sicht des Historikers Dr. Mathias Deutsch M.A. Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Dresden, 4. April 2011 Gliederung 1. Vorbemerkungen 2. Quellen zu historischen
Portikusverschiebung am Bayerischen Bahnhof Leipzig
 Portikusverschiebung am Bayerischen Bahnhof Leipzig In Folge der Bauarbeiten des City-Tunnel Leipzigs ereignet sich im Frühjahr 2006 eine der spektakulärsten Aktionen beim Bau der Station Bayerischer Bahnhof.
Portikusverschiebung am Bayerischen Bahnhof Leipzig In Folge der Bauarbeiten des City-Tunnel Leipzigs ereignet sich im Frühjahr 2006 eine der spektakulärsten Aktionen beim Bau der Station Bayerischer Bahnhof.
Kriterien der Bewertung der Qualität der von der Firma Pilkington IGP Sp. z o.o. produzierten Glaserzeugnisse
 Kriterien der Bewertung der Qualität der von der Firma Pilkington IGP Sp. z o.o. produzierten Glaserzeugnisse Allgemeine Bestimmungen Gemäß den Verkaufsbedingungen und den Allgemeinen Garantiebedingungen
Kriterien der Bewertung der Qualität der von der Firma Pilkington IGP Sp. z o.o. produzierten Glaserzeugnisse Allgemeine Bestimmungen Gemäß den Verkaufsbedingungen und den Allgemeinen Garantiebedingungen
25 Jahre Sanierung der Uranerzbergbau-Gebiete in Sachsen und Thüringen
 1 25 Jahre Sanierung der Uranerzbergbau-Gebiete in Sachsen und Thüringen Der Uranerzbergbau in Sachsen und Thüringen hat riesige Umweltschäden in einer dicht besiedelten Region hinterlassen. Seit 1991
1 25 Jahre Sanierung der Uranerzbergbau-Gebiete in Sachsen und Thüringen Der Uranerzbergbau in Sachsen und Thüringen hat riesige Umweltschäden in einer dicht besiedelten Region hinterlassen. Seit 1991
B e g r ü n d u n g. zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 05/003 - Westlich Leuchtenberger Kirchweg Vereinfachtes Verfahren gemäß 13 BauGB
 B e g r ü n d u n g zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 05/003 - Westlich Leuchtenberger Kirchweg Vereinfachtes Verfahren gemäß 13 BauGB Stadtbezirk 5 - Stadtteil Lohausen 1. Örtliche Verhältnisse Das etwa
B e g r ü n d u n g zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 05/003 - Westlich Leuchtenberger Kirchweg Vereinfachtes Verfahren gemäß 13 BauGB Stadtbezirk 5 - Stadtteil Lohausen 1. Örtliche Verhältnisse Das etwa
Erdhebungen Böblingen - Newsletter
 Thomas Treutler Von: Landratsamt Böblingen Gesendet: Mittwoch, 27. April 2016 13:45 An: Thomas Treutler Betreff: Aktuelle Auswertung der Satellitenmessungen Anlagen: Satelliten_Messung_Nord_April_2016.jpg;
Thomas Treutler Von: Landratsamt Böblingen Gesendet: Mittwoch, 27. April 2016 13:45 An: Thomas Treutler Betreff: Aktuelle Auswertung der Satellitenmessungen Anlagen: Satelliten_Messung_Nord_April_2016.jpg;
ASPEKTE UND MÖGLICHKEITEN ZUR STANDSICHERHEITSBEWERTUNG VON FLUSSDEICHEN
 Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik ASPEKTE UND MÖGLICHKEITEN ZUR STANDSICHERHEITSBEWERTUNG VON FLUSSDEICHEN Konferenz für ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement
Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik ASPEKTE UND MÖGLICHKEITEN ZUR STANDSICHERHEITSBEWERTUNG VON FLUSSDEICHEN Konferenz für ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement
Thermische Nutzung von Grubenwässern. Projekt Zwickau. Kooperativer Forschungsansatz. Stand der Forschungsarbeiten. Partner und Zeitplan des Projekts
 Thermische Nutzung von Grubenwässern Grubenwasserproblem des Altbergbaustandortes Zwickau Kooperativer Forschungsansatz Stand der Forschungsarbeiten Partner und Zeitplan des Projekts 1 Grubenwasserproblem
Thermische Nutzung von Grubenwässern Grubenwasserproblem des Altbergbaustandortes Zwickau Kooperativer Forschungsansatz Stand der Forschungsarbeiten Partner und Zeitplan des Projekts 1 Grubenwasserproblem
