Phase 1: Anwendungsanalyse
|
|
|
- Guido Bauer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Fabian Scheler Peter Ulbrich Wolfgang Schröder-Preikschat Lehrstuhl für Informatik 4 Verteilte Systeme und Betriebssysteme Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg {scheler,ulbrich,wosch}@cs.fau.de 1
2 Übersicht Einordnung Zielsetzung Problematik Lösungsansätze Anforderungen & Fakten 2
3 Einordnung Phase 1 Beziehungen zwischen Ereignis n und Ergebnis m zeitlich wie viel Zeit darft verstreichen Termine physikalisch wie ist das Ergebnis zu bestimmen? Ereignis 1 Ergebnis 1 Zustand A entry/entera Differentialgleichungssysteme Ereignis 2 Ergebnis 2 Zustand B exit/exitb Zustandsmaschinen Regelungstechnik Ereignis n Echtzeitsystem Ergebnis m 3
4 Zielsetzung physikalisches Objekt Welche Größen sind relevant? Wie hängen diese Größen zusammen? Echtzeitsystem Welche Ereignisse gilt es zu behandeln? Welche Zeitschranken gilt es einzuhalten? Welche Beziehung Zeitschranke physikalischen Objekt gibt es? Wie sieht das physikalische Modell aus? Welche Größen des physikalischen Modells muss man abbilden? Wie bildet man diese Größen ab? 4
5 Problematik selbst einfach erscheinende Objekte sind aus physikalischer Sicht äußerst komplex Vereinfachungen sind unabdingbar Beispiel: Hau den Lukas 5
6 Problematik: Hau den Lukas Schaltvorgänge an den Spulen sind nicht konstant! Induktivität der Spule ist nicht konstant! Ein- und Ausschaltvorgänge und die Induktionsgesetze Wo ist der Eisenkern in der Spule? Kraft auf den Eisenkern in der Spule ist nicht konstant! Wo ist der Eisenkern in der Spule? Welche Geschwindigkeit hat der Eisenkern? Beschleunigung des Eisenkerns ist nicht konstant! Kraft auf den Eisenkern ist nicht konstant komplexe, zeitabhängige Vorgänge macht Integration notwendig häufig nicht mehr analytisch darstellbar numerische Lösung wird erforderlich 6
7 Ergebnisse: Hau den Lukas (SS 2006) Induktivität der Spule in Abhängigkeit der Position des Eisenkerns 7
8 Ergebnisse: Hau den Lukas (SS 2006) Schaltverzögerung der Spule in Abhängigkeit der Position des Eisenkerns 8
9 Ergebnisse: Hau den Lukas (SS 2006) Kraftwirkung der Spule auf den Eisenkern in Abhängigkeit der Position des Eisenkerns 9
10 Ergebnisse: Hau den Lukas (SS 2006) selbst das Modell ist bereits stark vereinfacht verschiedene Größen werden nicht berücksichtigt Gegeninduktion Wirbelströme Luftwiderstand experimentelle Bestimmung gewisser Randparameter 10
11 Lösungsansätze Reduktion auf den Zustand Regelungstechnik 11
12 Reduktion auf den Zustand... genauer: den beobachtbaren Zustand Idee man kann den Zustand immer beobachten... und man kann ihn gezielt und exakt manipulieren Konsequenz für unser Modell es kann auf den beobachtbaren Zustand reduziert werden häufig gibt es nur noch diskrete Wertbereiche reine Kausalitäts- also Ursache-Wirkung-Beziehung drastische Vereinfachung des Modells ohne relevante Eigenschaften zu verlieren 12
13 Beispiel: Hau den Lukas Beobachtung der letzten Spule: durch Lichtschranken der Bewegungsrichtung: Spule n aktuelle Spule: Spule n - vorherige Spule: Spule n + 1 aufwärts - vorherige Spule: Spule n - 1 abwärts Spule n Manipulation Eisenkern kann - festgehalten werden - fallen gelassen werden - angehoben werden Spule n 1 Zustand ist vollständig beobachtbar und gezielt manipulierbar 13
14 Nachteil dieses Modell sagt nichts aus über... den Eisenkern die verwendeten Spulen die Umgebungstemperaturen Eine gezielte Manipulation kann nicht garantiert werden Wenn diese Größen verändert werden System muss sich gutmütig verhalten gegenüber Parametern, die man nicht kontrollieren kann diese Parameter kann man dann vernachlässigen Längst nicht alle Systeme erfüllen diese Eigenschaft 14
15 Regelungstechnik Problem interner Zustand ist nicht beobachtbar interne Parameter beeinflussen das System in relevantem Umfang Idee Nachbildung/Berechnung des Zustandes - physikalisches Modell - inkl. internem Verhalten Konsequenz für unser Modell mathematisch/physikalische Beschreibung des Systems Bestimmung der Systemparameter: Trägheit, Widerstand,... Berücksichtigung vergangener Zustände Beschreibung des Systems durch das Modell Exakte Analyse notwendig 15
16 Regelungstechnik Systemtheorie Eingangsvektor Ausgangsvektor Systemmatrix Abweichung vom Sollwert des Systems Ist-Wert des Systems Rückkopplung der internen Zustände beobachtbar beeinflussbar berechenbar System-Modell Beschreibt die Zusammenhänge zwischen beeinflussbaren, beobachtbaren und berechenbaren Systemparametern 16
17 Beispiel: Quadkopter Beobachtung Winkelgeschwindigkeit und Lage um X bzw. Y-Achse Manipulation Die erzeugte Schubkraft kann variiert werden Geregelt wird die Spannung u der Motoren Reaktion Abhängig von den Momenten des Objekts (Masse, Trägheit) und Motor/Propeller (Trägheit, Reibung, Wirkungsgrad) Zustand Nicht beobacht-, aber berechenbar 17
18 Modellbildung Berechnung beliebiger Zustände Bestimmung durch Messung Erstellen von Kennlinien (Messung zusätzlicher Parameter) Ableiten von Konstanten oder Funktionen z.b. Motor Messung - Schubkraft - Drehzahl - Stromaufnahme - Spannung Motorkonstante Funktion - Spannung/Schub 18
19 Anforderungen & Fakten I4Copter Carolo-Cup Hau den Lukas Generator 19
20 Anforderung: I4Copter (1) Zielsetzung: semi-autonomer Flug Stabiler Schwebeflug Unterstützung durch automatisches Starten & Landen Anfliegen von Wegpunkten - Autopilot Aufteilung Verhaltenssteuerung - feste Echtzeit - GPS-Datenverarbeitung, Trajektorienberechnung - Hold-Position oder Fly-Home Fluglageregelung - harte Echtzeit Erfassung/Aufbereitung von Sensorwerten Berechnung neuer Stellgrößen Ansteuerung von Aktoren 20
21 Anforderung: I4Copter (2) Komponentenüberwachung und Verhaltensmodell Komponetenzustand und -überwachung (Init, Active, Error) Analyse und Spezifikation von Arbeitspunkten Übergeordnetes Verhaltenmodell (z.b. Zustandsautomat) Ausnahmebehandlung Fehleranalyse Entwurf Implementierung & Integration Höhen- und Gier-Regler Bestimmung der Drehung über Gyroskop und Kompass Bestimmung der Höhe über IR-Abstands- und Druck-Sensor 21
22 Fakten: I4Copter (1) Sensorboard X,Y,Z Gyroskope X, Y Accelerometer Barometer Kompass 2. Tricore 1796 Board Ethernet 150MHz, 2MB MRAM 3. Akku 4. Funkempfänger RC und WLAN 5. Antrieb Bürstenloser Motor 6. Motorregler I2C Bus Diskret 255 Stufen 22
23 Fakten: I4Copter (2) 23
24 Fakten: I4Copter (3) 24
25 Anforderung: Carolo-Cup (1) Zielsetzung: autonomes Abfahren eines Rundkurses Abfahren eines Rundkurses und Ausweichen von Hindernissen paralleles Einparken Aufteilung der Steuerung High-Level: Netbook, Intel Atom - weiche/feste Echtzeit - Bildverarbeitung, Fahrspurerkennung, Trajektorienplanung Low-Level: Mikrocontroller, Infineon TriCore TC harte Echtzeit Geschwindigkeitsregelung und Orientierungssteuerung Erfassung/Aufbereitung von Sensorwerten Ansteuerung von Aktoren 25
26 Anforderung: Carolo-Cup (2) Ausnahmebehandlung Fehleranalyse Entwurf Implementierung & Integration Geschwindigkeitsmessung basierend auf Encoderscheiben Signalerfassung über GPTA - Messen der Flanken/Zeiteinheit vs. Zeit zwischen zwei Flangen (Orientierungsregelung) basierend auf einer existierenden Orientierungssteuerung Bestimmung von Beschleunigung/Drehung über eine IMU 26
27 Fakten: Carolo-Cup (1) Tamiya: VW Race Touareg Lenkwinkel: +/- 20 Länge: 445 mm Breite: 187 mm Radstand: 267 mm Breite Radstand Länge Lenkwinkel 27
28 Fakten: Carolo-Cup (2) 1. Kamera 2. Ultraschallsensoren 3. Infrarotsensoren 4. LEDs 5. Encoderscheiben 6. Netbook 7. Infineon TriCore TC Lenkservo 9. Fahrtenregler 28
29 Fakten: Carolo-Cup (3) Devantech SRF05 μeye UI-1226LE-M Kamera Funkempfänger 4x Ultraschall Sharp GP2D120 2x Infrarot ADC Mikrocontroller GPIO GPTA Serial Netbook PWM Serial USB 3x Taster PWM Sharp GP1A71R Tamiya TEU-101BK 2x Radsensoren Motorregler Lichter Lenkservo Blinker 29
30 Fakten: Carolo-Cup (4) Speed Controller RC ch1 speed ch2 steering Edge 20ms Update setspeed target_speed Throttle setthrottle throttle Speed Filter off CheckSignal speed Control Arbiter Arbit Distance Controller 20ms Update setdistance target_distance off getdistance distance getspeed getdistance speed distance time arbiter_state Data Transmitter Parse 20ms RX 20ms Wheel Sensor Serial blink steering Filter RX_SLIP Send rx tx edge Edge Buttons Collect Clicked Steering setsteering Handler 1 button1 2 button2 3 button3 steering Voltage Sensors supply motor Infrared Sensors Start blink Stop Toggle left Yellow Blinker Blue Blinker Start blink Stop Toggle right Lights setfrontled right front left setbreakled blue break Ultrasonic Sensors front_left front_right rear_left rear_right 30
31 Anforderungen: Hau den Lukas (1) Programmierbarkeit ein Programm wird durch eine Datenstruktur beschrieben, die durch Prozeduraufrufe erzeugt/initialisiert wird lift_continous(my_prog,7); fall_stepwise(my_prog,2); lift_continous(my_prog,4);... schließlich wird dieses Programm ausgeführt start_program(my_prog); folgende Primitive sollen beherrscht werden schrittweise anheben/fallen lassen kontinuierlich anheben/fallen lassen Primitive sind kombinierbar 31
32 Anforderungen: Hau den Lukas (2) Benutzerschnittstelle Programme werden unveränderlich gespeichert ein Wechsel zwischen den Programmen ist aber möglich Programme werden geladen Interaktion über die serielle Schnittstelle bzw. CAN-Bus Not-Aus-Funktion sofortiges Stoppen der normalen Funktion Übergang in einen sicheren Zustand Monitoring/Überwachung kritische Systemzustände werden erkannt und angezeigt z.b. wenn Spulen zu lange aktiviert sind Profiling wie lange ist welche Spule an, wie oft wurde welche Spule durchlaufen 32
33 Fakten: Hau den Lukas dcb lp lc lc lp db dcb Länge: Spule Länge: Projektil Abstand: Lichtschranken Abstand:Spule Lichtschranke 30 mm 82 mm 230 mm 24 mm db 33
34 Fakten: Hau den Lukas d l lb l lb d db m Länge: Projektil Länge: Bohrung Durchmesser: Projektil Durchmesser: Bohrung Gewicht Material: Eisen 82 mm 26 mm 18,6 mm 10 mm 144 g db r2 r1 l l r1 r2 l R N effektive Länge Innendurchmesse Außendurchmesse Induktivität Widerstand Windungszahl Toleranz 23 mm 28 mm mm 0,82 mh 0,52 Ohm % 34
35 Fakten: Hau den Lukas Ansteuerung der Spulen Pin 0.5 Pin 0.12 (x.y: x Port, y Pin) Abfrage der Lichtschranken Pin 7.0 Pin 7.7 Unterbrechungen der Lichtschranken Pin 1.0 Dauer von Auslösung der Lichtschranke bis zur ISR vernachlässigbar 35
36 Anforderung: Generator Implementierung folgendes Regelkreises: bestimmt Drehzahl treibt an Motor Regler Generator Rückkopplung Spannung naiver Regler - Hochfrequente Abtastung des Systems - kleine Änderungen der Stellgrößen Reglerimplementierung - mit/ohne Beobachter Bestimmung der Kennlinien für Motor und Generator Evaluation: Einschwingverhalten 36
37 Fakten: Generator Steuerspannung des Motors kontinuierlich (PWM-Signal) diskret (256 Stufen, extra Platine) 4. Motordrehzahl 5. Referenzspannung (7,8 V) 2. Manuelle Steuerung Durch Potentiometer 3. Umschaltung Steuerspannung/manuell Messung durch Lichtschranke optisch ablesbar Abgreifbar 6. Zuschaltung div. Lasten konstant variabel 37
38 Fakten: Generator 1. manuelle Steuerung, Potentiometerstellung: MIN 2. Einstellung der Referenzspannung 3. Kalibrierung des Reglers 4. Umschalten auf die Steuerspannung Und damit auf den implementierten Regler 38
39 Fazit scheinbare Vorgänge sind physikalisch sehr komplex komplexe physikalische Vorgänge sind mathematisch häufig nicht analytisch lösbar Vereinfachungen des Modells numerische Lösungsansätze Massive Vereinfachungen sind notwendig Was muss man wirklich wissen? Was kann man wissen/messen? Welche Einschränkungen sind damit verbunden? 39
40 Fazit scheinbare Vorgänge sind physikalisch sehr komplex komplexe physikalische Vorgänge sind mathematisch häufig nicht analytisch lösbar Vereinfachungen des Modells numerische Lösungsansätze Massive Vereinfachungen sind notwendig Was muss man wirklich wissen? Was kann man wissen/messen? Welche Einschränkungen sind damit verbunden? Entwurf des Echtzeitsystems setzt Vertrautheit mit dem physikalischen Objekt voraus! 40
Phase 1: Anwendungsanalyse
 Übersicht Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Fabian Scheler Peter Ulbrich Wolfgang Schröder-Preikschat Einordnung Zielsetzung Problematik Lösungsansätze Anforderungen & Fakten
Übersicht Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Fabian Scheler Peter Ulbrich Wolfgang Schröder-Preikschat Einordnung Zielsetzung Problematik Lösungsansätze Anforderungen & Fakten
Phase 1: Anwendungsanalyse
 Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Fabian Scheler Peter Ulbrich Michael Stilkerich Wolfgang Schröder-Preikschat Lehrstuhl für Informatik IV Verteilte Systeme und Betriebssysteme
Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Fabian Scheler Peter Ulbrich Michael Stilkerich Wolfgang Schröder-Preikschat Lehrstuhl für Informatik IV Verteilte Systeme und Betriebssysteme
Problemstellung. Anwendungsanalyse. Spezifikationstechniken. Analyse der Problemstellung. Wie komme ich vom Echtzeitproblem zum Echtzeitsystem?
 Problemstellung Anwendungsanalyse Florian Franzmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) http://www4.cs.fau.de
Problemstellung Anwendungsanalyse Florian Franzmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) http://www4.cs.fau.de
Phase 1: Anwendungsanalyse
 Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Übersicht Zielsetzung Problematik Anforderungen & Fakten Fabian Scheler Michael Stilkerich Wolfgang Schröder-Preikschat Lehrstuhl für Informatik
Phase 1: Anwendungsanalyse Echtzeitsysteme 2 - Vorlesung/Übung Übersicht Zielsetzung Problematik Anforderungen & Fakten Fabian Scheler Michael Stilkerich Wolfgang Schröder-Preikschat Lehrstuhl für Informatik
Anwendungsanalyse von Echtzeitsystemen
 Anwendungsanalyse von Echtzeitsystemen Vorgehen in der Praxis Florian Franzmann, Martin Hoffmann, Isabella Stilkerich Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte
Anwendungsanalyse von Echtzeitsystemen Vorgehen in der Praxis Florian Franzmann, Martin Hoffmann, Isabella Stilkerich Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte
Anwendungsanalyse von Echtzeitsystemen
 Anwendungsanalyse von Echtzeitsystemen Vorgehen in der Praxis Florian Franzmann Martin Hoffmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte
Anwendungsanalyse von Echtzeitsystemen Vorgehen in der Praxis Florian Franzmann Martin Hoffmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte
Phase 1: Anwendungsanalyse
 Übersicht Phase 1: Anwendungsanayse Echtzeitsysteme 2 - Voresung/Übung Ziesetzung Probematik Lösungsansätze Anforderungen & Fakten Fabian Scheer Peter Ubrich Michae Stikerich Wofgang Schröder-Preikschat
Übersicht Phase 1: Anwendungsanayse Echtzeitsysteme 2 - Voresung/Übung Ziesetzung Probematik Lösungsansätze Anforderungen & Fakten Fabian Scheer Peter Ubrich Michae Stikerich Wofgang Schröder-Preikschat
Projektpraktikum Informationsverarbeitung Zwischenpräsentation. Team TUfatTUfly
 Projektpraktikum Informationsverarbeitung Zwischenpräsentation Team TUfatTUfly 11.06.2013 Benedikt Streicher, Jonas Hess, Laurenz Altmüller, Lukas Heim, Frenkli Shoraj, Faisal Alam Agenda 1 Projektstatus
Projektpraktikum Informationsverarbeitung Zwischenpräsentation Team TUfatTUfly 11.06.2013 Benedikt Streicher, Jonas Hess, Laurenz Altmüller, Lukas Heim, Frenkli Shoraj, Faisal Alam Agenda 1 Projektstatus
verteilte Systeme (Anwendung Quadrocopter) an.
 verteilte Systeme 15.05.2012 Quadrocopter für Aufgaben im Indoor-Bereich (Luftfahrtinformatik). Die Systeme sollen in die Lage versetzt werden selbstständig (autonom) zu agieren (z.b. Suchen durchführen)
verteilte Systeme 15.05.2012 Quadrocopter für Aufgaben im Indoor-Bereich (Luftfahrtinformatik). Die Systeme sollen in die Lage versetzt werden selbstständig (autonom) zu agieren (z.b. Suchen durchführen)
Annährungssensoren. Induktive Sensoren. Kapazitive Sensoren. Ultraschall-Sensoren. Optische Anährungssensoren
 Annährungssensoren Zum Feststellen der Existenz eines Objektes innerhalb eines bestimmten Abstands. In der Robotik werden sie für die Nah-Gebiets-Arbeit, Objekt-Greifen oder Kollisionsvermeidung verwendet.
Annährungssensoren Zum Feststellen der Existenz eines Objektes innerhalb eines bestimmten Abstands. In der Robotik werden sie für die Nah-Gebiets-Arbeit, Objekt-Greifen oder Kollisionsvermeidung verwendet.
Echtzeitsysteme (EZS) 2 Integrierte Lehrveranstaltung, 4 SWS. Überblick. Entwicklungsumgebung. Experiment 1: Hau den Lukas
 Überblick 13 Ausblick Echtzeitsysteme (EZS) 2 Integrierte Lehrveranstaltung, 4 SWS Ausblick EZS2 Hiwi Studien- und Diplomarbeiten Inhalt ein kompletter Entwicklungszyklus für ein EZS 1. Anforderungsanalyse
Überblick 13 Ausblick Echtzeitsysteme (EZS) 2 Integrierte Lehrveranstaltung, 4 SWS Ausblick EZS2 Hiwi Studien- und Diplomarbeiten Inhalt ein kompletter Entwicklungszyklus für ein EZS 1. Anforderungsanalyse
ANYSENSE ALLGEMEINE HINWEISE 3 INSTALLATION 5 KONFIGURATION 6 ANHANG 14
 ANYSENSE MANUAL ANYSENSE Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie sorgfältig die folgende Anleitung, um das Gerät korrekt zu installieren und zu verbinden. Bitte besuchen Sie
ANYSENSE MANUAL ANYSENSE Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie sorgfältig die folgende Anleitung, um das Gerät korrekt zu installieren und zu verbinden. Bitte besuchen Sie
Abschlusspräsentation Hau den Lukas
 Abschlusspräsentation Hau den Lukas Guilherme Bufolo Martin Oettinger Dirk Pfeiffer 21.07.2009 1 Übersicht 2 Versuchsaufbau 3 Aufgabe/Randbedingungen 4 Implementierung 5 Tests 6 Probleme Projekt der Vorlesung
Abschlusspräsentation Hau den Lukas Guilherme Bufolo Martin Oettinger Dirk Pfeiffer 21.07.2009 1 Übersicht 2 Versuchsaufbau 3 Aufgabe/Randbedingungen 4 Implementierung 5 Tests 6 Probleme Projekt der Vorlesung
1 Spannung messen mit Grenzwertüberwachung
 1 Spannung messen mit Grenzwertüberwachung 1.1 Spannung simulieren Der Drehregler liefert eine Wert zwischen 0 und 10. Die Messinstrument- Anzeige und die Tankanzeige zeigen diesen Wert an. 3 LEDs neben
1 Spannung messen mit Grenzwertüberwachung 1.1 Spannung simulieren Der Drehregler liefert eine Wert zwischen 0 und 10. Die Messinstrument- Anzeige und die Tankanzeige zeigen diesen Wert an. 3 LEDs neben
Entwicklung einer Motorsteuerung für zwei Getriebemotoren
 Übersicht Motivation Hardware Software Fazit Ende Entwicklung einer Motorsteuerung für zwei Getriebemotoren Studienarbeit, Abschlussvortrag T. K. Technische Universität Braunschweig Institut für Betriebssysteme
Übersicht Motivation Hardware Software Fazit Ende Entwicklung einer Motorsteuerung für zwei Getriebemotoren Studienarbeit, Abschlussvortrag T. K. Technische Universität Braunschweig Institut für Betriebssysteme
Linienverfolgung. Anforderung Umsetzung Regler P Anteil I Anteil D Anteil PID Regler. ASURO Gruppe_G WS 07/08
 Linienverfolgung Anforderung Umsetzung Regler P Anteil I Anteil D Anteil PID Regler Anforderung Der Asuro soll mit Hilfe von 2 Fototransistoren und einer Leuchtiode selbständig einer Linie folgen können.
Linienverfolgung Anforderung Umsetzung Regler P Anteil I Anteil D Anteil PID Regler Anforderung Der Asuro soll mit Hilfe von 2 Fototransistoren und einer Leuchtiode selbständig einer Linie folgen können.
Umbau eines Saug- und Wisch Roboters auf ARDUINO Steuerung
 Saug-Wisch-Roboter Umbau eines Saug- und Wisch Roboters auf ARDUINO Steuerung TOPAN AVC 701 (702) Seite 1 Saug-Wisch-Roboter Elektronik M Saug Motor Radmotor Links FB 433 M Elektronik Arduino Nano DC-
Saug-Wisch-Roboter Umbau eines Saug- und Wisch Roboters auf ARDUINO Steuerung TOPAN AVC 701 (702) Seite 1 Saug-Wisch-Roboter Elektronik M Saug Motor Radmotor Links FB 433 M Elektronik Arduino Nano DC-
Regelungstechnik. Eine kurze Einführung
 Regelungstechnik Eine kurze Einführung Regelungstechnik Übersicht und Begriffe Zweipunkt-Regler PID-Regler Weitergehende Konzepte Praktische Umsetzung Simulation Regelung vs. Steuerung Wert einstellen,
Regelungstechnik Eine kurze Einführung Regelungstechnik Übersicht und Begriffe Zweipunkt-Regler PID-Regler Weitergehende Konzepte Praktische Umsetzung Simulation Regelung vs. Steuerung Wert einstellen,
Farbe CTS. M1 rot +12V ROT. M2 braun Masse BRAUN. M3 schwarz Zündspule Reihenfolge beliebig SCHWARZ. M4 schwarz Zündspule Reihenfolge beliebig ORANGE
 CTS5TW - STANDARD 6-poliger Anschluss Pin Kabel- Farbe Beschreibung Kabelbaum CTS ECU-Pin Siehe Schaltplan M1 rot +12V ROT M2 braun Masse BRAUN M3 schwarz Zündspule Reihenfolge beliebig SCHWARZ M4 schwarz
CTS5TW - STANDARD 6-poliger Anschluss Pin Kabel- Farbe Beschreibung Kabelbaum CTS ECU-Pin Siehe Schaltplan M1 rot +12V ROT M2 braun Masse BRAUN M3 schwarz Zündspule Reihenfolge beliebig SCHWARZ M4 schwarz
HYBRID SERVO DRIVER ES-DH2306
 MERKMALE: Closed-loop, eliminiert Schrittverluste bzw. Verlust der Synchronisation Versorgungsspannung: 150-230 VAC oder 212-325 VDC Exzellente Reaktionszeiten, schnelle Beschleunigung und sehr großes
MERKMALE: Closed-loop, eliminiert Schrittverluste bzw. Verlust der Synchronisation Versorgungsspannung: 150-230 VAC oder 212-325 VDC Exzellente Reaktionszeiten, schnelle Beschleunigung und sehr großes
Projekt von Sergio Staab, Niklas Abel
 (1) Was haben wir vor (Unser Projekt) -Hardware Aufbau -Software Aufbau (2) Der RP6 -Sensoren -Prozessor -Motor/Leistung (3) I2C Schnittstelle (4) Raspberry Pi -Schnittstellen -Prozessor -Betriebssystem
(1) Was haben wir vor (Unser Projekt) -Hardware Aufbau -Software Aufbau (2) Der RP6 -Sensoren -Prozessor -Motor/Leistung (3) I2C Schnittstelle (4) Raspberry Pi -Schnittstellen -Prozessor -Betriebssystem
Quadrokopter. Echtzeitsysteme 2. Matthias Niessner, Christian Liebscher. July 15, 2008 Erlangen. Quadrokopter
 Quadrokopter Echtzeitsysteme 2 Matthias Niessner, Christian Liebscher July 15, 2008 Erlangen 1 von 48 Matthias Niessner, Christian Liebscher Quadrokopter 1 Einleitung 2 Aufgabe 3 Komponenten 4 Regelung
Quadrokopter Echtzeitsysteme 2 Matthias Niessner, Christian Liebscher July 15, 2008 Erlangen 1 von 48 Matthias Niessner, Christian Liebscher Quadrokopter 1 Einleitung 2 Aufgabe 3 Komponenten 4 Regelung
13 Ausblick. Überblick. Ausblick EZS2 Hiwi Studien- und Diplomarbeiten. wosch WS 2007/08 EZS 13-1
 Überblick 13 Ausblick Ausblick EZS2 Hiwi Studien- und Diplomarbeiten wosch WS 2007/08 EZS 13-1 13 Ausblick 13.1 EZS2 Echtzeitsysteme (EZS) 2 Integrierte Lehrveranstaltung, 4 SWS Inhalt ein kompletter Entwicklungszyklus
Überblick 13 Ausblick Ausblick EZS2 Hiwi Studien- und Diplomarbeiten wosch WS 2007/08 EZS 13-1 13 Ausblick 13.1 EZS2 Echtzeitsysteme (EZS) 2 Integrierte Lehrveranstaltung, 4 SWS Inhalt ein kompletter Entwicklungszyklus
Echtzeitsysteme. Übungen zur Vorlesung. Fabian Scheler, Peter Ulbrich, Niko Böhm
 Echtzeitsysteme Übungen zur Vorlesung Fabian Scheler, Peter Ulbrich, Niko Böhm Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) www4.informatik.uni-erlangen.de
Echtzeitsysteme Übungen zur Vorlesung Fabian Scheler, Peter Ulbrich, Niko Böhm Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) www4.informatik.uni-erlangen.de
Endvortrag. Christian Müller Alexander Altmann Moritz Weissenberger Daniel Hueske Nicolas Himmelmann Fachgebiet Echtzeitsysteme Team Knight Riders
 Endvortrag Christian Müller Alexander Altmann Moritz Weissenberger Daniel Hueske Nicolas Himmelmann 12.12.2016!1 Fachgebiet Echtzeitsysteme Team Knight Riders Gliederung Organisation Wall Follower 03.03.2017
Endvortrag Christian Müller Alexander Altmann Moritz Weissenberger Daniel Hueske Nicolas Himmelmann 12.12.2016!1 Fachgebiet Echtzeitsysteme Team Knight Riders Gliederung Organisation Wall Follower 03.03.2017
M(n)-Kennlinien, Parameter Klemmenspannung n in 1/min v in km/h M in Nm
 1 E-Bike (17P) Der Motor eines E-Bikes besitzt die im n(m)-diagramm dargestellten Kennlinien. Diese gelten für die angegebenen Motor-Klemmenspannungen. Die Motorachse ist direkt an der Hinterradachse angebracht.
1 E-Bike (17P) Der Motor eines E-Bikes besitzt die im n(m)-diagramm dargestellten Kennlinien. Diese gelten für die angegebenen Motor-Klemmenspannungen. Die Motorachse ist direkt an der Hinterradachse angebracht.
Arduino Kurs Timer und Interrupts. Stephan Laage-Witt FES Lörrach
 Arduino Kurs Timer und Interrupts Stephan Laage-Witt FES Lörrach - 2018 Themen Timer Interrupts Regelmäßige Aufgaben ausführen Exakte Zeitintervalle messen FES Lörrach Juni 2018 2 Exakte Zeiten sind gar
Arduino Kurs Timer und Interrupts Stephan Laage-Witt FES Lörrach - 2018 Themen Timer Interrupts Regelmäßige Aufgaben ausführen Exakte Zeitintervalle messen FES Lörrach Juni 2018 2 Exakte Zeiten sind gar
Dokumentation Roboterfahrzeug
 Dokumentation Roboterfahrzeug Gruppe 6 Sensor und Regelungssysteme Praktikum Mechatronik Master SS16 Matthias Wolf, Fabian Pfeffer Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... I Abbildungsverzeichnis...
Dokumentation Roboterfahrzeug Gruppe 6 Sensor und Regelungssysteme Praktikum Mechatronik Master SS16 Matthias Wolf, Fabian Pfeffer Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... I Abbildungsverzeichnis...
Projekt von Sergio Staab, Niklas Abel
 (1) Was haben wir vor (Unser Projekt) -Hardware Aufbau -Software Aufbau (2) Der RP6 -Sensoren -Prozessor -Motor/Leistung -Ist Zustand (3) I²C BUS (4) Pegel Wandler (5) Raspberry Pi -Schnittstellen -Prozessor
(1) Was haben wir vor (Unser Projekt) -Hardware Aufbau -Software Aufbau (2) Der RP6 -Sensoren -Prozessor -Motor/Leistung -Ist Zustand (3) I²C BUS (4) Pegel Wandler (5) Raspberry Pi -Schnittstellen -Prozessor
Mechatronik Grundlagen
 Prüfung WS 2009/2010 Mechatronik Grundlagen Prof. Dr.-Ing. K. Wöllhaf Anmerkungen: Aufgabenblätter auf Vollständigkeit überprüfen Nur Blätter mit lesbarem Namen werden korrigiert. Keine rote Farbe verwenden.
Prüfung WS 2009/2010 Mechatronik Grundlagen Prof. Dr.-Ing. K. Wöllhaf Anmerkungen: Aufgabenblätter auf Vollständigkeit überprüfen Nur Blätter mit lesbarem Namen werden korrigiert. Keine rote Farbe verwenden.
 Das mikroprozessorgesteuerte CO 2 Messgerät dient zur Erfassung des CO 2 -Gehaltes der Luft im Bereich bis 2.000 5.000-10.000 ppm, sowie der Temperatur und Luftfeuchte. Die Messsignale werden durch eine
Das mikroprozessorgesteuerte CO 2 Messgerät dient zur Erfassung des CO 2 -Gehaltes der Luft im Bereich bis 2.000 5.000-10.000 ppm, sowie der Temperatur und Luftfeuchte. Die Messsignale werden durch eine
Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590. Steuergerätediagnose mit ESI[tronic]
![Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590. Steuergerätediagnose mit ESI[tronic] Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590. Steuergerätediagnose mit ESI[tronic]](/thumbs/67/56723114.jpg) Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590 Steuergerätediagnose mit ESI[tronic] Ihre Vorteile im Überblick Sichere Investition: Unterstützung aller gängigen und auch zukünftigen Fahrzeugschnittstellen auf
Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590 Steuergerätediagnose mit ESI[tronic] Ihre Vorteile im Überblick Sichere Investition: Unterstützung aller gängigen und auch zukünftigen Fahrzeugschnittstellen auf
EZS Handwerkszeug. Übung zur Vorlesung EZS. Florian Franzmann Martin Hoffmann Tobias Klaus Peter Wägemann
 EZS Handwerkszeug Übung zur Vorlesung EZS Florian Franzmann Martin Hoffmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)
EZS Handwerkszeug Übung zur Vorlesung EZS Florian Franzmann Martin Hoffmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)
HTL Dornbirn WPT_NEFF. Mitschriften. Simon Waiblinger. Seite 0
 HTL Dornbirn WPT_NEFF Mitschriften Simon Waiblinger Seite 0 MITSCHRIFT 1 16.09.2015 Platinen werden platzsparend angeordnet ( Routing ). Leiterbahnen dürfen sich nicht überschneiden und die Elemente sollten
HTL Dornbirn WPT_NEFF Mitschriften Simon Waiblinger Seite 0 MITSCHRIFT 1 16.09.2015 Platinen werden platzsparend angeordnet ( Routing ). Leiterbahnen dürfen sich nicht überschneiden und die Elemente sollten
Versuch 4 M_Dongle Servotester. Labor Mikrocontroller mit NUC130. Prof. Dr.-Ing. F. Kesel Dipl.-Ing. (FH) J. Hampel Dipl.-Ing. (FH) A.
 Versuch 4 M_Dongle Servotester Labor Mikrocontroller mit NUC130 Prof. Dr.-Ing. F. Kesel Dipl.-Ing. (FH) J. Hampel Dipl.-Ing. (FH) A. Reber 11.06.2016 Inhalt 1 Einführung... 2 1.1 Grundlagen Modellbau-Servo...
Versuch 4 M_Dongle Servotester Labor Mikrocontroller mit NUC130 Prof. Dr.-Ing. F. Kesel Dipl.-Ing. (FH) J. Hampel Dipl.-Ing. (FH) A. Reber 11.06.2016 Inhalt 1 Einführung... 2 1.1 Grundlagen Modellbau-Servo...
Eingebettete Systeme
 Institut für Informatik Lehrstuhl für Eingebettete Systeme Prof. Dr. Uwe Brinkschulte Benjamin Betting Eingebettete Systeme 1. Aufgabe (Regelsystem) 3. Übungsblatt Lösungsvorschlag a) Das Fahrzeug kann
Institut für Informatik Lehrstuhl für Eingebettete Systeme Prof. Dr. Uwe Brinkschulte Benjamin Betting Eingebettete Systeme 1. Aufgabe (Regelsystem) 3. Übungsblatt Lösungsvorschlag a) Das Fahrzeug kann
Anforderungen für Chassis, Mechanik, Elektrik, Elektronik
 Anforderungen für Chassis, Mechanik, Elektrik, Elektronik Version vom 25.6.13, 10.07.13, Chassis 1 1 Chassis, Rahmen 600 x 400 x 200 mm ( LxBxH) 10 kg verwindungssteife Rahmenkonstruktion aus Alu-Profil,
Anforderungen für Chassis, Mechanik, Elektrik, Elektronik Version vom 25.6.13, 10.07.13, Chassis 1 1 Chassis, Rahmen 600 x 400 x 200 mm ( LxBxH) 10 kg verwindungssteife Rahmenkonstruktion aus Alu-Profil,
ST7. Schrittmotorsteuerung
 ST7 Schrittmotorsteuerung 1. FUNKTION................................................................................................. 2 1.1. DATENBLATT... 2 1.1.1. Anwendung... 2 1.1.2. Daten... 2 1.1.3.
ST7 Schrittmotorsteuerung 1. FUNKTION................................................................................................. 2 1.1. DATENBLATT... 2 1.1.1. Anwendung... 2 1.1.2. Daten... 2 1.1.3.
Ziele Physikalische Eigenschaften Systemeigenschaften. Echtzeitsysteme 2. Eisenbahn. Daniel Brinkers, Markus Becher, Henry Schäfer.
 Echtzeitsysteme 2 Eisenbahn Daniel Brinkers, Markus Becher, Henry Schäfer FAU Erlangen 2007-05-09 / Anwendungsanalyse Gliederung 1 Ziele 2 Physikalische Eigenschaften Eigenschften von Zügen Eigenschaften
Echtzeitsysteme 2 Eisenbahn Daniel Brinkers, Markus Becher, Henry Schäfer FAU Erlangen 2007-05-09 / Anwendungsanalyse Gliederung 1 Ziele 2 Physikalische Eigenschaften Eigenschften von Zügen Eigenschaften
WCET Analyse. Florian Franzmann Tobias Klaus Peter Wägemann
 WCET Analyse Florian Franzmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) http://www4.cs.fau.de 11. November
WCET Analyse Florian Franzmann Tobias Klaus Peter Wägemann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) http://www4.cs.fau.de 11. November
Übersicht.
 1 Übersicht 1. Diag Mode CCM / ECM (ab C4 1990) Seite 2-5 2. CCM Fault Code List Seite 6 3. LTPWS Fault Code List Seite 7 4. ABS Fault Code List Seite 7 5. SIR (Airbag) Fault Code List Seite 7 6. ECM Fault
1 Übersicht 1. Diag Mode CCM / ECM (ab C4 1990) Seite 2-5 2. CCM Fault Code List Seite 6 3. LTPWS Fault Code List Seite 7 4. ABS Fault Code List Seite 7 5. SIR (Airbag) Fault Code List Seite 7 6. ECM Fault
Radar Evaluation Board - REB165 Installation / Getting Started
 Radar Evaluation Board - REB165 Installation / Getting Started 1. Installation Treiber/Software RICHTIG FALSCH Verbinden Sie den Radarsensor mit dem Board. Verbinden Sie USB Kabel mit dem Board und Ihrem
Radar Evaluation Board - REB165 Installation / Getting Started 1. Installation Treiber/Software RICHTIG FALSCH Verbinden Sie den Radarsensor mit dem Board. Verbinden Sie USB Kabel mit dem Board und Ihrem
TR-TEXT_EC. Displaymodul zur Verwendung mit dem EMUS-BMS von Elektromotus und Motor-Controllern von Curtis Instruments
 TR-TEXT_EC Displaymodul zur Verwendung mit dem EMUS-BMS von Elektromotus und Motor-Controllern von Curtis Instruments Besondere Merkmale Darstellung von Daten des Batterie-Mangement-Systems und des Motor-Controllers
TR-TEXT_EC Displaymodul zur Verwendung mit dem EMUS-BMS von Elektromotus und Motor-Controllern von Curtis Instruments Besondere Merkmale Darstellung von Daten des Batterie-Mangement-Systems und des Motor-Controllers
Mathematische Grundlagen Kalman Filter Beispielprogramm. Kalman Filter. Stephan Meyer
 Kalman Filter Stephan Meyer FWPF Ortsbezogene Anwendungen und Dienste Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 07.12.2007 Outline 1 Mathematische Grundlagen 2 Kalman Filter 3 Beispielprogramm Mathematische
Kalman Filter Stephan Meyer FWPF Ortsbezogene Anwendungen und Dienste Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 07.12.2007 Outline 1 Mathematische Grundlagen 2 Kalman Filter 3 Beispielprogramm Mathematische
Infokarte: Snap4Arduino
 Infokarte: Snap4Arduino Ein Arduino-Projekt erstellen Um ein neues Arduino-Projekt in Snap4Arduino zu erstellen, wird das Programm geöffnet. Snap erzeugt automatisch ein neues Projekt. Soll ein bereits
Infokarte: Snap4Arduino Ein Arduino-Projekt erstellen Um ein neues Arduino-Projekt in Snap4Arduino zu erstellen, wird das Programm geöffnet. Snap erzeugt automatisch ein neues Projekt. Soll ein bereits
Führungskonzept eines. -Teil 2- Enrico Hensel Masterstudiengang Informatik Seminar-Ringvorlesung 2009
 Führungskonzept eines autonomen Fahrzeuges -Teil 2- Enrico Hensel Masterstudiengang Informatik Seminar-Ringvorlesung 2009 Einleitung Rückblick Motivation Bestandaufnahme Fahrzeugplattform Fahrzeugregelung
Führungskonzept eines autonomen Fahrzeuges -Teil 2- Enrico Hensel Masterstudiengang Informatik Seminar-Ringvorlesung 2009 Einleitung Rückblick Motivation Bestandaufnahme Fahrzeugplattform Fahrzeugregelung
Telemetrie-System 2,4 GHz
 Telemetrie-System 2,4 GHz e-mail: office@lindinger.at www.lindinger.at Stand der Technik Paralleler Servoanschluss Separater Telemetriesender Separate Sensoren RPM- Sensor BL- Motor V und A Sensor BL-Regler
Telemetrie-System 2,4 GHz e-mail: office@lindinger.at www.lindinger.at Stand der Technik Paralleler Servoanschluss Separater Telemetriesender Separate Sensoren RPM- Sensor BL- Motor V und A Sensor BL-Regler
AUTOSUN AUTARKE LÖSUNG. EIN SOLARBETRIEBENES SYSTEM für senkrechte oder Dachfensterrollläden.
 AUTOSUN AUTARKE LÖSUNG EIN SOLARBETRIEBENES SYSTEM für senkrechte oder Dachfensterrollläden. KOMPLETTES SYSTEM bestehend aus dem Motor T3.5 EHz DC (siehe Seite 34), einem Akku und einem Solarpanel. Dies
AUTOSUN AUTARKE LÖSUNG EIN SOLARBETRIEBENES SYSTEM für senkrechte oder Dachfensterrollläden. KOMPLETTES SYSTEM bestehend aus dem Motor T3.5 EHz DC (siehe Seite 34), einem Akku und einem Solarpanel. Dies
Modellierung verteilter Systeme Grundlagen der Programm und Systementwicklung
 Modellierung verteilter Systeme Grundlagen der Programm und Systementwicklung Sommersemester 2012 Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy Unter Mitarbeit von Dr. M. Spichkova, J. Mund, P. Neubeck Lehrstuhl Software
Modellierung verteilter Systeme Grundlagen der Programm und Systementwicklung Sommersemester 2012 Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy Unter Mitarbeit von Dr. M. Spichkova, J. Mund, P. Neubeck Lehrstuhl Software
Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590. Steuergerätediagnose mit ESI[tronic]
![Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590. Steuergerätediagnose mit ESI[tronic] Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590. Steuergerätediagnose mit ESI[tronic]](/thumbs/77/75950048.jpg) Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590 Steuergerätediagnose mit ESI[tronic] Modernste Steuergerätediagnose für ein Höchstmaß an Effizienz Die neuen, robusten Kommunikationsmodule KTS 560 und KTS 590 basieren
Uns bewegen LÖSUNGEN KTS 560 / KTS 590 Steuergerätediagnose mit ESI[tronic] Modernste Steuergerätediagnose für ein Höchstmaß an Effizienz Die neuen, robusten Kommunikationsmodule KTS 560 und KTS 590 basieren
Konzeptausarbeitung Steer-by-Wire
 Konzeptausarbeitung Steer-by-Wire PAE-Labor Leistungselektronik & Mikrocontrollertechnik WS17/18 Christian Aßfalg 291342 Alexander Blum 291442 Ziel des Projekts Das Innovationsfahrzeug Trettraktor soll
Konzeptausarbeitung Steer-by-Wire PAE-Labor Leistungselektronik & Mikrocontrollertechnik WS17/18 Christian Aßfalg 291342 Alexander Blum 291442 Ziel des Projekts Das Innovationsfahrzeug Trettraktor soll
Automatisierungstechnik 1
 Automatisierungstechnik Hinweise zum Laborversuch Motor-Generator. Modellierung U a R Last Gleichstrommotor Gleichstromgenerator R L R L M M G G I U a U em = U eg = U G R Last Abbildung : Motor-Generator
Automatisierungstechnik Hinweise zum Laborversuch Motor-Generator. Modellierung U a R Last Gleichstrommotor Gleichstromgenerator R L R L M M G G I U a U em = U eg = U G R Last Abbildung : Motor-Generator
Klasse, Name : Datum : Rad l/r Linienfolger l/r Laderaum ATMEGA 128
 HTL_RoboterDKU.odt Übung : Arbeiten mit dem HTL Leonding Roboter Seite : 1 von 7 1. Roboter Peripherie Eingänge Ausgänge DIGITAL ANA- LG DATEN Taster Kante l/r Rad l/r Linienfolger l/r Laderaum Klappe
HTL_RoboterDKU.odt Übung : Arbeiten mit dem HTL Leonding Roboter Seite : 1 von 7 1. Roboter Peripherie Eingänge Ausgänge DIGITAL ANA- LG DATEN Taster Kante l/r Rad l/r Linienfolger l/r Laderaum Klappe
Umrichter zur Ansteuerung von permanenterregten Synchronmaschinen (PMSM) und bürstenlosen DC-Motoren (BLDC)
 CC-75-500 Umrichter zur Ansteuerung von permanenterregten Synchronmaschinen (PMSM) und bürstenlosen DC-Motoren (BLDC) Sensorlose Geschwindigkeitsregelung von 0 U/min bis zu 1 Million U/min Maximale Ausgangsleistung:
CC-75-500 Umrichter zur Ansteuerung von permanenterregten Synchronmaschinen (PMSM) und bürstenlosen DC-Motoren (BLDC) Sensorlose Geschwindigkeitsregelung von 0 U/min bis zu 1 Million U/min Maximale Ausgangsleistung:
Dokumentation. für metratec TUC Evaluation Board. Stand: Februar Version: 1.1. Dokumentation TUC Eval-Board Seite 1 von 10
 Dokumentation für metratec TUC Evaluation Board Stand: Februar 2012 Version: 1.1 Dokumentation TUC Eval-Board Seite 1 von 10 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1. Allgemeine Hinweise... 3 1.1.
Dokumentation für metratec TUC Evaluation Board Stand: Februar 2012 Version: 1.1 Dokumentation TUC Eval-Board Seite 1 von 10 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1. Allgemeine Hinweise... 3 1.1.
Zusammenfassung der 8. Vorlesung
 Zusammenfassung der 8. Vorlesung Beschreibung und Analyse dynamischer Systeme im Zustandsraum Steuerbarkeit eines dynamischen Systems Unterscheidung: Zustandssteuerbarkeit, Zustandserreichbarkeit Unterscheidung:
Zusammenfassung der 8. Vorlesung Beschreibung und Analyse dynamischer Systeme im Zustandsraum Steuerbarkeit eines dynamischen Systems Unterscheidung: Zustandssteuerbarkeit, Zustandserreichbarkeit Unterscheidung:
ROBOTER ARCHITEKTUR ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN REVISION
 ROBOTER ARCHITEKTUR ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN REVISION 2 Rev.2 11/01/2013 1 Inhalt Das vorliegende Dokument bezieht sich hier auf Ambrogio Roboter (auch anwendbar auf alle anderen ZCS Roboter, Wiper
ROBOTER ARCHITEKTUR ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN REVISION 2 Rev.2 11/01/2013 1 Inhalt Das vorliegende Dokument bezieht sich hier auf Ambrogio Roboter (auch anwendbar auf alle anderen ZCS Roboter, Wiper
High Performance Motion Control. Modellbasierte Entwicklung Virtueller Sensorik
 High Performance Motion Control Modellbasierte Entwicklung Virtueller Sensorik Führend in Technologie Weltweit nah am Kunden Wirtschaftlich unabhängig Unser Team für Ihren Erfolg 2.820 Mitarbeiter 585
High Performance Motion Control Modellbasierte Entwicklung Virtueller Sensorik Führend in Technologie Weltweit nah am Kunden Wirtschaftlich unabhängig Unser Team für Ihren Erfolg 2.820 Mitarbeiter 585
C x Hexapod Motion Controller
 C-887.52x Hexapod Motion Controller Kompaktes Tischgerät zur Steuerung von 6-Achs-Systemen Leistungsfähiger Controller mit Vektorsteuerung Kommandierung in kartesischen Koordinaten Änderungen des Bezugssystems
C-887.52x Hexapod Motion Controller Kompaktes Tischgerät zur Steuerung von 6-Achs-Systemen Leistungsfähiger Controller mit Vektorsteuerung Kommandierung in kartesischen Koordinaten Änderungen des Bezugssystems
Schaltregler. engl. Switching Regulator, DC-DC Converter. Ansatz: Anstelle des linear betriebenen Transistors einen Umschalter benutzten V 0 =D V S
 Schaltregler engl. Switching Regulator, DC-DC Converter Ansatz: Anstelle des linear betriebenen Transistors einen Umschalter benutzten V S V 0 Buck Converter (Abwärtsregler) V S Was ist zu erwarten? V
Schaltregler engl. Switching Regulator, DC-DC Converter Ansatz: Anstelle des linear betriebenen Transistors einen Umschalter benutzten V S V 0 Buck Converter (Abwärtsregler) V S Was ist zu erwarten? V
Jan Monsch. Donnerstag, 2. Mai 13
 101 Jan Monsch Agenda Arduino Platform Digitale Ausgaben Analoge Eingänge Digitale Eingaben I2C Geräte (Digitales Thermometer) Arduino SW Download goo.gl/dj5l2 Was ist Arduino? Open Source Einplatinen-Computer
101 Jan Monsch Agenda Arduino Platform Digitale Ausgaben Analoge Eingänge Digitale Eingaben I2C Geräte (Digitales Thermometer) Arduino SW Download goo.gl/dj5l2 Was ist Arduino? Open Source Einplatinen-Computer
BESTIMMUNG DES WECHSELSTROMWIDERSTANDES IN EINEM STROMKREIS MIT IN- DUKTIVEM UND KAPAZITIVEM WIDERSTAND.
 Elektrizitätslehre Gleich- und Wechselstrom Wechselstromwiderstände BESTIMMUNG DES WECHSELSTROMWIDERSTANDES IN EINEM STROMKREIS MIT IN- DUKTIVEM UND KAPAZITIVEM WIDERSTAND. Bestimmung des Wechselstromwiderstandes
Elektrizitätslehre Gleich- und Wechselstrom Wechselstromwiderstände BESTIMMUNG DES WECHSELSTROMWIDERSTANDES IN EINEM STROMKREIS MIT IN- DUKTIVEM UND KAPAZITIVEM WIDERSTAND. Bestimmung des Wechselstromwiderstandes
Bachelorprüfung MM I 2. März Vorname: Name: Matrikelnummer:
 Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 2. März 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:......
Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 2. März 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:......
Fortgeschrittenenpraktikum Inverses Pendel
 Fortgeschrittenenpraktikum Inverses Pendel Johannes Vogt, Stefan Richter Robotiklabor an der Universität Heidelberg Übersicht Team und Betreuer Aufgabenstellung Theoretische Modellierung des physikalischen
Fortgeschrittenenpraktikum Inverses Pendel Johannes Vogt, Stefan Richter Robotiklabor an der Universität Heidelberg Übersicht Team und Betreuer Aufgabenstellung Theoretische Modellierung des physikalischen
Ballistischer Chronograph
 Ballistischer Chronograph Bedienungsanleitung Ballistischer Chronograph Die Vorrichtung ist ausgelegt, um die Geschwindigkeit und die kinetische Energie der Munition bei Luftgewehren zu messen. Eigenschaften:
Ballistischer Chronograph Bedienungsanleitung Ballistischer Chronograph Die Vorrichtung ist ausgelegt, um die Geschwindigkeit und die kinetische Energie der Munition bei Luftgewehren zu messen. Eigenschaften:
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik. Aufgabensammlung zur. Regelungstechnik B. Prof. Dr. techn. F. Gausch Dipl.-Ing. C.
 Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik Aufgabensammlung zur Regelungstechnik B Prof. Dr. techn. F. Gausch Dipl.-Ing. C. Balewski 10.03.2011 Übungsaufgaben zur Regelungstechnik B Aufgabe 0
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik Aufgabensammlung zur Regelungstechnik B Prof. Dr. techn. F. Gausch Dipl.-Ing. C. Balewski 10.03.2011 Übungsaufgaben zur Regelungstechnik B Aufgabe 0
L50 / BLITZ. Motherboard. Optionales Zubehör. Grassensoren (6x) ON/OFF Taste. Absturzsensoren (4x) START/STOP Taste. Radmotoren (2x) Akku.
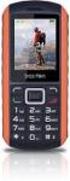 ROBOT Anschlussplan L50 / BLITZ Optionales Zubehör Grassensoren (6x) ON/OFF Taste (mit LED s) Absturzsensoren (4x) Motherboard START/STOP Taste (mit LED s) Akku Radmotoren (2x) Empfänger Messermotor Spule
ROBOT Anschlussplan L50 / BLITZ Optionales Zubehör Grassensoren (6x) ON/OFF Taste (mit LED s) Absturzsensoren (4x) Motherboard START/STOP Taste (mit LED s) Akku Radmotoren (2x) Empfänger Messermotor Spule
Lehr- und Forschungsprojekt Balancer
 Lehr- und Forschungsprojekt Balancer Prof. Dr.-Ing. Tobias Flämig-Vetter Email: tobias.flaemig@dhbw-stuttgart.de Tel: +49 711 1849 636 http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~flaemig/studienarbeiten/balancer/
Lehr- und Forschungsprojekt Balancer Prof. Dr.-Ing. Tobias Flämig-Vetter Email: tobias.flaemig@dhbw-stuttgart.de Tel: +49 711 1849 636 http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~flaemig/studienarbeiten/balancer/
Automatisierung. Steuerung und Automatisierung
 Automatisierung Steuerung und Automatisierung Umfang: ca. 1-3 Zeitstunden Steuerung eines Quadrokopters Sicherheitseinweisung Aufgaben & Hinweise Fußzeilentext 2 Steuerung eines Quadrokopters: Basierend
Automatisierung Steuerung und Automatisierung Umfang: ca. 1-3 Zeitstunden Steuerung eines Quadrokopters Sicherheitseinweisung Aufgaben & Hinweise Fußzeilentext 2 Steuerung eines Quadrokopters: Basierend
Übungen zu Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPiC) im Sommersemester 2018
 Übungen zu Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPiC) im Sommersemester 2018 2018-05-29 Bernhard Heinloth Lehrstuhl für Informatik 4 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl
Übungen zu Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPiC) im Sommersemester 2018 2018-05-29 Bernhard Heinloth Lehrstuhl für Informatik 4 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl
STO - Safe Torque Off
 Servo Drives mit STO - Safe Torque Off Indel Servo-Drives Sicherer Halt nach EN ISO 13849-1 GIN-SAC3 GIN-SAC3x3 INFO-SAC3 INFO-SAC3x3 Alle Indel Servo-Drives sind neu mit der Sicherheitsfunktion STO Safe
Servo Drives mit STO - Safe Torque Off Indel Servo-Drives Sicherer Halt nach EN ISO 13849-1 GIN-SAC3 GIN-SAC3x3 INFO-SAC3 INFO-SAC3x3 Alle Indel Servo-Drives sind neu mit der Sicherheitsfunktion STO Safe
Präzisions Drehtisch Baureihe ADR-A
 Präzisions Drehtisch Baureihe ADR-A Bei der Baureihe ADR-A handelt es sich um Drehtische mit eisenbehaftetem Torque Motor. Sie ermöglichen präzise und dynamische Winkelbewegungen. Direktantrieb mit hochpoligem
Präzisions Drehtisch Baureihe ADR-A Bei der Baureihe ADR-A handelt es sich um Drehtische mit eisenbehaftetem Torque Motor. Sie ermöglichen präzise und dynamische Winkelbewegungen. Direktantrieb mit hochpoligem
Einleitung. Gliederung des Kolloquiums: 1. Vorstellung der Aufgabe. 2. Präsentation des Prozesses. 3. Konstruktion des 3D-Scanners
 Einleitung 3 Gliederung des Kolloquiums: 1. Vorstellung der Aufgabe 2. Präsentation des Prozesses 4. Zusammenfassung und Ausblick 1. Vorstellung der Aufgabe 4 Reverse Engineering Aus Industrie und Forschung
Einleitung 3 Gliederung des Kolloquiums: 1. Vorstellung der Aufgabe 2. Präsentation des Prozesses 4. Zusammenfassung und Ausblick 1. Vorstellung der Aufgabe 4 Reverse Engineering Aus Industrie und Forschung
JETI REX Assist Update Version 1.10 (September 2018)
 JETI REX Assist Update Version 1.10 (September 2018) ACHTUNG / WICHTIG: Nach dem Update auf die Version 1.10 müssen unbedingt alle Einstellungen und Ruderausschläge in allen Flugmodi am Modell überprüft
JETI REX Assist Update Version 1.10 (September 2018) ACHTUNG / WICHTIG: Nach dem Update auf die Version 1.10 müssen unbedingt alle Einstellungen und Ruderausschläge in allen Flugmodi am Modell überprüft
Projektseminar Echtzeitsysteme 2011
 Projektseminar Echtzeitsysteme 2011 Endvortrag ES Real-Time Systems Lab Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr Dept. of Electrical Engineering and Information Technology Dept. of Computer Science (adjunct Professor)
Projektseminar Echtzeitsysteme 2011 Endvortrag ES Real-Time Systems Lab Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr Dept. of Electrical Engineering and Information Technology Dept. of Computer Science (adjunct Professor)
PIMag Hochlast-Lineartisch
 PIMag Hochlast-Lineartisch Hohe Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz, Linearmotor V-417 Breite 166mm Stellweg bis 813 mm Nennkraft 87 N Inkrementeller oder absoluter Linearencoder Präzise Kugelumlaufführungen,
PIMag Hochlast-Lineartisch Hohe Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz, Linearmotor V-417 Breite 166mm Stellweg bis 813 mm Nennkraft 87 N Inkrementeller oder absoluter Linearencoder Präzise Kugelumlaufführungen,
Höhenregelung eines schwebenden Magneten
 Technische Universität Berlin MRT M R T Prof. Dr.-Ing. R. King Fakultät III Institut für Prozess- und Anlagentechnik Fachgebiet Mess- und Regelungstechnik TU Berlin. Sekretariat. P2-1. Mess- und Regelungstechnik
Technische Universität Berlin MRT M R T Prof. Dr.-Ing. R. King Fakultät III Institut für Prozess- und Anlagentechnik Fachgebiet Mess- und Regelungstechnik TU Berlin. Sekretariat. P2-1. Mess- und Regelungstechnik
Quadrocopters and it s Applications: Overview of State of the Art Techniques
 : Overview of State of the Art Techniques Visual Tracking for Robotic Applications Sebastian Brunner Lehrstuhl für Echtzeitsysteme und Robotik Technische Universität München Email: brunnese@in.tum.de Date:
: Overview of State of the Art Techniques Visual Tracking for Robotic Applications Sebastian Brunner Lehrstuhl für Echtzeitsysteme und Robotik Technische Universität München Email: brunnese@in.tum.de Date:
Advanced Motion Control Techniques. Dipl. Ing. Jan Braun maxon motor ag Switzerland
 Advanced Motion Control Techniques Dipl. Ing. Jan Braun maxon motor ag Switzerland Agenda Schematiascher Aufbau Positionsregelkreis Übersicht Motion Control Systeme PC based mit CANopen für DC und EC Motoren
Advanced Motion Control Techniques Dipl. Ing. Jan Braun maxon motor ag Switzerland Agenda Schematiascher Aufbau Positionsregelkreis Übersicht Motion Control Systeme PC based mit CANopen für DC und EC Motoren
Der diskrete Kalman Filter
 Der diskrete Kalman Filter Fachbereich: Informatik Betreuer: Marc Drassler Patrick Winkler 1168954 6. Dezember 2004 Technische Universität Darmstadt Simulation und Systemoptimierung Darmstadt Dribbling
Der diskrete Kalman Filter Fachbereich: Informatik Betreuer: Marc Drassler Patrick Winkler 1168954 6. Dezember 2004 Technische Universität Darmstadt Simulation und Systemoptimierung Darmstadt Dribbling
Ein Benchmarkgenerator zur Bewertung von WCET-Analysatoren
 Ein Benchmarkgenerator zur Bewertung von WCET-Analysatoren 16. November 2017 Christian Eichler eichler@cs.fau.de Lehrstuhl für Verteilte Systeme und Betriebssysteme Motivation Motivation: WCET-Analysatoren
Ein Benchmarkgenerator zur Bewertung von WCET-Analysatoren 16. November 2017 Christian Eichler eichler@cs.fau.de Lehrstuhl für Verteilte Systeme und Betriebssysteme Motivation Motivation: WCET-Analysatoren
PRODUKTINFORMATION. Steuerungseinheit ibox MC. ibox MC kleine, kompakte Steuer- und Regeltechnik für Fahrzeuge und Maschinen.
 PRODUKTINFORMATION ibox MC kleine, kompakte Steuer- und Regeltechnik für Fahrzeuge und Maschinen. Robuste Elektronik in robustem Gehäuse. Die Steuerung ist durch ihre Bauform und Materialeigenschaften
PRODUKTINFORMATION ibox MC kleine, kompakte Steuer- und Regeltechnik für Fahrzeuge und Maschinen. Robuste Elektronik in robustem Gehäuse. Die Steuerung ist durch ihre Bauform und Materialeigenschaften
Radar Evaluation Board - REB165 Installation / Getting Started
 Radar Evaluation Board - REB165 Installation / Getting Started 1. Installation Treiber/Software RICHTIG FALSCH Verbinden Sie den Radarsensor mit dem Board. Verbinden Sie USB Kabel mit dem Board und Ihrem
Radar Evaluation Board - REB165 Installation / Getting Started 1. Installation Treiber/Software RICHTIG FALSCH Verbinden Sie den Radarsensor mit dem Board. Verbinden Sie USB Kabel mit dem Board und Ihrem
Name:...Vorname:... Seite 1 von 8. FH München, FB 03 Grundlagen der Elektrotechnik SS Matrikelnr.:... Hörsaal:... Platz:...
 Name:...Vorname:... Seite von 8 FH München, FB 0 Grundlagen der Elektrotechnik SS 004 Matrikelnr.:... Hörsaal:... Platz:... Zugelassene Hilfsmittel: beliebige eigene A 4 Σ N Aufgabensteller: Buch, Göhl,
Name:...Vorname:... Seite von 8 FH München, FB 0 Grundlagen der Elektrotechnik SS 004 Matrikelnr.:... Hörsaal:... Platz:... Zugelassene Hilfsmittel: beliebige eigene A 4 Σ N Aufgabensteller: Buch, Göhl,
CYOUTOO Datenblatt Version
 CYOUTOO Datenblatt Version 4-24.05.2008 Christian Ulrich http://www.ulrichc.de Seite 2 von 5 Vorwort/Anmerkung CYOUTOO ist als Experimentierplattform bzw. auf dem Weg zum Sicherheitsroboter ständig im
CYOUTOO Datenblatt Version 4-24.05.2008 Christian Ulrich http://www.ulrichc.de Seite 2 von 5 Vorwort/Anmerkung CYOUTOO ist als Experimentierplattform bzw. auf dem Weg zum Sicherheitsroboter ständig im
fischertechnik-workshop
 fischertechnik-workshop fischertechnik-steuerung mit Scratch MINT-Feriencamp, 31.05.2018 Dirk Fox Agenda Scratch Controller Sensoren & Aktoren ftscratch Materialien Scratch Scratch-IDE https://scratch.mit.edu/projects/editor/
fischertechnik-workshop fischertechnik-steuerung mit Scratch MINT-Feriencamp, 31.05.2018 Dirk Fox Agenda Scratch Controller Sensoren & Aktoren ftscratch Materialien Scratch Scratch-IDE https://scratch.mit.edu/projects/editor/
1 Achsen Servosteuerung Mammut
 1 Achsen Servosteuerung Mammut Was ist die Mammut? Die Mammut ist eine CNC Steuerung der 2. Generation, sie ist für höheren Strom und Spannung ausgelegt wie die Whale2.In dieser Dokumentation wird erklärt
1 Achsen Servosteuerung Mammut Was ist die Mammut? Die Mammut ist eine CNC Steuerung der 2. Generation, sie ist für höheren Strom und Spannung ausgelegt wie die Whale2.In dieser Dokumentation wird erklärt
Kurzeitmesser Didaline / Kurzzeitmesser Komplettset Best.-Nr. MD03248 / MD03247
 Kurzeitmesser Didaline / Kurzzeitmesser Komplettset Best.-Nr. MD03248 / MD03247 Gehäuse aus schlagfestem ABS Abmessungen: 250 x 160 x 225 mm. 3 1/2stellige rote LED-Anzeige, Höhe der Ziffern: 17mm. Maximale
Kurzeitmesser Didaline / Kurzzeitmesser Komplettset Best.-Nr. MD03248 / MD03247 Gehäuse aus schlagfestem ABS Abmessungen: 250 x 160 x 225 mm. 3 1/2stellige rote LED-Anzeige, Höhe der Ziffern: 17mm. Maximale
Versuch A: Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors
 Technische Universität Berlin Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik Fachgebiet Regelungssysteme Leitung: Prof. Dr.-Ing. Jörg Raisch IV Zeitdiskrete Regelsysteme Integriertes Praktikum Versuch A: Drehzahlregelung
Technische Universität Berlin Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik Fachgebiet Regelungssysteme Leitung: Prof. Dr.-Ing. Jörg Raisch IV Zeitdiskrete Regelsysteme Integriertes Praktikum Versuch A: Drehzahlregelung
Domänenanalyse - Gerätetreiber
 Domänenanalyse - Gerätetreiber Andreas Ströber, Alexander Maret-Huskinson, Dominik Murr SS 2003 - OSE 2 Kurze Erläuterung Unser Ziel ist es nicht, alle vorgestellten Features auch am Ende implementiert
Domänenanalyse - Gerätetreiber Andreas Ströber, Alexander Maret-Huskinson, Dominik Murr SS 2003 - OSE 2 Kurze Erläuterung Unser Ziel ist es nicht, alle vorgestellten Features auch am Ende implementiert
Einführung in die Arduino-Programmierung II
 Einführung in die Arduino-Programmierung II Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences Elektrotechnik und Informatik Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 5. Dimmen einer LED
Einführung in die Arduino-Programmierung II Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences Elektrotechnik und Informatik Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 5. Dimmen einer LED
LEGO MINDSTORMS NXT MIT LABVIEW 2009 PROGRAMMIEREN
 LEGO MINDSTORMS NXT MIT LABVIEW 2009 PROGRAMMIEREN Prof. Dr.-Ing. Dahlkemper Fabian Schwartau Patrick Voigt 1 NXT DIRECT COMMANDS Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den NXT zu programmieren: Es werden
LEGO MINDSTORMS NXT MIT LABVIEW 2009 PROGRAMMIEREN Prof. Dr.-Ing. Dahlkemper Fabian Schwartau Patrick Voigt 1 NXT DIRECT COMMANDS Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den NXT zu programmieren: Es werden
Elektromagnetische Induktion Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Generator, Wechselstrom
 Aufgaben 13 Elektromagnetische Induktion Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Generator, Wechselstrom Lernziele - aus einem Experiment neue Erkenntnisse gewinnen können. - sich aus dem Studium eines schriftlichen
Aufgaben 13 Elektromagnetische Induktion Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Generator, Wechselstrom Lernziele - aus einem Experiment neue Erkenntnisse gewinnen können. - sich aus dem Studium eines schriftlichen
Heatmaster II FAQ Stand: Mittwoch, 6. Februar 2013
 Eigenschaften Welche Systemanforderungen hat der Heatmaster II? Welche technische Daten hat der Heatmaster II? Wie ist der Lieferumfang? Was Kann alles an den Heatmaster II angeschlossen werden? Bei welcher
Eigenschaften Welche Systemanforderungen hat der Heatmaster II? Welche technische Daten hat der Heatmaster II? Wie ist der Lieferumfang? Was Kann alles an den Heatmaster II angeschlossen werden? Bei welcher
Microsoft.NET Gadgeteer: Ein raffinierter Weg zum Embedded-Produkt. ECC 2013 Marcel Berger
 Microsoft.NET Gadgeteer: Ein raffinierter Weg zum Embedded-Produkt ECC 2013 Marcel Berger 1 Agenda Motivation Einführung Microsoft.NET Micro Framework Einführung Microsoft.NET Gadgeteer Vorteile Architektur
Microsoft.NET Gadgeteer: Ein raffinierter Weg zum Embedded-Produkt ECC 2013 Marcel Berger 1 Agenda Motivation Einführung Microsoft.NET Micro Framework Einführung Microsoft.NET Gadgeteer Vorteile Architektur
Datenblatt GCM MOD xxx Rail.1/.2 Kommunikationsmodul Modbus
 Datenblatt GCM MOD xxx Rail.1/.2 Kommunikationsmodul Modbus ERP-Nr. 5204182 ERP-Nr. 5204182.2 ERP-Nr. 5206138 ERP-Nr. 5206139 ERP-Nr. 5206139.2 ERP-Nr. 5206759 GCM MOD GMM Rail.1 GCM MOD GMM Rail.2 GCM
Datenblatt GCM MOD xxx Rail.1/.2 Kommunikationsmodul Modbus ERP-Nr. 5204182 ERP-Nr. 5204182.2 ERP-Nr. 5206138 ERP-Nr. 5206139 ERP-Nr. 5206139.2 ERP-Nr. 5206759 GCM MOD GMM Rail.1 GCM MOD GMM Rail.2 GCM
Hybride Systeme Einführung und Übersicht
 Hybride Systeme Einführung und Übersicht Thomas Stauner Lehrstuhl Software & Systems Engineering Inhaltsübersicht Hybride Systeme Begriffsklärung und Motivation Eigenschaften Beschreibungstechniken Analysetechniken
Hybride Systeme Einführung und Übersicht Thomas Stauner Lehrstuhl Software & Systems Engineering Inhaltsübersicht Hybride Systeme Begriffsklärung und Motivation Eigenschaften Beschreibungstechniken Analysetechniken
Messungen mit dem Taschenrechner - Kurzbeschreibung
 Universität Bielefeld Fakultät für Physik Physik und ihre Didaktik Prof. Dr. Bärbel Fromme Messungen mit dem Taschenrechner - Kurzbeschreibung Vorbereitungen: Interface CBL2 an Taschenrechner anschließen,
Universität Bielefeld Fakultät für Physik Physik und ihre Didaktik Prof. Dr. Bärbel Fromme Messungen mit dem Taschenrechner - Kurzbeschreibung Vorbereitungen: Interface CBL2 an Taschenrechner anschließen,
RUNDENZEIT DREHZAHL GESCHWINDIGKEIT QUERBESCHLEUNIGUNG 5 ANALOGEINGÄNGE - GANG
 AIM MyChron3 gold Auto MyChron 3 gold Auto AUTO RUNDENZEIT DREHZAHL GESCHWINDIGKEIT QUERBESCHLEUNIGUNG 5 ANALOGEINGÄNGE - GANG Beschreibung MyChron 3 gold Auto ist eine 10-Kanal-Datenaufzeichnung mit digitalem
AIM MyChron3 gold Auto MyChron 3 gold Auto AUTO RUNDENZEIT DREHZAHL GESCHWINDIGKEIT QUERBESCHLEUNIGUNG 5 ANALOGEINGÄNGE - GANG Beschreibung MyChron 3 gold Auto ist eine 10-Kanal-Datenaufzeichnung mit digitalem
