Wie eignen sich Kinder die Rechtschreibung an?
|
|
|
- Käte Simen
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Erika Brinkmann Wie eignen sich Kinder die Rechtschreibung an? Bis vor 40, 50 Jahren hat sich die Rechtschreibdidaktik auf die Frage konzentriert, wie man Kindern die Orthographie beibringen könne und zwar in der Schule. Erst in den 1970er-Jahren eröffnete die Forschung eine neue Sicht auf den Schriftspracherwerb. Die anregenden Befunde kamen zunächst aus Untersuchungen zum Lesenlernen, zu einem wichtigen Teil schon mit Vorschulkindern. Im angelsächsischen Sprachraum waren es u. a. Reid (1966), Read (1971), Chomsky (1971), Gentry (1978; 1982), Baghban (1984), in Deutschland vor allem Eichler (1976), Castrup (1978), Valtin u. a. (1986), die sogenannte Spontanschreibungen analysierten, um zu verstehen, wie Kinder die Beziehung zwischen Laut- und Schriftsprache für sich rekon-struieren. Der Schriftspracherwerb wird aus dieser Sicht nicht als bloß additiver Erwerb von Kenntnissen (z. B. Laut-Buchstaben-Beziehungen oder Einzelwortschreibungen) bzw. Fertigkeiten (z. B. Lautanalyse oder»verlängern«) verstanden, sondern als Entwicklung von Strategien und deren Umorganisation. In Form von Stufenmodellen (in der Nachfolge von Gentry 1978; 1982; Frith 1985; 1986; Günther 1986/1995) haben verschiedene Autor/ inn/en die kritischen Schritte in diesem Prozess beschrieben, die inzwischen durch größere Studien empirisch gut belegt sind (vgl. für die alphabetische Phase Brügelmann 1990 und Richter 1992, für die orthographische und die morphematische Strategie May 1995). Für den Unterricht deutschsprachiger Kinder hat lediglich die logographische (Vor-)Stufe keine besondere Bedeutung (mehr), wie Studien von Wimmer u. a. (1990) und Klicpera / Gasteiger-Klicpera (1993) gezeigt haben. Für die zentrale Rolle der anschließenden alphabetischen Phase des Rechtschreiblernens scheint die unterschiedliche Komplexität des jeweiligen Schriftsystems, also die»durchsichtigkeit«der Buchstaben-Laut-Beziehung in verschiedenen Sprachen, keinen Unterschied zu machen allenfalls für das Tempo, in dem Kinder zunächst das alphabetische Prinzip und anschließend Rechtschreibbesonderheiten meistern (vgl. Caravolas 2004). Diese Befunde dürfen aber nicht zu einer Verdinglichung von»stufen«führen, zu denen sich Kinder wie in Schubladen zuordnen ließen (s. zu wichtigen Einschränkungen unten). Der Perspektivwechsel von den Lehrmethoden zu den Aneignungsstrategien der Kinder wirft zudem zwei Fragen auf: Welche Bedeutung haben deren»eigenproduktionen«(wie Selter [1994] das Phänomen für den Bereich der Mathematik benannt hat) für den 164 Zugang zur Schriftsprache und wie kommen die Kinder»von der Invention zur Konvention«(Brügelmann 1999 b)? Im Folgenden werte ich dazu die Forschungslage aus, indem ich die Befunde chronologisch nach der Entwicklung der Kinder strukturiere. Zugänge zur Schriftsprache vor der Schule Bereits vor hundert Jahren hatten Reformpädagog/inn/en wie Maria Montessori beobachtet, dass Kinder anfingen (lautbezogen) zu schreiben, ohne lesen zu können eine Einsicht, die Jürgen Reichen Ende der 1970er-Jahre didaktisch für sein Konzept»Lesen durch Schreiben«nutzte. Intensive Fallstudien von Vorschulkindern u. a. Blumenstock (1986), Gaber / Eberwein (1986), Scheerer-Neumann u. a. (1986), Brinkmann (1997, Kap. 4.1) und Befunde aus größeren Stichproben (s. u.) zeigten gleichermaßen, dass Kinder auch schon ohne Instruktion und später selbst bei einem eher gegenläufig konzipierten Unterricht eigene Strategien entwickeln, um sich die Struktur der Schriftsprache zu erschließen. Grundlegend war und ist die Interview-Studie von Ferreiro / Teberosky (1979), die in der Piaget-Tradition Vorschulkindern schriftsprachliche Aufgaben stellten (z. B. Kannst du Bär schreiben?«;»schreib mal vier Katzen!«) und sie zu ihren Schreibversuchen befragten. In der Anfangsphase folgten viele dabei der vertrauten Bilder- Logik: mehr Buchstaben für ein größeres Tier oder für eine größere Anzahl. Valtin u. a. (1984) fanden bei deutschsprachigen Kindern ebenfalls, dass die Entdeckung des Lautbezugs einen großen Schritt darstellte; so war vielen nicht klar, dass auch Artikel und Verben verschriftet werden. Oft wurde den Befunden aus solchen Fallstudien entgegengehalten, sie seien nicht aussagekräftig, weil meist Kinder beobachtet wurden, die in den besonders schriftsprachreichen und anregenden Familien der Autor/inn/en aufwuchsen. Übersehen wurden (und werden ) dabei parallele Befunde mit Unterschichtkindern (z. B. Ferreiro / Teberosky 1982, 22ff.), in Kindergarten-Studien (vgl. Lenel 2005) und Schulanfangsklassen (s. u.). Übersehen wurde auch, dass die Argumentation anders gerichtet war: Selbst Kinder aus diesen privilegierten Milieus nähern sich der Orthographie über die Vorstufen und fehlerhaften Zwischenformen an, die später bei sog.»lernschwachen«kindern zu beobachten sind, und ihr erfolgreicher Rechtschreib erwerb wird nicht durch diese»umwege«behindert. Förderlich für die weitere Rechtschreibentwicklung sind ganz unterschiedliche Bedingungen. Von den Umweltbedingungen ist der Unterricht besonders einflussreich (s. den gesonderten Beitrag von Brügelmann i. d. B.). An dieser Stelle bedeutsam sind schulunabhängige individuelle Voraussetzungen auch wenn sie ihrerseits von Umweltfaktoren wie den schriftsprachlichen Anregungen in der Familie beeinflusst sein können (vgl. zur 165
2 Förderung der»family literacy«van Steensel 2013; Nickel 2014). Aus verschiedenen Sammelreferaten der letzten 30 Jahre (Brügelmann 1984; Richter 1992, Kap. 4; Lenel 2005, Kap. 2; National Early Literacy Panel 2008, Kap. 2) lassen sich folgende Erkenntnisse über förderliche Voraussetzungen für den Einstieg in den Schriftspracherwerb gewinnen (deren Fehlen umgekehrt besonders hinderlich ist): 166 Gegenstandsnahe, also direkt auf (Schrift-)Sprache bezogene Erfahrungen und Kompetenzen haben eine höhere Bedeutung als allgemeine kognitive Funktionen wie Intelligenz, Gedächtnis oder Wahrnehmungs- und motorische Leistungen. Schriftsprachbezogene Einsichten, Kenntnisse und Fertigkeiten sind bedeutsamer als rein lautsprachliche. Die phonologische Bewusstheit stellt als Brücke zwischen Laut- und Schriftsprache eine wichtige Teilkompetenz dar, muss aber nicht vorweg als»voraussetzung«gesichert werden. Exkurs zur Bedeutung der phonologischen Bewusstheit In den vergangenen 30 Jahren ist die Fähigkeit der Kinder, ihre Aufmerksamkeit auf die Lautform von Wörtern zu richten und diese gezielt zu manipulieren, vielfach untersucht worden. Diese Veränderung des Blicks auf Sprache stellt einen wichtigen Schritt beim Erwerb der Schriftsprache dar. Umstritten ist aber, ob sie als»voraussetzung«zu betrachten und zu fördern ist. Für diese Annahme verweisen ihre Befürworter/innen auf folgende Forschungsbefunde (vgl. u. a. National Reading Panel 2000, Kap. II.1; Ehri u. a. 2001; Einsiedler u. a. 2002; Schneider / Küspert 2003): deutliche Korrelationen zwischen dem Niveau phonologischer Bewusstheit vor der Schule und der Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenz im Anfangsunterricht; höheres Risiko für Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten, sofern ein Mindestniveau phonologischer Bewusstheit vor der Schule unterschritten wird; positive Effekte einer Förderung vor der Schule auf den Erfolg beim Lesen- und Schreibenlernen in der Schule. Die Kritiker/innen schränken die Aussagekraft dieser Befunde in verschiedener Hinsicht ein (vgl. Brügelmann 2005; Franzkowiak 2006, Kap. 2; Rackwitz 2008; Valtin 2010 c; 2012): Die Korrelationen zwischen phonologischer Bewusstheit und Erfolg beim Lesen- und Schreibenlernen sind schon für den Anfangsunterricht nicht sehr hoch (vgl. aktuell die Metaanalyse deutschsprachiger Trainingsstudien von Fischer / Post 2015, die nur einen geringen Transfereffekt [Effekstärke von d =.14] auf die Lese- und Rechtschreibleistungen fanden). Sie nehmen für die Leistungsentwicklung zum Ende der Grundschulzeit oder gar in die Sekundarstufe hinein weiter ab. Wie hoch der Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit vor der Schule und Erfolg beim Schriftspracherwerb ist, hängt zudem von der Art des Unterrichts ab. Auch wenn eine schwache phonologische Bewusstheit das Risiko für Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten erhöht, ist die große Mehrheit aus dieser Gruppe trotzdem erfolgreich. Dieses Muster findet sich zudem für eine große Zahl weiterer Merkmale, sodass unklar ist, ob eine schwach ausgeprägte phonologische Bewusstheit Ursache oder nur Symptom für eine Risikolage ist. Bedeutsame Fördereffekte einer vorgängigen Förderung sind nur bei starker Kontrolle der Durchführung nachweisbar. Der erwartete Transfer fällt je nach Leistung (z. B. Lesen vs. Rechtschreiben), eingesetztem Test (z. B. Textverständnis vs. Wortlesen) und untersuchter Dauer (z. B. Klasse 1/2 vs 3/4) unterschiedlich hoch aus. Alternativen, z. B. stärker schriftbezogene Förderansätze, sind bisher nicht ähnlich breit untersucht worden, haben sich in den vorliegenden Interventionsstudien aber als vergleichbar effektiv erwiesen. Selbst bei eingeschränkten Indikatoren für Schriftspracherfahrung vor der Schule ist auch deren Prognosekraft ähnlich hoch wie die der phonologischen Bewusstheit (s. z. B. Schneider / Näslund 1999, 141). Abgesehen von der Relativierung der empirischen Befunde sind auch grundsätzliche Unterschiede in der Sicht auf den Schriftspracherwerb und das Lernen anzumerken. Während die Befürworter/innen die phonologische Bewusstheit als eine Art Modul betrachten, das einen Eigenbeitrag zum Lesen und Schreiben leistet und das bei unterdurchschnittlicher Leistung durch Training wieder instand zu setzen ist, unterstellen die Kritiker/innen eine Selbstorganisation der Lerner/innen, die z. B. Schwächen in diesem Bereich durch Stärken in anderen kompensieren können. Zusätzlich relativieren sie die Wichtigkeit dieser Teilleistung danach, in welchem Umfeld die Kinder lernen. So haben separate Übungen der phonologischen Bewusstheit in einem ganzheitlich orientierten Leseunterricht (wie in vielen Schulen in den USA) eine andere Bedeutung als bei einem analytisch-synthetischen Vorgehen (wie in Deutschland), z. B. beim Schreiben mit einer Anlauttabelle: Bei beiden wird die phonologische Bewusstheit ständig»im Gebrauch«geübt. Auch erleichtert die größere orthographische Transparenz der deutschen Schriftsprache im Vergleich zum Englischen das Eindringen in die Struktur des alphabetischen Systems unabhängig vom Niveau der vorher erreichten phonologischen Bewusstheit (vgl. Landerl / Wimmer 2000). So folgern Mann / Wimmer (2002, 653) aus ihrem Vergleich der Entwicklung deutscher und US-amerikanischer Vorschulkinder im Anfangsunterricht:» dass sich phonologische Bewusstheit primär als Folge von Schrifterfahrung entwickelt«(übers. Bri). 167
3 Die ersten beiden Jahre in der Schule Wie die Vorschulstudien gezeigt haben, ist der Schulanfang auch in Bezug auf die schriftsprachliche Kompetenzen keine»stunde Null«. Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede in den Schriftspracherfahrungen der Kinder und den aus ihnen resultierenden Kenntnissen und Fertigkeiten (Rathenow / Vöge 1982; Richter 1992; National Early Literacy Panel 2008). Mason (1981, 25) bezifferte den Unterschied im Niveau der kognitiven Strategien auf etwa drei Entwicklungsjahre, eine Differenz, die Largo (2009) in seinem Schweizer Längsschnitt für verschiedene Leistungsdimensionen generell gefunden hat. Zwei Längsschnitte mit jeweils 260 Kindern und für Detailanalysen Teilstichproben daraus im Projekt»Kinder auf dem Weg zur Schrift«(Brügelmann 1990) und ein weiterer mit mehr als 400 Kindern von Richter (1992) haben die Rechtschreibentwicklung von Schulanfang an über mehrere Messzeitpunkte bis Mitte der zweiten Klasse untersucht. Einerseits schreiben die Kinder bei den nachfolgenden Terminen in der Regel auf dem Niveau der nächsthöheren Stufen, wie die Entwicklungsmodelle vorhersagen. Zudem erwies sich das Niveau der Verschriftungen zu Beginn und im Verlauf des ersten Schuljahres als der beste Prädiktor der Rechtschreibleistung in einem Grundwortschatz-Diktat Mitte 2. Klasse (Richter 1992, 172; Brügelmann 1999 b, 322). In diesen Prädiktor gehen zwei Kriterien ein: wie vollständig die Laute eines Wortes durch Buchstaben (er-) lesbar dargestellt werden, und in welchem Maße schon Rechtschreibmuster aufgenommen sind und zwar unabhängig davon, ob diese im konkreten Fall korrekt (<fahren>), zumindest legal (<faaren>) oder sogar illegal eingesetzt worden sind (<farren>). Vor allem der letzte Befund überrascht. Er verweist auf ein generelles Problem, nämlich dass dieselbe (Oberflächen-) Leistung in verschiedenen Phasen des Rechtschreiberwerbs eine unterschiedliche Bedeutung hat: Typisch ist die Verwendung illegaler Rechtschreibmuster in den ersten Schulmonaten für fortgeschrittene Rechtschreiber/innen, ein Jahr später aber für langsame Lerner/innen. Der zentrale Befund: Analysiert man die Fehlschreibungen von Anfänger/inne/n und rechtschreibschwachen Schüler/inne/n, die nach unterschiedlichen didaktischen Konzeptionen unterrichtet wurden, so fällt auf, dass diese Kinder schon an der lautlichen Durchgliederung der Wörter und ihrer schriftlichen Repräsentation scheitern (Kossow 1976; Frith 1980b; Brinkmann / Brügelmann 1982). Dazu passend fand Schneider (1982, 141) bei dem Versuch, unterschiedliche Rechtschreibleistungen zu erklären, für Zweitklässler/innen einen starken Einfluss der Lautunterscheidungsfähigkeit, für Viertklässler/innen dagegen eine höhere Bedeutung von Wortschatz, Sprachgedächtnis und Lesefähigkeit. In den Studien von Brügelmann u. a. (1987/88, 59f.) und Richter (1992, 144, 282) zeigte sich, dass 168 Kinder Fortschritte schwerpunktmäßig über die nächste/n Stufe/n machen, also in der orthographischen Richtigkeit erst, nachdem sie die Wörter im Wesentlichen lautgerecht verschriftet hatten. Dazu passen die hohe Korrelation von r =.81 zwischen lautgerechter Verschriftung von Kunstwörtern und orthographischer Korrektheit von Realwörtern in der Stichprobe von Wimmer u. a. (1990, 147f.) und ihr Hinweis, dass orthographische Fehler bei schwachen Rechtschreiber/inne/n nur zu 37 % lautgerecht sind (gegenüber sonst 80 %; a. a. O., 149). Neugebauer / Kirchner (2013) bestätigten diese Befunde in einer Interventionsstudie, in deren Rahmen sich die Wirksamkeit einer orthographischen Förderung als davon abhängig erwies, dass die alphabetische Strategie beherrscht wurde. Für den weiteren Verlauf untersuchten Scheerer-Neumann / Schnitzler (2009) 178 Kinder vom Beginn der 2. Klasse bis zum Beginn der 3. Klasse mit einer Liste von Wörtern unterschiedlicher phonologischer und orthographischer Komplexität. Ihre wichtigsten Befunde: Bereits zu Beginn der 2. Klasse ist die alphabetische Strategie im Durchschnitt weit entwickelt:»fast drei Viertel der Schreibungen entsprechen zu Beginn des zweiten Schuljahrs also schon der voll entfalteten alphabetischen Strategie«. Aber:»Fast 25 % der Kinder schreiben weniger als 60 % der Wörter phonologisch vollständig.«zu Beginn der 3. Klasse sinkt dieser Anteil deutlich unter 10 %. Die zu Beginn der 2. Klasse erst in Ansätzen entwickelte orthographische Strategie zeigt schon bis Mitte der 2. Klasse einen erheblichen Zuwachs.»In allen Leistungsgruppen sind Leistungssteigerungen zu beobachten: Sie sind besonders ausgeprägt in den beiden niedrigsten Leistungsgruppen.«Dass die Schere sich ein Stück weit schließt, ist bei der alphabetischen Strategie allerdings auch mit einem Deckeneffekt in der obersten Leistungsgruppe zu erklären. Der Anfang 2. Klasse erhobene Indikator»orthographisch korrekt plus lauttreu«, der also alle lautgerechten Schreibungen erfasst (unabhängig davon, ob sie zusätzlich rechtschriftlich korrekt sind), sagt die orthographische Leistung Anfang der 3. Klasse fast ebenso gut voraus wie der Anteil orthographischer Schreibungen allein.»dies bedeutet, dass zu Beginn des zweiten Schuljahrs phonologisch vollständige Schreibungen, auch wenn sie orthographisch noch nicht korrekt sind, als gut entwickelte Schreibungen angesehen werden können, die leicht in orthographisch vollständige Schreibungen überführt werden können.«169
4 Die Entwicklung bis zum Ende der Grundschulzeit In einem Querschnittvergleich von Grundschüler/inne/n in der Schweiz sowie Deutschland-Ost und -West nach der Wende fanden Brügelmann u. a. (1994, 137) in allen Gruppen deutliche Fortschritte sowohl in einem Diktat aus häufigen Wörtern (Grundwortschatz Bayern, Mindestwortschatz DDR) als auch in freien Texten. Dabei zeigten sich die Schüler/innen aus den östlichen Bundesländern im Diktat aus dem Übungswortschatz deutlich überlegen (Ende 4. Klasse 87.9 % gegenüber 82.3 bzw % der Wörter richtig), während der Abstand in den freien Texten mit 92.6 % zu 91.1 bzw % eher gering ausfiel (a. a. O., 146). Qualitative Veränderungen hat May (1991) über den Erwerb von Rechtschreibmustern in einem echten Längsschnitt über die Grundschulzeit hinweg untersucht, indem er 400 Kindern alle halbe Jahre dieselben Wörter diktierte. Er fand dabei typische Muster der zu einem bestimmten Termin dominierenden, d. h. jeweils häufigsten, Schreibungen über die verschiedenen Leistungsgruppen hinweg (s. Abb. XX; daneben gab es allerdings individuelle Varianten). Diese Übersicht verdeutlicht, dass sich eigenaktives Konstruieren nicht auf die alphabetische Phase beschränkt. Auch die Aneignung der orthographischen Besonderheiten basiert auf einer inneren Regelbildung (vgl. Eichler 1976; 1983; zur Zeichensetzung: Afflerbach 1997), d. h. einem weitgehend»impliziten Lernen«(ausführlich dazu: Neuweg 2015). Dies wurde besonders deutlich im Vergleich der Rechtschreibentwicklung west- und ostdeutscher Schüler/innen nach der Wende. Die von May gefundenen Aneignungsmuster sind allerdings weniger stabil, als die Übersicht aus seinen punktuellen Erhebungen nahelegt. Eigene Erhebungen über mehrere Termine innerhalb eines Jahres, z. T. innerhalb einer Intensivphase von zwei Monaten, haben zwar die Grundmuster des May schen Modells bestätigt, aber eine starke Fluktuation der individuellen Schreibungen von Termin zu Termin sichtbar gemacht (vgl. Brinkmann 1997). In einem Kurzzeit-Längsschnitt von Drittklässlern zeigte sich, dass diese Schreibungen sogar binnen weniger Tage in starkem Maße wechseln, d. h. dass die Kinder die Wörter jeweils immer wieder neu konstruieren (Brinkmann 2003). Diese Studien belegen also eine große Bandbreite und sogar kurzfristige Schwankungen in der parallelen Anwendung von Strategien. Auch wenn in einzelnen Phasen neu erworbene Strategien dominieren, bleiben andere verfügbar und werden vor allem bei unbekannten und bei schwierigen Wörtern oder unter Stressbedingungen (wieder) genutzt. Ebenso finden sich Vorgriffe auf anspruchsvollere Strategien, die zunächst nur an einzelnen Wörtern oder Phänomenen erprobt werden. Für Lehrer/innen besonders wichtig: 170 * Ab Klasse 5:»Fahrrad«im Kompositum»Fahrradschloss«. Tab.: Abfolge typischer Schreibungen von»fahrrad«in verschiedenen Leistungsgruppen (May 2013, 28) eine richtige wie auch eine falsche Oberflächenform kann oft verschiedenen Tiefenstrukturen entsprechen, sodass man Kontext und Vorgeschichte kennen muss, um das Risiko von Fehldeutungen zu verringern (vgl. <KINO> als frühe lautorientierte Schreibung oder als Ausnahme zur Regelschreibung des /i:/ als <ie>; ausführlicher Brügelmann 2015 a, 53f.). Als heuristisches Instrument zur Beobachtung der Lernentwicklung und insbesondere zur diagnostischen Deutung von Fehlern haben sich die Stufenmodelle jedoch bewährt. 171
5 Insgesamt nimmt über die Grundschulzeit hinweg die durchschnittliche Fehlerquote je nach Aufgabe von % auf 8 15 % und danach bis Klasse 9 bzw. 10 auf 2 3 % ab (vgl. May 1994b; 2013; Brügelmann 2003). Rechtschreibförderung ist also eine Aufgabe auch der Sekundarstufe. Unbeschadet der notwendigen Anregung, Unterstützung und Rückmeldung folgt die Aneignung der Rechtschreibung dabei einer Eigenlogik, und zwar unabhängig vom Leistungsniveau der Kinder und von der Methodik des Rechtschreibunterrichts (vgl. May 1995; 1991). Andererseits weist sie wie gezeigt auch individuelle Besonderheiten auf (vgl. Brinkmann 1997), sodass die genannten Stufen- und Strategiemodelle nur eine heuristische Funktion haben und nicht präskriptiv genutzt werden dürfen. Beide»Kräfte«typische Aneignungsmuster und individuelle Zugänge setzen den Vorstellungen einer»steuerung«des Lernens durch»programme«deutliche Grenzen. Dies zeigt sich auch in Studien zur Wirksamkeit verschiedener Ansätze der aktuellen Rechtschreibdidaktik (s. Brügelmann i. d. B., XXff.). Im Rahmen des Münchener LOGIK-Längsschnitts untersuchten Schneider u. a. (1987, 128) die Entwicklung verschiedener Leistungsgruppen. Anders als Klicpera u. a. (1993) fanden sie keine Öffnung der Leistungsschere, sondern im Durchschnitt vergleichbare Lernfortschritte (»Karawaneneffekt«). Dabei gab es auf der individuellen Ebene allerdings erhebliche Verschiebungen, die auf wichtige Spielräume für eine Förderung in der Über die Grundschule hinaus In ihrem»wiener Längsschnitt«von Klasse 2 bis 8 haben Klicpera / Gasteiger-Klicpera (1993) Kinder aus 23 Klassen im Lesen und Rechtschreiben untersucht. Sie fanden eine bedeutsame Abnahme der Fehler auch noch nach der vierten Klasse. Das nebenstehende Schaubild aus den Normierungsdaten (Jahrgangsquerschnitte) der Hamburger Schreibprobe (May 2013, 20) zeigt ebenfalls die erheblichen Fortschritte von Grundschulkindern in ihrer Rechtschreibkompetenz und vor allem für die leistungsschwachen Schüler/innen auch im Verlauf der Sekundarstufe. Vergleicht man die Entwicklung der verschiedenen Leistungsgruppen über die drei Studien hinweg, so erhält man drei ganz unterschiedliche Bilder: Während die Auswertung von May (2013) für die leistungsschwächeren Schüler/innen einen Aufholeffekt zeigt, beobachteten Klicpera / Klicpera- Gasteiger (1993) eine Öffnung der Leistungsschere und noch einmal anders stellte Schneider (1989) für die Grundschulzeit einen»karawaneneffekt«(brügelmann 2004) fest, d. h. in der SCHOLASTIK-Studie machten alle Leistungsgruppen von ihren je unterschiedlichen Voraussetzungen aus vergleichbare Fortschritte. Diese Differenzen verweisen auf ein grundsätzliches Problem solcher Entwicklungsstudien: Je nach Aufgabe und Stichprobe ergeben sich unterschiedliche Verläufe, und das auf den ersten Blick sehr plausible (und auch bei IGLU und PISA genutzte) Differenzmaß»Schuljahresfortschritt«ist ebenfalls heikel, da es nicht intervallskaliert ist: Ein Unterschied von ein, zwei Schuljahren bedeutet zu Beginn der Grundschule qualitativ etwas ganz anderes als zum Ende der Sekundarstufe I. 172 Tab.: Abfolge typischer Schreibungen von»fahrrad«in verschiedenen Leistungsgruppen (May 2013, 20) 173
6 Schule verweisen. Obwohl die Rechtschreibleistungen zu verschiedenen Terminen zwischen Anfang 2. Klasse und 4. Klasse mit r =.55 bis.78 korrelierten (a. a. O., 119), ließen sich auf der Einzelfallebene erhebliche Veränderungen beobachten, sodass nur»zwischen 48 und 57 Prozent der Kinder konstant im untersten Quartil verblieben. Demnach wechselte ein beträchtlicher Prozentsatz anfänglich schwacher Rechtschreiber das Quartil«, wobei»immerhin 30 Prozent der ursprünglich schwachen Rechtschreiber bei der zweiten Erhebung und 42 Prozent bei der dritten Erhebung zu den besseren Schülern (oberstes oder zweitoberstes Quartil) gehörten; von den Schülern, die sich bei der zweiten Messung im untersten Quartil befanden, wechselten beim dritten Meßzeitpunkt immerhin 36 Prozent in den oberen Bereich«; lediglich im Extrembereich der unteren 5 % war die Zuordnung stabiler (a. a. O., 122f.) Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man wie Klicpera / Gasteiger-Klicpera (1993) die Entwicklung über die Grundschulzeit hinaus untersucht. Zwar halten in den extremen Leistungsbereichen viele Schüler/innen ihre Rangplätze über die Zeit hinweg, aber im mittleren Leistungsbereich, z. B. zwischen Prozentrang 6 und 70, gibt es bei Klicpera / Gasteiger-Klicpera (1993, 84) vielfach Auf- und Abstiege (a. a. O., 84). Die berichteten Korrelationen von.70 bis.80 über mehrere Klassenstufen hinweg (ähnlich wie bei Schneider u. a. 1997) dürfen also nicht als Festlegung der Leistungspositionen schon im Anfangsunterricht missverstanden werden. Und selbst von den extrem schwachen Rechtschreiber/inne/n (< PZR 5) verblieben im Wiener Längsschnitt bis Klasse 8 nur 42 % in diesem Bereich. Dass die frühen Unterschiede langfristig bedeutsam sind, die Entwicklung der Kinder auch dann aber keineswegs determinieren, konnte Schneider (2009, 214) im Rahmen des Münchener LOGIK-Längsschnitts zeigen. Verglichen wurden die Rechtschreibleistungen Anfang 2. Klasse mit denen im Alter von 23 Jahren. Die gefundene Korrelation von r =.50 bedeutet, dass sich die Unterschiede in der Rechtschreibkompetenz Erwachsener zu einem Viertel über die Unterschiede zu Beginn des Rechtschreibunterrichts erklären lassen. Es gibt also einen deutlichen Zusammenhang zwischen frühen und späteren Rechtschreibleistungen in der Stichprobe insgesamt, aber wie wir oben selbst bei Korrelationen von >.70 gesehen haben eine Korrelation von.50 zeigt, dass noch erhebliche Spielräume für Veränderungen der individuellen Rangposition bestehen. Dies bedeutet eine deutliche Ermutigung und Verpflichtung für die Schule, in eine gezielte Förderung zu investieren. Denn gleichzeitig zeigt der geringe Zuwachs vom Schulende (Erhebung mit 18 Jahren) bis zum 23. Lebensjahr (auf 66 Wörter wurde im Durchschnitt nur ein Wort mehr richtig geschrieben), dass nach der Schulzeit nicht mehr mit großen Fortschritten zu rechnen ist. Auszug aus: Brinkmann, E. (Hrsg.) (2015): Rechtschreiben in der Diskussion Schriftspracherwerb und Rechtschreibunterricht. Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd Grundschulverband: Frankfurt
Der zweite entscheidende und kritische Entwicklungsschritt ist die Entwicklung orthografischer Strategien (May 1995). Unsere Schrift ist keine
 Ich vertrete an der Universität Hamburg die Deutschdidaktik mit dem Schwerpunkt Sprachlicher Anfangsunterricht und möchte deshalb mit dem Schulanfang in das Thema einsteigen. Wie lernen Schulanfänger Schreiben?
Ich vertrete an der Universität Hamburg die Deutschdidaktik mit dem Schwerpunkt Sprachlicher Anfangsunterricht und möchte deshalb mit dem Schulanfang in das Thema einsteigen. Wie lernen Schulanfänger Schreiben?
Fünf Leitfragen. Schulisches Versagen und gesellschaftliches Problem. oder Medienhype? (1) Ist Rechtschreibung (heute noch) wichtig?
 Schulisches Versagen und gesellschaftliches Problem oder Medienhype? Fünf Leitfragen 1. Ist Rechtschreibung (heute noch) wichtig? 2. Wie schlecht sind die schriftsprachlichen* Leistungen heute tatsächlich?
Schulisches Versagen und gesellschaftliches Problem oder Medienhype? Fünf Leitfragen 1. Ist Rechtschreibung (heute noch) wichtig? 2. Wie schlecht sind die schriftsprachlichen* Leistungen heute tatsächlich?
Kinder lernen Lesen und Schreiben: Wie man diesen Denkentwicklungsprozess verstehen und fördern f
 Kinder lernen Lesen und Schreiben: Wie man diesen Denkentwicklungsprozess verstehen und fördern f kann Erika Brinkmann & Hans Brügelmann Schreibenlernen ist eine Denkentwicklung 1. Einsicht: Schreiben
Kinder lernen Lesen und Schreiben: Wie man diesen Denkentwicklungsprozess verstehen und fördern f kann Erika Brinkmann & Hans Brügelmann Schreibenlernen ist eine Denkentwicklung 1. Einsicht: Schreiben
Inhaltsverzeichnis 1 Wie fing alles an? Von den Anfängen der Schriftsprache bis zu den ersten Ansätzen des formalen Lese- und Schreibunterrichts
 Inhaltsverzeichnis 1 Wie fing alles an? Von den Anfängen der Schriftsprache bis zu den ersten Ansätzen des formalen Lese- und Schreibunterrichts... 1 1.1 Wie entwickelte sich die Schriftsprache von der
Inhaltsverzeichnis 1 Wie fing alles an? Von den Anfängen der Schriftsprache bis zu den ersten Ansätzen des formalen Lese- und Schreibunterrichts... 1 1.1 Wie entwickelte sich die Schriftsprache von der
Konzeptionelle Grundlagen und methodische Hilfen für den Rechtschreibunterricht
 Konzeptionelle Grundlagen und methodische Hilfen für den Rechtschreibunterricht Schreiben lernen, Schreiblernmethoden und Rechtschreiben lernen in der Grundschule Erika Brinkmann in Zusammenarbeit mit
Konzeptionelle Grundlagen und methodische Hilfen für den Rechtschreibunterricht Schreiben lernen, Schreiblernmethoden und Rechtschreiben lernen in der Grundschule Erika Brinkmann in Zusammenarbeit mit
Wir sind alle Legastheniker manchmal
 Wir sind alle Legastheniker manchmal Rechtschreibfehler als Anzeichen von Lernschwierigkeiten und Lernfortschritten? Hans Brügelmann (Universität Siegen) Eveline (I) Die fünfjährige Eveline muss sich jeden
Wir sind alle Legastheniker manchmal Rechtschreibfehler als Anzeichen von Lernschwierigkeiten und Lernfortschritten? Hans Brügelmann (Universität Siegen) Eveline (I) Die fünfjährige Eveline muss sich jeden
ENTWICKLUNG SCHRIFTSPRACHLICHER KOMPETENZEN IM ANFANGSUNTERRICHT
 ENTWICKLUNG SCHRIFTSPRACHLICHER KOMPETENZEN IM ANFANGSUNTERRICHT von Eva-Maria Kirschhock KLINKHARDT 2004 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN/OBB. Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Problemaufriss 13 2 Schriftsprache
ENTWICKLUNG SCHRIFTSPRACHLICHER KOMPETENZEN IM ANFANGSUNTERRICHT von Eva-Maria Kirschhock KLINKHARDT 2004 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN/OBB. Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Problemaufriss 13 2 Schriftsprache
INHALTSVERZEICHNIS 1 PROBLEMAUFRISS 1 2 SCHRIFTSPRACHE UND MODELLE IHRES ERWERBS 3
 I INHALTSVERZEICHNIS 1 PROBLEMAUFRISS 1 2 SCHRIFTSPRACHE UND MODELLE IHRES ERWERBS 3 2.1 Linguistische Grundlagen 3 2.1.1 Schriftspracherwerb: Unterschiedliche Bedeutungsakzente 3 2.1.2 Mündliche Sprache
I INHALTSVERZEICHNIS 1 PROBLEMAUFRISS 1 2 SCHRIFTSPRACHE UND MODELLE IHRES ERWERBS 3 2.1 Linguistische Grundlagen 3 2.1.1 Schriftspracherwerb: Unterschiedliche Bedeutungsakzente 3 2.1.2 Mündliche Sprache
Wie wirken verschiedene Methoden des Rechtschreibunterrichts?
 Hans Brügelmann Wie wirken verschiedene Methoden des Rechtschreibunterrichts? In dieser überarbeiteten Fassung eines früheren Beitrags (Brügelmann 2013) werden Befunde aus empirischen Untersuchungen zu
Hans Brügelmann Wie wirken verschiedene Methoden des Rechtschreibunterrichts? In dieser überarbeiteten Fassung eines früheren Beitrags (Brügelmann 2013) werden Befunde aus empirischen Untersuchungen zu
Vorstellung eines Diagnosewerkes im Fachseminar Deutsch - Die Ideen-Kiste 1 von Brinkmann, E. / Brügelmann, H.
 Seminar für das Lehramt für Sonderpädagogik Hamm Fachseminar Deutsch Fachleiterin: Frau Belch Verfasserin: Anna-Katharina Otremba Datum: 16.01.2008 Vorstellung eines Diagnosewerkes im Fachseminar Deutsch
Seminar für das Lehramt für Sonderpädagogik Hamm Fachseminar Deutsch Fachleiterin: Frau Belch Verfasserin: Anna-Katharina Otremba Datum: 16.01.2008 Vorstellung eines Diagnosewerkes im Fachseminar Deutsch
LUST-2: Teil II. Der Siegener Satzlese-Test. Intention, Aufbau und erste Befunde. Fragen für die Untersuchung mit dem differenzierten Test
 LUST-2: Teil II Der Siegener Satzlese-Test Intention, Aufbau und erste Befunde Fragen für die Untersuchung mit dem differenzierten Test Gibt es unter den erfolgreichen LeserInnen so etwas wie die normale
LUST-2: Teil II Der Siegener Satzlese-Test Intention, Aufbau und erste Befunde Fragen für die Untersuchung mit dem differenzierten Test Gibt es unter den erfolgreichen LeserInnen so etwas wie die normale
Rechtschreibkönnen: Teil der schrittweisen Aneignung von Schriftsprache
 Rechtschreibkönnen: Teil der schrittweisen Aneignung von Schriftsprache Stellungnahme zur Anhörung im Schulausschuss des Landtags NRW von Prof. Dr. Hans Brügelmann 16 STELLUNGNAHME 16/1634 A15 Die aktuelle
Rechtschreibkönnen: Teil der schrittweisen Aneignung von Schriftsprache Stellungnahme zur Anhörung im Schulausschuss des Landtags NRW von Prof. Dr. Hans Brügelmann 16 STELLUNGNAHME 16/1634 A15 Die aktuelle
Lernstandsdiagnose im Richtig schreiben
 Das Erlernen des Richtig schreibens ist ein langer Prozess, der auch am Ende der Grundschulzeit nicht abgeschlossen ist. Auf dem Weg zum normgerechten Schreiben durchläuft ein Kind verschiedene Stufen
Das Erlernen des Richtig schreibens ist ein langer Prozess, der auch am Ende der Grundschulzeit nicht abgeschlossen ist. Auf dem Weg zum normgerechten Schreiben durchläuft ein Kind verschiedene Stufen
Schriftspracherwerb in der Zweitsprache
 Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Eine qualitative Längsschnittstudie von Tabea Becker 1. Auflage Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Becker schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Eine qualitative Längsschnittstudie von Tabea Becker 1. Auflage Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Becker schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Gerät Baden-Württemberg ins Abseits?
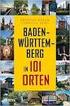 Rechtschreibunterricht Gerät Baden-Württemberg ins Abseits? Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann hat in einem Ende des Jahres versandten Rundschreiben die Grundschulen aufgefordert,
Rechtschreibunterricht Gerät Baden-Württemberg ins Abseits? Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann hat in einem Ende des Jahres versandten Rundschreiben die Grundschulen aufgefordert,
Grundschule Hoheluft. Kinder auf dem Weg zur Schrift
 Grundschule Hoheluft Kinder auf dem Weg zur Schrift Erstlesen und -schreiben Lesen und Schreiben setzen sich aus einem Bündel von Teilfertigkeiten zusammen. Der Erwerb einiger dieser Teilfertigkeiten beginnt
Grundschule Hoheluft Kinder auf dem Weg zur Schrift Erstlesen und -schreiben Lesen und Schreiben setzen sich aus einem Bündel von Teilfertigkeiten zusammen. Der Erwerb einiger dieser Teilfertigkeiten beginnt
Lese- & Rechtschreibschwäche. Ursachen & Lösungen
 Lese- & Rechtschreibschwäche Ursachen & Lösungen Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Was ist das? LRS wird als Beeinträchtigung der Lese- und Schreibfähigkeiten
Lese- & Rechtschreibschwäche Ursachen & Lösungen Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Was ist das? LRS wird als Beeinträchtigung der Lese- und Schreibfähigkeiten
Rotstift oder Didaktik? ROTSTIFT ODER DIDAKTIK? WIE KINDER RECHT SCHREIBEN LERNEN. TiGA
 ROTSTIFT ODER DIDAKTIK? WIE KINDER RECHT SCHREIBEN LERNEN TiGA Prof. Dr. Erika Brinkmann FORUM Unterrichtspraxis DIDACTA Hannover 2018 Donnerstag, 22. Februar 2018 12.00 13.00 Uhr Grundschulverband Rotstift
ROTSTIFT ODER DIDAKTIK? WIE KINDER RECHT SCHREIBEN LERNEN TiGA Prof. Dr. Erika Brinkmann FORUM Unterrichtspraxis DIDACTA Hannover 2018 Donnerstag, 22. Februar 2018 12.00 13.00 Uhr Grundschulverband Rotstift
Erste Ergebnisse aus IGLU
 Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Gerd Walther, Renate Valtin (Hrsg.) Erste Ergebnisse aus IGLU Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich
Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Gerd Walther, Renate Valtin (Hrsg.) Erste Ergebnisse aus IGLU Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich
Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Sekundarstufe I
 Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Sekundarstufe I Ferdinand Eder Universität Salzburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft Mathematik-Kompetenz Mathematik-Kompetenz ist
Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Sekundarstufe I Ferdinand Eder Universität Salzburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft Mathematik-Kompetenz Mathematik-Kompetenz ist
Projekt. Schriftspracherwerb von Grundschulkindern nichtdeutscher Herkunftssprache. Presseinformation
 A Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie Arbeitsbereich Empirische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Hans Merkens Telefon: 3-838 55224 Fax: 3-838 54796 merken@zedat.fu-berlin.de Projekt Schriftspracherwerb
A Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie Arbeitsbereich Empirische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Hans Merkens Telefon: 3-838 55224 Fax: 3-838 54796 merken@zedat.fu-berlin.de Projekt Schriftspracherwerb
Ministerium für Schule und Weiterbildung. Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2008
 Ministerium für Schule und Weiterbildung Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2008 Am 6. und 8. Mai 2008 wurden in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal in den dritten Klassen der Grundschulen
Ministerium für Schule und Weiterbildung Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2008 Am 6. und 8. Mai 2008 wurden in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal in den dritten Klassen der Grundschulen
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie
 Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Inhalt. Vorwort zur dritten Auflage 13 Vorwort zur ersten Auflage 17 Einleitung 20. Erster Abschnitt - Der geübte Leser und der geübte Schreiber
 Inhalt Vorwort zur dritten Auflage 13 Vorwort zur ersten Auflage 17 Einleitung 20 Erster Abschnitt - Der geübte Leser und der geübte Schreiber 1 Die Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens... 23 1.1
Inhalt Vorwort zur dritten Auflage 13 Vorwort zur ersten Auflage 17 Einleitung 20 Erster Abschnitt - Der geübte Leser und der geübte Schreiber 1 Die Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens... 23 1.1
Wie viel Rechtschreibung brauchen Grundschulkinder?
 Norbert Kruse Anke Reichardt (Hg.) Wie viel Rechtschreibung brauchen Grundschulkinder? Positionen und Perspektiven zum Rechtschreibunterricht in der Grundschule I Positionen Beate Leßmann Rechtschreibung
Norbert Kruse Anke Reichardt (Hg.) Wie viel Rechtschreibung brauchen Grundschulkinder? Positionen und Perspektiven zum Rechtschreibunterricht in der Grundschule I Positionen Beate Leßmann Rechtschreibung
Die Not mit den Noten. Das Problem. Vortrag von Hans Brügelmann (Fachreferent im Grundschulverband) am 29.4.
 Was bedeuten diese Noten? Die Not mit den Noten Chancen für eine pädagogische Lern- Leistungskultur Vortrag von Hans Brügelmann (Fachreferent im Grschulverband) am 29.4.2015 in Verden Die Beibehaltung
Was bedeuten diese Noten? Die Not mit den Noten Chancen für eine pädagogische Lern- Leistungskultur Vortrag von Hans Brügelmann (Fachreferent im Grschulverband) am 29.4.2015 in Verden Die Beibehaltung
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Lernbegleitende Diagnostik im Bereich Deutsch - Schreiben. Jutta Schwenke
 Lernbegleitende Diagnostik im Bereich Deutsch - Schreiben Jutta Schwenke 15.05.12 Wenn Kinder schreiben, brauchen sie eine Didaktik des Lernenlassens. Eine solche Didaktik erfordert Lehrerinnen und Lehrer,
Lernbegleitende Diagnostik im Bereich Deutsch - Schreiben Jutta Schwenke 15.05.12 Wenn Kinder schreiben, brauchen sie eine Didaktik des Lernenlassens. Eine solche Didaktik erfordert Lehrerinnen und Lehrer,
Schweizer MINT Studie: Vorbereitung auf zukünftiges Lernen. Naturwissenschaftliches Denken ab der Primarschule fördern
 DAS -LERNZENTRUM DER ETH ZÜRICH Schweizer MINT Studie: Vorbereitung auf zukünftiges Lernen Naturwissenschaftliches Denken ab der Primarschule fördern Ralph Schumacher & Elsbeth Stern, ETH Zürich Mai 2018
DAS -LERNZENTRUM DER ETH ZÜRICH Schweizer MINT Studie: Vorbereitung auf zukünftiges Lernen Naturwissenschaftliches Denken ab der Primarschule fördern Ralph Schumacher & Elsbeth Stern, ETH Zürich Mai 2018
Didaktik der Arithmetik Klasse 1-3 SS 2009 Hans-Dieter Rinkens
 Didaktik der Arithmetik Klasse 1-3 SS 2009 Hans-Dieter Rinkens Inhalt Lehrplan Mathematik für die Grundschule des Landes NRW Arithmetische Vorkenntnisse am Schulanfang Zahlaspekte, Zählen, Zahlzeichen
Didaktik der Arithmetik Klasse 1-3 SS 2009 Hans-Dieter Rinkens Inhalt Lehrplan Mathematik für die Grundschule des Landes NRW Arithmetische Vorkenntnisse am Schulanfang Zahlaspekte, Zählen, Zahlzeichen
Kompensation von LS bei Kindern mit überwundenen USES, die phonologische Ebene betreffen
 Kompensation von LS bei Kindern mit überwundenen USES, die phonologische Ebene betreffen Carola D. Schnitzler, MSc (GB) Humanwissenschaftliche Fakultät Profilbereich Bildungswissenschaften Grundschulpädagogik
Kompensation von LS bei Kindern mit überwundenen USES, die phonologische Ebene betreffen Carola D. Schnitzler, MSc (GB) Humanwissenschaftliche Fakultät Profilbereich Bildungswissenschaften Grundschulpädagogik
Rechtschreibung, Rechtschreibförderung, Rechtschreiblernen im Anfangsunterricht 1. Anmerkungen zu dem Statement von Ursula Bredel für die Anhörung
 Hans Brügelmann Erika Brinkmann Rechtschreibung, Rechtschreibförderung, Rechtschreiblernen im Anfangsunterricht 1 Anmerkungen zu dem Statement von Ursula Bredel für die Anhörung vor dem Schulausschuss
Hans Brügelmann Erika Brinkmann Rechtschreibung, Rechtschreibförderung, Rechtschreiblernen im Anfangsunterricht 1 Anmerkungen zu dem Statement von Ursula Bredel für die Anhörung vor dem Schulausschuss
Musterseite. Lernstandsbeobachtungen zu den Schwingschreibblättern K2 und K4 und der Schwingkartei
 Lernstandsbeobachtungen Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache sind schon sehr frühzeitig in Klasse 1 zu erkennen. In der LRS-Förderung gewinnen deshalb präventive Ansätze zunehmend an Bedeutung.
Lernstandsbeobachtungen Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache sind schon sehr frühzeitig in Klasse 1 zu erkennen. In der LRS-Förderung gewinnen deshalb präventive Ansätze zunehmend an Bedeutung.
Lernbeobachtung in Klasse 1 Anspruchsvolle Förderkonzepte
 Lernbeobachtung in Klasse 1 Anspruchsvolle Förderkonzepte Lernentwicklung von Jan-Carlos Rolle der Lehrerin Funktion von Förderdiagnostik und Lernbeobachtung für lernwirksamen Unterricht Schulanfangsbeobachtung:
Lernbeobachtung in Klasse 1 Anspruchsvolle Förderkonzepte Lernentwicklung von Jan-Carlos Rolle der Lehrerin Funktion von Förderdiagnostik und Lernbeobachtung für lernwirksamen Unterricht Schulanfangsbeobachtung:
AKTUELLE FORSCHUNGS- ERGEBNISSE ZUR LRS
 AKTUELLE FORSCHUNGS- ERGEBNISSE ZUR LRS Kristina Moll Kinder- und Jugendpsychiatrie LMU Klinikum München 02.02.2019 Interdisziplinäre Fachtagung zur Lese- und Rechtschreibstörung ICD-10 (F81.0): LRS Das
AKTUELLE FORSCHUNGS- ERGEBNISSE ZUR LRS Kristina Moll Kinder- und Jugendpsychiatrie LMU Klinikum München 02.02.2019 Interdisziplinäre Fachtagung zur Lese- und Rechtschreibstörung ICD-10 (F81.0): LRS Das
Homogene Lerngruppen: eine didaktische Fiktion und pädagogische Sackgasse
 Homogene Lerngruppen: eine didaktische Fiktion und pädagogische Sackgasse Beitrag von Hans Brügelmann zur Fachtagung Längeres gemeinsames Lernen am 5.2.2010 in Köln Inklusion: jeder ist anders, und das
Homogene Lerngruppen: eine didaktische Fiktion und pädagogische Sackgasse Beitrag von Hans Brügelmann zur Fachtagung Längeres gemeinsames Lernen am 5.2.2010 in Köln Inklusion: jeder ist anders, und das
Inhalt. Vorwort 11. Wie erkenne ich, ob ein Kind eine Legasthenie hat?.. 13 Die Begriffe Lese-Rechtschreib-Störung und Legasthenie 25
 Inhalt Vorwort 11 Wie erkenne ich, ob ein Kind eine Legasthenie hat?.. 13 Die Begriffe Lese-Rechtschreib-Störung und Legasthenie 25 Faktoren, die den Lese-Rechtschreib-Erwerb fördern. 31 Entwicklung im
Inhalt Vorwort 11 Wie erkenne ich, ob ein Kind eine Legasthenie hat?.. 13 Die Begriffe Lese-Rechtschreib-Störung und Legasthenie 25 Faktoren, die den Lese-Rechtschreib-Erwerb fördern. 31 Entwicklung im
Kommentierte Linkliste zu LRS-Diagnostik und -Förderung
 Anlage 7 Kommentierte Linkliste zu LRS-Diagnostik und -Förderung In Bezug auf Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten gibt es einen gesonderten Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen
Anlage 7 Kommentierte Linkliste zu LRS-Diagnostik und -Förderung In Bezug auf Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten gibt es einen gesonderten Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen
Legasthenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung. Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera
 Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera Legasthenie - LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung Unter Mitarbeit von Barbara Schmidt 4., aktualisierte Auflage Mit 22 Abbildungen
Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera Legasthenie - LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung Unter Mitarbeit von Barbara Schmidt 4., aktualisierte Auflage Mit 22 Abbildungen
Lese-Rechtschreibschwäche im Schulalltag
 Selma-Maria Behrndt Martina Steffen (Hrsg.) Lese-Rechtschreibschwäche im Schulalltag PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Einleitung 15 I. Teil: Interdisziplinäre
Selma-Maria Behrndt Martina Steffen (Hrsg.) Lese-Rechtschreibschwäche im Schulalltag PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Einleitung 15 I. Teil: Interdisziplinäre
Hamburger Schreib-Probe
 Hamburger Schreib-Probe Wissenschaftlich fundierter Test zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz von Klasse 1 bis 10 Hamburger Schreib-Probe (HSP) Wissenschaftlich fundierter Test zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz
Hamburger Schreib-Probe Wissenschaftlich fundierter Test zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz von Klasse 1 bis 10 Hamburger Schreib-Probe (HSP) Wissenschaftlich fundierter Test zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz
Inhalt. Vorwort. 3 Definition der Lese-Rechtschreibstörung
 Inhalt Vorwort 1 Das deutsche Schriftsystem 13 1.1 Unterschiedliche Schriftsysteme 13 Die deutsche Orthographie 17 1.2.1 Das Grapheminventar des Deutschen 17 1.22 Prinzipien der deutschen Orthographie
Inhalt Vorwort 1 Das deutsche Schriftsystem 13 1.1 Unterschiedliche Schriftsysteme 13 Die deutsche Orthographie 17 1.2.1 Das Grapheminventar des Deutschen 17 1.22 Prinzipien der deutschen Orthographie
Ministerium für Schule und Weiterbildung. Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2009
 Ministerium für Schule und Weiterbildung Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2009 4. September 2009 Am 12. und 14. Mai 2009 wurden in Nordrhein-Westfalen zum dritten Mal in den dritten
Ministerium für Schule und Weiterbildung Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2009 4. September 2009 Am 12. und 14. Mai 2009 wurden in Nordrhein-Westfalen zum dritten Mal in den dritten
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW. Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA) für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA) für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 20.12. Am 27. und 29. September wurden in Nordrhein-Westfalen zum
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA) für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 20.12. Am 27. und 29. September wurden in Nordrhein-Westfalen zum
1. Von der herkömmlichen psychologisch-pädagogischen Diagnostik zur Förderdiagnostik 23
 Inhalt Vorwort 15 Einleitung 17 Förderdiagnostik - Versuch einer Begriffsklärung und Konkretisierung für den Praxisalltag 21 1. Von der herkömmlichen psychologisch-pädagogischen Diagnostik zur Förderdiagnostik
Inhalt Vorwort 15 Einleitung 17 Förderdiagnostik - Versuch einer Begriffsklärung und Konkretisierung für den Praxisalltag 21 1. Von der herkömmlichen psychologisch-pädagogischen Diagnostik zur Förderdiagnostik
1. Wie lernen Kinder Rechtschreiben
 Rechtschreibkonzept 1. Wie lernen Kinder Rechtschreiben Die logographemische Phase Die alphabetische (phonetische) Phase Die orthographische Phase Die morphematische Stufe Die wortübergreifende Stufe 2.
Rechtschreibkonzept 1. Wie lernen Kinder Rechtschreiben Die logographemische Phase Die alphabetische (phonetische) Phase Die orthographische Phase Die morphematische Stufe Die wortübergreifende Stufe 2.
RCAE Research Center for Applied Education. Lernfortschrittsblatt SCHREIBEN. Begleitdokument
 RCAE Research Center for Applied Education Lernfortschrittsblatt SCHREIBEN Begleitdokument Lernfortschrittsblatt Schreiben RCAE Research Center for Applied Education GmbH Khevenhüllerstraße 9 Klagenfurt
RCAE Research Center for Applied Education Lernfortschrittsblatt SCHREIBEN Begleitdokument Lernfortschrittsblatt Schreiben RCAE Research Center for Applied Education GmbH Khevenhüllerstraße 9 Klagenfurt
n Marianne Wilhelm Konrad Kregcjk B E H T N H
 Konrad Kregcjk n Marianne Wilhelm H T S B B E U C A N H B UC 1 Das Buchstabenbuch Sie halten nun das Buchstabenbuch zu DEUTSCH MIT PFIFF 1 in den Händen. Das Buchstabenbuch fördert wichtige Basiskompetenzen
Konrad Kregcjk n Marianne Wilhelm H T S B B E U C A N H B UC 1 Das Buchstabenbuch Sie halten nun das Buchstabenbuch zu DEUTSCH MIT PFIFF 1 in den Händen. Das Buchstabenbuch fördert wichtige Basiskompetenzen
Rechtschreibförderung. auf Grundlage der HSP
 Rechtschreibförderung auf Grundlage der HSP Umsetzung im Unterricht 1. Erstellen einer alphabetischen Klassenliste 2. Sortieren nach Leistung 3. Erstellung von Strategieprofilen Die Testergebnisse der
Rechtschreibförderung auf Grundlage der HSP Umsetzung im Unterricht 1. Erstellen einer alphabetischen Klassenliste 2. Sortieren nach Leistung 3. Erstellung von Strategieprofilen Die Testergebnisse der
LUST-2: Fragestellungen und Design
 s:lust2.03.fragen und design/ 07-28 / 07-23 Axel Backhaus, Erika Brinkmann, Hans Brügelmann, Andrea Steck, Manfred Wespel LUST-2: Fragestellungen und Design Das Projekt LUST-2 wird kooperativ durchgeführt
s:lust2.03.fragen und design/ 07-28 / 07-23 Axel Backhaus, Erika Brinkmann, Hans Brügelmann, Andrea Steck, Manfred Wespel LUST-2: Fragestellungen und Design Das Projekt LUST-2 wird kooperativ durchgeführt
Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich
 www.ifs.tu-dortmund.de Office.mcelvany@fk12.tu-dortmund.de Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich Hintergrund Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern
www.ifs.tu-dortmund.de Office.mcelvany@fk12.tu-dortmund.de Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich Hintergrund Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern
Lernstrategien in der Grundschule Wo sind die Defizite im Unterricht der Grundschule?
 Hans Merkens Lernstrategien in der Grundschule Wo sind die Defizite im Unterricht der Grundschule? Arbeitsbereich Empirische Erziehungswissenschaft Vortrag 22.11.2006 in Wünsdorf Spracherwerb in der Grundschule
Hans Merkens Lernstrategien in der Grundschule Wo sind die Defizite im Unterricht der Grundschule? Arbeitsbereich Empirische Erziehungswissenschaft Vortrag 22.11.2006 in Wünsdorf Spracherwerb in der Grundschule
KESS 4 - Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger Grundschulen
 Wilfried Bos, Marcus Pietsch (Hrsg.) KESS 4 - Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger Grundschulen Waxmann Münster / New York München / Berlin
Wilfried Bos, Marcus Pietsch (Hrsg.) KESS 4 - Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger Grundschulen Waxmann Münster / New York München / Berlin
LeFiS-Lernförderung in Schulen - Evaluation eines Modellprojekts zur schulinternen Lerntherapie für Kinder mit Lese-& Rechtschreibschwierigkeiten
 LeFiS-Lernförderung in Schulen - Evaluation eines Modellprojekts zur schulinternen Lerntherapie für Kinder mit Lese-& Rechtschreibschwierigkeiten Claudia Mähler, Christina Balke-Melcher, Kirsten Schuchardt
LeFiS-Lernförderung in Schulen - Evaluation eines Modellprojekts zur schulinternen Lerntherapie für Kinder mit Lese-& Rechtschreibschwierigkeiten Claudia Mähler, Christina Balke-Melcher, Kirsten Schuchardt
Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Renate Valtin, Gerd Walther (Hrsg.) IGLU
 Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Renate Valtin, Gerd Walther (Hrsg.) IGLU Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich Waxmann
Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Renate Valtin, Gerd Walther (Hrsg.) IGLU Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich Waxmann
Vierte Rückmeldung der Praxispartner. Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre
 Konsortium Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre Prof. Dr. Roland Merten / Thomas Buchholz, M.A. Jena, 14.06.07 Vierte Rückmeldung der Praxispartner Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre
Konsortium Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre Prof. Dr. Roland Merten / Thomas Buchholz, M.A. Jena, 14.06.07 Vierte Rückmeldung der Praxispartner Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre
ILeA SCHÜLERHEFT. Deutsch, Mathematik. Name: Individuelle Lernstandsanalysen. Wissenschaftliche Mitarbeit
 ILeA Individuelle Lernstandsanalysen SCHÜLERHEFT Deutsch, Mathematik 1 Name: Wissenschaftliche Mitarbeit Aufgabenblatt 1: Leeres Blatt Schriftspracherwerb 3 Aufgabenblatt 3a: Erkennen von Reimwörtern
ILeA Individuelle Lernstandsanalysen SCHÜLERHEFT Deutsch, Mathematik 1 Name: Wissenschaftliche Mitarbeit Aufgabenblatt 1: Leeres Blatt Schriftspracherwerb 3 Aufgabenblatt 3a: Erkennen von Reimwörtern
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation )
 Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse
 Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Leistungskonzept Deutsch Grundschule Sonnenhügel Stufe 1 / 2 Schuleingangsphase
 Leistungskonzept Deutsch Grundschule Sonnenhügel Stufe 1 / 2 Schuleingangsphase 1. Inhalte/ Kriterien der Leistungsmessung nach Lehrplan Bereich: Sprechen und zuhören verstehend zuhören Gespräche führen
Leistungskonzept Deutsch Grundschule Sonnenhügel Stufe 1 / 2 Schuleingangsphase 1. Inhalte/ Kriterien der Leistungsmessung nach Lehrplan Bereich: Sprechen und zuhören verstehend zuhören Gespräche führen
Lese-Rechtschreibprobleme. bei Grundschulkindern
 mit Audio-CD Alexandra von Plüskow Lese-Rechtschreibprobleme bei Grundschulkindern Ihr Kind auf dem Weg zur Schriftsprache Vorschulische Förderung 3 Die Schriftsprache erwirbt Ihr Kind in verschiedenen
mit Audio-CD Alexandra von Plüskow Lese-Rechtschreibprobleme bei Grundschulkindern Ihr Kind auf dem Weg zur Schriftsprache Vorschulische Förderung 3 Die Schriftsprache erwirbt Ihr Kind in verschiedenen
Leseuntersuchung mit dem Stolperwörtertest
 PROJEKT LUST - Siegen Leseuntersuchung mit dem Stolperwörtertest Erste Ergebnisse aus einer Längsschnittuntersuchung im Satzlesen und Textverstehen - Vorstellung des Projekts LUST 1 PROJEKT LUST - Siegen
PROJEKT LUST - Siegen Leseuntersuchung mit dem Stolperwörtertest Erste Ergebnisse aus einer Längsschnittuntersuchung im Satzlesen und Textverstehen - Vorstellung des Projekts LUST 1 PROJEKT LUST - Siegen
1. Einleitende Überlegungen zur aktuellen Diskussion der Didaktik des Lese- und Schreibunterrichts
 Vorwort xiü 1. Einleitende Überlegungen zur aktuellen Diskussion der Didaktik des Lese- und Schreibunterrichts I 1.1. Zur Fundierung der folgenden Diskussion: Belege für Unterschiede in der Wahrnehmung
Vorwort xiü 1. Einleitende Überlegungen zur aktuellen Diskussion der Didaktik des Lese- und Schreibunterrichts I 1.1. Zur Fundierung der folgenden Diskussion: Belege für Unterschiede in der Wahrnehmung
Leistungskonzept Deutsch Grundschule Sonnenhügel Stufe 1/ 2
 Leistungskonzept Deutsch Grundschule Sonnenhügel Stufe 1/ 2 1. Inhalte/ Kriterien der Leistungsmessung nach Lehrplan Bereich: Sprechen und zuhören verstehend zuhören Gespräche führen zu anderen sprechen
Leistungskonzept Deutsch Grundschule Sonnenhügel Stufe 1/ 2 1. Inhalte/ Kriterien der Leistungsmessung nach Lehrplan Bereich: Sprechen und zuhören verstehend zuhören Gespräche führen zu anderen sprechen
Jeanette Roos Hermann Schöler (Hrsg.) Entwicklung des Schriftspracherwerbs in der Grundschule
 Jeanette Roos Hermann Schöler (Hrsg.) Entwicklung des Schriftspracherwerbs in der Grundschule Jeanette Roos Hermann Schöler (Hrsg.) Entwicklung des Schriftspracherwerbs in der Grundschule Längsschnittanalyse
Jeanette Roos Hermann Schöler (Hrsg.) Entwicklung des Schriftspracherwerbs in der Grundschule Jeanette Roos Hermann Schöler (Hrsg.) Entwicklung des Schriftspracherwerbs in der Grundschule Längsschnittanalyse
Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)
 Andreas Mayer Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) Mit einem Beitrag von Sven Lindberg Mit 32 Abbildungen und 14 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Andreas Mayer, Sprachheilpädagoge, hat
Andreas Mayer Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) Mit einem Beitrag von Sven Lindberg Mit 32 Abbildungen und 14 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Andreas Mayer, Sprachheilpädagoge, hat
Dr. Ilona Löffler Christiane Meckel. Mindeststandards Rechtschreibkompetenz für die 1. und 2. Klasse
 Dr. Ilona Löffler Christiane Meckel Mindeststandards Rechtschreibkompetenz für die 1. und 2. Klasse Mindeststandards Rechtschreibkompetenz für die 1. und 2. Klasse Netzwerkprojekt Frühwarnsystem Rechtschreibschwächen
Dr. Ilona Löffler Christiane Meckel Mindeststandards Rechtschreibkompetenz für die 1. und 2. Klasse Mindeststandards Rechtschreibkompetenz für die 1. und 2. Klasse Netzwerkprojekt Frühwarnsystem Rechtschreibschwächen
Bericht zur Auswertung der zentralen Deutscharbeit aus dem Schuljahr 2006/2007
 1 Referat 32 August 2007 Bericht zur Auswertung der zentralen Deutscharbeit aus dem Schuljahr 2006/2007 Inhalt Vorbemerkung 1. Konzeption der Deutscharbeit 2. Landesergebnisse 2.1 Beschreibung der Stichprobe
1 Referat 32 August 2007 Bericht zur Auswertung der zentralen Deutscharbeit aus dem Schuljahr 2006/2007 Inhalt Vorbemerkung 1. Konzeption der Deutscharbeit 2. Landesergebnisse 2.1 Beschreibung der Stichprobe
Freie und Hansestadt Hamburg Pressestelle des Senats
 Freie und Hansestadt Hamburg Pressestelle des Senats 27. April 2007 / bbs SCHULE Hamburgs Fünft- und Sechstklässler schreiben besser Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierig stellte ausgewählte Ergebnisse
Freie und Hansestadt Hamburg Pressestelle des Senats 27. April 2007 / bbs SCHULE Hamburgs Fünft- und Sechstklässler schreiben besser Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierig stellte ausgewählte Ergebnisse
Professionelle Entwicklungsberichte und Beschreibung der Lernausgangslage am PC erstellen
 Professionelle Entwicklungsberichte und Beschreibung der Lernausgangslage am PC erstellen Fertige Textbausteine für Kindergarten und Grundschule auf CD-ROM von Petra Ahrens Grundwerk mit Ergänzungslieferungen
Professionelle Entwicklungsberichte und Beschreibung der Lernausgangslage am PC erstellen Fertige Textbausteine für Kindergarten und Grundschule auf CD-ROM von Petra Ahrens Grundwerk mit Ergänzungslieferungen
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Inhaltsverzeichnis. I Zentrale Aspekte des Anfangsunterrichts Vorwort... 11
 Vorwort... 11 I Zentrale Aspekte des Anfangsunterrichts... 17 Lernen fördern................................ 19 Bodo Hartke 1 Einführung................................. 19 2 Lernen und Gedächtnis..........................
Vorwort... 11 I Zentrale Aspekte des Anfangsunterrichts... 17 Lernen fördern................................ 19 Bodo Hartke 1 Einführung................................. 19 2 Lernen und Gedächtnis..........................
Lesen- und Schreibenlernens. Erika Brinkmann & Hans Brügelmann
 Vier Säulen S des Lesen- und Schreibenlernens Erika Brinkmann & Hans Brügelmann Freies Schreiben eigener Texte Grundbedingung: regelmäß äßige freie Schreibzeiten Kinder stempeln Bilder und schreiben Wörter
Vier Säulen S des Lesen- und Schreibenlernens Erika Brinkmann & Hans Brügelmann Freies Schreiben eigener Texte Grundbedingung: regelmäß äßige freie Schreibzeiten Kinder stempeln Bilder und schreiben Wörter
Pressemitteilung Berlin, 11. Dezember 2012
 Pressemitteilung Berlin, 11. Dezember 2012 Deutschlands Grundschülerinnen und Grundschüler im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften im internationalen Vergleich weiterhin im oberen Drittel
Pressemitteilung Berlin, 11. Dezember 2012 Deutschlands Grundschülerinnen und Grundschüler im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften im internationalen Vergleich weiterhin im oberen Drittel
BESONDERE BILDUNGSBEDÜRFNISSE SCHRITT FÜR SCHRITT GEMEINSAM GEHEN
 BESONDERE BILDUNGSBEDÜRFNISSE SCHRITT FÜR SCHRITT GEMEINSAM GEHEN BEZIRKSFORTBILDUNG BEZIRK PUSTERTAL Informationen und Anmeldungen: www.schulverbund-pustertal.it Treffen der Koordinatorinnen und Koordinatoren
BESONDERE BILDUNGSBEDÜRFNISSE SCHRITT FÜR SCHRITT GEMEINSAM GEHEN BEZIRKSFORTBILDUNG BEZIRK PUSTERTAL Informationen und Anmeldungen: www.schulverbund-pustertal.it Treffen der Koordinatorinnen und Koordinatoren
Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept
 Pilotstudie Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept Theoretischer Hintergrund: Hören, Sehen, richtiges Sprechen, aber auch gute fein- und grobmotorische Fertigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen
Pilotstudie Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept Theoretischer Hintergrund: Hören, Sehen, richtiges Sprechen, aber auch gute fein- und grobmotorische Fertigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen
Senat benachteiligt die Stadtteilschulen bei der Versorgung mit Fachlehrkräften
 Senat benachteiligt die n bei der Versorgung mit Fachlehrkräften Immer wieder hat der SPD-Senat versprochen, er wolle die n zu einer attraktiven Schulform ausbauen und zu einem Erfolgsmodell machen (so
Senat benachteiligt die n bei der Versorgung mit Fachlehrkräften Immer wieder hat der SPD-Senat versprochen, er wolle die n zu einer attraktiven Schulform ausbauen und zu einem Erfolgsmodell machen (so
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Passendes Wortmaterial (Minimalpaare, wie z. B. Riese Risse, siehe Arbeitsauftrag) Kompetenzerwartungen
Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Passendes Wortmaterial (Minimalpaare, wie z. B. Riese Risse, siehe Arbeitsauftrag) Kompetenzerwartungen
Inhaltsverzeichnis. I Zentrale Aspekte des Anfangsunterrichts 17. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I Zentrale Aspekte des Anfangsunterrichts 17 Lernen fördern 19 Bodo Hartke 1 Einführung 19 2 Lernen und Gedächtnis 20 3 Zur Entwicklung von Wissen 24 4 Erkennen von besonderem
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 I Zentrale Aspekte des Anfangsunterrichts 17 Lernen fördern 19 Bodo Hartke 1 Einführung 19 2 Lernen und Gedächtnis 20 3 Zur Entwicklung von Wissen 24 4 Erkennen von besonderem
1. Einleitende Überlegungen zur aktuellen Diskussion der Didaktik des Lese- und Schreibunterrichts
 Vorwort xiii 1. Einleitende Überlegungen zur aktuellen Diskussion der Didaktik des Lese- und Schreibunterrichts 1 1.1. Zur Fundierung der folgenden Diskussion: Belege für Unterschiede in der Wahrnehmung
Vorwort xiii 1. Einleitende Überlegungen zur aktuellen Diskussion der Didaktik des Lese- und Schreibunterrichts 1 1.1. Zur Fundierung der folgenden Diskussion: Belege für Unterschiede in der Wahrnehmung
Konzept zum Rechtschreibtraining
 Konzept zum Rechtschreibtraining am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen Stand: 13.12.2015 verantwortlich: Daniel Heymann 1. Legitimation Das Rechtschreibtraining ist ein Teil des Gesamtkonzepts des Gymnasiums
Konzept zum Rechtschreibtraining am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen Stand: 13.12.2015 verantwortlich: Daniel Heymann 1. Legitimation Das Rechtschreibtraining ist ein Teil des Gesamtkonzepts des Gymnasiums
Vorwort zur SLD III im Jahr Vorwort zur SLD IV Lern- und Leistungsschwierigkeiten als pädagogische Herausforderung...
 Vorwort zur SLD III im Jahr 2004... 1 Vorwort zur SLD IV... 3 1 Lern- und Leistungsschwierigkeiten als pädagogische Herausforderung... 5 1.1 Schulleistungsprobleme: Probleme des Schülers oder der Schule?...
Vorwort zur SLD III im Jahr 2004... 1 Vorwort zur SLD IV... 3 1 Lern- und Leistungsschwierigkeiten als pädagogische Herausforderung... 5 1.1 Schulleistungsprobleme: Probleme des Schülers oder der Schule?...
Inhalt Von Sven L in dberg
 Inhalt Vorw ort... 11 1 Das deutsche Schriftsystem... 13 1.1 Unterschiedliche Schriftsysteme... 13 1.2 Die deutsche Orthographie... 17 1.2.1 Das Grapheminventar des Deutschen... 17 12 2 Prinzipien der
Inhalt Vorw ort... 11 1 Das deutsche Schriftsystem... 13 1.1 Unterschiedliche Schriftsysteme... 13 1.2 Die deutsche Orthographie... 17 1.2.1 Das Grapheminventar des Deutschen... 17 12 2 Prinzipien der
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung im Fach Mathematik
 Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung im Fach Mathematik Inhalt 1. Auszug aus dem Nds. Kerncurriculum Mathematik, 2017 2. Leistungsfeststellung in den Klassen 1 und 2 der GS Barienrode 3. Leistungsbewertung
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung im Fach Mathematik Inhalt 1. Auszug aus dem Nds. Kerncurriculum Mathematik, 2017 2. Leistungsfeststellung in den Klassen 1 und 2 der GS Barienrode 3. Leistungsbewertung
Leseleistungen von LehrerInnen und Lehramtsstudierenden im Stolperwörter-Lesetest. Erste Befunde und ihre Deutung
 Brügelmann, H. (2004l): Leseleistungen von LehrerInnen und Lehramtsstudierenden im Stolperwörter-Lesetest. Erste Befunde und ihre Deutung. Vervielf. Ms. Projekt LUST/ FB 2 der Universität: Siegen. www.uni-siegen.de/~agprim/lust
Brügelmann, H. (2004l): Leseleistungen von LehrerInnen und Lehramtsstudierenden im Stolperwörter-Lesetest. Erste Befunde und ihre Deutung. Vervielf. Ms. Projekt LUST/ FB 2 der Universität: Siegen. www.uni-siegen.de/~agprim/lust
- Theoretischer Bezugsrahmen -
 Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
THE ROLE OF PROSODIC SENSITIVITY IN CHILDREN S READING DEVELOPMENT
 Universität des Saarlandes Fakultät 4.7 HS: Kinderintonation Dozentin: Bistra Andreeva Referentin: Juliane Schmidt THE ROLE OF PROSODIC SENSITIVITY IN CHILDREN S READING DEVELOPMENT Karen Whalley und Julie
Universität des Saarlandes Fakultät 4.7 HS: Kinderintonation Dozentin: Bistra Andreeva Referentin: Juliane Schmidt THE ROLE OF PROSODIC SENSITIVITY IN CHILDREN S READING DEVELOPMENT Karen Whalley und Julie
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/ Wahlperiode
 LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/2634 6. Wahlperiode 10.02.2014 KLEINE ANFRAGE des Abgeordneten David Petereit, Fraktion der NPD Vermittlung der Rechtschreibung und Rechtschreibleistungen an
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/2634 6. Wahlperiode 10.02.2014 KLEINE ANFRAGE des Abgeordneten David Petereit, Fraktion der NPD Vermittlung der Rechtschreibung und Rechtschreibleistungen an
Verlauf der BMD - Messung Benchmarking zur Qualitätskontrolle in der Behandlung der Osteoporose? Bis zu neun Jahre follow up.
 Verlauf der BMD - Messung Benchmarking zur Qualitätskontrolle in der Behandlung der Osteoporose? Bis zu neun follow up. E. Heinen, M. Beyer, I. Hellrung, I. Riedner-Walter PRAXIS für ENDOKRINOLOGIE, Nürnberg
Verlauf der BMD - Messung Benchmarking zur Qualitätskontrolle in der Behandlung der Osteoporose? Bis zu neun follow up. E. Heinen, M. Beyer, I. Hellrung, I. Riedner-Walter PRAXIS für ENDOKRINOLOGIE, Nürnberg
Erste Ergebnisse aus IGLU
 Erste Ergebnisse aus IGLU Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich Bearbeitet von Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Renate Valtin,
Erste Ergebnisse aus IGLU Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich Bearbeitet von Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Renate Valtin,
LRS bei Hörgeschädigte Definition- Prävalenz- Klassifikation
 LRS bei Hörgeschädigte Definition- Prävalenz- Klassifikation Klassifikation: Leserechtschreibstörung Achse I Klinisch-psychiatrisches Syndrom (z.b. Schulangst) Achse II Umschriebene Entwicklungsstörung
LRS bei Hörgeschädigte Definition- Prävalenz- Klassifikation Klassifikation: Leserechtschreibstörung Achse I Klinisch-psychiatrisches Syndrom (z.b. Schulangst) Achse II Umschriebene Entwicklungsstörung
EFFEKTIVE FÖRDERUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT LERNSTÖRUNGEN. Matthias Grünke
 EFFEKTIVE FÖRDERUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT LERNSTÖRUNGEN Matthias Grünke Vortrag auf dem Fachtag der Stadt Köln am 29.11.2017 Durchschnittliche Effektstärken von Unterrichtsmethoden (Grünke,
EFFEKTIVE FÖRDERUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT LERNSTÖRUNGEN Matthias Grünke Vortrag auf dem Fachtag der Stadt Köln am 29.11.2017 Durchschnittliche Effektstärken von Unterrichtsmethoden (Grünke,
Individuelle Leistungen erfassen, Lernentwicklung begleiten
 Individuelle Leistungen erfassen, Lernentwicklung begleiten Das Elementarmathematische Basisinterview (EMBI) Aufbau Theorie: Konzeptionelle Grundlagen des Elementarmathematischen Basisinterviews Praxis:
Individuelle Leistungen erfassen, Lernentwicklung begleiten Das Elementarmathematische Basisinterview (EMBI) Aufbau Theorie: Konzeptionelle Grundlagen des Elementarmathematischen Basisinterviews Praxis:
Lesen lernen als Forschungsgegenstand
 Problemaufriss Kinder mit erhöhtem Risiko für LRS müssen früh erfasst und unterstützt werden, damit sie trotz ungünstiger Voraussetzungen das Lesen- und Schreibenlernen möglichst erfolgreich bewältigen
Problemaufriss Kinder mit erhöhtem Risiko für LRS müssen früh erfasst und unterstützt werden, damit sie trotz ungünstiger Voraussetzungen das Lesen- und Schreibenlernen möglichst erfolgreich bewältigen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lesetraining in drei Niveaustufen / Klasse 2
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: / Klasse 2 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort 4 Methodisch-didaktische Hinweise 5 1 Wackelzähne
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: / Klasse 2 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort 4 Methodisch-didaktische Hinweise 5 1 Wackelzähne
Haben alle Mitglieder eines Systems dieselbe Intelligenz?
 Haben alle Mitglieder eines Systems dieselbe Intelligenz? Oft wird diese Frage gestellt und meistens wird sie mit Natürlich, es haben doch alle das selbe Gehirn beantwortet. Doch reicht das aus, damit
Haben alle Mitglieder eines Systems dieselbe Intelligenz? Oft wird diese Frage gestellt und meistens wird sie mit Natürlich, es haben doch alle das selbe Gehirn beantwortet. Doch reicht das aus, damit
Hören, lauschen, lernen
 Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache (Küspert/Schneider, 2008) Dies ist ein Programm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit Die phonologische Bewusstheit
Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache (Küspert/Schneider, 2008) Dies ist ein Programm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit Die phonologische Bewusstheit
Rechtschreibung und was Eltern wissen sollten
 Rechtschreibung und was Eltern wissen sollten Afra Sturm, Thomas Lindauer, Claudia Neugebauer Rechtschreibung und was Eltern wissen sollten Welche Rolle spielt die Rechtschreibung, wenn unser Kind einen
Rechtschreibung und was Eltern wissen sollten Afra Sturm, Thomas Lindauer, Claudia Neugebauer Rechtschreibung und was Eltern wissen sollten Welche Rolle spielt die Rechtschreibung, wenn unser Kind einen
Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund
 Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund Alexandra Marx Vortrag auf der DGLS-Fachtagung IGLU Wie lässt sich eine nachhaltige Verbesserung der Lesekompetenz
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund Alexandra Marx Vortrag auf der DGLS-Fachtagung IGLU Wie lässt sich eine nachhaltige Verbesserung der Lesekompetenz
