Aspekte der Erzähltheorie
|
|
|
- Lioba Schmidt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aspekte der Erzähltheorie 1 1. Fiktionale Erzählungen und Geschichtsschreibung Fiktion nennt man eine Aussage bzw. Darstellung eines Sachverhalts oder Geschehens, die keinen Wirklichkeitsbezug, keine Referenzialisierbarkeit beansprucht und demnach weder wahr noch falsch genannt werden kann. Die literarische Fiktion im besonderen stellt, nach einer Formulierung Kants, gedichtete und zugleich dabei für möglich angenommene Gegenstände vor und grenzt sich damit, in dramatischer wie epischer Ausformung, von der Wirklichkeitsaussage, besonders vom historischen Bericht ab. In dieser Darstellung des Möglichen (oder auch Vorstellbaren) sieht bereits Aristoteles die Überlegenheit der dichterischen Fiktion gegenüber der ans besondere Faktum gebundenen Historiographie begründet. Damit widerspricht er Platons Abwertung der Dichtung als Lüge und sichert ihr einen Eigenwert, der den abendländischen Literaturbegriff bis heute prägt. Die angemessene Rezeption fiktionaler Texte setzt voraus, dass aufgrund einer Übereinkunft zwischen Autor und Leser der Anspruch auf Verifizierbarkeit, den dieser an informative Texte richtet, suspendiert wird Erzähltheorie (Narratologie) Sie ist die Wissenschaft vom Erzählen. Die Methoden der Erzähltheorie sind von der modernen Linguistik inspiriert. So wie die Sprachwissenschaft durch eine synchrone Untersuchung des Sprachsystems aufzeigt, wie durch die Opposition und Kombination von Basiselementen (Phonemen, Morphemen, Syntagmen, usw.) sinnvolles Sprachmaterial entsteht, so versucht die Erzähltheorie zu eruieren, wie aus Sätzen Erzählungen werden, d.h. wie man aus dem Erzähltext Rückschlüsse auf das Erzählsystem ziehen kann. 2 Umstritten ist jedoch das Verhältnis von Erzähltheorie und Interpretation. Während die Narratologie sich prinzipiell als Theorie versteht, die das Was und Wie des Erzählens untersucht und diese systematisieren möchte, betonen viele Narratologen, dass die erzähltheoretischen Beschreibungskategorien ihnen wesentliche Anregungen bei der interpretatorischen Textarbeit geliefert haben, und die meisten Literaturwissenschaftler sind sich darin einig, dass die Präzision erzähltechnischer Termini einen klareren Umgang mit Texten ermöglicht Erzähltechnische Termini 3.1 Der Erzähler: Person Auktoriale Erzählsituation Bei der auktorialen Erzählsituation handelt es sich um eine Konstellation, bei der Aussenperspektive vorherrscht. Die Erzählerfigur berichtet über die fiktionale Welt, der sie selbst nicht angehört, wobei der Erzähler die Welt der Figuren überblickt. Der Erzähler legt aus Distanz und mit Wissen des Ausgangs der Komplikationen die Geschichte dar und nimmt nach Belieben Einblick in das Bewusstsein der Figuren. Der Erzähler wird daher vielfach als allwissend beschrieben. 4 Ich-Erzähler Eine Form des Erzählens, in der der Protagonist oder einer der Protagonisten der Erzähler ist. 1 Vogt, Grundlagen narrativer Texte, S Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S Ebenda, S Ebenda, S. 168.
2 2 Dabei unterscheidet man zwischen Ich-Erzählungen, bei denen es sich um eine Identität von Erzähler und Helden handelt, und Ich-Erzählungen, bei denen der Erzähler nur eine Randfigur ist, die aus der Ferne die Taten des Helden beobachtet und zu interpretieren sucht (peripherer Ich-Erzähler). Beim Ich-Erzähler selbst unterscheidet man generell zwischen dem Ich als Erzähler (erzählendes ich) und dem Ich als Figur und Erlebendem (erlebendes ich). Eine Erzählung kann entweder das erzählende ich oder das erlebende ich betonen. Beim erzählenden ich wird häufig aus der Sicht eines älteren, weiseren Erzählers berichtet; es dominieren Evaluation, Retrospektive und Moralisierung. Beim Ich als Figur (erlebendes ich) wird die Retrospektive eher vernachlässigt und der Erzähler wird als Figur in den Mittelpunkt gerückt und die Konzentration liegt auf dem Geschehen in actu. 5 Personale Erzählsituation Die Person, die die personale Erzählsituation bezeichnet, ist eine Reflektorfigur. Durch ihr Bewusstsein ist die Geschichte reflektiert. Texte im Reflektormodus sind solche, die einen medias in res Einstieg haben. Es wird nichts erklärt, die Wissenslage ist die der Reflektorfigur, deren Bewusstsein für die Darstellung ausschlaggebend ist. Der Bericht ist in der personalen Erzählsituation oft unübersichtlich, da der Protagonist die Ereignisse eben erst erlebt und sie in seinem Bewusstsein daher noch nicht überblicken und ordnen kann. Daher sind auch die Auswahlkriterien dessen, was wahrgenommen wird, spontan und unsystematisch. Die Reflektorfigur vermittelt für den Leser die Illusion, direkt am Geschehen zu partizipieren, wenn auch durch den Filter des Bewusstseins des Protagonisten Verhältnis der Erzählinstanz zum Erzählten 7 Räumlicher Standort der Erzählinstanz: Es wird nach dem räumlichen Verhältnis der Erzählinstanz zum Geschehen gefragt. In welchem räumlichen Verhältnis steht ihre Position zum Ort des Geschehens? Und welche räumliche Perspektive auf das Geschehen kann man aus ihrer Erzählung ableiten? Entfernung: Die räumliche Distanz der Erzählinstanz vom Geschehen kann von großer Nähe bis zu großer Ferne reichen. Winkel: Die Perspektive der Erzählinstanz kann von einem begrenzten Winkel bis hin zu einer olympischen Sicht mit einem nahezu unbegrenzten Überblick über das gesamte Geschehen variieren. 3.3 Perspektive der Erzählinstanz auf die Figuren Innensicht: Die Erzählinstanz kann in die Figuren hineinblicken und kennt ihre Gedanken und Gefühle, sie kann innere Zustände beschreiben. Kennzeichen: Worte der inneren Bewegung ( er/sie/es wusste, verstand, glaubte, meinte, fühlte ). Außensicht: Die Erzählinstanz hat keinen Einblick in das Bewusstsein der handelnden Figuren, sie kann keine inneren Zustände, Gefühle, Befindlichkeiten oder Motivationen beschreiben, sondern ist 5 Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S. 105 und Ebenda, S Da in Fludernik die Frage der Erzählperspektive etwas unübersichtlich dargestellt ist, geht Punkt 3.2 und 3.3 zurück auf: bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/split_lehrstuehle/neuere_deutsche_literatur/pdf- Dateien/Einf_hrung_in_die_Erz_hltextanalyse.pdf ( )
3 3 auf die Wiedergabe des äußerlich an den Figuren Beobachtbaren beschränkt ( er weinte, statt er war traurig ). 3.4 Rahmenerzählung Rahmen können entweder nur zu Beginn, nur am Ende, sowohl zu Beginn wie zu Abschluss der Erzählung oder auch intermittierend plaziert sein. Es gibt auch Erzählungen mit komplexen Rahmenstrukturen, wie zum Beispiel Tausendundeine Nacht. Die eingerahmte Geschichte kann, wie in Tausend und einer Nacht, jeweils eine Geschichte sein, die eine Figur erzählt, und in dieser Geschichte wird wieder eine Geschichte erzählt Zeitstrukturen Erzähltempo: Erzählzeit und erzählte Zeit Beim Erzähltempo geht es grundsätzlich darum, wie viel Lese- oder Sehzeit welcher Dauer der Ereignisse an sich gegenübersteht. Das Erzähltempo ergibt sich aus dem Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit. Nur selten sind Erzählzeit und erzählte Zeit isochron. Man unterscheidet im wesentlichen fünf Möglichkeiten 9 : Raffung: Die Erzählzeit ist gegenüber der erzählten Zeit stark gerafft. Am Beginn und Ende von Romanen werden zum Beispiel die Jugend des Helden oder sein Leben nach Ende der Haupthandlung in einem Kapitel zusammengefasst. Isochronie: Die Erzählung dauert ebenso lange wie die Ereignisse. Dieser Fall kann eigentlich nur in der wortwörtlichen Wiedergabe von Figurenrede eintreten oder bei Beschreibungen von kurz aufeinander folgenden raschen Handlungen, z.b. von Raufereien. Aber bereits Er stieg die Treppe hoch und klopfte an die Tür ist verzerrt, da das Treppensteigen länger dauert als das Anklopfen. Aber beides nimmt genauso viel Platz ein im Erzähltext. Dehnung: Die Darstellungsebene dehnt die Ereignisse durch Beschreibung oder Gedankendarstellung aus. Beispielsweise kann der Moment des Sterbens auf vielen Seiten beschrieben werden. Pause: es werden Landschaften, Bewusstseinszustände oder soziohistorische Hintergründe beschrieben, die mit keinem Geschehen auf der Ebene der dargestellten Welt korrelieren. Ellipse: Die Ellipse (Zeitsprung, Aussparung) ist eigentlich die radikalste Form der Raffung, die ja ebenfalls auf Selektion zurückgeht. Vieles wird einfach weggefiltert, da sonst die Erzählung mit Details überfrachtet wäre Chronologie Die meisten Romane weisen eine chronologische Struktur auf, auch wenn sie eine stark geraffte Vorgeschichte eventuell in Rückblende geliefert oder den Erzählbeginn zwecks grösserer Eindringlichkeit medias in res gestaltet haben. Die Erzähltheorie hat sich in der Folge von Genette besonders auf die sogenannten Anachronien, also Abweichungen von der Chronologie der Geschichte, gestürzt. 10 Am häufigsten trifft man auf die Rückblende (Analepse). Dabei werden frühere Ereignisse erzählt, oft als Teil einer Erinnerung des Helden oder als Erklärung für unerwartete Ereignisse, die gerade geschildert wurden. 11 Die Arten von Analepsen können etwa sein: Vorzeithandlung, aufbauende Rückwendung (als zweiter Erzählabschnitt in vielen Novellen 8 Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S Ebenda, S Ebenda, S Ebenda, S. 46.
4 4 und Romanen), auflösende Rückwendung (als letzter Erzählabschnitt z.b. in einem Detektivroman), subjektiver Rückblick einer Figur. 12 Vorausdeutungen (Prolepsen), die den Zukunftshorizont einer erzählten Handlung öffnen und Spannung aufbauen, sind zukunftsungewiss oder zukunftsgewiss, je nachdem, ob sie von einer Handlungsfigur als Wunsch, Befürchtung, Versprechen usw. oder von der im Rahmen der Fiktion allwissenden Erzählinstanz geäussert werden. Besonders ausgeprägt sind einführende Vorausdeutungen, die am Beginn eines Textes oder Abschnitts stehen. Häufig sind sie im Konditional verfasst: noch lange würde er sich dieser Worte besinnen. Sie können auch bereits im Titel vorkommen (z.b. Buddenbrooks. Verfall einer Familie ). 13 Typisch für postmoderne experimentelle Texte ist die sogenannte Achronie. Hier lässt sich nicht feststellen, in welcher Reihenfolge Ereignisse stattfanden, so dass auch keine chronologische Reihenfolge bzw. keine Feststellung, ob die Darstellung chronologisch ist, möglich wird Erzählweise Genette unterscheidet zudem unter dem Stichwort Frequenz (Häufigkeit) singulative, repetitive und iterative Erzählweise. Singulativ: einmalige Erzählung einer einmaligen Sache Repetitiv: mehrmalige Erzählung einer einmaligen Sache Iterativ: mehrmalige oder einmalige Erzählung einer mehrmaligen (sich wiederholenden) Sache. Beispiel für eine einmalige Erzählung einer mehrmaligen Sache: Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. 15 Ein mögliches Beispiel für eine mehrmalige Erzählung einer mehrmaligen Sache haben wir bei der Kurzgeschichte Der verschwundene Ehemann von deq Hed yat gesehen. 3.6 Redeformen Der Erzähldiskurs 16 hat volle Kontrolle darüber, was überhaupt dargestellt wird und in welcher Form es im Text erscheint: direkte Rede, Redebericht, indirekte Rede oder erlebte Rede. Redebericht Dabei handelt es sich um die Darstellung der Rede einer anderen Person in geraffter Form, wobei die genauen Aussagen der Rede und ihr Wortlaut nicht wiedergegeben werden. Beispiel: Mit Rührung und Freude begrüsste der Konsul Thomas alsbald nach seiner Ankunft. Hier wird nur die Tatsache einer Rede erwähnt (Begrüssung), aber nichts über deren Inhalt gesagt. Indirekte Rede sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie syntaktisch untergeordnet ist. Im Deutschen kann jedoch auch der Konjunktiv allein die indirekte Rede markieren. Die erlebte Rede Sie erlaubt innerhalb einer erzählerischen Darstellung des Redeinhaltes stilistische und syntaktische Anleihen an die direkte Rede und baut die Rededarstellung dank des Wegfallens syntaktischer Rahmung (z.b. Sie bemerkte, dass ) in den Erzählfuss ein, so dass es nicht immer eindeutig bestimmbar ist, wo genau erlebte Rede beginnt oder ob überhaupt eine solche vorliegt. In Referenz und Tempusgebrauch passt sie sich der umliegenden Rede an. 12 Vogt, Grundlagen narrativer Texte, S Ebenda, S Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S Vogt, Grundlagen narrativer Texte, S Erzähldiskurs: Diskurs meint hier den Erzähltext, wie er uns als Satzfolge und Absatzfolge beim Lesen entgegentritt. Vgl. Fludernik, S. 17. Dieser Diskursbegriff hat kaum oder gar nichts gemein mit dem Diskursbegriff Michel Foucaults.
5 5 Beispiel (kursiv: erlebte Rede): Übrigens erklärte er zu Hause, die Jurisprudenz sei der schönste Beruf [indirekte Rede], ja, das wäre ein Beruf für ihn gewesen [erlebte Rede]. Oder: Heinrich schritt die Strasse entlang. Was, es war schon fünf? Er musste sich beeilen, Sonja würde um sieben eintreffen Sprache und Stil Prinzipiell sind stilistische Fragen sprachspezifisch, während Kategorien wie etwa Analepsen und Erzählsituation sprachunabhängig existieren, also in derselben Weise für verschiedene Sprachen und Kulturen Geltung beanspruchen dürfen. Zwar können in verschiedenen Literaturen, Kulturen oder historischen Zeitstufen einzelne Kategorien bevorzugt werden und andere eher marginal sein. Beispielsweise wurde der personale Roman erst im späten neunzehnten Jahrhundert erfunden Dialekt-/Standardsprache-Unterscheidung Eine wichtige Stilkategorie, die Fludernik nennt und die wir auch in der persischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts antreffen, ist die Dialekt-/Standardsprache-Unterscheidung. Diese ist im (europäischen) Roman des achtzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts regulär ein Mittel, um die Sprache des gebildeten Erzählers von den verschiedenen Sprachebenen der Charaktere zu unterscheiden. Dabei variieren die humoristisch-satirischen direkten Reden und die empathische Verwendung von Lokalkolorit im historischen Roman. Die direkte Rede wird häufig dazu eingesetzt, um den sozialen Stand einer Person zu symbolisieren und Lokalkolorit einzubringen. Im (europäischen) zwanzigsten Jahrhundert setzt sich sodann eine Tendenz durch, dass auch der Erzähler (und nicht nur der Ich-Erzähler) Dialektsprache verwendet Wortstellung: Voranstellung von Präpositionalphrasen Die Voranstellung von Präpositionalphrasen wie z.b. Ins Zimmer flog ein grosser Vogel ist in Erzählungen oft mit der Schilderung überraschender Ereignisse verbunden. Da solche Voranstellungen oft mit der Inversion von Subjekt und Verb einhergehen, wird das Problem auch häufig als stilistische Funktion der Inversion diskutiert Metaphorik Eine Metapher im Erzähltext entstammt entweder zunächst einmal der Rede des Erzählers, den Gedanken einer Figur oder den Äusserungen eines Helden. Metaphern können jedoch auch eine weit über den Mikro-Kontext hinausgehende Bedeutung haben, sich also auf ein Buch als ganzes beziehen (in Dickens Roman Klein Dorrit wird die Gefängnismetapher auf so viele Bereiche ausgedehnt, dass letztlich alle Figuren des Romans Gefangene zu sein scheinen, ja das Leben als solches als Gefängnis erscheint). Es gibt bestimmte Autoren und bestimmte Werke, die besonders metaphorisch sind (in Europa sind dies Dickens, Jelinek und Balzac). Eine Metapher kann sich, wie bei Dickens die Gefängnismetapher, als Strukturprinzip des Romans und daher als Strategie des Autors entpuppen. In einem solchen Fall spielt Metaphorik eine entscheidende strukturelle Rolle und ist dann auch erzähltheoretisch relevant Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S. 81 und Ebenda, S Ebenda, S Ebenda, S Ebenda, S
6 6 Exkurs: Die Metapherntheorie der historischen Diskursanalyse Philipp Sarasins: Diskurse sind regulierte, stabilisierende Bezeichnungsordnungen. Was verbindet verschiedene Diskurse in- und ausserhalb der Wissenschaft miteinander? Die Metapher. Metapher: Ein metaphorischer Signifikant ist selbst Teil einer anderen, weiteren Signifikantenkette, von wo er seine wörtliche Bedeutung erst gewonnen hat und die mit seinem Import im neuen Zusammenhang auch mitassoziiert wird. Die Anstrengung, die Bedeutung von Worten so weit zu stabilisieren, dass sie möglichst klar das bezeichnen, was sie bezeichnen sollen und damit Begriffe sind -, ist jeder wissenschaftlichen Tätigkeit inhärent, und es ist auch klar, dass diese Stabilisierung die Funktion von Diskursen ist. Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Begriff/Metapher lässt sich jedoch nur als analytische aufrechterhalten. Die Zelle ist ein stabilisierter Basisbegriff in der Biologie. Zugleich ist sie weiterhin eine überaus aktive Metapher, die ihre eigene Geschichte hat = Terrorzellen spielen eine prominente Rolle Gedanken, Gefühle und das Unbewusste In der Literatur kann in die Gedanken und Gefühle von Figuren hineingesehen werden. Dies ganz im Gegensatz zum wirklichen Leben, wo wir über das Denken und die wahren Motive unserer Mitbürger nur spekulieren können. Die Literatur ermöglicht uns also die völlige Gewissheit über das Bewusstsein anderer Personen, die uns auf solche Weise so vertraut werden, wie wir uns selbst sind. Die Empathie, welche wir für Romanfiguren empfinden, ist also zu einem nicht geringen Teil Folge der magischen Fähigkeit der Erzählung, uns Einblick in Andere zu gewähren, als ob wir diese wie uns selbst kennten. Nicht jede Erzählung erlaubt uns die Sicht in die Gedankenwelt und das Innenleben der Protagonisten. Es handelt sich also um eine Möglichkeit, die nicht immer genutzt wird. Die Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren sind für Erzählungen deshalb wichtig, weil sie unter anderem die Intentionen und Motive von Akteuren sowie ihre Reaktionen auf äussere Einflüsse vermitteln hilft. In anderen, eher handlungsbetonten Geschichten ist es wiederum das Verständnis der Motive und Intentionen oder der Erwartungshaltung der Protagonisten, die dem Leser wesentlichen Interpretationsgewinn ermöglichen. 23 Neben der zentralen Stellung des Bewusstseins für das Narrative und insbesondere für die fiktionale Erzählung hat sich die Narratologie hauptsächlich mit der Gedankendarstellung im Roman befasst. Hervorgerufen wurde dies insbesondere durch die Entstehung des Bewusstseinsromans Ende des 19. Jahrhunderts, der seinen Höhepunkt in den Werken insbesondere von Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust und Franz Kafka, also in der literarischen Moderne, erlebte. 24 Es gibt drei Grundtypen der Gedankendarstellung 25 : -Eine quasi-direkte Wiedergabe von Gedanken in der direkten inneren Rede, die insbesondere durch finite Verben im Präsens kenntlich wird. -Die Darstellung von Gedanken in erlebter Rede -Der Gedankenbericht, der in den Verben oder Hauptwörtern auf Bewusstseinsvorgänge hinweist (z.b. Seine Gedanken kreisten um die Frage, Sie wog ihre Optionen ab ). 5. Literatur: Fludernik, Monika: Einführung in die Erzähltheorie, Darmstadt Vogt, Jochen: Grundlagen narrativer Texte, in: Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 2003, S Vgl. Sarasin, Philipp: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt am Main 2003, S Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S Ebenda, S Ebenda, S. 98.
Theorie des Erzählens
 Franz K. Stanzel Theorie des Erzählens Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhalt Vorwort 9 Einleitung 11 1. Mittelbarkeit als Gattungsmerkmal der Erzählung 15 1.1. Mittelbarkeit und Point of View" 21
Franz K. Stanzel Theorie des Erzählens Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhalt Vorwort 9 Einleitung 11 1. Mittelbarkeit als Gattungsmerkmal der Erzählung 15 1.1. Mittelbarkeit und Point of View" 21
Die Erzählsituation ist der Blickwinkel desjenigen, der die Geschichte des Autors dem Leser erzählt. Einige Literaturgelehrte unterscheiden zwischen:
 2. ERZÄHLSITUATIONEN PERSPEKTIVEN/SICHTWEISE Auktorial, personal, Ich-Erzählung, Innensicht, Außensicht was bedeutet das eigentlich? Es gibt veröffentlichte Autoren, die nie im Leben etwas von diesen Begriffen
2. ERZÄHLSITUATIONEN PERSPEKTIVEN/SICHTWEISE Auktorial, personal, Ich-Erzählung, Innensicht, Außensicht was bedeutet das eigentlich? Es gibt veröffentlichte Autoren, die nie im Leben etwas von diesen Begriffen
Gérard Genette: Die Erzählung (hg. von Jochen Vogt) discours : Abfolge von Zeichen, Text, das Wie der Darstellung
 Gérard Genette: Die Erzählung (hg. von Jochen Vogt) 1994 discours : Abfolge von Zeichen, Text, das Wie der Darstellung histoire : Abfolge von Ereignissen, eine Geschichte, das Was der Darstellung discours
Gérard Genette: Die Erzählung (hg. von Jochen Vogt) 1994 discours : Abfolge von Zeichen, Text, das Wie der Darstellung histoire : Abfolge von Ereignissen, eine Geschichte, das Was der Darstellung discours
Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
 Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?
Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?
Erzähltechniken im Deutschen Grundbegriffe der Textanalyse
 Erzählform? Zeitdehnung? Zeitraffung? Erzählzeit? Erzähltechnik erzählte Zeit? Erzählverhalten? Erzählperspektive? Erzähltechniken im Deutschen Grundbegriffe der Textanalyse Eine Übungspräsentation von
Erzählform? Zeitdehnung? Zeitraffung? Erzählzeit? Erzähltechnik erzählte Zeit? Erzählverhalten? Erzählperspektive? Erzähltechniken im Deutschen Grundbegriffe der Textanalyse Eine Übungspräsentation von
Erzählsituation - Fokalisierung
 Erzählsituation - Fokalisierung 26.4.2017 Fiction does not imitate reality out there. It imitates a fellow telling about it. (Baker) Wer spricht zu wem? Realer Autor (author) Erzähler (narrator) fiktiver
Erzählsituation - Fokalisierung 26.4.2017 Fiction does not imitate reality out there. It imitates a fellow telling about it. (Baker) Wer spricht zu wem? Realer Autor (author) Erzähler (narrator) fiktiver
b) Lies die Kurzgeschichte ein zweites Mal. Schreibe unten in Stichwörtern auf, wie die Figuren miteinander umgehen.
 A: Inhaltssicherung Aufgabe 1: a) In der Kurzgeschichte treten drei Figuren auf. Nenne die drei Figuren und erkläre stichpunktartig, in welcher Beziehung die Figuren zueinander stehen. b) Lies die Kurzgeschichte
A: Inhaltssicherung Aufgabe 1: a) In der Kurzgeschichte treten drei Figuren auf. Nenne die drei Figuren und erkläre stichpunktartig, in welcher Beziehung die Figuren zueinander stehen. b) Lies die Kurzgeschichte
Dr. Gabriele Czerny Literatur: Gansel Carsten: Moderne Kinder- und Jugendliteratur. Berlin 1999.
 1 Dr. Gabriele Czerny Literatur: Gansel Carsten: Moderne Kinder- und Jugendliteratur. Berlin 1999. Erzähltheoretische Grundvoraussetzungen und Kategorien Zur Struktur epischer bzw. narrativer Kinder- und
1 Dr. Gabriele Czerny Literatur: Gansel Carsten: Moderne Kinder- und Jugendliteratur. Berlin 1999. Erzähltheoretische Grundvoraussetzungen und Kategorien Zur Struktur epischer bzw. narrativer Kinder- und
Erzählsituationen in Literatur und Film
 Matthias Hurst Erzählsituationen in Literatur und Film Ein Modell zur vergleichenden Analyse von literarischen Texten und filmischen Adaptionen Max Niemeyer Verlag Tübingen 1996 INHALT Einleitung 1 TEIL
Matthias Hurst Erzählsituationen in Literatur und Film Ein Modell zur vergleichenden Analyse von literarischen Texten und filmischen Adaptionen Max Niemeyer Verlag Tübingen 1996 INHALT Einleitung 1 TEIL
Fachliche Grundlagen des Literaturunterrichts
 Fachliche Grundlagen des Literaturunterrichts Epik III: Moderne Formen Erzählungen im Unterricht Seminar im SoSe 2009 Gottes Auge von Wolfgang Borchert 1921-1947 Fiktionales Zeitensystem der Erzähldauer
Fachliche Grundlagen des Literaturunterrichts Epik III: Moderne Formen Erzählungen im Unterricht Seminar im SoSe 2009 Gottes Auge von Wolfgang Borchert 1921-1947 Fiktionales Zeitensystem der Erzähldauer
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik
 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Maßnahmen gegen die Gewalt" von Bertolt Brecht - mehrschrittige Interpretation Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Maßnahmen gegen die Gewalt" von Bertolt Brecht - mehrschrittige Interpretation Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Gute. Geschichten erzählen. - ein Leitfaden -
 Gute Geschichten erzählen - ein Leitfaden - Inhaltsverzeichnis 1 Grundstruktur jeder Geschichte... 4 2 Eine Geschichte erfinden... 6 3 Dramaturgie des Erzählens... 9 Literaturverzeichnis Impressum 1 Grundstruktur
Gute Geschichten erzählen - ein Leitfaden - Inhaltsverzeichnis 1 Grundstruktur jeder Geschichte... 4 2 Eine Geschichte erfinden... 6 3 Dramaturgie des Erzählens... 9 Literaturverzeichnis Impressum 1 Grundstruktur
Konzeptionelle Überlegungen zum Unterricht im 4. Kurshalbjahr (Abitur 2017 und 2018) LISUM - Fortbildung Deutsch Sek. II
 Konzeptionelle Überlegungen zum Unterricht im 4. Kurshalbjahr (Abitur 2017 und 2018) LISUM - Fortbildung Deutsch Sek. II 02.11.2016 Bildungsregion Berlin-Brandenburg Konzeptionelle Überlegungen zum Unterricht
Konzeptionelle Überlegungen zum Unterricht im 4. Kurshalbjahr (Abitur 2017 und 2018) LISUM - Fortbildung Deutsch Sek. II 02.11.2016 Bildungsregion Berlin-Brandenburg Konzeptionelle Überlegungen zum Unterricht
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Aufsatzarten. Register 75. Vorwort 5
 Inhalt Vorwort 5 Aufsatzarten 1 Grundlegende Arbeitstechniken 8 2 Die Erlebniserzählung 25 3 Die Fantasieerzählung 27 4 Die Beschreibung 28 5 Der Brief 32 6 Das Protokoll 34 7 Der Bericht 36 8 Die Schilderung
Inhalt Vorwort 5 Aufsatzarten 1 Grundlegende Arbeitstechniken 8 2 Die Erlebniserzählung 25 3 Die Fantasieerzählung 27 4 Die Beschreibung 28 5 Der Brief 32 6 Das Protokoll 34 7 Der Bericht 36 8 Die Schilderung
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Verlauf Material LEK Glossar Literatur
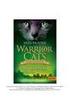 Reihe 21 S 5 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Peter Stamm: Blitzeis drei ausgewählte Erzählungen Über die Untersuchung von Sprache und Erzähltechnik zur Interpretation Modul 1 Die Erzählung
Reihe 21 S 5 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Peter Stamm: Blitzeis drei ausgewählte Erzählungen Über die Untersuchung von Sprache und Erzähltechnik zur Interpretation Modul 1 Die Erzählung
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Schlink, Der Vorleser
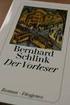 Schlink, Der Vorleser Teil 1 A Kap. 1-4 B Kap. 5-8 C Kap. 9-12 D Kap. 13-17 Aufträge für die Gruppenarbeit: 1. Setzen Sie Titel zu den Kapiteln! Versuchen Sie über die Titelgebung Wichtiges hervorzuheben
Schlink, Der Vorleser Teil 1 A Kap. 1-4 B Kap. 5-8 C Kap. 9-12 D Kap. 13-17 Aufträge für die Gruppenarbeit: 1. Setzen Sie Titel zu den Kapiteln! Versuchen Sie über die Titelgebung Wichtiges hervorzuheben
Übersicht über die wichtigsten Arbeitstechniken im Fach Deutsch
 Übersicht über die wichtigsten Arbeitstechniken im Fach Deutsch Die vorliegende Übersicht dient der Vorbereitung zur Teilnahme an den besonderen Leistungsfeststellungen zum Erwerb eines Mittleren Abschlusses.
Übersicht über die wichtigsten Arbeitstechniken im Fach Deutsch Die vorliegende Übersicht dient der Vorbereitung zur Teilnahme an den besonderen Leistungsfeststellungen zum Erwerb eines Mittleren Abschlusses.
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung)
 Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Die Inhaltsangabe. am Beispiel von Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts. -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind
 Die Inhaltsangabe am Beispiel von Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind 2017 Wolfgang Borchert Das Werk Wolfgang Borcherts ist schmal. Als er 26-jährig
Die Inhaltsangabe am Beispiel von Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind 2017 Wolfgang Borchert Das Werk Wolfgang Borcherts ist schmal. Als er 26-jährig
Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung
 Germanistik Marco Kunze Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung Studienarbeit Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Seminar für deutsche Sprache und Literatur
Germanistik Marco Kunze Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung Studienarbeit Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Seminar für deutsche Sprache und Literatur
Hinweise zur Arbeit an den Kurzgeschichten
 Hinweise zur Arbeit an den Kurzgeschichten Entwicklung Die Textgattung sowie der Begriff der Kurzgeschichte entstanden als «short stories» Anfang des 20. Jahrhunderts im Bereich der angloamerikanischen
Hinweise zur Arbeit an den Kurzgeschichten Entwicklung Die Textgattung sowie der Begriff der Kurzgeschichte entstanden als «short stories» Anfang des 20. Jahrhunderts im Bereich der angloamerikanischen
Über literarische Texte sprechen
 , Über literarische Texte sprechen I. Allgemeine Aussagen Bei diesem Text handelt es sich um... (+ Akk.) ein Drama / einen Roman / eine Kurzgeschichte Der Text / Die Erzählung / Die Kurzgeschichte / Der
, Über literarische Texte sprechen I. Allgemeine Aussagen Bei diesem Text handelt es sich um... (+ Akk.) ein Drama / einen Roman / eine Kurzgeschichte Der Text / Die Erzählung / Die Kurzgeschichte / Der
Stoffverteilungsplan Deutsch Unterrichtsthemen Kompetenzen Aufgabentypen
 Stoffverteilungsplan Deutsch Unterrichtsthemen Kompetenzen Aufgabentypen Seite 1 von 6 Deutsch Klasse 7 Unterrichtsvorhaben Themen/ Inhalte [ Konkretisierung durch das Lehrbuch ] Sprechen und Zuhören Kompetenzen
Stoffverteilungsplan Deutsch Unterrichtsthemen Kompetenzen Aufgabentypen Seite 1 von 6 Deutsch Klasse 7 Unterrichtsvorhaben Themen/ Inhalte [ Konkretisierung durch das Lehrbuch ] Sprechen und Zuhören Kompetenzen
Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität
 Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Die Dreiecksbeziehung Kreisler, Julia und Hedwiga in "Die Lebensansichten des Katers Murr" von E.T.A Hoffmann
 Germanistik Marko Stevic Die Dreiecksbeziehung Kreisler, Julia und Hedwiga in "Die Lebensansichten des Katers Murr" von E.T.A Hoffmann Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 2 2. Das Hell
Germanistik Marko Stevic Die Dreiecksbeziehung Kreisler, Julia und Hedwiga in "Die Lebensansichten des Katers Murr" von E.T.A Hoffmann Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 2 2. Das Hell
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Literarische Texte sind schriftliche Texte, in denen sprachliche Mittel eingesetzt werden. Dabei bedeutet die literarische Verwendung von Sprache häufig auch eine
KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Literarische Texte sind schriftliche Texte, in denen sprachliche Mittel eingesetzt werden. Dabei bedeutet die literarische Verwendung von Sprache häufig auch eine
1. Thema: Wir und unsere neue Schule Erfahrungen austauschen. Jahrgang: Schwerpunkt: Kommunikation, Reflexion über Sprache
 1. Thema: Wir und unsere neue Schule Erfahrungen austauschen Jahrgang: Schwerpunkt: Kommunikation, Reflexion über Sprache - Deutschbuch, Kap. 1, S. 9-21; - Arbeitsheft, S. 16, 1-4 - Brief - Wortarten -
1. Thema: Wir und unsere neue Schule Erfahrungen austauschen Jahrgang: Schwerpunkt: Kommunikation, Reflexion über Sprache - Deutschbuch, Kap. 1, S. 9-21; - Arbeitsheft, S. 16, 1-4 - Brief - Wortarten -
"Klavierstunde" von Gabriele Wohmann. Kurzgeschichtenanalyse
 Germanistik Madleen Wendt "Klavierstunde" von Gabriele Wohmann. Kurzgeschichtenanalyse Referat / Aufsatz (Schule) Interpretation der Kurzgeschichte Die Klavierstunde von Gabriele Wohmann Die Kurzgeschichte
Germanistik Madleen Wendt "Klavierstunde" von Gabriele Wohmann. Kurzgeschichtenanalyse Referat / Aufsatz (Schule) Interpretation der Kurzgeschichte Die Klavierstunde von Gabriele Wohmann Die Kurzgeschichte
Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman (S II) Reihe 11 S 1. Verlauf Material LEK Glossar Literatur
 Reihe 11 S 1 Verlauf Material Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman Erschließung durch analytische und produktionsorientierte Verfahren Judith Kurz-Bieligk, Koblenz Peter Stamms Roman Agnes
Reihe 11 S 1 Verlauf Material Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman Erschließung durch analytische und produktionsorientierte Verfahren Judith Kurz-Bieligk, Koblenz Peter Stamms Roman Agnes
Christoph Ransmayrs Die letzte Welt: Narrative Techniken zur Gestaltung der fiktionalen Welt
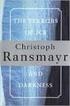 Christoph Ransmayrs Die letzte Welt: Narrative Techniken zur Gestaltung der fiktionalen Welt ein Vortrag von Patricia Sanda > Aushang > Präsentation 134 Aushang 135 Christoph Ransmayr Sein Leben Christoph
Christoph Ransmayrs Die letzte Welt: Narrative Techniken zur Gestaltung der fiktionalen Welt ein Vortrag von Patricia Sanda > Aushang > Präsentation 134 Aushang 135 Christoph Ransmayr Sein Leben Christoph
Kreative Schreibwerkstatt
 Kreative Schreibwerkstatt nach Texten von Jürg Schubiger und Franz Hohler Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind 2017 Kreatives Schreiben Kreatives Schreiben gibt es in allen Gattungen,
Kreative Schreibwerkstatt nach Texten von Jürg Schubiger und Franz Hohler Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind 2017 Kreatives Schreiben Kreatives Schreiben gibt es in allen Gattungen,
Inhalt. Erzählen Kompetenzcheck: Erzählen Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern
 Inhalt Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern Erzählen... 1 1 Die Teile einer Erzählung gestalten... 1 1.1 Grundlagen des Erzählens... 2 1.2 Wie ist eine gute Erzählung aufgebaut?... 3 1.3 Die Einleitung...
Inhalt Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern Erzählen... 1 1 Die Teile einer Erzählung gestalten... 1 1.1 Grundlagen des Erzählens... 2 1.2 Wie ist eine gute Erzählung aufgebaut?... 3 1.3 Die Einleitung...
GRUNDWISSEN Deutsch Vollversion
 6... 2 SCHREIBFORMEN / AUFSATZARTEN :... 2 1) ERZÄHLEN... 2 2) BERICHTEN... 2 3) BESCHREIBEN Vorgangsbeschreibung...2 Aufbau:... 2 Sprache und Stil:... 3 LITERATUR / LITERARISCHE GATTUNGEN...3 1) FABELN...
6... 2 SCHREIBFORMEN / AUFSATZARTEN :... 2 1) ERZÄHLEN... 2 2) BERICHTEN... 2 3) BESCHREIBEN Vorgangsbeschreibung...2 Aufbau:... 2 Sprache und Stil:... 3 LITERATUR / LITERARISCHE GATTUNGEN...3 1) FABELN...
/ Deutsch / Literatur / Kafka: Der Prozess / Seite 1/10
 www.klausschenck.de / Deutsch / Literatur / Kafka: Der Prozess / Seite 1/10 Inhaltsverzeichnis 1. Aufbau des Romans 2 2. Raum und Zeitverhältnisse 3 2.1 Raumverhältnisse (Grundlagen) 3 2.2 Zeitverhältnisse
www.klausschenck.de / Deutsch / Literatur / Kafka: Der Prozess / Seite 1/10 Inhaltsverzeichnis 1. Aufbau des Romans 2 2. Raum und Zeitverhältnisse 3 2.1 Raumverhältnisse (Grundlagen) 3 2.2 Zeitverhältnisse
Novelle, 2. Termin Gattung und Modell: Boccaccios Falkennovelle. Helmut Galle
 Novelle, 2. Termin Gattung und Modell: Boccaccios Falkennovelle Helmut Galle hgalle@usp.br Wiederholung: Charakteristika der Novelle Novelle vs. andere Formen der Erzählprosa Kürze vs. Länge: mittlere
Novelle, 2. Termin Gattung und Modell: Boccaccios Falkennovelle Helmut Galle hgalle@usp.br Wiederholung: Charakteristika der Novelle Novelle vs. andere Formen der Erzählprosa Kürze vs. Länge: mittlere
Deutsch/Jg Nr. 1 im 1. Hj.
 Deutsch/Jg. 6.1 Sachtexte analysieren formulieren eigene Meinungen und vertreten diese formulieren Appelle und Aufforderungen nehmen begründet Stellung äußern sich artikuliert, verständlich, sach- und
Deutsch/Jg. 6.1 Sachtexte analysieren formulieren eigene Meinungen und vertreten diese formulieren Appelle und Aufforderungen nehmen begründet Stellung äußern sich artikuliert, verständlich, sach- und
Die Schülerinnen orientieren sich in Zeitungen.
 Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
H.G.Wells "Die Zeitmaschine" als Spiegel der Zeit
 Germanistik C. Köhne H.G.Wells "Die Zeitmaschine" als Spiegel der Zeit Studienarbeit 1. Einleitung... 2 1.2 Einordnen in den gesellschaftlichen Kontext... 3 1.1.1 Eloi und Morlocks als Klassenvertreter
Germanistik C. Köhne H.G.Wells "Die Zeitmaschine" als Spiegel der Zeit Studienarbeit 1. Einleitung... 2 1.2 Einordnen in den gesellschaftlichen Kontext... 3 1.1.1 Eloi und Morlocks als Klassenvertreter
Fach: Deutsch Fachbuch: Klasse 8, 1. Halbjahr
 Schulinterne Richtlinien Fach: Deutsch Fachbuch: Klasse 8, 1. Halbjahr Unterrichtseinheit 1. Argumentieren - Zu Argumenten Stellung nehmen Db. Kap. 2 Sprechen Zuhören Sie verfügen über eine zuhörergerechte
Schulinterne Richtlinien Fach: Deutsch Fachbuch: Klasse 8, 1. Halbjahr Unterrichtseinheit 1. Argumentieren - Zu Argumenten Stellung nehmen Db. Kap. 2 Sprechen Zuhören Sie verfügen über eine zuhörergerechte
Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Kulturwissenschaft - Methoden II - Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs8 19.11.2007 Verstehend-historiographische
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Kulturwissenschaft - Methoden II - Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs8 19.11.2007 Verstehend-historiographische
UNI-WISSEN. Klett Lemtraining
 UNI-WISSEN Klett Lemtraining Inhalt 1 Literaturwissenschaft 9 1 Literaturwissenschaft: das letzte intellektuelle Abenteuer 9 2 Literatur und Wissenschaft 10 3 Vermittlung der Grundkenntnisse 13 4 Motivationen
UNI-WISSEN Klett Lemtraining Inhalt 1 Literaturwissenschaft 9 1 Literaturwissenschaft: das letzte intellektuelle Abenteuer 9 2 Literatur und Wissenschaft 10 3 Vermittlung der Grundkenntnisse 13 4 Motivationen
Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch Name: Klasse: Aufsatz / Beschreibung / Personen: Charakterisierung
 Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch Name: Klasse: Aufsatz / Beschreibung / Personen: Charakterisierung Personenbeschreibung II) Die Charakterisierung einer Person 1) Anfertigung einer Personencharakterisierung
Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch Name: Klasse: Aufsatz / Beschreibung / Personen: Charakterisierung Personenbeschreibung II) Die Charakterisierung einer Person 1) Anfertigung einer Personencharakterisierung
 '140 SVEN STRASEN 6.7 Toolkit νοn Leitfragen fiir die Analyse der Erzahlsituation und der Fokalisierung 7 ZUR ANALYSE DESERZAHLMODUS UND VERSCffiEDENER FORMEN νον FIGURENREDE 1) Treten ίη der vorliegenden
'140 SVEN STRASEN 6.7 Toolkit νοn Leitfragen fiir die Analyse der Erzahlsituation und der Fokalisierung 7 ZUR ANALYSE DESERZAHLMODUS UND VERSCffiEDENER FORMEN νον FIGURENREDE 1) Treten ίη der vorliegenden
1. Erzählen als Basisform der Verständigung
 1. Erzählen als Basisform der Verständigung Erzählen ist eine Grundform sprachlicher Darstellung, die in verschiedenen Formen und Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen stattfindet. Erzählungen sind
1. Erzählen als Basisform der Verständigung Erzählen ist eine Grundform sprachlicher Darstellung, die in verschiedenen Formen und Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen stattfindet. Erzählungen sind
SUBJEKT UND IDENTITÄT. Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com
 SUBJEKT UND IDENTITÄT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Resümee und Fragen 2. Konzepte von Identität und Subjektivität 3. Das Problem des Naturalismus 4. Das
SUBJEKT UND IDENTITÄT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Resümee und Fragen 2. Konzepte von Identität und Subjektivität 3. Das Problem des Naturalismus 4. Das
Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz. Reclam Lektüreschlüssel
 Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Reclam Lektüreschlüssel Lektüreschlüssel für Schüler Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Von Helmut Bernsmeier Philipp Reclam jun. Stuttgart Alle Rechte vorbehalten
Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Reclam Lektüreschlüssel Lektüreschlüssel für Schüler Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Von Helmut Bernsmeier Philipp Reclam jun. Stuttgart Alle Rechte vorbehalten
Folgende Aspekte epischer Texte sollten in der 12.Klasse behandelt werden, wobei die hier genannten Begriffe verwendet werden sollten:
 Folgende Aspekte epischer Texte sollten in der 12.Klasse behandelt werden, wobei die hier genannten Begriffe verwendet werden sollten: 1. Die epische Grundsituation (Autor Erzähler) 2. Erzählsituation
Folgende Aspekte epischer Texte sollten in der 12.Klasse behandelt werden, wobei die hier genannten Begriffe verwendet werden sollten: 1. Die epische Grundsituation (Autor Erzähler) 2. Erzählsituation
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Wie interpretiere ich Fabeln, Parabeln und Kurzgeschichten?
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wie interpretiere ich Fabeln, Parabeln und Kurzgeschichten? (Anleitung) Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wie interpretiere ich Fabeln, Parabeln und Kurzgeschichten? (Anleitung) Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Stärkt Menschen. Inspiriert Teams. Befähigt Organisationen.
 12.02.2017 _ merik-scharmer-4grundtypen-des-hinhoerens.docx 1/5 Grundsätzliches: Wichtig ist kein Urteil zu fällen, über das, welche Ebene richtig/besser ist (dann wären wir sofort im Modus des downloading).
12.02.2017 _ merik-scharmer-4grundtypen-des-hinhoerens.docx 1/5 Grundsätzliches: Wichtig ist kein Urteil zu fällen, über das, welche Ebene richtig/besser ist (dann wären wir sofort im Modus des downloading).
Brüchige jüdische Lebenswelt am Ende der Wiener Moderne:Arthur Schnitzlers "Traumnovelle"
 Germanistik Peter Klimitsch-Rathenböck Brüchige jüdische Lebenswelt am Ende der Wiener Moderne:Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" Studienarbeit Fernuniversität in Hagen Institut für neuere deutsche und
Germanistik Peter Klimitsch-Rathenböck Brüchige jüdische Lebenswelt am Ende der Wiener Moderne:Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" Studienarbeit Fernuniversität in Hagen Institut für neuere deutsche und
AUTORSCHAFT. Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com
 AUTORSCHAFT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Fragen und Antworten aus der letzten Stunde 2. Der Tod des Autors 3. Die Rückkehr des Autors 1. FRAGEN UND ANTWORTEN
AUTORSCHAFT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Fragen und Antworten aus der letzten Stunde 2. Der Tod des Autors 3. Die Rückkehr des Autors 1. FRAGEN UND ANTWORTEN
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen.
 Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Literatur ist die Kultur, die universal ist, die es in jeden Gesellschaft gibt. Die deutsche Literatur ist nicht unterschiedlich mit der indonesischen Literatur.
KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Literatur ist die Kultur, die universal ist, die es in jeden Gesellschaft gibt. Die deutsche Literatur ist nicht unterschiedlich mit der indonesischen Literatur.
Jahresplan für Deutsch Gymnasium Klasse 7 mit deutsch.werk 3
 Jahresplan für Deutsch Gymnasium Klasse 7 mit deutsch.werk 3 Bildungsstandards deutsch.werk 7 1. Sprechen Informieren zwischen zweckgebundenen, sachlichen Darstellungsweisen, die der Information dienen,
Jahresplan für Deutsch Gymnasium Klasse 7 mit deutsch.werk 3 Bildungsstandards deutsch.werk 7 1. Sprechen Informieren zwischen zweckgebundenen, sachlichen Darstellungsweisen, die der Information dienen,
Fachgruppe Deutsch Schuleigener Arbeitsplan Schuljahrgang 10 Liebfrauenschule Vechta
 1 Fachgruppe Deutsch Schuleigener Arbeitsplan Schuljahrgang 10 Liebfrauenschule Vechta Thematischer Schwerpunkt Kapitel im Kompetenzen 2 Methoden Lernkontrollen Lehrbuch 1 Formen modernen Erzählens: Interpretation
1 Fachgruppe Deutsch Schuleigener Arbeitsplan Schuljahrgang 10 Liebfrauenschule Vechta Thematischer Schwerpunkt Kapitel im Kompetenzen 2 Methoden Lernkontrollen Lehrbuch 1 Formen modernen Erzählens: Interpretation
Regeln für das richtige Zitieren
 Regeln für das richtige Zitieren Grundsätzlich: Zitate dürfen nicht die eigenständige Darstellung ersetzen, sondern: Zitate dienen als Belege im Rahmen der eigenen Darstellung. Ob aus dem Internet, aus
Regeln für das richtige Zitieren Grundsätzlich: Zitate dürfen nicht die eigenständige Darstellung ersetzen, sondern: Zitate dienen als Belege im Rahmen der eigenen Darstellung. Ob aus dem Internet, aus
t r a n s p o s i t i o n e n
 t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
Assignment Kate Chopin,The Story of an Hour (1894)
 Sprachen Jan Marschner Assignment Kate Chopin,The Story of an Hour (1894) Studienarbeit Jan Marschner Assignment Kate Chopin, The Story of an Hour (1894) In der Kurzgeschichte The Story of an Hour von
Sprachen Jan Marschner Assignment Kate Chopin,The Story of an Hour (1894) Studienarbeit Jan Marschner Assignment Kate Chopin, The Story of an Hour (1894) In der Kurzgeschichte The Story of an Hour von
11. Die Erzähltheorie
 11. Die Erzähltheorie Die Erzähltheorie, oder mit dem international anerkannten Terminus: die Narratologie (engl. narratology, frz. narratologie), ist die Wissenschaft vom Erzählen. Es handelt sich hierbei
11. Die Erzähltheorie Die Erzähltheorie, oder mit dem international anerkannten Terminus: die Narratologie (engl. narratology, frz. narratologie), ist die Wissenschaft vom Erzählen. Es handelt sich hierbei
SIGMUND FREUD
 SIGMUND FREUD 1856-1939 STRUKTURMODELL DER PSYCHE ERSTE TOPIK: TOPOGRAPHISCHES MODELL Bewusstsein Das ist die Sphäre, die von der Rationalität geprägt ist. Mit dem Bewusstsein nimmt das Individuum sich
SIGMUND FREUD 1856-1939 STRUKTURMODELL DER PSYCHE ERSTE TOPIK: TOPOGRAPHISCHES MODELL Bewusstsein Das ist die Sphäre, die von der Rationalität geprägt ist. Mit dem Bewusstsein nimmt das Individuum sich
PD Dr. Harald Neumeyer 1. Lehrveranstaltungen im Bereich der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft
 PD Dr. Harald Neumeyer 1 Lehrveranstaltungen im Bereich der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft 1.) Seminare an der Universität Bayreuth (seit WS 2000/01): SS 2010 Einführung in die Neuere deutsche
PD Dr. Harald Neumeyer 1 Lehrveranstaltungen im Bereich der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft 1.) Seminare an der Universität Bayreuth (seit WS 2000/01): SS 2010 Einführung in die Neuere deutsche
Einleitung. Textsorte Titel Autor Erscheinungsjahr Thema
 Kurzgeschichte Aufbau Einleitung mit den wesentlichen Informationen über den Text Hauptteil mit der Analyse und Interpretation + Gesamtinterpretation am Schluss Schluss mit der zusammenfassenden Beurteilung
Kurzgeschichte Aufbau Einleitung mit den wesentlichen Informationen über den Text Hauptteil mit der Analyse und Interpretation + Gesamtinterpretation am Schluss Schluss mit der zusammenfassenden Beurteilung
Lösungen zu Fragen zu Leseverstehen und Wortschatz
 DaF Zulassungsprüfung an der Universität Zürich, Muster / Lösungen Teil I 1 Lösungen zu Fragen zu Leseverstehen und Wortschatz total 25 Punkte Aufgabe 1 Ordnen Sie den acht im Text markierten Abschnitten
DaF Zulassungsprüfung an der Universität Zürich, Muster / Lösungen Teil I 1 Lösungen zu Fragen zu Leseverstehen und Wortschatz total 25 Punkte Aufgabe 1 Ordnen Sie den acht im Text markierten Abschnitten
Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs
 Germanistik Martin Zerrle Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 2 Zum Roman
Germanistik Martin Zerrle Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 2 Zum Roman
Verständlich schreiben
 Verständlich schreiben Ein Genie kann alles A ansprechend K kurz G gegliedert E einfach Einfach schreiben Wortwahl: geläufige Wörter verwenden, Fremdwörter erklären konkrete Wörter wählen, abstrakte Wörter
Verständlich schreiben Ein Genie kann alles A ansprechend K kurz G gegliedert E einfach Einfach schreiben Wortwahl: geläufige Wörter verwenden, Fremdwörter erklären konkrete Wörter wählen, abstrakte Wörter
Vertrag, Willenserklärung, Rechtsgeschäft
 Vertrag, Willenserklärung, Rechtsgeschäft I. Begriffe 1. Vertrag Der Vertrag ist eine Willenseinigung. Es handelt sich genauer um ein Rechtsgeschäft, das aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander
Vertrag, Willenserklärung, Rechtsgeschäft I. Begriffe 1. Vertrag Der Vertrag ist eine Willenseinigung. Es handelt sich genauer um ein Rechtsgeschäft, das aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander
Entwicklung des Parameters Erzählerpräsenz in der russischen Prosa
 Sprachen Monika Panhirsch Entwicklung des Parameters Erzählerpräsenz in der russischen Prosa Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Slavistik Seminar II: Entwicklung der Narrativität in der russischen
Sprachen Monika Panhirsch Entwicklung des Parameters Erzählerpräsenz in der russischen Prosa Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Slavistik Seminar II: Entwicklung der Narrativität in der russischen
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Verzeichnis der Grafiken und Folien
 Verzeichnis der Grafiken und Folien I. Was ist Erzählen? Sprecher- und Adressateninstanzen in der literarischen Erzählkommunikation (S.14) Folie 2 Die drei Grundkategorien der Erzähltextanalyse (S.15)
Verzeichnis der Grafiken und Folien I. Was ist Erzählen? Sprecher- und Adressateninstanzen in der literarischen Erzählkommunikation (S.14) Folie 2 Die drei Grundkategorien der Erzähltextanalyse (S.15)
Du bist der Mann! Bio Graphie. Leben Schreiben. Geschichten, die das Leben schreibt. Narratologie, Biographiearbeit und biblisches Erzählen
 Geschichten, die das Leben schreibt Narratologie, Biographiearbeit und biblisches Erzählen Prof. Dr. Ilse Müllner www.ilsemuellner.at 1 Geschichten erzählen Du bist der Mann! 2 Biographie Bio Graphie Leben
Geschichten, die das Leben schreibt Narratologie, Biographiearbeit und biblisches Erzählen Prof. Dr. Ilse Müllner www.ilsemuellner.at 1 Geschichten erzählen Du bist der Mann! 2 Biographie Bio Graphie Leben
4 REZEPTIONS- GESCHICHTE 5 MATERIALIEN 6 PRÜFUNGS- AUFGABEN. 2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
 4 REZEPTIONS- GESCHICHTE 5 MATERIALIEN 6 PRÜFUNGS- AUFGABEN 2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken Der Roman hat starke autobiografische Züge, da Kurbjuweit und seine Familie tatsächlich
4 REZEPTIONS- GESCHICHTE 5 MATERIALIEN 6 PRÜFUNGS- AUFGABEN 2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken Der Roman hat starke autobiografische Züge, da Kurbjuweit und seine Familie tatsächlich
Das Märchen im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Das Märchen im Fremdsprachenunterricht Wissenschaftliche Studie 1 Das Märchen im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Die folgende Arbeit untersucht die Textsorte
Germanistik Mohamed Chaabani Das Märchen im Fremdsprachenunterricht Wissenschaftliche Studie 1 Das Märchen im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Die folgende Arbeit untersucht die Textsorte
Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen"
 Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Das Verschwinden des Erzählers
 Welten Ostasiens 5 Das Verschwinden des Erzählers Erzähltheoretische Analysen von Erzählungen Tayama Katais aus den Jahren 1902-1908 von Verena Werner 1. Auflage Das Verschwinden des Erzählers Werner schnell
Welten Ostasiens 5 Das Verschwinden des Erzählers Erzähltheoretische Analysen von Erzählungen Tayama Katais aus den Jahren 1902-1908 von Verena Werner 1. Auflage Das Verschwinden des Erzählers Werner schnell
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Merkmale eines literarischen Textes beschreiben Kurzgeschichte: Neid ist grau mit gelben Punkten
 Thema: Inhaltsangabe 1 AB/A_Inhalt_04 Lösungsmuster: Merkmale eines literarischen Textes beschreiben Kurzgeschichte: Neid ist grau mit gelben Punkten Den Text verstehen 1a) Wer: Hauptfiguren: Schwestern
Thema: Inhaltsangabe 1 AB/A_Inhalt_04 Lösungsmuster: Merkmale eines literarischen Textes beschreiben Kurzgeschichte: Neid ist grau mit gelben Punkten Den Text verstehen 1a) Wer: Hauptfiguren: Schwestern
STILISTIK. PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Lehrstuhl für Germanistik an der Päd. Fakultät der Karlsuniversität in Prag
 STILISTIK PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Lehrstuhl für Germanistik an der Päd. Fakultät der Karlsuniversität in Prag tamara.buckova@pedf.cuni.cz Makrostilistik Problemkreis III Komposition / Textaufbau PhDr.
STILISTIK PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Lehrstuhl für Germanistik an der Päd. Fakultät der Karlsuniversität in Prag tamara.buckova@pedf.cuni.cz Makrostilistik Problemkreis III Komposition / Textaufbau PhDr.
Exzerpt Frank Kopanski "... sam säw zum nuosch" Anmerkungen zum Hochzeitsmahl in Heinrich Wittenwilers 'Ring'
 Germanistik Hans Erdmann Hans Erdmann Exzerpt Frank Kopanski "... sam säw zum nuosch" Anmerkungen zum Hochzeitsmahl in Heinrich Wittenwilers 'Ring' Exzerpt TU Dresden Fakultät Sprach-, Literatur- und
Germanistik Hans Erdmann Hans Erdmann Exzerpt Frank Kopanski "... sam säw zum nuosch" Anmerkungen zum Hochzeitsmahl in Heinrich Wittenwilers 'Ring' Exzerpt TU Dresden Fakultät Sprach-, Literatur- und
Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion
 Geisteswissenschaft Lars Okkenga Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion Prüfungsvorbereitung George Herbert
Geisteswissenschaft Lars Okkenga Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion Prüfungsvorbereitung George Herbert
J e n n i f e r L o r e n z e n - P e t h. S i n n k o n s t i t u t i o n u n d S i n n d e s t r u k t i o n
 J e n n i f e r L o r e n z e n - P e t h Erzählperspektive und Selbstreflexion in Thomas Manns Erzählungen S i n n k o n s t i t u t i o n u n d S i n n d e s t r u k t i o n I n h a l t s v e r z e i
J e n n i f e r L o r e n z e n - P e t h Erzählperspektive und Selbstreflexion in Thomas Manns Erzählungen S i n n k o n s t i t u t i o n u n d S i n n d e s t r u k t i o n I n h a l t s v e r z e i
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Was sagt der Totenschdel? Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Was sagt der Totenschdel? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT - Malerei interpretieren lernen Seite
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Was sagt der Totenschdel? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT - Malerei interpretieren lernen Seite
Ein blöder Tag. Grundwissen Deutsch: das Verb - Modus. PDF wurde mit pdffactory Pro-Prüfversion erstellt.
 Ein blöder Tag Modus Schließlich gibt es noch den Modus, die Aussageweise. Der Indikativ die Wirklichkeitsform ist die normale Form der Kommunikation. Wir hatten unglaubliches Glück: Unsere Mannschaft
Ein blöder Tag Modus Schließlich gibt es noch den Modus, die Aussageweise. Der Indikativ die Wirklichkeitsform ist die normale Form der Kommunikation. Wir hatten unglaubliches Glück: Unsere Mannschaft
Deutsch-Test: Konjunktiv I und II - indirekte Rede
 Name: Datum: Deutsch-Test: Konjunktiv I und II - indirekte Rede 1. Bilde die richtigen Formen im Konjunktiv I und II. Infinitiv Konjunktiv I Konjunktiv II glauben Er Er geben Es Es nehmen Sie Sie wissen
Name: Datum: Deutsch-Test: Konjunktiv I und II - indirekte Rede 1. Bilde die richtigen Formen im Konjunktiv I und II. Infinitiv Konjunktiv I Konjunktiv II glauben Er Er geben Es Es nehmen Sie Sie wissen
Die. Alfred Adlers. Zentrale Bedürfnisse des Menschen. Zentrale Bedürfnisse des Menschen. Einführung. Einführung. Einführung
 Zentrale Bedürfnisse des Menschen Die Alfred Adlers Bedürfnispyramide nach Maslow Zentrale Bedürfnisse des Menschen Bedürfnisse aller Menschen (nach Alfred Adler) 1. Das Bedürfnis dazuzugehören. 2. Das
Zentrale Bedürfnisse des Menschen Die Alfred Adlers Bedürfnispyramide nach Maslow Zentrale Bedürfnisse des Menschen Bedürfnisse aller Menschen (nach Alfred Adler) 1. Das Bedürfnis dazuzugehören. 2. Das
Anmerkung: Mit «(T)» sind die stärker theoriehaltigen Kapitel markiert.
 Anmerkung: Mit «(T)» sind die stärker theoriehaltigen Kapitel markiert. Vorwort 10 1. Einleitung 12 1.1 Das Verhältnis von Figur und Handlung 15 1.2 Wozu Figurenanalyse? 21 1.3 Auf der Suche nach einer
Anmerkung: Mit «(T)» sind die stärker theoriehaltigen Kapitel markiert. Vorwort 10 1. Einleitung 12 1.1 Das Verhältnis von Figur und Handlung 15 1.2 Wozu Figurenanalyse? 21 1.3 Auf der Suche nach einer
Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien
 Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien von Remigius Bunia ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien von Remigius Bunia ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Konstruktion der Vergangenheit
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Chris Lorenz Konstruktion der Vergangenheit Eine Einführung in die
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Chris Lorenz Konstruktion der Vergangenheit Eine Einführung in die
Zitate-Steckbrief. Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Friedrich Nietzsche ( ), deutscher Philosoph
 Zitate-Steckbrief Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Friedrich Nietzsche (1844 1900), deutscher Philosoph www.hypnoseausbildung-seminar.de Einleitung Die Worte einer großen Persönlichkeit der
Zitate-Steckbrief Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Friedrich Nietzsche (1844 1900), deutscher Philosoph www.hypnoseausbildung-seminar.de Einleitung Die Worte einer großen Persönlichkeit der
Städtisches Gymnasium Gütersloh Schulinternes Curriculum im Fach Deutsch - Jahrgangsstufe 9 (Stand )
 Städtisches Gymnasium Gütersloh Schulinternes Curriculum im Fach Deutsch - Jahrgangsstufe 9 (Stand 10.09. 2010) Thematische Ausrichtung Sprechen und Zuhören Kompetenzbereiche Lesen/Umgang mit Schreiben
Städtisches Gymnasium Gütersloh Schulinternes Curriculum im Fach Deutsch - Jahrgangsstufe 9 (Stand 10.09. 2010) Thematische Ausrichtung Sprechen und Zuhören Kompetenzbereiche Lesen/Umgang mit Schreiben
Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Ur-Ei zusammen sind, das nur bebrütet werden darf, um als herrliches Phänomen auf
 Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Ur-Ei zusammen sind, das nur bebrütet werden darf, um als herrliches Phänomen auf Goldflügeln in die Lüfte zu steigen.«aus Goethes Gedanken
Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Ur-Ei zusammen sind, das nur bebrütet werden darf, um als herrliches Phänomen auf Goldflügeln in die Lüfte zu steigen.«aus Goethes Gedanken
Ein Roman schreibt sich nicht von alleine.
 Ein Roman schreibt sich nicht von alleine. Viele Menschen haben tolle Geschichten im Kopf. Nur wenige verstehen es, sie auch so zu Papier zu bringen, dass sich ein Verlagslektorat dafür begeistern lässt.
Ein Roman schreibt sich nicht von alleine. Viele Menschen haben tolle Geschichten im Kopf. Nur wenige verstehen es, sie auch so zu Papier zu bringen, dass sich ein Verlagslektorat dafür begeistern lässt.
Über das Altern einer Generation
 12. Fachtagung der Deutschen Alterswissenschaftlichen Gesellschaft (DAWG) e.v. 15./ 16. September 2006 Ludwig-Windthorst Windthorst-Haus Haus,, Lingen Vorstellung der Diplomarbeit Die 68er Über das Altern
12. Fachtagung der Deutschen Alterswissenschaftlichen Gesellschaft (DAWG) e.v. 15./ 16. September 2006 Ludwig-Windthorst Windthorst-Haus Haus,, Lingen Vorstellung der Diplomarbeit Die 68er Über das Altern
Stoffverteilung Fach: Deutsch Klassenstufe: 10
 Stoffverteilung Fach: Deutsch Klassenstufe: 10 Stundenumfang/ Unterrichtswochen Unterrichtseinheit/ Inhalte 12-14 Stunden Streiten mit Kultur (Doppelklick 10, S. 12-26) 10 12 Stunden Nanotechnologie Technikverständnis
Stoffverteilung Fach: Deutsch Klassenstufe: 10 Stundenumfang/ Unterrichtswochen Unterrichtseinheit/ Inhalte 12-14 Stunden Streiten mit Kultur (Doppelklick 10, S. 12-26) 10 12 Stunden Nanotechnologie Technikverständnis
