1. Einleitende Bemerkungen
|
|
|
- Maria Otto
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ISSN KALBOTYRA (3) ZU STRUKTUR UND MODUSGEBRAUCH IM UNABHÄNGIGEN INDIREKTEN REFERAT IN DEUTSCHEN UND LITAUISCHEN POLITISCHEN KONTEXTEN Jurgita Sinkevičienė Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas Universiteto g. 5, LT Vilnius Tel.: El. paštas: jurgita.sinkeviciene@flf.stud.vu.lt 1. Einleitende Bemerkungen Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem unabhängigen indirekten Referat in Bezug auf seine Struktur bzw. auf den Modusgebrauch in deutschen und litauischen politischen Kontexten. Das Ziel der Forschung besteht darin, einige typische Merkmale des unabhängigen indirekten Referats im Deutschen und im Litauischen herauszuarbeiten und die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten in beiden Sprachen festzustellen. Der Gegenstand der Arbeit ist der Gebrauch des Modus im unabhängigen indirekten Referat, der besonders in der litauischen Sprachforschung zu wenig beachtet wird. Als Korpusgrundlage für die Analyse wurden die Internetseiten und gewählt, weil die beiden Quellen eine Menge von politischen Texten enthalten, die den heutigen Gebrauch des indirekten Referats liefern. Das Belegkorpus umfasst insgesamt 1000 Beispiele mit dem indirekten Referat, 500 litauische und 500 deutsche, die vom November 2008 bis Februar 2009 gesammelt wurden. Bei der Behandlung der theoretischen Grundlage und bei der Bestimmung der wichtigsten Begriffe wie das abhängige und das unabhängige indirekte Referat stützt man sich auf solche Autoren wie C. Fabricius-Hansen, R. Thieroff, G. Zifonun, sowie auf die Duden- Grammatik von Bei der Untersuchung wird die Methode der Analyse und Sortierung, des Vergleichs, der statistischen Auswertung des deutschen und litauischen Belegkorpus auf der deskriptiven Ebene angewandt. 66
2 2. Zum Problem der Rede- und Gedankenwiedergabe in der deutschen und litauischen Grammatiktheorie In den meisten Grammatiken des Deutschen wird das Thema der Redewiedergabe mehr oder weniger ausführlich behandelt. Zu beachten ist allerdings, dass für diesen Phänomenbereich verschiedene Termini in Gebrauch sind. Unter der Redewiedergabe werden traditionell die direkte Rede und die indirekte Rede verstanden (Buscha/Zoch 1984; Jung 1980; Duden- Grammatik 1998; Helbig/Buscha 2001; Götze/Hess-Lüttich 1993). Laut der Duden-Grammatik wird in der direkten Redewiedergabe eine wörtliche Äußerung angeführt, d.h. so, wie sie tatsächlich gemacht wird. Die Beziehung zwischen dem Sprecher, dem Urheber der Äußerung, und dem Hörer sei direkt und unmittelbar, z.b. (1) Hans behauptet: Davon habe ich nichts gewusst. In der indirekten Redewiedergabe dagegen werde eine Äußerung mittelbar wiedergegeben, von ihr werde berichtet, z.b. (2) Hans behauptet, dass er nichts davon gewusst habe (Duden 1998, 164). Laut H. Weinrich können bei der direkten Redewiedergabe spezifisch dialogische Elemente der Originaläußerung wie Gliederungssignale, Dialogpartikeln, Modalpartikeln und Interjektionen sowie Grußformeln, Wunschformeln, Kraftausdrücke und Ähnliches erhalten bleiben. Bei der indirekten Redewiedergabe zitiere der Sprecher eine Äußerung nicht in ihrer Originalfassung, sondern in einer abgewandelten, an den Kontext angepassten Form (Weinrich 1993, ). Im Unterschied zu Duden-Grammatik und H. Weinrich geht U. Engel vom Text aus und verwendet die Termini direkte Textwiedergabe und indirekte Textwiedergabe. Bei der Festlegung der Definitionen geht er von der Textschichtung aus. Bei der Textschichtung gebe es immer einen Primärtext d.h. eine originale Äußerung, z.b. (3) Der Baum hat keine Chance mehr. Bei der Übernahme der originalen Äußerung in einen neuen Text werde sie zum Sekundärtext. Der Sekundärtext könne mit dem Primärtext identisch sein. Dann ist die direkte Textwiedergabe vorhanden, z.b. (4) Oskar sagt: Der Baum hat keine Chance mehr. Der Sekundärtext könne aber auch gegenüber dem Primärtext nach bestimmten Regeln verändert werden. Dann handelt es sich um die indirekte Textwiedergabe, z.b. (5) Oskar behauptete, dieser Baum habe keine Chance mehr (Engel 2004, 65 67). E. Brendel, J. Meibauer, M. Steinbach vertreten einen anderen Standpunkt. In ihrem Aufsatz Aspekte einer Theorie des Zitierens kritisieren sie den Terminus der Redewiedergabe überhaupt. Die Sprachforscher behaupten, dass der Terminus unglücklich erscheint, wenn man sich mit Redewiedergabe nicht nur auf Wiedergabe mündlicher oder schriftlicher Äußerungen beziehen will, sondern auch auf Wiedergabe von Gedachtem (Brendel / Meibauer / Steinbach 2007, 6). 67
3 R. Thieroff definiert die Redewiedergabe wie folgt: Redewiedergabe heißt, dass der Sprecher deutlich macht, dass ein anderer oder er selbst in einer bestimmten Situation etwas gesagt (gedacht/geschrieben) hat oder sagen (denken/schreiben) will oder sagen (denken/ schreiben) kann (Thieroff 2007, 212). Die jüngste Auflage der Duden-Grammatik verwendet daher den Terminus Referat, der auf C. Fabricius-Hansen zurückgeht. Im engeren Sinne versteht man darunter die Wiedergabe von sprachlichen Äußerungen d.h. indirekte Redewiedergabe und im weiteren Sinne umfasst der Begriff auch die Wiedergabe von Gedachtem d.h. die Gedankenrepräsentation (Duden 2005, 529). C. Fabricius-Hansen unterscheidet das direkte Referat und das indirekte Referat. Das indirekte Referat unterscheidet sich von dem direkten Referat dadurch, dass bei ihm alle deiktischen Kategorien, alle temporalen und modalen Ausdrücke dem aktuellen Sprecher d.h. dem Referenten zugerechnet sind (Fabricius-Hansen 2002, 11). Weiterführend ist zu bemerken, dass innerhalb des indirekten Referats die Duden-Grammatik zwischen dem abhängigen und unabhängigen Referat unterscheidet, je nach dem, ob die Redewiedergabe in syntaktisch selbstständigen Sätzen oder in syntaktisch untergeordneten Sätzen erfolgt (Duden 2005, ). Das Referat ist ein umfangreicher Begriff, der nicht nur die direkte Redewiedergabe und die indirekte Redewiedergabe sondern auch die berichtete Rede und die erlebte Rede umfasst. Als syntaktisch unabhängiges indirektes Referat betrachtet man die berichtete Rede und die erlebte Rede. Laut G. Helbig und J. Buscha zeichnet sich die berichtete Rede dadurch aus, dass bei ihr mehrere indirekte Äußerungen aufeinander folgen und das redeeinleitende Verb bzw. der redeanführende Ausdruck nicht wiederholt wird. Die Sprachforscher verweisen darauf, dass bei der berichteten Rede aufgrund des fehlenden Hauptsatzes die Nebensätze nicht in Form von eingeleiteten Nebensätzen stehen, sondern als selbstständige Sätze auftreten. Die Grammatiker betonen, dass in solchen Sätzen der Konjunktiv obligatorisch ist, da sonst die Sätze nicht als abhängig, sondern als selbstständige Hauptsätze und die Rede nicht als indirekt und vermittelt, sondern als direkte Äußerung des Sprechers verstanden würde (Helbig/Buscha 2001, 177). R. Thieroff hebt hervor, dass die berichtete Rede nicht nur dann vorliege, wenn das redeeinleitende Verb nicht wiederholt wird, sondern sie komme häufig auch ganz ohne redeeinleitendes Verb aus, z.b. (6) [ ] Er lachte: Was zeichnet Sie denn, Faber? (7) Ich zeichnete auf das Marmor-Tischlein [ ], sein Lachen störte mich derart, dass ich einfach nicht zu sagen wusste. (8) Ich sei ja so schweigsam (Thieroff 1992, 258). Im Bereich der berichteten Rede ist der Gebrauch des Modus eine wichtige und aktuelle Frage. Die Grammatiken verweisen darauf, dass bei der unabhängigen indirekten Redewiedergabe der Konjunktiv verwendet wird. Für den Gebrauch des Konjunktivs im Funktionsbereich des Referats haben G. Zifonun et al. (Zifonun et al. 1999, 1753) die Bezeichnung Indirektheitskonjunktiv eingeführt. Diese Bezeichnung hat die Duden-Grammatik übernommen. 68
4 Die erlebte Rede betrachtet C. Fabricius-Hansen als eine typische Erscheinungsform der syntaktisch unabhängigen indirekten Gedankenwiedergabe (Fabricius-Hansen 2002, 12). In der Grammatiktheorie wird darauf hingewiesen, dass bei der erlebten Rede keine Transformation des Modus erfolgt, d.h. sie ist nur durch die Pronominal- und Tempusverschiebung gekennzeichnet, z.b. (9) Der Bäcker war schlechter Laune. Er musste jetzt wirklich der Tochter die Wahrheit erzählen. Es ging nicht an, dass sie in dem Alter an den Weihnachtsmann glaubte! (Duden 2006, 530). Aus dem Grund, dass sich dieser Beitrag hauptsächlich auf den Modusgebrauch im unabhängigen indirekten Referat konzentriert, wird die erlebte Rede in diesem Artikel nicht weiter behandelt. Da diese Arbeit eine kontrastive deutsch-litauische Untersuchung darstellt, ist es wichtig und nötig, auf die Grammatiktheorie des Litauischen zur Frage der Redewiedergabe einzugehen. Der Terminus des Referats, der in dieser Arbeit bevorzugt wird, ist in der litauischen Grammatiktheorie noch nicht vorhanden. Für die Wiedergabe fremder Worte und Gedanken ist im Litauischen die Bezeichnung netiesioginė kalba d.h. indirekte Rede verwendet, die auch in vielen deutschen Grammatiken vorkommt. Die indirekte Rede- und Gedankenwiedergabe wird im Deutschen durch den redekommentierenden Satz eingeführt und in der litauischen Grammatik werden kalbėjimo ir mąstymo veiksmažodžiai, d. h. die Verben des Sagens und Denkens als redeanführende Ausdrücke hervorgehoben (Sirtautas/Grenda 1988, 180). Die Grammatiker verweisen darauf, dass im untergeordneten Satz neben dem Konjunktiv und Indikativ auch die Partizipien und Gerundien auftreten. Das folgende Kapitel soll einen Überblick über die syntaktischen Eigenschaften des unabhängigen indirekten Referats in beiden Sprachen geben und dabei zeigen, dass das unabhängige indirekte Referat nicht nur für das Deutsche, sondern auch für das Litauische kennzeichnend ist. 3. Vergleich der Strukturen des unabhängigen indirekten Referats im Deutschen und Litauischen Wie es schon früher erwähnt wurde, tritt das unabhängige indirekte Referat im Deutschen in selbständigen Sätzen auf. Der Duden-Grammatik zufolge bildet das unabhängige indirekte Referat im Textzusammenhang eine zweite Ebene, die durch die Verwendung des Indirektheitskonjunktivs markiert ist, z.b. (10) Auch hier gibt es Häuser, wo Südländer wohnen: ein schwarzäugiger, braunhäutiger Halbwüchsiger kam in Begleitung eines ihm ähnlichen Kindes zur Tür herein und tauschte an der Theke eine große leere Weinflasche gegen eine volle um; dabei stellte er das Kind als seinen Onkel vor. Er gehe hier in die Volksschule, wo man eine besondere 69
5 70 Ausländerklasse eingerichtet habe, welche Bunte Klasse heiße: nicht wegen der Farbstifte, die fast die einzigen Unterrichtswerkzeuge seien, sondern der verschiedenen Hautfarben. Der Direktor sei stolz auf diese Klasse; [...]. [ ]. Das Kind neben dem Erzähler hob dabei einen Holzprügel und schoss mit diesem in die Runde. Die Duden-Grammatik betont, dass ohne den Konjunktiv diese zweite Ebene nicht oder nicht eindeutig erkennbar wäre. Laut der Duden-Grammatik gibt der Referent mit dem Indirektheitskonjunktiv zu verstehen, dass er den Satzinhalt als indirekte Redewiedergabe verstanden wissen will, für die er selber im Sprechzeitpunkt keinen Gültigkeitsanspruch erhebt (Duden 2005, 538). W. Flämig geht davon aus, dass der Indirektheitskonjunktiv im unabhängigen indirekten Referat nicht nur fremde Worte markiert, sondern auch die syntaktische Abhängigkeit bezeichnet. Der Sprachforscher bemerkt, dass das unabhängige indirekte Referat meistens durch den Konjunktiv I markiert wird. Die Fälle, wo der Konjunktiv I mit dem Indikativ zusammenfällt, werden automatisch durch den Konjunktiv II ersetzt, ohne dass dadurch eine inhaltliche Verschiebung einträte. Es ist bekannt, dass die Formen des Konjunktivs II auch den Modus Irrealis markieren. In dieser Funktion sei ein Austausch des Konjunktivs II mit dem Konjunktiv I nicht möglich. Laut W. Flämig gilt der Konjunktiv I als Normalmodus des unabhängigen indirekten Referats und der Konjunktiv II gilt als Ausdruck ablehnender Stellungnahme oder größeren Abstandes von der objektiven Realität (Flämig 1962, 44 52, 61). Die gleiche Meinung vertreten auch K. E. Heidolph, W. Flämig und W. Motsch, indem sie behaupten, dass mit dem Konjunktiv II, wenn er nicht notwendigerweise als Ersatz für den Konjunktiv I steht, der Referent zeige, dass er der Äußerung eine geringere Geltung beimesse (Heidolph/Flämig/Motsch 1981, 530). In den neueren Grammatiken ist eine andere Meinung vertreten. Im Gegensatz zu W. Flämig, K. E. Heidolph, W. Motsch verweisen E. Hentschel und H. Weydt auf G. Helbig und J. Buscha und behaupten, dass ein Zusammenhang zwischen der Distanz zur wiedergegebenen Äußerung und dem Gebrauch des Konjunktivs nicht nachweisbar sei (Hentschel/Weydt 1990, 108). C. Fabricius-Hansen vertritt die gleiche Meinung wie E. Hentschel und H. Weydt und betont, dass zur Wahl zwischen dem Konjunktiv I und Konjunktiv II stilistische und soziolinguistische Aspekte eine Rolle spielen. Welchen Stellenwert man einer konkreten unnötigen Konjunktiv II-Form in einem gegebenen Text oder Diskurs beimesse, hänge natürlich sehr stark davon ab, ob es sich um ein Gespräch handele, in dem sowieso dauernd die Konjunktiv II-Formen im indirekten Referat vorkommen oder um einen Zeitungsartikel, der sich sonst streng an die Regel Konjunktiv I, wenn eindeutig! halte (Fabricius-Hansen 1997, 31). Die Sprachforscherin weist darauf hin, dass es immer noch umstritten ist, ob mit einer Konjunktiv II-Form in Fällen, wo der Konjunktiv I deutlich genug wäre, eine größere Distanz zu dem Referierten als mit der entsprechenden Konjunktiv I-Form ausgedrückt wird, z.b. (11) Mag sein, dass Helmut Schlesinger und Co. Dem Druck weichen mussten. Aber sie können nicht im Ernst hoffen, dass es mit den europaweiten Spekulationen nun zu Ende wäre. Jedenfalls nicht, wenn, wie der Bundesbankchef sagt, bisher Spekulanten ein
6 unfreundliches Dominospiel betrieben hätten, wo eine Währung nach der anderen gekippt wurde. Warum sollte dieses Spiel jetzt nicht fortgesetzt werden? Laut C. Fabricius-Hansen muss die erste Konjunktiv-II-Form (wäre) nach der Distanzierungsannahme eine besondere Distanz ausdrücken, während die zweite Form (hätten) als Ersatz zu erklären ist, d.h. dass sie nicht als eine Distanz-Form betrachtet werden kann. Die Sprachforscherin betont, dass bisher kein methodisches Verfahren entwickelt worden ist, mit dem nachgewiesen werden könnte, dass die Distanz vom Referenten durch den Konjunktiv II zum Ausdruck gebracht wird (Fabricius-Hansen 1997, 30). Was das Litauische betrifft, ist zu bemerken, dass in dieser Sprache andere formale Mittel zur Markierung des unabhängigen indirekten Referats vorhanden sind. A. Valeckienė verweist darauf, dass die Worte einer anderen Person durch zwei Partizipien markiert werden können, z.b. (12a) Jis esąs ir vilką matęs. (12b) Er habe wohl auch den Wolf gesehen. (Valeckienė 1998, 88). Im Beispiel (12a) tritt das Partizip Präsens Aktiv im Nominativ Singular esąs als Hilfsverb auf und bildet das Perfekt des Wiedererzählmodus (WM) in Verbindung mit dem Nominativ Singular des Partizips Präteritum Aktiv matęs. V. Valskys analysiert in seinem Aufsatz Netiesioginės nuosakos raiška bevardės giminės dalyviais die Verwendung des im Präsens stehenden Partizips esą und behauptet, dass es über mehrere Funktionen verfügt. Laut V. Valskys tritt die Partizipialform esą auch als Modalpartikel (MP) auf, wenn sie nicht zur Bildung der Tempora des Wiedererzählmodus dient. Seine Behauptung bestätigt das folgende Beispiel, wo esą als Modalpartikel zu betrachten ist: (13a) Personažus aš esą renkuosi kaip draugus ar pažįstamus. (13b) Man sagt, dass ich mir die handelnden Personen wie Freunde oder Bekannte aussuche. (Valskys 2002, 33). 4. Ergebnisse der Analyse Die Untersuchung hat ergeben, dass das litauische unabhängige indirekte Referat im Vergleich zum Deutschen ganz selten gebraucht wird. Im Deutschen wurden mehr als 38% der analysierten Kontexte festgestellt, die das unabhängige indirekte Referat enthalten (etwa 300 Kontexte), im Litauischen machen sie dagegen nur 2% (9 Kontexte) aus. Aus der Untersuchung ist ersichtlich, dass im Deutschen und im Litauischen unterschiedliche formale Mittel zur Markierung des unabhängigen indirekten Referats vorhanden sind. Im Deutschen wird das unabhängige indirekte Referat hauptsächlich durch den Indirektheitskonjunktiv markiert, z.b. (14) Seinen Nachfolger im Auswärtigen Amt, Frank-Walter Steinmeier, nahm Fischer dagegen in Schutz. Der SPD-Kanzlerkandidat sei weder in der Finanzkrise noch beim Desaster der hessischen Genossen vordringlich gefragt gewesen. Bei den Vorgängen in Hessen 71
7 72 hätte die SPD-Parteiführung in Berlin wenig machen können. Die hessische SPD-Chefin Andrea Ypsilanti habe es versäumt, den rechten Flügel ihrer Partei bei der geplanten Duldung durch die Linkspartei einzubinden. Wie das Beispiel (14) zeigt, wird das unabhängige indirekte Referat in Form von selbständigen Sätzen gebraucht. In jedem Satz, der zum indirekten Referat gehört, tritt der Konjunktiv als obligatorisches Kennzeichen eines unabhängigen indirekten Referats auf. Der vorangestellte Satz im Beispiel (14) gilt als redekommentierender Satz, dessen Kern phraseologische Einheit in Schutz nehmen bildet. Der Konjunktiv Präsensperfekt Passiv (sei gefragt gewesen) als auch der Konjunktiv Präteritumperfekt Aktiv (hätte machen können) und der Konjunktiv Präsensperfekt Aktiv (habe versäumt) dienen zum Ausdruck der Vorzeitigkeit in Bezug auf das Geschehen im redekommentierenden Satz, wo der Indikativ Präteritum verwendet wird. Aus dem deutschen Belegkorpus geht hervor, dass neben dem redekommentierenden Satz auch die redekommentierenden Phrasen zur Einführung des unabhängigen indirekten Referats dienen, z.b. (15) Nach Steinmeiers Ansicht soll die Europäische Union (EU) etwa geplante Großinvestitionen vorziehen und gemeinsame Projekte etwa im Energiebereich beschleunigen, um drohende Beschäftigungsprobleme abzufedern. Weiter sei ein zusätzliches EU-Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen erforderlich. Im Beispiel (15) wird das unabhängige indirekte Referat, das im Konjunktiv Präsens Aktiv steht (sei erforderlich), durch den vorangestellten Satz mit der Präpositionalphrase nach Steinmeiers Ansicht eingeführt. Der Konjunktiv Präsens Aktiv (sei erforderlich) zeigt die Gleichzeitigkeit des Geschehens im unabhängigen indirekten Referat in Bezug auf das Geschehen im Satz mit redekommentierender Präpositionalphrase. Wie das Belegkorpus zeigt, kann das unabhängige indirekte Referat durch einen redekommentierenden Satz, der ein direktes Referat enthält, eingeführt werden, z.b. (16) Es ist offen, sagt auch Martin Krems, Sprecher des sachsen-anhaltinischen Innenministeriums. In Magdeburg trete das Kabinett ebenfalls am Dienstag vor der entscheidenden Sitzung in der Länderkammer zusammen. Beratungsbedarf bestehe in Sachen Sinnhaftigkeit der Online-Durchsuchungen und der Kompetenzverteilung von Bund und Land. Allerdings müsse der vom Bundestag verabschiedete Gesetzestext erst noch gründlich gelesen werden. Im Beispiel (16) tritt das unabhängige indirekte Referat in drei hintereinander stehenden Sätzen nach dem Satz mit dem direkten Referat auf. In allen drei Sätzen mit dem unabhängigen indirekten Referat wird der Konjunktiv Präsens verwendet, der zum Ausdruck der Nachzeitigkeit in Bezug auf die Handlung des redekommentierenden Satzes dient. Aus der Analyse des Belegkorpus geht hervor, dass sich das unabhängige indirekte Referat im Deutschen durch folgende Struktur auszeichnet: RKS/RKPh: UIR [Konj] 1 1 RKS: redekommentierender Satz; RKPh: redekommentierende Phrase; UIR: unabhängiges indirektes Refe- RKS: redekommentierender Satz; RKPh: redekommentierende Phrase; UIR: unabhängiges indirektes Referat; Konj: Konjunktiv.
8 Bei der Analyse des litauischen Belegkorpus wurde festegestellt, dass im Litauischen das unabhängige indirekte Referat wie im Deutschen in selbständigen Sätzen auftritt, z.b. (17) Seimo senbuvių nuomone, naujosios Vyriausybės programoje stiprus tik mokesčių reformos, arba kitaip vadinamas finansų sistemos stabilizavimo skyrius. Visa kita esą labai nekonkretu, tarsi kokio jaunesniojo mokslinio bendradarbio parašytas mokslo instituto darbo planas. (18) Kartu jis pripažino, kad kai kurie valdžios sprendimai buvo klaidingi, pavyzdžiui, už Mažeikių naftos akcijas gautus pinigus iš karto išmokėti kaip kompensacijas už prarastus sovietinius indėlius. Esą kur kas naudingiau būtų buvę juos panaudoti mokykloms renovuoti. Im Beleg (17) tritt das unabhängige indirekte Referat nach einem selbständigen Satz mit einer redekommmentierenden Nominalphrase auf und im Beleg (18) steht das unabhängige indirekte Referat nach einem redekommentierenden Satz, der syntaktisch selbständig ist und ein Verb des Sagens enthält. Wie die Beispiele (17), (18) zeigen, steht das unabhängige indirekte Referat in beiden Kontexten neben dem abhängigen indirekten Referat. Das unabhängige indirekte Referat folgt in einem selbständigen Satz und die Form esą gilt als Kennzeichen des indirekten Referats. Die Partizipialform esą ist vom suppletiven Verb būti abgeleitet. Im Beispiel (17) ist das Partizip esą das Präsens Aktiv des Wiedererzählmodus und im Beispiel (18) kann es als Modalpartikel betrachtet werden. Neben esą tritt im Beispiel (18) der Konditional Präteritum auf (būtų buvę), der auf die Irrealität des Geschehens hinweist. (19) Kita politikų skola visuomenei tuzinas garsių analitinių pažymų, kurių Seimas prašė iš Valstybės saugumo departamento (VSD), bet taip jų ir nesulaukė. Akademinio politologų klubo pirmininkas Justas Šireika įsitikinęs, kad ši skola itin skaudi gyventojams ir pavojinga demokratijai. Esą tai rodo, jog Lietuva tolsta nuo modernios šalies idealo ir virsta policine valstybe. Im Beispiel (19) tritt das unabhängige indirekte Referat nach dem syntaktisch selbständigen Satz auf, der ein abhängiges indirektes Referat enthält und als redekommentierender Satz gilt. Das unabhängige indirekte Referat ist durch die Modalpartikel esą, die in Verbindung mit dem Indikativ Präsens Aktiv steht, markiert. Der Indikativ Präsens Aktiv (rodo) dient im unabhängigen indirekten Referat zum Ausdruck der Gleichzeitigkeit in Bezug auf das Geschehen im redekommentierenden Satz mit dem Indikativ Präsens. Wie das Belegkorpus gezeigt hat, enthält das unabhängige indirekte Referat im Litauischen folgende Struktur: RKS/RKPh: UIR [WM-esą/MP-esą +Ind/Konj]. 2 Abschließend lässt sich sagen, dass das unabhängige indirekte Referat im Litauischen (2%) im Vergleich zum Deutschen (38%) sehr selten gebraucht wird. Es lässt sich anscheinend durch den Einfluss sämtlicher Mundarten und der russischen Sprache, unter deren Wirkung das Litauische lange Zeit stand, erklären. Darauf gibt es auch Hinweise in der litauischen Grammatiktheorie (LKE 2008, 371, Valskys 2002, 34). 2 WM: Wiedererzählmodus; MP: Modalpartikel; Ind: Indikativ. 73
9 Weiterhin ist zu bemerken, dass beim Vergleich des unabhängigen indirekten Referats im Deutschen und Litauischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen sind. Was die Struktur des unabhängigen indirekten Referats betrifft, wird es sowohl im Deutschen als auch im Litauischen in selbständigen Sätzen realisiert. Beide Sprachen weisen bestimmte Unterschiede im Modusgebrauch auf. Die Untersuchung des Belegkorpus hat ergeben, dass im unabhängigen indirekten Referat des Deutschen der Indirektheitskonjunktiv vorkommt, und in den entsprechenden Strukturen des Litauischen wird meistens die Partizipform esą, die als Tempus des Wiedererzählmodus (siehe Beispiel 17) oder als Modalpartikel (siehe Beispiele 18, 19) fungiert, in Verbindung mit dem Konjunktiv oder Indikativ verwendet. LITERATURVERZEICHNIS Brendel E., Meibauer J., Steinbach M Aspekte einer Theorie des Zitierens. In: Brendel E., Meibauer J., Steinbach M. Zitat und Bedeutung. Linguistische Berichte. Sonderheft 15/2007. Hamburg. S Buscha J., Zoch I Der Konjunktiv. Leipzig. Duden 4. Die Grammatik Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. Duden Die Grammatik. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. Eckert R., Bukevičiūtė E. J., Hinze F Die baltischen Sprachen. Leipzig, Berlin, München. Engel U Deutsche Grammatik. München. Fabricius-Hansen C Nicht direktes Referat im Deutschen Typologie und Abgrenzungsprobleme. In: Fabricius-Hansen C., Leirbukt O., Letens O Modus, Modalverben, Modalpartikeln. Trier. S Fabricius-Hansen C Der Konjunktiv als Problem des Deutschen als Fremdsprache. In: Aspekte der Modalität im Deutschen auch in kontrastiver Sicht. Hrsg. Friedhelm Debus. Hildesheim. S Flämig W Zum Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. Inhalte und Gebrauchsweisen. Berlin. Götze L., Hess-Lüttich E.W.B Grammatik der deutschen Sprache. München. Heidolph K. E., Flämig W., Motsch W Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin. Helbig G., Buscha J Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin, München, Wien, Zürich, New York. Hentschel E., Weydt H Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin, New York. Jung W Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig. LKE Lietuvių kalbos enciklopedija. Ambrazas V. ir kt. Vilnius. Sirtautas V., Grenda Č., Lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius. Thieroff R Wer spricht? Über die Formen der Redewiedergabe im Deutschen. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn. S Thieroff R Das finite Verb im Deutschen. Tempus Modus Distanz. Tübingen. Valeckienė A Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius. Valskys V Netiesioginės nuosakos raiška bevardės giminės dalyviais. In: Žmogus ir žodis. Nr Vilnius. S
10 Weinrich H Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. Zifonun G., Hoffmann L., Strecker B. et al Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin, New York. QUELLEN DES BELEGKORPUS [ ] [ ] APIE SINTAKSIŠKAI SAVARANKIŠKO NETIESIOGINIO REFERATO STRUKTŪRĄ IR NUOSAKŲ VARTOJIMĄ VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ POLITINIUOSE KONTEKSTUOSE Jurgita Sinkevičienė Santrauka Straipsnyje lyginami sintaksiškai savarankiško netiesioginio referato raiškos būdai vokiečių ir lietuvių kalbose. Taip vadinamas sintaksiškai savarankiškas netiesioginis referatas suprantamas kaip referento perteikta informacija savarankiškuose sakiniuose, t.y. be kito asmens kalbą įvedančių sakinių ar frazių. Tyrimas parodė, kad vokiečių kalboje skirtingai nei lietuvių šis reiškinys yra gan dažnas (38%), lietuvių kalboje jis aptinkamas pakankamai retai (2%). Tiek vokiečių, tiek lietuvių kalbose sintaksiškai savarankiškas netiesioginis referatas realizuojamas savarankiškuose sakiniuose, skirtumas glūdi tame, kad vokiečių kalboje pagrindinis išskiriamasis referato bruožas yra tariamoji nuosaka, o lietuvių kalboje esamojo laiko bevardės giminės dalyvis esą vartojamas ir kaip netiesioginės nuosakos forma, ir kaip modalinė dalelytė kartu tiek su tiesiogine, tiek su tariamąja nuosakomis. Įteikta 2009 m. birželio mėn. 75
Wirklichkeitsfonn Möglichkeitsfonnen <nur berichtet> ("ohne Gewähr", nicht gesichert) <nur gedacht, aber nicht wirklich>
 Bezeichnung Leistung Die Modi (Singular: Der Modus, Plural: Die Modi) Überblick über die Modi Der Indikativ Die Konjunktive Konjunktiv 11 Der Imperativ Wirklichkeitsfonn Möglichkeitsfonnen
Bezeichnung Leistung Die Modi (Singular: Der Modus, Plural: Die Modi) Überblick über die Modi Der Indikativ Die Konjunktive Konjunktiv 11 Der Imperativ Wirklichkeitsfonn Möglichkeitsfonnen
ÜBER DIE VERBEN ALS AUSDRUCKSMITTEL DER MODALITÄT IM DEUTSCHEN UND LITAUISCHEN
 ISSN 1392-1517. KALBOTYRA. 2005. 55(3) ÜBER DIE VERBEN ALS AUSDRUCKSMITTEL DER MODALITÄT IM DEUTSCHEN UND LITAUISCHEN Irena Marija Norkaitienė Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas Universiteto
ISSN 1392-1517. KALBOTYRA. 2005. 55(3) ÜBER DIE VERBEN ALS AUSDRUCKSMITTEL DER MODALITÄT IM DEUTSCHEN UND LITAUISCHEN Irena Marija Norkaitienė Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas Universiteto
Philosophisches Schreiben: Ethik und Wirtschaft Bezug zu anderen Autoren (Sitzung 6: )
 TU Dortmund, Wintersemester 2011/12 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Philosophisches Schreiben: Ethik und Wirtschaft Bezug zu anderen Autoren (Sitzung 6: 17.11.2011) 1. Plan
TU Dortmund, Wintersemester 2011/12 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Philosophisches Schreiben: Ethik und Wirtschaft Bezug zu anderen Autoren (Sitzung 6: 17.11.2011) 1. Plan
 Deutsch aus ferner Nähe DAFN 2005.03.20. E-Mail: fujinawa@ll.ehime-u.ac.jp 1. Konjunktiv subjunctive 1 2 2 2 (1)a. Wenn ich ein Millionär wäre, würde ich eine Weltreise machen. b. Ach, wenn ich doch ein
Deutsch aus ferner Nähe DAFN 2005.03.20. E-Mail: fujinawa@ll.ehime-u.ac.jp 1. Konjunktiv subjunctive 1 2 2 2 (1)a. Wenn ich ein Millionär wäre, würde ich eine Weltreise machen. b. Ach, wenn ich doch ein
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
4 Der Konjunktiv. Zeitformen. (Die Möglichkeitsform) Wenn ich ein Vöglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir
 4 Der Konjunktiv (Die Möglichkeitsform) Wenn ich ein Vöglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir (was ich nicht bin) (die ich nicht habe) (was ich nicht kann) Nicht-Wirklichkeit (Irrealis)
4 Der Konjunktiv (Die Möglichkeitsform) Wenn ich ein Vöglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir (was ich nicht bin) (die ich nicht habe) (was ich nicht kann) Nicht-Wirklichkeit (Irrealis)
Deutsch Grammatik 1 / 12 Der Konjunktiv I und II
 Deutsch Grammatik 1 / 12 Der Konjunktiv I und II Wenn der Konjunktiv nicht wäre, hätte ich keine Sorgen! Der Konjunktiv 2 / 12 Der Modus (Aussageweise) Der Modus des Verbs wird gebraucht, wenn man ausdrücken
Deutsch Grammatik 1 / 12 Der Konjunktiv I und II Wenn der Konjunktiv nicht wäre, hätte ich keine Sorgen! Der Konjunktiv 2 / 12 Der Modus (Aussageweise) Der Modus des Verbs wird gebraucht, wenn man ausdrücken
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
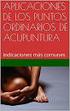 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Interdisziplinärer Workshop. Zitat und Bedeutung September 2006 Elke Brendel, Jörg Meibauer & Markus Steinbach
 » «: Interdisziplinärer Workshop Zitat und Bedeutung 29.-30. September 2006 Elke Brendel, Jörg Meibauer & Markus Steinbach Philosophisches Seminar Deutsches Institut Zitat & Bedeutung Brendel, Meibauer,
» «: Interdisziplinärer Workshop Zitat und Bedeutung 29.-30. September 2006 Elke Brendel, Jörg Meibauer & Markus Steinbach Philosophisches Seminar Deutsches Institut Zitat & Bedeutung Brendel, Meibauer,
In diesem Beitrag wird auf die Problematik der Abgrenzung von Quotativen und
 ISSN 1392-1517. Online ISSN 2029-8315. git Universität Vilnius Universiteto g. 5 LT-01513 Vilnius, Litauen E-Mail: Abstract In diesem Beitrag wird auf die Problematik der Abgrenzung von Quotativen und
ISSN 1392-1517. Online ISSN 2029-8315. git Universität Vilnius Universiteto g. 5 LT-01513 Vilnius, Litauen E-Mail: Abstract In diesem Beitrag wird auf die Problematik der Abgrenzung von Quotativen und
Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft:
 Die wichtigsten Zeitformen Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. ich laufe du läufst er/sie/es läuft Ich
Die wichtigsten Zeitformen Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. ich laufe du läufst er/sie/es läuft Ich
Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten. genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi
 Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi
Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi
Ein blöder Tag. Grundwissen Deutsch: das Verb - Modus. PDF wurde mit pdffactory Pro-Prüfversion erstellt.
 Ein blöder Tag Modus Schließlich gibt es noch den Modus, die Aussageweise. Der Indikativ die Wirklichkeitsform ist die normale Form der Kommunikation. Wir hatten unglaubliches Glück: Unsere Mannschaft
Ein blöder Tag Modus Schließlich gibt es noch den Modus, die Aussageweise. Der Indikativ die Wirklichkeitsform ist die normale Form der Kommunikation. Wir hatten unglaubliches Glück: Unsere Mannschaft
Kopiervorlagen. Schulgrammatik extra. Deutsch. 5. bis 10. Klasse. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik
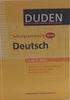 Kopiervorlagen Schulgrammatik extra Deutsch 5. bis 10. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik Zeitformen des Verbs: Präteritum und Plusquamperfekt Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes
Kopiervorlagen Schulgrammatik extra Deutsch 5. bis 10. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik Zeitformen des Verbs: Präteritum und Plusquamperfekt Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes
V Grammatik und Rechtschreibung Beitrag 14. Man nehme den Konjunktiv und eine Prise Mord! Die indirekte Rede sicher anwenden. Voransicht.
 V Grammatik und Rechtschreibung Beitrag 14 Indirekte Rede 1 von 28 Man nehme den Konjunktiv und eine Prise Mord! Die indirekte Rede sicher anwenden Mit Hörtexten auf CD 10 Von Uli Nater, München Stina
V Grammatik und Rechtschreibung Beitrag 14 Indirekte Rede 1 von 28 Man nehme den Konjunktiv und eine Prise Mord! Die indirekte Rede sicher anwenden Mit Hörtexten auf CD 10 Von Uli Nater, München Stina
Einleitung. 1. Gramm. Tempus - Temporalität. Referat: Tempusfehlerklassifikation
 Referat: Tempusfehlerklassifikation Humboldt-Universität zu Berlin Institut für deutsche Sprache und Linguistik HS: Korpuslinguistische Bearbeitung von Phänomenen des Deutschen Dozentin: Prof. Dr. Anke
Referat: Tempusfehlerklassifikation Humboldt-Universität zu Berlin Institut für deutsche Sprache und Linguistik HS: Korpuslinguistische Bearbeitung von Phänomenen des Deutschen Dozentin: Prof. Dr. Anke
Der Numerus dient zur Charakterisierung der Anzahl und kann sich auf ein Element (Singular) oder auf mehrere Elemente (Plural) beziehen.
 1 1. Der Begriff Konjugation Die Beugung von Verben bezeichnet man als Konjugation. Sie ermöglicht es, für jeden Aussagezweck die geeignete Verbform aus einem Infinitiv abzuleiten. 1.1. Formen der Verbgestaltung
1 1. Der Begriff Konjugation Die Beugung von Verben bezeichnet man als Konjugation. Sie ermöglicht es, für jeden Aussagezweck die geeignete Verbform aus einem Infinitiv abzuleiten. 1.1. Formen der Verbgestaltung
Konjunktivformen I + II
 www.klausschenck.de / Deutsch / Grammatik / Konjunktivformen / S. 1 von 5 Konjunktivformen I + II 1. an den Infinitivstamm werden die folgenden Konjunktiv- Endungen gehängt Singular Plural 1. Person -
www.klausschenck.de / Deutsch / Grammatik / Konjunktivformen / S. 1 von 5 Konjunktivformen I + II 1. an den Infinitivstamm werden die folgenden Konjunktiv- Endungen gehängt Singular Plural 1. Person -
Wort. nicht flektierbar. flektierbar. nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert. nach Genus, Kasus, Numerus flektiert
 Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien
 Folge 091 Grammatik 1. Indirekte Rede Um wiederzugeben, was jemand gesagt hat, verwendet man oft die indirekte Rede. Direkte Rede Indirekte Rede Anna: "Ich fahre zu meiner Mutter." Anna hat gesagt, dass
Folge 091 Grammatik 1. Indirekte Rede Um wiederzugeben, was jemand gesagt hat, verwendet man oft die indirekte Rede. Direkte Rede Indirekte Rede Anna: "Ich fahre zu meiner Mutter." Anna hat gesagt, dass
UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH
 GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
Was man mit Verben machen kann
 Was man mit Verben machen kann Konjugation Christian Gambel Einführung Grammatikalische Begriffe im Unterricht Im Deutschunterricht werden oft grammatikalische Begriffe verwendet. Da es sehr viele gibt,
Was man mit Verben machen kann Konjugation Christian Gambel Einführung Grammatikalische Begriffe im Unterricht Im Deutschunterricht werden oft grammatikalische Begriffe verwendet. Da es sehr viele gibt,
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur
 Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur Basisinfo Verben können verändert werden
Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur Basisinfo Verben können verändert werden
Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik
 Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Fach: Deutsch Jahrgang: 7
 In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
Passiv und Passiversatz
 Passiv und Passiversatz Werden-Passiv (oder Vorgangspassiv) Alle vier Jahre wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt. Die Partei wurde mit großer Mehrheit gewählt. Die Partei ist mit großer Mehrheit
Passiv und Passiversatz Werden-Passiv (oder Vorgangspassiv) Alle vier Jahre wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt. Die Partei wurde mit großer Mehrheit gewählt. Die Partei ist mit großer Mehrheit
Paraphrasieren bedeutet, einen Text sinngemäß, also nicht wortwörtlich wiederzugeben. Schlüsselbegriffe aus dem Originaltext bleiben dabei erhalten.
 VWA bedeutet, einen Text sinngemäß, also nicht wortwörtlich wiederzugeben. Schlüsselbegriffe aus dem Originaltext bleiben dabei erhalten. Schreibhandlungen Zusammenfassen: Bei der Übernahme von Gedanken
VWA bedeutet, einen Text sinngemäß, also nicht wortwörtlich wiederzugeben. Schlüsselbegriffe aus dem Originaltext bleiben dabei erhalten. Schreibhandlungen Zusammenfassen: Bei der Übernahme von Gedanken
für Fortgeschrittene NIVEAU NUMMER SPRACHE Fortgeschritten C1_1011G_DE Deutsch
 Redewiedergabe für Fortgeschrittene GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Fortgeschritten C1_1011G_DE Deutsch Lernziele Lerne, direkte und indirekte Aussagesätze in journalistischen Artikeln zu kombinieren Lerne
Redewiedergabe für Fortgeschrittene GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Fortgeschritten C1_1011G_DE Deutsch Lernziele Lerne, direkte und indirekte Aussagesätze in journalistischen Artikeln zu kombinieren Lerne
Formen des Umgangs mit fremden Arbeiten
 www.akin.uni-mainz.de/toolbox ZITIEREN UND BELEGEN SCHREIBEN Warum zitieren und verweisen? Zitate und Belege bestätigen Ihre Aussagen und stützen so ihre Argumentation. Zitate, Belege und Verweise dokumentieren
www.akin.uni-mainz.de/toolbox ZITIEREN UND BELEGEN SCHREIBEN Warum zitieren und verweisen? Zitate und Belege bestätigen Ihre Aussagen und stützen so ihre Argumentation. Zitate, Belege und Verweise dokumentieren
Vorwort 1.
 Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 1.2 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 1.2 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Inhalt. Inhalt. Vorwort 1
 Inhalt Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 12 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Inhalt Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 12 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur
 Studiengang BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur Lehrveranstaltung Deutsche Sprachübungen I Status Pflichtfach (A) Studienjahr 1. Semester 1. ECTS 3 Lehrende Marina Lovrić, mag.educ.philol.germ.
Studiengang BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur Lehrveranstaltung Deutsche Sprachübungen I Status Pflichtfach (A) Studienjahr 1. Semester 1. ECTS 3 Lehrende Marina Lovrić, mag.educ.philol.germ.
Sing Nf. Unb Gen Unb Def. Mask. Nom ich 1 Nom wir 1 Nom man 1 Gen meiner 1 Gen unser 1 Dat mir 1 Dat uns 1 Akk mich 1 Akk uns 1 ICH WP WIR MAN WP
 Sonderfälle bei den substantivischen Wörtern Nominativ... JOGHURT WP Sing Nf Def Indef-Pos... Def... Mask joghurt 1 der joghurt ein joghurt Neut joghurt 1 das joghurt ein joghurt joghurts 1 die joghurts
Sonderfälle bei den substantivischen Wörtern Nominativ... JOGHURT WP Sing Nf Def Indef-Pos... Def... Mask joghurt 1 der joghurt ein joghurt Neut joghurt 1 das joghurt ein joghurt joghurts 1 die joghurts
Syntaktische Tendenzen der Gegenwartssprache
 Syntaktische Tendenzen der Gegenwartssprache Anforderungen: Regelmäßige Teilnahme: max. 2 Fehlzeiten Vorbereitung auf die Sitzung: Text lesen, Fragen notieren, mitdiskutieren (!) Leitung einer Sitzung
Syntaktische Tendenzen der Gegenwartssprache Anforderungen: Regelmäßige Teilnahme: max. 2 Fehlzeiten Vorbereitung auf die Sitzung: Text lesen, Fragen notieren, mitdiskutieren (!) Leitung einer Sitzung
2. Wo sich die Formen des Konjunktivs I nicht von denen des Indikativs unterscheiden, verwendet man der Deutlichkeit wegen den Konjunktiv II.
 Die indirekte Rede Die indirekte Rede steht gewöhnlich im Konjunktiv. So drückt der Sprecher oder Schreiber die Distanz aus zu dem, was er berichtet. Er kennzeichnet es als etwas, dessen Wahrheit er nicht
Die indirekte Rede Die indirekte Rede steht gewöhnlich im Konjunktiv. So drückt der Sprecher oder Schreiber die Distanz aus zu dem, was er berichtet. Er kennzeichnet es als etwas, dessen Wahrheit er nicht
PROBLEME DER WORTARTEN-KLASSIFIKATION
 PROBLEME DER WORTARTEN-KLASSIFIKATION 1. Vollständigkeit der Klassifikation: Werden alle Ausdrücke erfasst? Beispielsweise wie und als in Er verhält sich wie ein Kind, Sie als Lehrerin (Adjunktive, IdS;
PROBLEME DER WORTARTEN-KLASSIFIKATION 1. Vollständigkeit der Klassifikation: Werden alle Ausdrücke erfasst? Beispielsweise wie und als in Er verhält sich wie ein Kind, Sie als Lehrerin (Adjunktive, IdS;
1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988)
 Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Vergleichssätze. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_1045G_DE Deutsch
 Vergleichssätze GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_1045G_DE Deutsch Lernziele Lerne irreale Vergleichssätze mit als, als ob, als wenn kennen. Lerne die Struktur von irrealen Vergleichssätzen.
Vergleichssätze GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_1045G_DE Deutsch Lernziele Lerne irreale Vergleichssätze mit als, als ob, als wenn kennen. Lerne die Struktur von irrealen Vergleichssätzen.
Einleitung 3. s Die unpersönlichen Sätze 14 Übungen Die bejahenden und die verneinenden Sätze 17 Übungen 20
 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 3 Kapitel I Der einfache Satz 1. Allgemeines 4 2. Der Aussagesatz, der Fragesatz und der Aufforderungssatz 5 6 3. Stellung der Nebenglieder des Satzes 8 1 9 4. Die unbestimmt-persönlichen
INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 3 Kapitel I Der einfache Satz 1. Allgemeines 4 2. Der Aussagesatz, der Fragesatz und der Aufforderungssatz 5 6 3. Stellung der Nebenglieder des Satzes 8 1 9 4. Die unbestimmt-persönlichen
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Wortklasse oder part of speech hat verschiedene Merkmale. Nach dem traditionellen System werden die deutschen Wortklassen in zehn Klassen unterteilt (Gross,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Wortklasse oder part of speech hat verschiedene Merkmale. Nach dem traditionellen System werden die deutschen Wortklassen in zehn Klassen unterteilt (Gross,
Inhalt.
 Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik. Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz. Robert Zangenfeind
 Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Grundstufe
 Deutsch als Fremdsprache Übungsgrammatik für die Grundstufe Inhalt Vorwort 5 Abkürzungen 6 A Verben 7 1. Grundverben 8 1.1 haben sein werden 8 1.2 Modalverben 11 2. Tempora 19 2.1 Präsens 19 2.2 Perfekt
Deutsch als Fremdsprache Übungsgrammatik für die Grundstufe Inhalt Vorwort 5 Abkürzungen 6 A Verben 7 1. Grundverben 8 1.1 haben sein werden 8 1.2 Modalverben 11 2. Tempora 19 2.1 Präsens 19 2.2 Perfekt
Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben. Grammatikalisierung. Modalverben. Sprachhistorische Aspekte
 Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
WERDEN-PASSIV (Es existiert ein Täter, der mit von fakultativ erwähnt werden kann)
 PASSIV WERDEN-PASSIV (Es existiert ein Täter, der mit von fakultativ erwähnt werden kann) Werden-Passiv bei transitiven Verben Die Lehrerin macht Übungen Passiv: Die Übungen werden (von der Lehrerin) gemacht.
PASSIV WERDEN-PASSIV (Es existiert ein Täter, der mit von fakultativ erwähnt werden kann) Werden-Passiv bei transitiven Verben Die Lehrerin macht Übungen Passiv: Die Übungen werden (von der Lehrerin) gemacht.
Wiederholung des Konjunktiv I. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2055G_DE Deutsch
 Wiederholung des Konjunktiv I GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2055G_DE Deutsch Lernziele Wiederhole die Präsensform des Konjunktiv I Lerne, die Konjunktiv I Vergangenheit zu gebrauchen Lerne,
Wiederholung des Konjunktiv I GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2055G_DE Deutsch Lernziele Wiederhole die Präsensform des Konjunktiv I Lerne, die Konjunktiv I Vergangenheit zu gebrauchen Lerne,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Ich packe meinen Koffer. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich packe meinen Koffer Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 24 Lerntheke zur Wortart Verb Grammatik beherrschen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich packe meinen Koffer Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 24 Lerntheke zur Wortart Verb Grammatik beherrschen
Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum
 4 Sigbert Latzel Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum Eine Darstellung mit Bezug auf Erfordernisse des Faches "Deutsch als Fremdsprache" MAX HUEBERVERLAG INHALTSVERZEICHNIS Geleitwort Vorwort des
4 Sigbert Latzel Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum Eine Darstellung mit Bezug auf Erfordernisse des Faches "Deutsch als Fremdsprache" MAX HUEBERVERLAG INHALTSVERZEICHNIS Geleitwort Vorwort des
Verlässlicher Grammatik-Transfer
 Transferwissenschaften 8 Verlässlicher Grammatik-Transfer Am Beispiel von subordinierenden Konjunktionen Bearbeitet von Alaa Mohamed Moustafa 1. Auflage 2011. Buch. XIV, 294 S. Hardcover ISBN 978 3 631
Transferwissenschaften 8 Verlässlicher Grammatik-Transfer Am Beispiel von subordinierenden Konjunktionen Bearbeitet von Alaa Mohamed Moustafa 1. Auflage 2011. Buch. XIV, 294 S. Hardcover ISBN 978 3 631
Flexion. Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman Derivationsmorphem vs. Flexionsmorphem
 Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman 23.11.04 vs. Wortbildung (1)a. [saft - ig] b. [[An - geb] - er] Derivationsmorphem vs. smorphem (4)a. Angeber - saftiger b. saftig - Safts c.
Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman 23.11.04 vs. Wortbildung (1)a. [saft - ig] b. [[An - geb] - er] Derivationsmorphem vs. smorphem (4)a. Angeber - saftiger b. saftig - Safts c.
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz. 2. Entwicklung und Progression in Lehrwerken
 Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Man nehme den Konjunktiv. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Man nehme den Konjunktiv Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Man nehme
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Man nehme den Konjunktiv Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Man nehme
Artikelwörter. Jason Rothe
 Artikelwörter Jason Rothe Was ist das für 1 geiler Vortrag? Gliederung 1. Einleitung 2. Lehrbuchauszug 3. These 4. Stellung der Artikelwörter 5. Artikel vs. Artikelwort 6. Zuschreibung des Genus 7. Morphosyntaktische
Artikelwörter Jason Rothe Was ist das für 1 geiler Vortrag? Gliederung 1. Einleitung 2. Lehrbuchauszug 3. These 4. Stellung der Artikelwörter 5. Artikel vs. Artikelwort 6. Zuschreibung des Genus 7. Morphosyntaktische
Regeln für das richtige Zitieren
 Regeln für das richtige Zitieren Grundsätzlich: Zitate dürfen nicht die eigenständige Darstellung ersetzen, sondern: Zitate dienen als Belege im Rahmen der eigenen Darstellung. Ob aus dem Internet, aus
Regeln für das richtige Zitieren Grundsätzlich: Zitate dürfen nicht die eigenständige Darstellung ersetzen, sondern: Zitate dienen als Belege im Rahmen der eigenen Darstellung. Ob aus dem Internet, aus
Subjekt- und Objekt-Sätze
 05-70a Qualifizierungsstufe I / GD 1. Was sind? Akkusativ-Objekt (a) Ich erwarte meinen Freund. Nomen (b) Ich erwarte, dass mein Freund heute kommt. dass-satz (c) Ich erwarte, meinen Freund zu treffen.
05-70a Qualifizierungsstufe I / GD 1. Was sind? Akkusativ-Objekt (a) Ich erwarte meinen Freund. Nomen (b) Ich erwarte, dass mein Freund heute kommt. dass-satz (c) Ich erwarte, meinen Freund zu treffen.
Formen des Konjunktiv II. Der Konjunktiv II. Die Formen des Konjunktiv II können etwas verwirrend sein Vergangenheit.
 Der Sie wäre lieber Pauls Frau. Maria ist Karls Frau. Maria hat Karl Sie wäre lieber Pauls Frau. Hier wird gesagt, dass etwas in der nicht passiert ist. Der einfache Der zusammengesetzte Formen des Die
Der Sie wäre lieber Pauls Frau. Maria ist Karls Frau. Maria hat Karl Sie wäre lieber Pauls Frau. Hier wird gesagt, dass etwas in der nicht passiert ist. Der einfache Der zusammengesetzte Formen des Die
Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik
 Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11 Aus der Lautlehre 13
 Vorwort 11 Aus der Lautlehre 13 Lektion 1a 21 Sprechübungen 21 Dialogmuster 23 Lesestück: Deutschunterricht 24 Wörter und Wendungen 24 Humor 25 Dialog 25 Wortarten 25 Monologmuster 26 Kommunikationsmodelle
Vorwort 11 Aus der Lautlehre 13 Lektion 1a 21 Sprechübungen 21 Dialogmuster 23 Lesestück: Deutschunterricht 24 Wörter und Wendungen 24 Humor 25 Dialog 25 Wortarten 25 Monologmuster 26 Kommunikationsmodelle
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
TEIL 1: Kasus und Verben. Autorprogramm: Mag. a Dr. in Justyna Haas
 TEIL 1: Kasus und Verben Autorprogramm: Mag. a Dr. in Justyna Haas Die deutsche Sprache hat vier Kasus (Fälle). Jeder Fall antwortet auf bestimmte Fragen oder wird unter bestimmten Voraussetzungen gebildet.
TEIL 1: Kasus und Verben Autorprogramm: Mag. a Dr. in Justyna Haas Die deutsche Sprache hat vier Kasus (Fälle). Jeder Fall antwortet auf bestimmte Fragen oder wird unter bestimmten Voraussetzungen gebildet.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Zitieren sich auf andere berufen. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Zitieren sich auf andere berufen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Zitieren sich auf andere berufen Vorüberlegungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Zitieren sich auf andere berufen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Zitieren sich auf andere berufen Vorüberlegungen
C. Besonderheiten einiger Wortarten. Das Substantiv
 C. Besonderheiten eini Wortarten Das Substantiv Litauische Substantive sind entweder männlich oder weiblich. Das Neutrum hat sich nur in einer speziellen Adjektivform erhalten. Insgesamt gibt es 5 Deklinationsklassen,
C. Besonderheiten eini Wortarten Das Substantiv Litauische Substantive sind entweder männlich oder weiblich. Das Neutrum hat sich nur in einer speziellen Adjektivform erhalten. Insgesamt gibt es 5 Deklinationsklassen,
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch
 Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Aspekt in der Grammatik - Ort des Aspekts im Tempussystem des Spanischen bzw. der romanischen Sprachen
 Sprachen Christina Müller Aspekt in der Grammatik - Ort des Aspekts im Tempussystem des Spanischen bzw. der romanischen Sprachen Studienarbeit " Estructuras del léxico verbal español " Hauptseminar Wintersemester
Sprachen Christina Müller Aspekt in der Grammatik - Ort des Aspekts im Tempussystem des Spanischen bzw. der romanischen Sprachen Studienarbeit " Estructuras del léxico verbal español " Hauptseminar Wintersemester
Grundverben 10 sein haben werden 10 ich bin, ich habe, ich werde können dürfen müssen 12 ich kann, ich muss, ich darf,
 Verb 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Grundverben 10 sein haben werden 10 ich bin, ich habe, ich werde können dürfen müssen 12 ich kann, ich muss, ich darf, sollen wollen mögen ich will, ich soll, ich mag/möchte
Verb 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Grundverben 10 sein haben werden 10 ich bin, ich habe, ich werde können dürfen müssen 12 ich kann, ich muss, ich darf, sollen wollen mögen ich will, ich soll, ich mag/möchte
Probeklausur Syntax-Übung MA Linguistik
 Probeklausur Syntax-Übung MA Linguistik Prof. Dr. Stefan Müller Humboldt Universität Berlin St.Mueller@hu-berlin.de 12. Februar 2018 In diesem Dokument gibt es Fragen zu allem, was in der Veranstaltung
Probeklausur Syntax-Übung MA Linguistik Prof. Dr. Stefan Müller Humboldt Universität Berlin St.Mueller@hu-berlin.de 12. Februar 2018 In diesem Dokument gibt es Fragen zu allem, was in der Veranstaltung
Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag
 Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Und jetzt ihr! - Lehrbuch - Basisgrammatik für Jugendliche - Deutsch als Fremdsprache Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Und jetzt ihr! - Lehrbuch - Basisgrammatik für Jugendliche - Deutsch als Fremdsprache Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Partikeln im gesprochenen Deutsch
 Germanistik Philipp Schaan Partikeln im gesprochenen Deutsch Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Definition der Wortart 'Partikel'... 3 3. Der Weg der Wortart 'Partikel' in der Duden-Grammatik...
Germanistik Philipp Schaan Partikeln im gesprochenen Deutsch Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Definition der Wortart 'Partikel'... 3 3. Der Weg der Wortart 'Partikel' in der Duden-Grammatik...
UE Grammatik der Gegenwartssprache
 UE Grammatik der Gegenwartssprache (I 1118; Lehrveranstaltungsnr. 100224) Sergios Katsikas Sommersemester 2010 Montag 12:00-13:30, Inst. f. Germanistik, ÜR 3 Vorläufiger Semesterplan 1. 22. März - Einleitung
UE Grammatik der Gegenwartssprache (I 1118; Lehrveranstaltungsnr. 100224) Sergios Katsikas Sommersemester 2010 Montag 12:00-13:30, Inst. f. Germanistik, ÜR 3 Vorläufiger Semesterplan 1. 22. März - Einleitung
1 Einleitung Hilfreiche Nachschlagewerke Das spanische Gerundium... 27
 Inhalt 1 Einleitung... 11 1.1 Wozu dieses Arbeitsbuch?...11 1.2 Wie kam es zu diesem Arbeitsbuch?...16 1.3 Wie ist dieses Arbeitsbuch aufgebaut?...18 1.4 Grammatikalische Bezeichnungen...18 1.4.1 Bezeichnung
Inhalt 1 Einleitung... 11 1.1 Wozu dieses Arbeitsbuch?...11 1.2 Wie kam es zu diesem Arbeitsbuch?...16 1.3 Wie ist dieses Arbeitsbuch aufgebaut?...18 1.4 Grammatikalische Bezeichnungen...18 1.4.1 Bezeichnung
Deutsch-Test: Konjunktiv I und II - indirekte Rede
 Name: Datum: Deutsch-Test: Konjunktiv I und II - indirekte Rede 1. Bilde die richtigen Formen im Konjunktiv I und II. Infinitiv Konjunktiv I Konjunktiv II glauben Er Er geben Es Es nehmen Sie Sie wissen
Name: Datum: Deutsch-Test: Konjunktiv I und II - indirekte Rede 1. Bilde die richtigen Formen im Konjunktiv I und II. Infinitiv Konjunktiv I Konjunktiv II glauben Er Er geben Es Es nehmen Sie Sie wissen
SMS Schnell-Merk-System
 5. bis 10. Klasse SMS Schnell-Merk-System Deutsch Grammatik Kompaktwissen Testfragen Mit Lernquiz fürs Handy 2Verben Verben lassen sich nach verschiedenen Merkmalen unterscheiden: nach Bedeutungsgruppen
5. bis 10. Klasse SMS Schnell-Merk-System Deutsch Grammatik Kompaktwissen Testfragen Mit Lernquiz fürs Handy 2Verben Verben lassen sich nach verschiedenen Merkmalen unterscheiden: nach Bedeutungsgruppen
STEOP Modulprüfung Mehrsprachigkeit. Sprachkompetenz B-/C-Sprache Deutsch Modelltest - Lösung
 STEOP Modulprüfung Mehrsprachigkeit Sprachkompetenz B-/C-Sprache Deutsch Modelltest - Lösung Zentrum für Translationswissenschaft STEOP-Modulprüfung Mehrsprachigkeit B-/C-Sprache Deutsch Modelltest B-/C-Sprache
STEOP Modulprüfung Mehrsprachigkeit Sprachkompetenz B-/C-Sprache Deutsch Modelltest - Lösung Zentrum für Translationswissenschaft STEOP-Modulprüfung Mehrsprachigkeit B-/C-Sprache Deutsch Modelltest B-/C-Sprache
7. Klasse. Grammatik. Deutsch. Grammatik. in 15 Minuten
 Grammatik 7. Klasse Deutsch Grammatik in 15 Minuten Klasse So übst du mit diesem Buch Im Inhaltsverzeichnis findest du alle für deine Klassenstufe wichtigen Themengebiete. Du hast zwei Möglichkeiten: 1.
Grammatik 7. Klasse Deutsch Grammatik in 15 Minuten Klasse So übst du mit diesem Buch Im Inhaltsverzeichnis findest du alle für deine Klassenstufe wichtigen Themengebiete. Du hast zwei Möglichkeiten: 1.
Konjunktiv II. Der Indikativ bezeichnet eine wirkliche, eine reale Welt, die man sehen, tasten, riechen, schmecken oder hören kann.
 Konjunktiv II 1) Was man über den Konjunktiv II wissen sollte. Der Indikativ bezeichnet eine wirkliche, eine reale Welt, die man sehen, tasten, riechen, schmecken oder hören kann. Diese Welt kann stattfinden:
Konjunktiv II 1) Was man über den Konjunktiv II wissen sollte. Der Indikativ bezeichnet eine wirkliche, eine reale Welt, die man sehen, tasten, riechen, schmecken oder hören kann. Diese Welt kann stattfinden:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutsch - ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch - ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch - ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Schwache und starke Verben. Ein grammatisches "Krafttraining" zur Präsens-, Präteritum- und Perfektbildung (Klasse 5/6) Das komplette
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Schwache und starke Verben. Ein grammatisches "Krafttraining" zur Präsens-, Präteritum- und Perfektbildung (Klasse 5/6) Das komplette
Wer spricht? Über die Formen der Redewiedergabe im Deutschen
 ROLF THIEROFF Wer spricht? Über die Formen der Redewiedergabe im Deutschen W pracy omówiono formalne róŝnice występujące pomiędzy tak zwaną mową niezaleŝną i mową zaleŝną w języku niemieckim. W obu przypadkach
ROLF THIEROFF Wer spricht? Über die Formen der Redewiedergabe im Deutschen W pracy omówiono formalne róŝnice występujące pomiędzy tak zwaną mową niezaleŝną i mową zaleŝną w języku niemieckim. W obu przypadkach
Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten Prof. Thomas Dreiskämper Wissenschaftliches Arbeiten
 Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten 2010 1 Formale Kriterien (1) 1. Literaturbasis Qualität der Quellen Wissenschaftliche Arbeiten brauchen wissenschaftliche Quellen. Das Internet ist nur zu verwenden,
Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten 2010 1 Formale Kriterien (1) 1. Literaturbasis Qualität der Quellen Wissenschaftliche Arbeiten brauchen wissenschaftliche Quellen. Das Internet ist nur zu verwenden,
VORÜBERLEGUNGEN ZUM PARTIZIP:
 Seite 1 von 5 VORÜBERLEGUNGEN ZUM PARTIZIP: Eine Spezialität des Gr und des Lat ist der im Vergleich zum Deutschen intensive Gebrauch partizipialer Formen. Das Dt kennt eigentlich nur die folgenden Patizipien:
Seite 1 von 5 VORÜBERLEGUNGEN ZUM PARTIZIP: Eine Spezialität des Gr und des Lat ist der im Vergleich zum Deutschen intensive Gebrauch partizipialer Formen. Das Dt kennt eigentlich nur die folgenden Patizipien:
Verfasser: Eckehart Weiß
 deutsch-digital.de Sprachbetrachtung Lernjahr: Jahrgangsstufe 5 und 6 Schwerpunkt: Die Zeiten - die Tempora Verfasser: Eckehart Weiß Der Gebrauch der Zeiten ist in vielen Sprachen im Detail unterschiedlich.
deutsch-digital.de Sprachbetrachtung Lernjahr: Jahrgangsstufe 5 und 6 Schwerpunkt: Die Zeiten - die Tempora Verfasser: Eckehart Weiß Der Gebrauch der Zeiten ist in vielen Sprachen im Detail unterschiedlich.
Wie bildet man das werden-passiv? Man bildet das werden- Passiv mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip Perfekt des Vollverbs.
 DAS WERDEN-PASSIV Wie bildet man das werden-passiv? Man bildet das werden- Passiv mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip Perfekt des Vollverbs. Präsens von werden Singular Plural ich werde du wirst
DAS WERDEN-PASSIV Wie bildet man das werden-passiv? Man bildet das werden- Passiv mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip Perfekt des Vollverbs. Präsens von werden Singular Plural ich werde du wirst
Zitate können in unterschiedlichen Formen ausgeführt werden, z.b. als:
 Wie wird korrekt zitiert? Zitate können in unterschiedlichen Formen ausgeführt werden, z.b. als: wörtliches, also Wort für Wort abgeschriebenes Zitat sinngemäßes, in eigene Worte gefasstes Zitat Zitat
Wie wird korrekt zitiert? Zitate können in unterschiedlichen Formen ausgeführt werden, z.b. als: wörtliches, also Wort für Wort abgeschriebenes Zitat sinngemäßes, in eigene Worte gefasstes Zitat Zitat
A 2004/3423. Spanische Grammatik - kurz und schmerzlos. Von Begona Prieto Peral und Victoria Fülöp-Lucio. Langenscheidt
 A 2004/3423 Langenscheidt Spanische Grammatik - kurz und schmerzlos Von Begona Prieto Peral und Victoria Fülöp-Lucio Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York Vorwort 1 Das Substantiv und der Artikel
A 2004/3423 Langenscheidt Spanische Grammatik - kurz und schmerzlos Von Begona Prieto Peral und Victoria Fülöp-Lucio Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York Vorwort 1 Das Substantiv und der Artikel
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Kaufmännische Berufsmatura im Kanton Zürich
 Aufnahmeprüfung 2014 Deutsch Serie 1 Sprachprüfung (40 Min.) Verfassen eines Textes (40 Min.) Hilfsmittel: Duden nur für das Verfassen eines Textes Name... Vorname... Adresse...... Maximal erreichbare
Aufnahmeprüfung 2014 Deutsch Serie 1 Sprachprüfung (40 Min.) Verfassen eines Textes (40 Min.) Hilfsmittel: Duden nur für das Verfassen eines Textes Name... Vorname... Adresse...... Maximal erreichbare
Textreproduktion. Indirekte Rede und Zitate
 Formale Regeln für die Textreproduktion Indirekte Rede und Zitate Inhalte dieser Präsentation 1) Die Grundregel 2) Indirekte Textwiedergabe FARBEN-QUIZ 3) Die Bildung des Konjunktivs FARBEN-QUIZ 4) Direkte
Formale Regeln für die Textreproduktion Indirekte Rede und Zitate Inhalte dieser Präsentation 1) Die Grundregel 2) Indirekte Textwiedergabe FARBEN-QUIZ 3) Die Bildung des Konjunktivs FARBEN-QUIZ 4) Direkte
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen
 Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Sprachlehre / Grammatik / Lösungen
 Bündner Mittelschulen Aufnahmeprüfung 2001 Gymnasium Deutsch Teil II Grammatik Sprachlehre / Grammatik / Lösungen 1. Wortarten Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter. Partikeln und Pronomen sind
Bündner Mittelschulen Aufnahmeprüfung 2001 Gymnasium Deutsch Teil II Grammatik Sprachlehre / Grammatik / Lösungen 1. Wortarten Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter. Partikeln und Pronomen sind
DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb
 DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb Verbarten Grundverben Modalverben Trennbare Verben Unregelmäßige Verben Reflexive Verben Verben mit Präposition sein - können dürfen wollen
DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb Verbarten Grundverben Modalverben Trennbare Verben Unregelmäßige Verben Reflexive Verben Verben mit Präposition sein - können dürfen wollen
Flexionsmerkmale / Tempus und Modus
 Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Winter 2016/17 C Flexionsmerkmale / Tempus und Modus C 1 Voraussetzungen Grundbegriffe aus Skript A und E: Flexion = die Bildung syntaktischer Wörter (= Flexionsformen, =
Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Winter 2016/17 C Flexionsmerkmale / Tempus und Modus C 1 Voraussetzungen Grundbegriffe aus Skript A und E: Flexion = die Bildung syntaktischer Wörter (= Flexionsformen, =
