Markus Stubbe (Autor) Aktive Dämpfung von multifrequenten Torsionsschwingungen in verzweigten Antriebssystemen
|
|
|
- Rudolf Frank
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Markus Stubbe (Autor) Aktive Dämpfung von multifrequenten Torsionsschwingungen in verzweigten Antriebssystemen Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, Göttingen, Germany Telefon: +49 (0) , Website:
2 Kapitel 1 Einleitung 1.1 Motivation Die aktive Dämpfung von Schwingungen in Antriebssystemen stellt seit langem ein anspruchsvolles und gleichermaßen reizvolles Arbeitsgebiet dar. Treten in Produktionsanlagen unerwünschte Schwingungen auf, kann dies nicht nur einer Verminderung der Produktqualität sondern auch zu einer Reduzierung der Lebensdauer der Maschinenelemente und Verringerung der Standzeiten von Werkzeugen führen. Nicht zuletzt können Schwingungen eine erhebliche Lärmbelastung mit sich bringen und so zu psychischem Stress beitragen. Es besteht also ein erhebliches Interesse, Schwingungen zu vermeiden. Im Idealfall geschieht dies durch eine geschickte Konstruktion, durch die die Eigenfrequenzen der Anlage so platziert werden, dass sie durch den Prozess nicht angeregt werden. In der Regel wird versucht, Konstruktionen möglichst steif auszuführen, um möglichst hohe Eigenfrequenzen zu erhalten (vergleiche unter anderem [Ber88]). Zusätzlich oder alternativ kann durch geeignete Werkstoffauswahl die systemeigene Dämpfung erhöht und das Risiko reduziert werden, dass unerwünschte Schwingungen auftreten. So stellt Mielczarek in [MRT + 05] eine Legierung mit einer spezifischen Dämpfungskapazität von 80 % vor als Vergleich nennt die Erfinderin Gusseisen mit Lamellengraphit, welches eine Dämpfungskapazität von 1 % aufweist. Solche Maßnahmen müssen schon bei der Konstruktion der Anlagen getroffen werden. Wurden die Möglichkeiten bei der Werkstoffauswahl ausgeschöpft und alle zur Schwingungsvermeidung dienenden konstruktiven Maßnahmen ergriffen, kann auf zusätzliche Maßnahmen zur Schwingungsdämpfung zurückgegriffen werden. Das kann zum Beispiel notwendig werden, wenn die zukünftigen Anwendungsgebiete von Komponenten zum Konstruktionszeitpunkt noch gar nicht bekannt sind oder Maschinen beim Kunden außerhalb ihrer Spezifikation eingesetzt werden. In [SHS + 03] beschreibt Sihler die unerwartete Anregung von Torsionsschwingungen an Schwungradspeichern zur Bereitstellung elektrischer Energie in einem Fusionsreaktor. In Folge schneller Lastwechsel sind innerhalb kürzester Zeit Schäden an Verbindungselementen aufgetreten, die zum Anlagenstillstand führten. Durch den Einsatz einer elektrisch wirkenden aktiven Dämpfungseinrichtung werden Schäden dieser Art nun vermieden. Oft wird auch zum Zeitpunkt der Konstruktion einer Anlage das dynamische Zusammenspiel verschiedener Elemente nicht bedacht. Gerade bei der elektrischen Kopplung mehrerer Antriebe ist diese Verbindung nicht immer offensichtlich und kann leicht übersehen werden. So bilden laut Schnurr (vergleiche [Sch04]) die Generatoren und Lasten des europäischen Verbundnetzes (UCTE) sowohl in Nord-Süd- als auch in West-Ost-Richtung ein schwingfähiges System mit Eigenfrequenzen im Bereich von 0,3 Hz (West-Ost-Richtung) 1
3 2 Einleitung bis 0,5 Hz (Nord-Süd-Richtung). Netzgekoppelte Anlagen, die schwach gedämpfte Eigenfrequenzen in diesem Frequenzbereich haben, können durch diese Schwingung in Resonanz versetzt werden. Für Kraftwerksgeneratoren stellt Zöller in [ZLM09] ein Konzept vor, bei dem durch Parallelschaltung eines verhältnismäßig kleinen Wechselrichters, das Generatorwellenmoment aktiv bedämpft werden kann. Die Eigenfrequenzen liegen dort in der Regel bei Hz. Zöller geht von einer Anregung aus, die nicht zwangsweise lokal stattfindet. Dies können beispielsweise Netzkurzschlüsse, Lastabwürfe oder Blitzeinschläge in Freileitungen sein. Bei vielen Maschinen sind periodische Anregungen Prozessimmanent und bekannt, sollen aber nicht an angekoppelte Maschinen weitergegeben werden. So beschreibt Papathanassiou in [PS06] seine Untersuchungen in einem elektrischen Inselnetz, das unter starkem Flicker leidet. Zunächst wurde vermutet, dass ein großer Anteil von Windkraftanlagen schuld daran sei, tatsächlich konnte aber ein Dieselgenerator ausgemacht werden, der durch sein stark mit Oberschwingungen behaftetes Drehmoment Schwingungen anregte, die letztendlich zu Flickern führten. Auch hier kann der von Zöller vorgeschlagene Ansatz Linderung verschaffen, wenn er der Problemstellung angepasst wird. Für einen offensichtlicheren Fall, bei dem die schlechte Drehmomentqualität von nicht kontinuierlichen Verbrennungsmaschinen zu unerwünschter Schwingungsanregung führt, stellt Pfleghaar [Pfl15] ein aktives Zweimassenschwungrad vor, das gegenüber gebräuchlichen Zweimassenschwungrädern deutlich bessere Dämpfungseigenschaften aufweist. Zwischen Motor und Getriebe von Kraftfahrzeugen eingebaut, sorgt es dafür, dass der Drehmomentrippel des Motors keine Schwingungen im Antriebsstrang anregen kann. Krüger stellt in [Krü95] eine anwendungsorientierte Methode zur Einstellung eines Drehzahlreglers vor, bei der er unter anderem Wert darauf legt, dass die Eigenschwingungen eines verzweigten Antriebssystems mit Lose möglichst stark bedämpft werden. Er greift dazu auf eine Zustandsregelung zurück. In [ABP04] wird ein Verfahren zur aktiven Schwingungsdämpfung in einem komplexen Antriebsstrang vorgestellt, bei dem mit einer vorhandenen elektrischen Maschine ein zusätzliches Drehmoment erzeugt wird, das auftretende Schwingungen reduziert. In schwingungsanfälligen Systemen, die bereits über einen geregelten elektrischen Antrieb verfügen, ist dies in der Regel die kostengünstigste und einfachste Variante. Lässt sich das System auf einen Zwei- oder Dreimassenschwinger reduzieren, existieren nahezu beliebig viele Ansätze, um in einer solchen Konstellation aktive Schwingungsdämpfung zu betreiben (siehe unter anderem [Krü95, Sti05, ST13, SM05, Sch10, Pfl15, Gos98, Faß02, BTH06, BTS11, BTS05]). Voraussetzung ist allerdings, dass der Benutzer Zugriff auf den Sollwert des Drehmoment bildenden Stroms hat, so dass das Regelverhalten vom Benutzer in geeigneter Art beeinflusst werden kann. Das ist in der Regel nicht der Fall, so dass trotzdem auf weiterführende Maßnahmen zurückgegriffen werden muss. Interessant wird es in Fällen, in denen zwar ein geregelter Antrieb zur Verfügung steht, dieser aber nicht zur aktiven Schwingungsdämpfung herangezogen werden kann. Das kann nicht nur passieren, wenn der Benutzer den Antriebsregler nicht entsprechend modifizieren kann, sondern auch in leistungsverzweigten Antriebssystemen vorkommen. Ist die Drehmassedes bereits vorhandenen Antriebs nicht an einer auftretenden Schwingung beteiligt, besteht keine Möglichkeit, sie mit dem vorhandenen Antrieb aktiv zu bedämpfen. In diesen Fällen ist es unerlässlich, zusätzliche Aktoren so im System anzubringen, dass sie auf die Schwingungen Einfluss nehmen können. In [SKH09] kommt Syed zu dem Schluss,
4 1.1 Motivation 3 dass Schwingungsprobleme in einem Hybrid-Fahrzeug mit verzweigtem Antriebsstrang durch eine zusätzliche elektrische Maschine reduziert werden können. Grundsätzlich lassen sich die oben vorgestellten Beispiele zur Schwingungsdämpfung wie in Abbildung 1.1 dargestellt kategorisieren. Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz Schwingungsdämpfung Anpassung der Systemparameter externe Dämpferkräfte Konstruktion (Versteifung) passive Dämpfer Material (große Dämpfung) adaptive Dämpfer vorhandene Maschine aktive Dämpfer extra Dämpfungsaktor Abbildung 1.1: Übersicht: Kategorisierung von Methoden zur Schwingungsdämpfung. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der aktiven Schwingungsdämpfung mittels zusätzlich installierter Aktoren (farblich hervorgehoben). lässt sich in der Abbildung ganz unten rechts einsortieren. Es wird also ein aktives Dämpfungssystem mit zusätzlich installiertem Aktor untersucht. Von bekannten Systemen unterscheidet es sich insofern, dass der Aktor als Inertialmassenaktor ausgeführt ist, also keine Drehmomentabstützung im Fundament oder benachbarten Maschinen benötigt. Die Drehmomentabstützung der eingesetzten Maschine geschieht an ihrem Rotor, der dadurch eine Auslenkung erfährt. Die zwei im Laufe der Untersuchungen entworfenen und gebauten Aktoren werden in Abbildung 1.2 gezeigt. Schematische Schnittbilder beider Maschinen sind in Abbildung 1.3 dargestellt. Durch die wegfallende Drehmomentabstützung lässt sich das Dämpfersystem sehr flexibel auch nachträglich in bestehende Anlagen integrieren, es muss lediglich ein freies Wellenstück in unmittelbarer Nähe einer Drehmasse des zu bedämpfenden Systems verfügbar sein. Führt man die Ansteuerung derart aus, dass die gemittelte Relativdrehzahl zwischen Rotor und Stator null ist (vergleiche Abschnitt 3.2) wird keine von der Drehzahl des Antriebsstrangs abhängige Spannung in den Statorwicklungen des Aktors induziert. So kann der Regler für den Drehmoment bildenden Strom des Dämpfungsaktors unabhängig von der Antriebsdrehzahl ausgelegt werden. Außerdem kann ohne großen Aufwand bei
5 4 Einleitung (a) Erster Prototyp, 2-phasige Maschine, vorgestellt in [ST13] (b) Zweiter Prototyp, permanenterregte, 3phasige Drehfeldmaschine Abbildung 1.2: Die im Rahmen dieser Arbeit gebauten und untersuchten Inertialmassenaktoren zur aktiven Schwingungsdämpfung. vergleichsweise kleinen Zwischenkreisspannungen eine große Stellreserve realisiert werden, da der Stromregler zur Einprägung eines Stroms nicht die drehzalproportionale induzierte Spannung überwinden muss, bevor er eine Wirkung erzielen kann. Entsprechend kann auch eine von der Antriebsdrehzahl unabhängige, hohe Reglerdynamik erreicht werden mit der auch hochfrequente Schwingungen aktiv bedämpft werden können. Ein besonderer Anspruch, der an das Dämpfungssystem gestellt wird, ist, dass es in der Lage sein soll, mehrere Frequenzen, die über ein breites Frequenzband verteilt sind, aktiv zu bedämpfen; auch dann, wenn sie zur gleichen Zeit auftreten (multifrequente Schwingungen). Diese Anforderung ergibt sich zum Beispiel bei selbsterregten Torsionsratterschwingungen in Stahlwalzwerken (vergleiche Abbildung 1.4, [Tur03, Sti05]). 1.2 Ziel und Vorgehen Das Ziel dieser Arbeit, ist es, an Hand theoretischer Überlegungen und experimenteller Untersuchungen zu zeigen, dass das vorgestellte System bestehend aus einem Aktor ohne feststehende Drehmomentabstützung (Inertialmassenaktor), einem Spannungszwischenkreis-Wechselrichter als Stellglied, einem PWM-basierten Regler für die drehmomentbildenden Phasenströme des Aktors, und einem neuen, unsymmetrischen Ansteuerverfahren ohne Messung der Rotorlage geeignet ist, aktiv multifrequente Schwingungen in verzweigten Antriebssystemen zu bedämpfen. Durch das eingesetzte Ansteuerverfahren kann die Regelung des Aktors sensorlos1 geschehen, es ist lediglich eine Strommessung erforderlich. Auf den Einsatz eines Lagegebers, der den Relativwinkel zwischen Stator und Rotor des Aktors misst, kann also verzichtet werden. 1 Ansteuerverfahren für elektrische Maschinen gelten dann als sensorlos, wenn keine Erfassung mechanischer Größen erforderlich ist
6 1.2 Ziel und Vorgehen 5 Stator Welle Rotor Abbildung 1.3: Schematische Schnittansichten der in Abbildung 1.2 gezeigten Aktoren. Das elektromagnetische Drehmoment der Maschinen wirkt auf Rotor und Stator. Es sorgt einerseits für eine Synchronisierung von Rotor und Stator, beinhaltet aber auch das zur aktiven Dämpfung verwendete Wechselmoment. Dieses Wechselmoment bewirkt eine relative Auslenkung des Rotors gegenüber dem Stator. Einführend wird in Abschnitt 1.3 in einer systemtheoretischen Betrachtung gezeigt, dass eine aktive Schwingungsdämpfung in verzweigten Antriebssystemen mit bereits vorhandenen elektrischen Maschinen nicht immer möglich ist. In Kapitel 2 werden Methoden zur nicht linearen Modellierung von elektromagnetischen Inertialmassenaktoren mit Speisung durch einen Spannungszwischenkreiswechselrichter vorgestellt und exemplarisch für die in diesem Vorhaben verwendeten Maschinen angewendet. Darauf Aufbauend werden in Kapitel 3 unter Berücksichtigung der externen Anforderungen sowie dem Eigenverhalten der Maschine grundsätzliche Überlegungen zur Auslegung von Inertialmassenaktoren angestellt. Kapitel 4 befasst sich anschließend mit der Regelung des elektromechanischen Systems aus Wechselrichter und elektrischer Maschine. Um die multifrequente aktive Dämpfung realisieren zu können, wird ein neuer Ansatz zur Kompensation von frequenzabhängigen Phasenverschiebungen vorgestellt, ein Dämpfungsregler mit dynamischer Reglerverstärkung ermöglicht eine Dämpfung mit maximalem Drehmoment, unabhängig von der Schwingungsamplitude. Die vorgestellten Methoden werden in Kapitel 5 experimentell untersucht. Dazu wurden zwei Prototypen entworfen, gebaut und untersucht (siehe Abbildung 1.2). Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Maschinenausführung als permanenterregte Drehfeldmaschine mit Außenläufer, da diese für industrielle Anwendungen sehr viel besser geeignet ist. Die Experimente werden an einem Schwing-Versuchsstand mit Leistungsverzweigung durchgeführt, der bereits zuvor zur Untersuchung von Schwingungsphänomenen und Reglerauslegung für Walzstraßen aufgebaut wurde. Dieser Versuchsstand hat drei Eigenfrequenzen im Bereich von 12,4 Hz bis 67 Hz, die simultan angeregt werden können.
7 6 Einleitung Stützwalze Walzgut Arbeitswalzen Hauptantrieb Verteilergetriebe Stützwalze Abbildung 1.4: Stark vereinfachte, schematische Darstellung eines Quartowalzgerüsts mit Hauptantrieb, Verteilgetriebe (Kammwalzgetriebe), Arbeits- und Stützwalzen sowie dem zu walzenden Walzgut. Abschließend werden die verwendeten Methoden und damit erzielten Ergebnisse in Kapitel 6 diskutiert, Verbesserungspotenziale aufgezeigt und weiterführende Fragen aufgeworfen. 1.3 Problemanalyse Existiert in einem mechatronischen System ein geregelter Antrieb mit ausreichend großer Dynamik, so wird dieser in der Regel zur aktiven Schwingungsdämpfung verwendet. Methoden für dieses Vorgehen werden in der Literatur ausführlich ausgearbeitet. So beschreibt Stichweh in [Sti05] für ein Zweimassenschwingersystem Verfahren zur aktiven Schwingungsdämpfung sowohl mit einem herkömmlichen PI-Zustandsregler als auch einem H -optimalen Regler. Dabei greift er die Arbeit von Goslar auf, der in [Gos98] PI-Zustandsregler beschreibt, die mittels Eigenwertvorgabe so parametriert werden, dass sowohl der Stellaufwand im Führungsverhalten als auch das Dämpfungsverhalten optimal sind. Faßnacht stellt in [Faß02] ein Entwurfsverfahren für einen robusten Zustandsbeobachter vor, der die hochdynamische Drehzahl-PI-Zustandsregelung eines Dreimassenschwingers ermöglicht. Dabei realisiert er auch eine aktive Schwingungsdämpfung unter Zuhilfenahme des bereits vorhandenen Antriebs. Betrachtet man das Schwingungsverhalten von Mehrmassenschwingern, deren Massen und Federn nicht nur in Reihe geschaltet, sondern über Verzweigungsgetriebe auch parallel oder vermascht sind, kann es unter ungünstigen Bedingungen vorkommen, dass die aktive Dämpfung von Schwingungen mittels des Hauptantriebs nicht möglich ist. Dies passiert immer dann, wenn das Drehmoment des Hauptantriebs an einem Punkt in das System geleitet wird, der gleichzeitig der Schwingungsknoten einer Schwingform ist. In diesem Fall ist die Schwingung für den Hauptantrieb weder Steuer- noch Beobachtbar. In [CN75] wird aufbauend auf der Systemdarstellung mittels der Rosenbrock Systemmatrix eines Zustandsraumsystems P (s) = ( si A B C D )
8 1.3 Problemanalyse 7 eine allgemeine Beschreibung von zwei in Reihe geschalteten Systemen hergeleitet. Mit Hilfe der links- und rechtsseitigen teilerfremdem Faktorisierung (engl. coprime factorisations) wird bewiesen, dass die Reihenschaltung zweier Systeme nur unter bestimmten Bedingungen vollständig zustandsbeobachtbar oder vollständig zustandssteuerbar ist. Auf dieser Arbeit aufsetzend hat Fuhrmann in [Fuh75] wenig später ähnliche Untersuchungen angestellt, in denen gezeigt wird, dass auch die Parallelschaltung zweier Systeme nur unter bestimmten Umständen vollständig zustandssteuer- und beobachtbar sind. D B C + ẋ 1 x 1 A u D y B C + ẋ 2 x 2 A Abbildung 1.5: Signalflussplan einer Parallelschaltung zweier Systeme mit identischen Systemeigenschaften. Eingeschränkt ist die Steuer- und Beobachtbarkeit parallel geschalteter Systeme immer dann, wenn die Systeme dieselben dynamischen Eigenschaften haben (vergleiche [Lun13b]). Betrachtet man zwei identische Systeme mit jeweils n Zuständen, die durch die Matrizen A, B, C und D sowie die beiden Zustandsvektoren x 1 und x 2 beschrieben werden, ergibt sich die Beschreibung der Parallelschaltung mit dem Eingang u in Zustandsraumdarstellung wie folgt:
9 8 Einleitung (ẋ1 ẋ 2 ) = ( A 0 0 A ) (x 1 x 2 ) + ( B B ) u y(t) = (C C) ( x 1 x 2 ) + 2D u Da die Systeme parallel geschaltet sind, ist das Eingangssignal u für beide Systeme gleich; der Ausgang ist die Summe der Ausgänge der Teilsysteme (vergleiche Abbildung 1.5). Vollständig zustandssteuerbar ist das System genau dann, wenn es eine Steuerfunktion u gibt, die das System aus einem beliebigen Anfangszustand x 0 = ( x 1 x 2 ) 0 in einer endlichen Zeit in einen beliebigen Endzustand x = ( x 1 x 2 ) bringt (vgl. [Lun10]). Um zu überprüfen, ob die Parallelschaltung der Systeme diese Bedingung erfüllt wird zunächst die Steuerbarkeitsmatrix S S bestimmt: S S = (B AB A 2 B A 2n 1 B) = (( B B ) (A 0 0 A ) (B B ) (A A ) ( B B ) (A 0 2n 1 0 A ) ( B B ) ) = ( B AB A2 B A 2n 1 B B AB A 2 B A 2n 1 B ) Für ein vollständig zustandssteuerbares System mit 2n Zuständen hat die Steuerbarkeitsmatrix S S den Rang 2n, das heißt alle Zeilen der Steuerbarkeitsmatrix sind linear unabhängig. Für die Parallelschaltung zweier Systeme ist dies offensichtlich nicht der Fall, da sich die Steuerbarkeitsmatrix zeilenweise aus zwei identischen Untermatrizen zusammensetzt. Die vollständige Zustandsbeobachtbarkeit eines Systems ist genau dann gegeben, wenn man bei einem bekannter Beeinflussung Bu sowie der Kenntnis der Systemmatrizen A und C bei gemessenem Ausgang y über ein endliches Zeitintervall den Anfangszustand x 0 bestimmen kann (vgl. [Unb07]). Untersucht man zwei identische parallel geschaltete Systeme auf vollständige Zustandsbeobachtbarkeit muss analog zur Steuerbarkeitsmatrix die Beobachtbarkeitsmatrix S B bestimmt werden: S B = C CA CA 2 CA n 1 (C C) (C C) ( A 0 0 A ) = (C C) ( A A ) = (C C) ( A 0 n 1 0 A ) C C CA CA CA 2 CA 2 CA n 1 CA n 1 Damit die Beobachtbarkeit gegeben ist, muss der Rang der Matrix S B gleich n sein, was offensichtlich nicht der Fall ist, da die Spalten der Matrix hier linear abhängig sind. Die in
10 1.3 Problemanalyse 9 der Einführung genannten Ansätze, bei denen eine aktive Schwingungsdämpfung mit Hilfe eines bereits vorhandenen, geregelten Antriebs realisiert wird, versagen in bestimmten verzweigten Antriebssystemen also selbst dann, wenn auf Grund der Unbeobachtbarkeit weitere Messstellen eingerichtet werden, um eine Schwingung identifizieren zu können.
11
https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
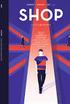 Stephan Meyer (Autor) Energieeffizienzsteigerung entlang der Supply Chain Entscheidungsmodell zur wertschöpfungskettenorientierten Emissionsminderung in Transformationsländern https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
Stephan Meyer (Autor) Energieeffizienzsteigerung entlang der Supply Chain Entscheidungsmodell zur wertschöpfungskettenorientierten Emissionsminderung in Transformationsländern https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
Geberlose Antriebssysteme für Hochleistungs- Textilmaschinen
 Asynchronmotor oder Servoantrieb? Die ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH präsentiert eine Alternative: Geberlose Antriebssysteme für Hochleistungs- Textilmaschinen Höchste Verfügbarkeit und sehr gute
Asynchronmotor oder Servoantrieb? Die ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH präsentiert eine Alternative: Geberlose Antriebssysteme für Hochleistungs- Textilmaschinen Höchste Verfügbarkeit und sehr gute
Blockbetrieb. Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme und Leistungselektronik. Arcisstraße 21 D München
 Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme und Leistungselektronik Technische Universität München Arcisstraße 21 D 80333 München Email: eat@ei.tum.de Internet: http://www.eat.ei.tum.de Prof. Dr.-Ing. Ralph
Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme und Leistungselektronik Technische Universität München Arcisstraße 21 D 80333 München Email: eat@ei.tum.de Internet: http://www.eat.ei.tum.de Prof. Dr.-Ing. Ralph
1. Einführung. Baudynamik (Master) SS 2017
 Baudynamik (Master) SS 2017 1. Einführung 1.1 Bedeutungen der Baudynamik 1.2 Grundbegriffe und Klassifizierung 1.3 Modellierung der Bauwerksschwingungen LEHRSTUHL FÜR BAUSTATIK 1 Baudynamik (Master) SS
Baudynamik (Master) SS 2017 1. Einführung 1.1 Bedeutungen der Baudynamik 1.2 Grundbegriffe und Klassifizierung 1.3 Modellierung der Bauwerksschwingungen LEHRSTUHL FÜR BAUSTATIK 1 Baudynamik (Master) SS
Übungsskript Regelungstechnik 2
 Seite 1 von 11 Universität Ulm, Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik Prof. Dr.-Ing. Klaus Dietmayer / Seite 2 von 11 Aufgabe 1 : In dieser Aufgabe sollen zeitdiskrete Systeme untersucht werden.
Seite 1 von 11 Universität Ulm, Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik Prof. Dr.-Ing. Klaus Dietmayer / Seite 2 von 11 Aufgabe 1 : In dieser Aufgabe sollen zeitdiskrete Systeme untersucht werden.
Feldorientierte Regelung
 Dieter Gerling Audi-Forum elektrische Kleinantriebe im Fahrzeug Ingolstadt, 05.05.2014 Inhalt Grundlagen Feldorientierte Regelung am Beispiel Asynchronmaschine Feldorientierte Regelung am Beispiel Permanentmagnet-Maschine
Dieter Gerling Audi-Forum elektrische Kleinantriebe im Fahrzeug Ingolstadt, 05.05.2014 Inhalt Grundlagen Feldorientierte Regelung am Beispiel Asynchronmaschine Feldorientierte Regelung am Beispiel Permanentmagnet-Maschine
Mögliche Quellen für Schwingungsanregungen im Antrieb
 Codestellen C070/x, C7/x, C7/x Verwendung der Bandsperren im 9400 HighLine Einleitung Die Dynamik von Servoantrieben wird durch unterschiedliche Einflüsse mitbestimmt, die unter bestimmten Bedingungen
Codestellen C070/x, C7/x, C7/x Verwendung der Bandsperren im 9400 HighLine Einleitung Die Dynamik von Servoantrieben wird durch unterschiedliche Einflüsse mitbestimmt, die unter bestimmten Bedingungen
Marc-Oliver von Maydell (Autor) Kraftkompensierender Drucksensor für die Flugmeßtechnik mit Selbstüberwachung
 Marc-Oliver von Maydell (Autor) Kraftkompensierender Drucksensor für die Flugmeßtechnik mit Selbstüberwachung https://cuvillier.de/de/shop/publications/2775 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Marc-Oliver von Maydell (Autor) Kraftkompensierender Drucksensor für die Flugmeßtechnik mit Selbstüberwachung https://cuvillier.de/de/shop/publications/2775 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
M 10 Resonanz und Phasenverschiebung bei der mechanischen Schwingung
 Fakultät für Physik und Geowissenschaften Physikalisches Grundpraktikum M 1 esonanz und Phasenverschiebung bei der mechanischen Schwingung Aufgaben 1. Bestimmen Sie die Frequenz der freien gedämpften Schwingung
Fakultät für Physik und Geowissenschaften Physikalisches Grundpraktikum M 1 esonanz und Phasenverschiebung bei der mechanischen Schwingung Aufgaben 1. Bestimmen Sie die Frequenz der freien gedämpften Schwingung
Zusammenfassung der 7. Vorlesung
 Zusammenfassung der 7. Vorlesung Steuer- und Erreichbarkeit zeitdiskreter Systeme Bei zeitdiskreten Systemen sind Steuer-und Erreichbarkeit keine äquivalente Eigenschaften. Die Erfüllung des Kalmankriteriums
Zusammenfassung der 7. Vorlesung Steuer- und Erreichbarkeit zeitdiskreter Systeme Bei zeitdiskreten Systemen sind Steuer-und Erreichbarkeit keine äquivalente Eigenschaften. Die Erfüllung des Kalmankriteriums
Automatisierungstechnik 1
 Automatisierungstechnik Hinweise zum Laborversuch Motor-Generator. Modellierung U a R Last Gleichstrommotor Gleichstromgenerator R L R L M M G G I U a U em = U eg = U G R Last Abbildung : Motor-Generator
Automatisierungstechnik Hinweise zum Laborversuch Motor-Generator. Modellierung U a R Last Gleichstrommotor Gleichstromgenerator R L R L M M G G I U a U em = U eg = U G R Last Abbildung : Motor-Generator
White Paper: Optimale Spannungsauslegung von mobilen Systemen
 U I P White Paper: Optimale Spannungsauslegung von mobilen Systemen Einleitung Bekannte Zusammenhänge: + Höhere Spannungen ermöglichen die gleiche Leistung mit geringerem Strom und damit geringeren Kupferquerschnitten
U I P White Paper: Optimale Spannungsauslegung von mobilen Systemen Einleitung Bekannte Zusammenhänge: + Höhere Spannungen ermöglichen die gleiche Leistung mit geringerem Strom und damit geringeren Kupferquerschnitten
Norman Lee Firchau (Autor) Variantenoptimierende Produktgestaltung
 Norman Lee Firchau (Autor) Variantenoptimierende Produktgestaltung https://cuvillier.de/de/shop/publications/3122 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075
Norman Lee Firchau (Autor) Variantenoptimierende Produktgestaltung https://cuvillier.de/de/shop/publications/3122 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075
Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe
 Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe https://cuvillier.de/de/shop/publications/334 Copyright:
Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe https://cuvillier.de/de/shop/publications/334 Copyright:
Der Allround-Frequenzumrichter zum Spartarif
 Der Allround-Frequenzumrichter zum Spartarif Die PDC-Umrichter sind im Maschinen- und Anlagenbau universell einsetzbare, voll digitale Geräte. Sie bieten dem Maschinen- und Anlagenbauer einen großen Funktionsumfang
Der Allround-Frequenzumrichter zum Spartarif Die PDC-Umrichter sind im Maschinen- und Anlagenbau universell einsetzbare, voll digitale Geräte. Sie bieten dem Maschinen- und Anlagenbauer einen großen Funktionsumfang
Florian Martin (Autor) Hochspannungsprüfsystem auf Basis leistungselektronischer Frequenzkonverter
 Florian Martin (Autor) Hochspannungsprüfsystem auf Basis leistungselektronischer Frequenzkonverter https://cuvillier.de/de/shop/publications/1426 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Florian Martin (Autor) Hochspannungsprüfsystem auf Basis leistungselektronischer Frequenzkonverter https://cuvillier.de/de/shop/publications/1426 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Elektromagnetische Schwingkreise
 Grundpraktikum der Physik Versuch Nr. 28 Elektromagnetische Schwingkreise Versuchsziel: Bestimmung der Kenngrößen der Elemente im Schwingkreis 1 1. Einführung Ein elektromagnetischer Schwingkreis entsteht
Grundpraktikum der Physik Versuch Nr. 28 Elektromagnetische Schwingkreise Versuchsziel: Bestimmung der Kenngrößen der Elemente im Schwingkreis 1 1. Einführung Ein elektromagnetischer Schwingkreis entsteht
UNIVERSITÄT DUISBURG - ESSEN Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Abt. Maschinenbau, Professur für Steuerung, Regelung und Systemdynamik
 Regelungstechnik I (PO95), Regelungstechnik (PO02 Schiffstechnik), Regelungstechnik (Bachelor Wi.-Ing.) (180 Minuten) Seite 1 NAME VORNAME MATRIKEL-NR. Aufgabe 1 (je 2 Punkte) a) Erläutern Sie anhand eines
Regelungstechnik I (PO95), Regelungstechnik (PO02 Schiffstechnik), Regelungstechnik (Bachelor Wi.-Ing.) (180 Minuten) Seite 1 NAME VORNAME MATRIKEL-NR. Aufgabe 1 (je 2 Punkte) a) Erläutern Sie anhand eines
3. Erzwungene gedämpfte Schwingungen
 3. Erzwungene gedämpfte Schwingungen 3.1 Schwingungsgleichung 3.2 Unwuchtanregung 3.3 Weganregung 3.4 Komplexe Darstellung 2.3-1 3.1 Schwingungsgleichung F(t) m Bei einer erzwungenen gedämpften Schwingung
3. Erzwungene gedämpfte Schwingungen 3.1 Schwingungsgleichung 3.2 Unwuchtanregung 3.3 Weganregung 3.4 Komplexe Darstellung 2.3-1 3.1 Schwingungsgleichung F(t) m Bei einer erzwungenen gedämpften Schwingung
https://cuvillier.de/de/shop/publications/7288
 Björn Pilarski (Autor) Mobile Personalinformationssysteme Empirische Erkenntnisse und Gestaltungsansätze zum Einsatz mobiler Anwendungen im Personalmanagement https://cuvillier.de/de/shop/publications/7288
Björn Pilarski (Autor) Mobile Personalinformationssysteme Empirische Erkenntnisse und Gestaltungsansätze zum Einsatz mobiler Anwendungen im Personalmanagement https://cuvillier.de/de/shop/publications/7288
Jürgen Wagner (Autor) Technische Konzepte zur RFID-gestützten Bauzustandsdokumentation in der Automobilindustrie
 Jürgen Wagner (Autor) Technische Konzepte zur RFID-gestützten Bauzustandsdokumentation in der Automobilindustrie https://cuvillier.de/de/shop/publications/884 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Jürgen Wagner (Autor) Technische Konzepte zur RFID-gestützten Bauzustandsdokumentation in der Automobilindustrie https://cuvillier.de/de/shop/publications/884 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Einfluss von Spannungsoberschwingungen und Rastmomenten auf den Gleichlauf von Servoantrieben mit Permanentmagnet-Synchronmotoren
 Einfluss von Spannungsoberschwingungen und Rastmomenten auf den Gleichlauf von Servoantrieben mit Permanentmagnet-Synchronmotoren Influence of voltage harmonics and cogging torque on speed deviations of
Einfluss von Spannungsoberschwingungen und Rastmomenten auf den Gleichlauf von Servoantrieben mit Permanentmagnet-Synchronmotoren Influence of voltage harmonics and cogging torque on speed deviations of
Auto-Tuning-Tool FAST für starre und teilelastische Systeme
 ARS 2000 Appl. Note 107 1 v. 8 1 Inhalt 1 Inhalt...1 2 Einleitung...1 3 Einführung FAST...2 2 Einleitung Die in dieser Application Note beschriebenen Funktionen sind in den Servopositionierreglern der
ARS 2000 Appl. Note 107 1 v. 8 1 Inhalt 1 Inhalt...1 2 Einleitung...1 3 Einführung FAST...2 2 Einleitung Die in dieser Application Note beschriebenen Funktionen sind in den Servopositionierreglern der
White Paper: Wechselwirkung von Umrichtern in größeren Systemen, vor allem mobilen Anwendungen
 Motor elektrisch VECTOPOWER Wechselrichter Batterie Lithium-Ionen White Paper: Wechselwirkung von Umrichtern in größeren Systemen, vor allem mobilen Anwendungen Einleitung Bei elektrischen Installationen
Motor elektrisch VECTOPOWER Wechselrichter Batterie Lithium-Ionen White Paper: Wechselwirkung von Umrichtern in größeren Systemen, vor allem mobilen Anwendungen Einleitung Bei elektrischen Installationen
Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences. 12. Januar 2017 HSD. Physik. Schwingungen III
 Physik Schwingungen III Wiederholung Komplexe Zahlen Harmonischer Oszillator DGL Getrieben Gedämpft Komplexe Zahlen Eulersche Formel e i' = cos ' + i sin ' Komplexe Schwingung e i!t = cos!t + i sin!t Schwingung
Physik Schwingungen III Wiederholung Komplexe Zahlen Harmonischer Oszillator DGL Getrieben Gedämpft Komplexe Zahlen Eulersche Formel e i' = cos ' + i sin ' Komplexe Schwingung e i!t = cos!t + i sin!t Schwingung
Ricardo Fiorenzano de Albuquerque (Autor) Untersuchung von Ejektor-Kälteanlagen beim Einsatz in tropischen Gebieten
 Ricardo Fiorenzano de Albuquerque (Autor) Untersuchung von Ejektor-Kälteanlagen beim Einsatz in tropischen Gebieten https://cuvillier.de/de/shop/publications/389 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Ricardo Fiorenzano de Albuquerque (Autor) Untersuchung von Ejektor-Kälteanlagen beim Einsatz in tropischen Gebieten https://cuvillier.de/de/shop/publications/389 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen
 Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6637 Copyright: Cuvillier Verlag,
Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6637 Copyright: Cuvillier Verlag,
SYNTHESE LINEARER REGELUNGEN
 Synthese Linearer Regelungen - Formelsammlung von 8 SYNTHESE LINEARER REGELUNGEN FORMELSAMMLUNG UND MERKZETTEL INHALT 2 Grundlagen... 2 2. Mathematische Grundlagen... 2 2.2 Bewegungsgleichungen... 2 2.3
Synthese Linearer Regelungen - Formelsammlung von 8 SYNTHESE LINEARER REGELUNGEN FORMELSAMMLUNG UND MERKZETTEL INHALT 2 Grundlagen... 2 2. Mathematische Grundlagen... 2 2.2 Bewegungsgleichungen... 2 2.3
Zeigen sie, dass das gegebene Zustandssystem steuerbar ist. Die Anwendbarkeit der beiden Kriterien wird im Folgenden an dem gegebenen System gezeigt.
 Priv.-Doz. G. Reißig, F. Goßmann M.Sc Universität der Bundeswehr München Institut für Steuer- und Regelungstechnik (LRT-5) Email: felix.gossmann@unibw.de Moderne Methoden der Regelungstechnik, HT 26 Übung
Priv.-Doz. G. Reißig, F. Goßmann M.Sc Universität der Bundeswehr München Institut für Steuer- und Regelungstechnik (LRT-5) Email: felix.gossmann@unibw.de Moderne Methoden der Regelungstechnik, HT 26 Übung
Gabriele Graube (Autor) Technik und Kommunikation ein systemischer Ansatz technischer Bildung
 Gabriele Graube (Autor) Technik und Kommunikation ein systemischer Ansatz technischer Bildung https://cuvillier.de/de/shop/publications/1065 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Gabriele Graube (Autor) Technik und Kommunikation ein systemischer Ansatz technischer Bildung https://cuvillier.de/de/shop/publications/1065 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Vorwort zur vierten Auflage
 Vorwort zur vierten Auflage Die elektrische Antriebstechnik erweitert ihre Anwendungsbereiche ständig. Ein Beispiel sind die elektrischen Antriebsstränge sowohl bei hybriden PKWs als auch bei Nutzfahrzeugen.
Vorwort zur vierten Auflage Die elektrische Antriebstechnik erweitert ihre Anwendungsbereiche ständig. Ein Beispiel sind die elektrischen Antriebsstränge sowohl bei hybriden PKWs als auch bei Nutzfahrzeugen.
https://cuvillier.de/de/shop/publications/7042
 Patrick Staub (Autor) Innovation im Kontext branchenstrukturellen Wandels in der genossenschaftlichen Weinwirtschaft Strategieanalyse und Unterstützungsansätze https://cuvillier.de/de/shop/publications/7042
Patrick Staub (Autor) Innovation im Kontext branchenstrukturellen Wandels in der genossenschaftlichen Weinwirtschaft Strategieanalyse und Unterstützungsansätze https://cuvillier.de/de/shop/publications/7042
Fachpraktikum Hochdynamische Antriebssysteme. Theoretische Grundlagen Gleichstrommaschine
 Fachpraktikum Hochdynamische ntriebssysteme Gleichstrommaschine Christof Zwyssig Franz Zürcher Philipp Karutz HS 2008 Gleichstrommaschine Die hier aufgeführten theoretischen Betrachtungen dienen dem Grundverständnis
Fachpraktikum Hochdynamische ntriebssysteme Gleichstrommaschine Christof Zwyssig Franz Zürcher Philipp Karutz HS 2008 Gleichstrommaschine Die hier aufgeführten theoretischen Betrachtungen dienen dem Grundverständnis
Einführung in die Mechatroniksimulation
 in die Mechatroniksimulation Prof. Dr. Ruprecht Altenburger ZHAW Institut für Mechatronische Systeme VPE Workshop, Rapperswil am 23.1.2014 1 / 19 1 Einleitung Mechatroniksimulation Modell starrer Körper
in die Mechatroniksimulation Prof. Dr. Ruprecht Altenburger ZHAW Institut für Mechatronische Systeme VPE Workshop, Rapperswil am 23.1.2014 1 / 19 1 Einleitung Mechatroniksimulation Modell starrer Körper
1 Grundlagen der Schrittantriebe 1 Erich Rummich
 Inhaltsverzeichnis Herausgeber-Vorwort Autoren-Vorwort 1 Grundlagen der Schrittantriebe 1 1.1 Einführung 1 1.2 Grundtypen von Schrittmotoren 4 1.2.1 Reluktanzschrittmotoren 4 1.2.2 Permanentmagnetisch
Inhaltsverzeichnis Herausgeber-Vorwort Autoren-Vorwort 1 Grundlagen der Schrittantriebe 1 1.1 Einführung 1 1.2 Grundtypen von Schrittmotoren 4 1.2.1 Reluktanzschrittmotoren 4 1.2.2 Permanentmagnetisch
6.2.2 Mikrowellen. M.Brennscheidt
 6.2.2 Mikrowellen Im vorangegangen Kapitel wurde die Erzeugung von elektromagnetischen Wellen, wie sie im Rundfunk verwendet werden, mit Hilfe eines Hertzschen Dipols erklärt. Da Radiowellen eine relativ
6.2.2 Mikrowellen Im vorangegangen Kapitel wurde die Erzeugung von elektromagnetischen Wellen, wie sie im Rundfunk verwendet werden, mit Hilfe eines Hertzschen Dipols erklärt. Da Radiowellen eine relativ
Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Herrn Prof. Dr. -Ing. P. Tenberge, da durch seine Anregung und Unterstützung diese Arbeit möglich wurde.
 Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als Doktorrand am Institut für Konstruktions- und Antriebstechnik der Fakultät für Maschinenbau an der Technischen Universität Chemnitz,
Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als Doktorrand am Institut für Konstruktions- und Antriebstechnik der Fakultät für Maschinenbau an der Technischen Universität Chemnitz,
5. Mechanische Schwingungen und Wellen. 5.1 Mechanische Schwingungen
 5. Mechanische Schwingungen und Wellen Der Themenbereich mechanische Schwingungen und Wellen ist ein Teilbereich der klassischen Mechanik, der sich mit den physikalischen Eigenschaften von Wellen und den
5. Mechanische Schwingungen und Wellen Der Themenbereich mechanische Schwingungen und Wellen ist ein Teilbereich der klassischen Mechanik, der sich mit den physikalischen Eigenschaften von Wellen und den
Entwicklung eines hybriden Algorithmus für adaptive Regler im geschlossenen Regelkreis
 Entwicklung eines hybriden Algorithmus für adaptive Regler im geschlossenen Regelkreis Ensio Hokka Problemstellung In vielen industriellen Regelapplikationen besteht die Notwendigkeit die Parametrisierung
Entwicklung eines hybriden Algorithmus für adaptive Regler im geschlossenen Regelkreis Ensio Hokka Problemstellung In vielen industriellen Regelapplikationen besteht die Notwendigkeit die Parametrisierung
Bachelorprüfung MM I 2. März Vorname: Name: Matrikelnummer:
 Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 2. März 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:......
Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 2. März 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:......
Mathias Arbeiter 09. Juni 2006 Betreuer: Herr Bojarski. Regelschaltungen. Sprungantwort und Verhalten von Regelstrecken
 Mathias Arbeiter 09. Juni 2006 Betreuer: Herr Bojarski Regelschaltungen Sprungantwort und Verhalten von Regelstrecken Inhaltsverzeichnis 1 Sprungantwort von Reglern 3 1.1 Reglertypen............................................
Mathias Arbeiter 09. Juni 2006 Betreuer: Herr Bojarski Regelschaltungen Sprungantwort und Verhalten von Regelstrecken Inhaltsverzeichnis 1 Sprungantwort von Reglern 3 1.1 Reglertypen............................................
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum MI Versuch 1.5 Erzwungene Schwingungen und Dämpfungen (Drehpendel nach Pohl) MI2AB Prof. Ruckelshausen MI2AB Prof. Ruckelshausen Seite 1 von 6 Inhaltsverzeichnis 1.) Versuch 1:
Physikalisches Praktikum MI Versuch 1.5 Erzwungene Schwingungen und Dämpfungen (Drehpendel nach Pohl) MI2AB Prof. Ruckelshausen MI2AB Prof. Ruckelshausen Seite 1 von 6 Inhaltsverzeichnis 1.) Versuch 1:
https://cuvillier.de/de/shop/publications/6765
 Jan Weitzel (Autor) Die ökonomische Bedeutung des Bankensektors unter Berücksichtigung der Too-Big-to-Fail -Doktrin Theoretische Zusammenhänge, empirische Erkenntnisse und ordnungspolitische Lösungsansätze
Jan Weitzel (Autor) Die ökonomische Bedeutung des Bankensektors unter Berücksichtigung der Too-Big-to-Fail -Doktrin Theoretische Zusammenhänge, empirische Erkenntnisse und ordnungspolitische Lösungsansätze
REGELUNG EINER PMSM (SPARK) FÜR EINE WINDKRAFTANLAGE
 Regelung einer PMSM (SPARK) für eine Windkraftanlage 1 REGELUNG EINER PMSM (SPARK) FÜR EINE WINDKRAFTANLAGE F. Turki 1 EINFÜHRUNG Alternative Stromversorgungen werden immer attraktiver und eine der saubersten
Regelung einer PMSM (SPARK) für eine Windkraftanlage 1 REGELUNG EINER PMSM (SPARK) FÜR EINE WINDKRAFTANLAGE F. Turki 1 EINFÜHRUNG Alternative Stromversorgungen werden immer attraktiver und eine der saubersten
Mechanische Schwingungen und Wellen
 Mechanische und Wellen Inhalt 1. 2.Überlagerung von 3.Entstehung und Ausbreitung von Wellen 4.Wechselwirkungen von Wellen 2 Voraussetzungen Schwingfähige Teilchen Energiezufuhr Auslenkung Rücktreibende
Mechanische und Wellen Inhalt 1. 2.Überlagerung von 3.Entstehung und Ausbreitung von Wellen 4.Wechselwirkungen von Wellen 2 Voraussetzungen Schwingfähige Teilchen Energiezufuhr Auslenkung Rücktreibende
Höhere Antriebsleistungen durch separat gespeiste parallele Stränge
 Themenvorschlag für FVA-AK Geregelte Antriebe Höhere Antriebsleistungen durch separat gespeiste parallele Stränge Kennwort : Parallelspeisung Prof. Dr.-Ing. Ralph M. Kennel Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme
Themenvorschlag für FVA-AK Geregelte Antriebe Höhere Antriebsleistungen durch separat gespeiste parallele Stränge Kennwort : Parallelspeisung Prof. Dr.-Ing. Ralph M. Kennel Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme
Höhere Antriebsleistungen durch separat gespeiste parallele Stränge
 Themenvorschlag für FVA-AK Geregelte Antriebe Höhere Antriebsleistungen durch separat gespeiste parallele Stränge Kennwort : Parallelspeisung Prof. Dr.-Ing. Ralph M. Kennel Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme
Themenvorschlag für FVA-AK Geregelte Antriebe Höhere Antriebsleistungen durch separat gespeiste parallele Stränge Kennwort : Parallelspeisung Prof. Dr.-Ing. Ralph M. Kennel Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme
Kompensation nichtlinearer Systemeigenschaften eines
 Kompensation nichtlinearer Systemeigenschaften eines EPS-Prüfstandes unter LabVIEW Beitrag von ITK Engineering AG zum National Instruments VIP-Kongress 2011 in der Reihe Prüfstandsautomatisierung Referent:
Kompensation nichtlinearer Systemeigenschaften eines EPS-Prüfstandes unter LabVIEW Beitrag von ITK Engineering AG zum National Instruments VIP-Kongress 2011 in der Reihe Prüfstandsautomatisierung Referent:
https://cuvillier.de/de/shop/publications/331
 Claudia Kratzsch (Autor) Entwicklung eines Modells zur fahrerzentrierten Beschreibung der Integralen Fahrzeugsicherheit Fallstudie: Car-to-Car und Car-to-Infrastructure Kommunikation https://cuvillier.de/de/shop/publications/331
Claudia Kratzsch (Autor) Entwicklung eines Modells zur fahrerzentrierten Beschreibung der Integralen Fahrzeugsicherheit Fallstudie: Car-to-Car und Car-to-Infrastructure Kommunikation https://cuvillier.de/de/shop/publications/331
maxon EC motor Bürstenlose DC Motoren: Eine Einführung
 maxon EC motor Bürstenlose DC Motoren: Eine Einführung Varianten: maxon EC Motorfamilien Gemeinsamkeiten Funktionsprinzip Wicklungsbeschaltung, Eisenverluste Elektronische Kommutierungssysteme Blockkommutierung
maxon EC motor Bürstenlose DC Motoren: Eine Einführung Varianten: maxon EC Motorfamilien Gemeinsamkeiten Funktionsprinzip Wicklungsbeschaltung, Eisenverluste Elektronische Kommutierungssysteme Blockkommutierung
Lioba Markl-Hummel (Autor) Multikriterielle Entscheidungsunterstützung für kommunale Klimaschutzmaßnahmen
 Lioba Markl-Hummel (Autor) Multikriterielle Entscheidungsunterstützung für kommunale Klimaschutzmaßnahmen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6257 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Lioba Markl-Hummel (Autor) Multikriterielle Entscheidungsunterstützung für kommunale Klimaschutzmaßnahmen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6257 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Erzwungene Schwingung, Resonanz, Selbstgesteuerte Schwingungen
 Aufgaben 19 Resonanz Erzwungene Schwingung, Resonanz, Selbstgesteuerte Schwingungen Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse erarbeiten können. - verstehen, was eine
Aufgaben 19 Resonanz Erzwungene Schwingung, Resonanz, Selbstgesteuerte Schwingungen Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse erarbeiten können. - verstehen, was eine
Bachelorprüfung MM I 15. Oktober Vorname: Name: Matrikelnummer:
 Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 15. Oktober 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:...
Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 15. Oktober 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:...
P1-12,22 AUSWERTUNG VERSUCH RESONANZ
 P1-12,22 AUSWERTUNG VERSUCH RESONANZ GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 0.1. Drehpendel - Harmonischer Oszillator. Bei dem Drehpendel handelt es sich um einen harmonischen Oszillator. Das Trägheitsmoment,
P1-12,22 AUSWERTUNG VERSUCH RESONANZ GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 0.1. Drehpendel - Harmonischer Oszillator. Bei dem Drehpendel handelt es sich um einen harmonischen Oszillator. Das Trägheitsmoment,
Vorbereitung. (1) bzw. diskreten Wellenzahlen. λ n = 2L n. k n = nπ L
 Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum Gitterschwingungen Vorbereitung Armin Burgmeier Robert Schittny 1 Theoretische Grundlagen Im Versuch Gitterschwingungen werden die Schwingungen von Atomen in einem
Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum Gitterschwingungen Vorbereitung Armin Burgmeier Robert Schittny 1 Theoretische Grundlagen Im Versuch Gitterschwingungen werden die Schwingungen von Atomen in einem
Andy Apfelstädt (Autor) Handlungsoptionen im euronationalen Ladungsverkehr
 Andy Apfelstädt (Autor) Handlungsoptionen im euronationalen Ladungsverkehr https://cuvillier.de/de/shop/publications/7559 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg
Andy Apfelstädt (Autor) Handlungsoptionen im euronationalen Ladungsverkehr https://cuvillier.de/de/shop/publications/7559 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg
120 Gekoppelte Pendel
 120 Gekoppelte Pendel 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die Schwingungsdauer zweier gekoppelter Pendel bei gleichsinniger und gegensinniger Schwingung. 1.2 Messen Sie die Schwingungs- und Schwebungsdauer bei
120 Gekoppelte Pendel 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die Schwingungsdauer zweier gekoppelter Pendel bei gleichsinniger und gegensinniger Schwingung. 1.2 Messen Sie die Schwingungs- und Schwebungsdauer bei
Shanna Appelhanz (Autor) Tracking & Tracing-Systeme in Wertschöpfungsnetzwerken für die industrielle stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe
 Shanna Appelhanz (Autor) Tracking & Tracing-Systeme in Wertschöpfungsnetzwerken für die industrielle stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe https://cuvillier.de/de/shop/publications/7194 Copyright:
Shanna Appelhanz (Autor) Tracking & Tracing-Systeme in Wertschöpfungsnetzwerken für die industrielle stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe https://cuvillier.de/de/shop/publications/7194 Copyright:
https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319
 Julita Magdalena Bock (Autor) Risikomanagement in börsennotierten Industrie- und Handelsunternehmen Zum Stand der Umsetzung und Nutzung als Instrument der Unternehmensführung https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319
Julita Magdalena Bock (Autor) Risikomanagement in börsennotierten Industrie- und Handelsunternehmen Zum Stand der Umsetzung und Nutzung als Instrument der Unternehmensführung https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319
Simon Schulte Beerbühl (Autor) Herstellung von Ammoniak unter Berücksichtigung fluktuierender Elektrizitätspreise
 Simon Schulte Beerbühl (Autor) Herstellung von Ammoniak unter Berücksichtigung fluktuierender Elektrizitätspreise https://cuvillier.de/de/shop/publications/6865 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Simon Schulte Beerbühl (Autor) Herstellung von Ammoniak unter Berücksichtigung fluktuierender Elektrizitätspreise https://cuvillier.de/de/shop/publications/6865 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Drehpendel. Praktikumsversuch am Gruppe: 3. Thomas Himmelbauer Daniel Weiss
 Drehpendel Praktikumsversuch am 10.11.2010 Gruppe: 3 Thomas Himmelbauer Daniel Weiss Abgegeben am: 17.11.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Versuchsaufbau 2 3 Eigenfrequenzbestimmung 2 4 Dämpfungsdekrementbestimmung
Drehpendel Praktikumsversuch am 10.11.2010 Gruppe: 3 Thomas Himmelbauer Daniel Weiss Abgegeben am: 17.11.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Versuchsaufbau 2 3 Eigenfrequenzbestimmung 2 4 Dämpfungsdekrementbestimmung
*DE A *
 *DE102007042930A120090312* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 042 930 A1 2009.03.12 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 042 930.6 (22) Anmeldetag:
*DE102007042930A120090312* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 042 930 A1 2009.03.12 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 042 930.6 (22) Anmeldetag:
maxon EC motor Bürstenlose DC Motoren: Eine Einführung
 maxon EC motor Bürstenlose DC Motoren: Eine Einführung Varianten: maxon EC Motorfamilien Gemeinsamkeiten Funktionsprinzip Wicklungsbeschaltung, Eisenverluste Elektronische Kommutierungssysteme Blockkommutierung
maxon EC motor Bürstenlose DC Motoren: Eine Einführung Varianten: maxon EC Motorfamilien Gemeinsamkeiten Funktionsprinzip Wicklungsbeschaltung, Eisenverluste Elektronische Kommutierungssysteme Blockkommutierung
Modellierung einer Strecke mit Motor
 LTAM-FELJC jean-claude.feltes@education.lu 1 Modellierung einer Strecke mit Motor Einführung Im LTAM wurde Labormaterial entwickelt mit dem man Versuche zu verschiedenen Regelungen durchführen kann: Drehzahlregelung
LTAM-FELJC jean-claude.feltes@education.lu 1 Modellierung einer Strecke mit Motor Einführung Im LTAM wurde Labormaterial entwickelt mit dem man Versuche zu verschiedenen Regelungen durchführen kann: Drehzahlregelung
Simulationsgestützte tzte Auslegung von Lineardirektantrieben mit MAXWELL, SIMPLORER und ANSYS. Matthias Ulmer, Universität Stuttgart
 Simulationsgestützte tzte Auslegung von Lineardirektantrieben mit MAXWELL, SIMPLORER und ANSYS Matthias Ulmer, Universität Stuttgart Gliederung 1. Motivation und Zielsetzung 2. Elektrodynamische Lineardirektantriebe
Simulationsgestützte tzte Auslegung von Lineardirektantrieben mit MAXWELL, SIMPLORER und ANSYS Matthias Ulmer, Universität Stuttgart Gliederung 1. Motivation und Zielsetzung 2. Elektrodynamische Lineardirektantriebe
Thomas Horn (Autor) Gefährdungsbetrachtung von PEM-Brennstoffzellen hinsichtlich des Einsatzes in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
 Thomas Horn (Autor) Gefährdungsbetrachtung von PEM-Brennstoffzellen hinsichtlich des Einsatzes in explosionsgefährdeten Betriebsstätten https://cuvillier.de/de/shop/publications/603 Copyright: Cuvillier
Thomas Horn (Autor) Gefährdungsbetrachtung von PEM-Brennstoffzellen hinsichtlich des Einsatzes in explosionsgefährdeten Betriebsstätten https://cuvillier.de/de/shop/publications/603 Copyright: Cuvillier
Koppelung von Struktur und Steuerung. Rapperswil. 23. Januar 2014. Elektromechanische Auslegung von Werkzeugmaschinen.
 Koppelung von Struktur und Steuerung Rapperswil 23. Januar 2014 Elektromechanische Auslegung von Werkzeugmaschinen GF AgieCharmilles Jan Konvicka / FE Inhaltsverzeichnis 1 Der Entwicklungsprozess 3 2 Maschinen-
Koppelung von Struktur und Steuerung Rapperswil 23. Januar 2014 Elektromechanische Auslegung von Werkzeugmaschinen GF AgieCharmilles Jan Konvicka / FE Inhaltsverzeichnis 1 Der Entwicklungsprozess 3 2 Maschinen-
- Einfluss der Regelung auf das dynamische Verhalten -
 Statisches und dynamisches Verhalten eines fünfachsigen Bearbeitungszentrums - Einfluss der Regelung auf das dynamische Verhalten - Dr.-Ing. Rouven Meidlinger planlauf GmbH Einleitung, Aufgabenstellung
Statisches und dynamisches Verhalten eines fünfachsigen Bearbeitungszentrums - Einfluss der Regelung auf das dynamische Verhalten - Dr.-Ing. Rouven Meidlinger planlauf GmbH Einleitung, Aufgabenstellung
AT Oberton Quarze. Vortragsreihe aus der Vorlesung Hoch- und Höchstfrequenztechnik an der Fachhochschule Aachen. Ralf Aengenheister
 AT Oberton Quarze Vortragsreihe aus der Vorlesung Hoch- und Höchstfrequenztechnik an der Fachhochschule Aachen Ralf Aengenheister 225038 Aachen, den 27 Dezember 2004 Fachbereich 5 1 INHALTSVERZEICHNIS
AT Oberton Quarze Vortragsreihe aus der Vorlesung Hoch- und Höchstfrequenztechnik an der Fachhochschule Aachen Ralf Aengenheister 225038 Aachen, den 27 Dezember 2004 Fachbereich 5 1 INHALTSVERZEICHNIS
Erzwungene Schwingung, Resonanz, Selbstgesteuerte Schwingungen
 Übung 19 Resonanz Erzwungene Schwingung, Resonanz, Selbstgesteuerte Schwingungen Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse erarbeiten können. - verstehen, was eine
Übung 19 Resonanz Erzwungene Schwingung, Resonanz, Selbstgesteuerte Schwingungen Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse erarbeiten können. - verstehen, was eine
Service & Support. Bewertung Verhältnis Fremdträgheitsmoment zu Motorträgheitsmoment
 lldeckblatt Bewertung Verhältnis Fremdträgheitsmoment zu Motorträgheitsmoment Hilfestellung Eingabe Grenzwerte für die farbliche Darstellung im SIZER FAQ August 213 Service & Support Answers for industry.
lldeckblatt Bewertung Verhältnis Fremdträgheitsmoment zu Motorträgheitsmoment Hilfestellung Eingabe Grenzwerte für die farbliche Darstellung im SIZER FAQ August 213 Service & Support Answers for industry.
Regelung eines inversen Pendels
 Regelung eines inversen Pendels Dr.-Ing. Michael Buchholz 29.10.2010 Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik NI Dozenten- und Ausbildertag 2010 Fürstenfeldbruck Seite 2 Anwendungsgebiete in der Forschung
Regelung eines inversen Pendels Dr.-Ing. Michael Buchholz 29.10.2010 Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik NI Dozenten- und Ausbildertag 2010 Fürstenfeldbruck Seite 2 Anwendungsgebiete in der Forschung
Elektrische und Aktoren
 Elektrische und Aktoren Eine Einfuhrung von Prof. Wolfgang Gerke Oldenbourg Verlag 1 Einleitung 1 2 Einteilung und Aufbau von Aktoren 5 2.1 Einteilung der Aktoren 5 2.2 Aufbau von Aktoren 8 3 Arbeit, Energie,
Elektrische und Aktoren Eine Einfuhrung von Prof. Wolfgang Gerke Oldenbourg Verlag 1 Einleitung 1 2 Einteilung und Aufbau von Aktoren 5 2.1 Einteilung der Aktoren 5 2.2 Aufbau von Aktoren 8 3 Arbeit, Energie,
Gliederung: 1. Der PRIUS 2. Hybridkonzepte 3. Motor und seine Betriebspunkte 4. Einsatz des Motors im Antriebsstrang
 Gliederung: 1. Der PRIUS 2. Hybridkonzepte 3. Motor und seine Betriebspunkte 4. Einsatz des Motors im Antriebsstrang 2 1. Der PRIUS 3 1. Der PRIUS Der Prius ist ein Pkw des japanischen Automobilherstellers
Gliederung: 1. Der PRIUS 2. Hybridkonzepte 3. Motor und seine Betriebspunkte 4. Einsatz des Motors im Antriebsstrang 2 1. Der PRIUS 3 1. Der PRIUS Der Prius ist ein Pkw des japanischen Automobilherstellers
Carsten Traupe (Autor) Schlachtschweinevermarktung in Niedersachsen - Stand, Defizite, Entwicklungsmöglichkeiten
 Carsten Traupe (Autor) Schlachtschweinevermarktung in Niedersachsen - Stand, Defizite, Entwicklungsmöglichkeiten https://cuvillier.de/de/shop/publications/3651 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Carsten Traupe (Autor) Schlachtschweinevermarktung in Niedersachsen - Stand, Defizite, Entwicklungsmöglichkeiten https://cuvillier.de/de/shop/publications/3651 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Inga Lampe (Autor) Die Lebensmittelüberwachung in Deutschland Eine Bewertung auf Basis ökonomischer Modelle und empirischer Analysen
 Inga Lampe (Autor) Die Lebensmittelüberwachung in Deutschland Eine Bewertung auf Basis ökonomischer Modelle und empirischer Analysen https://cuvillier.de/de/shop/publications/1176 Copyright: Cuvillier
Inga Lampe (Autor) Die Lebensmittelüberwachung in Deutschland Eine Bewertung auf Basis ökonomischer Modelle und empirischer Analysen https://cuvillier.de/de/shop/publications/1176 Copyright: Cuvillier
Regelungstechnik und Simulationstechnik mit Scilab und Modelica
 Peter Beater Regelungstechnik und Simulationstechnik mit Scilab und Modelica Eine beispielorientierte Einführung für Studenten und Anwender aus dem Maschinenbau Inhaltsverzeichnis Begriffe und Formelzeichen
Peter Beater Regelungstechnik und Simulationstechnik mit Scilab und Modelica Eine beispielorientierte Einführung für Studenten und Anwender aus dem Maschinenbau Inhaltsverzeichnis Begriffe und Formelzeichen
Bachelorprüfung MM I 8. März Vorname: Name: Matrikelnummer:
 Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 80 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 8. März 2011 Rechenteil Name:... Matr. Nr.:...
Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 80 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 8. März 2011 Rechenteil Name:... Matr. Nr.:...
Inhaltsverzeichnis. Rainer Hagl. Elektrische Antriebstechnik. ISBN (Buch): ISBN (E-Book):
 Inhaltsverzeichnis Rainer Hagl Elektrische Antriebstechnik ISBN (Buch): 978-3-446-43350-2 ISBN (E-Book): 978-3-446-43378-6 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43350-2
Inhaltsverzeichnis Rainer Hagl Elektrische Antriebstechnik ISBN (Buch): 978-3-446-43350-2 ISBN (E-Book): 978-3-446-43378-6 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43350-2
Digitale Steuerung. Hardwarepraktikum für Informatiker Matr. Nr.:... Versuch Nr.5. Vorkenntnisse: Universität Koblenz Landau Name:...
 Universität Koblenz Landau Name:..... Institut für Physik Vorname:..... Hardwarepraktikum für Informatiker Matr. Nr.:..... Digitale Steuerung Versuch Nr.5 Vorkenntnisse: Aufbau eines Gleichstrommotors,
Universität Koblenz Landau Name:..... Institut für Physik Vorname:..... Hardwarepraktikum für Informatiker Matr. Nr.:..... Digitale Steuerung Versuch Nr.5 Vorkenntnisse: Aufbau eines Gleichstrommotors,
4.6 Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden
 Dieter Suter - 36 - Physik B3 4.6 Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden 4.6. Das Doppelpendel Wir betrachten nun nicht mehr einzelne, unabhängige harmonische Oszillatoren, sondern mehrere, die aneinander
Dieter Suter - 36 - Physik B3 4.6 Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden 4.6. Das Doppelpendel Wir betrachten nun nicht mehr einzelne, unabhängige harmonische Oszillatoren, sondern mehrere, die aneinander
2. Eigenschaften dynamischer Systeme
 2. Eigenschaften dynamischer Systeme 2.1 Allgemeine Systemeigenschaften 2.1.1 Signale 2.1.2 Systeme Definition: System Ein System ist ein natürliches oder künstliches Gebilde. Es kann Eingangs-Signale
2. Eigenschaften dynamischer Systeme 2.1 Allgemeine Systemeigenschaften 2.1.1 Signale 2.1.2 Systeme Definition: System Ein System ist ein natürliches oder künstliches Gebilde. Es kann Eingangs-Signale
WECHSELLASTFESTIGKEIT VON PERMANENTERREGTEN SYNCHRONMASCHINEN
 WECHSELLASTFESTIGKEIT VON PERMANENTERREGTEN SYNCHRONMASCHINEN Dipl. Ing. Ulrich Gutsche Technischer Leiter Antriebssysteme FAURNDAU GmbH (Fertigung) Antriebstechnik GmbH FAURNDAU (Vertrieb/Entwicklung)
WECHSELLASTFESTIGKEIT VON PERMANENTERREGTEN SYNCHRONMASCHINEN Dipl. Ing. Ulrich Gutsche Technischer Leiter Antriebssysteme FAURNDAU GmbH (Fertigung) Antriebstechnik GmbH FAURNDAU (Vertrieb/Entwicklung)
3. Erzwungene Schwingungen
 3. Erzwungene Schwingungen Bei erzwungenen Schwingungen greift am schwingenden System eine zeitlich veränderliche äußere Anregung an. Kraftanregung: Am schwingenden System greift eine zeitlich veränderliche
3. Erzwungene Schwingungen Bei erzwungenen Schwingungen greift am schwingenden System eine zeitlich veränderliche äußere Anregung an. Kraftanregung: Am schwingenden System greift eine zeitlich veränderliche
Aufgabensammlung Regelungs- und Systemtechnik 2 / Regelungstechnik für die Studiengänge MTR/BMT
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT ILMENAU Institut für Automatisierungs- und Systemtechnik Fachgebiet Simulation und Optimale Prozesse Aufgabensammlung Regelungs- und Systemtechnik 2 / Regelungstechnik für die Studiengänge
TECHNISCHE UNIVERSITÄT ILMENAU Institut für Automatisierungs- und Systemtechnik Fachgebiet Simulation und Optimale Prozesse Aufgabensammlung Regelungs- und Systemtechnik 2 / Regelungstechnik für die Studiengänge
https://cuvillier.de/de/shop/publications/2645
 Friedrich Hainbuch (Autor) Die Verbesserung der Vitalkapazität der Lunge in Folge eines gezielten moderaten, halbjährigen Ausdauertrainings. Zugleich ein Beitrag zur Geroprophylaxe zur Steigerung der Alltagskompetenz
Friedrich Hainbuch (Autor) Die Verbesserung der Vitalkapazität der Lunge in Folge eines gezielten moderaten, halbjährigen Ausdauertrainings. Zugleich ein Beitrag zur Geroprophylaxe zur Steigerung der Alltagskompetenz
Dirk Richard Keiner (Autor) Methodischer Vergleich von verschiedenen Instrumenten zur Messung der Lebensqualität bei Osteoporosepatienten
 Dirk Richard Keiner (Autor) Methodischer Vergleich von verschiedenen Instrumenten zur Messung der Lebensqualität bei Osteoporosepatienten https://cuvillier.de/de/shop/publications/2029 Copyright: Cuvillier
Dirk Richard Keiner (Autor) Methodischer Vergleich von verschiedenen Instrumenten zur Messung der Lebensqualität bei Osteoporosepatienten https://cuvillier.de/de/shop/publications/2029 Copyright: Cuvillier
Drehpendel nach R.W. Pohl
 Drehpendel nach R.W. Pohl Technische Daten: Eigenfrequenz: Erregerfrequenz: Motorspannung: Stromaufnahme: ca. 0,55 Hz 0,1... 1,3 Hz 24 V=, an den Prüfbuchsen 0...20 V max. 650 ma Wirbelstromdämpfung: 0...20
Drehpendel nach R.W. Pohl Technische Daten: Eigenfrequenz: Erregerfrequenz: Motorspannung: Stromaufnahme: ca. 0,55 Hz 0,1... 1,3 Hz 24 V=, an den Prüfbuchsen 0...20 V max. 650 ma Wirbelstromdämpfung: 0...20
k = 1, 2,..., n (4.44) J k ϕ
 236 4 Torsionsschwinger und Längsschwinger ( J1 J2) M J M J2/ J1= 02, 10 0,5 8 1 + 6 2 max 4 5 2 10 2 bezogenes Moment 0 Bild 45 1 2 5 10 relatives Spiel ctϕ S/ M10 Maximales Moment infolge Spiel im Antrieb
236 4 Torsionsschwinger und Längsschwinger ( J1 J2) M J M J2/ J1= 02, 10 0,5 8 1 + 6 2 max 4 5 2 10 2 bezogenes Moment 0 Bild 45 1 2 5 10 relatives Spiel ctϕ S/ M10 Maximales Moment infolge Spiel im Antrieb
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch 3: Drehschwingungen. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 3: Drehschwingungen Durchgeführt am 27.10.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 3: Drehschwingungen Durchgeführt am 27.10.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Mechatronik und elektrische Antriebe
 Prof. Dr. Ing. Joachim Böcker Mechatronik und elektrische Antriebe 03.09.2014 Name: Matrikelnummer: Vorname: Studiengang: Aufgabe: (Punkte) 1 (30) 2 (18) 3 (22) Gesamt (60) Note Bearbeitungszeit: 120 Minuten
Prof. Dr. Ing. Joachim Böcker Mechatronik und elektrische Antriebe 03.09.2014 Name: Matrikelnummer: Vorname: Studiengang: Aufgabe: (Punkte) 1 (30) 2 (18) 3 (22) Gesamt (60) Note Bearbeitungszeit: 120 Minuten
Lars Thoroe (Autor) RFID in Reverse-Logistics-Systemen
 Lars Thoroe (Autor) RFID in Reverse-Logistics-Systemen https://cuvillier.de/de/shop/publications/219 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen, Germany
Lars Thoroe (Autor) RFID in Reverse-Logistics-Systemen https://cuvillier.de/de/shop/publications/219 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen, Germany
Hong Liu-Kiel (Autor) Mitarbeitermotivation in China und Deutschland Ein interkultureller Vergleich auf der Basis von Laborexperimenten
 Hong Liu-Kiel (Autor) Mitarbeitermotivation in China und Deutschland Ein interkultureller Vergleich auf der Basis von Laborexperimenten https://cuvillier.de/de/shop/publications/156 Copyright: Cuvillier
Hong Liu-Kiel (Autor) Mitarbeitermotivation in China und Deutschland Ein interkultureller Vergleich auf der Basis von Laborexperimenten https://cuvillier.de/de/shop/publications/156 Copyright: Cuvillier
Jan Wenker (Autor) Ökobilanzierung komplexer Holzprodukte am Beispiel industriell hergestellter Möbel
 Jan Wenker (Autor) Ökobilanzierung komplexer Holzprodukte am Beispiel industriell hergestellter Möbel https://cuvillier.de/de/shop/publications/7157 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Jan Wenker (Autor) Ökobilanzierung komplexer Holzprodukte am Beispiel industriell hergestellter Möbel https://cuvillier.de/de/shop/publications/7157 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
6 Elektromagnetische Schwingungen und Wellen
 6 Elektromagnetische Schwingungen und Wellen Gegen Ende des 19.Jahrhunterts gelang dem berühmten deutschen Physiker Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit der
6 Elektromagnetische Schwingungen und Wellen Gegen Ende des 19.Jahrhunterts gelang dem berühmten deutschen Physiker Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit der
Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch. Münster, den
 E6 Elektrische Resonanz Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch Münster, den.. INHALTSVERZEICHNIS. Einleitung. Theoretische Grundlagen. Serienschaltung von Widerstand R, Induktivität L
E6 Elektrische Resonanz Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch Münster, den.. INHALTSVERZEICHNIS. Einleitung. Theoretische Grundlagen. Serienschaltung von Widerstand R, Induktivität L
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik. Aufgabensammlung zur. Regelungstechnik B. Prof. Dr. techn. F. Gausch Dipl.-Ing. C.
 Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik Aufgabensammlung zur Regelungstechnik B Prof. Dr. techn. F. Gausch Dipl.-Ing. C. Balewski 10.03.2011 Übungsaufgaben zur Regelungstechnik B Aufgabe 0
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik Aufgabensammlung zur Regelungstechnik B Prof. Dr. techn. F. Gausch Dipl.-Ing. C. Balewski 10.03.2011 Übungsaufgaben zur Regelungstechnik B Aufgabe 0
Inhalt der Vorlesung A1
 PHYSIK Physik A/B1 A WS SS 17 13/14 Inhalt der Vorlesung A1 1. Einführung Methode der Physik Physikalische Größen Übersicht über die vorgesehenen Themenbereiche. Teilchen A. Einzelne Teilchen Beschreibung
PHYSIK Physik A/B1 A WS SS 17 13/14 Inhalt der Vorlesung A1 1. Einführung Methode der Physik Physikalische Größen Übersicht über die vorgesehenen Themenbereiche. Teilchen A. Einzelne Teilchen Beschreibung
