Technische Bedeutung der OM-Chemie:
|
|
|
- Jonas Bader
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Organometallchemie Metallorganische Chemie
2 Technische Bedeutung der OM-Chemie: Produktion von OM-Verbindungen - Silicone t/a - Pb-Alkyle t/a - Al-Alkyle t/a - Sn-Alkyle t/a Produktion durch OM-Katalysatoren - Polypropylen t/a - Polyethylen t/a - "Oxo"-Produkte t/a - Acetaldehyd t/a - Essigsäure t/a
3 Folien: Frank Uhlig Erste literaturbekannte metallorganische Verbindung Louis Claude Cadet de Gassicourt Pariser Apotheker findet beim Versuch, Geheimtinte herzustellen eine liqueur fumante de l arsenique As 2 O CH 3 COOK H 3 C O CH H 3 C 3 As As + As As CH 3 CH 3 H 3 C CH 3 CH 3 Kakodyloxid Dikakodylk gr. kakodes = Gestank
4 1760 Erste literaturbekannte übergangsmetallorganische Verbindung William C. Zeise Dänischer Apotheker (Kopenhagen) Platin-Ethylenkomplexe aus K 2 PtCl 6 bzw. K 2 PtCl 4 und Ethanol Cl 2- - Cl Cl Pt Cl Cl Cl EtOH Cl Cl Pt Cl Frank Uhlig
5 1760 Erste literaturbekannte übergangsmetallorganische Verbindung William C. Zeise Dänischer Apotheker (Kopenhagen) Platin-Ethylenkomplexe aus K 2 PtCl 6 bzw. K 2 PtCl 4 und Ethanol 2- Cl Cl Pt Cl Cl EtOH Cl Pt Cl Cl Pt Cl Frank Uhlig
6 Zinkorganyle Sir Edward Frankland (Imperial College) Auf der Suche nach freien Radikalen super Idee, cooles Ergebnis! H 3 C H 2 C I + Zn H 3 C H 2 C Zn H 2 C + ZnI 2 CH 3 X ZnI 2 + H 2 C CH 3 Doktorat in Marburg! Lernte in Deutschland Kolbe, Liebig und Bunsen kennen Ergebnis: Stichflamme aus dem Autoklaven beim Öffnen er war überzeugt, er hätte Radikale. Frank Uhlig
7 Zinkorganyle Sir Edward Frankland (Imperial College) Später: Herstellung von Quecksilberalkylen CH 3 X + Na/Hg (CH 3 ) 2 Hg + NaX Verwendung von R 2 Hg und R 2 Zn als Alkylüberträger weitere Hauptgruppen(metall)organyle (R 4 Sn, R 3 B, ) Doktorat in Marburg! Lernte in Deutschland Kolbe, Liebig und Bunsen kennen Einführung des Begriffs VALENZ! Frank Uhlig
8 Andere Hauptgruppenorganyle K.J. König und M.E.Schweizer - Tetraethylblei aus Na/Pb und Ethyljodid W.Hallwachs und A.Schafarik - Alkylaluminiumiodide aus Al und Alkyljodiden C.Friedel und J.M.Crafts - Organochlorsilane R m SiCl 4-m aus SiCl 4 und ZnR 2 (Alkylgruppenübertragung) J. A. Wanklyn halogenidfreie Magnesiumalkyle aus Mg und HgR 2 Frank Uhlig
9 Periodensystem D. I. Mendelejew 1869 erstes modernes modernes Periodensystem Nutzung metallorganischer Verbindungen zur Vorhersage neuer Elemente Bekannt Postuliert Gefunden CdEt 2 InEt 3 InEt 3 SiEt 4 Eka-SiEt 4 GeEt 4 SnEt 4 C. Winkler 1887 Frank Uhlig
10 erstes binäres Metallcarbonyl: Ni(CO) 4 Ludwig Mond Industriechemiker (England) interessiert sich für die Abfallprodukte aus industriellen Prozessen. entwickelt z.b. ein Verfahren zur Schwefelrückgewinnung aus CaS, das im Leblanc-Prozeß anfällt. Brachte ihm viel Ruhm ein. 2 NaCl + H 2 SO 4 + CaCO C Na 2 CO 3 + CaS + 2 HCl + 2 CO 2 geboren in Kassel, studierte in Marburg bei Kolbe und in Heidelberg bei Bunsen; arbeitet dann in einem Chemiewerk in Kassel mit viel Erfolg und wird nach England abgeworben Frank Uhlig
11 erstes binäres Metallcarbonyl: Ni(CO) 4 Ludwig Mond Industriechemiker (England) dann: entdeckt durch Zufall, das Ni mit CO reagiert: CO Ni CO OC Ni CO CO geboren in Kassel, studierte in Marburg bei Kolbe und in Heidelberg bei Bunsen; arbeitet dann in einem Chemiewerk in Kassel mit viel Erfolg und wird nach England abgeworben Ni(CO) 4 ist flüssig und verdampfbar verwendet das, um Ni aus den Erzen zu extrahieren: MOND-PROZESS Frank Uhlig
12 erstes binäres Metallcarbonyl: Ni(CO) 4 Ludwig Mond Industriechemiker (England) gründet mit Sir Tomlinson Brunner die Chemiefirma Brunner, Mond & Co. später wird daraus der jetzige ICI Konzern (Imperial Chemical Industries) geboren in Kassel, studierte in Marburg bei Kolbe und in Heidelberg bei Bunsen; arbeitet dann in einem Chemiewerk in Kassel mit viel Erfolg und wird nach England abgeworben entwickelt so nebenbei die erste Brenstoffzelle (1889) Frank Uhlig
13 Magnesiumalkyle eine brilliante Doktorarbeit Victor Grignard Universität Lyon arbeitet eng mit Philippe Barbier in Lyon zusammen Doktorarbeit 1901 Sur les Combinaisons organomagnésiennes mixtes R-X + Mg R-MgX einfach herzustellen, stabiler als R 2Zn und dazu besser Alkylierungsmittel. Frank Uhlig
14 Magnesiumalkyle Victor Grignard Universität Lyon entwickelte sehr schnell sehr viele Verwendungsmöglichkeiten in der organischen Synthese 1935 (als er starb) bereits über 6000 (!!) Literaturverweise auf seine Grignardreagentien NOBELPREIS 1912 (gemeinsam mit Paul Sabatier) Frank Uhlig
15 Entwicklungen an der Jahrhundertschwelle L. F. S. Kipping - Silicone aus Ph 2 SiCl 2 und Wasser W. J. Pope - erstes reines Übergangsmetallalkyl Me 3 Pt - I C.Friedel und J.M.Crafts - Salvarsan Arsenderivat zur Bekämpfung der Syphillis F. Hein Synthese erster Sandwichkomplexe aus CrCl 3 und PhMgBr Frank Uhlig
16 Magnesiumalkyle Schlenk-Gleichgewicht für Grignard- WSchlenk W. Reagentien Entwickelte die heute Schlenk-Kolben oder-rohre genannten Glasgeräte, Urvater der heutigen aneroben Arbeitstechniken Lithium-Alkyle durch Transalkylierung 2 Li + R 2 Hg 2 LiR + Hg 2 EtLi + Me 2 Hg 2 MeLi + Et 2 Hg Frank Uhlig
17 Fischer-Tropsch Synthese Franz Joseph Emil Fischer Kaiser-Wilhelm Institut Mülheim Fischer wird 1913 zum ersten Direktor des neu gegründeten Kaiser-Wilhelm- Institutes in Mülheim berufen 1925 zusammen mit Hans Tropsch: Herstellung von Paraffinen aus Wassergas: FISCHER-TROPSCH-PROZESS CO + H 2 Ni/Co (CH 2 ) n Frank Uhlig
18 Systematisierung der Carbonylchemie; erste Hydridkomplexe Walter Hieber Technische Hochschule München beschäftigt sich sehr viel mit der Chemie und Reaktivität von Übergangsmetallcarbonylen. CO Fe(CO) 5 X 2 OC -CO OC Fe CO X X Frank Uhlig
19 Systematisierung der Carbonylchemie; erste Hydridkomplexe Walter Hieber Technische Hochschule München der systematische Zugang zur Übergangsmetall-Carbonylchemie laesst ihn eine neue Stoffklasse entdecken: Hydrid-Carbonylverbindungen (1931). OH - Fe(CO) 5 H 2 [Fe(CO) 4 ] - -HCO 3 Frank Uhlig
20 die Anwendung dieser Grundlagenforschung: Hydroformylierung Otto Roelen Ruhr-Chemie arbeitet an der Fischer-Tropsch-Synthese und versucht herauszufinden, woher die oxidierten Nebenprodukte kommen. Entdeckt dabei folgende Reaktion: CO + H 2 + Co CHO + O Frank Uhlig
21 die Anwendung dieser Grundlagenforschung: Hydroformylierung Otto Roelen Ruhr-Chemie die eigentlich katalytische aktive Spezies: H[Co(CO) 4 ], das in situ aus Co, CO und H 2 entsteht. heute: nur noch homogen katalytisch, weil die Selektivität gesteuert werden kann: CHO CO/H 2 CHO + HCo(CO) 4 n-butanal iso-butanal über 70% der Hydroformylierungsprodukte sind C4 ( org. Grundstoffe); n-butanal erwünscht Frank Uhlig
22 Acetylenchemie Walter Julius Reppe BASF Ludwigshafen chemische Modifizierung von Acetylenen; entwickelt in den 30er und 40er Jahren zahlreiche Synthesen kleiner organischer Moleküle mit Acetylenen als Ausgangsstoffen. gss Frank Uhlig
23 Acetylenchemie Walter Julius Reppe BASF Ludwigshafen O HOH 2 C CH 2 OH O OMe H 3 C CHO H 3 C O O Frank Uhlig
24 Direktsynthese von Organochlorsilanen aus elementarem Silicium E. G. Rochow R. Müller USA, Deutschland Kupfer-Katalysator, Katalysator der Mechanismus der Reaktion ist bis heute Gegenstand von Untersuchungen Heute kann durch Reaktortypen und Reaktionsbedingungen die Selektivität der Reaktion gesteuert werden. Andere Silicium-Verbindungen sind heute auf diesem Wege ebenfalls darstellbar. Cu-Kat. MeCl + Si Me 2 SiCl 2 + MeSiCl 3 + Me 3 SiCl Frank Uhlig
25 Ferrocen: Beginn der modernen metallorganischen Chemie P.L. Pauson und Samuel A. Miller PAUSON: Umsetzung von FeCl 2 mit CpMgCl FeCl 2 + MgCl H H Fe Nature, 1951 Peter Ludwig Pauson (University of Sheffield) MILLER: kurze Zeit vorher: Rkt. von CpH mit Eisen bei 300 C Fe + CH C H Fe H J.Chem.Soc., 1952 Frank Uhlig
26 Ferrocen: Beginn der modernen metallorganischen Chemie P.L. Pauson und Samuel A. Miller Strukturaufklärung kurz danach durch WOODWARD und WILKINSON (Harvard University) sowie unabhängig davon durch E.O.FISCHER (TU München) Peter Ludwig Pauson (University of Sheffield) Frank Uhlig
27 Bindungsmodell für Alken- Übergangsmetallkomplexe Michael J. S. DEWAR 1951 J. CHATT, L. A. DUNCANSON 1953
28 Wittig Reaktion Auf der Suche nach Phosphoranen Ph 4 P-Me werden die Phosphorylide entdeckt [Ph 3 P-Me]Cl + PhLi Ph 4 P-Me X Georg WITTIG erhält 1979 gemeinsam mit Herbert C. Brown (Hydroborierung) den Nobelpreis Frank Uhlig
29 Karl Ziegler: Mülheim/Ruhr als Startpunkt der homogenen Katalyse Karl Ziegler Max Planck Institut für Kohlenforschung (Mülheim an der Ruhr) diese Reaktion macht ihn zu einem der reichsten Männer Deutschlands: TiCl 4 / AlEt 3 mit den Erträgen aus den Patenten wird nicht nur das gesamte MPI für fast ein halbes Jahrhundert komplett finanziert, sondern Ziegler ersteigert sich privat eine ganz beachtliche Kunstsammlung v.a. expressionistischer Werke (Sammlung Ziegler in der Alten Post in Mülheim) Frank Uhlig n
30 Karl Ziegler: Mülheim/Ruhr als Startpunkt der homogenen Katalyse Karl Ziegler Max Planck Institut für Kohlenforschung (Mülheim an der Ruhr) wissenschaftlich-intellektuelle Ästhetik: Zieglers eigentliches Forschungsthema: die Umsetzung von Aluminiumalkylen mit Olefinen mit dem Ziel der Synthese langkettiger Alkohole: AlEt 3 + 3n Al n 3 H 2 O HO n Frank Uhlig
31 Karl Ziegler: Mülheim/Ruhr als Startpunkt der homogenen Katalyse Karl Ziegler Max Planck Institut für Kohlenforschung (Mülheim an der Ruhr) wissenschaftlich-intellektuelle Ästhetik: im Autoklaven werden AlEt 3 und Ethylen zusammengepresst. eines Tages findet er unter den Reaktionsprodukten in der Gasphase BUTEN 2? Frank Uhlig
32 Karl Ziegler: Mülheim/Ruhr als Startpunkt der homogenen Katalyse Karl Ziegler Max Planck Institut für Kohlenforschung (Mülheim an der Ruhr) wissenschaftlich-intellektuelle Ästhetik: Wie kann das passiert sein? - durch VERUNREINIGUNGEN im Autoklaven der wurde mit HCl konz gewaschen, wobei sich Nickel aus dem Stahl gelöst hat. Durch unsauberes Nachspülen mit Wasser blieb dieses Nickel im Autoklaven und änderte somit den Reaktionsverlauf und Zieglers finanzielle Situation 2 Ni
33 Karl Ziegler: Mülheim/Ruhr als Startpunkt der homogenen Katalyse Karl Ziegler Max Planck Institut für Kohlenforschung (Mülheim an der Ruhr) wissenschaftlich-intellektuelle Ästhetik: nur aufgrund dieser einzelnen Beobachtung ändert Ziegler die Forschungsrichtung des gesamten Instituts: alle Metalle werden systematisch auf alle Mitarbeiter verteilt, bis er schliesslich h in TiCl 4 den Polymerisationskatalysator findet TiCl 4 / AlEt 3 n Frank Uhlig
34 Karl Ziegler: Mülheim/Ruhr als Startpunkt der homogenen Katalyse Karl Ziegler Max Planck Institut für Kohlenforschung (Mülheim an der Ruhr) wissenschaftlich-intellektuelle Ästhetik: für diese Entdeckung wird er 1963 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet zusammen mit... Frank Uhlig
35 Giulio Natta: neue Polymere mit den neuen Katalysatoren Giulio Natta (Polytechnikum Turin) greift sehr schnell Zieglers Reaktion auf und untersucht die Polymerisation mit verschiedenen Monomeren und entwickelt Methoden zur stereoregulierten t Polymerisation Kat. n isotaktisches PP neue Kunststoffe, die unser Alltagsleben schliesslich entscheidend mitbestimmen Frank Uhlig
36 E.O. Fischer: die erste Metall-Kohlenstoff Doppelbindung Ernst Otto Fischer (TU München) Nobelpreis 1973 ( Aufklärung der Ferrocenstruktur) 1964: erster CARBEN-Komplex: CO CO OC W C OC CO O CO CO CO O - Li + RLi Me 3 O + CO OC W C OC W C OC CH 3 OC CO CO OMe CH 3 Frank Uhlig
37 E.O. Fischer: die erste Metall-Kohlenstoff Doppelbindung Ernst Otto Fischer (TU München) 1973: erster CARBIN-Komplex: CO CO OC W C OC CO OMe CH 3 BX 3 -BX 2 (OMe) -CO CO CO X W C OC CO CH 3 geplant war eigentlich: CO CO OC W C OC CO OMe CH 3 BX 3 -BX 2 (OMe) -CO CO CO OC W C OC CO X CH 3 Frank Uhlig
38 G. Wilkinson: homogen-katalytische Hydrierung von Olefinen Sir Geoffrey Wilkinson (Imperial College, London) Nobelpreis 1973 ( Aufklärung der Ferrocenstruktur) Ph 3 P Rh PPh 3 Ph 3 P Cl Hydrierung von Alkenen und Alkinen mit H 2 bei 25 C, 1atm.) Frank Uhlig
39 G. Wilkinson: homogen-katalytische Hydrierung von Olefinen Sir Geoffrey Wilkinson (Imperial College, London) Nobelpreis 1973 ( Aufklärung der Ferrocenstruktur) auch z.b. Isolierung extrem reaktiver Übergangsmetall-Alkyl Komplexe (hohe Oxidatonsstufen) CH 3 H 3 C CH 3 W H 3 C CH 3 CH 3 Frank Uhlig
40 R. Hoffmann: MO-Bindungstheorie Roald Hoffmann (Cornell University) Nobelpreis 1981; Building the bridges between inorganic and organic chemistry bringt v.a. mit Hilfe von EHMO Rechnungen ( Extended Hückel Molecular Orbitals ) die organische, anorganische und metallorganische Chemie unter einen qualitativen Hut von Molekülorbitalbetrachtungen Frank Uhlig
41 R. Hoffmann: MO-Bindungstheorie Roald Hoffmann (Cornell University) z.b. Fragment-Orbitale: M C O oder Isolobalanalogien, usw... Frank Uhlig
42 R.Bergman: C-H Aktivierung von unreaktiven Alkanen Robert G. Bergman (University of California, Berkeley) C-H Aktivierung von Methan (fast gleichzeitig auch W.A.G. Graham) h CH 4 Ir H R 3 P Ir H H -H 2 R 3 P Ir R 3 P H CH 3 auch C-C-Aktivierung, etc... Allgemein Herstellung hochreaktiver Metallzentren, die starke Bindungen knacken knacken können. Frank Uhlig
43 W.A.Herrmann: MTO ein sehr effektiver Oxidationskatalysator Wolfgang A. Herrmann (TU München) z.b. Epoxidierung von Olefinen O MTO / H 2 O 2 sehr vielseitiger Kat.: z.b. Metathese, C-C Bindungsspaltung, etc... Frank Uhlig
44 R. Grubbs: Ruthenium Carbene für ROMP Robert H. Grubbs (California Institute of Technology) ROMP = ring opening metathesis polymerization Cl Cl PCy 3 Ru C PCy 3 R H n viele verschiedene Metathese- Reaktionen mit dem Grubbs Katalysator ; heute: Kat. der 2. Generation, wasserlöslich, etc... Frank Uhlig
45 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Alois Fürstner (Max Planck Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr) Verwendung von Metatheskatalysatoren für die Königsdisziplin der organischen Synthese: Naturstoffsynthese z.b. Ring Closing Metathesis L 3 MoCl Frank Uhlig
46 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Richard Schrock (Massachusetts Institute of Technology) 1975: erster nicht heteroatomstabilisierter Carbenkomplex ( = Allenyliden, Schrock- Carben ) Cl 2 Li Ta Cl - Ta C H grundsätzlich verschiedene Reaktivität zu Fischer-Carbenen Fischer-Carbenen (M=CRX) Frank Uhlig
47 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Maurice S. Brookhart (University of North Carolina a at Chapel Hill) im Grenzgebiet zwischen metallorganischer Chemie und ihrer technologischer Anwendung macht späte Übergangsmetalle für die Ethylenpolymerisation zugänglich O PPh 3 Ni N Ph PE Ph verträgt fkt. Gruppen! neue Polymere siehe Zigeler! die erste Entdeckung war die Dimerisierung von Buten durch Nickelspuren! Frank Uhlig
48 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Robert H. Crabtree (Yale University) viele innovative Forschungsgebiete: z.b. Metallhydride, Donorstabilisierte Carbene ( Arduengocarbene ), schwache Wechselwirkungen (H-H, H H-X,...), u.v.m vm Kombinatorik in der homogenen Katalyse: wie findet man schnell einen optimal massgeschneiderten Katalysator? Frank Uhlig
49 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Malcolm L. Green (Oxford University) sowohl explorative synthetisch metallorganische Chemie, als auch ihre Anwendungen in Katalyse und Materialchemie innovativ: metallorganische und anorganische Chemie in carbon nanotubes ( nano test tubes ) Frank Uhlig
50 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Ryoji Noyori K.Barry Sharpless Nobelpreis 2001; asymmetrische (Nagoya University) Katalyse (Scripps Research Institute) Noyori, Knowles: HYDRIERUNG R 1 R 1 R 2 William S. Knowles (Monsanto, St.Louis) R 4 R 3 R 2 chiraler Kat., H 2 R 4 R 3 * H * H
51 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Ryoji Noyori K.Barry Sharpless Nobelpreis 2001; asymmetrische (Nagoya University) Katalyse (Scripps Research Institute) Sharpless: OXIDATION R 1 R 1 R 4 William S. Knowles (Monsanto, St.Louis) R 4 R 3 R 2 OsO 4, chiraler Lig. 3+ Fe R 4 R 3 * OH * OH
52 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Richard Schrock Robert H. Grubbs Yves Chauvin (Massachusetts Institute of Technology) (California Institute of Technology) (Institut Français du Pétrole Rueil-Malmaison) Nobelpreis 2005: Olefinmetathese
53 AKTUELLE FORSCHUNG einige weitere herausragende Beispiele Richard F. Heck Ei-ichi Negishi Akira Suzuki (Quezon City Philippines ) (Purdue University West Lafayette) (Hokkaido University Sapporo) Nobelpreis 2010: Palladium - katalysierte Kreuzkupplungsreaktion
54 Aktuelle Trends Synthese und Reaktivität von Metall-Element-Mehrfachbindungen (E, E = C, Si, Ge, Sn, Pb); (E = C, Si, Ge, Sn, Pb) C-X-, Si-X-Aktivierung (X = C, H, Hal) (Katalyse) Anwendung von OM-Komplexen in der gezielten organischen Synthese (C-C-Verknüpfungsreaktionen, Isomerisierungen etc.) Synthese und Reaktivität mehrkerniger OM-Komplexe mit Kombinationen aus frühen und späten ÜM (ELM Complexes) OM-Komplexe zur Zersetzung aus der Gasphase (MOCVD) OM-Komplexe mit nichtlinear optischen Eigenschaften (NLO)
55 Christoph Elschenbroich Dirk Steinborn Catherine E. Housecroft Alan G. Sharpe
56 Definition von Metallkomplexen Zentralatom und Liganden M - L Bindung erfolgt über die Wechselwirkung freier Elektronenpaare der Liganden mit vakanten Orbitalen des Zentralatoms = dative Bindung
57 Definition von Organometall-Verbindungen Vorhandensein einer Metall-Kohlenstoff-Bindung M - C Polarität der M-C-Bindung: M C denn: EN(C) > EN(M)
58 Einige Tendenzen für die Reaktivität Metallorganischer Verbindungen: - Die thermische Stabilität als auch die Reaktivität steigen mit steigender M-C Polarität. - Ionische Verbindungen (Alkali, Erdalkali- und La-Verbindungen) können als Carbanionen betrachtet werden (starke Basen) Hydrolyseempfindlich. - Die Elemente der Gruppen 1, 2 und 3 bilden wegen Elektronenmangels Mehrzentrenbindungen aus (Oligomerisierung), je polarer die Verbindungen desto reaktiver. - Verbindungen mit den Elementen der 14., 15. und 16. Gruppe sind wegen geringer MC-Polarität und koordinativer Sättigung meist inert (stabil nicht unbedingt).
59 Klassifizierung nach Bindungstyp, Polarität der M-C-Bindung und Elektronegativität Kovalente Mehrzentrenbindungen ionisch kovalent: m-c- -Bindungen kovalent: m-c- -Bindungen + m-c- -Bindungen selten m-c- -Bindungen
60 Klassifizierung nach Bindungstyp, Polarität der M-C-Bindung und Elektronegativität Grenzen fließend dennoch: Gruppe 1: kovalente Elektronenmangel-Verbindungen (< 8 VE für HG) mit M-CR 3 -M Mehrzentrenbindungen bei kleinen hochgeladenen, stark polarisierenden "Kationen M n+ " hohen Ionenpotentials z.b. [LiMe] 4, [BeMe 2 ] n, [MgPh 2 ] n, [AlMe 3 ] 2, [Ln(AlMe 4 ) 3 ], [CuMe] n etc. Gruppe 2: Verbindungen mit hohem ionischen Anteil; große und stark elektropositive Kationen,stabile Carbanionen mit hoher Gruppenelektronegativität (sp 2, sp); nicht flüchtig, Ionengitter; z.b. Na[C CH], KCp, K + [CPh3].
61 Gruppe 3: kovalente Hauptgruppenorganyle, flüchtig, überwiegend σ-bindungen, Stabilisierung des Elektronenmangels (< 8VE) über Hyperkonjugation hauptsächlich M-C σ-bindungen (GaEt 3, PbEt 4, Ph 3 Sn-C CR, BiMe 5 ) in seltenen Fällen: M-C π-bindungen (z.b. Si=C, P=C, bzw. η n -gebundene -Donor- Liganden, z.b. Cp 2 Sn) Gruppe 4: kovalente Übergangsmetallorganyle, häufig flüchtig, σ- und -Bindungen, Stabilisierung des Elektronenmangels (< 18 VE) über agostische WW mit σ-bindenden El.paaren z.b. in Ti(CH 2 R) 4, durch Adduktbildung mit L oder mit nichtbindenden El.paaren von Cl -, z.b. in R 2 Al-Cl oder Assoziate mit π-elektronenpaaren, z.b. Cu-C CRC CR sowohl M-C σ-bindungen: Alkyl-, Aryl-, Vinyl-, Alkinyl als auch M-C π-bindungen: Carben-, Carbin-, CO-ηη n -gebundene σ, -Donor-Liganden (η 5 -C 5 H 5 ) σ-donor- -Acceptor-Liganden (η 2 -Olefine, η 2 -Alkine, η 2 -Ketone).
62 Definition von Metallkomplexen Zentralatom und Liganden M - L Bindung erfolgt über die Wechselwirkung freier Elektronenpaare der Liganden mit vakanten Orbitalen des Zentralatoms = dative Bindung
63 Klassifizierung nach Bindungstyp, Polarität der M-C-Bindung und Elektronegativität Vorhandensein einer Metall-Kohlenstoff-Bindung M - C Polarität der M-C-Bindung: M C denn: EN(C) > EN(M)
64 Klassifizierung nach Bindungstyp, Polarität der M-C-Bindung und Elektronegativität ti ität Die Polarität der M-C Bindung hängt ab von der Elektronegativitätsdifferenz der Bindungspartner. Aber nicht etwa eines isolierten M- oder C-Atoms, sondern der Baugrupppen [L n M] δ+ bzw. [CR 3 ] δ ("Gruppenelektronegativität") Die Gruppenelektronegativität EN(-C n H m ) einer Kohlenstoff-Baugruppe hängt stark ab: vom Hybridisierungsgrad: i d Da s-elektronen einer stärkeren Kernanziehung unterliegen als p-elektronen, wächst EN(C) mit steigendem s-anteil (gleichzeitig iti Zunahme des ionischen i Bindungsanteils und der CH-Acidität) EN: Csp 3 = Csp 2 = Csp= CH 3 -CH=CH 2 -C CH -C 6 H 5 EN G, ionischer Anteil und s-anteil steigt
65 EN G, ionischer Anteil und s-anteil steigt Die M-C-Bindung in Alkinyl-Komplexen ist polarer (thermodynamisch stabiler) als die in Alkyl-Komplexen von den Substituenten am C-Atom, die eine Partialladung am C-Haftatom induzieren können: EN G (CH 3 ) = 2.31 M-CH 3 reaktiv EN G G( (CF 3 3) = 3.47 M-CF 3 unreaktiv, vgl. M-Cl) ähnlicher Trend: -C 6 H 5 vs -C 6 F 5
66 Die Gruppenelektronegativität EN(-MLnXm) einer Metall-Baugruppe / eines Komplexfragments hängt stark ab von induktiven / mesomeren Effekten der Liganden / Substituenten am M Starke σ-donoren wie Alkylgruppen oder starke π-donoren (mit lone pair) z.b. =NR 2 (Imido) > =O 2 (Oxo) und NR 2 (Amido) > OR (Alkoxo) erhöhen die Elektronendichte am Metallzentrum, reduzieren folglich dessen Fähigkeit, in einer weiteren Bindung mit Kohlenstoff C- Bindungselektronen an das Metall zu binden an elektronenreichen Komplexfragmenten gebunden behält der anionische Ligand (z.b. H 3 C oder H) seine negative Ladung an elektronenarmen Komplexfragmenten gebunden wird das Carbanion hin zu einer unpolaren Bindungssituation it ti bis hin zu H 3 C δ+ (bzw. H δ+ ) polarisiert. i Et 3 Ge-H δ- + (CH 3 ) 2 CO H-C(CH 3 ) 2 -O-GeEt 3 ; Cl 3 Ge-H δ+ + (CH 3 ) 2 CO Cl 3 Ge-C(CH 3 ) 2 -OH
67 Starke π-acceptoren (CO, NO mit leeren π* Orbitalen) vermindern die Elektronendichte am Metallzentrum der anionische Ligand (z.b. H 3 C oder H) wird stark zu einer unpolaren Bindungssituation oder darüber hinaus zu H 3 C δ+ (bzw. H δ+ ) polarisiert. Bsp. Umpolung der Acidität δ+ H-Co(CO) 4 Metall-Protonensäure (acides H) δ H-Co(PMe 3 ) 4 eher hydridisches H von der Oxidationsstufe: je höher die Metall-Oxidationsstufe, desto stärker polarisierend wirkt M auf anionische C-Liganden z.b. EN(Tl + ) , EN(Tl 3+ )204( 2.04 (nach hpauling); 6. Periode: CsR BaR 2 LaR 3 HfR 4 TaR 5 WR 6 - kovalenter Charakter nimmt zu -EN(M n+ ) nimmt zu
68 Stabilität und Reaktivität von Hauptgruppenorganylen - M-C-Bindungen schwächer als M-N, M-O. -Organometallverbindungen g oft thermodynamisch instabil, d.h. Standardbildungsenthalpie G f ist klein oder sogar positiv. Bildungsenthalpie H f (hohe Bindungsenergien) ähnlich. Merke: M-C-Bindungsenergien sind nicht generell gering. Die thermodynamische Stabilität gleicht derjenigen anderer kovalenter Bindungen D(N-N), D(S-S), D(C-N) etc. Faustregel I: D(M-Cl) ist etwa das fache von D(M-C) Faustregel II: Die mittlere Bindungsenergie D(M-C) von Hautgruppenmetall-Organylen (+ Gruppe 12) nimmt innerhalb der Gruppe zu den schwereren Metallen hin ab, bei den Übergangsmetall-Organylen dagegen zu.
69
70 Die Bindung in Übergangsmetallkomplexen Donator/Akzeptor-Synergismus: - -Hinbindung - -Hinbindung
71 - -Rückbindung - -Rückbindung 18-Elektronen-Regel: Die wichtigste Regel, um die Stabilität von metallorganischen Übergangsmetall-Komplexen abzuschätzen; 9 vollbesetzte Orbitale Vergleiche Oktett-Regel für die Hauptgruppenelemente
72 ÜM-d-Elektronen + Bindungselektronen = 18 Valenzelektronen
73 Huheey, Keiter, Keiter, S. 741
74 Riedel (Hrsg.), "Moderne Anorganische Chemie"
75 Klapötke, Tornieporth-Oetting, Nichtmetallchemie
76 Symmetrierassen von s-, p- und d-orbitalen in Abhängigkeit von der Punktgruppe Shriver, Atkins, Langford, Anorganische Chemie
77
78
79
80 insgesamt mit sgesa t t 54 Elektronen besetzt
81 T d MO-Diagramm im Tetraeder
82 Td
83 Td
84 Td
85 D 4h MO-Diagramm für D 4h -Symmetrie
86 D4h
87
88 Ende
89 Kleiner Exkurs zu den Hauptgruppen:
90 Stabilität und Reaktivität von Hauptgruppenorganylen Faustregel III: Alle metallorganischen Verbindungen sind thermodynamisch instabil - in Bezug auf Reaktion mit Sauerstoff MR n + O 2 MO m + CO 2 + H 2 O - H - in Bezug auf Hydrolyse MR n + H 2 O M(OH) n + n RH - H allerdings sind diese Reaktionen häufig kinetisch gehemmt (Ea).
91 Stabilität und Reaktivität von Hauptgruppenorganylen Bei der kinetischen Stabilität gibt es jedoch erhebliche Unterschiede: SnMe 4, Tetramethylstannan ( H f =-19 kj/mol). Bei der Oxidation zu 4 CO 2, 6 H 2 O und SnO werden 3590 kj/mol frei. Trotzdem ist die Verbindung leicht darstellbar, Luftund hydrolysestabil und lange lagerbar. Me 3 In, Trimethylindium, eine endotherme Verbindung mit ( H f = 173 kj/mol) ist pyrophor und hydrolysiert spontan. SnMe 4 : Sn gut abgeschirmt (tetraedr. Koordination), Sn-C-Bindung wenig polar. InMe 3 : In Elektronensextett, stark positiv polarisiert und durch Nukleophile (O 2 oder H 2 O) leicht angreifbar (trig.planare Koordination)
92 Stabilität und Reaktivität von Hauptgruppenorganylen kinetische Stabilität durch - Abgeschlossene Valenzschale ( elektronische Absättigung ) 8 VE bei HG-Organylen: SnMe 4 18 VE bei ÜM-Verbindungen: CpRu(CO) 2 Me - Koordinativ abgeschlossene Ligandenspähre ( koordinative Absättigung ) hohe K.Z. wie in [WMe 8 ] 2-, (bipy)beet 2 -Sterisch anspruchsvolle Liganden Mes 2 Sn=SnMes 2 (Mesityl), Cp* 2 Sn (Cp*=C 5 Me 5 ) -
93 Stabilität und Reaktivität von Hauptgruppenorganylen kinetisch labil: - Nicht abgeschlossene Valenzschale und damit niedrig liegendes Akzeptorniveau nukleophil angreifbar durch Wasser oder radikalisch von 3 O 2 : Al 2 Me 6, TiMe 4, WMe 6 - Abgeschlossene Valenzschale, aber freies Elektronenpaar elektrophil angreifbar durch z.b. H + oder radikalisch von 3 O 2 : SbMe 3 - ß-H-Atom in der Alkylkette und glztg. niedrig liegendes Akzeptororbital am M: ß-H-Eliminierung zum Olefin.
Übergangsmetall-Verbindungen in der Organischen Synthese Prof. Dr. Günter Helmchen
 Übergangsmetall-Verbindungen in der Organischen Synthese Prof. Dr. Günter Helmchen Teil I 1. Einleitung, Übersicht, Literatur 2. -Komplexe 2.1 Einleitung, Übersicht 2.2 -Eliminierung (Mechanismus) 2.3
Übergangsmetall-Verbindungen in der Organischen Synthese Prof. Dr. Günter Helmchen Teil I 1. Einleitung, Übersicht, Literatur 2. -Komplexe 2.1 Einleitung, Übersicht 2.2 -Eliminierung (Mechanismus) 2.3
Übersicht. Wasserstoff-Verbindungen
 Allgemeine Chemie - Teil Anorganische Chemie II: 5. Hauptgruppe Übersicht A. Die Stellung der Elemente der 5. Hauptgruppe im Periodensystem. Stickstoff 2.1. Stickstoff-Wasserstoff Wasserstoff-Verbindungen.1.1.
Allgemeine Chemie - Teil Anorganische Chemie II: 5. Hauptgruppe Übersicht A. Die Stellung der Elemente der 5. Hauptgruppe im Periodensystem. Stickstoff 2.1. Stickstoff-Wasserstoff Wasserstoff-Verbindungen.1.1.
Welches Element / Ion hat die Elektronenkonfiguration 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6. Geben Sie isoelektronische Ionen zu den folgenden Atomen an
 Übung 05.11.13 Welches Element / Ion hat die Elektronenkonfiguration 1s 2 2s 2 2p 6 Ne / F - / O 2- / N 3- / Na + / Mg 2+ / Al 3+. Welches Element / Ion hat die Elektronenkonfiguration 1s 2 2s 2 2p 6 3s
Übung 05.11.13 Welches Element / Ion hat die Elektronenkonfiguration 1s 2 2s 2 2p 6 Ne / F - / O 2- / N 3- / Na + / Mg 2+ / Al 3+. Welches Element / Ion hat die Elektronenkonfiguration 1s 2 2s 2 2p 6 3s
Ziegler Natta Katalysatoren. Dennis Weber
 en Dennis Weber Inhalt Polymerisation Am Beispiel Ethen Ziegler Natta Polymerisation Taktizität Ziegler Natta Katalysator Metallocenkatalysatoren Polymerisation Hochdruckpolymerisation von Ethen seit 1935
en Dennis Weber Inhalt Polymerisation Am Beispiel Ethen Ziegler Natta Polymerisation Taktizität Ziegler Natta Katalysator Metallocenkatalysatoren Polymerisation Hochdruckpolymerisation von Ethen seit 1935
4. Alkene und Alkine : Reaktionen und Darstellung
 Inhalt Index 4. Alkene und Alkine : Reaktionen und Darstellung 4.1. Elektrophile Additionen an Alkene ; Regioselektivität Das Proton einer starken Säure kann sich unter Bildung eines Carbeniumions an eine
Inhalt Index 4. Alkene und Alkine : Reaktionen und Darstellung 4.1. Elektrophile Additionen an Alkene ; Regioselektivität Das Proton einer starken Säure kann sich unter Bildung eines Carbeniumions an eine
4. Alkene und Alkine : Reaktionen und Darstellung
 Dienstag, 22. Oktober 2002 Allgemeine Chemie B II Page: 1 4. Alkene und Alkine : Reaktionen und Darstellung 4.1. Elektrophile Additionen an Alkene ; Regioselektivität Das Proton einer starken Säure kann
Dienstag, 22. Oktober 2002 Allgemeine Chemie B II Page: 1 4. Alkene und Alkine : Reaktionen und Darstellung 4.1. Elektrophile Additionen an Alkene ; Regioselektivität Das Proton einer starken Säure kann
Katalyse. Martin Babilon 14/07/2011. Katalyse. Martin Babilon Universität Paderborn. 14 Juli Montag, 18. Juli 2011
 Katalyse Universität Paderborn 14 Juli 2011 1 Übersicht Motivation & Einleitung Katalyse-Zyklus homogene Katalyse heterogene Katalyse 2 Motivation 3 Geschichte der Katalyse 6000 v. Christus: Alkoholvergärung
Katalyse Universität Paderborn 14 Juli 2011 1 Übersicht Motivation & Einleitung Katalyse-Zyklus homogene Katalyse heterogene Katalyse 2 Motivation 3 Geschichte der Katalyse 6000 v. Christus: Alkoholvergärung
Anorganik II: Fragenkatalog: Teil III
 Anorganik II: Fragenkatalog: Teil III 1) Geben Sie je ein Beispiel für neutrale, anionische, kationische, π- Donor, π-akzeptor, σ-donor, Chelat- und Brückenliganden und den trans-effekt und den trans-einfluss
Anorganik II: Fragenkatalog: Teil III 1) Geben Sie je ein Beispiel für neutrale, anionische, kationische, π- Donor, π-akzeptor, σ-donor, Chelat- und Brückenliganden und den trans-effekt und den trans-einfluss
Chemie für Bauingenieure Uebung 2
 Chemie für Bauingenieure Uebung 2 Aufgabe 1 i. Bestimmen Sie mithilfe des Periodensystems für folgende Elemente die Anzahl Elektronen, Protonen und Neutronen. ii. Bestimmen Sie dann für die jeweiligen
Chemie für Bauingenieure Uebung 2 Aufgabe 1 i. Bestimmen Sie mithilfe des Periodensystems für folgende Elemente die Anzahl Elektronen, Protonen und Neutronen. ii. Bestimmen Sie dann für die jeweiligen
Reaktionstypen der Aliphate
 Einleitung Klasse 8 Reine Kohlenstoffketten, wie Alkane, Alkene und Alkine werden als Aliphate bezeichnet. Bei jeder chemischen Reaktion werden bestehende Verbindungen gebrochen und neue Bindungen erstellt.
Einleitung Klasse 8 Reine Kohlenstoffketten, wie Alkane, Alkene und Alkine werden als Aliphate bezeichnet. Bei jeder chemischen Reaktion werden bestehende Verbindungen gebrochen und neue Bindungen erstellt.
Thema: Chemische Bindungen Wasserstoffbrückenbindungen
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische Bindungen Wasserstoffbrückenbindungen Wasserstoffbrückenbindungen, polare H-X-Bindungen, Wasser, Eigenschaften des Wassers, andere Vbg. mit H-Brücken
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische Bindungen Wasserstoffbrückenbindungen Wasserstoffbrückenbindungen, polare H-X-Bindungen, Wasser, Eigenschaften des Wassers, andere Vbg. mit H-Brücken
Carbenkomplexe. Vortrag von Marcel Lang und Malin Reller. Institut für Anorganische Chemie, Fakulät Chemie- und Biowissenschaften
 Carbenkomplexe Vortrag von Marcel Lang und Malin Reller Institut für Anorganische Chemie, Fakulät Chemie- und Biowissenschaften KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Carbenkomplexe Vortrag von Marcel Lang und Malin Reller Institut für Anorganische Chemie, Fakulät Chemie- und Biowissenschaften KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02
 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der
Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der
Rolle des Katalysators
 olle des Katalysators Aktivierungsenergie der unkatalysierten eaktion Aktivierungsenergie der katalysierten eaktion Energie E a E a ' Edukte nicht katalysierte eaktion eaktion mit Katalysator zu stark
olle des Katalysators Aktivierungsenergie der unkatalysierten eaktion Aktivierungsenergie der katalysierten eaktion Energie E a E a ' Edukte nicht katalysierte eaktion eaktion mit Katalysator zu stark
Metallorganik Teil 2. OFP-Seminar. Marburg, 31.01.06
 Metallorganik Teil 2 FP-Seminar Marburg, 31.01.06 Einleitung Teil 2: Titan, smium, Zirkonium Bor Silizium Mangan, uthenium Palladium Zusammenfassung Wiederholung? 2 Stufen Et NC Wiederholung Cuprat Et
Metallorganik Teil 2 FP-Seminar Marburg, 31.01.06 Einleitung Teil 2: Titan, smium, Zirkonium Bor Silizium Mangan, uthenium Palladium Zusammenfassung Wiederholung? 2 Stufen Et NC Wiederholung Cuprat Et
Organische Chemie für Verfahrensingenieure, Umweltschutztechniker und Werkstoffwissenschaftler
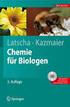 Prof. Dr. J. Christoffers Institut für Organische Chemie Universität Stuttgart 29.04.2003 Organische Chemie für Verfahrensingenieure, Umweltschutztechniker und Werkstoffwissenschaftler 1. Einführung 2.
Prof. Dr. J. Christoffers Institut für Organische Chemie Universität Stuttgart 29.04.2003 Organische Chemie für Verfahrensingenieure, Umweltschutztechniker und Werkstoffwissenschaftler 1. Einführung 2.
Valenz-Bindungstheorie H 2 : s Ueberlappung von Atomorbitalen s-bindung: 2 Elektronen in einem Orbital zylindrischer Symmetrie
 Valenz-Bindungstheorie Beschreibung von Molekülen mit Hilfe von Orbitalen H H H 2 : H 2 s Ueberlappung von Atomorbitalen s-bindung: 2 Elektronen in einem Orbital zylindrischer Symmetrie um die interatomare
Valenz-Bindungstheorie Beschreibung von Molekülen mit Hilfe von Orbitalen H H H 2 : H 2 s Ueberlappung von Atomorbitalen s-bindung: 2 Elektronen in einem Orbital zylindrischer Symmetrie um die interatomare
Koordinationschemie der Übergangsmetalle
 Koordinationschemie der Übergangsmetalle adia C. Mösch-Zanetti Institut für Anorganische Chemie der Universität Göttingen Empfohlene Lehrbücher Anorganische Chemie 5. Aufl. S. 672-704 und Moderne Anorganische
Koordinationschemie der Übergangsmetalle adia C. Mösch-Zanetti Institut für Anorganische Chemie der Universität Göttingen Empfohlene Lehrbücher Anorganische Chemie 5. Aufl. S. 672-704 und Moderne Anorganische
Die elektrophile Addition
 Die elektrophile Addition Roland Heynkes 3.10.2005, Aachen Die elektrophile Addition als typische Reaktion der Doppelbindung in Alkenen bietet einen Einstieg in die Welt der organisch-chemischen Reaktionsmechanismen.
Die elektrophile Addition Roland Heynkes 3.10.2005, Aachen Die elektrophile Addition als typische Reaktion der Doppelbindung in Alkenen bietet einen Einstieg in die Welt der organisch-chemischen Reaktionsmechanismen.
Ionisierungsenergie und Elektronenaffinität. Bindigkeit Valenzstrichformel Molekülgeometrie
 Tendenzen im Periodensystem Ionisierungsenergie und Elektronenaffinität Atombindung (Elektronenpaarbindung) Bindigkeit Valenzstrichformel Molekülgeometrie Räumlicher Bau einfacher Moleküle Polare Atombindung
Tendenzen im Periodensystem Ionisierungsenergie und Elektronenaffinität Atombindung (Elektronenpaarbindung) Bindigkeit Valenzstrichformel Molekülgeometrie Räumlicher Bau einfacher Moleküle Polare Atombindung
Elemente des Periodensystems. Natürliche Häufigkeit der Elemente
 Elemente des Periodensystems Natürliche Häufigkeit der Elemente 1 Der Wasserstoff Vorkommen Eigenschaften Gewinnung Verwendung Verbindungen 2 Vorkommen Interstellare Wasserstoffwolken Orion-Nebel und auf
Elemente des Periodensystems Natürliche Häufigkeit der Elemente 1 Der Wasserstoff Vorkommen Eigenschaften Gewinnung Verwendung Verbindungen 2 Vorkommen Interstellare Wasserstoffwolken Orion-Nebel und auf
Basiswissen Chemie. Vorkurs des MINTroduce-Projekts
 Basiswissen Chemie Vorkurs des MINTroduce-Projekts Christoph Wölper christoph.woelper@uni-due.de Sprechzeiten (Raum: S07 S00 C24 oder S07 S00 D27) Was bisher geschah Redox-Reaktion Oxidation Reduktion
Basiswissen Chemie Vorkurs des MINTroduce-Projekts Christoph Wölper christoph.woelper@uni-due.de Sprechzeiten (Raum: S07 S00 C24 oder S07 S00 D27) Was bisher geschah Redox-Reaktion Oxidation Reduktion
Zeichnen von Valenzstrichformeln
 Zeichnen von Valenzstrichformeln ür anorganische Salze werden keine Valenzstrichformeln gezeichnet, da hier eine ionische Bindung vorliegt. Die Elektronen werden vollständig übertragen und die Ionen bilden
Zeichnen von Valenzstrichformeln ür anorganische Salze werden keine Valenzstrichformeln gezeichnet, da hier eine ionische Bindung vorliegt. Die Elektronen werden vollständig übertragen und die Ionen bilden
Typische Eigenschaften von Metallen
 Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls
Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls
Trennungsgang. AC-I Seminar, B.
 Trennungsgang http://illumina-chemie.de/mangan-chrom-t2100.html www.chemgapedia.de, www.chemische-experimente.com 1 Trennungsgang auf einen Blick Trennungsgang Reaktionen in wässriger Lösung Fällung und
Trennungsgang http://illumina-chemie.de/mangan-chrom-t2100.html www.chemgapedia.de, www.chemische-experimente.com 1 Trennungsgang auf einen Blick Trennungsgang Reaktionen in wässriger Lösung Fällung und
Grundlagen Chemie. Dipl.-Lab. Chem. Stephan Klotz. Freiwill ige Feuerwehr Rosenheim
 Grundlagen Dipl.-Lab. Chem. Stephan Klotz Freiwill ige Feuerwehr Rosenheim Einführung Lernziele Einfache chemische Vorgänge, die Bedeutung für die Feuerwehrpraxis haben, erklären. Chemische Grundlagen
Grundlagen Dipl.-Lab. Chem. Stephan Klotz Freiwill ige Feuerwehr Rosenheim Einführung Lernziele Einfache chemische Vorgänge, die Bedeutung für die Feuerwehrpraxis haben, erklären. Chemische Grundlagen
Reaktionsverhalten und Syntheseprinzipien
 Reaktionsverhalten und Syntheseprinzipien Mit 61 Bildern und 52 Tabellen VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig I nhaltsverzeichnis Verzeichnis der verwendeten Symbole und Abkürzungen 16
Reaktionsverhalten und Syntheseprinzipien Mit 61 Bildern und 52 Tabellen VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig I nhaltsverzeichnis Verzeichnis der verwendeten Symbole und Abkürzungen 16
Mehrkernige Verbindungen
 Mehrkernige Verbindungen Koordinationscluster Strukturen mehrkerniger Metallcarbonlye Übergangsmetallcluster Konzepte zum Verständnis von Clustern 18 Elektonen Regel (für Cluster bis M 4 ). Isolobal Konzept
Mehrkernige Verbindungen Koordinationscluster Strukturen mehrkerniger Metallcarbonlye Übergangsmetallcluster Konzepte zum Verständnis von Clustern 18 Elektonen Regel (für Cluster bis M 4 ). Isolobal Konzept
CHE 172.1: Organische Chemie für die Life Sciences
 1 E 172.1: Organische hemie für die Life Sciences Prof Dr. J. A. Robinson 4. Alkene und Alkine : Reaktionen und erstellung 4.1. Elektrophile Additionen an Alkene ; Regioselektivität Das Proton einer starken
1 E 172.1: Organische hemie für die Life Sciences Prof Dr. J. A. Robinson 4. Alkene und Alkine : Reaktionen und erstellung 4.1. Elektrophile Additionen an Alkene ; Regioselektivität Das Proton einer starken
41. Welches der folgenden Elemente zeigt die geringste Tendenz, Ionen zu bilden?
 41. Welches der folgenden Elemente zeigt die geringste Tendenz, Ionen zu bilden? A) Ca B) C C) F D) Na 42. Steinsalz löst sich in Wasser, A) weil beide Ionen Hydrathüllen bilden können B) es eine Säure
41. Welches der folgenden Elemente zeigt die geringste Tendenz, Ionen zu bilden? A) Ca B) C C) F D) Na 42. Steinsalz löst sich in Wasser, A) weil beide Ionen Hydrathüllen bilden können B) es eine Säure
Oxidation und Reduktion
 Seminar RedoxReaktionen 1 Oxidation und Reduktion Definitionen: Oxidation: Abgabe von Elektronen Die Oxidationszahl des oxidierten Teilchens wird größer. Bsp: Na Na + + e Reduktion: Aufnahme von Elektronen
Seminar RedoxReaktionen 1 Oxidation und Reduktion Definitionen: Oxidation: Abgabe von Elektronen Die Oxidationszahl des oxidierten Teilchens wird größer. Bsp: Na Na + + e Reduktion: Aufnahme von Elektronen
(10 VE, W. Hieber, TUM)
 (d 2 sp 3 ), d z 2 besetzt Beispiel σ ab I I 2. etallcarbonyle, allgemeiner Teil als Komplexligand (10 VE, W. Hieber, TU) analog: N, N, N 2 ; RN (Nitril), RN (Isonitril); P 3 ( = R, l, F, R) π-säuren:
(d 2 sp 3 ), d z 2 besetzt Beispiel σ ab I I 2. etallcarbonyle, allgemeiner Teil als Komplexligand (10 VE, W. Hieber, TU) analog: N, N, N 2 ; RN (Nitril), RN (Isonitril); P 3 ( = R, l, F, R) π-säuren:
Grundlagen der Chemie Polare Bindungen
 Polare Bindungen Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Elektronegativität Unter der Elektronegativität
Polare Bindungen Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Elektronegativität Unter der Elektronegativität
Std. Stoffklassen Konzepte & Methoden Reaktionen 2 Struktur und Bindung 2 Alkane Radikale Radikal-Reaktionen 2 Cycloalkane Konfiguration &
 Materialien (Version: 26.06.2001) Diese Materialien dienen zur Überprüfung des Wissens und sind keine detailierten Lernunterlagen. Vorschlag: fragen Sie sich gegenseitig entsprechend dieser Listen ab.
Materialien (Version: 26.06.2001) Diese Materialien dienen zur Überprüfung des Wissens und sind keine detailierten Lernunterlagen. Vorschlag: fragen Sie sich gegenseitig entsprechend dieser Listen ab.
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde:
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Periodensystem, Anordnung der Elemente nach steigender Ordnungszahl, Hauptgruppen, Nebengruppen, Lanthanoide + Actinoide, Perioden, Döbereiner, Meyer, Medelejew
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Periodensystem, Anordnung der Elemente nach steigender Ordnungszahl, Hauptgruppen, Nebengruppen, Lanthanoide + Actinoide, Perioden, Döbereiner, Meyer, Medelejew
Gegeben sind die folgenden Werte kovalenter Bindungsenthalpien:
 Literatur: Housecroft Chemistry, Kap. 22.1011 1. Vervollständigen Sie folgende, stöchiometrisch nicht ausgeglichene Reaktions gleichungen von Sauerstoffverbindungen. Die korrekten stöchiometrischen Faktoren
Literatur: Housecroft Chemistry, Kap. 22.1011 1. Vervollständigen Sie folgende, stöchiometrisch nicht ausgeglichene Reaktions gleichungen von Sauerstoffverbindungen. Die korrekten stöchiometrischen Faktoren
Grundtypen der Bindung. Grundtypen chemischer Bindung. Oktettregel. A.8.1. Atombindung
 Grundtypen der Bindung Grundtypen chemischer Bindung Oktettregel A.8.1. Atombindung 1 A.8.1 Atombindung Valenz (Zahl der Bindungen) Atombindung auch: kovalente Bindung, ElektronenpaarBindung Zwei Atome
Grundtypen der Bindung Grundtypen chemischer Bindung Oktettregel A.8.1. Atombindung 1 A.8.1 Atombindung Valenz (Zahl der Bindungen) Atombindung auch: kovalente Bindung, ElektronenpaarBindung Zwei Atome
Vorprüfung in Chemie für Studierende des Maschinenbaus und des Gewerbelehramts Studiengang Bachelor
 Grundlagen der Chemie für Studierende des Maschinenbaus, Prof. Deutschmann Vorprüfung in Chemie für Studierende des Maschinenbaus und des Gewerbelehramts Studiengang Bachelor Freitag, 20. März 2009, 14:00-17:00
Grundlagen der Chemie für Studierende des Maschinenbaus, Prof. Deutschmann Vorprüfung in Chemie für Studierende des Maschinenbaus und des Gewerbelehramts Studiengang Bachelor Freitag, 20. März 2009, 14:00-17:00
O H H 3 C. Methanol. Molekulargewicht Siedepunkt Löslichkeit in Wasser H 3 C-OH. unbegrenzt H 3 C-Cl. 7.4 g/l H 3 C-CH 3 -24/C -88/C
 Struktur und Eigenschaften 3 C 3 C C 3 105 109 112 Wasser Methanol Dimethylether Vektoraddition der einzelnen Dipolmomente eines Moleküls zum Gesamtdipolmoment Anmerkung zu aktuellen Ereignissen: itrofen
Struktur und Eigenschaften 3 C 3 C C 3 105 109 112 Wasser Methanol Dimethylether Vektoraddition der einzelnen Dipolmomente eines Moleküls zum Gesamtdipolmoment Anmerkung zu aktuellen Ereignissen: itrofen
Seminar zum Methodenkurs Christian Graßl
 Seminar zum Methodenkurs Christian Graßl Neue Typen von Wasserstoffbrückenbindungen in der Organometallchemie (Coord. Chem. Rev. 231 (2002) 165) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/wasserstoffbr%c3%bcckenbindungen_des_wasser.png
Seminar zum Methodenkurs Christian Graßl Neue Typen von Wasserstoffbrückenbindungen in der Organometallchemie (Coord. Chem. Rev. 231 (2002) 165) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/wasserstoffbr%c3%bcckenbindungen_des_wasser.png
Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.)
 Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.) Gliederung Grundlagen der physikalisch-organischen Chemie Radikalreaktionen Nukleophile und elektrophile Substitution am gesättigten C-Atom
Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.) Gliederung Grundlagen der physikalisch-organischen Chemie Radikalreaktionen Nukleophile und elektrophile Substitution am gesättigten C-Atom
Kapitel 5: Additionen an C-C- Mehrfachbindungen
 Kapitel 5: Additionen an C-C- hrfachbindungen» Theorie, Konzepte, chanismus - MO Theorie: elektrophile Addition (Brom/Olefin) und [2+4]- Cycloaddition (Diels-Alder-Reaktion) - Bromierung der Doppelbindung:
Kapitel 5: Additionen an C-C- hrfachbindungen» Theorie, Konzepte, chanismus - MO Theorie: elektrophile Addition (Brom/Olefin) und [2+4]- Cycloaddition (Diels-Alder-Reaktion) - Bromierung der Doppelbindung:
Enthalpie, Entropie und Temperatur des Phasenübergangs flüssig-gasförmig. eine Analyse von Elementen und chemischen Verbindungen
 Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.v. Enthalpie, Entropie und Temperatur des Phasenübergangs flüssiggasförmig eine Analyse von Elementen und chemischen Verbindungen Harald Mehling Berater
Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.v. Enthalpie, Entropie und Temperatur des Phasenübergangs flüssiggasförmig eine Analyse von Elementen und chemischen Verbindungen Harald Mehling Berater
Chemie für Biologen. Vorlesung im. WS 2004/05 V2, Mi 10-12, S04 T01 A02. Paul Rademacher Institut für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen
 Chemie für Biologen Vorlesung im WS 200/05 V2, Mi 10-12, S0 T01 A02 Paul Rademacher Institut für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil : 03.11.200) MILESS: Chemie für Biologen 66 Chemische
Chemie für Biologen Vorlesung im WS 200/05 V2, Mi 10-12, S0 T01 A02 Paul Rademacher Institut für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil : 03.11.200) MILESS: Chemie für Biologen 66 Chemische
2. Chemische Bindungen 2.1
 2. Chemische Bindungen 2.1 Chemische Bindungen Deutung von Mischungsversuchen Benzin und Wasser mischen sich nicht. Benzin ist somit eine hydrophobe Flüssigkeit. Auch die Siedepunkte der beiden Substanzen
2. Chemische Bindungen 2.1 Chemische Bindungen Deutung von Mischungsversuchen Benzin und Wasser mischen sich nicht. Benzin ist somit eine hydrophobe Flüssigkeit. Auch die Siedepunkte der beiden Substanzen
OC07 Seminar WS15/16
 OC07 Seminar WS15/16 Chemie Frustrierter Lewis-Paare Bastian Oberhausen und Stephan Muth Betreuer: Lukas Junk D. W. Stephan und G. Erker, Angew. Chem. 2015, 127, 6498 6541. D. W. Stephan und G. Erker,
OC07 Seminar WS15/16 Chemie Frustrierter Lewis-Paare Bastian Oberhausen und Stephan Muth Betreuer: Lukas Junk D. W. Stephan und G. Erker, Angew. Chem. 2015, 127, 6498 6541. D. W. Stephan und G. Erker,
Periodensystem. Physik und Chemie. Sprachkompendium und einfache Regeln
 Periodensystem Physik und Chemie Sprachkompendium und einfache Regeln 1 Begriffe Das (neutrale) Wasserstoffatom kann völlig durchgerechnet werden. Alle anderen Atome nicht; ein dermaßen komplexes System
Periodensystem Physik und Chemie Sprachkompendium und einfache Regeln 1 Begriffe Das (neutrale) Wasserstoffatom kann völlig durchgerechnet werden. Alle anderen Atome nicht; ein dermaßen komplexes System
Basiswissen Chemie. Vorkurs des MINTroduce-Projekts
 Basiswissen Chemie Vorkurs des MINTroduce-Projekts Christoph Wölper christoph.woelper@uni-due.de Sprechzeiten (Raum: S07 S00 C24 oder S07 S00 D27) Organisatorisches Kurs-Skript http://www.uni-due.de/ adb297b
Basiswissen Chemie Vorkurs des MINTroduce-Projekts Christoph Wölper christoph.woelper@uni-due.de Sprechzeiten (Raum: S07 S00 C24 oder S07 S00 D27) Organisatorisches Kurs-Skript http://www.uni-due.de/ adb297b
Chemische Bindung. Ionenbindung (heteropolare Bindung) kovalente Bindung van-der-waals-bindung Metallbindung
 Chemische Bindung Ionenbindung (heteropolare Bindung) kovalente Bindung van-der-waals-bindung Metallbindung 1 Was sind Ionen? Ein Ion besteht aus einem oder mehreren Atomen und hat elektrische Ladung Kationen
Chemische Bindung Ionenbindung (heteropolare Bindung) kovalente Bindung van-der-waals-bindung Metallbindung 1 Was sind Ionen? Ein Ion besteht aus einem oder mehreren Atomen und hat elektrische Ladung Kationen
08.12.2013. Wichtige Stoffgruppen. Stoffgruppe. Atomverband. Metallische Stoffe (Gitter) - Metalle - Legierungen (- Cluster) Metall Metall:
 1 Wichtige Stoffgruppen Atomverband Metall Metall: Metall Nichtmetall: Stoffgruppe Metallische Stoffe (Gitter) - Metalle - Legierungen (- Cluster) Salzartige Stoffe (Gitter) - Salze Nichtmetall Nichtmetall:
1 Wichtige Stoffgruppen Atomverband Metall Metall: Metall Nichtmetall: Stoffgruppe Metallische Stoffe (Gitter) - Metalle - Legierungen (- Cluster) Salzartige Stoffe (Gitter) - Salze Nichtmetall Nichtmetall:
Basiskenntnistest - Chemie
 Basiskenntnistest - Chemie 1.) Welche Aussage trifft auf Alkohole zu? a. ) Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe. b. ) Alle Alkohole sind ungiftig. c. ) Mehrwertige Alkohole werden
Basiskenntnistest - Chemie 1.) Welche Aussage trifft auf Alkohole zu? a. ) Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe. b. ) Alle Alkohole sind ungiftig. c. ) Mehrwertige Alkohole werden
1.) Organometallverbindungen sind wichtige Reagenzien für C C-Bindungsbildungen. Der am Metall gebundene Kohlenstoff ist nukleophil (10 Punkte).
 Lösung zur Übung 7 1.) rganometallverbindungen sind wichtige Reagenzien für C C-Bindungsbildungen. Der am Metall gebundene Kohlenstoff ist nukleophil (10 Punkte). a) para-bromtoluol A wird mit n-butyllithium
Lösung zur Übung 7 1.) rganometallverbindungen sind wichtige Reagenzien für C C-Bindungsbildungen. Der am Metall gebundene Kohlenstoff ist nukleophil (10 Punkte). a) para-bromtoluol A wird mit n-butyllithium
1) Welche Aussagen über die Hauptgruppenelemente im Periodensystem sind richtig?
 1) Welche Aussagen über die Hauptgruppenelemente im Periodensystem sind richtig? 1) Es sind alles Metalle. 2) In der äußeren Elektronenschale werden s- bzw. s- und p-orbitale aufgefüllt. 3) Sie stimmen
1) Welche Aussagen über die Hauptgruppenelemente im Periodensystem sind richtig? 1) Es sind alles Metalle. 2) In der äußeren Elektronenschale werden s- bzw. s- und p-orbitale aufgefüllt. 3) Sie stimmen
Periodensystem der Elemente - PSE
 Periodensystem der Elemente - PSE Historische Entwicklung Möglichkeiten der Reindarstellung seit 18. Jhdt. wissenschaftliche Beschreibung der Elemente 1817 Johann Wolfgang Döbereiner: ähnliche Elemente
Periodensystem der Elemente - PSE Historische Entwicklung Möglichkeiten der Reindarstellung seit 18. Jhdt. wissenschaftliche Beschreibung der Elemente 1817 Johann Wolfgang Döbereiner: ähnliche Elemente
Moderne Aldol-Reaktionen
 Moderne Aldol-Reaktionen Katrina Brendle Institut für Organische Chemie Seminar zum Fortgeschrittenenpraktium KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Großforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft
Moderne Aldol-Reaktionen Katrina Brendle Institut für Organische Chemie Seminar zum Fortgeschrittenenpraktium KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Großforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft
4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator
 4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator Neben der thermodynamischen Lage des chemischen Gleichgewichts ist der zeitliche Ablauf der Reaktion, also die Geschwindigkeit der Einstellung des Gleichgewichts,
4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator Neben der thermodynamischen Lage des chemischen Gleichgewichts ist der zeitliche Ablauf der Reaktion, also die Geschwindigkeit der Einstellung des Gleichgewichts,
Chemische Bindung, Molekülbau, Stöchiometrie
 Seminar zum Brückenkurs Chemie 2016 Chemische Bindung, Molekülbau, Stöchiometrie Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 20.09.2016 Zeichnen von Valenzstrichformeln 1. Zeichnen Sie die Strukturformeln der folgenden
Seminar zum Brückenkurs Chemie 2016 Chemische Bindung, Molekülbau, Stöchiometrie Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 20.09.2016 Zeichnen von Valenzstrichformeln 1. Zeichnen Sie die Strukturformeln der folgenden
3 Gestreckte Abschlussprüfung, Teil 1 Allgemeine und Präparative Chemie
 43 3 Gestreckte Abschlussprüfung, Teil 1 Allgemeine und Präparative Chemie 3.1 Atombau, chemische Bindung, Periodensystem der Elemente 3.1.1 Elektronegativität und Beurteilung der Polarität Zur Beurteilung
43 3 Gestreckte Abschlussprüfung, Teil 1 Allgemeine und Präparative Chemie 3.1 Atombau, chemische Bindung, Periodensystem der Elemente 3.1.1 Elektronegativität und Beurteilung der Polarität Zur Beurteilung
CHEMIE KAPITEL 1 AUFBAU DER MATERIE. Timm Wilke. Georg-August-Universität Göttingen. Wintersemester 2014 / 2015
 CHEMIE KAPITEL 1 AUFBAU DER MATERIE Timm Wilke Georg-August-Universität Göttingen Wintersemester 2014 / 2015 Folie 2 Valenzelektronen und Atomeigenschaften Valenzelektronen (Außenelektronen) bestimmen
CHEMIE KAPITEL 1 AUFBAU DER MATERIE Timm Wilke Georg-August-Universität Göttingen Wintersemester 2014 / 2015 Folie 2 Valenzelektronen und Atomeigenschaften Valenzelektronen (Außenelektronen) bestimmen
Atombau, Periodensystem der Elemente
 Seminar zum Brückenkurs Chemie 2015 Atombau, Periodensystem der Elemente Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 21.09.2015 1. Aufbau des Atomkerns und radioaktiver Zerfall - Erläutern Sie den Aufbau der Atomkerne
Seminar zum Brückenkurs Chemie 2015 Atombau, Periodensystem der Elemente Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 21.09.2015 1. Aufbau des Atomkerns und radioaktiver Zerfall - Erläutern Sie den Aufbau der Atomkerne
1. Struktur und Bindung organischer Moleküle (Siehe Kapitel 6. in Allgemeine Chemie B, I. Teil)
 Tuesday, January 30, 2001 Allgemeine Chemie B II. Kapitel 1 Page: 1 Inhalt Index 1. Struktur und Bindung organischer Moleküle (Siehe Kapitel 6. in Allgemeine Chemie B, I. Teil) 1.1 Atomstruktur Die Ordnungszahl
Tuesday, January 30, 2001 Allgemeine Chemie B II. Kapitel 1 Page: 1 Inhalt Index 1. Struktur und Bindung organischer Moleküle (Siehe Kapitel 6. in Allgemeine Chemie B, I. Teil) 1.1 Atomstruktur Die Ordnungszahl
n Pentan 2- Methylbutan 2,2, dimethylpropan ( Wasserstoffatome sind nicht berücksichtigt )
 Grundwissen : 10 Klasse G8 Kohlenwasserstoffe Alkane Einfachbindung (σ -Bindung, kovalente Bindung ) : Zwischen Kohlenstoffatomen überlappen halbbesetzte p- Orbitale oder zwischen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen
Grundwissen : 10 Klasse G8 Kohlenwasserstoffe Alkane Einfachbindung (σ -Bindung, kovalente Bindung ) : Zwischen Kohlenstoffatomen überlappen halbbesetzte p- Orbitale oder zwischen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen
Fortschritte bei der Synthese anorganischer Nanoröhren und Fulleren-artiger Nanopartikel
 Fortschritte bei der Synthese anorganischer Nanoröhren und Fulleren-artiger Nanopartikel Seminarvortrag zum anorganischen Kolloquium im WS 2006/2007 Quelle: Reshef Tenne, Angew. Chem., 2003, 115, 5280-5289
Fortschritte bei der Synthese anorganischer Nanoröhren und Fulleren-artiger Nanopartikel Seminarvortrag zum anorganischen Kolloquium im WS 2006/2007 Quelle: Reshef Tenne, Angew. Chem., 2003, 115, 5280-5289
a.) Wie groß ist die Reaktionsenthalpie für die Diamantbildung aus Graphit? b.) Welche Kohlenstoffform ist unter Standardbedingungen die stabilere?
 Chemie Prüfungsvorbereitung 1. Aufgabe Folgende Reaktionen sind mit ihrer Enthalpie vorgegeben C (Graphit) + O 2 CO 2 R = 393,43 KJ C (Diamant) + O 2 CO 2 R = 395,33 KJ CO 2 O 2 + C (Diamant) R = +395,33
Chemie Prüfungsvorbereitung 1. Aufgabe Folgende Reaktionen sind mit ihrer Enthalpie vorgegeben C (Graphit) + O 2 CO 2 R = 393,43 KJ C (Diamant) + O 2 CO 2 R = 395,33 KJ CO 2 O 2 + C (Diamant) R = +395,33
Aluminium. Eisen. Gold. Lithium. Platin. Neodym
 Fe Eisen Al Aluminium Li Lithium Au Gold Pt Platin Nd Neodym Zn Zink Sn Zinn Ni Nickel Cr Chrom Mo Molybdän V Vanadium Co Cobalt In Indium Ta Tantal Mg Magnesium Ti Titan Os Osmium Pb Blei Ag Silber
Fe Eisen Al Aluminium Li Lithium Au Gold Pt Platin Nd Neodym Zn Zink Sn Zinn Ni Nickel Cr Chrom Mo Molybdän V Vanadium Co Cobalt In Indium Ta Tantal Mg Magnesium Ti Titan Os Osmium Pb Blei Ag Silber
Lösung Sauerstoff: 1s 2 2s 2 2p 4, Bor: 1s 2 2s 2 2p 1, Chlor: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Neon: 1s 2 2s 2 2p 6
 1 of 6 10.05.2005 10:56 Lösung 1 1.1 1 mol Natrium wiegt 23 g => 3 mol Natrium wiegen 69 g. 1 mol Na enthält N A = 6.02 x 10 23 Teilchen => 3 mol enthalten 1.806 x 10 24 Teilchen. 1.2 Ein halbes mol Wasser
1 of 6 10.05.2005 10:56 Lösung 1 1.1 1 mol Natrium wiegt 23 g => 3 mol Natrium wiegen 69 g. 1 mol Na enthält N A = 6.02 x 10 23 Teilchen => 3 mol enthalten 1.806 x 10 24 Teilchen. 1.2 Ein halbes mol Wasser
Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen Blatt 1/5
 Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen Blatt 1/5 1 Elektronenübertragung, Oxidation und Reduktion Gibt Natrium sein einziges Außenelektron an ein Chloratom (7 Außenelektronen) ab, so entsteht durch diese
Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen Blatt 1/5 1 Elektronenübertragung, Oxidation und Reduktion Gibt Natrium sein einziges Außenelektron an ein Chloratom (7 Außenelektronen) ab, so entsteht durch diese
n = V Lsg m n l mol Grundwissen 9. Klasse Chemie (NTG) Analytische Chemie Stoffmenge n Molare Masse M Molares Volumen V M Stoffmengenkonzentration c
 Grundwissen 9. Klasse Chemie (NTG) 1. Analytische Chemie und Stöchiometrie Analytische Chemie Untersuchung von Reinstoffen und Stoffgemischen mit dem Ziel diese eindeutig zu identifizieren (= qualitativer
Grundwissen 9. Klasse Chemie (NTG) 1. Analytische Chemie und Stöchiometrie Analytische Chemie Untersuchung von Reinstoffen und Stoffgemischen mit dem Ziel diese eindeutig zu identifizieren (= qualitativer
Wasserstoff. Helium. Bor. Kohlenstoff. Standort: Name: Ordnungszahl: Standort: Name: Ordnungszahl: 18. Gruppe. Standort: Ordnungszahl: Name:
 H Wasserstoff 1 1. Gruppe 1. Periode He Helium 2 18. Gruppe 1. Periode B Bor 5 13. Gruppe C Kohlenstoff 6 14. Gruppe N Stickstoff 7 15. Gruppe O Sauerstoff 8 16. Gruppe Ne Neon 10 18. Gruppe Na Natrium
H Wasserstoff 1 1. Gruppe 1. Periode He Helium 2 18. Gruppe 1. Periode B Bor 5 13. Gruppe C Kohlenstoff 6 14. Gruppe N Stickstoff 7 15. Gruppe O Sauerstoff 8 16. Gruppe Ne Neon 10 18. Gruppe Na Natrium
Einführungskurs 7. Seminar
 ABERT-UDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG Einführungskurs 7. Seminar Prof. Dr. Christoph Janiak iteratur: Riedel, Anorganische Chemie,. Aufl., 00 Kapitel.8.0 und Jander,Blasius, ehrb. d. analyt. u. präp. anorg.
ABERT-UDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG Einführungskurs 7. Seminar Prof. Dr. Christoph Janiak iteratur: Riedel, Anorganische Chemie,. Aufl., 00 Kapitel.8.0 und Jander,Blasius, ehrb. d. analyt. u. präp. anorg.
Zu welchem Trennprinzip zählt die Ausfällung des Katalysators?
 Zu welchem Trennprinzip zählt die Ausfällung des Katalysators? Flüssig-Flüssig-Recycle 20,0% Thermische Abtrennung 6,7% Filtrative Abtrennung 6,7% Heterogenisierung 66,7% Welche Katalysatorzersetzungreaktions
Zu welchem Trennprinzip zählt die Ausfällung des Katalysators? Flüssig-Flüssig-Recycle 20,0% Thermische Abtrennung 6,7% Filtrative Abtrennung 6,7% Heterogenisierung 66,7% Welche Katalysatorzersetzungreaktions
Übung zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach Übung Nr. 4, 09./
 Übung zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach Übung Nr. 4, 09./10.05.11 Nucleophile Substitution 1. Beschreiben Sie den Reaktionsmechanismus von a) S N 1 X = beliebige Abgangsgruppe
Übung zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach Übung Nr. 4, 09./10.05.11 Nucleophile Substitution 1. Beschreiben Sie den Reaktionsmechanismus von a) S N 1 X = beliebige Abgangsgruppe
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II Lösungsvorschlag zu Blatt 5
 Wintersemester 006 / 007 04.1.006 1. Aufgabe Die Wellenfunktionen unterscheiden sich gar nicht. Während der Lösung der elektronischen Schrödingergleichung werden die Kerne als ruhend betrachtet. Es kommt
Wintersemester 006 / 007 04.1.006 1. Aufgabe Die Wellenfunktionen unterscheiden sich gar nicht. Während der Lösung der elektronischen Schrödingergleichung werden die Kerne als ruhend betrachtet. Es kommt
Die 3 Stoffklassen der Elemente
 Die Art der Bindung hängt davon ab, wie stark die Atome ihre Valenzelektronen anziehen. Elektronegativität (Abb. 17, S. 114) Qualitative Angabe, wie stark die Atomrümpfe die Elektronen in der Valenzschale
Die Art der Bindung hängt davon ab, wie stark die Atome ihre Valenzelektronen anziehen. Elektronegativität (Abb. 17, S. 114) Qualitative Angabe, wie stark die Atomrümpfe die Elektronen in der Valenzschale
REAKTIONEN DER ORGANISCHEN CHEMIE
 REAKTIONEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 1) ÜBERSICHT VON DEN REAKTIONEN AUSGEHEND: Die Reaktion der OC lassen sich auf 4 Grundtypen zurückführen: Grundtyp Addition Substitution Eliminierung Umlagerung allg A
REAKTIONEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 1) ÜBERSICHT VON DEN REAKTIONEN AUSGEHEND: Die Reaktion der OC lassen sich auf 4 Grundtypen zurückführen: Grundtyp Addition Substitution Eliminierung Umlagerung allg A
Stoffeigenschaften und Teilchenmodell
 Stoffeigenschaften und Teilchenmodell Teilchenmodell (1) Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen. (2) Zwischen den Teilchen wirken Anziehungskräfte. (3) Alle Teilchen befinden sich in ständiger, regelloser
Stoffeigenschaften und Teilchenmodell Teilchenmodell (1) Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen. (2) Zwischen den Teilchen wirken Anziehungskräfte. (3) Alle Teilchen befinden sich in ständiger, regelloser
Musterklausur 1 zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie
 Musterklausur 1 zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie Achtung: Taschenrechner ist nicht zugelassen. Aufgaben sind so, dass sie ohne Rechner lösbar sind. Weitere Hilfsmittel: Periodensystem der Elemente
Musterklausur 1 zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie Achtung: Taschenrechner ist nicht zugelassen. Aufgaben sind so, dass sie ohne Rechner lösbar sind. Weitere Hilfsmittel: Periodensystem der Elemente
Stoffeigenschaften und Teilchenmodell
 Stoffeigenschaften und Teilchenmodell Teilchenmodell (1) Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen. (2) Zwischen den Teilchen wirken Anziehungskräfte. (3) Alle Teilchen befinden sich in ständiger, regelloser
Stoffeigenschaften und Teilchenmodell Teilchenmodell (1) Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen. (2) Zwischen den Teilchen wirken Anziehungskräfte. (3) Alle Teilchen befinden sich in ständiger, regelloser
ORGANISCHE CHEMIE 1. Stoff der 21. Vorlesung: Reaktionen... I. Reaktionen der Carbonylgruppe I. mit C-Nukleophilen Grignard Organolithium Wittig
 Stoff der 21. Vorlesung: eaktionen... GANISCE CEMIE 1 21. Vorlesung, Freitag, 05. Juli 2013 I. eaktionen der Carbonylgruppe I. mit C-Nukleophilen Grignard rganolithium Wittig arald Schwalbe Institut für
Stoff der 21. Vorlesung: eaktionen... GANISCE CEMIE 1 21. Vorlesung, Freitag, 05. Juli 2013 I. eaktionen der Carbonylgruppe I. mit C-Nukleophilen Grignard rganolithium Wittig arald Schwalbe Institut für
Wasserstoffbrückenbindung, H 2 O, NH 3, HF, Wasserstoff im PSE, Isotope, Vorkommen, exotherme Reaktion mit Sauerstoff zu Wasser, Energieinhalt,
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Das Element Wasserstoff und seine Verbindungen Wasserstoffbrückenbindung, H 2 O, NH 3, HF, Wasserstoff im PSE, Isotope, Vorkommen, exotherme Reaktion mit Sauerstoff
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Das Element Wasserstoff und seine Verbindungen Wasserstoffbrückenbindung, H 2 O, NH 3, HF, Wasserstoff im PSE, Isotope, Vorkommen, exotherme Reaktion mit Sauerstoff
Bindungskonzepte in der. Organischen Chemie. 1.1 Hybridisierung
 O:/Wiley/Organische_Chemie_Aufl_1/3d/c01.3d from 19.07.2012 09:18:28 1 Bindungskonzepte in der 1 Organischen Chemie In diesem Kapitel Die Organische Chemie wird gemeinhin als die Chemie der Kohlenstoffverbindungen
O:/Wiley/Organische_Chemie_Aufl_1/3d/c01.3d from 19.07.2012 09:18:28 1 Bindungskonzepte in der 1 Organischen Chemie In diesem Kapitel Die Organische Chemie wird gemeinhin als die Chemie der Kohlenstoffverbindungen
1. Stoffe und Eigenschaften
 1. Stoffe und Eigenschaften Chemischer Vorgang Stoffänderung, keine Zustandsänderung Physikalischer Vorgang Lösung Zustandsänderung, keine Stoffänderung (z.b. Lösen, Aggregatzustände,...) Homogenes Gemisch
1. Stoffe und Eigenschaften Chemischer Vorgang Stoffänderung, keine Zustandsänderung Physikalischer Vorgang Lösung Zustandsänderung, keine Stoffänderung (z.b. Lösen, Aggregatzustände,...) Homogenes Gemisch
Syntheseprinzipien. 4., unveränderte Auflage. Autoren. Egon Uhlig, Jena (federführender Autor) Mit 80 Bildern und 49 Tabellen
 Lehrbuch 7 Reaktionsverhalten und Syntheseprinzipien Autoren Egon Uhlig, Jena (federführender Autor) 4., unveränderte Auflage Mit 80 Bildern und 49 Tabellen Günter Domschke, Dresden Siegfried Engels, Merseburg
Lehrbuch 7 Reaktionsverhalten und Syntheseprinzipien Autoren Egon Uhlig, Jena (federführender Autor) 4., unveränderte Auflage Mit 80 Bildern und 49 Tabellen Günter Domschke, Dresden Siegfried Engels, Merseburg
CHE 172.1: Organische Chemie für die Life Sciences
 1 CHE 172.1: Organische Chemie für die Life Sciences Prof Dr. J. A. Robinson 1. Struktur und Bindung organischer Moleküle 1.1 Atomstruktur : Die Ordnungszahl (oder Atomzahl /Atomnummer = Atomic number)
1 CHE 172.1: Organische Chemie für die Life Sciences Prof Dr. J. A. Robinson 1. Struktur und Bindung organischer Moleküle 1.1 Atomstruktur : Die Ordnungszahl (oder Atomzahl /Atomnummer = Atomic number)
Kapitel 8 MO-Verbindungen der Übergangsmetalle - Bindungsverhältnisse und Strukturen
 Kapitel 8 MO-Verbindungen der Übergangsmetalle - Bindungsverhältnisse und Strukturen 8.1 Vergleich Hauptgruppen-Nebengruppen Hauptgruppen (p-block) Bindigkeit: entsprechend der 8-n-Regel (Ausnahme: hypervalente
Kapitel 8 MO-Verbindungen der Übergangsmetalle - Bindungsverhältnisse und Strukturen 8.1 Vergleich Hauptgruppen-Nebengruppen Hauptgruppen (p-block) Bindigkeit: entsprechend der 8-n-Regel (Ausnahme: hypervalente
5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5.
 5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5. Atomradien 5.6. Atomvolumina 5.7. Dichte der Elemente 5.8. Schmelzpunkte
5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5. Atomradien 5.6. Atomvolumina 5.7. Dichte der Elemente 5.8. Schmelzpunkte
Inhaltsverzeichnis. 3 Gesättigte Kohlenwasserstoffe (Alkane) 3.1 Offenkettige Alkane 3.2 Cyclische Alkane
 Inhaltsverzeichnis 1 Chemische Bindung in organischen Verbindungen 1.1 Einleitung 1.2 Grundlagen der chemischen Bindung 1.3 Die Atombindung (kovalente oder homöopolare Bindung) 1.4 Bindungslängen und Bindungsenergien
Inhaltsverzeichnis 1 Chemische Bindung in organischen Verbindungen 1.1 Einleitung 1.2 Grundlagen der chemischen Bindung 1.3 Die Atombindung (kovalente oder homöopolare Bindung) 1.4 Bindungslängen und Bindungsenergien
Anorganische Chemie 1 Version 1.5b Thema:
 Lösliche Gruppe: NH 4 +, Na +, Mg 2+, K + (Quelle: Qualitative Anorganische Analyse, Eberhard Gerdes) Anorganische Chemie 1 Version 1.5b Thema: 1. Säurestärke Allgemein gesprochen existieren Neutralsäuren,
Lösliche Gruppe: NH 4 +, Na +, Mg 2+, K + (Quelle: Qualitative Anorganische Analyse, Eberhard Gerdes) Anorganische Chemie 1 Version 1.5b Thema: 1. Säurestärke Allgemein gesprochen existieren Neutralsäuren,
Chemische Bindungsanalyse in Festkörpern
 Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Chemie und Lebensmittel Chemie Professur AC2 Dr. Alexey I. Baranov Chemische Bindungsanalyse in Festkörpern Sommersemester 2015 Bindung in Orbitaldarstellung:
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Chemie und Lebensmittel Chemie Professur AC2 Dr. Alexey I. Baranov Chemische Bindungsanalyse in Festkörpern Sommersemester 2015 Bindung in Orbitaldarstellung:
Kohlenwasserstoffe. Alkane. Kohlenwasserstoffe sind brennbare und unpolare Verbindungen, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind.
 2 2 Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe sind brennbare und unpolare Verbindungen, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind. 4 4 Alkane Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffverbindungen
2 2 Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe sind brennbare und unpolare Verbindungen, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind. 4 4 Alkane Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffverbindungen
Chemische Bindung. Kovalente Bindung (Atombindung) Ionenbindung Metallischer Zustand. Zwischenmolekulare Kräfte:
 Chemische Bindung Chemische Bindung Kovalente Bindung (Atomindung) Ionenindung Metallischer Zustand Zwischenmolekulare Kräfte: o H-Brücken o Van-der-Waals-Kräfte/Londonkräfte LEWIS-Darstellung Oktettregel
Chemische Bindung Chemische Bindung Kovalente Bindung (Atomindung) Ionenindung Metallischer Zustand Zwischenmolekulare Kräfte: o H-Brücken o Van-der-Waals-Kräfte/Londonkräfte LEWIS-Darstellung Oktettregel
Bindungen: Kräfte, die Atome zusammenhalten, Bindungsenergie,
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische h Bindungen Bindungen: Kräfte, die Atome zusammenhalten, Bindungsenergie, unterschiedliche Arten chemischer Bindungen, Atombindung, kovalente
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische h Bindungen Bindungen: Kräfte, die Atome zusammenhalten, Bindungsenergie, unterschiedliche Arten chemischer Bindungen, Atombindung, kovalente
Praktikumsrelevante Themen
 Praktikumsrelevante Themen Säuren und Basen Säure-Base-Konzepte Säure-Base-Gleichgewichte Säurestärke, Basenstärke ph-, poh-, pk-werte Pufferlösungen Titrationen 1 Säure-Base-Definition nach ARRHENIUS
Praktikumsrelevante Themen Säuren und Basen Säure-Base-Konzepte Säure-Base-Gleichgewichte Säurestärke, Basenstärke ph-, poh-, pk-werte Pufferlösungen Titrationen 1 Säure-Base-Definition nach ARRHENIUS
AC Molekülchemie und Metallorganische Chemie. Beispielklausur I
 AC Molekülchemie und Metallorganische Chemie Beispielklausur I 1) Ermitteln, zeichnen und benennen Sie mithilfe des VSEPR-Modells jeweils die Struktur der Addukte einer starken Lewis-Base :D (wie z.b.
AC Molekülchemie und Metallorganische Chemie Beispielklausur I 1) Ermitteln, zeichnen und benennen Sie mithilfe des VSEPR-Modells jeweils die Struktur der Addukte einer starken Lewis-Base :D (wie z.b.
Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie III III
 Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie III III Metallorganische Chemie Dr. J. Wachter IR-Teil3 www.chemie.uni-regensburg.de/anorganische_chemie/scheer/lehre.html www.chemie.uniregensburg.de/anorganische_chemie/wachter/lehre.html
Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie III III Metallorganische Chemie Dr. J. Wachter IR-Teil3 www.chemie.uni-regensburg.de/anorganische_chemie/scheer/lehre.html www.chemie.uniregensburg.de/anorganische_chemie/wachter/lehre.html
Zustände der Elektronen sind Orbitale, die durch 4 Quantenzahlen
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Das wellenmechanische h Atommodell (Orbitalmodell) ll) Zustände der Elektronen sind Orbitale, die durch 4 Quantenzahlen beschrieben werden, Hauptquantenzahl
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Das wellenmechanische h Atommodell (Orbitalmodell) ll) Zustände der Elektronen sind Orbitale, die durch 4 Quantenzahlen beschrieben werden, Hauptquantenzahl
Die chemische Reaktion
 Die chemische Reaktion Die Chemie beschäftigt sich mit Stoffen und ihren Eigenschaften. Die Dinge in unserer Umwelt bestehen aus vielen verschiedenen Stoffen, die häufig miteinander vermischt sind. Mit
Die chemische Reaktion Die Chemie beschäftigt sich mit Stoffen und ihren Eigenschaften. Die Dinge in unserer Umwelt bestehen aus vielen verschiedenen Stoffen, die häufig miteinander vermischt sind. Mit
30. Lektion. Moleküle. Molekülbindung
 30. Lektion Moleküle Molekülbindung Lernziel: Moleküle entstehen aus Atomen falls ihre Wellenfunktionen sich derart überlappen, daß die Gesamtenergie abgesenkt wird. Begriffe Begriffe: Kovalente Bindung
30. Lektion Moleküle Molekülbindung Lernziel: Moleküle entstehen aus Atomen falls ihre Wellenfunktionen sich derart überlappen, daß die Gesamtenergie abgesenkt wird. Begriffe Begriffe: Kovalente Bindung
[4+2] Cycloaddition Diels Alder
![[4+2] Cycloaddition Diels Alder [4+2] Cycloaddition Diels Alder](/thumbs/53/32900999.jpg) [4+2] Cycloaddition Diels Alder Additionsreaktion zwischen einem 1,3 Dien und einem Alken (Dienophil). Methode zur Synthese von einfach ungesättigten 6 Ringen. 3 Bindungen werden zu 2 Bindungen und einer
[4+2] Cycloaddition Diels Alder Additionsreaktion zwischen einem 1,3 Dien und einem Alken (Dienophil). Methode zur Synthese von einfach ungesättigten 6 Ringen. 3 Bindungen werden zu 2 Bindungen und einer
