Ber.ANLI (1996)
|
|
|
- Ina Hafner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ber.ANLI (1996) Naturschutzaspekte bei der Denkmalpflege unter besonderer Berücksichtigung der Mauervegetation * Dietmar BRANDES 1. Einleitung Baudenkmäler sind geschichtsträchtige Biotope. Warum aber sind sie zugleich Objekte des Artenoder Naturschutzes? Ziel des Artenschutzes ist die Erhaltung und Entwicklung der jetzt noch vorhandenen Artenvielfalt Da Burgen, alte Stadtmauern oder Steinbrücken häufig Fundorte seltener Pflanzenarten sind, die entweder heute in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft keine natürlichen Wuchsorte mehr haben, oder aber als alte Gartenrelikte auch kulturgeschichtliche Bedeutung aufweisen, müssen bei Renovierungs- und Erhaltungsmaßnahmen auch Naturschutzaspekte berücksichtigt werden. Die entsprechende Argumentation gilt natürlich auch für Tierarten, die in oder an alten Gebäuden leben. 2. Entwicklung der Siedlungsvegetation Unsere heutige Siedlungsvegetation ist das Ergebnis eines langen historischen Prozesses, in dessen Verlauf ganz spezifische Nischen und Konkurrenzbedingungen auftraten. Thre Entwicklung ist deshalb nicht einfach durch Neueinsaat bzw. Anpflanzung wiederholbar. Die Genese der Siedlungsflora hat sich in den folgenden Abschnitten vollzogen: Vor der Rodung des Waldes fanden sich auf dem Gebiet der späteren Siedlung nur einheimische (indigene) Arten. Der größte Teil von ihnen - überwiegend Waldpflanzen fand nach der Rodung keine zusagenden Lebensbedingungen mehr, diese Arten verschwanden rasch aus dem Gebiet der Siedlung. Ein anderer Teil der Iudigenen wurde jedoch durch die Siedlungstätigkeit des Menschen begünstigt; während weitere Arten weder vom Menschen begünstigt noch lokal ausgerottet wurden. Schließlich konnte sich eine Reihe einheimischer Arten, die ursprünglich nicht auf der Fläche der Siedlung vorkam, nach Rodung des Waldes mit oder olme direkte Förderung durch den Menschen dort etablieren. Über einen längeren Zeitraum hin wurden archäophytische Siedlungsbegleiter, die zumeist aus dem Mittelmeerraum oder dem Südosten Europas stammen, eingeführt bzw. eingeschleppt. Zu ihnen gehören zahlreiche Arzneipflanzen, ehemalige Würzund Nutzpflanzen, ebenso auch Acker- und Gartenunkräuter. Die Arten, die nach der Entdeckung Amerikas erstmals unser Gebiet erreichten, werden definitionsgemäß als Neophyten bezeichnet. Unter ihnen sind nun auch Arten aus Nordamerika und aus Ostasien. Etwa seit 1870 kann z.b. die weitere Entwicklung der Siedlungsflora anhand von Literatur und Herbarbelegen wesentlich genauer rekonstruiert werden. Bereits gegen Ende des letzten Jahrhunderts wurde der Rückgang einzelner "Dorfpflanzen" beklagt. Durch verwildernde und sich einbürgernde Zierpflanzen kamen gerade in unserem Jahrhundert neue Arten hinzu. Gleichzeitig verstärkte sich der Artenrückgang, von dem nun auch schon Neophyten betroffen werden, sehr. Infolge von Nutzungsänderungen, Aufwuchsbekämpfung und zunehmender Oberflächenversiegelung werden sich die oft nur noch kleinen Populationen nicht mehr lange behaupten können, so daß in naher Zukunft mit einem großen Artenverlust zu rechnen ist. Es wird also deutlich, daß sich die Flora der Siedlungen, also der Städte, Dörfer und Burgen, in einem dynamischen Prozeß herausgebildet hat, daß sie auf weitere nutzungsbedingte Änderungen mehr oder minder rasch reagieren wird. Viele der jetzt noch vorkommenden Arten spiegeln unsere Kulturgeschichte wider. Wir kötmen uns heute nur noch an Burgen, in alten Dörfern, an Stadtmauern u.ä. ein Bild der Siedlungsvegetation vergangeuer Zeiten machen. Sie zu erhalten ist nicht nur ein Gebot des Artenschutzes und der Sicherung genetischer Ressourcen, sondern auch des Denkmalschutzes. 3. Mauern als Lebensraum für Pflanzen Mauern sind der wichtigste Bestandteil von Baudenkmälern, weswegen sie hier etwas eingehender diskutiert werden sollen. Sie stellen einen künstlichen Lebensraum dar, der nur zögernd, d.h. mit seiner Alterung, von Pflanzenarten vor allem der unmittelbaren Umgebung besiedelt wird. Wenn die Lebensbedingungen auf Mauern bzw. in deren Fugen wegen der geringen Ressourcen an Wasser und Nährstoffen auch sehr eingeschränkt sind, so bieten Mauern doch oft einen konkurrenzarmen Wuchsort. Mauern stellen aber keineswegs einen einheitlichen Standort dar. Bei der einzelnen * Vortrag auf dem ANL-Serninar "Grün im Umgriff historischer Bauten" vom Juni 1993 in Gessertshausen bei Augsburg (in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld) 145
2 Mauer ist zwischen der vertikalen Mauerfläche, in der nur die Mauerfugen von höheren Pflanzen besiedelt werden können, der Mauerkrone und dem Mauerfuß zu unterscheiden. Selbst die vertikale Mauerfläche läßt sich nach Expositions- und Feuchtigkeitsverhältnissen weiter gliedern. Die Wasserversorgung ist vermutlich kurz unterhalb der Krone (Sickerwasser!) und im untersten Teil der Mauer (aufsteigende Feuchtigkeit) am besten. Südexponierte Mauerflächen stellen die in ihren Fugen wurzelnden Pflanzen vor wesentliche größere Probleme des Wasserhaushalts als nordexponierte Mauem. Eine große Bedeutung spielt schließlich auch die Neigung der Mauerfläche: sobald die Mauer auch nur um wenige Grad vom Lot abweicht, kann wesentlich mehr Feuchtigkeit in die Fugen eindringen als bei einer senkrechten Mauer. Dies spiegelt sich sehr deutlich in der Vegetation wieder. Auf älteren Mauerkronen hat sich häufig eine wenige cm mächtige Auflage aus schluffig-grusigem Material angereichtert, so daß sich dort fragmentarische Trockemasen bzw. Felsgrusrasen entwickeln konnten. Interessant sind aber nicht nur die alten Mauem selbst, sondern auch die Bereiche am sog. Mauerfuß, also unmittelbar vor der Mauer. Hier herrschen durch herabfallenden Mörtel, durch Kot und Urin, aber auch durch den kleinklimatischen Spaliereffekt ganz besondere Standortsbedingungen. Sie stellen einen spezifischen Lebensraum für wärme- und nährstoffbedürftige Pflanzenarten dar. Es ist weiterhin zwischen Gebäudemauem, freistehenden Mauem und Stützmauem zu unterscheiden. Gebäudemauem sind am besten gepflegt, sie sind in der Regel relativ dünn und trocken und dementsprechend vegetationsfrei; lediglich die Mauem von Burgen und auch mancher alten Kirchen stellen hier eine Ausnahme dar. Freistehende Umgrenzungsmauem haben hingegen eine wesentlich größere Bedeutung als Wuchsort von Pflanzen. Die besten Bedingungen hinsichtlich Wasser- und Nährstoffversorgung haben Stützmauern, insbesondere Ufermauem. Von ausschlaggebender Bedeutung sind ferner die Baustoffe der Mauer und die Art des Mörtels, vor allem aber das Alter der Mauer. Der "typische" Mauerbewuchs entwickelt sich erst nach mehreren hundert Jahren, so daß die Bedeutung alter Mauem als Lebensraum kaum überschätzt werden kann. Wie bereits oben angedeutet, erfolgt die Besiedlung der Mauem vor allem durch Pflanzenarten ihrer Umgebung. Eine stattliche Anzahl von Arten besiedelt heute diesen Lebensraum; es sind sowohl Gartenflüchtlinge, als auch unabsichtlich vom Menschen eingeschleppte Arten oder Trockemasenarten. Vor allem auf sehr alten Mauem fmdet man häufig Pflanzen, die ihre primären Wuchsorte (in der Umgebung) längst durch anthropogene Eingriffe verloren haben. Zu ilmen gehören die in Tab. 1 zusammengestellten Arten, die früher alle als Heilpflanzen genutzt wurden. Tabelle 1 Ehemalige Heilpflanzen als charakterischer Bestandteil der Mauervegetation Asplenium ruta-muraria (Mauerraute) Asplenium trichomanes (Schwarzstieliger Streifenfarn) Ceterach officinarum (Milzfarn) Corydalis lutea (Gelber Lerchensporn) Cymbalaria muralis (Mauer-Zymbelkraut) Parietaria judaica (Mauer -Glaskraut) Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge) 4. Burgen Auf die Flora alter Burgen wurde erstmals 1862 von KIRSCHLEGER aufmerksam gemacht. Hier sind die Höhenburgen, wie wir sie z.b. noch am Mittelrhein, am Harzrand, an der Saale und Unstrut fmden, von besonderem Interesse, da süd- und westexponierte Mauem und Hänge wärmebedürftigen Pflanzenarten geeignete Wuchsorte bieten. Tabelle 2 Charakteristische "Burgenpflanzen" (Auswahl) Anthemis tinctoria (Färber-Hundskamille) Anthriscus caucalis (Hunds-Kerbel) Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma (Wildform d. Gartenkümmels) Artemisia absinthium (Wermut) Artemisia pontica (Pontischer Beifuß) Asperugo procumbens (Scharfkraut) Asplenium ruta-muraria (Mauerraute) Asplenium trichomanes (Braunstengeliger Streifenfarn) Ballota nigra (Schwarznessel) Cheiranthus cheiri (Goldlack) Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich) Conium maculatum (Gefleckter Schierling) Cymbalaria muralis (Mauer-Zymbelkraut) Cystopteris fragilis (Zerbrechlicher Blasenfarn) Datura stramonium (Stechapfel) Dipiotaxis muralis (Mauersenf) Echium vulgare (Natterkopf) Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut) Iris germanica (Deutsche Schwertlilie) Isatis tinctoria (Färber-Waid) Lappula squarrosa (Kletten-Igelsarne) Leonurus cardiaca (Echter Löwenschwanz) Malva neglecta (Gänse-Malve) Malva sylvestris (Wilde Malve) Medicago minima (Zwerg-Schneckenklee) Nepeta cataria (Gewöhnliche Katzenminze) Onopordum acanthium (Gewöhnliche Eselsdistel) Parietaria judaica (Mauer-Glaskraut) Ruta graveolens (Wein-Raute) Sempervivum tectorum (Dach-Hauswurz) Sisymbrium austriacum (Österreichische Rauke) Tanacetum parthenium (Mutterkraut) Verbena officinalis (Gewöhnliches Eisenkraut) 146
3 Bei Höhenburgen ist die Vegetation des Burgfelsens bzw. Burghügels in der Regel besonders schutzwürdig, fmden sich hier doch seltene und bedrohte thermophile Pflanzenarten. Xerothermrelikte wie Stipa capillata (Haar-Pfriemengras) oder Veronica prostrata (Liegender Ehrenpreis), die sonst kaum Wuchsmöglichkeiten in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft finden, wachsen dort zusammen mit verwilderten Kulturpflanzen zumeist südeuropäischer Herkunft. Aber selbst Mauerreste in Wäldern führen zu einer Bereicherung der Flora, wie VOLLRATH (1958/60) am Beispiel der Burgen des Oberpfälzer Waldes eindrucksvoll zeigen konnte. Längst aufgelassene und vom Walde wiedereroberte Burgstellen tragen infolge der Veränderungen des Bodens eine von der Umgebung immer noch deutlich abweichende Vegetation. Die Anreicherung von Kalk, Nitrat und Phosphat begünstigt anspruchsvolle Mullbogen Zeiger. Dies gilt insbesondere bei basenarmen Ausgangsgesteinen bzw. bei einer entkalkten Lehmdecke. So können z.b. im Elm östlich Braunschweig Burgen, die bereits vor 450, teils sogar vor fast 800 Jahren zerstört wurden, im Frühjahr noch an ihrer Vegetation erkannt werden. Historische Parkanlagen von Wasserburgen, Schlössern und Gütern sind nicht nur von der Gartengeschichte und von ihrem Baumbestand her interessant, sondern auch wegen der Verwilderung vieler ehemals als Zierpflanzen eingebrachter Arten (vgl. Tab. 3). Tabelle 4 Stadtmauern als Refugien für seltene/bedrohte Pflanzenarten (a) Mauerfugen und Mauerkrone: Achillea nobilis (Edel-Schafgarbe) Anthemis tinctoria (Färber-Hundskamille) Artemisia absinthium (Wermut) Artemisia campestris (Feld-Beifuß) Asplenium ruta-muraria (Mauerraute) Asplenium trichomanes (Braunstengeliger Streifenfarn) Cheiranthus cheiri (Goldlack) Corydalis lutea (Gelber Lerchensporn) Cymbalaria muralis (Mauer-Zymbelkraut) Cynoglossum officinale (Gebräuchliche Hundszunge) Isatis tinctoria (Färber-Waid) Lappula squarrosa (Kletten-lgelsame) Medicago minima (Zwerg-Schneckenklee) Melica ciliata (yyimper-perlgras) Parietaria judaica (Mauer-Glaskraut) Saxifraga tridactylites (Dreifinger-Steinbrech) Sempervivum tectorum (Dach-Hauswurz) (b) Mauerfuß: Ballota nigra (Schwarznessel) Chenopodium murale (Mauer-Gänsefuß) Parietaria judaica (Mauer-Glaskraut) Parietaria officinalis (Aufrechtes Glaskraut) Tabelle 3 Bedrohte Pflanzenarten historischer Parkanlagen Tabelle 5 Frühjahrsgeophyten der Wallanlagen Anthriscus caucalis (Hunds-Kerbel) Aristolochia clematitis (Gewöhnliche Osterluzei) Bryonia alba (yyeiße Zaunrübe) Bryonia dioica (Zweihäusige Zaunrübe) Eranthis hiemalis (Winterling) Galantbus nivalis (Schneeglöckchen) Geranium phaeum (Brauner Storchschnabel) Inula helenium (Echter Alant) Ornithogalum nutans (Nickender Milchstern) Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern) Parietaria officinalis (Aufrechtes Glaskraut) Scrophularia vernalis (Frühlings-Braunwurz) Scutellaria altissima (Hohes Helmkraut) Telekia speciosa (Telekie) Tulipa sylvestris (Wild-Tulpe) 5. Stadtmauern Stadtmauem stellen jahrhundertealte Sekundärbiotope dar, die in ganz West-, Süd- und Mitteleuropa eine wichtige Refugialfunktion für zahlreiche seltene und/oder gefährdete Pflanzenarten aufweisen. Entsprechendes gilt z.b. auch für die Umfassungsmauem von Klöstern bzw. Klostergütern (s. Tab. 4). Allium paradoxum (Seltsamer Lauch) Arum maculatum (Gefleckter Aronstab) Bryonia alba (Weiße Zaunrübe) Bryonia dioica (Zweihäusige Zaunrübe) Corydalis cava (Hohler Lerchensporn) Corydalis intermedia (Mittlerer Lerchensporn) Gagea lutea (yyald-goldstem) Gagea pratensis (yyiesen-goldstem) Gagea villosa (Acker-Goldstern) Galanthus nivalis (Schneeglöckchen) Ornithogalum umbellatum (Doldiger Milchstern) Ranunculus ficaria (Scharbockskraut) Scilla siberica (Sibirischer Blaustem) Tulipa sylvestris (yyild-tulpe) Die nach außen an die Stadtmauer angrenzenden Wallanlagen sind schließlich oft Lebensraum anspruchsvoller und hübsch blühender Waldarten, unter denen sich besonders viele Frühjahrsgeophyten befmden (vgl. Tab. 5). In Einzelfällen sind auch die spätmittelalterlichen Landwehren als Biotop interessant. So stellt die aus einem Doppelgrabensystem mit Wällen bestehende Braunschweiger Landwehr den wichtigsten Orchideenwuchsort im Gebiet der Stadt dar. 147
4 6. Kirchen und Kirchhöfe Wir wollen uns nun den Kirchen zuwenden. Mit Ausnahme weniger Mauerpflanzen wie Asplenium ruta-muraria und Cymbalaria muralis sowie einiger zufälliger Pflanzen sind Kirchen kaum Biotope für höhere Pflanzen. Umso größere Bedeutung besitzen aber die Kirchhöfe, da sie meist nicht so intensiv gepflegt werden wie Privatgärten; auch scheinen Herbizide seltener eingesetzt zu werden. Zahlreiche Siedlungszeiger konnten so bislang auf den Kirchhöfen überdauern; unter ihnen finden sich viele alte Heilpflanzen. Wenn man z.b. im ganzen Dorf keine Malve (Malva neglecta) mehr fmdet, lohnt es sich immer, unmittelbar vor der Südwand des Kirchenschiffs zu suchen. Von besonderer Bedeutung sind die Umfassungs- bzw. Stützmauem des Kirchhofs, aber auch die nitrophilen Staudenfluren um Sträucher und an Zäunen. Entsprechendes gilt auch für alte Pfarrgärten. 7. Fazit Aufgabe des Artenschutzes ist die Erhaltung der derzeit vorhandenen Artenvielfalt, folgerichtig fordert das Naturschutzgesetz denn auch den Schutz der Siedlungsvegetation. Dies gilt insbesondere für die Erhaltung von Pflanzensippen, die (derzeit) keine anderen Lebensmöglichkeiten außer auf oder an Baudenkmälern haben. Man sollte den Ensemble-Begriff richtig verstehen bzw. erweitern: die Vegetation gehört mit zum Ensemble, sie spiegelt die regionale Kulturgeschichte wider und macht einen Teil des Erlebnisinhaltes aus. Baudenkmal und vom Menschen genutzte bzw. umgestaltete "Natur" bilden eine Einheit. Welche Möglichkeiten zur Erhaltung von Baudenkmälern und ihrer spezifischen Flora gibt es nun? Patentlösungen existieren sicher nicht; die folgenden Punkte erscheinenjedoch wichtig: 1. Vor einer Restaurierung eines Baudenkmals (Burg, Kirche mit Kirchhof, Stadtmauer o.ä.) muß auch eine biologische Bestandsaufnahme durch Experten erfolgen. Wenn diese ergibt, daß schützenswerte Arten vorhanden sind, muß die jetzt noch vorhandene Artenvielfalt erhalten werden. 2. Mauerspalten sollten nicht überall mit verwitterungsbeständigem Mörtel verputzt werden. Sofern es die Funktion der Mauer erlaubt, sind Bereiche mit Bewuchs nur vorsichtig zu verputzen. Ist dies nicht möglich, sollte das Fugenmaterial in eine für diesen Zweck neu zu bauende Mauer umgesetzt werden. Zumindest die Schaffung eines Ersatzstandortes ist unerläßlich, da bisherige Mauem erst nach einigen 100 Jahren (!) ihren optimalen Bewuchs aufweisen, und ansonsten mit dem Erlöschen der Mauervegetation überhaupt zu rechnen ist. 3. Die Mauerkrone sollte zumindest nicht lückenlos mit Dachziegeln, Beton o.ä. Materialien ver- siegelt werden. Eine denkbare Alternative wäre das Einziehen einer wasserundurchlässigen Schicht im oberen Drittel der Mauer bei gleichzeitiger Schonung des Kronenbewuchses, wobei Gehölze entfernt werden können. 4. Mauerfüße düfen nicht mit Asphalt o.ä. versiegelt werden; bei Pflasterungen ist an genügend Abstand von der Mauer zu denken. Kratzen oder vorsichtiges Aufreißen der oberen Bodenschicht vor der Mauer kann die Samenbank aktivieren und zu interessanten Ergebnissen führen. 5. Grundsätzlich sollte altes Baumaterial nicht auf Bauschuttdeponien verbracht werden, sondern zur Gestaltung von Ersatzbiotopen wie z.b. (Trocken-)Mauem verwendet werden. 6. Bereiche mit interessanter Siedlungsvegetation sollten keineswegs mit sog. "Mutterboden" abgedeckt und in Rasenflächen oder Rabatten verwandelt werden. 7. Wegen ihrer Refugialfunktion besonders interessant sind Burgen, Stadtmauem und dörfliche Kirchhöfe. Sie sind deshalb besonders behutsam zu behandeln. Bei Kirchhöfen bietet sich u.u. eine Übernahme von Patenschaften durch die Kirchengemeinden bzw. durch Naturschutzvereinigungen an. Klostergüter bzw. aus ihnen hervorgegangene Domänen spielen eine wichtige Rolle für die Erhaltung der Dorfvegetation, was bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden sollte. 8. Literatur zur Flora von Baudenkmälern und deren Umgebung 8.1 Mauern allgemein BRANDES, D. (1992): Asplenietea-Gesellschaften an sekundären Standorten in Mitteleuropa. - Ber. d. Reinhold-Tüxen-Ges. 4: SEGAL, S. (1969): Ecological notes on wall vegetation. - Den Haag. 325 S. 8.2 Burgen BRANDES, D. (1996): Burgruinen als Habitatinseln: ihre Flora und Vegetation sowie die Bedeutung für Sukzessionsforschung und Naturschutz dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Burgruinen des Harzgebietes. - Braunschw. Naturk. Sehr. 5: JANSSEN, A. (1990): Flora und Vegetation der Ruine Stallberg/Steigerwald anthropogene Veränderung des Wuchspotentials. - Tuexenia 10: KIRSCHLEGER, F. (1862): Sur les plantes des vieux chateau, dans la region alsatovosgienne. - Bull. Soc. Bot. France 9:
5 LENNAR, G. & J. NIESSEN (1910): Die Flora alter Baudenkmäler am Niederrhein. - In: Der deutsche Niederrhein vom Erftgebiet bis zur Landesgrenze. - Krefeld. S LOHMEYER, W. (1975a): Rheinische Höhenburgen als Refugien für nitrophile Pflanzen. - Natur u. Landschaft 50: (1975b): Zur Kenntnis der anthropogenen Flora und Vegetation des Tomberges bei Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis. Beitr. naturk. Forsch. Südw. - Dtld. 34: (1984): Vergleichende Studie über die Flora und Vegetation auf der Rheinbrohler Ley und dem Ruinengelände der Höhenburg Hammerstein (Mittelrhein). - Natur u. Landschaft 59: BAKKER, P.A. & E. BOEVE (1985): Stinzenplanten. - Zutphen. 168 S. BRANDES, D. (1985): Nitrophile Saumgesellschaften in alten Parkanlagen und ihre Bedeutung für den Naturschutz. Phytocoenologia 13: JANSEN, M.T. & D.T.E. van der PLOEG (1977): Stinzeplanten in Nederland. - Wetenschappel. Mededel. Konink. Nederl. Natuurhist. Ver. Nr. 122: 44 S. 8.4 Stadtmauem BARNEWITZ, A. (1998): Die auf der Stadtmauer von Brandenburg a.h. wachsenden Pflanzen. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 40: TÜXEN, R. (1954): Über die räumliche, durch Relief und Gestein bedingte Ordnung der natürlichen Waldgesellschaften am nördlichen Rande des Harzes. - Vegetatio 5/6: VOLLRATH, H. (1958/60): Burgruinen bereichern die Flora. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 10: BRANDES, D. (1992): Flora und Vegetation von Stadtmauern. Tuexenia 12: HELOT, E. (1985): Die Pflanzenwelt der Warburger Stadtmauern. Jahrb. Kreis Höxter 1985: Parks von Wasserburgen, Schössem und Gütern BAKKER, P.A. (1985): Erhaltung von Stinzenplanten (Zwiebel- und Knollengewächse an alten Burgen). - In: Bericht über d. Internat. Symposium "Naturschutz durch Freilichtmuseen". Schriftenr. Stiftg. zum Schutze gefährdeter Pflanzen 4: Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Dietmar Brandes Technische Universität Braunschweig Botanisches Institut und Botanischer Garten Arbeitsgr. Geobotanik und Biologie höherer Pflanzen Gaußstr. 7 D Braunschweig 149
6 Berichte der ANL 20 (1996) Herausgeber: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) Seethaler Str. 6 D Laufen Telefon: 08682/ Telefax: 08682/ (Verwaltung) 08682/1560 (Fachbereiche) Naturschutzakademie@ t -online.de Internet: Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege ist eine dem Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen angehörende Einrichtung. Schriftleitung und Redaktion: Dr. Notker Mallach, ANL Für die Einzelbeiträge zeichnen die jeweiligen Autoren verantwortlich. Die Herstellung von Vervielfältigungenauch auszugsweise - aus den Veröffentlichungen der Bayerischen Akademie für Naturschtuz und Landschaftspflege sowie die Benutzung zur Herstellung anderer Veröffentlichungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Erscheinungsweise: Einmal jährlich Bezugsbedingungen: Siehe Publikationsliste am Ende des Heftes Satz: Christina Brüder!, ANL Druck und Buchbinderei: Fa. Kurt Grauer, Moosharn 41, Laufen Druck auf Recyclingpapier (aus 100% Altpapier) ISSN ISBN X
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BRAUNSCHWEIG
 UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BRAUNSCHWEIG Dietmar Brandes Naturschutzaspekte bei der Denkmalpflege unter besonderer Berücksichtigung der Mauervegetation (Vortrag auf dem ANL-Seminar Grün im Umgriff historischer
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BRAUNSCHWEIG Dietmar Brandes Naturschutzaspekte bei der Denkmalpflege unter besonderer Berücksichtigung der Mauervegetation (Vortrag auf dem ANL-Seminar Grün im Umgriff historischer
Historische Gärten und Parks charmante Orte und alte Pflanzen
 Historische Gärten und Parks charmante Orte und alte Pflanzen 14. Oktober 2014 Gemeinschaftshaus Broitzem Landschaftsgarten: Kunstvolle Zähmung der Natur Einen Park ohne exotische Arten könnte man mit
Historische Gärten und Parks charmante Orte und alte Pflanzen 14. Oktober 2014 Gemeinschaftshaus Broitzem Landschaftsgarten: Kunstvolle Zähmung der Natur Einen Park ohne exotische Arten könnte man mit
Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei)
 Dietmar Brandes (2007): Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) 1/5 Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) Some notes to the spontaneous flora of
Dietmar Brandes (2007): Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) 1/5 Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) Some notes to the spontaneous flora of
Fragmentierung von WäldernW
 Fragmentierung von WäldernW Mit Ausnahme der Meeresküsten, der Gewässer und der Hochgebirge sowie einiger weniger Sonderstandorte bilden Waldgesellschaften in Mitteleuropa die potentiell natürliche Vegetation.
Fragmentierung von WäldernW Mit Ausnahme der Meeresküsten, der Gewässer und der Hochgebirge sowie einiger weniger Sonderstandorte bilden Waldgesellschaften in Mitteleuropa die potentiell natürliche Vegetation.
Zur Situation der historischen privaten Gärten in Bayern
 Ber. ANL I 20 1123-127 (1996) Zur Situation der historischen privaten Gärten in Bayern * Gerhard RICHTER Eine komplette oder gar umfassende Übersicht über wertvolle bzw. denkmalwürdige historische private
Ber. ANL I 20 1123-127 (1996) Zur Situation der historischen privaten Gärten in Bayern * Gerhard RICHTER Eine komplette oder gar umfassende Übersicht über wertvolle bzw. denkmalwürdige historische private
Über die Mauerflora von Amalfi (Italien) Notes on the wall flora of the Amalfi Coast (Italy)
 Institut für Pflanzenbiologie Arbeitsgruppe Vegetationsökologie Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Über die Mauerflora von Amalfi (Italien) Notes on the wall flora of the
Institut für Pflanzenbiologie Arbeitsgruppe Vegetationsökologie Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Über die Mauerflora von Amalfi (Italien) Notes on the wall flora of the
Blumenzwiebel zum Verwildern
 Blumenzwiebel zum Verwildern Laub einziehen lassen, nicht abmähen! Samen ausreifen lassen (ungestörter Platz) Nur gesunde, feste Knollen verpflanzen Möglichst schnell nach Lieferung pflanzen Bis sich ein
Blumenzwiebel zum Verwildern Laub einziehen lassen, nicht abmähen! Samen ausreifen lassen (ungestörter Platz) Nur gesunde, feste Knollen verpflanzen Möglichst schnell nach Lieferung pflanzen Bis sich ein
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN
 BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
Lebendige Spuren aus der Vergangenheit - Pflanzen unserer Burgen, Schlösser und Klöster
 botanik Lebendige Spuren aus der Vergangenheit - Pflanzen unserer Burgen, Schlösser und Klöster ÖKO L 31/4 (2009): 13-24 Michael HOHLA Therese-Riggle-Straße 16 4982 Obernberg am Inn m.hohla@eduhi.at Bereits
botanik Lebendige Spuren aus der Vergangenheit - Pflanzen unserer Burgen, Schlösser und Klöster ÖKO L 31/4 (2009): 13-24 Michael HOHLA Therese-Riggle-Straße 16 4982 Obernberg am Inn m.hohla@eduhi.at Bereits
Buschwindröschen Anemone nemorosa. Gelbe Narzisse Narcissus
 Buschwindröschen Anemone nemorosa Das Buschwindröschen ist eine giftige Pflanze. Der Wurzelstock liegt waagrecht im Boden. Die Pflanze schließt ihre Blüten bei Regen und Nacht. weiß 10-25 cm hoch; meist
Buschwindröschen Anemone nemorosa Das Buschwindröschen ist eine giftige Pflanze. Der Wurzelstock liegt waagrecht im Boden. Die Pflanze schließt ihre Blüten bei Regen und Nacht. weiß 10-25 cm hoch; meist
Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie
 Stand: Dezember 13 Adenophora liliifolia (Lilienblättrige Becherglocke) Berichtsjahr: 13 Quelle: Nationaler FFH-Bericht 13 Stand: Dezember 13 17 Angelica palustris (Sumpf-Engelwurz) Berichtsjahr: 13 Quelle:
Stand: Dezember 13 Adenophora liliifolia (Lilienblättrige Becherglocke) Berichtsjahr: 13 Quelle: Nationaler FFH-Bericht 13 Stand: Dezember 13 17 Angelica palustris (Sumpf-Engelwurz) Berichtsjahr: 13 Quelle:
Pflanzen und Tiere am Flughafen
 Lehrerkommentar MST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Lehrplan: In ausgewählten, natürlichen Lebensräumen einige typische Pflanzen und Tiere benennen. Die Kinder wissen um die schützenswerte
Lehrerkommentar MST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Lehrplan: In ausgewählten, natürlichen Lebensräumen einige typische Pflanzen und Tiere benennen. Die Kinder wissen um die schützenswerte
Pflanzen auf den Ruderalflächen im Kirchfeld
 Pflanzen auf den Ruderalflächen im Kirchfeld Natur- und Umweltschutzstelle Horw Pflanzenliste 2012 INHALTSVERZEICHNIS Ruderalflächen Definition.. 4 Lavendel...2 Hopfenklee...2 Gewöhnlicher Natterkopf...2
Pflanzen auf den Ruderalflächen im Kirchfeld Natur- und Umweltschutzstelle Horw Pflanzenliste 2012 INHALTSVERZEICHNIS Ruderalflächen Definition.. 4 Lavendel...2 Hopfenklee...2 Gewöhnlicher Natterkopf...2
TULPEN. Päonienblütig GEFÜLLTE MISCHUNG. Größe 11/12. Langblühend; April-Mai. Pflanzzeit: September-31 Dezember. Zwiebeln aus Kulturmaterial vermehrt.
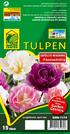 Nach der Blüte Samenstand entfernen. Das Laub darf nach dem Blühen erst abgeschnitten werden, wenn es anfängt gelb zu werden. Tulpen eingepfl anzt in Rabatten, Beeten und Steingärten bringen Ihnen im Frühjahr
Nach der Blüte Samenstand entfernen. Das Laub darf nach dem Blühen erst abgeschnitten werden, wenn es anfängt gelb zu werden. Tulpen eingepfl anzt in Rabatten, Beeten und Steingärten bringen Ihnen im Frühjahr
KostProbe Seiten. So bestimmst du Blütenpflanzen
 Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Hiermit wird der in 2 beschriebene Bereich der Altstadt von Kaiserswerth als Denkmalbereich gemäß 5 DSchG unter Schutz gestellt.
 Düsseldorf Amtsblatt Nr. 34 vom 27. 8. 1988 Redaktioneller Stand: November 1998 Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 5. Juli 1988 aufgrund des 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler
Düsseldorf Amtsblatt Nr. 34 vom 27. 8. 1988 Redaktioneller Stand: November 1998 Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 5. Juli 1988 aufgrund des 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler
Zwiebel- / Knollenpflanzen
 Zwiebel- / Knollenpflanzen Symbolpflanze / Bärlauch Allium ursinum Halbschatten, feucht weiß 5 Waldstaude Blaustern Scilla siberica histor. Parkpflanze Halbschatten blau 3-4 Buschwindröschen Anemone nemerosa
Zwiebel- / Knollenpflanzen Symbolpflanze / Bärlauch Allium ursinum Halbschatten, feucht weiß 5 Waldstaude Blaustern Scilla siberica histor. Parkpflanze Halbschatten blau 3-4 Buschwindröschen Anemone nemerosa
Schwarzerle. Alnus glutinosa. Foto: ZIM
 1a Foto: ZIM Bäume & Sträucher Schwarzerle Alnus glutinosa Höhe bis 25 m Wissenswertes Der Name der Schwarzerle beruht auf der früheren Verwendung zum Schwarzfärben von Leder mit Erlenrinde. 1b Foto: RPK
1a Foto: ZIM Bäume & Sträucher Schwarzerle Alnus glutinosa Höhe bis 25 m Wissenswertes Der Name der Schwarzerle beruht auf der früheren Verwendung zum Schwarzfärben von Leder mit Erlenrinde. 1b Foto: RPK
Vortrag "Biodiversität"
 1. Vorstellung Dr. Gero Karthaus MdL Verheiratet, zwei Kinder Studium der Biologie, Geographie und Pädagogik zwischen 1981 und 1987 Promotion 1988 Lehrauftrag Uni Bonn Landschaftsarchitekt Seit 1987 beruflich
1. Vorstellung Dr. Gero Karthaus MdL Verheiratet, zwei Kinder Studium der Biologie, Geographie und Pädagogik zwischen 1981 und 1987 Promotion 1988 Lehrauftrag Uni Bonn Landschaftsarchitekt Seit 1987 beruflich
 ... 4... 4... 6... 8...10...12...20...20...22...22...24...25...26...26...29...30...36...36...39...39...43...43...44 ...46...46...47...47...51...52...53...54...55...55...58...58...61...62 Vertrag
... 4... 4... 6... 8...10...12...20...20...22...22...24...25...26...26...29...30...36...36...39...39...43...43...44 ...46...46...47...47...51...52...53...54...55...55...58...58...61...62 Vertrag
Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen
 Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen Problem Böschungspflege Die Pflege der teilweise sehr hohen und steilen Böschungen am Kaiserstuhl und im Breisgau verursacht
Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen Problem Böschungspflege Die Pflege der teilweise sehr hohen und steilen Böschungen am Kaiserstuhl und im Breisgau verursacht
Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft
 Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft Jahrestagung in Potsdam 02.-04. (05.) Juni 2011 (Himmelfahrts-Wochenende) Flora und Vegetation in Brandenburg Organisation: Priv.-Doz. Dr. Thilo Heinken, Dr.
Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft Jahrestagung in Potsdam 02.-04. (05.) Juni 2011 (Himmelfahrts-Wochenende) Flora und Vegetation in Brandenburg Organisation: Priv.-Doz. Dr. Thilo Heinken, Dr.
Was schmeckt? Experimentieren erlaubt
 Was schmeckt? 19 und Wald-Sauerklee sehr gerne mögen. Alles, was bitter ist dagegen, ist meins. Nicht umsonst heißt es: Die Geschmäcker sind verschieden. Vertrauen Sie diesbezüglich ganz auf Ihren Körper
Was schmeckt? 19 und Wald-Sauerklee sehr gerne mögen. Alles, was bitter ist dagegen, ist meins. Nicht umsonst heißt es: Die Geschmäcker sind verschieden. Vertrauen Sie diesbezüglich ganz auf Ihren Körper
Ringfahndung nach Ambrosia artemisiifolia: von Hafenpflanze und Vogelfutterbegleiter zum Ackerunkraut?
 Ringfahndung nach Ambrosia artemisiifolia: von Hafenpflanze und Vogelfutterbegleiter zum Ackerunkraut? Jens Nitzsche, TU Braunschweig AG für Vegetationsökologie & exp. Pflanzensoziologie Übersicht Fragestellung
Ringfahndung nach Ambrosia artemisiifolia: von Hafenpflanze und Vogelfutterbegleiter zum Ackerunkraut? Jens Nitzsche, TU Braunschweig AG für Vegetationsökologie & exp. Pflanzensoziologie Übersicht Fragestellung
Hamburger Naturdach Pflanzenliste für die extensive Dachbegrünung mit regionalen Arten 1
 Hamburger Naturdach Pflanzenliste für die extensive Dachbegrünung mit regionalen Arten Durchwurzelbare Aufbaudicke: 8-15 cm Stand: 1.4.2016 Das extensive Hamburger Naturdach" bietet viel Raum für eine
Hamburger Naturdach Pflanzenliste für die extensive Dachbegrünung mit regionalen Arten Durchwurzelbare Aufbaudicke: 8-15 cm Stand: 1.4.2016 Das extensive Hamburger Naturdach" bietet viel Raum für eine
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. Art Ab 15. Februar. März April Mai Juni Juli.
 Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
Weitere Informationen erhalten Sie unter
 :: Ambrosia.de - Ambrosia erkennen Beim Ausreißen von blühenden Ambrosien sollten unbedingt eine Feinstaubmaske sowie Handschuhe getragen werden. Pollenallergiker sollten diese Arbeiten niemals selbst
:: Ambrosia.de - Ambrosia erkennen Beim Ausreißen von blühenden Ambrosien sollten unbedingt eine Feinstaubmaske sowie Handschuhe getragen werden. Pollenallergiker sollten diese Arbeiten niemals selbst
Gartenflüchtlinge als neue Mitglieder der Dorfflora in Nordrhein-Westfalen
 Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 9: 481-490. März 2008 Gartenflüchtlinge als neue Mitglieder der Dorfflora in Nordrhein-Westfalen Rüdiger Wittig Abstract A comparison of the species composition of
Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 9: 481-490. März 2008 Gartenflüchtlinge als neue Mitglieder der Dorfflora in Nordrhein-Westfalen Rüdiger Wittig Abstract A comparison of the species composition of
Einkeimblättrige (Monocotyledonae)
 Einkeimblättrige (Monocotyledonae) Merkmale Blütenhülle meist einfach und 3- zählig (Perigon) Blä$er einfach und meist wechselständig Bla$spreiten o7 lanze$lich und meist parallelnervig, o7 mit Bla$scheiden
Einkeimblättrige (Monocotyledonae) Merkmale Blütenhülle meist einfach und 3- zählig (Perigon) Blä$er einfach und meist wechselständig Bla$spreiten o7 lanze$lich und meist parallelnervig, o7 mit Bla$scheiden
G e m e i n d e G e o r g e n b e r g. Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans Mitteräcker
 G e m e i n d e G e o r g e n b e r g Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans Mitteräcker Gemeinde Georgenberg Neuenhammerstraße 1 92714 Pleystein Pleystein, Johann
G e m e i n d e G e o r g e n b e r g Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans Mitteräcker Gemeinde Georgenberg Neuenhammerstraße 1 92714 Pleystein Pleystein, Johann
GEPARDE: Die Rolle eines Raubtieres in seinem Lebensraum
 GEPARDE: Die Rolle eines Raubtieres in seinem Lebensraum Ein Unterrichtsleitfaden Vorwort Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, wie wir alle wissen, bietet unsere Erde vielseitige Ressourcen wie Wasser,
GEPARDE: Die Rolle eines Raubtieres in seinem Lebensraum Ein Unterrichtsleitfaden Vorwort Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, wie wir alle wissen, bietet unsere Erde vielseitige Ressourcen wie Wasser,
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Nordrhein-Westfalen Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Königswinter-Ittenbach Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali Südlich von
Burgen und Schlösser in Nordrhein-Westfalen Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Königswinter-Ittenbach Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali Südlich von
Die Allelopathie und ihr Nutzen in der biologischen Landwirtschaft
 Die Allelopathie und ihr Nutzen in der biologischen Landwirtschaft Nicolas Delabays Christian Bohren Station fédérale de recherches agronomiques Agroscope RAC Changins Ein Referat in 4 Teilen: Definition
Die Allelopathie und ihr Nutzen in der biologischen Landwirtschaft Nicolas Delabays Christian Bohren Station fédérale de recherches agronomiques Agroscope RAC Changins Ein Referat in 4 Teilen: Definition
Lebensraum. Kirchturm
 Lebensraum Kirchturm Dohle Seit sie ihren ursprünglichen Lebensraum, die Steppe, verlassen hat, bezieht die Dohle (Coloeus monedula) bevorzugt Nischen, Schornsteine und Mauerlöcher in hohen Gebäuden.
Lebensraum Kirchturm Dohle Seit sie ihren ursprünglichen Lebensraum, die Steppe, verlassen hat, bezieht die Dohle (Coloeus monedula) bevorzugt Nischen, Schornsteine und Mauerlöcher in hohen Gebäuden.
Regeln für die Gestaltung von Wohnbauten in der Obwaldner Landschaft
 Regeln für die Gestaltung von Wohnbauten in der Obwaldner Landschaft Philipp Maurer, Raumplaner ETH NDS SIA Sarnen, 2. Juni 2016 2 Warum Regeln? Abbruch und Wiederaufbau seit 2012 zulässig. Art. 24c Abs.
Regeln für die Gestaltung von Wohnbauten in der Obwaldner Landschaft Philipp Maurer, Raumplaner ETH NDS SIA Sarnen, 2. Juni 2016 2 Warum Regeln? Abbruch und Wiederaufbau seit 2012 zulässig. Art. 24c Abs.
Floristische Diversität im Nordosten Niedersachsens
 Floristische Diversität im Nordosten Niedersachsens Natur und Kultur in der Elbtalaue 02. November 2013 Hitzacker Warum kommen so viele naturbegeisterte Touristen? Gibt es hier mehr Pflanzenarten als anderswo?
Floristische Diversität im Nordosten Niedersachsens Natur und Kultur in der Elbtalaue 02. November 2013 Hitzacker Warum kommen so viele naturbegeisterte Touristen? Gibt es hier mehr Pflanzenarten als anderswo?
Wildnis in der Stadt Haben wir den Mut dazu?
 Wildnis in der Stadt Haben wir den Mut dazu? Foto: Günther von Szombathely Silke Wissel Projektmanagerin Kommunaler Umweltschutz Foto: DUH Foto: Stefan Cop Wildnis Von Menschen unberührte Natur Ablauf
Wildnis in der Stadt Haben wir den Mut dazu? Foto: Günther von Szombathely Silke Wissel Projektmanagerin Kommunaler Umweltschutz Foto: DUH Foto: Stefan Cop Wildnis Von Menschen unberührte Natur Ablauf
Blühende Pflanzen für die Biogasanlage
 - Gliederung - Dauerkulturenversuch Ergebnisse Dauerkulturenversuch Erträge, Gasausbeute, Siliereignung, Flächenbedarf, Nitrat nach der Ernte Fazit Dauerkulturen Quo vadis Energiemais? Biomassekulturen
- Gliederung - Dauerkulturenversuch Ergebnisse Dauerkulturenversuch Erträge, Gasausbeute, Siliereignung, Flächenbedarf, Nitrat nach der Ernte Fazit Dauerkulturen Quo vadis Energiemais? Biomassekulturen
Arnica. montana. Vorläufige Ergebnisse aus der aktuellen Kartierung
 Arnica montana Vorläufige Ergebnisse aus der aktuellen Kartierung Floristische Kartierung LUBW LUBW (Landesanstalt für f Umwelt, Messungen und Naturschutz) unterst unterstützt tzt das Projekt Berichtspflicht
Arnica montana Vorläufige Ergebnisse aus der aktuellen Kartierung Floristische Kartierung LUBW LUBW (Landesanstalt für f Umwelt, Messungen und Naturschutz) unterst unterstützt tzt das Projekt Berichtspflicht
... zu mehr Stadtnatur!
 Cornelis F. Hemmer Dr. Corinna Hölzer www.deutschland-summt.de... zu mehr Stadtnatur! Mit der Biene als Botschafterin www.stiftung-mensch-umwelt.de Die Vision Die Notwendigkeit für den Schutz von Biodiversität
Cornelis F. Hemmer Dr. Corinna Hölzer www.deutschland-summt.de... zu mehr Stadtnatur! Mit der Biene als Botschafterin www.stiftung-mensch-umwelt.de Die Vision Die Notwendigkeit für den Schutz von Biodiversität
Online Feldbuch Neophyten. Benutzeranleitung
 Benutzeranleitung Mai 2016 1 Inhaltsverzeichnis 1 Wo finden Sie das Online Feldbuch Neophyten auf unserer Website? 3 2 Startseite und Login 4 3 Online Feldbuch Neophyten Übersichtsseite 5 4 Befragung ohne
Benutzeranleitung Mai 2016 1 Inhaltsverzeichnis 1 Wo finden Sie das Online Feldbuch Neophyten auf unserer Website? 3 2 Startseite und Login 4 3 Online Feldbuch Neophyten Übersichtsseite 5 4 Befragung ohne
Gemeindehaus Meiersmaadstrasse Sigriswil 3657 Schwanden. Praxishilfe Neophytenbekämpfung
 Gemeinde Sigriswil Forstbetrieb Sigriswil Gemeindehaus Meiersmaadstrasse 24 3655 Sigriswil 3657 Schwanden Praxishilfe Neophytenbekämpfung Andreas Schweizer Försterpraktikant BZW-Lyss verfasst am 8.8.2013
Gemeinde Sigriswil Forstbetrieb Sigriswil Gemeindehaus Meiersmaadstrasse 24 3655 Sigriswil 3657 Schwanden Praxishilfe Neophytenbekämpfung Andreas Schweizer Försterpraktikant BZW-Lyss verfasst am 8.8.2013
Indikatorpflanzen im Schulgelände
 Indikatorpflanzen im Schulgelände 1.1 Inhaltsangabe Deckblatt 1.1 Inhaltsverzeichnis 1.2 Kurzfassung 1.3 Einleitung 2. Vorstellung unseres Schulgeländes 3. Einführung in unsere Untersuchungsmethode 4.
Indikatorpflanzen im Schulgelände 1.1 Inhaltsangabe Deckblatt 1.1 Inhaltsverzeichnis 1.2 Kurzfassung 1.3 Einleitung 2. Vorstellung unseres Schulgeländes 3. Einführung in unsere Untersuchungsmethode 4.
Wettbewerb Bienenfreundlichste Kommune Schleswig-Holsteins
 Wettbewerb Bienenfreundlichste Kommune Schleswig-Holsteins Städte und Dörfer als Paradiese für Bienen? Dipl.-Biol. Birte Pankau, 28.04.2015 luise/pixelio.de (o.l.; u. r.), Norbert Voigt (u.l.; o. r.) Hintergrund
Wettbewerb Bienenfreundlichste Kommune Schleswig-Holsteins Städte und Dörfer als Paradiese für Bienen? Dipl.-Biol. Birte Pankau, 28.04.2015 luise/pixelio.de (o.l.; u. r.), Norbert Voigt (u.l.; o. r.) Hintergrund
Steppen im öffentlichen Grün
 Verwendung von Steppenvegetation in Österreich Pannonische Steppenvegetation in Ostösterreich in Landschaft und Garten Landschaft Steppen im mitteleuropäischen Sinn (Begriffe, Charakteristik) Pannonische
Verwendung von Steppenvegetation in Österreich Pannonische Steppenvegetation in Ostösterreich in Landschaft und Garten Landschaft Steppen im mitteleuropäischen Sinn (Begriffe, Charakteristik) Pannonische
Die Hecke - unentbehrlicher Lebensraum für Neuntöter & Co. -
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Die Hecke - unentbehrlicher Lebensraum für Neuntöter & Co. - IAB 4a Sachgebiet Kulturlandschaft & Kulturlandschaftstag am 5. Oktober 2016 in Freising E. Schweiger
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Die Hecke - unentbehrlicher Lebensraum für Neuntöter & Co. - IAB 4a Sachgebiet Kulturlandschaft & Kulturlandschaftstag am 5. Oktober 2016 in Freising E. Schweiger
Neuer Botanischer Garten der Georg-August-Universität Göttingen
 1 Neuer Botanischer Garten der Georg-August-Universität Göttingen Eine Gärtnerisch/Botanische Fotodokumentation Aus dem Zeitraum 1 9 6 8-2 0 1 1 in S/W und Farbe Autor: Wolfram Richter, Dipl.-Ing. für
1 Neuer Botanischer Garten der Georg-August-Universität Göttingen Eine Gärtnerisch/Botanische Fotodokumentation Aus dem Zeitraum 1 9 6 8-2 0 1 1 in S/W und Farbe Autor: Wolfram Richter, Dipl.-Ing. für
Versorgung und Erreichbarkeit im ländlichen Raum Bewährte Pfade und neue Wege aus der Sicht der sächsischen Landesplanung
 Versorgung und Erreichbarkeit im ländlichen Raum Bewährte Pfade und neue Wege aus der Sicht der sächsischen Landesplanung Dr. Ludwig Scharmann Sächsisches Staatsministerium des Innern, Dresden Aktuell:
Versorgung und Erreichbarkeit im ländlichen Raum Bewährte Pfade und neue Wege aus der Sicht der sächsischen Landesplanung Dr. Ludwig Scharmann Sächsisches Staatsministerium des Innern, Dresden Aktuell:
Bienen und Biodiversität
 Bienen und Biodiversität Bienen und Biodiversität Eine der wichtigen Grundlagen für unser Ökosystem liegt in der Artenvielfalt der Insekten und der Pflanzenwelt. Dies System ist gestört und zum Teil bereits
Bienen und Biodiversität Bienen und Biodiversität Eine der wichtigen Grundlagen für unser Ökosystem liegt in der Artenvielfalt der Insekten und der Pflanzenwelt. Dies System ist gestört und zum Teil bereits
Wintersport und die Gefahren für die Natur
 Wintersport und die Gefahren für die Natur Winterzeit Wir befinden uns mitten im Winter. Es wird kälter, der Schnee kommt und die Tage werden kürzer. Das Landschaftsbild verändert sich: Die Bäume haben
Wintersport und die Gefahren für die Natur Winterzeit Wir befinden uns mitten im Winter. Es wird kälter, der Schnee kommt und die Tage werden kürzer. Das Landschaftsbild verändert sich: Die Bäume haben
Neues Wohnen im Alten Dorf
 Neues Wohnen im Alten Dorf Vortrag: Hartmut Kind, Büro SP PLUS, Bad Nauheim Mittelalterliche Stadtmauer Limes Römisches Kastell 2 Archäologische Funde Limeskastell Marköbel. Rekonstruiertes Mauerstück
Neues Wohnen im Alten Dorf Vortrag: Hartmut Kind, Büro SP PLUS, Bad Nauheim Mittelalterliche Stadtmauer Limes Römisches Kastell 2 Archäologische Funde Limeskastell Marköbel. Rekonstruiertes Mauerstück
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Wiese in Leichter Sprache
 Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Alternative Methoden
 Praxis naturnaher Gestaltung Grundlagen und Erfahrungen Was zeichnet ein naturnah gestaltetes Gelände aus? Ort zum Leben für uns Menschen: Renate Froese-Genz Fachbetrieb für naturnahe Grünplanung In dem
Praxis naturnaher Gestaltung Grundlagen und Erfahrungen Was zeichnet ein naturnah gestaltetes Gelände aus? Ort zum Leben für uns Menschen: Renate Froese-Genz Fachbetrieb für naturnahe Grünplanung In dem
Satzung über Werbeanlagen in der Stadt Kulmbach
 Satzung über Werbeanlagen in der Stadt Kulmbach Vom 2. Februar 1989 Die Stadt Kulmbach erlässt aufgrund von Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 Nr. 1 sowie Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 der Bayerischen Bauordnung
Satzung über Werbeanlagen in der Stadt Kulmbach Vom 2. Februar 1989 Die Stadt Kulmbach erlässt aufgrund von Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 Nr. 1 sowie Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 der Bayerischen Bauordnung
Potenziale und Herausforderungen für den Naturschutz in historischen Parkanlagen
 2. Fachsymposium Stadtgrün 11. - 12. Dezember 2013 in Berlin-Dahlem Potenziale und Herausforderungen für den Naturschutz in historischen Parkanlagen Dr. Moritz von der Lippe, Technische Universität Berlin
2. Fachsymposium Stadtgrün 11. - 12. Dezember 2013 in Berlin-Dahlem Potenziale und Herausforderungen für den Naturschutz in historischen Parkanlagen Dr. Moritz von der Lippe, Technische Universität Berlin
S T E I N - R E I C H
 S T E I N - R E I C H Über das Leben an Trockenmauern Abschlussarbeit Baubiologie / Bauökologie, Gerhard Stoll / Maloja, Sommer 2000 Angaben: Rote Bildlegenden: Bilder aus fremden Quellen Grüne Bildlegenden:
S T E I N - R E I C H Über das Leben an Trockenmauern Abschlussarbeit Baubiologie / Bauökologie, Gerhard Stoll / Maloja, Sommer 2000 Angaben: Rote Bildlegenden: Bilder aus fremden Quellen Grüne Bildlegenden:
Antrag auf Förderung der Wallheckenpflege
 An die Stadt Delmenhorst Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz Am Stadtwall 1 (Stadthaus) Telefon: (04221) 99-2889 27749 Delmenhorst Telefax: (04221) 99-1255 Antrag auf Förderung der Wallheckenpflege Grundstückseigentümer/-in:
An die Stadt Delmenhorst Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz Am Stadtwall 1 (Stadthaus) Telefon: (04221) 99-2889 27749 Delmenhorst Telefax: (04221) 99-1255 Antrag auf Förderung der Wallheckenpflege Grundstückseigentümer/-in:
Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Probstzella vom 09.01.1998 (Baumschutzsatzung)
 Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Probstzella vom 09.01.1998 (Baumschutzsatzung) Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella hat aufgrund des 17 Absatz 4 des Vorläufigen Thüringer Naturschutzgesetzes
Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Probstzella vom 09.01.1998 (Baumschutzsatzung) Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella hat aufgrund des 17 Absatz 4 des Vorläufigen Thüringer Naturschutzgesetzes
Artenschutz vers. Gehölzpflege?
 Artenschutz vers. Gehölzpflege? - Ein Jahr neues Bundesnaturschutzgesetz - Frühjahrstagung der Beratungskräfte des Obst- und Gartenbaus Horb am Neckar am 3. Mai 2011 1. Das Problem Neues Bundesnaturschutzgesetz
Artenschutz vers. Gehölzpflege? - Ein Jahr neues Bundesnaturschutzgesetz - Frühjahrstagung der Beratungskräfte des Obst- und Gartenbaus Horb am Neckar am 3. Mai 2011 1. Das Problem Neues Bundesnaturschutzgesetz
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Informationen 15. Exotische Gehölze
 Exotische Gehölze im KIRCHHEIMER-Arboretum Freiburg des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg mit 47 Farbaufnahmen von HELMUT PRIER Bearbeiter: HELMUT PRIER DIETHARD H. STORCH
Exotische Gehölze im KIRCHHEIMER-Arboretum Freiburg des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg mit 47 Farbaufnahmen von HELMUT PRIER Bearbeiter: HELMUT PRIER DIETHARD H. STORCH
Flora und Vegetation der Rheinaue Friemersheim 1
 Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 6.4 (2006): 1-6 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 6.4 (2006): 1-6 Flora und Vegetation der Rheinaue
Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 6.4 (2006): 1-6 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 6.4 (2006): 1-6 Flora und Vegetation der Rheinaue
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale
 Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Mathematik 16 Koordinatensystem 01 Name: Vorname: Datum:
 Mathematik 16 Koordinatensystem 01 Name: Vorname: Datum: Aufgabe 1: Gib an, wie gross der Temperaturunterschied ist: a) 90 C / 40 C: b) 75 C / 38 C: c) 82 C / 17 C: d) 42 C / 8 C: e) 33 C / 67 C: f) 21
Mathematik 16 Koordinatensystem 01 Name: Vorname: Datum: Aufgabe 1: Gib an, wie gross der Temperaturunterschied ist: a) 90 C / 40 C: b) 75 C / 38 C: c) 82 C / 17 C: d) 42 C / 8 C: e) 33 C / 67 C: f) 21
Themenweg/Lehrpfad. Sponheimer Weg. Schwierigkeit: Kondition: Technik: Bewertungen: Erlebnis: Landschaft: 1500 m. leicht (0)
 Themenweg/Lehrpfad STANDARD Beste Jahreszeit: (0) Länge: Höhenmeter: 94,5 km 1503 m Zeit: 1500 m 0:00 h J F M A M J Schwierigkeit: Kondition: Technik: leicht J A S O N D Geoinformationen und redaktionelle
Themenweg/Lehrpfad STANDARD Beste Jahreszeit: (0) Länge: Höhenmeter: 94,5 km 1503 m Zeit: 1500 m 0:00 h J F M A M J Schwierigkeit: Kondition: Technik: leicht J A S O N D Geoinformationen und redaktionelle
Solaranlage: Freiflächenanlage in Pfettrach, Gemeinde Attenkirchen
 Solaranlage: Freiflächenanlage in Pfettrach, Gemeinde Attenkirchen Solaranlagen erzeugen nicht nur auf den Dächern Strom, sondern auch auf den Feldern. Letztere heißen Photovoltaik-Freiflächensolaranlagen.
Solaranlage: Freiflächenanlage in Pfettrach, Gemeinde Attenkirchen Solaranlagen erzeugen nicht nur auf den Dächern Strom, sondern auch auf den Feldern. Letztere heißen Photovoltaik-Freiflächensolaranlagen.
IST DAS EIN BIOTOP ODER KANN DAS WEG? Biodiversität auf Gewerbeflächen fördern Natur wertschätzen
 IST DAS EIN BIOTOP ODER KANN DAS WEG? Biodiversität auf Gewerbeflächen fördern Natur wertschätzen IST DAS EIN BIOTOP ODER KANN DAS WEG? Natur ist schön Der Wert des besiedelten Raum für den Erhalt der
IST DAS EIN BIOTOP ODER KANN DAS WEG? Biodiversität auf Gewerbeflächen fördern Natur wertschätzen IST DAS EIN BIOTOP ODER KANN DAS WEG? Natur ist schön Der Wert des besiedelten Raum für den Erhalt der
Biodiversität und Unternehmen
 1.Treffen Kontaktnetzwerk Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 Dipl. - Ing. Peter Smeets Landschaftsarchitekt, BDLA Zehntwall 5-7 50374 Erftstadt 02235 / 685.359-0 kontakt@la-smeets.de Februar 2014 2
1.Treffen Kontaktnetzwerk Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 Dipl. - Ing. Peter Smeets Landschaftsarchitekt, BDLA Zehntwall 5-7 50374 Erftstadt 02235 / 685.359-0 kontakt@la-smeets.de Februar 2014 2
das ArtenFinder-Jahr 2016 widmet sich anknüpfend an den Meldeaufruf zu den Spätblühern Ende
 Frühlingserwachen Liebe Artenfinderinnen und Artenfinder, Neustadt, 12.02.2016 das ArtenFinder-Jahr 2016 widmet sich anknüpfend an den Meldeaufruf zu den Spätblühern Ende 2015 nun der Beobachtung und Erfassung
Frühlingserwachen Liebe Artenfinderinnen und Artenfinder, Neustadt, 12.02.2016 das ArtenFinder-Jahr 2016 widmet sich anknüpfend an den Meldeaufruf zu den Spätblühern Ende 2015 nun der Beobachtung und Erfassung
Natur im Tiergarten überraschend
 Natur im Tiergarten überraschend Prof. Dr. Ingo Kowarik & Institut für Ökologie der TU Berlin Lebensräume, auch für Tiere und Pflanzen Bäume, Gehölze, Säume Gewässer Rasen, Wiesen Foto N.A. Klöhn Historische
Natur im Tiergarten überraschend Prof. Dr. Ingo Kowarik & Institut für Ökologie der TU Berlin Lebensräume, auch für Tiere und Pflanzen Bäume, Gehölze, Säume Gewässer Rasen, Wiesen Foto N.A. Klöhn Historische
Kultur- und Lebensräume
 Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Anleitung Zweifluchtpunktperspektive
 Anleitung Zweifluchtpunktperspektive Schritt 1 Als erstes positioniert man einen Körper, z.b. ein Gebäude, auf der (grün). Um euch die Theorie der Zweifluchtpunktperspektive zu veranschaulichen, nehme
Anleitung Zweifluchtpunktperspektive Schritt 1 Als erstes positioniert man einen Körper, z.b. ein Gebäude, auf der (grün). Um euch die Theorie der Zweifluchtpunktperspektive zu veranschaulichen, nehme
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica
 Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgruine Hofen- Größte Burgruine Stuttgarts von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Stuttgart Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgruine Hofen- Größte Burgruine Stuttgarts von Frank Buchali Im Stuttgarter Vorort Hofen
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Stuttgart Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgruine Hofen- Größte Burgruine Stuttgarts von Frank Buchali Im Stuttgarter Vorort Hofen
Die Klimazonen der Erde
 Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Wohnen in der City. Zu vermieten: 10 City-Wohnungen und 2 Büros in Darmstadt, Bismarckstraße 18 20
 Wohnen in der City Zu vermieten: 10 City-Wohnungen und 2 Büros in Darmstadt, Bismarckstraße 18 20 2 Wohnen in der City Hochwertig und exklusiv Die gezeigten Abbildungen geben in Anlehnung an die geplante
Wohnen in der City Zu vermieten: 10 City-Wohnungen und 2 Büros in Darmstadt, Bismarckstraße 18 20 2 Wohnen in der City Hochwertig und exklusiv Die gezeigten Abbildungen geben in Anlehnung an die geplante
Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20
 Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20 (1) Jedes der 24 Teilquadrate grenzt an genau eine der acht Ecken. Da nach unserer Vorschrift die drei Teilquadrate an jeder Ecke unterschiedlich gefärbt sein
Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20 (1) Jedes der 24 Teilquadrate grenzt an genau eine der acht Ecken. Da nach unserer Vorschrift die drei Teilquadrate an jeder Ecke unterschiedlich gefärbt sein
Ökologie. basics. 103 Abbildungen 52 Tabellen. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart
 Ökologie 103 Abbildungen 52 Tabellen basics Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis 100* «HS- S>J.S(;HC LAN'f.:tS- UND \ Vorwort 8 1 Was ist Ökologie? 10 1.1 Teilgebiete der Ökologie 10 1.2 Geschichte
Ökologie 103 Abbildungen 52 Tabellen basics Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis 100* «HS- S>J.S(;HC LAN'f.:tS- UND \ Vorwort 8 1 Was ist Ökologie? 10 1.1 Teilgebiete der Ökologie 10 1.2 Geschichte
Kompetenzcheck Im Tropischen Regenwald
 1. Orientierungskompetenz b) Ich kann auf einer Weltkarte (stumme Karte) die Regionen einzeichnen, die Anteile am Tropischen Regenwald haben. Trage in die Weltkarte die Lage der heute noch eistierenden
1. Orientierungskompetenz b) Ich kann auf einer Weltkarte (stumme Karte) die Regionen einzeichnen, die Anteile am Tropischen Regenwald haben. Trage in die Weltkarte die Lage der heute noch eistierenden
Deutsche Nationalparke und Biosphärenreservate
 Deutsche Nationalparke und Biosphärenreservate Zur Bewahrung der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt sollen Schutzgebiete einen wesentlichen Beitrag leisten. Die aktuelle Deutschlandkarte verdeutlicht
Deutsche Nationalparke und Biosphärenreservate Zur Bewahrung der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt sollen Schutzgebiete einen wesentlichen Beitrag leisten. Die aktuelle Deutschlandkarte verdeutlicht
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen. Ruderale Mikrohabitate in Einzeldarstellungen 10 Unkrautfluren auf Viehweiden
 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Ruderale Mikrohabitate in Einzeldarstellungen 10 Unkrautfluren auf Viehweiden Prof. Dr. Dietmar Brandes 7. September 2012 Weideunkräuter
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Ruderale Mikrohabitate in Einzeldarstellungen 10 Unkrautfluren auf Viehweiden Prof. Dr. Dietmar Brandes 7. September 2012 Weideunkräuter
A n d e r B i e s e l h e i d e
 Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Glienicke / Nordbahn A n d e r B i e s e l h e i d e (Textbebauungsplan) Satzung Begründung gemäß 9(8) BauGB Textliche Festsetzungen gem. 9 BauGB i.v.m. BauNVO und 89
Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Glienicke / Nordbahn A n d e r B i e s e l h e i d e (Textbebauungsplan) Satzung Begründung gemäß 9(8) BauGB Textliche Festsetzungen gem. 9 BauGB i.v.m. BauNVO und 89
Frühlings- Quiz 2. Copyright 2006 Medienwerkstatt Mühlacker Verlagsgesellschaft mbh und deren Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
 Frühlings- Quiz 2 Ich bin ja mal sehr gespannt, wie gut du dich mit den Pflanzen in der Jahreszeit Frühling auskennst! Copyright 2007 Medienwerkstatt Mühlacker Verlagsgesellschaft mbh und deren Lizenzgeber.
Frühlings- Quiz 2 Ich bin ja mal sehr gespannt, wie gut du dich mit den Pflanzen in der Jahreszeit Frühling auskennst! Copyright 2007 Medienwerkstatt Mühlacker Verlagsgesellschaft mbh und deren Lizenzgeber.
Hänge am Schmoner Tal zwischen Schmon und Spielberg
 Hänge am Schmoner Tal zwischen Schmon und Spielberg Biologische Diversität auf Gesteinen des Röts mit interessanten Aufschlüssen A. Müller, 2015 Zwischen dem Weinort Freyburg an der Unstrut und dem Schmoner
Hänge am Schmoner Tal zwischen Schmon und Spielberg Biologische Diversität auf Gesteinen des Röts mit interessanten Aufschlüssen A. Müller, 2015 Zwischen dem Weinort Freyburg an der Unstrut und dem Schmoner
Flora des Inneren Thüringischen Beckens
 Flora des Inneren Thüringischen Beckens Dr. Gunter Löbnitz Angelika Gehlhaar Inhalt Geografie Klima Geologie und Böden Nutzung in der Geschichte und Gegenwart Lebensräume und Flora Projekt Bilderflora
Flora des Inneren Thüringischen Beckens Dr. Gunter Löbnitz Angelika Gehlhaar Inhalt Geografie Klima Geologie und Böden Nutzung in der Geschichte und Gegenwart Lebensräume und Flora Projekt Bilderflora
Burgen in Ostbayern, Teil 1 Donaustauf und Falkenstein
 Burgen in Ostbayern, Teil 1 Donaustauf und Falkenstein Das Regensburger Umland bietet viele lohnende Ziele für eine kleine Nachmittagsausfahrt. Dazu zählen unter anderem zahlreiche Burgen. Zwei dieser
Burgen in Ostbayern, Teil 1 Donaustauf und Falkenstein Das Regensburger Umland bietet viele lohnende Ziele für eine kleine Nachmittagsausfahrt. Dazu zählen unter anderem zahlreiche Burgen. Zwei dieser
Beetplan Insekten- & Schmetterlingsgarten
 Beetplan Insekten- & Schmetterlingsgarten Insekten- & Schmetterlingsgarten Der Insekten- und Schmetterlingsgarten ist ein wahres Paradies für Genießer, die sich an reich blühenden und duftenden Gehölzen
Beetplan Insekten- & Schmetterlingsgarten Insekten- & Schmetterlingsgarten Der Insekten- und Schmetterlingsgarten ist ein wahres Paradies für Genießer, die sich an reich blühenden und duftenden Gehölzen
Biotopverbundplanung auf regionaler Ebene für ausgewählte, vom Klimawandel betroffener Arten
 Biodiversität und Klimawandel -Vernetzung der Akteure -in Deutschland VII vom 29.08 bis 01.09.2010 -BFN-Internat. Naturschutzakademie Insel Vilm Biotopverbundplanung auf regionaler Ebene für ausgewählte,
Biodiversität und Klimawandel -Vernetzung der Akteure -in Deutschland VII vom 29.08 bis 01.09.2010 -BFN-Internat. Naturschutzakademie Insel Vilm Biotopverbundplanung auf regionaler Ebene für ausgewählte,
Schulinternes Curriculum Geschichte, Jahrgang 7
 Wilhelm-Gymnasium Fachgruppe Geschichte Schulinternes Curriculum Jg. 7 Seite 1 von 5 Schulinternes Curriculum Geschichte, Jahrgang 7 Hoch- und Spätmittelalter / Renaissance, Humanismus, Entdeckungsreisen
Wilhelm-Gymnasium Fachgruppe Geschichte Schulinternes Curriculum Jg. 7 Seite 1 von 5 Schulinternes Curriculum Geschichte, Jahrgang 7 Hoch- und Spätmittelalter / Renaissance, Humanismus, Entdeckungsreisen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten
 1 Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten in Deutschland, Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen und den Regionen Nordrhein-Westfalens 199-008 Sozialversicherungspflichtig
1 Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten in Deutschland, Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen und den Regionen Nordrhein-Westfalens 199-008 Sozialversicherungspflichtig
G e m e i n d e v e r o r d n u n g
 G e m e i n d e v e r o r d n u n g zum Schutze des Bestandes an Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde Bad Füssing (Baumschutz-Verordnung) Auf Grund des Art.
G e m e i n d e v e r o r d n u n g zum Schutze des Bestandes an Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde Bad Füssing (Baumschutz-Verordnung) Auf Grund des Art.
Agrarförderung in Hessen und wie sie in benachteiligten Regionen wie dem Odenwald ankommt
 Agrarförderung in Hessen und wie sie in benachteiligten Regionen wie dem Odenwald ankommt In Hessen sind rund 23.000 landwirtschaftliche Betriebe in der Statistik der Agrarförderung 2007/2008 erfasst und
Agrarförderung in Hessen und wie sie in benachteiligten Regionen wie dem Odenwald ankommt In Hessen sind rund 23.000 landwirtschaftliche Betriebe in der Statistik der Agrarförderung 2007/2008 erfasst und
Wie kann ich die Hangneigung meiner Grünland-, Acker-, Obst- und Weinbauflächen berechnen?
 Wie kann ich die Hangneigung meiner Grünland-, Acker-, Obst- und Weinbauflächen berechnen? Warum ist es wichtig, die Hangneigung der eigenen Flächen zu kennen? Die Kenntnis der Hangneigung der eigenen
Wie kann ich die Hangneigung meiner Grünland-, Acker-, Obst- und Weinbauflächen berechnen? Warum ist es wichtig, die Hangneigung der eigenen Flächen zu kennen? Die Kenntnis der Hangneigung der eigenen
Das Wappen Freisewinkel
 Das Wappen Freisewinkel gestiftet von Stephan Freisewinkel im Jahr 2008 Familienforschung-Freisewinkel 2013 Autor: Christian F. Seidler Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung
Das Wappen Freisewinkel gestiftet von Stephan Freisewinkel im Jahr 2008 Familienforschung-Freisewinkel 2013 Autor: Christian F. Seidler Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung
Heinz Sielmann Stiftung und Industrie-und und Handelskammer Braunschweig
 Naturidyll auf dem Firmengelände Wie geht das? - Unternehmerfrühstück in Braunschweig - Vortrag am 26. August 2015 für Heinz Sielmann Stiftung und Industrie-und und Handelskammer Braunschweig Im Rahmen
Naturidyll auf dem Firmengelände Wie geht das? - Unternehmerfrühstück in Braunschweig - Vortrag am 26. August 2015 für Heinz Sielmann Stiftung und Industrie-und und Handelskammer Braunschweig Im Rahmen
Streuobstwiesenschutz Gemeinsam mehr erreichen. Foto: G. Hein
 Streuobstwiesenschutz Gemeinsam mehr erreichen Foto: G. Hein Kulturbiotop Streuobstwiese Hochstamm-Obstbäume und Grünland, extensiv genutzt Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz Lebensraum Streuobstwiese Streuobstwiese
Streuobstwiesenschutz Gemeinsam mehr erreichen Foto: G. Hein Kulturbiotop Streuobstwiese Hochstamm-Obstbäume und Grünland, extensiv genutzt Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz Lebensraum Streuobstwiese Streuobstwiese
