Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden
|
|
|
- Sabine Fuchs
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden Projektbericht 2001 bis Thomas Reich, Reinhard Lässig und Thomas Wohlgemuth Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
2
3 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden Projektbericht 2001 bis Thomas Reich, Reinhard Lässig und Thomas Wohlgemuth Herausgeber Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
4 Verantwortlich für die Herausgabe: Prof. Dr. James Kirchner, Direktor Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Adresse der Autoren: Thomas Reich, Dr. Reinhard Lässig 1, Dr. Thomas Wohlgemuth 2 Eidg. Forschungsanstalt WSL, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf 1 Projektleitung Projektleitung 2010 Alle Fotos ohne Autorangabe stammen von Thomas Reich. Wir danken Christoph Angst für die Konzeption der Datenaufnahmen und für die Durchführung der ersten beiden Felderhebungen. Dank gebührt auch Daniela Csenscics, Andrea Walther, Sabrina Baumann, Christoph Hester und Evelyne Schnider, die uns als Praktikantinnen und Praktikanten jeweils für eine Saison bei den Datenaufnahmen unterstützten. Nicht vergessen möchten wir die zahlreichen anderen Personen, die für kürzere oder längere Zeit bei den Feldaufnahmen mithalfen: Hansheinrich Bachofen, Heidi Breuss, Enrico Cereghetti, Christian Hofmann, Lorenz Hübner, Daniel Köchli, Vasyl Lavny, Christan Matter, Yvonne Merki, Peter Schweizer, Stephanie Toepperwien, Christoph Weidmann. Wir danken den Vertretern des Amtes für Wald und Landschaft des Kantons Obwalden für die gute Zusammenarbeit sowie der Teilsame Lungern-Obsee, in deren Wald die Forschungen stattgefunden haben. Wir danken Andreas Rigling für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts. Das Forschungsprojekt wurde mit Geldern des Reservatsfonds finanziert, der durch das Bundesamt für Umwelt BAFU gespiesen wird. Zitierung: REICH, T.; LÄSSIG, R.; WOHLGEMUTH, T., 2010: Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden. Projektbericht 2001 bis. [Published online ] Available from World Wide Web < Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. 42 S. [pdf] Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorf, 2010 Umschlag von oben nach unten: Windwurffläche 6 Jahre nach dem Sturm (Foto: Christoph Angst) lebende Fichte inmitten abgestorbener Bergföhren (Foto: Thomas Reich) Stichprobenpunkt im Baumverhau (Foto: Christoph Angst) Datenaufnahme (Foto: Thomas Reich) Fichtenverjüngung auf Wurzelteller (Foto: Thomas Reich)
5 Reich, T.; Lässig, R.; Wohlgemuth, T. 2010: Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden. Projektbericht 2001 bis. [Published online ] Available from World Wide Web < Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. 42 S. [pdf] Abstract Forest dynamics after windthrow in the Rorwald preserve, canton Obwalden In December 1999, the winter storm Lothar blew down many stands of Norway spruce (Picea abies) and mountain pine (Pinus mugo) in the Rorwald preserve, an extensive forest area in the canton Obwalden. During the following years spruce bark beetle (Ips typographus) rapidly spread from damaged areas. From 2001 to the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL monitored the forest dynamics on an area of 107 ha using 142 sample plots. In open places where trees were uprooted or broken by the storm, regeneration was generally quick despite a high browsing rate. In detail, rowan (Sorbus aucuparia) and other deciduous tree species could profit from improved light conditions. Nevertheless, numbers show marked differences with respect to sites mirroring the importance of soil properties, micro-relief and advance regeneration. The future forest may be structurally diverse due to the spatio-temporally highly varying sapling growth. Roe deer, red deer and chamois cannot hinder tree regeneration on large windthrow areas. However, the combination of selective browsing by these animals and the different growth properties of tree species influence the composition of the next forest generation. Dead wood is an important substrate for the germination and early growth of Norway spruce. This holds especially for moist and wet places, where rapidly growing dense tall herbs generally shade out tree saplings. Tree regeneration is still sparse in mountain pine stands that had died from bark beetle attacks. In these stands, site conditions are wet and tree regeneration needs clearly more time than on moist or welldrained substrates. In the centre zone of the forest preserve, where no post-windthrow sanitation logging took place, roughly 40% of the standing Norway spruce and 75% of the standing mountain pines died from spruce bark beetle. The bark beetle gradation culminated in Afterwards, the number of new attacks rapidly decreased, and since, tree mortality was very low. Keywords: windthrow, forest preserve, tree regeneration, forest rejuvenation, spruce bark beetle, Ips typographus, ungulate browsing
6 Reich, T.; Lässig, R.; Wohlgemuth, T. 2010: Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden. Projektbericht 2001 bis. [Published online ] Available from World Wide Web < Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. 42 S. [pdf] Abstract Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald, Kanton Obwalden Im Dezember 1999 warf der Orkan Lothar im Rorwald viele Waldbestände. In den Folgejahren entwickelte sich in den vom Sturm geschädigten Fichten- und Bergföhrenwäldern eine starke Massenvermehrung des Buchdruckers (Ips typographus). Von 2001 bis untersuchte die Eidg. Forschungsanstalt WSL die Waldentwicklung im neu geschaffenen Waldresrevat auf einer Fläche von 107 ha mit 142 Stichprobenflächen. Die Wiederbewaldung schreitet auf den lichtdurchfluteten Sturmflächen trotz hohem Verbissdruck grundsätzlich schnell voran. Insbesondere die Vogelbeere und andere Laubgehölze profitieren vom erhöhten Lichtangebot. Die Verjüngungszahlen zeigen jedoch grosse standörtliche Unterschiede, die hauptsächlich von der Beschaffenheit des Waldbodens, vom kleinstandörtlichen Relief und von der Vorverjüngung bestimmt werden. Die zeitlich und räumlich gestaffelte Wiederbewaldung erhöht die Strukturvielfalt des zukünftigen Waldes. Reh, Hirsch und Gämse verhindern die Wiederbewaldung auf grossen Sturmflächen nicht. Das selektive Äsungsverhalten des Schalenwildes beeinflusst aber in Kombination mit der unterschiedlichen Wuchskraft der Baumarten die Zusammensetzung der zukünftigen Waldbestände. Für die Fichtenverjüngung ist Moderholz ein bedeutsamer Keimstandort. Vor allem auf vernässten Flächen mit dichter Krautvegetation ist Totholz für die Wiederbewaldung unabdingbar. 10 Jahre nach dem Sturm gibt es in den durch Borkenkäfer flächig abgestorbenen Bergföhrenwäldern noch kaum junge Bäume. An diesen Standorten braucht die Wiederbewaldung mehr Zeit als auf den übrigen Flächen. In der Kernzone des Waldreservats, in der keine forstlichen Eingriffe stattfanden, sind rund 40% der nach dem Sturm stehen gebliebenen Fichten und 75% der Bergföhren durch Borkenkäferbefall abgestorben. Die Massenvermehrung des Käfers erreichte 2003 ihren Höhepunkt. Danach ist der Neubefall von Bäumen schnell zurückgegangen, und seit starben kaum noch Altbäume ab. Keywords: Windwurf, Naturwaldreservat, Wiederbewaldung, Waldverjüngung, Borkenkäfer, Ips typographus, Wildverbiss
7 Inhalt Abstract Entstehung des Projekts Der Rorwald Lage und Waldgesellschaften Nutzungsgeschichte Besonderheiten Methoden Stichprobennetz Probekreise Totalschadenflächen und Streuschadenflächen Ergebnisse mit Erläuterungen Definitionen und Bemerkungen Baumverjüngung Wildverbiss Vorrat, stehendes Totholz und Todesursachen Vegetationsentwicklung Ergebnisse aus anderen Untersuchungen im Rorwald Borkenkäfer-Monitoring (Forster 2006) Nahrungsangebot und Nahrungsnutzung von Huftieren (Weber et al. 2006) Erhebung der Kleinsäuger (Sjusko et al., unpubl.) Inventar der Avifauna (Mollet 2004) Diskussion Borkenkäferbefall Wiederbewaldung Literatur / Publikationen / Berichte... 41
8 6 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald 1 Entstehung des Projekts Der Rorwald ist dank seiner Abgeschiedenheit und fehlender Erschliessung seit über einem Jahrhundert nur noch sporadisch und extensiv genutzt worden. Er ist reich an seltenen Waldgesellschaften, Tier- und Pflanzenarten regte der Unterwaldner Bund für Naturschutz (UBN), heute Pro Natura Unterwalden, eine Schutz- und Nutzungsplanung für den Rorwald an. Mit einer Naturraumanalyse wollte man die Grundlagen dafür schaffen, die Nutzungskonflikte möglichst zu Gunsten des Naturschutzes zu lösen. Die umfangreiche Schutz- und Nutzungsplanung Rorwald wurde durch die Büros Oeko-B AG, UNA und UTAS AG durchgeführt und im Sommer 1997 abgeschlossen (Grunder et. al 1997). Am 26. Dezember 1999 warf der Sturm Lothar im Rorwald schätzungsweise 20'000 m 3 Holz. Es entstanden nebst vielen Streuwürfen auch zwei grössere Windwurfflächen. Insgesamt beträgt die Fläche aller Windwürfe 27 Hektaren. Das Schadenausmass beschleunigte die bereits vor dem Sturm bestehende Idee, den Rorwald als Waldreservat auszuscheiden. Im Herbst 2000 schloss der Kanton Obwalden mit der Waldeigentümerin, der Teilsame Lungern-Obsee, und der kantonalen Sektion von Pro Natura eine Vereinbarung über das 200 ha grosse Waldreservat Rorwald am Glaubenbüelenpass (Abb. 1). Dieses umfasst das eigentliche Naturwaldreservat samt Hoch-, Übergangs- und Flachmooren von nationaler Bedeutung (80 ha), eine Sonderwaldreservatszone (27 ha) sowie einen Waldgürtel mit besonderer Schutzfunktion (93 ha). Naturwald Sonderwald Wald mit besonderer Schutzfunktion Projektperimeter Reservatsgrenze Abb. 1: Das Waldreservat Rorwald. Im Jahr 2000 entwickelte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) im Auftrag des Kantons Obwalden im Rorwald ein Forschungsprojekt, das durch den vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) gespiesenen Reservatsfonds finanziert wurde. Hauptziel des Projekts war die Beobachtung der Waldentwicklung während der ersten zehn Jahre nach dem Sturm. Der Vertrag zwischen der WSL und der Rorwaldkommission - bestehend aus der Teilsame Lungern- Obsee, dem Amt für Wald und Landschaft Obwalden und Pro Natura - deckte die Periode von 2001 bis 2010 ab. Die WSL dokumentierte in dieser Zeit mittels regelmässiger Datenerhebungen und
9 Reich, T. et al Beobachtungen die Waldentwicklung im Natur- und Sonderwaldreservat (107 ha). Der Schwerpunkt lag bei der Waldverjüngung auf den Windwurfflächen. Daneben fand ein Borkenkäfer-Monitoring, eine Dissertation zur Nahrungsnutzung von Schalenwild sowie eine Erhebung der Kleinsäugetiere statt. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach erstellte im Auftrag des Kantons Obwalden auf dem selben Perimeter ein Inventar der Avifauna. Das Projekt im Rorwald ergänzte die Lothar-Forschung der WSL, die hauptsächlich in tiefen Lagen stattfand. Die hier dargestellten Resultate reihen sich in die WSL-Windwurffoschung ein, die Erkenntnisse aus mehreren Untersuchungsgebieten zu den Stürmen Vivian (Februar 1990) und Lothar (Dezember 1999) erarbeitet. 2 Der Rorwald Dieses Kapitel beruht im Wesentlichen auf der Schutz- und Nutzungsplanung Rorwald (Grunder et al. 1997). 2.1 Lage und Waldgesellschaften Das Waldreservat Rorwald liegt in der Gemeinde Giswil nördlich der Strasse über den Glaubenbielenpass auf einem mässig nach Südosten geneigten Hang auf einer Höhe von 1200 bis 1560 m ü. M.. Es gehört zum Einzugsgebiet der Giswiler Laui und ist zu drei Seiten von tiefen, steil abfallenden, erodierenden Gräben umgeben. Im oberen Teil grenzt das Reservat an Alpweiden und Riedwiesen, die mit dem Bergwald stark verzahnt sind. Die offenen Gebiete bestehen mehrheitlich aus Flach-, Hangund Hochmooren. Die geologische Unterlage ist fast überall Flysch. Der Rorwald kann als eigentlicher Kern des Giswiler Flyschgebietes bezeichnet werden. Auf trockenen Kuppenlagen gibt es mittelgründige Podsolböden, an den Bacheinhängen, die in ständiger Bewegung sind, herrschen Rohböden vor. Abb 2: Blick von der Strasse am Glaubenbielenpass auf den Rorwald im August. Zwischen Pilatus und Giswiler Stock wachsen vergleichbare Wälder auf ähnlichen Standorten. Die Wälder dort sind jedoch besser erschlossen oder viel dichter mit Alpweiden durchsetzt. Vor dem Windwurf Lothar war der Rorwald ein geschlossener, strukturreicher Nadelwald. Folgende Waldgesellschaften kommen vor: Abb. 3: Im Rorwald gibt es über 30 Hektaren Torfmoos-Bergföhrenwälder.
10 8 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Tab. 1: Waldgesellschaften im Rorwald. Bezeichnung nach Ellenberg und Klötzli (1972) Nummer Anteil Typischer Tannen Buchenwald 18 1 % Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald 46 1 % Schachtelhalm-Tannenmischwald % Alpendost-Fichten-Tannenmischwald 50 8 % Subalpiner Fichtenwald mit Torfmoos % Subalpiner Fichtenwald mit Heidelbeere 57* 6 % Torfmoos-Bergföhrenwald % diverse Pioniergesellschaften (insb. Weisserlenbestände) 5 % Rund die Hälfte der Reservatfläche besteht aus Wäldern auf sauren Böden mit Rohhumusauflage (Tab. 1: 46, 57*, 57, 71), die aus Sicht des Naturschutzes als wertvoll gelten. Die Rohhumusauflage belegt, dass diese Bestände seit Jahrtausenden keinen schnellen Bodenbewegungen unterworfen waren und deshalb nicht erosionsgefährdet sind. Je ein Viertel der Bestände besteht aus Fichten- Tannenwäldern (49, 50) und aus Mischwäldern mit Laubholz, wobei Pioniergesellschaften an Bacheinhängen die Mehrheit darstellen. In den beiden Reservattypen sind die Waldgesellschaften etwas unterschiedlich verteilt (Abb. 5). Im Naturwaldreservat gibt es besonders viele Wälder auf Moorboden. Abb. 4: In den tieferen Lagen wachsen reine Weisserlen-Bestände, die als Pioniergesellschaft kartiert sind. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sonderwald Naturwald diverse Pioniergesellschaften Torfmoos-Bergföhrenwald Typischer Tannen-Buchenwald Schachtelhalm-Tannenmischwald Alpendost-Fichten-Tannenmischwald Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald Subalpiner Fichtenwald mit Heidelbeere Subalpiner Fichtenwald mit Torfmoos Abb. 5: Waldgesellschaften nach Reservattyp (Flächenanteile anhand der Stichprobenpunkte). Zu Beginn des Projekts im Jahr 2001 waren die wichtigsten Baumarten Fichte (68% des Lebendvorrats), Bergföhre (24%) und Weisstanne (6%).
11 Reich, T. et al Nutzungsgeschichte Der Rorwald wird in einem Kaufbrief von 1639 zum ersten Mal erwähnt. Damals erwarb die Teilsame Lungern-Obsee das Waldgebiet, das noch heute in ihrem Besitz ist. Wegen seiner abgelegenen Lage war der Rorwald als Holzlieferant von untergeordneter Bedeutung. Vor 1912 sind nur vereinzelte Holznutzungen bekannt. Der Rorwald wurde hingegen als Weideland für Kühe, Rinder, Schafe und Pferde sehr stark genutzt. Daneben gab es verschiedene Kohlplätze, wo unter anderem aus Erlenholz Holzkohle hergestellt wurde. Auch Streunutzung ist belegt. Zudem wurden Pilze und Beeren in grossen Mengen gesammelt. Abb. 6: Holz-Reist-Brücke über den Rorgraben, gebaut im Jahre Foto: Amt für Wald und Landschaft Obwalden Um 1900 stieg die Nachfrage nach Holz an. Zwischen 1912 und 1919 wurden schätzungsweise 3500 m 3 Holz genutzt und mit Hilfe raffinierter Holzkonstruktionen über die tiefen Bachtobel abtransportiert (Abb. 6) legte man auf dem Hochmoorplateau oberhalb Rorzopf Entwässerungsgräben an, um die Produktivität des Bodens zu erhöhen. Diese Gräben wachsen seit Jahrzehnten langsam zu, sind aber noch heute im Gelände sichtbar. Von 1919 bis 1940 sind keine Holznutzungen bekannt. Hingegen fand 1929 eine erste Inventur mittels Vollkluppierung statt. Daraus ergab sich ein Stehendvorrat von 219 m 3 /ha (Tab. 2). Ab 1940 erfolgte unter dem Druck der Kriegswirtschaft eine zweite Nutzungsperiode im Rorwald. Zu dieser Zeit entstand im Rorzopf eine stattliche Holzerhütte, die 1960 an den heutigen Standort versetzt wurde. Zwischen 1940 und 1951 schlugen die Forstleute zirka 9000 m 3 Holz. Eine erneute Vollkluppierung ergab 1956 einen Vorrat von 200 m 3 /ha. Die dritte und bisher letzte Nutzung erfolgte 1958/1959. In den beiden Jahren wurden 2100 m 3 Holz aufgerüstet. Insgesamt wurden zwischen ca und 1960 auf einer Fläche von 120 Hektaren rund m 3 Holz genutzt. Zwischen 1961 und 1973 wurden in einer Blösse oberhalb der Holzerhütte ca Fichten und Weisserlen gepflanzt. Eine dritte Vorratserhebung, dieses Mal als Stichprobeninventur, ergab m 3 /ha. Tab. 2: Lebendvorrat im Rorwald im Laufe der Zeit. Jahr Vorrat (sv/ha, TFM/ha, ~m 3 /ha) ermittelt durch Vollkluppierung Vollkluppierung Stichprobeninventur Stichprobeninventur WSL Stichprobeninventur WSL Stichprobeninventur WSL 1 Grunder et al. (1997) 2 Bäume ab BHD 16cm, mit Windwurfflächen, Abb. 38
12 10 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald 2.3 Besonderheiten Der Rorwald ist eines der wenigen Gebiete in Obwalden, die grossflächig unerschlossen sind. Dank seiner Abgeschiedenheit und fehlender Erschliessung wurde seit über einem Jahrhundert nur noch sporadisch und extensiv Holz genutzt (durchschnittliche Nutzung 1,7 m 3 pro Hektare und Jahr, seit 1959 keine Nutzungen mehr). Auf diese Weise konnte sich eine in der Schweiz selten gewordene Urtümlichkeit erhalten respektive neu entwickeln. Weil es keine Forststrassen und kaum Wege gibt, und weil das Gebiet zu drei Seiten von tiefen Gräben umgeben ist, wird der Rorwald nur selten von Menschen begangen. Deshalb finden hier störungsempfindliche Tiere noch ihre nötige Ruhe. Der Rorwald ist diesbezüglich im Kanton Obwalden das wichtigste Gebiet. Er ist deshalb aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes eines der wertvollsten Waldgebiete im Kanton. Grosse Bedeutung hat der Rorwald speziell für die Avifauna, insbesondere für Rauhfusshühner. Auch der Schalenwildbestand (Reh, Hirsch, Gämse) ist überdurchschnittlich. Abb. 7: Kleinseggenriede, oft eng mit dem Wald verzahnt, beherbergen viele Tier- und Pflanzenarten. Der Rorwald ist Teil einer Moorlandschaft von nationaler Bedeutung, bestehend aus einem Mosaik von Flach- und Hochmooren, Wald, Gehölzen und Zwergstrauchbeständen. Besonders erwähnenswert sind die ausgedehnten Torfmoos- Bergföhren-Wälder sowie die zahlreichen Kleinseggenriede. Durch den Windwurf ist der Anteil an Totholz enorm gestiegen, was den Rorwald auch in dieser Hinsicht aussergewöhnlich macht. Abb. 8: Das stark gefährdete Auerhuhn findet im Rorwald einen sehr guten Lebensraum. Foto: Chris van Rijswijk, Über den Rorwald sind viele Informationen vorhanden. Die Geschichte des Rorwaldes wurde von Franz Bürgi, ehemaliger Förster von Lungern, mit viel Liebe zum Detail festgehalten (Bürgi 1994). Einen umfassenden Überblick gibt die Schutz- und Nutzungsplanung Rorwald von Grunder et al. (1997). In den vergangenen Jahren sind im Zuge des WSL- Forschungsprojektes Datensätze zu verschiedenen Themen dazu gekommen (siehe Kap. 4 und 5). Dies dürfte den Rorwald auch in Zukunft zu einem begehrten Forschungsobjekt machen. 3 Methoden Die Datenerhebung und die Wahl der Aufnahme-Parameter lehnen sich stark an die Methode der WSL- Rahmenprojekte Vivian und Lothar sowie an das zweite Landesforstinventar (LFI2) an. Ein ausführlicher Methodenbeschrieb findet sich in der Zusammenstellung Methode der Erhebungen (Reich und Angst 2003).
13 Reich, T. et al Stichprobennetz Die Felderhebungen erfolgten auf 95 Stichprobeflächen, die auf einem regelmässigen Raster im Abstand von 100 m angeordnet sind. Zusätzlich haben wir die beiden grossen Windwurfflächen mit drei verdichteten Stichproben-Blöcken genauer untersucht. Die 47 verdichteten Probeflächen haben einen Abstand von 20 m (Abb. 9 und 10, Tab. 3). Alle Stichprobenpunkte wurden mittels GPS eingemessen. Sie sind mit Aluminiumpflöcken und Holzpfosten markiert (Abb. 11). Die Holzpfosten waren im Sommer bei den meisten Punkte noch vorhanden und in recht gutem Zustand. Naturwald Sonderwald Stichprobennetz 100 m Stichprobenblöcke 20 m grosse Windwurfflächen Abb. 9: Schematische Darstellung der Stichprobenflächen im Projektperimeter. Tab. 3: Stichprobentypen im Rorwald reguläres Stichprobennetz verdichtete Stichprobenblöcke Abstand zwischen den Stichproben 100 m 20 m Anzahl Stichproben Anzahl Stichproben auf Totalschadenflächen Anzahl Stichproben im Naturwaldreservat Nummerierung bis A1 bis O4
14 12 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Abb. 10: Beschriftung der Stichprobenpunkte: Ausschnitt aus dem Luftbild Rorwald. Abb. 11: Der Stichprobenpunkt G1 im Jahr Foto: Christoph Angst 3.2 Probekreise Die Datenerhebungen fanden innerhalb kreisförmiger Stichprobenflächen statt. Die Aufnahme der Bäume erfolgte dabei in zwei konzentrischen Probekreisen. Im kleineren Kreis mit 30 m 2 Horizontalfläche massen wir alle Bäume ab 20 cm Höhe bis 12 cm Brusthöhendurchmesser. Im grösseren Kreis mit 500 m 2 Horizontalfläche erhoben wir alle Bäume über 12 cm BHD sowie verschiedene Parameter zu Waldstruktur (Abb. 12).
15 Reich, T. et al m² Bäume bis BHD 12 cm wurden aufgenommen 500 m2 Bäume mit BHD 12 cm wurden aufgenommen Abb. 12: Schema der Probekreise: nur die rot gefärbten Bäume wurden berücksichtigt. 3.3 Totalschadenflächen und Streuschadenflächen Der Sturm Lothar hat nicht im ganzen Rorwald gleich starke Schäden hinterlassen. Aus diesem Grund unterscheiden wir Stichprobenflächen mit Totalschaden und solche mit Streuschäden. Als Streuschaden gilt eine Windwurffläche, die kleiner als 0,25 Hektaren ist. Stichproben ohne Sturmschäden werden zu den Streuschadenflächen gezählt (Abb. 13). In den beiden Reservatstypen sind die Sturmschäden nicht gleich verteilt, weil das Naturwaldresrevat speziell in Zonen mit grossen Sturmschäden gelegt wurde (Abb. 14). Abb. 13: Ausschnitt aus dem Luftbild Rorwald: Totalschadenflächen (> 0.25 ha) in roter und Streuschäden (< 0.25 ha) in blauer Schraffur.
16 14 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald 100% 80% 60% 40% Totalschaden Streuschaden 20% 0% Sonderwald Naturwald Abb. 14: Schadensintensität auf den Probeflächen nach Reservatstyp. 4 Ergebnisse mit Erläuterungen Definitionen und Bemerkungen Im Rorwald verstehen wir unter "Verjüngung" alle Bäumchen zwischen 20 und 300 cm Höhe. Wo nicht speziell bezeichnet dienen die Punkte des 100-m-Stichprobennetzes als Datengrundlage. Zur Berechnung des Vorrates diente der Massentarif aus dem Wirtschaftsplan Rorwald (Stehli und Giss (1979), S. 42). Dieser Massentarif berücksichtigt alle Bäume ab BHD 16. Die ersten Datenaufnahmen im Jahr 2001 fanden auf drei Probekreisen statt, was sich jedoch als zu zeitaufwändig erwies. Der Wechsel zu zwei Probekreisen führte zu deutlichen Abweichungen bei der Berechnung des Holzvorrates. Aus diesem Grund passten wir den Vorrat des Jahres 2001 an denjenigen von 2003 an. Der daraus resultierende Fehler dürfte gering sein, weil bis 2003 praktisch noch keine stehenden Bäume umgefallen waren. Während der Datenaufnahme im Sommer 2003 fällte der lokale Forstdienst zur Borkenkäferbekämpfung viele Bäume. Aus diesem Grund verzichteten wir in diesem Jahr auf eine Datenerhebung in diesem Gebiet. Demzufolge sind im Jahr 2003 nur für das Naturwaldreservat Aussagen möglich. haben wir aus Spargründen keine Messung des Brusthöhendurchmessers durchgeführt. Die Vorräte des Jahres wurden interpoliert. Die vertikalen Balken in den Diagrammen geben den Standardfehler (SE) des Mittelwertes an
17 N/ha N/ha Reich, T. et al Baumverjüngung Die Verjüngungszahl hat sowohl im ganzen Projektperimeter (Abb. 16) als auch im Naturwaldreservat (Abb. 17) seit 2001 stetig zugenommen. Besonders markant war der Anstieg der jungen Vogelbeeren (Abb. 18 und 19). Nachdem sich deren Anzahl zwischen 2001 und 2003 sowie zwischen 2003 und im Naturwaldreservat noch verdoppelte, hat sich der Prozess danach deutlich verlangsamt (Abb. 19). In den letzten Jahren hat der Anteil der Weichhölzer Weide, Birke oder Weisserle stark zugenommen. Abb. 15: Von 2001 bis hat die Zahl der Weichhölzer stetig zugenommen. Im Bild eine junge Moorbirke Sträucher übriges Laubholz Birken Weiden Weisserle Vogelbeere Tanne/Bergföhre Fichte Abb. 16: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Jahr wurden nicht genügend Daten erhoben Sträucher übriges Laubholz Birken Weiden Weisserle Vogelbeere Tanne/Bergföhre Fichte Abb. 17: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Naturwaldreservat nach Jahr.
18 Fichte Tanne/Bergföhre Vogelbeere Weisserle Weiden Birken übriges Laubholz Sträucher N/ha Fichte Tanne/Bergföhre Vogelbeere Weisserle Weiden Birken übriges Laubholz Sträucher N/ha 16 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Abb. 18: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Baumart wurden nicht genügend Daten erhoben Abb. 19: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Naturwaldreservat nach Baumart. Im Naturwaldreservat war die Baumverjüngung kurz nach dem Sturm Lothar deutlich weniger zahlreich als im Sonderwaldresevat (Faktor 1.49; Tab. 4). Im Verlauf der Jahre hat sich der Unterschied zwischen den beiden Reservatteilen verringert (ab Faktor 1.11).
19 Reich, T. et al Tab. 4: Verjüngungszahlen (Stammzahl/ha) von 2001 bis (alle Baumarten). Jahr Naturwaldreservat Projektperimeter Faktor zu wenig Daten Die Nivellierung der Verjüngung 10 Jahre nach dem Windwurf hängt mit dem erhöhten Lichtangebot zusammen, das vor allem im Naturwaldreservat charakteristisch war und wovon besonders die Vogelbeere profitierte. Diese Baumart hat die dort grösste Stammzahlzunahme zu verzeichnen (Abb. 17), und in den Probekreisen mit Totalschaden dominierte sie (Abb. 25). Die Unterschiede zwischen dem Naturwald- und dem Sonderwaldreservat können durch drei Faktoren erklärt werden: 1) Das Naturwaldreservat ist höher gelegen als das Sonderwaldreservat. Mit zunehmender Meereshöhe nimmt die Verjüngungsdichte leicht, aber signifikant ab (R 2 =0.10; p=0.002; Abb. 23a). 2) Rund ein Drittel der Stichprobenpunkte des Naturwaldreservats liegen im feuchten Torfmoos- Bergföhrenwald (Abb. 5), wo die Verjüngungsbedingungen für die meisten Baumarten generell ungünstig sind. Im Sonderwaldreservat fehlen Torfmoos-Bergföhrenwälder. 3) Der Anteil der Totalschadenflächen ist im Naturwaldreservat mit 40% wesentlich grösser als im Sonderwaldreservat (Abb. 14). Generell war die Verjüngungsdichte während der ganzen Beobachtungszeit auf Totalschadenflächen geringer als in Streuschadenflächen (Abb. 25). Bäume unter 20 cm Im ersten Beobachtungsjahr 2001 massen wir nur Bäume über 20 cm Höhe. Um abzuschätzen, welche Bäume zusätzlich angesamt haben, zählten wir seit 2003 auch alle Keimlinge und Bäumchen unter 20 cm (Abb. 21). Die Keimungsbedingungen haben sich nach 2003 kontinuierlich verschlechtert. Dies hängt mit der stetig zunehmenden Vegetation zusammen, die praktisch die ganze Untersuchungsfläche bedeckte (Abb. 48 und 49). Der Höhepunkt der Ansamungs- und Anwuchsphase ist also bereits seit einigen Jahren überschritten. An Kleinstandorten wie aufgeklappten Wurzeltellern herrschten dagegen auch 10 Jahre nach dem Sturm noch immer gute Keimungsbedingungen (Abb. 20). Abb. 20: Eine Gruppe von mehr als 15 ein- bis vierjährigen Fichten unter 20 cm Höhe im Sommer.
20 N/ha Fichte Tanne Bergföhre Vogelbeere Bergahorn Birken Weiden übrige N/ha 18 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Abb. 21: Bäume kleiner als 20 cm im Naturwaldreservat (Stichprobennetze 20 m und 100 m). Im Jahr 2001 fand noch keine Erhebung statt. Höhenklassen In der Höhenklasse stiegen die Verjüngungszahlen bis und verharren seither auf diesem Niveau (Abb. 22). Es sind in den letzten Jahren also etwa gleich viele Bäumchen dieser Höhenklasse entwachsen wie neue Bäume hinzugekommen sind. Weil die Zahl der Bäumchen unter 20 cm Höhe bereits seit 2003 abnimmt (Abb. 21), dürften die Stammzahlen in den Höhenklassen zwischen 20 und 300 cm in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tendenziell zurückgehen Höhenklasse [cm] Abb. 22: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Naturwaldreservat nach Höhenklassen, ohne Sträucher.
21 N/ha N/ha Reich, T. et al Einfluss der Meereshöhe Mit zunehmender Meereshöhe nimmt die Verjüngungsdichte leicht, aber signifikant ab (Abb. 23a). Auch durch Gruppieren der Stichprobenpunkte lässt sich zeigen, dass es in höheren Lagen tendenziell weniger Verjüngung gibt (Abb. 23b). 25'000 20'000 15'000 y = -23.8x + 38 R² = 0.10, p= '000 5' Höhe über Meer [m] Abb. 23a: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Höhe über Meer Plots Plots 43 Plots Sträucher übriges Laubholz Birken Weiden Weisserle Vogelbeere Tanne/Bergföhre Fichte 0 < >1400 Höhe über Meer [m] Abb. 23b: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Höhe über Meer.
22 N/ha 20 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Einfluss der Schadenintensität Im Jahr 2001 wuchsen auf den Totalschadenflächen viel weniger Jungbäume als auf den Streuschadenflächen (Abb. 25). Vier Jahre später zählten wir auf beiden Flächentypen schon fast gleich viele Bäumchen. Diese Differenz hat sich allerdings zwischen und nicht mehr verringert. Auf den Totalschadenflächen war die Vogelbeere die dominierende Baumart, wobei der Grossteil der Bäumchen nach dem Sturm Lothar aufgekommen ist. Der Anteil Kernwüchse ist allerdings nur schwer abschätzbar. An günstigen Standorten wächst die Vogelbeere mehrstämmig und teilweise zu Dutzenden in grossen Gruppen (Abb. 24), was die Identifikation einzelner Individuen erheblich erschwerte. Die wenigen Tannen und Bergföhren wachsen mehrheitlich auf Streuschadenflächen. Seit etablieren sie sich aber auch auf den Probeflächen mit Totalschaden. Auf den Totalschadenflächen sind in den letzten Jahren zahlreiche Weiden aufgekommen. Dagegen ist die Weisserle praktisch nur auf den vom Sturm schwach beeinträchtigten Flächen zu finden. Abb. 24: Die Vogelbeere hat auf Windwurfflächen stark zugenommen, wo sie oft in grossen Gruppen mit vielen Trieben wächst Sträucher übriges Laubholz Birken Weiden Weisserle Vogelbeere Tanne/Bergföhre Fichte Streuschaden Totalschaden Abb. 25: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Windwurfintensität wurden nicht genügend Daten erhoben.
23 Reich, T. et al Verjüngung der Bergföhre Besonderes Augenmerk galt im Rorwald der Bergföhre. Diese Baumart bildete vor 1999 einen beachtlichen Teil der Baumschicht. Torfmoos-Bergföhren-Bestände mit sehr hohem Föhrenanteil waren im Gebiet häufig. Die Weiterentwicklung dieser Wälder ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar, denn durch den Sturm und Borkenkäferbefall ist der Grossteil der Bergföhren abgestorben (Abb. 38 und 39), und die Verjüngung dieser Baumart setzte nur zögerlich ein (Abb. 18, 19 und 21). So waren auch 10 Jahre nach dem Windwurfereignis total erst 23 junge Bergföhren in den Stichprobenkreisen vorhanden (Tab. 5). Das entspricht 54 Bäumen pro Hektare, wobei die sich verjüngenden Föhren oft geklumpt vorkamen und mehrheitlich am oberen Rand der grossen Windwurffläche wuchsen. Abb. 26: Junge Bergföhren waren auch erst spärlich vorhanden. Tab. 5: Anzahl erhobener Bergföhren im Projektperimeter (Stichprobennetze 20 m und 100 m) Abb. 27: In Mulden von aufgeklappten Wurzeltellern herrschen schlechte Verjüngungsbedingungen. Bergföhren- Verjüngung ( cm) Bergföhren <20 cm Total erhobene Bergföhren Wuchsort der Verjüngung Junge Bäume etablierten sich besonders erfolgreich auf Wurzelstöcken, auf Moderholz und auf aufgeklappten Wurzeltellern (Abb. 28). So wuchsen auf diesen Substraten, die zusammen nur 8% der Gesamtfläche ausmachen, gut ein Drittel der gesamten Baumverjüngung. Unterdurchschnittlich besiedelt wurden die Mulden von Wurzeltellern und alle anderen Bodenoberflächen. Letztere weisen einen Flächenanteil von 92% auf, beherbergten aber weniger als zwei Drittel der Verjüngung. Im Gegensatz zu den Wurzeltellern herrschen in Wurzeltellermulden schlechte Keimbedingungen. Die freigelegten Böden in diesen Mulden sind meist torfig oder lehmig, wodurch sich entweder Stauwasser bildet oder die obersten Schichten im Sommer stark austrocknen (Abb. 27). Den widrigen Bedingungen zum Trotz haben sich bis auch auf diesen Flächen Bäumchen etabliert, hauptsächlich Weiden (Abb. 31).
24 Verjüngungsnateil 22 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Normalfläche Wurzelteller aufgeklappt Wurzelstock Moderholz Wurzeltellermulde Verjüngungsanteil Verjüngungsanteil Verjüngungsanteil 2001 Flächenanteil übrige 0% 20% 40% 60% 80% Abb. 28: Verhältnis zwischen dem Flächenanteil der Kleinstandorte und dem Verjüngungsanteil auf den Kleinstandorten im Projektperimeter. Auf den Probeflächen mit Streuschäden wuchsen mehr Bäumchen auf Wurzelstöcken und Moderholz, während auf den Totalschadenflächen die Wurzelteller als Verjüngungsstandort erwartungsgemäss eine grössere Rolle spielten (Abb. 29). 100% 80% 60% 40% 20% übrige Wurzeltellermulde Wurzelteller aufgeklappt Moderholz Wurzelstock Normalfläche 0% Streuschaden Totalschaden Abb. 29: Flächenanteile der Kleinstandorte auf den Probeflächen nach Windwurfintensität im Projektperimeter. Die Verjüngungsanteile der Kleinstandorte in Probekreisen veränderten sich im Laufe der Jahre nur wenig. Anfängliche Unterschiede zwischen den Proben mit Streuschaden und solchen mit Totalschaden verringerten sich ebenfalls mit zunehmendem Alter der Windwurffläche (Abb. 30).
25 Fichte Tanne/Bergföhre Vogelbeere Weisserle Weiden Birken übriges Laubholz Sträucher Verjüngungsanteil N/ha Reich, T. et al übrige Wurzeltellermulde Wurzelteller aufgeklappt Moderholz Wurzelstock Normalfläche Streuschaden Totalschaden Abb. 30: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Kleinstandort und Windwurfintensität wurden nicht genügend Daten erhoben. Verhältnismässig viele Fichten wuchsen auf Wurzelstöcken und Moderholz (Abb. 31 und 32). In Wurzeltellermulden fanden wir praktisch nur Weiden, Birken und andere Weichgehölze. Weisserlen hingegen wurden dagegen fast ausschliesslich auf Normalflächen notiert. Nur die Fichte konnte bisher vom Substrat Moderholz profitieren. 100% 80% 60% 40% 20% 0% übrige Wurzeltellermulde Wurzelteller aufgeklappt Moderholz Wurzelstock Normalfläche Abb. 31: Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Projektperimeter nach Kleinstandort und Baumart, Jahr.
26 24 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Die Fichte verjüngt sich mehrheitlich in den tiefer gelegenen Teilen des Rorwaldes, wo mehr oder weniger geschlossener Wald auf feuchter, aber nicht vernässter Unterlage vorherrscht (Abb. 33). Bei der Vogelbeere war die Verteilung weniger einheitlich. Sie wurde in allen Höhenlagen des Rorwaldes notiert und wies auf den wenig beschatteten Windwurfflächen die grössten Stammzahlen auf. Birken und Weiden wurden hauptsächlich im nordöstlichen Teil des Untersuchungsgebiets gefunden, wo viel Wald dem Wind zum Opfer fiel. In der Summe gibt nur wenige Stichprobenflächen, auf denen kaum oder keine Verjüngung vorhanden ist. Abb. 32: Moderholz, Wurzelstöcke und aufgeklappte Wurzelteller sind die besten Kleinstandorte für die Verjüngung. Insbesondere die Fichte verjüngt sich oft auf totem Holz. Fichte Vogelbeere 1500 m 1400 m 1300 m 1500 m 1400 m 1300 m Birken/Weiden alle Baumarten 1500 m 1400 m 1300 m 1500 m 1400 m 1300 m Abb. 33: Räumliche Verteilung der Verjüngung von Bäumen zwischen 20 und 300 cm Höhe im Jahr. Die Blasengrössen entsprechen der relativen Verjüngungszahl auf der jeweiligen Stichprobe.
27 Reich, T. et al Wildverbiss Die Verbissintensität beschreibt den Anteil der innerhalb eines Jahres verbissenen Gipfeltriebe als Anteil an den insgesamt vorhandenen Gipfeltrieben. Von kritischer Verbissintensität wird gesprochen, wenn ein Baum durch Verbiss einen durchschnittlichen Höhenzuwachsverlust von 25% erleidet. Dieser Wert ist als Grenzwert für die maximal zulässige Verbissbelastung definiert. Bei diesem Höhenzuwachsverlust sterben erste Bäume verbissbedingt ab, wodurch auch der Anteil der verbissempfindlichen oder der vom Wild bevorzugten Baumarten abnimmt. Von Schaden ist die Rede, wenn die kritische Verbissintensität während eines längeren Zeitraum überschritten wird. Abb. 34: Der Grenzwert für die maximal zulässige Verbissbelastung der Weisstanne wird im Rorwald deutlich und über Jahre hinweg überschritten. Nach diesem Schema erhoben wir die Verbissintensität im Rorwald. Der Vergleich mit den Grenzwerten nach Eiberle und Nigg (1987) resp. Schwitter et al. (2002) zeigte, dass die Verbissintensität bei Weisstanne, Vogelbeere und anderen Laubgehölzen deutlich über dem zulässigen Grenzwert liegt (Abb. 35). Die kritischen Verbissintensitäten nach Eiberle und Nigg (1987) beziehen sich auf Bäume zwischen 10 und 130 cm Höhe. Als bestmöglichste Annäherung an diese Masse berücksichtigten wir in unseren Berechnungen die Baumgrössen zwischen 20 und 140 cm Weide (60) Vogelbeere (1252) Birke (63) Tanne (66) Bergahorn (27) Weisserle (79) Grenzwerte für die Verbissintensität nach Eiberle und Nigg (1987). Gemittelte Verbissintensität im Rorwald Fichte (1711) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Verbissprozent des Endtriebs Abb. 35: Vergleich der gemittelten Verbissintensität im Rorwald für Bäume zwischen 20 und 140 cm Höhe mit den Grenzwerten nach Eiberle und Nigg (1987) resp. Schwitter et al. (2002). Die Zahl in Klammer hinter der Baumart gibt an, wieviele Bäume während der Erhebungsdauer beurteilt wurden. Der optische Eindruck im Rorwald bestätigt, dass der Verbissdruck auf die Weisstanne tatsächlich und über Jahre hinweg zu hoch war. Junge Tannen wurden in der Regel totgebissen und hatten ausserhalb von Windwurfflächen praktisch keine Chance aufzukommen (Abb. 36). Vom regelmässigen Verbiss verschont wurden nur junge Tannen, die im Baumverhau der Sturmflächen an günstigen Stelle wachsen, welche dem Wild schwer zugänglich sind.
28 26 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Vogelbeeren, die unter dunklen Lichtverhältnissen wuchsen. Diese Bäumchen wurden in der Regel jährlich verbissen und trieben im darauf folgenden Jahr nur spärlich wieder aus. Kaum eine Vogelbeere entwuchs unter diesen Bedingungen dem Äser. Im Gegensatz zur Weisstanne konnte die schnell wachsende und gut wieder austreibende Vogelbeere aber bei genügend Licht der Reichweite des Wildes genügend rasch entwachsen. Gleiches gilt für Birken und Weiden. Auf den Windwurfflächen verhinderte der hohe Verbissdruck das Aufwachsen dieser Laubbaumarten nicht. Abb. 36: Totgebissene Weisstannen. Derzeit kann diese Baumart nur an geschützten Stellen im Baumverhau der Windwurfflächen dem Äser entwachsen. 4.3 Vorrat, stehendes Totholz und Todesursachen Der Sturm hat unzählige Bäume umgeworfen und dabei den Holzvorrat schlagartig stark gesenkt. Aber auch danach hat der Anteil der lebenden Bäume nochmals deutlich abgenommen. So ist im Projektperimeter zwischen 2001 und deutlich mehr als ein Drittel aller lebenden Bäume abgestorben, und im Naturwaldreservat war es im selben Zeitraum annähernd die Hälfte (Abb. 38 und 39). Der Verlust war bei den Bergföhren besonders ausgeprägt. Nach 2003 sind im Naturwaldreservat und vermutlich auch im ganzen Projektperimeter nur noch wenige Bäume abgestorben, (Abb. 40). Der Lebendvorrat erreichte im Projektperimeter im Jahr mit durchschnittlich nur 115 m 3 /ha Fichte, 21 m 3 /ha Tanne und 11 m 3 /ha Bergföhre einen Tiefstand (Abb. 41). Seitdem hat der Lebendvorrat wieder zugenommen. Dazu trug einerseits das Dickenwachstum der lebenden Bäume bei, anderseits erreichten jüngere Bäume die Kluppierschwelle von 16 cm. Abb. 37: Etwa 60% der Fichten und 25% der Bergföhren haben die Borkenkäfer- Massenvermehrung überlebt. Seit steigt der Lebendvorrat wieder an.
29 m 3 /ha m 3 /ha Reich, T. et al Fichte gefällt/umgefallen stehend tot lebend alle Baumarten Bergföhre Tanne Laubholz Abb. 38: Vorrat der Bäume ab BHD 16 cm im Projektperimeter nach Anteil lebender Bäume. BHD 2001 korrigiert und BHD interpoliert wurden nicht genügen Daten erhoben gefällt/umgefallen stehend tot lebend alle Baumarten 150 Fichte Bergföhre Tanne Laubholz Abb. 39: Vorrat der Bäume ab BHD 16 cm im Naturwaldreservat nach Anteil lebender Bäume. BHD 2001 korrigiert und BHD interpoliert.
30 m 3 /ha m 3 /ha 28 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald tot (gefällt und umgefallen) tot stehend lebend Projektperimeter Naturwaldreservat Abb. 40: Entwicklung des Vorrats ab BHD 16 cm. BHD 2001 korrigiert und BHD interpoliert wurden in Teilen des Projektperimeters nicht genügend Daten erhoben Laubholz Tanne Bergföhre Fichte Projektperimeter Naturwaldreservat Abb. 41: Lebendvorrat der Bäume ab BHD 16 cm nach Baumart. BHD 2001 korrigiert und BHD interpoliert wurden in Teilen des Projektperimeters nicht genügend Daten erhoben.
31 Reich, T. et al Bei der Ersterhebung 2001 stellte sich die Frage nach der Quantifizierung der durch Lothar geworfenen Holzmenge. Eine genaue Messung erwies sich als viel zu aufwendig und von einer groben Schätzung wurde abgesehen. Aus diesem Grund blieb letztlich nur die Aufnahme des stehenden Totholzes übrig. Ab der zweiten Erhebung 2003 erfassten wir nicht nur jene Bäume, die durch Windbruch oder durch Borkenkäfer abgestorben sind, sondern auch die gefällten Bäume. Das Absterben der Bäume nach Lothar war die Folge des starken Borkenkäferbefalls in den Jahren 2001 bis Im Projektperimeter belief sich das durch den Käfer verursachte Totholz im Jahr auf über 50 m 3 /ha (Abb. 44). Weitere 43 m 3 /ha wurden zum Zweck der Käferbekämpfung gefällt. Im Vergleich dazu nehmen sich die etwa 10 m 3 Windbruchholz gering aus. Allein im Naturwaldreservat starben über 70 m 3 /ha Fichtenund Bergföhren durch den Buchdrucker ab (Abb. 45). Zur Käferbekämpfung wurden auch am Rande des Naturwaldreservats 14 m 3 /ha gefällt. Abb. 42: Zirka 90% der zur Borkenkäferbekämpfung gefällten Bäume wurden per Helikopter abtransportiert. Während praktisch nur Fichten Windbruch erlitten, starben fast alle Bergföhren infolge Borkenkäferbefall ab. Vor allem bei älterem stehendem Totholz war die Todesursache allerdings unklar. Für solche Fälle wurde die Bezeichnung unbekannt verwendet. Im Jahr stellten wir bei 47% aller abgestorbenen Bäume im Rorwald Borkenkäferbefall als Todesursache fest. Von Windbruch waren 11% der stehenden toten Bäume betroffen. 36% der nach Lothar abgestorbenen Bäume wurden gefällt. Im Naturwaldreservat sind 71% durch Borkenkäfer abgestorben, bei 16% war Windbruch verantwortlich und 13% wurden gefällt. Der Hauptteil der gefällten Bäume im Naturwaldreservat betraf eine grossflächige Räumung im südwestlichen Teil des Rorwaldes. Das stehende Totholz ergibt sich aus den erhobenen toten Bäumen abzüglich der gefällten. Es bestand abgesehen von ganz wenigen Tannen aus 46 m 3 /ha Fichten (im Naturwaldreservat 56 m 3 /ha) und 28 m 3 /ha Bergföhren (im Naturwaldreservat 41 m 3 /ha). Stehendes Totholz entstand im Projektperimeter zur Hauptsache durch Käferbefall (74%). Abb. 43: Das Volumen des stehenden Tothozes blieb zwischen und unverändert. Nach hatte sich das Volumen des stehenden Totholzes kaum mehr verändert. Die Menge der neu abgestorbenen Bäume und diejenige der einzelnen toten Bäume, die inzwischen umgefallen sind, war etwa gleich gross. Im Naturwaldreservat nahm das Volumen des stehenden Totholzes von 2003 bis infolge Borkenkäferberfalls noch leicht zu (Abb. 45). Der Anstieg war allerdings weit weniger stark, als noch 2003 befürchtet worden war.
32 m 3 /ha m3/ha 30 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald alle Baumarten Fichte unbekannt gefällt Windbruch Borkenkäfer Bergföhre 20 0 Tanne Laubholz Abb. 44: Stehendes Totholz und nach dem Sturm gefällte Bäume im Projektperimeter nach Baumart Fichte unbekannt gefällt Windbruch Borkenkäfer alle Baumarten 60 Bergföhre Tanne Laubholz Abb. 45: Stehendes Totholz und nach dem Sturm gefällte Bäume im Naturwaldreservat nach Baumart. Der Borkenkäfer befiel Bergföhren in allen Durchmesserstufen und Fichten mit mittleren Durchmessern, was aus einem Vergleich der Durchmesserverteilung der lebenden Bäume für die Jahre 2001 und hervorgeht (Abb. 46). Die Differenz zwischen 2001 und kann praktisch ausschliesslich auf den Borkenkäferbefall zurückgeführt werden. Bergföhren starben ausnahmslos durch den Borkenkäfer ab, und bei der Fichte betrafen die Sanitätshiebe jeweils jene Bäume, die vom Käfer befallen waren und somit wohl auch ohne Eingriffe abgestorben wären. Die Tanne war dagegen durch die Buchdrucker-Gradation kaum betroffen.
33 m 3 /ha Reich, T. et al Laubholz Tanne Bergföhre Fichte Durchmesserstufe [cm] Abb. 46: Durchmesserverteilung der lebenden Bäume ab BHD 16 cm in den Jahren 2001 und im Projektperimeter. 4.4 Vegetationsentwicklung Die Deckungsgrade der wichtigsten verjüngungsbehindernden und verdämmenden Vegetationstypen wurden bei jeder Erhebung in Prozenten geschätzt. Seit 2001 haben diese Vegetationstypen sowohl auf den Streuschadenflächen als auch auf den Totalschadenflächen zugenommen (Abb. 48 und 49). Der kumulierte Deckungsgrad war 2001 auf den Totalschadenflächen mit 30% deutlich kleiner als auf den Streuschadenflächen, die zwei Jahre nach Lothar durchschnittlich zu 50% bewachsen waren. Durch aufgeklappte Wurzelteller wurde auf den Probekreisen mit Totalschaden viel Rohboden freigelegt (Abb. 47). Erst zwischen 2001 und 2003 begann sich die Vegetationsdecke an solchen Orten stärker zu schliessen. Abb. 47: Umkippende Bäume haben Ende 1999 die Vegetation samt Oberboden wie einen Teppich weggezogen. Foto: Christoph Angst Sowohl auf den Flächen mit Totalschaden als auch auf Streuschadenflächen nahm die Bedeckung mit Moosen stark und jene mit Torfmoosen moderat zu (Abb. 49). Die Heidelbeere verdreifachte ihren Flächenanteil zwischen 2001 und auf beiden Flächentypen. Der deutlichste Unterschied ergibt sich bei der Himbeere, die seit 2003 auf den Probeflächen mit Totalschaden stark zugenommen hat. Sie hat dort vom erhöhten Lichtangebot und möglicherweise auch vom höheren Grad der Bodenverletzung profitiert. Zudem war die Himbeere auf den Streuschadenflächen durch den höheren Vernässungsgrad limitiert (mehr Torfmoos). Der Anteil vegetationsfreier Flächen, der erstmals erhoben wurde, nahm kontinuierlich ab.
34 Deckungsgrad in % Deckungsgrad in % 32 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Totalschaden Streuschaden Abb. 48: Bodenbedeckung der wichtigsten Vegetationstypen im Projektperimeter nach Schadentyp. Der kumulierte Deckungsgrad übersteigt 100%, weil der Boden durch die verschiedenen Pflanzenarten oft mehrfach überschirmt wird vegetationsfrei Himbeere Heidelbeere übrige Moose Torfmoos Streuschaden Totalschaden Abb. 49: Bodenbedeckung der wichtigsten Vegetationstypen im Projektperimeter nach Schadentyp und. Die Rubrik vegetationsfrei wurde zum ersten Mal erhoben.
35 Reich, T. et al Ergebnisse aus anderen Untersuchungen im Rorwald 5.1 Borkenkäfer-Monitoring (Forster 2006) Im Rahmen des Projekts Lothar und Borkenkäfer: Untersuchungen zur Wirksamkeit von Bekämpfungsmassnahmen und natürlicher Regulation verfolgten Experten der Forschungsanstalt WSL in ausgewählten Gebieten und Geländekammern mit unterschiedlichen Räumungsintensitäten von Sturm- und Käferschäden die Entwicklung der Borkenkäfersituation, darunter im Rorwald. Weil sich die Verhältnisse regional stark unterscheiden, sind die Beobachtungen an den einzelnen Orten als Fallstudien zu betrachten. Verallgemeinernde Aussagen sind nur in beschränktem Masse möglich. Das Borkenkäfer-Monitoring kam zum Schluss, dass nach dem Sturm ungefähr die gleiche Menge Holz durch Borkenkäfer abgestorben ist wie bereits vom Sturm geworfen wurde. Dies deckt sich mit unseren nicht quantifizierten Beobachtungen. Im kühlen Klima des Rorwalds entwickelte sich nur eine Käfergeneration pro Jahr. Dass der Buchdrucker auch die Bergföhre befällt, war bereits von verschiedenen Orten bekannt. Im Rorwald zeigte sich das flächige Absterben dieser Baumart aber besonders deutlich, weil es hier ausgedehnte Bergföhrenwälder gab. Abb. 50: Borkenkäferfallen dienten dem Monitoring der Käferpopulation. Kernaussagen aus dem Projekt: Je mehr Sturmschäden, desto grösser auch der Borkenkäfer-Folgebefall. Die Witterung bremst oder begünstigt eine Massenvermehrung. In Berggebieten laufen Borkenkäfer-Epidemien langsamer ab als in Tieflagen, bzw. mit verzögerten Höhepunkten der Gradation. Das Aufräumen von Sturmschäden und insbesondere von Käfernestern ist eine wirksame Methode, um den Folgebefall durch den Buchdrucker zu reduzieren, sofern konsequent eingegriffen wird und ein überwiegender Teil des Holzes rechtzeitig entrindet oder entfernt werden kann. Je mehr Windwürfe vorhanden sind, desto kleiner wird die vorbeugende Wirkung einer Sturmschaden-Räumung. Erstens kann aus logistischen Gründen nicht mehr alles Holz rechtzeitig aufgerüstet werden; zweitens steigt der Anteil bruttauglicher, geschwächter, stehengebliebener Bäume. Stehendbefall tritt in geräumten Sturmschadengebieten früher aber weniger heftig in Erscheinung als in ungeräumten.
36 34 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald 5.2 Nahrungsangebot und Nahrungsnutzung von Huftieren (Weber et al. 2006) Im Projekt Wechselwirkungen zwischen Vegetation und Huftieren: Einfluss von Windwurf auf Nahrungsangebot und Nahrungsnutzung im Rorwald, wurde der Einfluss von Windwurf auf das Nahrungsangebot und die Nahrungswahl der Huftiere in den Sturmflächen und im geschlossenen Wald untersucht. Im Sommer 2001 und 2003 fanden Verbiss- und Vegetationserhebungen auf insgesamt 28 Flächen von je 20 m 2 statt. Im Sommer 2003 sammelten die Wissenschafterinnen zusätzlich Kot, um diesen später im Labor zu analysieren. Abb. 51: Losung diente zur Analyse der Der Gesamtdeckungsgrad der Vegetation (v. a. Farne, Gräser, Nahrungsnutzung im Rorwald. Foto: Ulrich Moose, Heidelbeere, Himbeere und Brombeere) nahm Wasem zwischen 2001 und 2003 in den Sturmflächen zu. In den Waldflächen blieb er unverändert. Die Waldflächen waren artenreicher als die Windwurfflächen. Die Anzahl Frassspuren des Wildes hat zwischen 2001 und 2003 abgenommen. Die Autorinnen vermuten, dass die Huftierdichte entweder lokal niedriger war oder dass die Tiere zur Nahrungsaufnahme andere Flächen ausserhalb der untersuchten Gebiete genutzt haben. In den Waldflächen wurden mehr Frassspuren gefunden als in den Sturmflächen, am meisten an Heidelbeeren. Die Vegetationszusammensetzung war der wichtigste Faktor für Nahrungswahl der Huftiere. Die Waldstruktur ist nur insofern von Bedeutung, wie sie die Vegetationszusammensetzung beeinflusst. 5.3 Erhebung der Kleinsäuger (Sjusko et al., unpubl.) Im September 2002 erfasste der russischen Gastwissenschafter Anatolji Sjusko im Rorwald Kleinsäuger (Nagetiere, Spitzmäuse) mit Lebendfallen. Als Ködermaterial diente ein Gemisch aus Haferflocken, Erdnussbutter, Rosinen und Haselnusskernen. In den beiden Behandlungsvarianten geräumt und belassen, sowie in der Kontrollfläche (intakter Wald) wurden je 30 Fallen gestellt. Während drei Tagen kontrollierte der Experte jeweils einmal morgens und abends seine 90 Fallen. Die gefangenen Tiere wurden bestimmt und gewogen. Zudem markierte Sjusko die Tiere vor der Freilassung, um Wiederfänge feststellen zu können. Insgesamt gingen in drei Fangtagen im Rorwald sieben Arten von Kleinsäugern in die Fallen (Tab. 6): fünf Nagetierarten und zwei Spitzmausarten. Auffällig wenige Arten hat der russische Gastwissenschafter in der belassenen Windwurffläche gefunden, am meisten im intakten Wald. Der deutlich häufigste Nager war die Rötelmaus. Sie zog die Windwurfflächen dem intakten Wald vor, wobei die Individuenzahlen in der geräumten Fläche am höchsten waren. Die Zwergspitzmaus wurde gar ausschliesslich in den Windwurfflächen gefangen. Bei den anderen Arten sind die Fangzahlen zu gering, um auf Habitatpräferenzen schliessen zu Abb. 52: Der russische Gastwissenschaftler Anatolji Sjusko untersucht eine gefangene Maus im Rorwald.
37 Reich, T. et al können. Die Daten über das Lebendgewicht zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsvarianten. Am 16. September 2002 zeigte das Schweizer Fernsehen DRS in der Sendung MTW die Arbeit von Anatolji Sjusko im Rorwald. Abb. 53: Einer von zwei gefangenen Gartenschläfern. Tab. 6: Kleinsäugerfänge im Rorwald im September Arten- und Individuenzahlen für die Behandlungsvarianten geräumt und belassen, sowie für die Kontrollfläche im intakten Wald. Art Wald belassen Windwurf geräumt Clethrionomys glareolus (Rötelmaus) Apodemus sylvaticus (Waldmaus) 2 2 Apodemus flavicollis (Gelbhalsmaus) 1 1 Microtus agrestis (Erdmaus) 1 1 Eliomys quercinus (Gartenschläfer) 2 2 Sorex araneus (Waldspitzmaus) Sorex minutus (Zwergspitzmaus) Artenzahl Individuenzahl Total 5.4 Inventar der Avifauna (Mollet 2004) Die Schweizerische Vogelwarte erhielt vom Kanton Obwalden den Auftrag, auf dem Perimeter des Projekts Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald ein Inventar der Brutvögel zu erstellen. Im Mai und Juni 2002 sowie im Februar und Mai 2003 erfassen die Ornithologen mit verschiedenen Methoden die lokale Brutvogelfauna. Die revieranzeigenden Singvogelarten wurden durch eine sogenannte Punkttaxierung erhoben. An 46 Punkten notierten die Forscher am frühen Morgen während 5 Minuten sämtliche visuell und akustisch festgestellten Vogelarten. Diese Aufnahme wurde an je drei Tagen durchgeführt. Um das Auerhuhn nachzuweisen, fanden zusätzliche Begehungen statt. Es wurde nach direkten Hinweisen (Losung, Federn, Sichtbeobachtungen) gesucht. Auch für Spechte, Eulen und die Waldschnepfe waren spezielle Begehungen nötig, weil diese Arten mit der Punkttaxierung nicht oder nur ungenügend erfasst werden können. Abb. 54: Der Dreizehenspecht hat vom riesigen Angebot an stehendem Fichtentotholz profitiert.
38 36 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Auf einer Fläche von 200 ha zählten die Ornithologen insgesamt 41 Vogelarten, darunter Auerhuhn, Haselhuhn und Waldschnepfe (Tab. 7). 38 dieser Arten können im Rorwald brüten. Wanderfalke, Steinadler und Kolkrabe sind Nahrungsgäste. Tab. 7: Liste aller im Rorwald nachgewiesenen Vogelarten Alpenmeise Amsel Auerhuhn Buchfink Buntspecht Dreizehenspecht Eichelhäher Erlenzeisig Fitis Gimpel Grünspecht Habicht Haselhuhn Haubenmeise Heckenbraunelle Kleiber Kohlmeise Kolkrabe Kuckuck Mäusebussard Misteldrossel Mönchsgrasmücke Rabenkrähe Ringdrossel Ringeltaube Rotkehlchen Schwarzspecht Singdrossel Sommergoldhähnchen Sperber Steinadler Tannenhäher Tannenmeise Waldbaumläufer Waldkauz Waldschnepfe Wanderfalke Weidenmeise Wintergoldhähnchen Zaunkönig Zilpzalp Für das Auerhuhn ist der Rorwald ein Lebensraum von aussergewöhnlicher Qualität. Aufgrund der Anzahl Nachweise für Schwarzspecht, Dreizehenspecht und Waldschnepfe gehen die Ornithologen davon aus, dass auch diese drei Arten im Rorwald in speziell hoher Dichte vorkommen. Insgesamt wird der Rorwald als vogelartenreiches Gebiet eingestuft, das im Vergleich zu anderen Schweizer Bergwäldern einen überdurchschnittlichen Wert für die Vogelwert hat. 6 Diskussion 6.1 Borkenkäferbefall Sanitärhiebe im Sonderwaldreservat Starke Stürme wie Lothar hinterlassen unweigerlich Spuren im Wald, insbesondere ein völlig verändertes, ungewohntes Waldbild und finanzielle Schäden. Nach jedem grossen Windwurf stellen sich deshalb viele Fragen. Soll man das Holz aufräumen oder liegen lassen? Wie entwickelt sich der Holzpreis? Innert welcher Frist steht wieder der gewohnte Wald mit den gewünschten Baumarten? Soll auf die Naturverjüngung gewartet werden oder ist Pflanzung angebracht? Kann der vom Sturm zerzauste Wald seine Schutzfunktion noch erfüllen? Auch zum Rorwald stellten sich die Forstbehörden derartige Fragen. Nach sorgfältigem Abwägen entschlossen sie sich, das Gebiet als Waldreservat auszuscheiden. Abb. 55: Nach dem Windwurf folgt der Käfer. Wieviel natürliche Dynamik soll man zulassen?
39 Reich, T. et al Wie in vielen anderen Sturmregionen der Schweiz führte die warme, trockene Witterung im Sommer 2003 zu einer starken Vermehrung des Buchdruckers. In der Folge veränderte sich das Landschaftsbild durch grosse Mengen stehendes Käferholz, was zu lebhaften Diskussionen führte. Zudem gab es Befürchtungen, dass das Gebiet durch das flächige Absterben der Bäume anfälliger auf Erosionsprozesse würde. Der Rorwald liegt im Einzugsgebiet des berüchtigten Wildbachs Giswiler Laui und ist von tiefen, aktiven Erosionsgräben umgeben. Die Obwaldner Forstbehörden beschlossen deshalb, die Ausbreitung des Borkenkäfers durch konsequentes Eingreifen einzudämmen, um das Risiko eines grossflächigen Absterbens des Waldes klein zu halten. Die Abb. 56: Die Bekämpfungsstrategie ist aufgegangen. Die umliegenden Schutzwälder blieben von grösserem Buchdruckerbefall verschont. Foto: Reinhard Lässig Bekämpfungsstrategie ist aufgegangen: die Massenvermehrung des Buchdruckers hat auch zehn Jahre nach dem Windwurfereignis nicht auf die umliegenden Schutzwälder übergegriffen. Käfergradation auch im Naturwaldreservat zu Ende Entgegen der Erwartung vieler ist der Absterbeprozess durch Borkenkäferbefall auch in der Kernzone der Waldreservats, in der keine forstlichen Eingriffe stattfanden, nach zum Erliegen gekommen. Die genauen Gründe kennen wir nicht, denn die Dichte von Borkenkäferpopulationen wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. Die wichtigsten sind Standort und Witterung, das Angebot an Brutmaterial, die Widerstandskraft der Wirtsbäume (Disposition) und natürliche Feinde wie verschiedene räuberische und parasitische Insekten (Forster 2006). Die verbleibenden lebenden Bäume waren offensichtlich genügend widerstandsfähig, um dem Befallsdruck der zurückgehenden Käferpopulation zu trotzen. Hätte man deshalb auf die aufwendigen Bekämpfungsmassen verzichten können? Die Frage muss unbeantwortet bleiben. Sicher ist, dass das Fällen, Entrinden oder Abtransportieren des Holzes die Entwicklung einer grossen Menge Käfer verhindert und damit vermutlich den Befallsdruck auf die lebenden Bäume im Naturwaldreservat deutlich vermindert hat. Daher sehen wir in der Käferbekämpfung einen mitentscheidenden regulierenden Faktor auf die Massenvermehrung, die 6 Jahre nach dem Sturm zum Erliegen gekommen ist. Klarheit darüber, ob beim Verzicht auf Bekämpfungsmassnahmen nicht nur alle Bäume im Waldreservat, sondern auch die umliegenden Wälder abgestorben wären, hätte nur das Experiment geschaffen. In der Schweiz gibt es aber schlicht zu viele Interessen am bestehenden (Schutz-)Wald, um ein solches Experiment zu wagen. Dass das Zulassen der natürlichen Dynamik mit Risiken verbunden gewesen wäre, zeigt aktuell der deutsche Nationalpark Bayerischer Wald, wo eine Borkenkäfer-Massenvermehrung in für Mitteleuropa bisher ungekanntem Ausmass im Gang ist (Müller et al. 2008). Abb. 57: Lebende Fichte inmitten von abgestorbenen Bergföhren. Der Buchdrucker hat die Föhre gegenüber der Fichte bevorzugt.
40 38 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Bergföhre bevorzugt Besonders auffällig war im Rorwald der Befall der Bergföhre durch den Buchdrucker. Die Torfmoos- Bergföhrenwälder, die den Sturm noch zum grössten Teil unbeschadet überstanden hatten, sind dadurch flächig abgestorben (Abb. 60). Auch wenn der Befall von Bergföhre durch den Buchdrucker bereits von anderen Orten bekannt ist, scheint uns das Ausmass im Rorwald doch bemerkenswert. Der Buchdrucker hat die Bergföhren nicht nur gemeinsam mit der Fichte befallen, sondern diese gegenüber der Rottanne sogar bevorzugt (Abb. 57). 6.2 Wiederbewaldung Grosse standörtliche Unterschiede Zentraler Teil des Forschungsprojekts war die Waldverjüngung, insbesondere die Wiederbewaldung der Windwurfflächen. Allein aufgrund der Höhenlage dauert die Regeneration des Rorwaldes deutlich länger als jene auf den meisten Lothar-Flächen im Mittelland (Wohlgemuth et al. 2008). So entsprechen die Baumhöhen auf den neunjährigen Rorwald-Schadenflächen mit viel Verjüngung etwa den Messwerten von Bäumen, die zwischen 2003 bis in Lothar-Flächen der Tieflagen festgestellt wurden. Die Wiederbewaldung schreitet im Rorwald im Vergleich mit den Mittellandstandorten also sichtbar langsamer voran. Auch die durchschnittliche Dichte der Baumverjüngung ist im Rorwald deutlich geringer als auf Windwurfflächen des Mittellandes (Angst et al. 2003). Im Untersuchungsgebiet stellten wir hinsichtlich der Verjüngungsdichte wiederum riesige Unterschiede auf den verschiedenen Stichprobenflächen fest. Während wir auf einigen Flächen keinen einzigen Baum zählten, wuchsen auf anderen Dutzende kleiner Fichten auf wenigen Quadratmetern, oder es entwickelten sich grosse Gruppen von Vogelbeeren (Abb. 24). Auf moorigen und vergrasten Flächen, vor allem in Kleinseggenrieden, wächst kaum ein Baum (Abb. 7). Dass die baumfreien Riede und Moore nicht verwalden, ist aus Sicht des Natur- und Artenschutzes erwünscht. Wildverbiss beeinflusst Baumartenzusammensetzung Bereits 1990 wurde starker Wildverbiss im Rorwald beobachtet (Grunder et al. 1997). Auch zwischen 2001 und taxierten wir den Verbissdruck durch Reh, Hirsch und Gämse aufgrund unserer Erhebungen als sehr hoch. Trotzdem scheint die Wiederbewaldung der grösseren Sturmflächen durch das Wild nicht in Frage gestellt, weil der Verbissdruck auf diesen Flächen offensichtlich nicht zu vollständigem Ausfall von Baumarten führt. Allerdings wirkt sich die selektive Äsungstätigkeit durch das Schalenwild generell auf die Zusammensetzung der zukünftigen Baumschicht aus. Bei tieferen Wilddichten dürfte insbesondere der Anteil der Weisstanne wesentlich höher sein. Die Fichte wird im Rorwald mit wenigen Ausnahmen nicht verbissen und kann ungehindert wachsen. Laubgehölze wie Vogelbeere, Birke und Weide werden zwar stark verbissen, entwachsen aber auf Windwurfflächen dank ihrer guten Ausschlagsfähigkeit und der enormen Wuchskraft innert einiger Jahre dem Äser. Die Weisstanne, deren Fähigkeit neu Abb. 58: Auf den Windwurfflächen vermögen Laubgehölze trotz starkem Verbissdruck dem Äser zu entwachsen.
41 Reich, T. et al auszutreiben und den Haupttrieb zu ersetzen beschränkt ist, wird hingegen in der Regel so stark verbissen, dass sie über kurz oder lang abstirbt. Diese Baumart kann nur aufwachsen, wenn sie zufällig an einem für das Wild schlecht erreichbaren Platz wächst, beispielsweise im Verhau zwischen mehreren liegenden Stämmen. Auf Flächen mit wenig oder ohne Sturmschäden schafft es praktisch nur die Fichte, der Reichweite des Wildes zu entwachsen. Im Gegensatz zu den Windwürfen, wo die Laubgehölze dank des grossen Lichtangebots rasch wachsen, bleiben Vogelbeere, Birke und Weide an wenig besonnten Standorten durch den regelmässigen Verbiss klein. Die Bäumchen überleben zwar sehr lange, gedeihen aber kümmerlich und sterben unter diesen Bedingungen längerfristig meistens ab. Die Weisstanne kann im geschlossenen Wald dem Äser ebenfalls nicht entwachsen. Im Rorwald spielt der Wildverbiss je nach den Lichtverhältnissen also eine unterschiedliche Rolle. Auf besonnten Flächen, d.h. auf grösseren Schadenflächen, mag der Verbiss die rasch wachsenden Bäume nur geringfügig zu limitieren. Lediglich die Weisstanne hat hier Mühe aufzukommen. In diesem Sinne wirkt Verbiss auf die Baumartenzusammensetzung des zukünftigen Waldes. Auf Streuschadenflächen und im geschlossenen Waldbestand wachsen hingegen auch Vogelbeere und anderes Laubholz als Folge von beschränktem Lichtgenuss und ständigem Verbiss nur langsam. Das Licht ist deshalb der wichtigste Faktor für die Baumverjüngung: sowohl die Häufigkeit der natürlichen Waldverjüngung als auch das Höhenwachstum ist vom verfügbaren Licht abhängig. Ohne Regulierung des Schalenwildes wird die Weisstanne im Rorwald längerfristig zu einem seltenen Baum. Fichtenverjüngung auf Moderholz Totholz spielt für die Fichtenverjüngung im Rorwald eine wichtige Rolle. Rund ein Drittel der erhobenen Fichten wächst hier auf Wurzelstöcken und Moderholz (Abb. 59). Auf vernässtem Untergrund mit dichter Hochstauden- Vegetation ist dieser Anteil noch deutlich höher. Totholz bildet in genügend vermodertem Zustand ein sehr gutes Keimbeet für Fichtensamen. Im Gegensatz zu den Fichtenkeimlingen sind Hochstauden auf Totholz jedoch nicht überlebensfähig. Die auf Moderholz gekeimten Fichten profitieren also von der fehlenden Konkurrenz. Somit trägt Totholz entscheidend dazu bei, dass es auch auf verjüngungsfeindlichen Flächen Fichtennachwuchs gibt. Abb. 59: Auf vernässtem Untergrund verjüngen sich die Fichten besonders auf Moderholz. Foto: Christoph Angst Im Gegensatz zur Fichte keimen Tannen kaum auf totem Holz, sondern hauptsächlich auf Waldboden. Besonders in tieferen Lagen des Rorwalds verzeichneten wir jeweils zahlreiche Weisstannenkeimlinge in der Nähe von grossen Tannen. Die Weisstanne kommt hier auf mittleren Böden vor, wo Totholz auch bei Fichte eine untergeordnete Rolle spielt.
42 40 Waldentwicklung nach Windwurf im Waldreservat Rorwald Verjüngung der Bergföhrenwälder braucht Zeit Die Torfmoos-Bergföhrenwälder sind zum grössten Teil abgestorben (Abb. 60). Es ist zu erwarten, dass sich hier wieder ein Bergföhrenwald entwickelt, weil sich die Föhre in Hochmooren gegenüber der Fichte normalerweise auf Dauer durchsetzen kann. Untersuchungen von Schmid et al. (1995) zeigen, dass Licht eine wichtige Rolle im Hinblick auf die generative Verjüngung dieser staunässe-toleranten Art spielt. Auf mittlerem Untergrund unterliegt sie den wuchskräftigeren und schattentoleranteren Baumarten. Dagegen findet sie kaum Konkurrenten auf offenen Moosflächen in Hochmooren, wo extreme Keim- und Aufwuchsbedingungen herrschen: die Fichte kann sich hier nicht etablieren. Der Verjüngungsprozess dauert auf den moorigen Flächen allerdings lange. Bisher gibt es auf den Föhrenwaldstandorten trotz günstigen Lichtverhältnissen noch kaum junge Bäume. Gründe für die spärliche Bergföhrenverjüngung könnten Samenmangel infolge fehlender Mastjahre oder die dichte Bodenvegetation mit zu wenig offenem Boden sein. Im Gegensatz zu den Windwurfflächen wurde der Boden nirgends durch Abb. 60: Die Wiederbewaldung auf moorigen Flächen kommt im Vergleich zu den übrigen Flächen nur langsam voran. umfallende Bäume aufgerissen. Es bestand daher keine vorübergehende Gunstsituation für die Keimung von Föhrensamen. Trotzdem nimmt die Zahl der kleinen Bergföhren im Rorwald langsam aber kontinuierlich zu (Tabelle 5). Weil ausser der Bergföhre und teilweise der Birke auf den nassesten Flächen kaum andere Baumarten wachsen, dürften diese beiden Arten auf moorigen Böden den zukünftigen Wald bilden. Die Fichte ist hier nicht konkurrenzstark genug. Dies ändert sich jedoch, sobald die Böden trockeneren werden. Am Rand einiger Torfmoos-Bergföhrenwälder wachsen junge Fichten nach. Strukturreichtum dank unregelmässiger Verjüngung Der Rorwald war schon vor dem Sturm Lothar für seine strukturierten Waldbestände bekannt (Grunder et al. 1997). Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern. Im Gegenteil: auf den ungeräumten Windwurfflächen wird sich in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich ein strukturreicher Gebirgswald mit einem erheblichen Laubholzanteil entwickeln. Strukturvielfalt entsteht in erster Linie, weil die Verjüngung auf den grossen Sturmflächen nicht gleichzeitig wächst, sondern zeitlich und räumlich gestaffelt. An Orten, an denen schon 1999 Verjüngung vorhanden war (Vorverjüngung), ragten die Bäume im Jahr teilweise schon über fünf Meter in die Höhe. Auf unvernässten Standorten erreichten zahlreiche nach Lothar gekeimte Bäume Mannshöhe, während die Verjüngung auf anderen Flächen nur langsam vorankommt. Abb. 61: Wo Baumstämme mehrschichtig aufeinander liegen, etablieren sich die Bäumchen mit Verzögerung. Dies fördert die Strukturvielfalt des künftigen Waldes. Aufgeklappte Wurzelteller, auf denen zahlreiche Bäume wachsen, und stark vernässte Stellen ohne Verjüngung verstärken diesen Effekt zusätzlich. Wo zwei oder gar drei Baumschichten übereinander
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern
 Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
NATURWALDRESERVAT HECKE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
NATURWALDRESERVAT DAMM
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
NATURWALDRESERVAT ROHRHALDE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim NATURWALDRESERVAT ROHRHALDE Naturwaldreservat Rohrhalde Laubbäume prägen die Nordteile des Naturwaldreservats. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim NATURWALDRESERVAT ROHRHALDE Naturwaldreservat Rohrhalde Laubbäume prägen die Nordteile des Naturwaldreservats. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Land- und Forstwirtschaft. Land- und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft der Schweiz. Neuchâtel 2015
 07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1500 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2015 Neuchâtel 2015 Forststatistik 2014 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 913
07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1500 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2015 Neuchâtel 2015 Forststatistik 2014 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 913
Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2015 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG)
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging a. Inn Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2015 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging a. Inn Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2015 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft
Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Landnutzer
 Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Dr. Hubert Kammerlander Gruppe Forst Waldfläche wächst langsam aber stetig 540 W aldfläche in [1.000 ha] 520 500 480 460 440 420 400 Quelle: ÖWI 61/70 71/80 81/85
Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Dr. Hubert Kammerlander Gruppe Forst Waldfläche wächst langsam aber stetig 540 W aldfläche in [1.000 ha] 520 500 480 460 440 420 400 Quelle: ÖWI 61/70 71/80 81/85
Land- und Forstwirtschaft. Land- und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft der Schweiz. Neuchâtel, 2014
 07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1400 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2014 Neuchâtel, 2014 Forststatistik 2013 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 778
07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1400 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2014 Neuchâtel, 2014 Forststatistik 2013 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 778
Profitiert die Juraviper von Biotopaufwertungen im Wald?
 Profitiert die Juraviper von Biotopaufwertungen im Wald? Beispiel einer rfolgskontrolle aus dem Kanton Basel-Landschaft Aspisviper-Tagung der KARCH in Leysin, 26. September 2015 Christoph Bühler, Hintermann
Profitiert die Juraviper von Biotopaufwertungen im Wald? Beispiel einer rfolgskontrolle aus dem Kanton Basel-Landschaft Aspisviper-Tagung der KARCH in Leysin, 26. September 2015 Christoph Bühler, Hintermann
Arten und Lebensräume Landwirtschaft Vielfalt in der Agrarlandschaft
 Arten und Lebensräume Landwirtschaft Vielfalt in der Agrarlandschaft erfassen ALL-EMA 3. 2015 4 ALL-EMA Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft» Die Landwirtschaft ist auf eine intakte
Arten und Lebensräume Landwirtschaft Vielfalt in der Agrarlandschaft erfassen ALL-EMA 3. 2015 4 ALL-EMA Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft» Die Landwirtschaft ist auf eine intakte
Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen in einem künftigen Nationalpark
 Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar AUSWEISUNGEN VON NATURWALDRESERVATEN IN RHEINLAND-PFALZ aus der Nutzung genommen
Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar AUSWEISUNGEN VON NATURWALDRESERVATEN IN RHEINLAND-PFALZ aus der Nutzung genommen
SUCCESSION IN A PROTECTION FOREST AFTER PICEA ABIES DIE-BACK ANDREA DORIS KUPFERSCHMID ALBISETTI
 DISS. ETH NO. 15228 SUCCESSION IN A PROTECTION FOREST AFTER PICEA ABIES DIE-BACK A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Natural Sciences
DISS. ETH NO. 15228 SUCCESSION IN A PROTECTION FOREST AFTER PICEA ABIES DIE-BACK A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Natural Sciences
1. Ansiedlung, Überleben und. Konkurrenz junger Bäume
 1. Ansiedlung, Überleben und Konkurrenz junger Bäume Bestandesstrukturen in Wäldern Im dichten Buchenwald findet kaum Verjüngung statt Verjüngung noch schwieriger im tropischen Regenwald Es werde Licht...
1. Ansiedlung, Überleben und Konkurrenz junger Bäume Bestandesstrukturen in Wäldern Im dichten Buchenwald findet kaum Verjüngung statt Verjüngung noch schwieriger im tropischen Regenwald Es werde Licht...
Obwohl Österreich sehr dicht besiedelt ist, kommt auf jeden Bundesbürger fast ein halber Hektar Wald.
 1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
WILDEINFLUSSMONITORING
 WILDEINFLUSSMONITORING Heimo Schodterer Institut für Waldschutz BFW-Praxistage 2010 Wien, Mariabrunn 25.02.2010 Wildeinfluss / Wildschaden Richtige Interpretation der WEM-Ergebnisse I) Begriffe: Wildeinfluss
WILDEINFLUSSMONITORING Heimo Schodterer Institut für Waldschutz BFW-Praxistage 2010 Wien, Mariabrunn 25.02.2010 Wildeinfluss / Wildschaden Richtige Interpretation der WEM-Ergebnisse I) Begriffe: Wildeinfluss
Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach
 Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach Folie 2 Meteorologischer Ablauf Entstehung eines Sturmtiefs über dem Nordatlantik am 25. Dezember 1999 Rapider Druckabfall innerhalb weniger Stunden Zugbahn
Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach Folie 2 Meteorologischer Ablauf Entstehung eines Sturmtiefs über dem Nordatlantik am 25. Dezember 1999 Rapider Druckabfall innerhalb weniger Stunden Zugbahn
NATURWALDRESERVAT WOLFSEE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen NATURWALDRESERVAT WOLFSEE Naturwaldreservat Wolfsee Der Wolfsee gab dem Reservat seinen Namen. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Wolfsee liegt im
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen NATURWALDRESERVAT WOLFSEE Naturwaldreservat Wolfsee Der Wolfsee gab dem Reservat seinen Namen. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Wolfsee liegt im
BÄUMCHEN WECHSELT EUCH!
 BÄUMCHEN WECHSELT EUCH! Unser Ziel ist eine gesunde Mischung. Wer heute Waldbau sagt, muss auch Waldumbau und Energiewende meinen. Standortgemäß, naturnah, stabil, leistungsfähig, erneuerbar: Anpassungsfähige
BÄUMCHEN WECHSELT EUCH! Unser Ziel ist eine gesunde Mischung. Wer heute Waldbau sagt, muss auch Waldumbau und Energiewende meinen. Standortgemäß, naturnah, stabil, leistungsfähig, erneuerbar: Anpassungsfähige
Kommen wieder harte Zeiten für alt- und totholzabhängige Arten?
 Kommen wieder harte Zeiten für alt- und totholzabhängige Arten? Einleitung Eine der Hauptfunktionen des Waldes ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt (Projektleitung WAP-CH, 2004 ). Diese Funktion
Kommen wieder harte Zeiten für alt- und totholzabhängige Arten? Einleitung Eine der Hauptfunktionen des Waldes ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt (Projektleitung WAP-CH, 2004 ). Diese Funktion
Permanente Stichprobeninventur Langula - Ergebnisse und Erfahrungen
 Permanente Stichprobeninventur Langula - Ergebnisse und Erfahrungen Dirk Fritzlar, Forstamt Hainich-Werratal Berechnungen und Grafiken S. 12, 14-22: Dr. Dominik Hessenmöller FBG Hainich Drei Waldgenossenschaften
Permanente Stichprobeninventur Langula - Ergebnisse und Erfahrungen Dirk Fritzlar, Forstamt Hainich-Werratal Berechnungen und Grafiken S. 12, 14-22: Dr. Dominik Hessenmöller FBG Hainich Drei Waldgenossenschaften
BSc: Waldmesslehre Waldinventur I
 Plot design: Arten von Probeflächen = fixed area plots (mit einer fest definierten Fläche). Geschachtelte Probeflächen = nested plots (mit mehreren fest definierten Unterflächen). Probeflächen mit mehreren
Plot design: Arten von Probeflächen = fixed area plots (mit einer fest definierten Fläche). Geschachtelte Probeflächen = nested plots (mit mehreren fest definierten Unterflächen). Probeflächen mit mehreren
3. Landesforstinventar (LFI) Auswertung der Ergebnisse für den Kanton Freiburg
 LFI3 - Einführung 3. Landesforstinventar (LFI) Auswertung der Ergebnisse für den Kanton Freiburg Das Landesforstinventar ist eine periodische Aufnahme des Zustandes und der Veränderungen des Schweizer
LFI3 - Einführung 3. Landesforstinventar (LFI) Auswertung der Ergebnisse für den Kanton Freiburg Das Landesforstinventar ist eine periodische Aufnahme des Zustandes und der Veränderungen des Schweizer
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg. Markt Höchberg WALDNATURSCHUTZ IM GEMEINDEWALD
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg Markt Höchberg WALDNATURSCHUTZ IM GEMEINDEWALD Foto: Wolfgang Fricker Eiche Hainbuche Rotbuche Der Gemeinde-wald Höchberg Der Gemeindewald Höchberg
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg Markt Höchberg WALDNATURSCHUTZ IM GEMEINDEWALD Foto: Wolfgang Fricker Eiche Hainbuche Rotbuche Der Gemeinde-wald Höchberg Der Gemeindewald Höchberg
Grossflächige hochaufgelöste Schneehöhenkarten aus digitalen Stereoluftbildern
 Grossflächige hochaufgelöste Schneehöhenkarten aus digitalen Stereoluftbildern Christian Ginzler 1, Mauro Marty 1 & Yves Bühler 2 1 Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 2 WSL-Institut
Grossflächige hochaufgelöste Schneehöhenkarten aus digitalen Stereoluftbildern Christian Ginzler 1, Mauro Marty 1 & Yves Bühler 2 1 Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 2 WSL-Institut
Code 1: alle drei Tiere (1 Pflanzen- und 2 Fleischfresser) korrekt markiert (siehe oben)
 Wald N_6d_65 Im Wald findet ständig ein Kreislauf statt: Pflanzenteile werden von Tieren gefressen und verdaut. Pflanzenfresser dienen Fleischfressern als Nahrung. Alte Pflanzenteile, tote Tiere und Kot
Wald N_6d_65 Im Wald findet ständig ein Kreislauf statt: Pflanzenteile werden von Tieren gefressen und verdaut. Pflanzenfresser dienen Fleischfressern als Nahrung. Alte Pflanzenteile, tote Tiere und Kot
Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels. Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst
 Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Die Baumartenzusammensetzung entscheidet für die nächsten 70 150 Jahre über Stabilität,
Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Die Baumartenzusammensetzung entscheidet für die nächsten 70 150 Jahre über Stabilität,
NSG-ALBUM. Hangbrücher bei Morbach
 NSG-ALBUM Hangbrücher bei Morbach Teilgebiet Gebranntes Bruch FFH-6106-303 Idarwald; 07-NSG-7231-055 Hangbrücher bei Morbach NP 4.100 (NPK 4.105) Naturpark Saar-Hunsrück (M. Scholtes) NSG-ALBUM Gebranntes
NSG-ALBUM Hangbrücher bei Morbach Teilgebiet Gebranntes Bruch FFH-6106-303 Idarwald; 07-NSG-7231-055 Hangbrücher bei Morbach NP 4.100 (NPK 4.105) Naturpark Saar-Hunsrück (M. Scholtes) NSG-ALBUM Gebranntes
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica
 Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
BORKENKÄFER. Gefahr in Verzug!!
 BORKENKÄFER nach Manfred Wolf, Forstdirektion Niederbayern Oberpfalz 2004 Gefahr in Verzug!! Biologie Lebensweise der Fichten-Borkenkäfer Borkenkäfer fliegen ab dem Frühjahr auf geschwächte stehende Bäume
BORKENKÄFER nach Manfred Wolf, Forstdirektion Niederbayern Oberpfalz 2004 Gefahr in Verzug!! Biologie Lebensweise der Fichten-Borkenkäfer Borkenkäfer fliegen ab dem Frühjahr auf geschwächte stehende Bäume
1 NIEDERSCHLAGSMENGEN
 1 NIEDERSCHLAGSMENGEN Im Kanton Solothurn fallen im langjährigen Durchschnitt etwa 1240 mm Niederschläge pro Jahr. Das sind insgesamt rund 980 Mia. Liter Regen und Schnee oder ein 225000 km langer Zug,
1 NIEDERSCHLAGSMENGEN Im Kanton Solothurn fallen im langjährigen Durchschnitt etwa 1240 mm Niederschläge pro Jahr. Das sind insgesamt rund 980 Mia. Liter Regen und Schnee oder ein 225000 km langer Zug,
Entwicklungen im Nationalpark Bayerischer Wald
 NÜRTINGEN, 08. NOVEMBER 2013 Entwicklungen im Dr. Franz Leibl Lage des Nationalparks Bayerischer Wald 2 Waldinventur 2002/03 Fi 67 %, Bu 24,5 %, Vogelbeere 3,1 %, Tanne 2,6 %, Andere 2,8 % 3 Zonierung
NÜRTINGEN, 08. NOVEMBER 2013 Entwicklungen im Dr. Franz Leibl Lage des Nationalparks Bayerischer Wald 2 Waldinventur 2002/03 Fi 67 %, Bu 24,5 %, Vogelbeere 3,1 %, Tanne 2,6 %, Andere 2,8 % 3 Zonierung
Ergebnisse der 3. Bundeswaldinventur in der Region Berlin-Brandenburg
 Ergebnisse der 3. Bundeswaldinventur in der Region Berlin-Brandenburg Ministerium für Infrastruktur 1 Was ist eine Bundeswaldinventur? Ministerium für Infrastruktur alle 10 Jahre werden im gesamten Bundesgebiet
Ergebnisse der 3. Bundeswaldinventur in der Region Berlin-Brandenburg Ministerium für Infrastruktur 1 Was ist eine Bundeswaldinventur? Ministerium für Infrastruktur alle 10 Jahre werden im gesamten Bundesgebiet
Waldbauliche Beobachtungsfläche Üetliberg, Bestand 10.26 (Grün Stadt Zürich)
 Fachstelle Waldbau (FWB) - Centre de compétence en sylviculture (CCS) Peter Ammann Pascal Junod ammann@bzwlyss.ch junod@cefor.ch 032 387 49 72 032 387 49 71 c/o Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20,
Fachstelle Waldbau (FWB) - Centre de compétence en sylviculture (CCS) Peter Ammann Pascal Junod ammann@bzwlyss.ch junod@cefor.ch 032 387 49 72 032 387 49 71 c/o Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20,
6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE
 6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE. Ein Planet für über 6 Milliarden Wie viele Menschen leben auf der Erde und wo leben sie? Es gibt bereits über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die
6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE. Ein Planet für über 6 Milliarden Wie viele Menschen leben auf der Erde und wo leben sie? Es gibt bereits über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die
Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel
 Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel Tagung «Klimawandel und Wald eine ökonomische Sicht» Zollikofen, HAFL, 29. April 2015 Dr. Peter Brang Leiter des Forschungsprogramms
Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel Tagung «Klimawandel und Wald eine ökonomische Sicht» Zollikofen, HAFL, 29. April 2015 Dr. Peter Brang Leiter des Forschungsprogramms
ProSilvaSchweiz > Bitterlich-Übung
 ProSilvaSchweiz > Bitterlich-Übung Exkursion vom Donnerstag, 12. November 2015 Forstrevier Bachs ZH > christian.rosset@bfh.ch Berner Fachhochschule Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissenschaften
ProSilvaSchweiz > Bitterlich-Übung Exkursion vom Donnerstag, 12. November 2015 Forstrevier Bachs ZH > christian.rosset@bfh.ch Berner Fachhochschule Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissenschaften
Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen
 Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen Problem Böschungspflege Die Pflege der teilweise sehr hohen und steilen Böschungen am Kaiserstuhl und im Breisgau verursacht
Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen Problem Böschungspflege Die Pflege der teilweise sehr hohen und steilen Böschungen am Kaiserstuhl und im Breisgau verursacht
Zum persönlichen Gebrauch
 Klimawandel und Biodiversität im Schweizer Wald Thomas Wohlgemuth WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft 8903 Birmensdorf Waldfläche: Nutzungswandel Waldfläche in der Schweiz Brändli
Klimawandel und Biodiversität im Schweizer Wald Thomas Wohlgemuth WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft 8903 Birmensdorf Waldfläche: Nutzungswandel Waldfläche in der Schweiz Brändli
r e b s r e l l a b e i r t e b t s r , h c s e l e t t i M n i r e t i e l r e i v e r, s s i e w a s i l önnen. hützen zu k
 der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick
 2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick Das Hauptziel dieser Arbeit ist einen hochaufgelösten Niederschlagsdatensatz für Deutschland, getrennt nach konvektivem und stratiformem
2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick Das Hauptziel dieser Arbeit ist einen hochaufgelösten Niederschlagsdatensatz für Deutschland, getrennt nach konvektivem und stratiformem
Forstwirtschaft der Schweiz. Taschenstatistik 2009
 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 29 Neuchâtel, 29 Forststatistik 28 Schweiz Zürich Bern Luzern Holznutzung Total in m 3 5 262 199 428 645 1 58 791 329 465 Veränderung zum Vorjahr (27) in %
Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 29 Neuchâtel, 29 Forststatistik 28 Schweiz Zürich Bern Luzern Holznutzung Total in m 3 5 262 199 428 645 1 58 791 329 465 Veränderung zum Vorjahr (27) in %
Klimabulletin Winter 2016/2017 _
 Klimabulletin Winter 2016/2017 _ Der Winter 2016/17 zeichnete sich vor allem durch seine ausgeprägte Trockenheit aus. Die winterlichen Niederschlagmengen erreichten im landesweiten Mittel nur rund die
Klimabulletin Winter 2016/2017 _ Der Winter 2016/17 zeichnete sich vor allem durch seine ausgeprägte Trockenheit aus. Die winterlichen Niederschlagmengen erreichten im landesweiten Mittel nur rund die
Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften
 Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Waldrallye Haus Dortmund
 Waldrallye Haus Dortmund Die Waldralle umfasst drei verschiedene Aufgabenformen: a) Stationen: Mit Zahlen markierte Punkte, an denen Fragen beantwortet werden müssen. b) Übungen: Stationen, an denen Aufgaben
Waldrallye Haus Dortmund Die Waldralle umfasst drei verschiedene Aufgabenformen: a) Stationen: Mit Zahlen markierte Punkte, an denen Fragen beantwortet werden müssen. b) Übungen: Stationen, an denen Aufgaben
Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate?
 Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate? Rolf Ullrich 1), Jörg Rapp 2) und Tobias Fuchs 1) 1) Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima und Umwelt, D-63004 Offenbach am Main 2) J.W.Goethe-Universität,
Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate? Rolf Ullrich 1), Jörg Rapp 2) und Tobias Fuchs 1) 1) Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima und Umwelt, D-63004 Offenbach am Main 2) J.W.Goethe-Universität,
Der Schutzwald, das natürliche Bollwerk gegen Naturereignisse, reagiert auf Umwelteinflüsse!
 Der Schutzwald, das natürliche Bollwerk gegen Naturereignisse, reagiert auf Umwelteinflüsse! Tagung BVR, 20. Juni 2008 Klimawandel und Naturgefahren Driver (Wasserkraft, Biomasse, Sonne) Erneuerbare Energien
Der Schutzwald, das natürliche Bollwerk gegen Naturereignisse, reagiert auf Umwelteinflüsse! Tagung BVR, 20. Juni 2008 Klimawandel und Naturgefahren Driver (Wasserkraft, Biomasse, Sonne) Erneuerbare Energien
Amt für Landschaft und Natur
 Amt für Landschaft und Natur Abteilung Wald züriwaldwer bisch du? Der Wald im Kanton Zürich Der Wald im Wandel Obwohl sich die Rolle des Waldes für den Menschen ständig wandelt, erfüllt der Wald seine
Amt für Landschaft und Natur Abteilung Wald züriwaldwer bisch du? Der Wald im Kanton Zürich Der Wald im Wandel Obwohl sich die Rolle des Waldes für den Menschen ständig wandelt, erfüllt der Wald seine
The management of alpine forests in Germany
 The management of alpine forests in Germany Workshop of the Alpine Convention 11./12.09.2014 in Pieve di Cadore Stefan Tretter, Overview 1. Data on mountain forests in Germany 2. Legal framework for the
The management of alpine forests in Germany Workshop of the Alpine Convention 11./12.09.2014 in Pieve di Cadore Stefan Tretter, Overview 1. Data on mountain forests in Germany 2. Legal framework for the
Betriebsbesuch Markus Klug Greisdorf, Obergrail (Steiermark A) 7 ha Reben (blaue Wildbacher Rebe)
 Reisebericht Betriebsbesuch 30.7.2012 Markus Klug Greisdorf, Obergrail (Steiermark A) Betriebsgrösse 40 ha: 30 ha Wald 7 ha Reben (blaue Wildbacher Rebe) 3 ha Kastanien Höhe ü. M. 510 m ca. 1 000 mm Niederschläge/
Reisebericht Betriebsbesuch 30.7.2012 Markus Klug Greisdorf, Obergrail (Steiermark A) Betriebsgrösse 40 ha: 30 ha Wald 7 ha Reben (blaue Wildbacher Rebe) 3 ha Kastanien Höhe ü. M. 510 m ca. 1 000 mm Niederschläge/
Das Landesforstinventar
 Einblicke in den Schweizer Wald Das Landesforstinventar liefert ein repräsentatives Bild über den Zustand und die Entwicklung des Schweizer Waldes. Das Landesforstinventar liefert ein repräsentatives Bild
Einblicke in den Schweizer Wald Das Landesforstinventar liefert ein repräsentatives Bild über den Zustand und die Entwicklung des Schweizer Waldes. Das Landesforstinventar liefert ein repräsentatives Bild
Friedrichshafen Streuobstbäume vor der Blüte schneiden
 19.02.2017 17:49 Corinna Raupach Friedrichshafen Streuobstbäume vor der Blüte schneiden Eine Hochstamm-Expertin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt Tipps, wie alte Obstsorten
19.02.2017 17:49 Corinna Raupach Friedrichshafen Streuobstbäume vor der Blüte schneiden Eine Hochstamm-Expertin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt Tipps, wie alte Obstsorten
Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern, Diagrammen und Statistiken
 Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald -
 Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Au A f u f d em e m Weg e zum u m Dauerwald 1
 Auf dem Weg zum Dauerwald 1 Dauerwaldbewirtschaftung = Streben nach nachhaltiger Nutzung und Pflege. Nachhaltigkeit bezieht sich auf dauernd erbrachte ökonomische, ökologische und soziale Waldleistungen.
Auf dem Weg zum Dauerwald 1 Dauerwaldbewirtschaftung = Streben nach nachhaltiger Nutzung und Pflege. Nachhaltigkeit bezieht sich auf dauernd erbrachte ökonomische, ökologische und soziale Waldleistungen.
Der Aargauer Wald in Zahlen
 Der Aargauer Wald in Zahlen Vom Schweizer Wald im Allgemeinen und dem Aargauer Wald im Besonderen gibt es unzählige Daten. Sie geben Auskunft über die Fläche und die Artenvielfalt. Sie informieren zudem
Der Aargauer Wald in Zahlen Vom Schweizer Wald im Allgemeinen und dem Aargauer Wald im Besonderen gibt es unzählige Daten. Sie geben Auskunft über die Fläche und die Artenvielfalt. Sie informieren zudem
Konzeption zur ökologischen Sanierung des Tessiner Moores im Biosphärenreservat Schaalsee
 Konzeption zur ökologischen Sanierung des Tessiner Moores im Biosphärenreservat Schaalsee Naturraum Das Tessiner Moor liegt nördlich von Wittenburg zwischen Karft und Tessin (Abb. 1). Es hat eine Fläche
Konzeption zur ökologischen Sanierung des Tessiner Moores im Biosphärenreservat Schaalsee Naturraum Das Tessiner Moor liegt nördlich von Wittenburg zwischen Karft und Tessin (Abb. 1). Es hat eine Fläche
Wann bilden Bäume einen Wald? Dritte Erhebung von 2004 bis 2007
 Wie ist der Schweizer Wald beschaffen und wie verändert er sich mit der Zeit? Antwort auf diese Fragen gibt das Schweizerische Landesforstinventar (LFI). Der Wald erfüllt viele Aufgaben: Er bietet Schutz
Wie ist der Schweizer Wald beschaffen und wie verändert er sich mit der Zeit? Antwort auf diese Fragen gibt das Schweizerische Landesforstinventar (LFI). Der Wald erfüllt viele Aufgaben: Er bietet Schutz
Film- und Kinostatistik Schweiz Die Schweizer Filmproduktion (Kino und Fernsehen),
 Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la statistique OFS 16 Kultur und Medien Juni 28 Film- und Kinostatistik Schweiz Die Schweizer Filmproduktion (Kino und Fernsehen), 1913 27 Inhaltsverzeichnis
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la statistique OFS 16 Kultur und Medien Juni 28 Film- und Kinostatistik Schweiz Die Schweizer Filmproduktion (Kino und Fernsehen), 1913 27 Inhaltsverzeichnis
Mehr Licht im Wald planmäßige und ungeplante Holzentnahmen
 ElMar Hauk Mehr Licht im Wald planmäßige und ungeplante Holzentnahmen Licht spielt für den Lebensraum Wald eine zentrale Rolle und bestimmt wesentlich Baumartenmischung und Bestandesentwicklung. Seit der
ElMar Hauk Mehr Licht im Wald planmäßige und ungeplante Holzentnahmen Licht spielt für den Lebensraum Wald eine zentrale Rolle und bestimmt wesentlich Baumartenmischung und Bestandesentwicklung. Seit der
Netzwerk Naturwald Lebensräume verbinden gemeinsam Wege finden
 Netzwerk Naturwald Lebensräume verbinden gemeinsam Wege finden ECONNECT Großes Projekt um die ökologische Vernetzung im Alpenraum zu verbessern/zu erhalten Nördliche Kalkalpen als eine der Pilotregionen
Netzwerk Naturwald Lebensräume verbinden gemeinsam Wege finden ECONNECT Großes Projekt um die ökologische Vernetzung im Alpenraum zu verbessern/zu erhalten Nördliche Kalkalpen als eine der Pilotregionen
Unsere Kinder schreiben
 Unsere Kinder schreiben Am 24. 10. 2012 haben wir unsern Besuch beim Förster vorbereitet. Zu diesem Zweck haben wir die Kinder des Zyklus 2.1.B mit denen des Zyklus 2.2.B gemischt, um gemeinsam Fragen
Unsere Kinder schreiben Am 24. 10. 2012 haben wir unsern Besuch beim Förster vorbereitet. Zu diesem Zweck haben wir die Kinder des Zyklus 2.1.B mit denen des Zyklus 2.2.B gemischt, um gemeinsam Fragen
3.4 Wirtschaft und Arbeit. B1 Demografische Entwicklung und Wanderungsbewegungen der Wohnbevölkerung
 117 3.4 Wirtschaft und Arbeit B1 Demografische Entwicklung und Wanderungsbewegungen der Wohnbevölkerung INDIKATOR: Altersstruktur der Bevölkerung und Anteil der Wohnbevölkerung mit ausländischem Pass in
117 3.4 Wirtschaft und Arbeit B1 Demografische Entwicklung und Wanderungsbewegungen der Wohnbevölkerung INDIKATOR: Altersstruktur der Bevölkerung und Anteil der Wohnbevölkerung mit ausländischem Pass in
Zäh und wildwüchsig: die Arve im Murgtal
 Zäh und wildwüchsig: die Arve im Murgtal Verbreitung der Arven in der Schweiz Die grössten Arvenwälder findet man im Engadin und im Wallis. Arvenwälder sind selten, sie nehmen nur etwa 1% der Gesamtwaldfläche
Zäh und wildwüchsig: die Arve im Murgtal Verbreitung der Arven in der Schweiz Die grössten Arvenwälder findet man im Engadin und im Wallis. Arvenwälder sind selten, sie nehmen nur etwa 1% der Gesamtwaldfläche
Artenvielfalt, Nahrungsnetzwerke und Ausbreitungsdistanzen von Mulmhöhlen bewohnenden Arthropoden (LWF Projekt L56)
 Artenvielfalt, Nahrungsnetzwerke und Ausbreitungsdistanzen von Mulmhöhlen bewohnenden Arthropoden (LWF Projekt L56) Bastian Schauer, Elisabeth Obermaier & Heike Feldhaar Bastian Schauer, Tierökologie I,
Artenvielfalt, Nahrungsnetzwerke und Ausbreitungsdistanzen von Mulmhöhlen bewohnenden Arthropoden (LWF Projekt L56) Bastian Schauer, Elisabeth Obermaier & Heike Feldhaar Bastian Schauer, Tierökologie I,
Statistisches Bundesamt
 Pressekonferenz Leben in Deutschland: Datenreport 2013 am 26. November 2013 in Berlin -Statement von Roderich Egeler- Es gilt das gesprochene Wort Das deutsche Jobwunder Beim Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt
Pressekonferenz Leben in Deutschland: Datenreport 2013 am 26. November 2013 in Berlin -Statement von Roderich Egeler- Es gilt das gesprochene Wort Das deutsche Jobwunder Beim Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt
Merkblatt 3: Unterscheidung von Fällplatz, Frassplatz und Nagespur
 Merkblatt 3: Unterscheidung von Fällplatz, Frassplatz und Nagespur Grundsätzliches Die Unterscheid zwischen Nagespur, Fällplatz und Frassplatz ist nicht immer eindeutig, da es keine klaren und messbaren
Merkblatt 3: Unterscheidung von Fällplatz, Frassplatz und Nagespur Grundsätzliches Die Unterscheid zwischen Nagespur, Fällplatz und Frassplatz ist nicht immer eindeutig, da es keine klaren und messbaren
Wald in Leichter Sprache
 Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Neues zu natürlicher Dynamik, Klimaanpassung, Biodiversität und Waldbaukonzepten
 Buchenwälder in der Forschung Neues zu natürlicher Dynamik, Klimaanpassung, Biodiversität und Waldbaukonzepten Christian Ammer Bad Langensalza, 27. April 2016 Abteilung Hainich-Tagung Waldbau und 27. Waldökologie
Buchenwälder in der Forschung Neues zu natürlicher Dynamik, Klimaanpassung, Biodiversität und Waldbaukonzepten Christian Ammer Bad Langensalza, 27. April 2016 Abteilung Hainich-Tagung Waldbau und 27. Waldökologie
Diagnostik und Forschung im Pflanzenschutzlabor
 Diagnostik und Forschung im Pflanzenschutzlabor Daniel Rigling Leiter Gruppe Phytopathologie Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 1 Eingeschleppte Schadorganismen Definition: Neu:
Diagnostik und Forschung im Pflanzenschutzlabor Daniel Rigling Leiter Gruppe Phytopathologie Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 1 Eingeschleppte Schadorganismen Definition: Neu:
22. Schweizer Phänologie-Tag in Birmensdorf ZH Waldphänologie und waldökologische Beobachtungen
 22. Schweizer Phänologie-Tag in Birmensdorf ZH Waldphänologie und waldökologische Beobachtungen Anne Thimonier, Maria Schmitt, Peter Waldner, Oliver Schramm Einleitung Waldphänologie Erkenntnisse der letzten
22. Schweizer Phänologie-Tag in Birmensdorf ZH Waldphänologie und waldökologische Beobachtungen Anne Thimonier, Maria Schmitt, Peter Waldner, Oliver Schramm Einleitung Waldphänologie Erkenntnisse der letzten
Naturwaldreservate im Nationalpark - Beispiele für künftige Waldentwicklungen
 Naturwaldreservate im Nationalpark - Beispiele für künftige Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar Fragen: - In welche Richtung laufen die Naturprozesse? - Können wir sie laufen lassen?
Naturwaldreservate im Nationalpark - Beispiele für künftige Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar Fragen: - In welche Richtung laufen die Naturprozesse? - Können wir sie laufen lassen?
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland
 Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
W o r k s h o p P r i m a r s t u f e 3-4
 Workshop 1 (WS1) : Bäume erkennen Es existieren zahlreiche unterschiedliche Bäume. In diesem Projekt wirst du dich auf eine einzige Art konzentrieren. Dazu musst du aber fähig sein deine Baumart zu erkennen
Workshop 1 (WS1) : Bäume erkennen Es existieren zahlreiche unterschiedliche Bäume. In diesem Projekt wirst du dich auf eine einzige Art konzentrieren. Dazu musst du aber fähig sein deine Baumart zu erkennen
Der Wald und seine Funktionen
 Der Wald als Holzproduzent und Arbeitgeber Bildquelle: www.wald.ch Der Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen Bildquelle: www.wald.ch Der Wald als Trinkwasser- und Kohlenstoffspeicher Bildquelle: www.wald.ch,
Der Wald als Holzproduzent und Arbeitgeber Bildquelle: www.wald.ch Der Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen Bildquelle: www.wald.ch Der Wald als Trinkwasser- und Kohlenstoffspeicher Bildquelle: www.wald.ch,
Untersuchungen zum Durchmesserzuwachs an den Wald- und Hauptmessstationen (Praktikumsarbeit FSU Jena, Master-Studiengang Geografie)
 Untersuchungen zum Durchmesserzuwachs an den Wald- und Hauptmessstationen (Praktikumsarbeit FSU Jena, Master-Studiengang Geografie) Im Rahmen des Forstlichen Umweltmonitoring werden an den 14 Thüringer
Untersuchungen zum Durchmesserzuwachs an den Wald- und Hauptmessstationen (Praktikumsarbeit FSU Jena, Master-Studiengang Geografie) Im Rahmen des Forstlichen Umweltmonitoring werden an den 14 Thüringer
Theorie der Neuankömmlinge widerlegt Die älteste Fichte der Damit wären die schwedischen Fichten die ältesten Bäume der Welt. Welt
 Ältester Baum der Welt entdeckt Fichte in den schwedischen Bergen erreicht Alter von 9.550 Jahren Den ältesten Baum der Welt haben Wissenschaftler jetzt im schwedischen Dalarna entdeckt. Die 9.550 Jahre
Ältester Baum der Welt entdeckt Fichte in den schwedischen Bergen erreicht Alter von 9.550 Jahren Den ältesten Baum der Welt haben Wissenschaftler jetzt im schwedischen Dalarna entdeckt. Die 9.550 Jahre
Der Wald der Zukunft in Thüringen. Herausforderungen und Lösungen am Beispiel des Staatswaldes
 Der Wald der Zukunft in Thüringen Herausforderungen und Lösungen am Beispiel des Staatswaldes Inhaltsverzeichnis 1. Holzvorräte 2. Zuwachs und nachhaltige Nutzung 3. Baumarten 4. Waldaufbau 5. Waldverjüngung
Der Wald der Zukunft in Thüringen Herausforderungen und Lösungen am Beispiel des Staatswaldes Inhaltsverzeichnis 1. Holzvorräte 2. Zuwachs und nachhaltige Nutzung 3. Baumarten 4. Waldaufbau 5. Waldverjüngung
Grün, grün, grün muss er sein
 tropenwald Grün, grün, grün muss er sein Foto: Greenpeace/Volker Oppermann 22 Nr. 115/4.12 wald Mut zum Nichtstun im Nationalpark Bayerischer Wald: Die toten, grauen Bäume bleiben stehen Nr. 115/4.12 23
tropenwald Grün, grün, grün muss er sein Foto: Greenpeace/Volker Oppermann 22 Nr. 115/4.12 wald Mut zum Nichtstun im Nationalpark Bayerischer Wald: Die toten, grauen Bäume bleiben stehen Nr. 115/4.12 23
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Waldwirtschaftsplan Forsteinrichtung
 Waldwirtschaftsplan Forsteinrichtung Warum planen? Für einen, der nicht weiß, nach welchem Hafen er steuern will, gibt es keinen günstigen Wind. (Seneca, röm. Philosoph) Nachhaltigkeit "Jede weise Forstdirektion
Waldwirtschaftsplan Forsteinrichtung Warum planen? Für einen, der nicht weiß, nach welchem Hafen er steuern will, gibt es keinen günstigen Wind. (Seneca, röm. Philosoph) Nachhaltigkeit "Jede weise Forstdirektion
Übungen (HS-2010): Urteilsfehler. Autor: Siegfried Macho
 Übungen (HS-2010): Urteilsfehler Autor: Siegfried Macho Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis 1. Übungen zu Kapitel 2 1 Übungen zu Kontingenz- und Kausalurteile 1 Übung 1-1: 1. Übungen zu Kapitel 2 Gegeben:
Übungen (HS-2010): Urteilsfehler Autor: Siegfried Macho Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis 1. Übungen zu Kapitel 2 1 Übungen zu Kontingenz- und Kausalurteile 1 Übung 1-1: 1. Übungen zu Kapitel 2 Gegeben:
SACHSEN-ANHALT. Veröffentlicht am ,MBl. LSA Nr. 8. FAR Mario Trapp, Infoveranstaltung RL - WUM
 SACHSEN-ANHALT Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark Veröffentlicht am 07.03.2016,MBl. LSA Nr. 8 WAS WIRD GEFÖRDERT? Maßnahmen die über das vorgeschriebene Maß z.b. nach Naturschutzverordnungen
SACHSEN-ANHALT Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark Veröffentlicht am 07.03.2016,MBl. LSA Nr. 8 WAS WIRD GEFÖRDERT? Maßnahmen die über das vorgeschriebene Maß z.b. nach Naturschutzverordnungen
Der Wald hat ein gutes Gedächtnis
 Der Wald hat ein gutes Gedächtnis Autor(en): Objekttyp: Brang, Peter / Bugmann, Harald Article Zeitschrift: Cratschla : Informationen aus dem Schweizerischen Nationalpark Band (Jahr): - (2010) Heft 2 PDF
Der Wald hat ein gutes Gedächtnis Autor(en): Objekttyp: Brang, Peter / Bugmann, Harald Article Zeitschrift: Cratschla : Informationen aus dem Schweizerischen Nationalpark Band (Jahr): - (2010) Heft 2 PDF
Urbane Wälder in Leipzig
 LUKAS DENZLER IDEEN RECHERCHEN GESCHICHTEN Urbane Wälder in Leipzig Fotos: Lukas Denzler / Februar 2016 Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), der ehemalige
LUKAS DENZLER IDEEN RECHERCHEN GESCHICHTEN Urbane Wälder in Leipzig Fotos: Lukas Denzler / Februar 2016 Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), der ehemalige
Subtile Strömungswirkungen
 Norbert Harthun Leipzig, im Juni 2005 Subtile Strömungswirkungen Es ist eindeutig, dass der Wechsel von einer Wasserlaufkrümmung in die andere besondere Wirkung auf die Umgebung hat. Im vergangenen PKS-Seminar
Norbert Harthun Leipzig, im Juni 2005 Subtile Strömungswirkungen Es ist eindeutig, dass der Wechsel von einer Wasserlaufkrümmung in die andere besondere Wirkung auf die Umgebung hat. Im vergangenen PKS-Seminar
Forst. Aktuelle Waldschutzsituation
 Forst Aktuelle Waldschutzsituation Information der Hauptstelle für Waldschutz Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) Fachbereich Waldentwicklung / Monitoring Ausgabe 04/2015 vom 29.06.2015 Inhalt
Forst Aktuelle Waldschutzsituation Information der Hauptstelle für Waldschutz Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) Fachbereich Waldentwicklung / Monitoring Ausgabe 04/2015 vom 29.06.2015 Inhalt
Mit der Aargauer Brille
 Mit der Aargauer Brille Aargauer Wälder im Zentrum! Hier wird fündig, wer mehr über die Ausdehnung, Nutzung und das Besondere des Aargauer Waldes erfahren möchte. 1.2 1.6 Lebendiges Totholz Lebensraum
Mit der Aargauer Brille Aargauer Wälder im Zentrum! Hier wird fündig, wer mehr über die Ausdehnung, Nutzung und das Besondere des Aargauer Waldes erfahren möchte. 1.2 1.6 Lebendiges Totholz Lebensraum
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015
 HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015 Der Sommer 2015 war sowohl im Tiefland als auch auf Österreichs Bergen der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturmessungen, lediglich im Jahr
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015 Der Sommer 2015 war sowohl im Tiefland als auch auf Österreichs Bergen der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturmessungen, lediglich im Jahr
Raubbau und naturnahe Waldbewirtschaftung Ein Vergleich
 Raubbau und naturnahe Waldbewirtschaftung Ein Vergleich Ökoregionen/Makroökologie Dr. Holger Schulz WS 09/10 21.01.2010 Referentin: Colette Waitz Gliederung 1) Einführung 2) Raubbau am Wald 3) Naturnahe
Raubbau und naturnahe Waldbewirtschaftung Ein Vergleich Ökoregionen/Makroökologie Dr. Holger Schulz WS 09/10 21.01.2010 Referentin: Colette Waitz Gliederung 1) Einführung 2) Raubbau am Wald 3) Naturnahe
DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI
 DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI Dagmar Bednárová, NLC LVÚ Zvolen Bernkastel Kues 04. 07. 6. 2013 Aus der Historie der Zulassung 1938 erste Vorschrift über die Zulassung
DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI Dagmar Bednárová, NLC LVÚ Zvolen Bernkastel Kues 04. 07. 6. 2013 Aus der Historie der Zulassung 1938 erste Vorschrift über die Zulassung
Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie
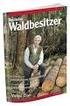 Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie Christian Ammer, Universität Göttingen Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen 1/25 Waldbau Abteilung Waldbau und Waldökologie der
Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie Christian Ammer, Universität Göttingen Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen 1/25 Waldbau Abteilung Waldbau und Waldökologie der
Borkenkäfer aufgepasst: Dreizehenspecht
 Borkenkäfer aufgepasst: Dreizehenspecht Abbildung 1: Männchen eines Dreizehenspechts beim Trommeln an einer toten Fichte. (Bild: Beat Wermelinger) Der Klimawandel wird voraussichtlich häufiger zu idealen
Borkenkäfer aufgepasst: Dreizehenspecht Abbildung 1: Männchen eines Dreizehenspechts beim Trommeln an einer toten Fichte. (Bild: Beat Wermelinger) Der Klimawandel wird voraussichtlich häufiger zu idealen
Spectra Aktuell 4/16. Spectra Social Network Monitor: Rasanter Zuwachs hält an 50+ Generation in der Welt der Sozialen Netzwerke angekommen!
 Spectra Aktuell 4/16 Spectra Social Network Monitor: Rasanter Zuwachs hält an 50+ Generation in der Welt der Sozialen Netzwerke angekommen! Spectra Marktforschungsgesellschaft mbh. Brucknerstraße 3-5/4,
Spectra Aktuell 4/16 Spectra Social Network Monitor: Rasanter Zuwachs hält an 50+ Generation in der Welt der Sozialen Netzwerke angekommen! Spectra Marktforschungsgesellschaft mbh. Brucknerstraße 3-5/4,
Keine eindeutige Wahrheit
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Vermögensverteilung 21.01.2016 Lesezeit 4 Min Keine eindeutige Wahrheit Wie viel genau besitzen die reichsten 10 Prozent der Bundesbürger? Weil
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Vermögensverteilung 21.01.2016 Lesezeit 4 Min Keine eindeutige Wahrheit Wie viel genau besitzen die reichsten 10 Prozent der Bundesbürger? Weil
Tutorium Makroökonomie I. Blatt 6. Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell
 Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Rothirschbesiedlung des nördlichen Jurabogens mit Hilfe von Übersiedlungen an der A1
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Artenmanagement Rothirschbesiedlung des nördlichen Jurabogens mit Hilfe von Übersiedlungen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Artenmanagement Rothirschbesiedlung des nördlichen Jurabogens mit Hilfe von Übersiedlungen
Erfahrungen im Umgang mit Buchdrucker-Massenvermehrungen
 Erfahrungen im Umgang mit Buchdrucker-Massenvermehrungen (Ips typographus L.) nach Sturmereignissen in der Schweiz BEAT FORSTER, FRANZ MEIER, ROLF GALL und CHRISTOPH ZAHN Keywords: Bark beetles; Scolytidae;
Erfahrungen im Umgang mit Buchdrucker-Massenvermehrungen (Ips typographus L.) nach Sturmereignissen in der Schweiz BEAT FORSTER, FRANZ MEIER, ROLF GALL und CHRISTOPH ZAHN Keywords: Bark beetles; Scolytidae;
Modul č. 11. Odborná němčina pro 1. ročník
 Modul č. 11 Odborná němčina pro 1. ročník Thema 8: Pflanzen und Tiere im Wald Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 Autor modulu: Mgr. Hana Nováková Thema 8: Pflanzen und Tiere im Wald a) Pflanzen
Modul č. 11 Odborná němčina pro 1. ročník Thema 8: Pflanzen und Tiere im Wald Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 Autor modulu: Mgr. Hana Nováková Thema 8: Pflanzen und Tiere im Wald a) Pflanzen
