Physiologische Wirkungen von Extraktionssäften aus Äpfeln, Weinbeeren und Roten Beten in vitro und am Menschen
|
|
|
- Lena Schulze
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Physiologische Wirkungen von Extraktionssäften aus Äpfeln, Weinbeeren und Roten Beten in vitro und am Menschen Sabine Sembries 1, Gerhard Dongowski 1#, Katri Mehrländer 2, Frank Will 2 und Helmut Dietrich 2 1 Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, Arbeitsgruppe Präventiv-medizinische Lebensmittelforschung, Arthur- Scheunert-Allee , D Nuthetal 2 Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Weinanalytik und Getränkeforschung, Rüdesheimer Straße 28, D Geisenheim Zusammenfassung Mittels In-vitro- und In-vivo-Experimenten wurden ernährungsphysiologische Wirkungen von Extraktionssäften aus Äpfeln, Trauben und Roten Beten untersucht, die durch eine zweistufige enzymatische Maischebehandlung (Tresterextraktion) gewonnen wurden. Die aus den Extraktionssäften isolierten Saftkolloide (lösliche Ballaststoffe) wurden bei der Fermentation in vitro mit menschlicher Darmflora zu hohen Konzentrationen an kurzkettigen Fettsäuren (SCFA), vorwiegend Acetat, fermentiert. Aus den Apfelkolloiden wurde zusätzlich viel Butyrat und aus den Rote- Bete-Kolloiden viel Propionat gebildet. Der Zusatz von Polyphenol- bzw. Betalainfraktionen während der Fermentation der Apfel- bzw. Rote-Bete- Kolloide in vitro führte zu einer weiteren Erhöhung der SCFA-Konzentration. In Gegenwart der antioxidativ wirksamen Saftinhaltsstoffe wurde die Lag-Phase der Oxidation von LDL-Cholesterol in vitro verzögert. Der Extraktionssaft aus Roten Beten war dabei in seiner antioxidativen Wirkung am effektivsten. Weiterhin konsumierten in einer Pilotstudie 1 Probanden jeweils 2 Wochen lang die Extraktionssäfte. Ihr Einfluss auf die Serumlipidspiegel sowie auf die Bakterienzellzahlen und SCFA in Faeces war im Vergleich zu den Kontrollphasen gering. Während der Saftinterventionsphasen erfolgten eine höhere Flüssigkeitsaufnahme und Urinausscheidung, eine vermehrte Ausscheidung von Gallensäuren und neutralen Sterolen sowie eine Zunahme des Anteils an primären Gallensäuren in Faeces. Während der Gabe der Extraktionssäfte aus Äpfeln und Trauben kam es zu einem Anstieg an Polyphenolen und deren Metabolite im Urin. Dieser Effekt wurde auch in Resorptionsuntersuchungen bestätigt. Nach Gabe des Extraktionssaftes aus Roten Beten wurde im Urin Betanin gefunden. Die Ergebnisse weisen auf positive ernährungsphysiologische Wirkungen der Extraktionssäfte hin. Die Polyphenol- und Ballaststoff-reichen Extraktionssäfte sind als Grundlage für die Entwicklung von gesundheitsfördernden und innovativen Produkten geeignet. Summary In nutritional in vitro and in vivo studies, the physiological effects of extraction juices from apples, grapes and red beets were evaluated. Extraction juices were produced by a two step enzymatic mash treatment. Juice colloids (soluble dietary fibre) isolated from those extraction juices resulted in high amounts of short-chain fatty acids (SCFA), mainly as acetate when fermented by the human intestinal flora in vitro. Colloids from apples increased also butyrate yields whereas fermentation of colloids from red beets additionally raised levels of propionate. Supplementation of polyphenols or betalains to the respective colloids from apples or red beets enhanced even more the concentration of SFCA produced in vitro. LDL oxidation in vitro was delayed as lag phase increased in the presence of antioxidative juice ingredients which were most prominent with the extraction juice from red beets. Furthermore, in a pilot study 1 human subjects consumed extraction juices for two weeks each. Effects of extraction juices on serum lipid levels and on bacterial counts as well as on SCFA in faeces were minor when compared to the control periods. During juice administration, consumption of liquids and excretion of urine was enhanced as well as the excretion of bile acids, neutral sterols and # Dr. Gerhard Dongowski, dongo@mail.dife.de 35 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26
2 primary bile acids in faeces. The intake of extraction juices from apples and grapes resulted in higher concentrations of polyphenols and their metabolites in urine. This effect was also shown in an absorption study. After consumption of extraction juice from red beets betanin was found in urine. Results from these in vitro and in vivo studies reveal that extraction juices have positive physiological effects. Thus such extraction juices rich in polyphenols and dietary fibre are a suitable basis for the development of innovative and health-promoting products for human nutrition. Keywords: Extraktionssaft, Apfel, Weinbeere, Rote Bete, Polyphenol, Betalain, ernährungsphysiologische Wirkung, kurzkettige Fettsäure, Gallensäure, neutrales Sterol / extraction juice, apple, grape, red beet, polyphenol, betalain, nutritional effect, short-chain fatty acid, bile acid, neutral sterol Um die potenzielle Eignung solcher Ausgangsmaterialien zu prüfen, wurden im Rahmen von In-vitro- und In-vivo- Experimenten ernährungsphysiologische Wirkungen von Extraktionssäften aus Äpfeln, Trauben und Roten Beten untersucht, die durch eine zweistufige enzymatische Maischebehandlung (Tresterextraktion) gewonnen wurden. Dazu wurden die aus den Extraktionssäften isolierten Saftkolloide (lösliche Ballaststoffe) auf ihre Fermentierbarkeit durch die menschliche Darmflora in vitro getestet. Weiterhin wurden die antioxidativen Eigenschaften der sekundären Saftinhaltsstoffe gegenüber isolierter LDL geprüft. In einem Ernährungsversuch am Menschen wurden zudem die drei Tresterextraktionsvarianten auf ihre physiologischen Effekte in einer Pilotstudie untersucht. 1 Einleitung Die Nutzbarmachung der in pflanzlichen Zellwänden anwesenden Polysaccharide mit Ballaststoffcharakter und der mit ihnen vergesellschaftet vorkommenden sekundären Pflanzenstoffe hat aufgrund ihrer physiologischen Wirkungen für die Ernährung des Menschen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die in Früchten enthaltenen Phenolcarbonsäurederivate, Flavonoide und Anthocyane sind als natürliche Antioxidanzien wirksam (Rice-Evans et al., 1995). Bisher bleibt jedoch bei der üblichen Praxis der Fruchtsaftherstellung ein wesentlicher Teil dieser Stoffe ungenutzt im Trester zurück. Es wurde kürzlich gezeigt, dass in einem zweistufigen Verfahren durch eine enzymatische Tresterextraktion unter Einsatz von Pektinase-, Hemicellulase- und Cellulase-haltigen Enzympräparaten (Will et al., 2 und 23) im Unterschied zu den früheren Verfahren der so genannten Totalverflüssigung (Pilnik, 1982) Säfte gewonnen werden können, die sich von den bisher üblichen in ihrer Zusammensetzung unterscheiden und einen verfahrenstechnischen Ansatz für die Gewinnung von Saftprodukten mit vorteilhaften ernährungsphysiologischen Wirkungen darstellen (Sembries et al., 23 und 24 sowie 25). Bei der Apfelverarbeitung führte die enzymatische Tresterextraktion sowohl zu einer partiellen Hydrolyse von Polysacchariden (Mehrländer et al., 22) als auch zu einer verstärkten Freisetzung von vorwiegend löslichen Ballaststoffen (Dongowski und Sembries, 21) und weiteren Fruchtinhaltsstoffen wie der Polyphenole (Bauckhage et al., 2). Für den Markt an funktionellen Lebensmitteln ergibt sich ein Bedarf an Produkten mit erhöhten Gehalten an bioaktiven sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen. Hierfür sind Trester bzw. teilentsaftete Maischen aus der Fruchtund Gemüsesaftgewinnung, wie beispielsweise die Rückstände nach der Gewinnung von Apfelsaft und Traubensaft, geeignete Ausgangsmaterialien. Ein weiterer interessanter Ausgangsstoff ist der Pressrückstand nach der Gewinnung von Rote-Bete-Saft, der Betalaine enthält. 2 Material und Methoden 2.1 Gewinnung der Extraktionssäfte Der Extraktionssaft aus Äpfeln wurde nach dem zweistufigen Verfahren gemäß Will et al. (2 und 23) gewonnen. Dazu wurden im industriellen Maßstab 2 t Apfelmaische zunächst mit 1 ppm des pektolytischen Enzympräparates Pectinex Smash (Novozymes, Dittingen/Schweiz) 1 h bei ca. 2 C unter gelegentlichem Rühren enzymiert. Die Entsaftung erfolgte mit einem Dekanter (Flottweg, Vilsbiburg). Der abgepresste Trester wurde in einem Maischetank mit Wasser im Verhältnis 1:1 vermischt und mit Direktdampf auf 5 C erhitzt. Nach Erreichen der Temperatur wurden 2 ppm Pectinex AFP-L4 (Novozymes) zudosiert, und es wurde 2 h kontinuierlich gerührt. Das Enzympräparat enthielt Cellulaseaktivitäten. Der enzymierte Trester wurde anschließend in einer Horizontalpresse (Bucher HP 5, Niederweningen/Schweiz) abgepresst und der Extraktionssaft wurde auf 12,3 Brix konzentriert. Für den Traubenextraktionssaft wurde Trester von weißen Traubensorten aus dem Raum Geisenheim verwendet. Die handverlesenen und entrappten Trauben wurden gequetscht und in einer Presse entsaftet. Nach Abtrennung des Premiumsaftes wurde der Trester sofort eingefroren und bis zu seiner Weiterverarbeitung bei 24 C gelagert. Der Trester wurde dann mit heißem Wasser (95 C) im Verhältnis 1:1 aufgetaut und in einem heizbaren Rührtank auf 45 5 C temperiert. Nach Zudosierung von 2 ppm Rohapect AP 2 und 2 ppm Rohament CL (AB Enzymes GmbH, Darmstadt) wurde 2 h unter Rühren enzymiert. Anschließend wurde in einer Horizontalpresse (Bucher HP-L 2) entsaftet (Mehrländer et al., 24). Die Extraktionssäfte aus Äpfeln und Trauben wurden in Flaschen abgefüllt, pasteurisiert und bei 4 C gelagert. 3 kg Rote Bete wurden nach Heißwasserblanchierung (95 C, 15 min) gemahlen und der Premiumsaft wurde mittels Dekanter (Flottweg) gewonnen. Der abgepresste Trester wurde in einem Maischetank mit Wasser im Verhältnis 1:1 vermischt und mit Direktdampf auf 5 C erhitzt. Nach Er- Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26 Originalarbeiten ı 351
3 reichen der Temperatur wurden 25 ppm Pectinex AFP-L 2 (Novozymes) zudosiert und es wurde 2 h kontinuierlich bei 45 5 C gerührt. Der enzymierte Trester wurde über einen Dekanter (Flottweg) entsaftet. Der Tresterextraktionssaft von etwa 4 Brix wurde mittels Fallstromverdampfer auf 12 Brix konzentriert, auf 13 C erhitzt und bis zur Verwendung eingefroren zwischengelagert. 2.2 Isolierung der Saftkolloide Zur Isolierung der einzelnen Saftkolloide wurden die entsprechenden Extraktionssäfte zunächst mittels präparativer Ultrafiltration (Bucher/Abcor, Niederweningen/Schweiz) mit Rohrmodulen bei einem Cut-Off von 18 kda aufkonzentriert. Anschließend wurde ein Teil Retentat mit fünf Teilen 96 %igem (v/v) Ethanol versetzt. Die präzipitierten Kolloide wurden zentrifugiert, mit Ethanol gewaschen und bei 6 C getrocknet. 2.3 Isolierung der Flavonoid- und Betalainextrakte Für einige In-vitro-Fermentationsvarianten wurden Flavonoid- bzw. Betalainextrakte aus den Säften gewonnen. Zur Herstellung der Flavonoidextrakte wurden je 7 ml Extraktionssaft aus Äpfeln bzw. Trauben mittels Festphasenextraktion an C 18 aufgearbeitet. Der Betalainextrakt wurde aus 375 ml Rote-Bete-Saftkonzentrat (1 Brix) nach einer modifizierten Methode von Stintzing et al. (22a) gewonnen. Die schonend (bei 4 C) eingeengten Extrakte wurden anschließend in 7 %igem Methanol aufgenommen und bei 2 C zwischengelagert. 2.4 Analytische Methoden Freie Galakturonsäure wurde mittels HPAEC und PAD-Detektion bestimmt (Will et al., 2). Der Gehalt an Gesamtphenolen wurde mit dem Folin-Ciocalteu-Reagenz (FRC) ermittelt. Die Polyphenole der Apfelsäfte wurden nach Schieber et al. (21) mittels RP-HPLC/DAD bestimmt. Die Detektion der Flavan-3-ole, Procyanidine und Dihydrochalkone erfolgte bei 28 nm, die der Phenolcarbonsäuren bei 32 nm und die der Flavonole bei 36 nm. Die in den Traubensäften enthaltenen Polyphenole wurden nach Rechner et. al. (1998) an einer fluorierten RP-Phase mittels HPLC aufgetrennt und durch UV- bzw. elektrochemischer Detektion bestimmt. Der Nachweis der Flavan-3-ole, Procyanidine und Dihydrochalkone erfolgte bei 28 nm und die der Phenolcarbonsäuren bei 32 nm. Die Traubensäfte wurden auf ihre Gehalte an Stilbenen (Resveratrol und -derivate) an einer fluorierten RP-Phase untersucht. Die Detektion erfolgte mittels UV- Detektion bei 31 nm für trans-isomere und 286 nm für cis-isomere. Die Proben wurden membranfiltriert (,45 µm) und direkt injiziert. In Anlehnung an Nilsson (197) wurden Betaxanthine (als Vulgaxanthin I) und Betacyane (als Betanin) quantitativ erfasst. Die Betalaine wurden mittels HPLC-DAD nach Stintzing et al. (22a) sowie mittels HPLC-ESI-MS im positiven Ionisierungsmodus nach Stintzing et al. (22b) bestimmt. Die antioxidative Kapazität der Extraktionssäfte wurde im so genannten TEAC (Trolox Equivalent Antioxidative Capacity)-Test ermittelt (Miller et al., 1993). Die Methode basiert auf der Fähigkeit der Antioxidanzien, das Radikalion ABTS + (2,2 -Azinobis-3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonat) in wässriger Lösung abzufangen. Als Bezugssubstanz diente das synthetische wasserlösliche Vitamin E-Derivat Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8,-tetramethylchroman-2-carboxylsäure). Gemessen wurde die Entfärbung der intensiv blau gefärbten ABTS + -Lösung durch Antioxidanzien im Vergleich zu Trolox. Die TEAC -Werte werden als Trolox- Äquivalente angegeben. Der Gehalt an Ballaststoffen wurde nach der enzymatischgravimetrischen AOAC-Methode bestimmt (Prosky et al., 1988). 2.5 In-vitro-Fermentation Die In-vitro-Fermentationen wurden mittels der anaeroben Kultivierungstechnik in Hungate-Röhrchen durchgeführt. Die Zusammensetzung des Fermentationsmediums (ph 7,1 ±,1) war wie folgt:,5 % NaCl,,42 % NaHCO 3,,2 M Na 2 HPO 4 /KH 2 PO 4,,1 % Hefeextrakt,,1 % Fleischpepton und,1 % Caseinpepton sowie,25 % Cystein-HCl und,1 % Resazurin. Als Inokulum diente 1 % Frischfaeces zweier Probanden, der zu gleichen Anteilen miteinander gemischt wurde, in,1 M Phosphatpuffer (ph 7,4). Als Substrate wurden die isolierten Saftkolloide (Ballaststoffe) aus den Extraktionssäften (und vergleichsweise aus Premiumsäften) sowie ein hochverestertes Pektin jeweils in einer Endkonzentration von 1 mg/ml eingesetzt. Als Positiv-Kontrolle wurden Ansätze mit 3 % Glucose und als Negativ-Kontrolle Ansätze ohne C-Quelle durchgeführt. In einigen Ansätzen wurde zu den Kolloiden,1 ml Flavonoid- bzw. Betalainextrakt aus dem gleichen Saft zugegeben. Die In-vitro-Fermentationen wurden jeweils in Triplikaten durchgeführt. Für die für die Bestimmung der kurzkettigen Fettsäuren (SCFA, short-chain fatty acids), des ph-wertes und der Bakterienmasse (als Protein) wurden nach, 6, 1 und 24 h Proben entnommen. 2.6 Oxidation von LDL-Cholesterol in vitro LDL wurden für die Oxidationsversuche aus EDTA-Plasma mittels präparativer Dichtegradienten-Ultrazentrifugation nach einer modifizierten Methode von Chung et al. (198) isoliert. Dazu wurde das EDTA-Plasma mit KBr auf eine Dichte von 1,24 g/ml eingestellt und anschließend mit,9 % NaCl (δ = 1,6; 2 µm Butylhydroxytoloul,,1 % EDTA) überschichtet. Im Ausschwingrotor SW6Ti wurden die Proben 3 h bei 41 g ultrazentrifugiert. Danach wurde die LDL-Bande vorsichtig abgenommen und bis zum Oxidationsversuch (maximal 1 Woche) bei 4 C im Dunkeln aufbewahrt. Nach Entsalzen mittels Vivaspin 5-Säulen (Cut-Off 1 kda) und Proteinbestimmung nach Brad- 352 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26
4 ford wurde die Cu 2+ -induzierte Oxidation von LDL in vitro nach einer modifizierten Methode von Zhang et al. (21) durchgeführt. Dazu wurden 125 µg/ml LDL-Protein mit Phosphat-gepufferter Salzlösung (Kontrolle) bzw. mit Extraktionssaft (je 1 µg/ml Gesamtphenole [FCR]) versetzt und 5 min bei 37 C unter Schütteln im Thermoblock inkubiert. Durch Zugabe von frischer CuSO 4 -Lösung (5 µm) wurde die Oxidation der LDL jeweils im Dreifachansatz gestartet. Nach, 2, 4, 6, 8 und 24 h wurde die Reaktion durch Zugabe von 1 % EDTA gestoppt. Die Proben wurden anschließend sofort auf Eis gekühlt und bis zur Messung der Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBARS) bei 2 C eingefroren. Die Oxidation der LDL wurde via TBARS verfolgt. Für die Bestimmung der TBARS wurden,55 ml LDL-Probe mit jeweils,5 ml 25 % (w/v) Trichloressigsäure und 1 % (w/v) Thiobarbitursäure in,3 % (w/v) NaOH 4 min im Thermoblock bei 95 C inkubiert (Wallin et al., 1993). Nach dem Abkühlen auf Eis wurden die Proben 1 min bei 1 g und 4 C zentrifugiert. Die Extinktion des Überstandes wurde bei einer Wellenlänge von 532 nm gegen den Standard Tetraethoxypropan (,5 3 µm) gemessen. 2.7 Ernährungsversuche am Menschen Zehn gesunde Probanden (Alter 2 42 Jahre; BMI 19 25; w/m: 9/1) nahmen in einem Ernährungsversuch über insgesamt dreimal 2 Wochen zur normalen Kost die Extraktionssäfte aus Apfel-, Trauben- und Rote-Bete-Trester über den Tag verteilt zu sich. Von den beiden erst genannten Säften tranken die Probanden täglich 1,4 Liter, vom Rote-Bete-Saft dagegen täglich,7 Liter (Testphasen). Vor, zwischen und nach diesen Saftinterventionsphasen wurden jeweils zweiwöchige saftfreie Run-In- bzw. Wash-Out-Phasen durchgeführt. Diese vier Phasen wurden als Kontrollen betrachtet. Über den gesamten Zeitraum von 14 Wochen wurden jeweils am Ende der zweiwöchigen Saftinterventions- und Kontrollphasen Blut-, Urin- und Faecesproben gesammelt und auf folgende Parameter analysiert: Lipide im Serum, SCFA, Gallensäuren, neutrale Sterole, Mikroflora und ph- Wert im Faeces sowie ph-wert und sekundäre Pflanzenstoffe im Urin. Die Probanden protokollierten während der Saftinterventionsphasen ihr allgemeines körperliches Wohlbefinden im Vergleich zu Nichttesttagen. 2.8 Resorptionsstudie Weiterhin nahmen fünf gesunde weibliche Probanden (Alter Jahre; BMI 2 25) an einer Resorptionsstudie teil. Zur besseren Verfolgung der Resorption wurden die Probanden dazu angehalten, sich über einen Zeitraum von insgesamt 4 Tagen frei von sekundären Pflanzenstoffen zu ernähren, d.h. es sollten sämtliche pflanzliche Lebensmittel bzw. Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs gemieden werden, um einen Wash-Out derartiger Pflanzeninhaltsstoffe im Körper zu erzielen. Somit beschränkte sich der Verzehr während dieses Zeitraumes besonders auf folgende Lebensmittel: Milch, Wasser, Käse ohne Kräuterzusätze, Eier, Weißbrot, Buttermilch, Butter, Margarine, Naturquark, Naturjoghurt, Fisch, Fleisch, Salz, Zucker, Nudeln (keine Vollkornnudeln), weißer Reis, Honig und weißes Mehl. Dagegen durften Obst und Gemüse sowie deren Produkte, Gewürze, Tee, Kaffee, Kakao, Schokolade, Wein, Fruchtsäfte, Vollkornprodukte und Nüsse nicht verzehrt werden. Während der vier sekundärstofffreien Tage führten die Probanden ein Ernährungsprotokoll. Am 1. und 2. Interventionstag wurde von den Probanden je ein Aliquot des Morgen-Urins zur Analyse der sekundären Pflanzenstoffe gesammelt. Nach 1- bis 12-stündiger Nahrungskarenz fand am 3. Tag der eigentliche Resorptionsversuch statt. Die Probanden erhielten nüchtern 5 ml des Tresterextraktionssaftes aus Äpfeln oder Trauben innerhalb von 1 min. In den ersten 4 h nach dem Trinken des Saftes sollte von den Probanden weiterhin eine Nahrungskarenz eingehalten werden. Anschließend waren nur Mahlzeiten erlaubt, die frei von sekundären Pflanzenstoffen waren. Die Resorption wurde anhand von Blut- und Urinproben verfolgt. Die Blutabnahmen erfolgten, 3, 6, 9 min sowie 2, 4, 6, 8 und 24 h nach der Saftaufnahme. Der Urin wurde am 3. Tag über 24 h in Aliquoten gesammelt und sofort eingefroren. Nach der letzten Blutabnahme (nach 24 h) wurden zwei weitere Urinproben von jedem Probanden gesammelt. Erst danach durften alle Probanden wieder ihre Normaldiät aufnehmen. Die Versuche am Menschen wurden von der Ethikkommission der Universität Potsdam geprüft und genehmigt. 2.9 Bestimmung physiologischer Parameter Triglyceride, Gesamtcholesterol sowie HDL- und LDL- Cholesterol wurden enzymatisch im Serum unter Anwendung kommerzieller Kits (Olympus Diagnostica GmbH, Hamburg) gemessen. Die Analyse der Serumlipide wurde durch das Hygiene Institut Labordiagnostik Potsdam GbR durchgeführt. Die SCFA bei den In-vitro-Untersuchungen und in den Faecesproben wurden nach Zugabe des internen Standards iso-buttersäure zunächst in ihre lagerstabilen Na-Salze umgewandelt. Vor der Analyse wurden diese durch Zugabe von Ameisensäure in ihre flüchtige Form überführt. Die gaschromatographische Bestimmung der SCFA erfolgte an einer HP-FFAP-Säule (3 m,53 mm) im GC-System von Hewlett-Packard (Waldbronn) (Dongowski et al., 22). Die während der In-vitro-Fermentation entstandene Bakterienmasse wurde nach Waschen in Phosphat-gepufferter Salzlösung und dreimaligem Einfrieren und Auftauen als Protein mittels Bichinchoninsäure-Kit (Fa. Pierce, Rockford/USA) bestimmt. In den Faecesproben wurden die Gesamtzellzahlen der fakultativen aeroben und der anaeroben Bakterien sowie die Zellzahlen der Lactobacillen; Bacteroides-Gruppe; Bifidobacterium sp. und Escherichia coli mittels klassischer Methoden bestimmt (Sembries et al., 23). Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26 Originalarbeiten ı 353
5 SCFA (mmol/l) Kolloide aus Apfeltresterextraktionssaft Kolloide aus Apfeltresterextraktionssaft + Polyphenole Butyrat Propionat Acetat Die statistischen Analysen wurden mit der Statistical Package for Social Sciences Software SPSS 11. (SPSS Inc., Chicago/ USA) durchgeführt. Die Werte werden als Mittelwerte und Standardfehler (SD bzw. SEM) angegeben. Die Daten wurden durch einseitige ANOVA und dem Dunnett s t-test analysiert. Differenzen mit P <,5 werden als signifikant angesehen h 1 h 24 h 6 h 1 h 24 h Fermentationszeit Abb. 1 Bildung von SCFA während der In-vitro-Fermentation der Kolloide aus Apfeltresterextraktionssaft allein und in Gegenwart von safteigenen Polyphenolen mit Humanfaeces. Werte sind Mittelwerte ± SD (n = 3) Vor der Bestimmung der Steroide wurden gefriergetrocknete Faecesproben mit,5 M NaOH in EtOH hydrolysiert und dann zentrifugiert. Im Überstand wurden die neutralen Sterole durch Extraktion mit Hexan abgetrennt, während die Gallensäuren in der wässrigen Phase verbleiben. Die neutralen Sterole wurden durch Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie auf Kieselgel 6 F 254 -Platten (Merck, Darmstadt) mit Ether-Heptan (55:45; v/v) im HPTLC-System von Camag (Muttenz/Schweiz) getrennt (Dongowski et al., 23). Die Gallensäuren wurden zunächst mittels Festphasenextraktion an Bakerbond spe C 18 -Kartuschen gereinigt, dann mit 4-Brommethyl-7-methoxycumarin in Gegenwart von Crown-6 als Katalysator derivatisiert und mittels HPLC und Fluoreszenzdetektion an einer unpolaren stationären Phase (Nucleosil 1 Å; C 18 ; 5 µm; 25 4,6 mm) in einer Modifikation nach Wang et al. (199) an einer HPLC- Anlage von Gynkotek (Germering) bestimmt (Dongowski et al. 23). Für die Bestimmung von sekundären Pflanzenstoffen wurde Citratplasma 2 h bei 37 C mit β-glucuronidase (aus Helix pomatia) (1 IE/µl in,2 M Na-Acetatpuffer, ph 5,) deglucuronidiert (N 2 -Atmosphäre) und anschließend mit,2 M Na-Acetatpuffer (ph 5,) und MeOH/Eisessig (1:1) versetzt. Nach Zentrifugation wurde der Überstand schonend bis zur Trockne eingeengt und in Dimethylformamid/H 2 O (2:1) aufgenommen. In einem Parallelansatz wurden die Plasmaproben ohne den Zusatz von β-glucuronidase behandelt. Urinproben (ca. 2 ml) wurden zunächst mittels Festphasenextraktion an C 18 -Kartuschen vorbehandelt. Das methanolische Eluat wurde bis zur Trockne eingeengt, und der Rückstand wurde in Wasser aufgenommen. Anschließend wurden die Proben analog zu den Plasmaproben weiter aufgearbeitet. Bis zur Analyse mittels HPLC und coulorimetrischer Detektion (Pforte et al., 2) wurden die aufgearbeiteten Proben bei 2 C gelagert. 3 Ergebnisse 3.1 Zusammensetzung der Extraktionssäfte Im Apfelextraktionssaft wurden folgende analytische Parameter bestimmt: Trockenmasse (TM) 12,3 Brix; Kolloide 5,5 g/l; Gesamtsäure (als Weinsäure bei ph 7,) 7,5 g/l; freie Galakturonsäure 4,44 g/l; Ballaststoffe 5,92 g/l; antioxidative Kapazität (TEAC) 15,7 mmol Trolox/l; Gesamtphenole 1658 mg/l. Mittels HPLC wurden folgende Konzentrationen an Polyphenolen (in mg/l) gefunden: Catechin 1,8; Epicatechin 71,2; Kryptochlorogensäure 7,6; Chlorogensäure 237,8; 3-Coumaroylchinasäure 15,4; 4-Coumaroylchinasäure 88,8; 5-Coumaroylchinasäure 8,2; Phloretin-2 xyloglucosid 216,4; Phloretin-2 -xylogalactosid 9,5; Phloridzin 187,2; Quercetin-3-rutinosid 8,9; Quercetin-3-galactosid 24,6; Quercetin-3-glucosid 13,4; Quercetin-3-xylosid 1,3; Quercetin-3-arabinosid 2,6; Quercetin- 3-rhamnosid 32,7; Procyanidin B1 18,9; Procyanidin B2 156,5; Gesamt-Polyphenole 112. Im Extraktionssaft aus Trauben wurden folgende analytische Parameter ermittelt: TM 4,4 Brix; Kolloide,9 g/l; Gesamtsäure (als Weinsäure bei ph 7,) 3, g/l; freie Galakturonsäure,69 g/l; Ballaststoffe 2,44 g/l; antioxidative Kapazität (TEAC) 23,4 mmol Trolox/l; Gesamtphenole 1877 mg/l. Mittels HPLC wurden folgende Konzentrationen an Polyphenolen (in mg/l) gefunden: Catechin 225,8; Epicatechin 195,; Gallussäure 13,5; p-coumaroyl-glucosyltartrat 3,2; Caftarsäure 8,4; Coutarsäure 4,7; Quercetinderivate 21,1; cis-piceid (als trans-resveratrol),4; Procyanidin B1 6,7; Procyanidin B2 46,7; Gesamt-Polyphenole 58. Im verwendeten Extraktionssaft aus Roten Beten wurden folgende analytische Parameter gemessen: TM 12, Brix; Kolloide 1,8 g/l; Gesamtsäure (als Weinsäure bei ph 7,) 1,2 g/l; freie Galakturonsäure,38 g/l; Ballaststoffe 1,27 g/l; antioxidative Kapazität (TEAC) 14,5 mmol Trolox/l; Gesamtphenole 184 mg/l; Betacyane 14 mg/l; Betaxanthin 16 mg/l; Gesamt-Betalaine 246 mg/l. 3.2 In-vitro-Fermentation Bei der Fermentation der einzelnen Substrate in vitro, die den bakteriellen Abbau der Ballaststoffe im Dickdarm si- 354 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26
6 muliert, waren Acetat, Propionat und Butyrat die dominierenden kurzkettigen Fettsäuren. Mit Ausnahme der Negativ- Kontrolle (ohne Substrat) lag der prozentuale Anteil von n-valeriat und iso-valeriat in zu vernachlässigender Menge bei oder unter 2 % der Gesamt-SCFA. Während der Fermentation der Kolloide aus dem Extraktionssaft vom Apfel wurde ein stetiger Anstieg der SCFA bis etwa 1 h beobachtet (Abb. 1). Nach 24 h wurden etwa 7 mmol Gesamt-SCFA/l gemessen. Bei der Fermentation der Kolloide aus den Premiumsäften wurden in ähnliche Konzentrationen an SCFA erzielt (Daten nicht gezeigt). Die prozentuale Verteilung von Acetat:Propionat:Butyrat lag nach 24 h bei 68:16:16 für die Kolloide aus dem Extraktionssaft. Wurde bei der Fermentation ein Flavonoidextrakt SCFA (mmol/l) Kolloide aus Traubentresterextraktionssaft Kolloide aus Traubentresterextraktionssaft + Polyphenole 6 h 1 h 24 h 6 h 1 h 24 h Fermentationszeit Butyrat Propionat Acetat Abb. 2 Bildung von SCFA während der In-vitro-Fermentation der Kolloide aus Traubentresterextraktionssaft allein und in Gegenwart von safteigenen Polyphenolen mit Humanfaeces. Werte sind Mittelwerte ± SD (n = 3) SCFA (mmol/l) Kolloide aus Rote-Bete-Tresterextraktionssaft aus demselben Saft zugesetzt, so erhöhte sich die Konzentration an Gesamt-SCFA auf 79 mmol/l nach 24 h (Abb. 1). Dabei wurde ein Anstieg des Anteils an Butyrat gemessen, was aufgrund seiner ernährungsphysiologischen Bedeutung ein wünschenswerter Effekt ist. Die prozentuale Verteilung von Acetat:Propionat:Butyrat betrug hier 64:15:21. Bei der Fermentation von Traubensaftkolloiden wurden im Vergleich zu den Apfelsaftkolloiden geringere Ausbeuten an Gesamt-SCFA gefunden, wie Abb. 2 für die Probe aus dem Extraktionssaft zeigt (57 mmol nach 24 h). Nach einer Inkubationszeit von 6 h stieg die SCFA-Konzentration nur unwesentlich weiter an, d. h. es trat eine Substratlimitierung ein. Bei der Fermentation der Kolloide aus dem Premiumsaft von Trauben wurden nach 24 h nur ca. 5 mmol Gesamt-SCFA gebildet (Daten nicht gezeigt). Im Unterschied zu den Apfelsaftkolloiden wurden die Traubensaftkolloide zu deutlich mehr Acetat fermentiert. Der prozentuale Anteil der einzelnen SCFA betrug hier 73:13:14. Ein Zusatz des Polyphenolextraktes aus dem Extraktionssaft von Trauben zum Fermentationsansatz der Kolloide führte überraschenderweise zu einer starken Hemmung der Fermentation (Abb. 2). Erst nach 24 h lagen 51 mmol/l Gesamt-SCFA vor. Die prozentualen Anteile von Acetat:Propionat: Butyrat betrugen 71:2:9, d. h. es wurde anteilig mehr Propionat von der Faecesflora produziert. Bei der Fermentation der Kolloide aus dem Extraktionssaft von Roten Beten wurden nach 24 h 55 mmol/l Gesamt- SCFA gebildet (molares Verhältnis Acetat: Propionat:Butyrat 59:36: 5) (Abb. 3). Insgesamt wurden diese Kolloide relativ langsam fermentiert. Ein Zusatz des safteigenen Betalainextraktes zum Fermentationsansatz führte zu einer Steigerung der Gesamt-SCFA auf 68 mmol/l nach 24 h (Abb. 3). Überraschenderweise wurden hohe Anteile an Propionat gebildet, während der Anteil von Acetat abnahm. Das molare Verhältnis der einzelnen SCFA betrug 47:35:18. Im Kontrollversuch ohne Substrat wurden nach 24 h nur 18 mmol SCFA gefunden. Da hier keine C-Quelle zur Verfügung stand, wurde in diesen Fermentationsansätzen im Vergleich zu allen anderen Fermentationen auch relativ hohe Anteile an Valeriaten aus dem Proteinabbau gebildet (Acetat:Propionat:Butyrat:n-Valeriat:iso-Valeriat 51:13:18:7:11). Weil Pektin-Polysaccharide den Hauptbestandteil der Saft- Kolloide aus Rote-Bete-Tresterextraktionssaft + Betalaine 6 h 1 h 24 h 6 h 1 h 24 h Fermentationszeit Butyrat Propionat Acetat Abb. 3 Bildung von SCFA während der In-vitro-Fermentation der Kolloide aus Rote-Bete-Tresterextraktionssaft allein und in Gegenwart von safteigenen Betalainen mit Humanfaeces. Werte sind Mittelwerte ± SD (n = 3) Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26 Originalarbeiten ı 355
7 SCFA (mmol/l) Glucose 6 h 1 h 24 h 6 h 1 h 24 h Fermentationszeit kolloide bilden, wurde vergleichsweise ein handelsübliches, hochverestertes Citruspektin untersucht. Dieses Polysaccharid wurde mit ähnlicher Geschwindigkeit wie die Kolloide aus den Extraktionssäften fermentiert. Nach 24 h wurden hier 61 mmol Gesamt-SCFA gebildet. Das molare Verhältnis der einzelnen SCFA lag bei 66:12:22 (Abb. 4). Mit zunehmender Fermentationszeit verschoben sich die prozentualen Anteile des Acetats zugunsten von Propionat und besonders von Butyrat. Intensiv wurde die als Positiv-Kontrolle eingesetzte Glucose (3 %) fermentiert. Nach 24 h wurden hier 93 mmol/l Gesamt-SCFA gemessen, wobei hauptsächlich Acetat gebildet wurde (Acetat:Propionat:Butyrat 81:6:13) (Abb. 4). Infolge der Protonenanhäufung durch die Bildung der SCFA während des Substratabbaus kam es zur Senkung des ph- Butyrat Propionat Acetat Abb. 4 Bildung von SCFA während der In-vitro-Fermentation von Glucose und hochverestertem Pektin mit Humanfaeces. Werte sind Mittelwerte ± SD (n = 3) ph-wert 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Abb. 5 Verlauf des ph-wertes während der In-vitro-Fermentationen von Saftkolloiden, Glucose und Pektin mit Humanfaeces. Werte sind Mittelwerte (n = 3) (AP: Äpfel; TR: Trauben; RB: Rote Bete; Glc: Glucose; Pek: Pektin; P: Polyphenole; B: Betalain) Pektin h 6 h 1 h 24 h Fermentationszeit Wertes im Medium. Da von den getesteten Kolloiden die Ballaststoffe aus den Extraktionssäften vom Apfel am besten durch die Mikroflora abbaubar waren, erfolgte hier auch die stärkste ph-wert- Senkung (Abb. 5). Bei Zusatz des Polyphenolextrakts im Fermentationsmedium wurde der ph-wert sogar noch weiter abgesenkt. Die weniger gut fermentierbaren Traubensaftkolloide konnten hingegen den ph-wert im Medium nur maximal um eine halbe ph-einheit senken. Aufgrund ihrer etwas besseren Abbaubarkeit im Vergleich zu den Traubenkolloiden sank der ph-wert bei den Rote-Bete-Kolloiden insgesamt um ca. 1,5 ph-einheiten. Der ph-wert des Kontrollversuchs (ohne Substrat) veränderte sich während der Fermentation kaum, während bei Einsatz von Glucose als Substrat erwartungsgemäß die stärkste Abnahme des ph-wertes gemessen wurde (Abb. 5). Der Zuwachs an Biomasse während der Fermentation wurde indirekt durch Messung des Proteingehalts im Ansatz verfolgt. Ohne Substrat kam es aufgrund mangelnder C-Quellen zur Zelllyse und zu einer Abnahme des Proteingehaltes (Abb. 6). Dieses zeigt sich auch im Anstieg der Valeriat-Konzentrationen. Der Biomassezuwachs war bei Anwesenheit der Apfelsaftkolloide im Medium vergleichbar mit dem in der Positiv-Kontrolle. Relativ gering war die Zunahme an Biomasse bei Einsatz der Kolloide aus dem Extraktionssaft von Trauben, während bei Einsatz des Präparates von Roten Beten eine hohe Zuwachsrate gemessen wurde. Ein Zusatz der Polyphenolextrakte während der Fermentation der Kolloide resultierte in einer deutlichen Zunahme der Biomasse, die höher war als bei der Fermentation von Glucose und Pektin (Abb. 6). ohne AP AP+P TR TR+P RB RB+B Glc Pek 3.3 Oxidation von LDL-Cholesterol in vitro In einem weiteren In-vitro-Versuch wurden die antioxidativen Eigenschaften der sekundären Pflanzenstoffe der drei Extraktionssäfte getestet. Bei der Lipidperoxidation (z. B. bei oxidativem Stress) entsteht u. a. das Sekundärprodukt Malondialdehyd (MDA) infolge des Abbaus von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Über die TBARS wurde die Metallioneninduzierte Oxidation isolierter LDL in Ab- bzw. Anwesenheit der Säfte aus Äpfeln, Trauben und Roten Beten verfolgt. Die Ergebnisse sind in Abb. 7 zusammengestellt. Der Extraktionssaft wurde für die In-vitro-Oxidation in einer Kon- 356 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26
8 zentration von 1 µg/ml Gesamtphenolen (FCR) eingesetzt. Bei der Oxidation von LDL wurde die Lag-Phase durch die Anwesenheit von antioxidativ wirksamen Saftinhaltsstoffen verzögert. Erst nach 4 h (Traube) bzw. 6 h (Apfel, Rote Bete) Inkubation begann die Oxidation der isolierten LDL in vitro, was in einem leichten Anstieg der TBARS erkennbar ist. Bei der Kontrolle (ohne Zusatz der Säfte) erfolgte die Oxidation dagegen sofort. Der Extraktionssaft aus Roten Beten war in seiner antioxidativen Wirkung am effektivsten. Selbst nach einer Inkubationszeit von 24 h wurden nur 9 nmol MDA/mg LDL-Protein gemessen, während in allen anderen Versuchen, bei denen die LDL- Oxidation bereits vollständig abgeschlossen war, Werte um ca. 14 nmol MDA/ mg LDL-Protein auftraten. Auch der Extraktionssaft aus Äpfeln zeigte eine hohe antioxidative Wirksamkeit. Bis zu einer Inkubationszeit von 8 h lag diese auf dem Niveau vom Rote-Bete-Saft. In Anwesenheit des Traubensaftes hingegen wurde die vollständige Oxidation der LDL bereits nach 8 h erreicht (Abb. 7). 3.4 Ernährungsversuche am Menschen Körperliches Wohlbefinden Die untersuchten Säfte wurden von den Probanden unterschiedlich gut akzeptiert. Der Extraktionssaft aus Trauben wurde als stark adstringierend empfunden. Der Extraktionssaft aus Äpfeln wurde als sehr süß bewertet, jedoch am besten angenommen. Das Konzentrat aus Roten Beten fand dagegen die geringste Akzeptanz, vornehmlich aufgrund des ungewohnt süßen Geschmacks sowie seiner Farbe und Konsistenz. Während des 14-wöchigen Versuchs wurde insgesamt dreimal das körperliche Wohlbefinden der Probanden jeweils am Ende der 2- wöchigen Saftinterventionen im Vergleich zu Nicht-Testtagen ermittelt. Die häufigste Nebenwirkung beim Verzehr von täglich 1,4 Liter Extraktionssäfte aus Äpfeln und Trauben über 2 Wochen war das Auftreten von Flatulenzen. In ihren körperlichen Aktivitäten waren unter dem Saftkonsum insgesamt keine Einschränkungen zu verzeichnen. Der Verzehr der Säfte führte bei einigen Probanden zur Erhöhung der Stuhlfrequenz. Trotz teilweise unterschiedlicher Stuhlkonsistenzen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der Faeces-TM zwischen Kontroll- und Saftinterventionsphasen. Biomassezuwachs (mg Protein/l) h 1 h 24 h Fermentationszeit ohne AP AP+P TR TR+P RB RB+B Glc Pek Abb. 6 Biomassezuwachs (als Protein bestimmt) während der In-vitro-Fermentationen von Saftkolloiden, Glucose und Pektin mit Humanfaeces. Werte sind Mittelwerte (n = 3) (AP: Äpfel; TR: Trauben; RB: Rote Bete; Glc: Glucose; Pek: Pektin; P: Polyphenole; B: Betalain) TBARS (nmol MDA/mg LDL-Protein) Flüssigkeitsaufnahme und Urinexkretion Die Flüssigkeitsaufnahme und Urinausscheidung waren während der Saftinterventionen höher als während der Kontrollphasen. Die Aufnahme betrug 2,4 ±,1 l/d in den Kontrollphasen und 2,45 ±,11 l/d während der Saftinterventionen. In den Kontrollphasen wurden 2,29 ±,12 l Urin/d ausgeschieden und unter Saftgabe 2,56 ±,11 l Urin/d. Die sonst von den Probanden aufgenommenen Getränke wurden während der zweiwöchigen Saftinterventionen nur teilweise durch die Extraktionssäfte ersetzt, was sich in der erhöhten Flüssigkeitsaufnahme widerspiegelt (P <,5) Reaktionszeit Kontrolle Apfel Traube Rote Bete Abb. 7 Oxidation von LDL-Cholesterol in Anwesenheit von 5 μm Cu 2+ ohne (Kontrolle) und mit Zusatz der Extraktionssäfte aus Äpfeln, Trauben und Roten Beten (1 μg/ml Gesamtphenole). Werte sind Mittelwerte (n = 3) (TBARS: Thiobarbitursäure-reaktive Substanzen; MDA: Malondialdehyd) Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26 Originalarbeiten ı 357
9 6, 5, der von 2,8 auf 2,6 sank. Alle anderen bestimmten Parameter blieben unverändert. Serumlipide (mmol/l) 4, 3, 2, 1,, Gesamt- Cholesterol HDL- Cholesterol LDL- Cholesterol Triglyceride Cholesterol/ HDL LDL/HDL ph-werte in Urin- und Faecesproben Signifikanten Unterschiede waren bei den ph-werten von Faecesproben zwischen den Kontroll- (7,11 ±,6) und Interventionsphasen (7,25 ±,5) nicht feststellbar (P =,1). Bei den Urinen (24-h-Proben) lag der ph-wert unter Saftintervention mit 6,7 ±,5 höher als 5,81 ±,5 in den Kontrollphasen (P <,5). Serumlipidspiegel Die Saftinterventionen hatten wenig Einfluss auf die Serumlipide (Abb. 8). Nur die Konzentration an Cholesterol nahm unter Saftgabe durchschnittlich von 4,9 mmol/l während der Kontrollphasen auf 4,6 mmol/l ab. Ebenso verhielt sich der Quotient aus Cholesterol und HDL-Cholesterol, Kontrollphasen Saftphasen Abb. 8 Serumlipide der Probanden während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften. Die Werte für die Kontrollphasen (n = 4) und die 3 Saftphasen (n = 3) sind jeweils zusammengefasst. Werte sind Mittelwerte ± SEM Bakterien-Zellzahlen (in der TM) 1,E+11 1,E+1 1,E+9 1,E+8 1,E+7 1,E+6 1,E+5 Fakultative Aerobier Gesamt- Anaerobier Coliforme Bacteroides Lactobacillus Bifidobacterium Abb. 9 Bakterien-Zellzahlen in frischen Faeces der Probanden während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften. Die Werte für die Kontrollphasen (n = 4) und die 3 Saftphasen (n = 3) sind jeweils zusammengefasst. Werte sind Mittelwerte ± SEM Bakterien-Zellzahlen in Faeces Während des Ernährungsversuchs gab es nur geringe Veränderungen in den Keimzahlen. Diese wurden besonders bei den fakultativen Aerobiern und bei der Lactobacillus-Gruppe gemessen. Signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und den Versuchsphasen, d. h. Veränderungen über eine Größenordnung hinaus, wurden nicht gefunden (Abb. 9). Kurzkettige Fettsäuren in Faeces In den Konzentrationen der drei wichtigsten SCFA Acetat, Propionat und Butyrat in Faeces der Probanden gab es individuell sehr große Unterschiede über den gesamten Versuchszeitraum hinweg. Es konnte kein einheitliches SCFA-Muster in Abhängigkeit von den Kontroll- und Saftinterventionsphasen beobachtet werden. Als ein Beispiel sind die SCFA-Konzentrationen in Faeces im gesamten Versuchszeitraum beim Probanden 3 in Abbildung 1 dargestellt. Es muss beachtet werden, dass über 9 % der im Dickdarm gebildeten SCFA schnell resorbiert werden, so dass ihre Konzentration in Faeces besonders dann ein sinnvoller Parameter für die Fermentationsrate ist, wenn eine hohe Ballaststoff-Konzentration in der Diät anwesend ist. Die molekularen Verhältnisse von Acetat, Propionat und Butyrat blieben bei allen Probanden nahezu unverändert. Kontrollphasen Saftphasen Gallensäuren und neutrale Sterole in Faeces Die Ausscheidung der Gallensäuren in Faeces der Probanden während des Versuchszeitraums ist in Tabelle 1 zusammengestellt. Es wurde ein breites Spektrum an Gallensäuren gefunden, das durch den Konsum der Extraktionssäfte aus Trauben, Äpfeln und Roten Beten in den Testphasen trotz der relativ starken individuellen Schwankungen beeinflusst wurde. So bewirkte die Gabe von Extraktionssäften insgesamt eine signifikante (P <,5) Zunahme der Ausscheidung der primären Gallensäuren Cholsäure, 7-Ketodesoxycholsäure und Chenodesoxycholsäure. Durch die Saftinterventionen konnte im Gegenzug die Konzentrationen der sekundären Gallensäure Desoxycholsäure, die einen Hauptanteil der ausgeschiedenen Gallensäuren bildet 358 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26
10 und ein unmittelbarer Metabolit der mikrobiellen Transformation der Cholsäure ist, in Faeces signifikant gesenkt werden (P <,5) (Abb. 11). Während der Saftintervention wurden etwa 1 % mehr primäre Gallensäuren im Vergleich zu den Kontrollphasen ausgeschieden (Abb. 12). Dagegen nahm der Anteil an sekundären Gallensäuren in Faeces der Probanden ab. Der Anteil der primären Gallensäuren erhöhte sich von 26,6 % (Kontrollen) auf 31,9 % (Saftphasen). Es wurden auch mit durchschnittlich 28,5 µmol/g TM mehr Gesamt-Gallensäuren unter Saftgabe ausgeschieden als in den Kontrollphasen (durchschnittlich 27,47 µmol/g TM) (P <,5). Die Anteile der beiden Gallensäure-Familien blieben im Untersuchungszeitraum unverändert. So lag der Anteil der Cholsäure-Familie, zu der Cholsäure, Desoxycholsäure, 7-Ketodesoxycholsäure, 3α-,12β-Dihydroxycholansäure und 12-Ketolitocholsäure gehören, bei ca. 73 % während des gesamten Versuchszeitraums. Neben den Gallensäuren wurden auch die neutralen Sterole (Cholesterol und seine Metabolite) in Faeces der Probanden im Untersuchungszeitraum analysiert. Im Vergleich zu den Kontrollphasen war ein Anstieg in der Ausscheidung der gesamten neutralen Sterole von durchschnittlich 82,5 µmol/ g TM auf 85,7 µmol/g TM unter den Saftinterventionen zu verzeichnen, der nahezu ausschließlich durch die vermehrte Exkretion der Cholesterol-Metabolite Coprostanon und Cholestanon bedingt wurde (Abb. 13) (P <,5). Coprostanon nahm von ca. 5,3 µmol/g TM auf 6,5 µmol/g TM in Faeces der Probanden zu und Cholestanon erhöhte sich von 8,3 auf 1, µmol/g TM. Sowohl die Konzentration dieser beiden Metabolite und als auch die der Summe der neutralen Sterole sanken in den Kontrollphasen wieder auf den Ausgangswert ab. Die Konzentrationen an Cholesterol und Coprostanol blieben dagegen im gesamten Untersuchungszeitraum annähernd unverändert bei 29,5 bzw. SCFA (µmol/g TM) Proband 3 Kontrolle 1 Traube Kontrolle 2 Apfel Kontrolle 3 Rote Bete Kontrolle 4 Butyrat Propionat Acetat Abb. 1 Kurzkettige Fettsäuren (SCFA) in frischen Faeces des Probanden 3 während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften 39,5 µmol/g TM. Verschiedene Vertreter der Phytosterole wurden ebenfalls in Faeces der Probanden gefunden (Daten nicht gezeigt). Betrachtet man den Gehalt an Gesamtsteroiden, die während des Ernährungsversuchs von den Probanden in Faeces ausgeschieden wurden, so waren ca. 75 % den neutralen Sterolen zuzuordnen (Tab. 2). Die restlichen 25 % entfielen auf die Gallensäuren. Insgesamt wurden durchschnittlich mehr als 1 µmol Gesamtsteroide/g TM mit den Faeces ausgeschieden. Das geringe Absinken des Serum-Cholesterolspiegels steht offenbar mit der erhöhten Ausscheidung der Steroide während der Saftphasen in Zusammenhang. Sekundäre Pflanzenstoffe im Urin Die Resorption sekundärer Pflanzenstoffe aus den drei getesteten Extraktionssäften wurde während des Ernährungsversuchs durch ihr Auftreten im Urin verfolgt. Da nicht bei allen Probanden Polyphenole und deren Metabolite gefunden wurden, ergab sich eine relativ große Streubreite der Durchschnittswerte. Tab. 1 Faecale Ausscheidung von Gallensäuren in den Kontroll- und Saftinterventionsphasen während des Untersuchungszeitraums (W: Wochen) W Versuchsphase Kontrolle 1 Trauben Kontrolle 2 Äpfel Kontrolle 3 Rote Bete Kontrolle 4 C DC # KDC DHC # KLC # CDC LC # UDC HDC # 6,5 ±,54 7,27 ±,6 5,98 ±,55 7,96 ±,57 6,2 ±,55 7,34 ±,51 6,36 ±,54 11,4 ±,8 1,25 ±,73 11,4 ±,82 1,17 ±,72 11, ±,75 1,26 ±,85 11,11 ±,88,9 ±,2,15 ±,3,8 ±,1,17 ±,3,7 ±,1,14 ±,3,8 ±,1 1,69 ±,23 1,8 ±,25 1,64 ±,22 1,6 ±,24 1,55 ±,22 1,57 ±,24 1,46 ±,26 [µmol/g Trockenmasse] 1,33 ±,17 1,53 ±,16 1,3 ±,17 1,37 ±,19 1,34 ±,2 1,25 ±,17 1,22 ±,22,75 ±,1,9 ±,11,73 ±,11,92 ±,1,7 ±,7,79 ±,11,69 ±,12 5,73 ±,41 5,51 ±,45 5,68 ±,45 5,8 ±,45 5,66 ±,44 5,62 ±,41 5,78 ±,49,36 ±,5,51 ±,6,38 ±,5,5 ±,5,46 ±,4,47 ±,7,38 ±,6,56 ±,1,59 ±,8,58 ±,1,63 ±,12,63 ±,11,62 ±,11,62 ±,12 Werte sind Mittelwerte ± SEM (n = 1); signifikanter Unterschied zu den Kontrollphasen (P <,5); C: Cholsäure; DC: Desoxycholsäure; KDC: 7-Ketodesoxycholsäure; DHC: 3α,12β-Dihydroxycholansäure; KLC: 12-Ketolithocholsäure; CDC: Chenodesoxycholsäure; LC: Lithocholsäure; UDC: Ursodesoxycholsäure; HDC: Hyodesoxycholsäure; # sekundäre Gallensäure Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26 Originalarbeiten ı 359
11 Gallensäuren (µmol/g TM) C DC KDC DHC KLC CDC LC UDC HDC Kontrollphasen Saftphasen Abb. 11 Gallensäuren in Faeces der Probanden während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften. Die Werte für die Kontrollphasen (n = 4) und die 3 Saftphasen (n = 3) sind jeweils zusammengefasst. Werte sind Mittelwerte ± SEM; signifikanter Unterschied zu den Kontrollphasen (P <,5); (C: Cholsäure; DC: Desoxycholsäure; KDC: 7-Keto-Desoxycholsäure; DHC: 3a,12b-Dihydroxycholansäure; KLC: 12-Ketolithocholsäure; CDC: Chenodesoxycholsäure; LC: Lithocholsäure; UDC: Ursodesoxycholsäure; HDC: Hyodesoxycholsäure) Gallensäuren (µmol/g TM) Primäre Gallensäuren Sekundäre Gallensäuren Gesamt-Gallensäuren Kontrolle 1 Traube Kontrolle 2 Apfel Kontrolle 3 Rote Bete Kontrolle 4 Abb. 12 Konzentration an primären, sekundären und Gesamt-Gallensäuren in Faeces der Probanden während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften (n = 1). Werte sind Mittelwerte ± SEM Bei den Untersuchungen mit den Extraktionssäften aus Trauben und Äpfeln traten in den Kontrollen Quercetin sowie in geringeren Mengen 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure (DHPES) und Isorhamnetin auf. Während Isorhamnetin durch Methylierung von Quercetin im Organismus entsteht, ist DHPES ein mikrobielles Abbauprodukt von Quercetin. Nur bei Gabe des Extraktionssaftes aus Trauben wurde das Abbauprodukt Homovanillinsäure in deutlichen Mengen gefunden. Während der Intervention mit dem Extraktionssaft aus Äpfeln trat das für den Apfel typischen Dihydrochalcon Phloretin im Urin auf. Außerdem kamen geringe Konzentrationen an Phloretin in der Kontrollphase nach Gabe des Extraktionssaftes aus Äpfeln vor (Abb. 14). Etwa 1 % der mit den Säften aufgenommenen Polyphenole wurde im Urin wieder gefunden. Der Rote-Bete-Farbstoff Betanin wurde bei Gabe des Extraktionssaftes aus Roten Beten bei insgesamt 6 von 9 Probanden im Urin nachgewiesen, wobei sich eine relativ große Streubreite ergab. Die Einzelwerte lagen zwischen 493 und 4265 nmol/24 h. Im 24-h-Urin wurden durchschnittlich 1253 ± 457 nmol Betanin gefunden. Etwa,8 % der aufgenommenen Betaninmenge wurde im Urin wieder gefunden. Bei einigen Probanden war auch makroskopisch eine Verfärbung des Urins durch den Rote-Bete-Farbstoff erkennbar. Die Untersuchungen zeigen, dass die sekundären Pflanzenstoffe partiell resorbiert und als Metabolite, teilweise in Form von mikrobiellen Abbauprodukten, renal ausgeschieden werden. Tab. 2 Steroide in den Faecesproben der Probanden Woche Versuchsphase Gallensäuren Neutrale Sterole Kontrolle 1 Trauben Kontrolle 2 Äpfel Kontrolle 3 Rote Bete Kontrolle 4 27,6 28,5 27,41 29,11 27,41 28,6 27,71 Gesamtsteroide Gallensäuren [µmol/g Trockenmasse] [%] 81,92 85,56 82,71 86,8 82,73 85,46 83,75 19,52 114,6 11,12 115,91 11,14 113,52 111,46 25,5 25,3 25,3 25,4 25,3 25, 25,2 Neutrale Sterole 74,5 74,7 74,7 74,6 74,7 75, 74,8 3.5 Resorptionuntersuchungen Die Resorption der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zweier Extraktionssäfte (Äpfel und Trauben) wurde an insgesamt 5 Probanden mittels Urin- und Plasmaproben verfolgt. Eine Resorption von sekundären Pflanzenstoffen konnte bei allen Probanden nachgewiesen werden. Für den Extraktionssaft aus Äpfeln wurden Quercetin und Phloretin als Resorptionsparameter herangezogen, beim Extraktionssaft aus Trauben war es das Quercetin, da eine Resorption von Hydroxy- 36 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26
12 zimtsäuren und Catechinen nicht nachgewiesen werden konnte. Ferner wurden die Metabolite DHPES, Homovanillinsäure und Isorhamnetin bestimmt. Bei Probanden, die den Extraktionssaft aus Äpfeln erhielten, wurde bereits nach etwa 1 h das Maximum der Phloretin-Konzentration im Plasma gemessen. Anschließend erfolgte eine starke Abnahme der Konzentration an Phloretin (Abb. 15). Das Flavonol Quercetin wurde weniger gut und langsamer resorbiert als das Dihydrochalcon Phloretin, was in dem flacheren Konzentrations- Zeit-Verlauf zu erkennen ist. Das Maximum wurde nach etwa 2 h im Plasma erreicht. Bereits 7 h nach Aufnahme des Apfelextraktionssaftes waren die sekundären Pflanzenstoffe nahezu vollständig aus dem Plasma eliminiert. Die Metabolite DHPES, Homovanillinsäure und Isorhamnetin konnten im Plasma nicht nachgewiesen werden. Zeitverzögert zum Auftreten im Plasma wurden sekundäre Pflanzenstoffe im Urin detektiert. Etwa 3 h nach der Saftaufnahme wurde die größte Menge Phloretin und Quercetin mit dem Urin ausgeschieden. Fast parallel zum Konzentrationsabfall im Plasma, sank nach etwa 7 8 h auch die Gesamtausscheidung von Flavonoiden im Urin stark ab. Am nächsten Morgen (nach ca. 22 h) wurde ein zweiter Anstieg in der Quercetin-Gesamtausscheidung beobachtet, der sich wahrscheinlich zum einen durch die Aufkonzentrierung des Urins und zum anderen durch die Ausscheidungspause während der Nacht erklären lässt. Im Unterschied zum Plasma wurden im Urin Metabolite der resorbierten Flavonoide gefunden. In geringen Mengen wurden Isorhamnetin und DHPES im Urin ausgeschieden, wobei auch Isorhamnetin ähnlich wie Quercetin vermehrt im Morgen-Urin des Folgetages detektiert wurde (Abb. 15). Die Probanden nahmen mit den 5 ml Apfelextraktionssaft 7,6 µmol Quercetin/-glycoside und 199 µmol Phloretin/-derivate zu sich. Insgesamt wurden 1,4 % der mit dem Apfelextraktionssaft getrunkenen Quercetin/-glycoside von den Probanden ausgeschieden, wovon,95 % als Quercetin und,9 % als Isorhamnetin im Urin bestimmt wurden. Beim Dihydrochalcon Phloretin betrug der ausgeschiedene Anteil,31 % der zugeführten Menge Phloretin/-derivaten. Da der Extraktionssaft aus Trauben wesentlich weniger sekundäre Pflanzenstoffe Neutrale Sterole (µmol/g TM) Cholesterol Coprostanol Coprostanon Cholestanon Chol- Metabolite Gesamt-NS Kontrollphasen Saftphasen Abb. 13 Neutrale Sterole in Faeces der Probanden während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften. Die Werte für die Kontrollphasen (n = 4) und die 3 Saftphasen (n = 3) sind jeweils zusammengefasst. Werte sind Mittelwerte ± SEM; signifikanter Unterschied zu den Kontrollphasen (P <,5); (Chol-Metabolite: Cholesterol-Metabolite; NS: neutrale Sterole) Renale Ausscheidung (nmol/24-h-urin) enthielt, wurden auch weniger Flavonoide resorbiert als bei Gabe des Saftes aus Äpfeln. Es gab große Unterschiede in den Flavonoidkonzentrationen zwischen den Probanden. Im Plasma war nur Quercetin nachweisbar. Die maximale Konzentration wurde bereits nach etwa 3 min beobachtet, nach 4 h war Quercetin praktisch vollständig aus dem Plasma eliminiert. Jedoch war es nach 24 h nochmals in geringer Konzentration anwesend. Im Urin traten neben Quercetin auch die Metabolite DHPES und Isorhamnetin auf (Daten nicht gezeigt). Von den mit 5 ml Traubenextraktionssaft aufgenommenen Quercetin und seinen Derivaten wurde 1 6 % im Urin ausgeschieden. Kontrollen Traubensaft Apfelsaft Abb. 14 Renale Ausscheidung von sekundären Pflanzenstoffen bzw. ihrer Metabolite im 24-h-Urin während des Ernährungsversuchs mit den Extraktionssäften aus Trauben und Äpfeln (jeweils n = 1). Die Werte für die Kontrollphasen (n = 4) sind zusammengefasst. Werte sind Mittelwerte ± SEM; signifikanter Unterschied zu den Kontrollphasen (P <,5) DHPES HVS Isorhamnetin Quercetin Phloretin Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 12. Jahrgang, Heft 8, 26 Originalarbeiten ı 361
5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE. T. Golubkova, M. Murkovic
 5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE T. Golubkova, M. Murkovic Institut für Biochemie Technische Universität, Graz, Österreich Einleitung Während
5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE T. Golubkova, M. Murkovic Institut für Biochemie Technische Universität, Graz, Österreich Einleitung Während
Untersuchungen zum antioxidativen Potenzial von Koppelprodukten (Verarbeitungsrückständen) der Arznei- und Gewürzpflanzenverarbeitung
 Untersuchungen zum antioxidativen Potenzial von Koppelprodukten (Verarbeitungsrückständen) der Ausgangssituation und Zielstellung Durchführung der Untersuchungen und Ergebnisse Sceening der Verarbeitungsrückstände
Untersuchungen zum antioxidativen Potenzial von Koppelprodukten (Verarbeitungsrückständen) der Ausgangssituation und Zielstellung Durchführung der Untersuchungen und Ergebnisse Sceening der Verarbeitungsrückstände
Ernährung und Chemie Thema: Präventive Ernährung Datum:
 Vitamine: Die Vitamine E, C und Beta-Carotin (Vorstufe des Vitamin A) werden als Antioxidantien bezeichnet. Antioxidantien haben die Eigenschaft so genannte freie Radikale unschädlich zu machen. Freie
Vitamine: Die Vitamine E, C und Beta-Carotin (Vorstufe des Vitamin A) werden als Antioxidantien bezeichnet. Antioxidantien haben die Eigenschaft so genannte freie Radikale unschädlich zu machen. Freie
THERMOGENE WIRKUNG VON WASSER BEI ADIPÖSEN FRAUEN UND MÄNNERN
 THERMOGENE WIRKUNG VON WASSER BEI ADIPÖSEN FRAUEN UND MÄNNERN M Boschmann 1, J Steiniger 2, V Brüser 1, G Franke 1, F Adams 1, HJ Zunft 2, FC Luft 1, J Jordan 1 1 Franz-Volhard-Klinik, CRC, Charité, Universitätsmedizin
THERMOGENE WIRKUNG VON WASSER BEI ADIPÖSEN FRAUEN UND MÄNNERN M Boschmann 1, J Steiniger 2, V Brüser 1, G Franke 1, F Adams 1, HJ Zunft 2, FC Luft 1, J Jordan 1 1 Franz-Volhard-Klinik, CRC, Charité, Universitätsmedizin
5 HPLC-Methodenentwicklung zur Isomerentrennung
 HPLC-Untersuchungen 5 HPLC-Untersuchungen 65 5 HPLC-Methodenentwicklung zur Isomerentrennung Die bei der -Substitution des Benzimidazolgrundgerüstes entstehenden Isomere machen eine nachfolgende Trennung
HPLC-Untersuchungen 5 HPLC-Untersuchungen 65 5 HPLC-Methodenentwicklung zur Isomerentrennung Die bei der -Substitution des Benzimidazolgrundgerüstes entstehenden Isomere machen eine nachfolgende Trennung
Was weiß ich über Ernährung im Hobbysport?
 Was weiß ich über Ernährung im Hobbysport? 1 Was weiß ich über Sport? 2 Botschaft Nummer 1 Leistung und Leistungssteigerungen sind bis ins hohe Alter möglich! 3 Marathoner Sprinter 4 Botschaft Nummer 2
Was weiß ich über Ernährung im Hobbysport? 1 Was weiß ich über Sport? 2 Botschaft Nummer 1 Leistung und Leistungssteigerungen sind bis ins hohe Alter möglich! 3 Marathoner Sprinter 4 Botschaft Nummer 2
Tab.3: Kontrollgruppe: Glukose- und Insulin-Serumkonzentration sowie Insulinbindung pro 1 Million Monozyten (n=3) während der Infusion von 0,9% NaCl
 4 Ergebnisse 4.1 Kontrollgruppe Bei den Untersuchungen der Kontrollgruppe wurde keine Veränderung der Insulinbindung der Monozyten festgestellt. (P>,; n.s.; t-test für verbundene Stichproben) Während der
4 Ergebnisse 4.1 Kontrollgruppe Bei den Untersuchungen der Kontrollgruppe wurde keine Veränderung der Insulinbindung der Monozyten festgestellt. (P>,; n.s.; t-test für verbundene Stichproben) Während der
3.1 Studie A: Genetisch determinierte Hypertonie. Spontan hypertensive Ratte (SHR/Mol) versus Wistar/Han-Ratte
 3 Ergebnisse 3.1 Studie A: Genetisch determinierte Hypertonie Spontan hypertensive Ratte (SHR/Mol) versus Wistar/Han-Ratte 3.1.1 Körper- und Organgewichte Die Daten zu Körpergewicht, linksventrikulärem
3 Ergebnisse 3.1 Studie A: Genetisch determinierte Hypertonie Spontan hypertensive Ratte (SHR/Mol) versus Wistar/Han-Ratte 3.1.1 Körper- und Organgewichte Die Daten zu Körpergewicht, linksventrikulärem
Die Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide
 ArBEitsBlÄttEr zur FAchinFormAtion Die Arbeitsblätter dienen der Veranschaulichung der qualitativen Auswahl an Lebensmitteln bzw. Getränken. Zu den vier Pyramidenseitenflächen steht jeweils ein Arbeitsblatt
ArBEitsBlÄttEr zur FAchinFormAtion Die Arbeitsblätter dienen der Veranschaulichung der qualitativen Auswahl an Lebensmitteln bzw. Getränken. Zu den vier Pyramidenseitenflächen steht jeweils ein Arbeitsblatt
Gemahlene Bio-Traubenkerne und Traubenschalen
 OPC aus SÜDtirol Gemahlene Bio-Traubenkerne und Traubenschalen Freie Radikale Quercetin OPC Rutin Vitamin A-C-E Resveratrol Das erste aus Südtirol OPC (Oligomere Proantho-Cyanidine) ist eines der zahlreichen
OPC aus SÜDtirol Gemahlene Bio-Traubenkerne und Traubenschalen Freie Radikale Quercetin OPC Rutin Vitamin A-C-E Resveratrol Das erste aus Südtirol OPC (Oligomere Proantho-Cyanidine) ist eines der zahlreichen
Typische Fragen für den Gehschul-Teil: Typ 1: Mengen und Konzentrationen:
 Die Gehschule ist ein Teil der Biochemischen Übungen für das Bakkalaureat LMBT. Aus organisatorischen Gründen wird dieser Test gleichzeitig mit der Prüfung aus Grundlagen der Biochemie angeboten. Das Abschneiden
Die Gehschule ist ein Teil der Biochemischen Übungen für das Bakkalaureat LMBT. Aus organisatorischen Gründen wird dieser Test gleichzeitig mit der Prüfung aus Grundlagen der Biochemie angeboten. Das Abschneiden
Untersuchung der Absorption von Schwermetallen und Ammonium durch MAC
 Wolferner Analytik GmbH Untersuchung der Absorption von Schwermetallen und Ammonium durch MAC 1 Veröffentlichung 15.12.2004, Studie Zusammenfassung: Im Auftrag der ASTRA GmbH, einer Vorgesellschaft der
Wolferner Analytik GmbH Untersuchung der Absorption von Schwermetallen und Ammonium durch MAC 1 Veröffentlichung 15.12.2004, Studie Zusammenfassung: Im Auftrag der ASTRA GmbH, einer Vorgesellschaft der
Produktbeschreibung: Die Inhaltsstoffe von AçaíPur :
 Produktbeschreibung: AçaíPur - nachweislich wirksam- durch mehrere Studien belegt.. AçaíPur - das Original im hygienischen Sachet ist der hochwertige Biokomplex schonend verarbeiteter, speziell selektierter
Produktbeschreibung: AçaíPur - nachweislich wirksam- durch mehrere Studien belegt.. AçaíPur - das Original im hygienischen Sachet ist der hochwertige Biokomplex schonend verarbeiteter, speziell selektierter
A. Wieviel molar ist eine 30 % Wasserstoffperoxidlösung (d = 1.11, M = 34)
 Grundlagen der Biochemie 29. 2. 2008 Einfache Rechenfragen: A. Wieviel molar ist eine 30 % Wasserstoffperoxidlösung (d = 1.11, M = 34) B. Welche Stoffmenge enthalten 2 µl einer 5 µm Lösung? Richtige Einheit
Grundlagen der Biochemie 29. 2. 2008 Einfache Rechenfragen: A. Wieviel molar ist eine 30 % Wasserstoffperoxidlösung (d = 1.11, M = 34) B. Welche Stoffmenge enthalten 2 µl einer 5 µm Lösung? Richtige Einheit
Mustervorschrift Versuch
 Mustervorschrift Versuch 10.2.3 N-Acetylierung von D-/L- Methionin (1.Stufe) 5.20 g (34.86 mmol) D-/L- Methionin (racemisch) werden in 51.13 g (48.80 ml, 349 mmol) reiner Essigsäure (Eisessig) gelöst 1.
Mustervorschrift Versuch 10.2.3 N-Acetylierung von D-/L- Methionin (1.Stufe) 5.20 g (34.86 mmol) D-/L- Methionin (racemisch) werden in 51.13 g (48.80 ml, 349 mmol) reiner Essigsäure (Eisessig) gelöst 1.
Tabelle 28: ph-werte des Harns aller Tiere über den gesamten Zeitraum.
 4.3. Ergebnisse der Harnuntersuchung 4.3.1. ph- des Harns Der ph- des Harns aller 132 untersuchten Tiere betrug zu Beginn der Untersuchung im Mittel 8,47 und verringerte sich mit Beginn der Vorbereitungsfütterung
4.3. Ergebnisse der Harnuntersuchung 4.3.1. ph- des Harns Der ph- des Harns aller 132 untersuchten Tiere betrug zu Beginn der Untersuchung im Mittel 8,47 und verringerte sich mit Beginn der Vorbereitungsfütterung
Wasser. Wasser ist, neben der Atemluft, unser wichtigstes Lebensmittel. es ist Lösungs- und Transportmittel im menschlichen Organismus
 Wasser Wasser ist, neben der Atemluft, unser wichtigstes Lebensmittel es ist Lösungs- und Transportmittel im menschlichen Organismus es sorgt für einen ständigen Austausch der Auf- und Abbauprodukte des
Wasser Wasser ist, neben der Atemluft, unser wichtigstes Lebensmittel es ist Lösungs- und Transportmittel im menschlichen Organismus es sorgt für einen ständigen Austausch der Auf- und Abbauprodukte des
7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern
 Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen. Prof. Dr. Thomas Kirner
 Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen Prof. Dr. Thomas Kirner 21.07.2015 Voraussetzungen Fermentation von Biomasse Mikroorganismen interagieren in einem komplexen
Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen Prof. Dr. Thomas Kirner 21.07.2015 Voraussetzungen Fermentation von Biomasse Mikroorganismen interagieren in einem komplexen
Synthese von DOC (2,5-Dimethoxy-4-chloramphetamin)
 T + K (2000) 68 (2): 62 Synthese von D (2,5-Dimethoxy-4-chloramphetamin) Dorothea Ehlers und Johanna Schäning Technische Fachhochschule Berlin, FB V, Kurfürstenstrasse 141, D-1210 Berlin, e-mail: ehlers@tfh-berlin.de
T + K (2000) 68 (2): 62 Synthese von D (2,5-Dimethoxy-4-chloramphetamin) Dorothea Ehlers und Johanna Schäning Technische Fachhochschule Berlin, FB V, Kurfürstenstrasse 141, D-1210 Berlin, e-mail: ehlers@tfh-berlin.de
Wissenschaftlicher Informationsdienst Tee
 Herbst 1999 Wissenschaftlicher Informationsdienst Tee Antioxidative Aktivität von Tee: Einfluss der Extraktionszeit und der Extraktionsvorgänge Dr. rer. nat. habil. Volker Böhm Institut für Ernährungswissenschaften,
Herbst 1999 Wissenschaftlicher Informationsdienst Tee Antioxidative Aktivität von Tee: Einfluss der Extraktionszeit und der Extraktionsvorgänge Dr. rer. nat. habil. Volker Böhm Institut für Ernährungswissenschaften,
6. Induktion der Galactosidase von Escherichia coli
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 19.1.2005 6. Induktion der Galactosidase
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 19.1.2005 6. Induktion der Galactosidase
UNTERSUCHUNGEN ÜBER THEAFLAVINE UND FLAVANOLE IN GRÜNEN UND SCHWARZEN TEES
 3 UNTERSUCHUNGEN ÜBER THEAFLAVINE UND FLAVANOLE IN GRÜNEN UND SCHWARZEN TEES Von der Gemeinsamen Naturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung
3 UNTERSUCHUNGEN ÜBER THEAFLAVINE UND FLAVANOLE IN GRÜNEN UND SCHWARZEN TEES Von der Gemeinsamen Naturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung
Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung
 Medizin Vanessa Schuh Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung Masterarbeit UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITÄT UND ANTIOXIDATIVEN WIRKUNG VON FLAVONOIDEN IM ZITRONENSAFT Masterarbeit
Medizin Vanessa Schuh Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung Masterarbeit UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITÄT UND ANTIOXIDATIVEN WIRKUNG VON FLAVONOIDEN IM ZITRONENSAFT Masterarbeit
Mit Ernährung Krebs vorbeugen. Veronika Flöter, M.Sc. Ernährungswissenschaft Beratungsstelle Ernährung am TZM
 Mit Ernährung Krebs vorbeugen Veronika Flöter, M.Sc. Ernährungswissenschaft Beratungsstelle Ernährung am TZM 13.09.2016 Einleitung Gesunde Ernährung Menge und Auswahl der Lebensmittel Zufuhr an Energie
Mit Ernährung Krebs vorbeugen Veronika Flöter, M.Sc. Ernährungswissenschaft Beratungsstelle Ernährung am TZM 13.09.2016 Einleitung Gesunde Ernährung Menge und Auswahl der Lebensmittel Zufuhr an Energie
Methoden zur Untersuchung von Papier, Karton und Pappe für Lebensmittelverpackungen und sonstige Bedarfsgegenstände
 Methoden zur Untersuchung von Papier, Karton und Pappe für Lebensmittelverpackungen und sonstige Bedarfsgegenstände 5. Bestimmung von Einzelsubstanzen 5.19 Levanase 1. Allgemeine Angaben Bezeichnung in
Methoden zur Untersuchung von Papier, Karton und Pappe für Lebensmittelverpackungen und sonstige Bedarfsgegenstände 5. Bestimmung von Einzelsubstanzen 5.19 Levanase 1. Allgemeine Angaben Bezeichnung in
Ernährungsphysiologische Forschungskonzepte im Rahmen von FEI/AiF- Forschungsvorhaben in vivo-studien
 Ernährungsphysiologische Forschungskonzepte im Rahmen von FEI/AiF- Forschungsvorhaben in vivo-studien Prof. Dr. Peter Stehle Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (IEL) Ernährungsphysiologie
Ernährungsphysiologische Forschungskonzepte im Rahmen von FEI/AiF- Forschungsvorhaben in vivo-studien Prof. Dr. Peter Stehle Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (IEL) Ernährungsphysiologie
Proteinbestimmung. Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der Proteinbestimmung mit den folgenden Lehrzielen:
 Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Prüfungsfragenkatalog für Diagnostik (Prof. Astrid Ortner)
 Prüfungsfragenkatalog für Diagnostik (Prof. Astrid Ortner) Stand: Dezember 2016 Termin: 15.12.2016 1. POCT-Systeme: Definition, Beispiele, Vorteile, Begriffserklärung 2. Leberdiagnostik GGT: Wann wird
Prüfungsfragenkatalog für Diagnostik (Prof. Astrid Ortner) Stand: Dezember 2016 Termin: 15.12.2016 1. POCT-Systeme: Definition, Beispiele, Vorteile, Begriffserklärung 2. Leberdiagnostik GGT: Wann wird
Ethanolbildung in Bananen
 Ethanolbildung in Bananen Peter Bützer Inhalt 1 Einführung... 1 2 Modell... 2 2.1 Annahmen:... 2 2.2 Simulation(Typ 1)... 2 2.3 Dokumentation (Gleichungen, Parameter)... 3 2.4 Vergleich der Simulation
Ethanolbildung in Bananen Peter Bützer Inhalt 1 Einführung... 1 2 Modell... 2 2.1 Annahmen:... 2 2.2 Simulation(Typ 1)... 2 2.3 Dokumentation (Gleichungen, Parameter)... 3 2.4 Vergleich der Simulation
Probe und Probenmenge Wassermenge Auftragspuffermenge 5 µl Kaninchenmuskelextrakt 50 µl 100 µl
 Arbeitsgruppe D 6 Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs 3: Proteinanalysen Im heutigen Kurs extrahierten wir zum einen Proteine aus verschiedenen Geweben eines Kaninchens und führten
Arbeitsgruppe D 6 Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs 3: Proteinanalysen Im heutigen Kurs extrahierten wir zum einen Proteine aus verschiedenen Geweben eines Kaninchens und führten
Quantitative Bestimmung unlöslicher Polysaccharide
 Diss. ETH Nr. 10070 Quantitative Bestimmung unlöslicher Polysaccharide I: Nebenprodukte bei der Derivatisierung von Monosacchariden zu Aldon'rtrilacetaten II: Zusammensetzung des Zellwandmaterials von
Diss. ETH Nr. 10070 Quantitative Bestimmung unlöslicher Polysaccharide I: Nebenprodukte bei der Derivatisierung von Monosacchariden zu Aldon'rtrilacetaten II: Zusammensetzung des Zellwandmaterials von
Ein Gemisch aus 13,2 g (0,1mol) 2,5-Dimethoxyterahydrofuran und 80ml 0,6 N Salzsäure werden erhitzt bis vollständige Lösung eintritt.
 1.Acetondicarbonsäureanhydrid 40g (0,27mol)Acetondicarbonsäure werden in einer Lösung aus 100ml Eisessig und 43ml (0,45mol) Essigsäureanhydrid gelöst. Die Temperatur sollte 20 C nicht überschreiten und
1.Acetondicarbonsäureanhydrid 40g (0,27mol)Acetondicarbonsäure werden in einer Lösung aus 100ml Eisessig und 43ml (0,45mol) Essigsäureanhydrid gelöst. Die Temperatur sollte 20 C nicht überschreiten und
Abbildung 5: Essigsäurekonzentration im Pansensaft bei Salz- und Kontrollzulage (H 2 O) an den Tagen S7 und S14. 49
 4. Ergebnisse 4.1 Konzentration flüchtiger Fettsäuren im Pansensaft 4.1.1 Essigsäure Abbildung 5 zeigt die Essigsäurekonzentrationen im Pansensaft während der ruminalen Supplementierung der zehn geprüften
4. Ergebnisse 4.1 Konzentration flüchtiger Fettsäuren im Pansensaft 4.1.1 Essigsäure Abbildung 5 zeigt die Essigsäurekonzentrationen im Pansensaft während der ruminalen Supplementierung der zehn geprüften
Gesunde Ernährung Eine Broschüre in leicht verständlicher Sprache
 Gesunde Ernährung Eine Broschüre in leicht verständlicher Sprache von Anna-Katharina Jäckle Anika Sing Josephin Meder Was steht im Heft? 1. Erklärungen zum Heft Seite1 2. Das Grund-Wissen Seite 3 3. Die
Gesunde Ernährung Eine Broschüre in leicht verständlicher Sprache von Anna-Katharina Jäckle Anika Sing Josephin Meder Was steht im Heft? 1. Erklärungen zum Heft Seite1 2. Das Grund-Wissen Seite 3 3. Die
GESUNDHEITSFÖRDERLICHE INHALTSSTOFFE VON PRODUKTEN AUS DER WEINVERARBEITUNG. Kroyer G.
 GESUNDHEITSFÖRDERLICHE INHALTSSTOFFE VON PRODUKTEN AUS DER WEINVERARBEITUNG Kroyer G. Institut für Verfahrenstechnik. Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften Abteilung für Naturstoff- und Lebensmittelchemie
GESUNDHEITSFÖRDERLICHE INHALTSSTOFFE VON PRODUKTEN AUS DER WEINVERARBEITUNG Kroyer G. Institut für Verfahrenstechnik. Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften Abteilung für Naturstoff- und Lebensmittelchemie
Microbial diversity and their roles in the vinegar fermentation process
 Microbial diversity and their roles in the vinegar fermentation process In: Appl Microbiol Biotechnol (2015) 99:4997 5024 Sha Li, Pan Li, Feng Feng & Li-Xin Luo Saarbrücken, den 04.11.2015 Biotechnologen
Microbial diversity and their roles in the vinegar fermentation process In: Appl Microbiol Biotechnol (2015) 99:4997 5024 Sha Li, Pan Li, Feng Feng & Li-Xin Luo Saarbrücken, den 04.11.2015 Biotechnologen
Gesunde Ernährung für Körper und Geist
 Gesunde Ernährung für Körper und Geist Dr. med Jolanda Schottenfeld-Naor Internistin, Diabetologin, Ernährungsmedizinerin RP-Expertenzeit 25. März 2015 Grundlagen der Ernährung Nährstoffe sind Nahrungsbestandteile,
Gesunde Ernährung für Körper und Geist Dr. med Jolanda Schottenfeld-Naor Internistin, Diabetologin, Ernährungsmedizinerin RP-Expertenzeit 25. März 2015 Grundlagen der Ernährung Nährstoffe sind Nahrungsbestandteile,
Sinnvoll essen Gesund Ernähren. Ödemzentrum Bad Berleburg Baumrainklinik Haus am Schloßpark
 Sinnvoll essen Gesund Ernähren Ernährungsaufbau Sparsam mit Zuckerund Fettreichen Lebensmitteln Öle und Fette in Maßen und von hoher Qualität Täglich Milch und Milchprodukte Fleisch, Wurst und Eier in
Sinnvoll essen Gesund Ernähren Ernährungsaufbau Sparsam mit Zuckerund Fettreichen Lebensmitteln Öle und Fette in Maßen und von hoher Qualität Täglich Milch und Milchprodukte Fleisch, Wurst und Eier in
Aspekte der Eisenresorption. PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse Binningen
 Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
DGEM Forschungsförderung Christoph Otto, Ulrike Kämmerer
 DGEM Forschungsförderung 2010 Christoph Otto, Ulrike Kämmerer Frage Untersuchungen zu den Auswirkungen einer Ketogenen Diät auf den Stoffwechsel von Tumoren Beeinflussen Ketonkörper Wachstum und Stoffwechsel
DGEM Forschungsförderung 2010 Christoph Otto, Ulrike Kämmerer Frage Untersuchungen zu den Auswirkungen einer Ketogenen Diät auf den Stoffwechsel von Tumoren Beeinflussen Ketonkörper Wachstum und Stoffwechsel
Für enzymkinetische Untersuchungen legen Sie 0.2 ml einer 5 mm Substratlösung vor. Der fertige Inkubationsansatz hat ein Volumen von 2 ml.
 Die Gehschule ist ein Teil der Biochemischen Übungen für das Bakkalaureat LMBT. Der Test wird im Anschluss an die Prüfung aus Grundlagen der Biochemie angeboten, welche 90 min dauert (also bei der Türe
Die Gehschule ist ein Teil der Biochemischen Übungen für das Bakkalaureat LMBT. Der Test wird im Anschluss an die Prüfung aus Grundlagen der Biochemie angeboten, welche 90 min dauert (also bei der Türe
Sukrin Eine gesunde und natürliche Alternative zu Zucker
 Sukrin Eine gesunde und natürliche Alternative zu Zucker Sukrin ist eine natürliche und kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen. Schmeckt, sieht aus und hat ein Volumen wie Zucker.
Sukrin Eine gesunde und natürliche Alternative zu Zucker Sukrin ist eine natürliche und kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen. Schmeckt, sieht aus und hat ein Volumen wie Zucker.
Die chemische Natur der Pigmente aus photosynthetischen Reaktionszentren von Rhodospirillum ruhrum G-9+
 Diss. ETHNr.6106 Die chemische Natur der Pigmente aus hotosynthetischen Reaktionszentren von Rhodosirillum ruhrum G-9+ ABHANDLUNG zur Erlangung destitelseinesdoktorsder Naturwissenschaften der Eidgenössischen
Diss. ETHNr.6106 Die chemische Natur der Pigmente aus hotosynthetischen Reaktionszentren von Rhodosirillum ruhrum G-9+ ABHANDLUNG zur Erlangung destitelseinesdoktorsder Naturwissenschaften der Eidgenössischen
Einfluss von zuckerreichem Heu auf das mikrobielle Profil im Pansen und die physiologischen Prozesse in der Pansenwand von Milchkühen
 Einfluss von zuckerreichem Heu auf das mikrobielle Profil im Pansen und die physiologischen Prozesse in der Pansenwand von Milchkühen SIMON INEICHEN, 22.11.2012 Masterarbeit Agrarwissenschaften, ETH Zürich
Einfluss von zuckerreichem Heu auf das mikrobielle Profil im Pansen und die physiologischen Prozesse in der Pansenwand von Milchkühen SIMON INEICHEN, 22.11.2012 Masterarbeit Agrarwissenschaften, ETH Zürich
Ernährung und Bewegung. Sport, Fitness und Ernährung, das sind Begriffe, die unweigerlich miteinander verbunden sind.
 Food-Guide Ernährungsratgeber für Sportler Ernährung und Bewegung Sport, Fitness und Ernährung, das sind Begriffe, die unweigerlich miteinander verbunden sind. Der Einfluss der Ernährung auf unsere Gesundheit
Food-Guide Ernährungsratgeber für Sportler Ernährung und Bewegung Sport, Fitness und Ernährung, das sind Begriffe, die unweigerlich miteinander verbunden sind. Der Einfluss der Ernährung auf unsere Gesundheit
GEBRAUCHSANLEITUNG. Glutatione Agarose Resin
 GEBRAUCHSANLEITUNG Glutatione Agarose Resin Agarose zur Affinitätsreinigung von GST-Tag-Fusionsproteinen und anderen Glutathion-Bindungsproteinen (Kat.-Nr. 42172) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str.
GEBRAUCHSANLEITUNG Glutatione Agarose Resin Agarose zur Affinitätsreinigung von GST-Tag-Fusionsproteinen und anderen Glutathion-Bindungsproteinen (Kat.-Nr. 42172) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str.
Pflanzliche Inhaltsstoffe nutzbar machen: Der Weg von der Pflanze zum Nahrungsergänzungsmittel
 Pflanzliche Inhaltsstoffe nutzbar machen: Der Weg von der Pflanze zum Nahrungsergänzungsmittel Vital Solutions Swiss Haupstrasse 137 C Ch 8274 Tägerwilen Bbi - Breeding Botanicals International Haupstrasse
Pflanzliche Inhaltsstoffe nutzbar machen: Der Weg von der Pflanze zum Nahrungsergänzungsmittel Vital Solutions Swiss Haupstrasse 137 C Ch 8274 Tägerwilen Bbi - Breeding Botanicals International Haupstrasse
Analytik von sekundären Pflanzenstoffen III: Polyphenole
 Analytik von sekundären Pflanzenstoffen III: Polyphenole Dr. Roland Wacker BioTeSys GmbH, Esslingen, www.biotesys.de Polyphenole stellen eine weit verbreitete Stoffgruppe der Inhaltsstoffe von Pflanzen
Analytik von sekundären Pflanzenstoffen III: Polyphenole Dr. Roland Wacker BioTeSys GmbH, Esslingen, www.biotesys.de Polyphenole stellen eine weit verbreitete Stoffgruppe der Inhaltsstoffe von Pflanzen
Klassenarbeit - Ernährung. Ordne die Wörter zu dem richtigen Feld ein. 3. Klasse / Sachkunde
 3. Klasse / Sachkunde Klassenarbeit - Ernährung Nahrungsmittelkreis; Zucker; Eiweiß; Nährstoffe; Vitamine; Getreide Aufgabe 1 Ordne die Wörter zu dem richtigen Feld ein. Brot, Paprika, Spiegelei, Öl, Quark,
3. Klasse / Sachkunde Klassenarbeit - Ernährung Nahrungsmittelkreis; Zucker; Eiweiß; Nährstoffe; Vitamine; Getreide Aufgabe 1 Ordne die Wörter zu dem richtigen Feld ein. Brot, Paprika, Spiegelei, Öl, Quark,
FETTREICHE NAHRUNGSMITTEL
 7 FETTREICHE NAHRUNGSMITTEL Fettreiche Nahrungsmittel können sowohl.. als auch.. Ursprung sein. Durch die Verarbeitung der Rohprodukte kann sich der Fettanteil.. Wir unterscheiden pflanzliche und tierische
7 FETTREICHE NAHRUNGSMITTEL Fettreiche Nahrungsmittel können sowohl.. als auch.. Ursprung sein. Durch die Verarbeitung der Rohprodukte kann sich der Fettanteil.. Wir unterscheiden pflanzliche und tierische
ETHANOL 70 Prozent Ethanolum 70 per centum. Aethanolum dilutum. Ethanol 70 Prozent ist eine Mischung von Ethanol 96 Prozent und Wasser.
 ÖAB 2008/004 ETHANOL 70 Prozent Ethanolum 70 per centum Aethanolum dilutum Definition Ethanol 70 Prozent ist eine Mischung von Ethanol 96 Prozent und Wasser. Gehalt: Ethanol 70 Prozent enthält mindestens
ÖAB 2008/004 ETHANOL 70 Prozent Ethanolum 70 per centum Aethanolum dilutum Definition Ethanol 70 Prozent ist eine Mischung von Ethanol 96 Prozent und Wasser. Gehalt: Ethanol 70 Prozent enthält mindestens
Methoden 44. 3. Methoden. 3.1. Polyphenolanalytik. 3.1.1. Polyphenolmuster und -gehalte mittels HPLC
 Methoden 44 3. Methoden Eine detaillierte Betrachtung und Bewertung der Einflüsse der Verarbeitungstechnik auf antioxidativ wirksame Inhaltsstoffe bei der Fruchtsaftherstellung erfordert gut reproduzierbare
Methoden 44 3. Methoden Eine detaillierte Betrachtung und Bewertung der Einflüsse der Verarbeitungstechnik auf antioxidativ wirksame Inhaltsstoffe bei der Fruchtsaftherstellung erfordert gut reproduzierbare
12 Zusammenfassung der Ergebnisse
 12 Zusammenfassung der Ergebnisse 12 Zusammenfassung der Ergebnisse Ziel dieser Leitlinie ist es, auf der Basis einer systematischen Analyse und Bewertung der vorliegenden Literatur evidenzbasierte Erkenntnisse
12 Zusammenfassung der Ergebnisse 12 Zusammenfassung der Ergebnisse Ziel dieser Leitlinie ist es, auf der Basis einer systematischen Analyse und Bewertung der vorliegenden Literatur evidenzbasierte Erkenntnisse
Phalloidin-Färbung an kultivierten adhärenten Säugerzellen. Formaldehyd-Fixierung
 Phalloidin-Färbung an kultivierten adhärenten Säugerzellen Formaldehyd-Fixierung 2 Materialien Pinzetten Für das Handling der Zellen ist es empfehlenswert Pinzetten mit sehr feiner Spitze zu nutzen. Hier
Phalloidin-Färbung an kultivierten adhärenten Säugerzellen Formaldehyd-Fixierung 2 Materialien Pinzetten Für das Handling der Zellen ist es empfehlenswert Pinzetten mit sehr feiner Spitze zu nutzen. Hier
Xylit die. gesunde Süsse
 Xylit die gesunde Süsse Was ist mithana Xylit mithana Xylit wird aus der Maisspindel, nach Abernten der Körner, gewonnen und ist somit ein ganz natürliches Süssemittel. mithana Xylit hat die gleiche Süsskraft
Xylit die gesunde Süsse Was ist mithana Xylit mithana Xylit wird aus der Maisspindel, nach Abernten der Körner, gewonnen und ist somit ein ganz natürliches Süssemittel. mithana Xylit hat die gleiche Süsskraft
Gut leben mit Diabetes
 Gut leben mit Diabetes Mathilde Schäfers Diätassistentin/Diabetesberaterin DDG Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn 10. Tag der gesunden Ernährungen Übergewicht? Body-Maß-Index BMI [kg/m2] BMI [kg/m2]
Gut leben mit Diabetes Mathilde Schäfers Diätassistentin/Diabetesberaterin DDG Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn 10. Tag der gesunden Ernährungen Übergewicht? Body-Maß-Index BMI [kg/m2] BMI [kg/m2]
Fragen zum Versuch 1. Kohlenhydrate. Fragen zum Versuch 2. Aminosäuren. Fragen zum Versuch 3. Lipide
 Fragen zum Versuch 1 Kohlenhydrate 1) Worin unterscheiden sich chemisch die folgenden Kohlenhydrate? a) Glucose und Fructose b) Laktose und Saccharose c) Stärke, Glykogen und Dextrin d) Was ist Agar-Agar,
Fragen zum Versuch 1 Kohlenhydrate 1) Worin unterscheiden sich chemisch die folgenden Kohlenhydrate? a) Glucose und Fructose b) Laktose und Saccharose c) Stärke, Glykogen und Dextrin d) Was ist Agar-Agar,
Test über die Veränderung von Laktat und Herzfrequenz unter regelmäßiger Einnahme von fitrabbit Mag. Bernhard Schimpl
 Test über die Veränderung von Laktat und Herzfrequenz unter regelmäßiger Einnahme von fitrabbit Mag. Bernhard Schimpl Testdesign: 6 Hobbyläufer (3 Frauen / 3 Männer) wurden einer Laufbandergometrie unterzogen,
Test über die Veränderung von Laktat und Herzfrequenz unter regelmäßiger Einnahme von fitrabbit Mag. Bernhard Schimpl Testdesign: 6 Hobbyläufer (3 Frauen / 3 Männer) wurden einer Laufbandergometrie unterzogen,
Functional Food. Zusätzliche Informationen
 Functional Food 2 Functional Food Anleitung LP Die Schüler können den Begriff und die Bedeutung von Functional Food in eigenen Worten erklären. Sie äussern sich in einer Diskussion dazu, ob solche Zusätze
Functional Food 2 Functional Food Anleitung LP Die Schüler können den Begriff und die Bedeutung von Functional Food in eigenen Worten erklären. Sie äussern sich in einer Diskussion dazu, ob solche Zusätze
FIT 4 Herzlich willkommen
 FIT 4 Herzlich willkommen Der Weg ist das Ziel! (Konfuzius) Quelle: ledion.de Heutige Themen Ernährungsempfehlung bei funktioneller Insulintherapie Strenge Diabeteskost Sünde Kernbotschaft Richtig essen
FIT 4 Herzlich willkommen Der Weg ist das Ziel! (Konfuzius) Quelle: ledion.de Heutige Themen Ernährungsempfehlung bei funktioneller Insulintherapie Strenge Diabeteskost Sünde Kernbotschaft Richtig essen
Obst & Gemüse sind gesund! Wir verzehren zu wenig. Frische und Vollreife?
 Obst & Gemüse sind gesund! Keine anderen Lebensmittel enthalten so viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, in so großer Menge wie
Obst & Gemüse sind gesund! Keine anderen Lebensmittel enthalten so viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, in so großer Menge wie
Nachweis der Nährstoffe (Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß) in verschiedenen Nahrungsmittel
 Nachweis der Nährstoffe (Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß) in verschiedenen Nahrungsmittel 1. Nachweis von Fett Material: - verschiedene Lebensmittel zum Testen, z. B. Apfel, Gurke, Saft, Kartoffelchips, Butter,
Nachweis der Nährstoffe (Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß) in verschiedenen Nahrungsmittel 1. Nachweis von Fett Material: - verschiedene Lebensmittel zum Testen, z. B. Apfel, Gurke, Saft, Kartoffelchips, Butter,
Lebensmittelanalytisches Praktikum für Ernährungswissenschaftler
 1 Lebensmittelanalytisches Praktikum für Ernährungswissenschaftler NACHWEIS DER ART DER WÄRMEBEHANDLUNG VN MILCH I. Einleitung Zum Nachweis der erfolgreichen Wärmebehandlung von Milch wird routinemäßig
1 Lebensmittelanalytisches Praktikum für Ernährungswissenschaftler NACHWEIS DER ART DER WÄRMEBEHANDLUNG VN MILCH I. Einleitung Zum Nachweis der erfolgreichen Wärmebehandlung von Milch wird routinemäßig
Darmmikrobiota, Probiotika und Stress-Resilienz
 Darmmikrobiota, Probiotika und Dr. Maike Groeneveld, Bonn Gliederung 1. Stress & Mikrobiota 2. Ernährung & Mikrobiota Foto: Yakult Stress wirkt über Stresshormone auch auf unseren Darm www.maike-groeneveld.de
Darmmikrobiota, Probiotika und Dr. Maike Groeneveld, Bonn Gliederung 1. Stress & Mikrobiota 2. Ernährung & Mikrobiota Foto: Yakult Stress wirkt über Stresshormone auch auf unseren Darm www.maike-groeneveld.de
ERNÄHRUNG. www.almirall.com. Solutions with you in mind
 ERNÄHRUNG www.almirall.com Solutions with you in mind ALLGEMEINE RATSCHLÄGE Es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass die Einhaltung einer speziellen Diät bei MS hilft oder dass irgendwelche Diäten
ERNÄHRUNG www.almirall.com Solutions with you in mind ALLGEMEINE RATSCHLÄGE Es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass die Einhaltung einer speziellen Diät bei MS hilft oder dass irgendwelche Diäten
A) Krankmachende Risiken verringern Wussten Sie, dass viele chronische Krankheiten vermeidbar sind?
 Gesunde Ernährung Warum ist gesunde Ernährung so wichtig? A) Krankmachende Risiken verringern Wussten Sie, dass viele chronische Krankheiten vermeidbar sind? Dazu gehören Erkrankungen wie:» Herzkrankheiten»
Gesunde Ernährung Warum ist gesunde Ernährung so wichtig? A) Krankmachende Risiken verringern Wussten Sie, dass viele chronische Krankheiten vermeidbar sind? Dazu gehören Erkrankungen wie:» Herzkrankheiten»
Inhalt. 7 Liebe Leserinnen und Leser
 Inhalt 7 Liebe Leserinnen und Leser 11 Fett ein wichtiger Energielieferant 17 Übergewicht eine Frage der Energiebilanz 25 Cholesterin kein Grund zur Panik 29 Wie Sie die Tabelle nutzen können 32 Cholesterin-
Inhalt 7 Liebe Leserinnen und Leser 11 Fett ein wichtiger Energielieferant 17 Übergewicht eine Frage der Energiebilanz 25 Cholesterin kein Grund zur Panik 29 Wie Sie die Tabelle nutzen können 32 Cholesterin-
Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke (insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden)
 Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke (insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden) Änderung vom 15. November 2006 Das Eidgenössische Departement des Innern verordnet: I Die
Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke (insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden) Änderung vom 15. November 2006 Das Eidgenössische Departement des Innern verordnet: I Die
Fettchemie Hauptbestandteile der Fette und Öle Fettbegleitstoffe... 14
 Einleitung... 4 Markt und Verbrauch... 6 Verbrauchszahlen... 6 Haupterzeugerländer... 6 Fettchemie... 12 Hauptbestandteile der Fette und Öle... 12 Fettbegleitstoffe... 14 Speisefette in der Ernährung...
Einleitung... 4 Markt und Verbrauch... 6 Verbrauchszahlen... 6 Haupterzeugerländer... 6 Fettchemie... 12 Hauptbestandteile der Fette und Öle... 12 Fettbegleitstoffe... 14 Speisefette in der Ernährung...
Endersch, Jonas Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Platz 53
 Endersch, Jonas 30.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 2.5a: Herstellung von Cholesterylbenzoat Reaktionsgleichung: Einleitung und Theorie: In diesem Versuch
Endersch, Jonas 30.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 2.5a: Herstellung von Cholesterylbenzoat Reaktionsgleichung: Einleitung und Theorie: In diesem Versuch
Obst & Gemüse sind gesund
 Obst & Gemüse sind gesund Keine anderen Lebensmittel enthalten so viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, in so großer Menge wie Gemüse und
Obst & Gemüse sind gesund Keine anderen Lebensmittel enthalten so viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, in so großer Menge wie Gemüse und
Für Sie untersucht: Stabilitätsuntersuchungen
 Für Sie untersucht: Stabilitätsuntersuchungen Die Wirk- und Hilfsstoffstabilität in Rezepturen wird durch verschiedenste Faktoren wie dem ph- Wert, der Temperatur, dem Licht, der stofflichen Zusammensetzung
Für Sie untersucht: Stabilitätsuntersuchungen Die Wirk- und Hilfsstoffstabilität in Rezepturen wird durch verschiedenste Faktoren wie dem ph- Wert, der Temperatur, dem Licht, der stofflichen Zusammensetzung
Induktion der β-galaktosidase von Escherichia coli
 Induktion der β-galaktosidase von Escherichia coli 1. Einleitung Das Bakterium Escherichia coli ist in der Lage verschiedene Substrate für seinen Stoffwechsel zu nutzen. Neben Glucose und Acetat kann es
Induktion der β-galaktosidase von Escherichia coli 1. Einleitung Das Bakterium Escherichia coli ist in der Lage verschiedene Substrate für seinen Stoffwechsel zu nutzen. Neben Glucose und Acetat kann es
Quantitative Analyse des Polysaccharides Sinistrin in Serum mittels HPLC und elektrochemischer Detektion
 Quantitative Analyse des Polysaccharides Sinistrin in Serum mittels HPLC und elektrochemischer Detektion D. Payerl, K. Öttl und G. Reibnegger Institut für Medizinische Chemie & Pregl-Laboratorium Harrachgasse
Quantitative Analyse des Polysaccharides Sinistrin in Serum mittels HPLC und elektrochemischer Detektion D. Payerl, K. Öttl und G. Reibnegger Institut für Medizinische Chemie & Pregl-Laboratorium Harrachgasse
RESOLUTION OIV-OENO gestützt auf die Arbeiten der Expertengruppen Spezifikationen önologischer Erzeugnisse und Mikrobiologie
 RESOLUTION OIV-OENO 496-2013 MONOGRAPHIE ÜBER HEFEAUTOLYSATE DIE GENERALVERSAMMLUNG, gestützt auf Artikel 2 Absatz iv des Übereinkommens vom 3. April 2001 zur Gründung der Internationalen Organisation
RESOLUTION OIV-OENO 496-2013 MONOGRAPHIE ÜBER HEFEAUTOLYSATE DIE GENERALVERSAMMLUNG, gestützt auf Artikel 2 Absatz iv des Übereinkommens vom 3. April 2001 zur Gründung der Internationalen Organisation
6.1 Nachweis von Vitamin C. Aufgabe. Welche Lebensmittel enthalten Vitamin C? Naturwissenschaften - Chemie - Lebensmittelchemie - 6 Vitamine
 Naturwissenschaften - Chemie - Lebensmittelchemie - 6 Vitamine (P787800) 6. Nachweis von Vitamin C Experiment von: Anouch Gedruckt: 28.02.204 :2:46 intertess (Version 3.2 B24, Export 2000) Aufgabe Aufgabe
Naturwissenschaften - Chemie - Lebensmittelchemie - 6 Vitamine (P787800) 6. Nachweis von Vitamin C Experiment von: Anouch Gedruckt: 28.02.204 :2:46 intertess (Version 3.2 B24, Export 2000) Aufgabe Aufgabe
Protokoll Praktikum für Humanbiologie Studenten
 Protokoll Praktikum für Humanbiologie Studenten Teil A: Charakterisierung der Auswirkungen von γ Interferon auf die Protein und mrna Mengen in humanen A549 Lungenepithelzellen. Studentenaufgaben Tag 1
Protokoll Praktikum für Humanbiologie Studenten Teil A: Charakterisierung der Auswirkungen von γ Interferon auf die Protein und mrna Mengen in humanen A549 Lungenepithelzellen. Studentenaufgaben Tag 1
Protokoll zur Übung Ölanalyse
 Protokoll zur Übung Ölanalyse im Rahmen des Praktikums Betreuender Assistent Univ.Ass. Dipl.-Ing. Martin Schwentenwein Verfasser des Protokolls: Daniel Bomze 0726183 1 Theoretischer Hintergrund 1.1 Aufgabenstellung
Protokoll zur Übung Ölanalyse im Rahmen des Praktikums Betreuender Assistent Univ.Ass. Dipl.-Ing. Martin Schwentenwein Verfasser des Protokolls: Daniel Bomze 0726183 1 Theoretischer Hintergrund 1.1 Aufgabenstellung
Infos und Bestellung
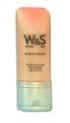 Mind Master FAQ frequently asked questions Version 3.0 Summery I. Wann sollte ich Mind Master einnehmen? S 3 II. Wie sollte Mind Master eingenommen werden? Kann es zu Unverträglichkeiten kommen? S 3 III.
Mind Master FAQ frequently asked questions Version 3.0 Summery I. Wann sollte ich Mind Master einnehmen? S 3 II. Wie sollte Mind Master eingenommen werden? Kann es zu Unverträglichkeiten kommen? S 3 III.
AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG. Gewinnung und Charakterisierung funktioneller Wertstoffe aus Nebenprodukten der Obst- und Gemüseverarbeitung
 AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG Gewinnung und Charakterisierung funktioneller Wertstoffe aus Nebenprodukten der Obst- und Gemüseverarbeitung EINFÜHRUNG Schieber, A.; Endreß, H.-U.: Carle, R.; (2001) Gewinnung
AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG Gewinnung und Charakterisierung funktioneller Wertstoffe aus Nebenprodukten der Obst- und Gemüseverarbeitung EINFÜHRUNG Schieber, A.; Endreß, H.-U.: Carle, R.; (2001) Gewinnung
4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen
 Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
JVi. Fragen und Antworten INDEX
 JVi Fragen und Antworten INDEX 1. Was ist JVi? 2. Warum sollte ich 120ml JVi pro Tag trinken? 3. Kann ich JVi mit anderen Nu Skin Produkten verwenden? 4. Ist JVi ein für den Hautcarotinoidwert zertifiziertes
JVi Fragen und Antworten INDEX 1. Was ist JVi? 2. Warum sollte ich 120ml JVi pro Tag trinken? 3. Kann ich JVi mit anderen Nu Skin Produkten verwenden? 4. Ist JVi ein für den Hautcarotinoidwert zertifiziertes
Polyphenole die heimlichen Helfer
 Polyphenole die heimlichen Helfer sekundäre Pflanzenstoffe, die auch beim Menschen positive Wirkung zeigen Gruppen der Phenolsäuren, Anthocyane und Flavonoide antioxidative Wirkung der Polyphenole erwiesen
Polyphenole die heimlichen Helfer sekundäre Pflanzenstoffe, die auch beim Menschen positive Wirkung zeigen Gruppen der Phenolsäuren, Anthocyane und Flavonoide antioxidative Wirkung der Polyphenole erwiesen
Aktuelle Trends im Ernährungsverhalten
 Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.v. 23. Durum- und Teigwaren-Tagung Aktuelle Trends im Ernährungsverhalten Prof. Dr. Helmut Heseker Universität Paderborn Fachgruppe Ernährung & Verbraucherbildung
Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.v. 23. Durum- und Teigwaren-Tagung Aktuelle Trends im Ernährungsverhalten Prof. Dr. Helmut Heseker Universität Paderborn Fachgruppe Ernährung & Verbraucherbildung
Ein Apfel am Tag erspart den Besuch beim Arzt
 Ein Apfel am Tag erspart den Besuch beim Arzt Dr. Stephan Barth Max Rubner-Institut, Karlsruhe 5. Oktober 13; Europom Hamburg Gesunde Ernährung ist Grundstein des Lebens Max Rubner-Institut Bundesforschungsinstitut
Ein Apfel am Tag erspart den Besuch beim Arzt Dr. Stephan Barth Max Rubner-Institut, Karlsruhe 5. Oktober 13; Europom Hamburg Gesunde Ernährung ist Grundstein des Lebens Max Rubner-Institut Bundesforschungsinstitut
vom Meldenden Personengruppe, die von der Angabe erfasst werden, eingeschränkt auf
 II-17 II-18 Ballaststoffe Ballaststoffe Obst und Gemüse enthalten einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Obst und Gemüse enthalten einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Obst und Gemüse füllen auf Grund
II-17 II-18 Ballaststoffe Ballaststoffe Obst und Gemüse enthalten einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Obst und Gemüse enthalten einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Obst und Gemüse füllen auf Grund
Ab welchen Werten wird s brenzlig?
 Was Sie über Cholesterin wissen sollten Ab welchen Werten wird s brenzlig?»wenn das Cholesterin über 200 mg/dl beträgt, dann ist bereits das Risiko für die Gefäße erhöht.wenn das Cholesterin etwa 250 mg/dl
Was Sie über Cholesterin wissen sollten Ab welchen Werten wird s brenzlig?»wenn das Cholesterin über 200 mg/dl beträgt, dann ist bereits das Risiko für die Gefäße erhöht.wenn das Cholesterin etwa 250 mg/dl
APPLIKATIONSNOTE Bestimmung von Aflatoxin M1 mittels FREESTYLE ThermELUTE mit online HPLC-Messung
 Bestimmung von Aflatoxin M1 mittels FREESTYLE ThermELUTE mit online HPLC-Messung APPLIKATIONSNOTE www.lctech.de Stand: Februar 2017, Version: 1.3 Bestimmung vom Aflatoxin M1 mittels FREESTYLE ThermELUTE
Bestimmung von Aflatoxin M1 mittels FREESTYLE ThermELUTE mit online HPLC-Messung APPLIKATIONSNOTE www.lctech.de Stand: Februar 2017, Version: 1.3 Bestimmung vom Aflatoxin M1 mittels FREESTYLE ThermELUTE
Institut für Lebensmittelchemie
 Institut für Lebensmittelchemie Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Entwicklung einer neuartigen membranchromatographischen Methode zur Isolierung von Anthocyanen aus Heidelbeeren
Institut für Lebensmittelchemie Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Entwicklung einer neuartigen membranchromatographischen Methode zur Isolierung von Anthocyanen aus Heidelbeeren
Kriterienkatalog Mai 2010
 Kriterienkatalog 09003 28. Mai 2010 Lebensmittel mit möglichst geringem Anteil an künstlichen Transfettsäuren ÖkoKauf Wien Arbeitsgruppe 09 Lebensmittel Arbeitsgruppenleiterin: Dipl. Ing. Herta Maier Wiener
Kriterienkatalog 09003 28. Mai 2010 Lebensmittel mit möglichst geringem Anteil an künstlichen Transfettsäuren ÖkoKauf Wien Arbeitsgruppe 09 Lebensmittel Arbeitsgruppenleiterin: Dipl. Ing. Herta Maier Wiener
Essen mit Sinn(en) - Fachtag Störfeld Essen. Workshop III. Alina Reiß Oecotrophologin B.Sc.
 Essen mit Sinn(en) - Fachtag Störfeld Essen Workshop III Alina Reiß Gliederung I. Teil: Kurzvortrag 1. Allgemeines 2. Sinn vom Essen Ernährungspyramide 3. Psychosoziale Faktoren 4. Tipps für den Alltag
Essen mit Sinn(en) - Fachtag Störfeld Essen Workshop III Alina Reiß Gliederung I. Teil: Kurzvortrag 1. Allgemeines 2. Sinn vom Essen Ernährungspyramide 3. Psychosoziale Faktoren 4. Tipps für den Alltag
Liebigkühler. Rundkolben Vorstoß. Becherglas
 Die Destillation 1 1 Allgemeines Bei der Destillation werden Stoffe mit unterschiedlichen Siedetemperaturen durch Erhitzen voneinander getrennt. Aus Rotwein kann auf diese Weise der Alkohol (Ethanol, Sdp.
Die Destillation 1 1 Allgemeines Bei der Destillation werden Stoffe mit unterschiedlichen Siedetemperaturen durch Erhitzen voneinander getrennt. Aus Rotwein kann auf diese Weise der Alkohol (Ethanol, Sdp.
4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark
 4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über das Signalverhalten von Leber, Milz und Knochenmark geben. Die Organe wurden zusammen
4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über das Signalverhalten von Leber, Milz und Knochenmark geben. Die Organe wurden zusammen
2017 Umsetzung von Zimtsäurechlorid mit Ammoniak zu Zimtsäureamid
 217 Umsetzung von Zimtsäurechlorid mit Ammoniak zu Zimtsäureamid O O Cl NH 3 NH 2 C 9 H 7 ClO (166.6) (17.) C 9 H 9 NO (147.2) Klassifizierung Reaktionstypen und Stoffklassen Reaktion der Carbonylgruppe
217 Umsetzung von Zimtsäurechlorid mit Ammoniak zu Zimtsäureamid O O Cl NH 3 NH 2 C 9 H 7 ClO (166.6) (17.) C 9 H 9 NO (147.2) Klassifizierung Reaktionstypen und Stoffklassen Reaktion der Carbonylgruppe
Übungsaufgaben zu Ionenreaktionen in wässriger Lösung
 Übungsaufgaben zu Ionenreaktionen in wässriger Lösung 1) Berechnen Sie den phwert von folgenden Lösungen: a) 0.01 M HCl b) 3 10 4 M KOH c) 0.1 M NaOH d) 0.1 M CH 3 COOH (*) e) 0.3 M NH 3 f) 10 8 M HCl
Übungsaufgaben zu Ionenreaktionen in wässriger Lösung 1) Berechnen Sie den phwert von folgenden Lösungen: a) 0.01 M HCl b) 3 10 4 M KOH c) 0.1 M NaOH d) 0.1 M CH 3 COOH (*) e) 0.3 M NH 3 f) 10 8 M HCl
D-(+)-Biotin (Vitamin H)
 D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!!
 !!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende neue Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf sind bis zum 31.05.2014 an folgende
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende neue Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf sind bis zum 31.05.2014 an folgende
Rf-Werte für einige Saccharide: Arabinose 0,54 Fructose 0,51 Galactose 0,44
 Chromatographie 1996/IV/1 1 Bei der chromatographischen Analyse spielt der Verteilungskoeffizient K eine große Rolle für die Qualität der Auftrennung von Substanzgemischen. Er ist definiert als Quotient
Chromatographie 1996/IV/1 1 Bei der chromatographischen Analyse spielt der Verteilungskoeffizient K eine große Rolle für die Qualität der Auftrennung von Substanzgemischen. Er ist definiert als Quotient
Betreuer: Tobias Olbrich Literatur: Nach Organic Syntheses Coll. Vol. 10 (2004), 96.
 rganisches Praktikum CP II Wintersemester 2009/10 Versuch 28 Salen-Ligand Betreuer: Tobias lbrich Literatur: ach rganic Syntheses Coll. Vol. 10 (2004), 96. Chemikalien: L-()-Weinsäure 1,2-Diaminocyclohexan
rganisches Praktikum CP II Wintersemester 2009/10 Versuch 28 Salen-Ligand Betreuer: Tobias lbrich Literatur: ach rganic Syntheses Coll. Vol. 10 (2004), 96. Chemikalien: L-()-Weinsäure 1,2-Diaminocyclohexan
