2 Superparamagnetische Eisenoxid-Partikel als Kontrastmittel für MR-Tomographie und Therapie
|
|
|
- Bella Schneider
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 5 2 Superparamagnetische Eisenoxid-Partikel als Kontrastmittel für MR-Tomographie und Therapie 2.1 Einleitung Der Begriff des Superparamagnetismus wurde 1952 erstmalig genannt (111) und beschreibt die Eigenschaft von sehr kleinen Eisenoxid-Partikeln in Pulvern oder Suspensionen, sich im Magnetfeld ähnlich wie ein Ferromagnet (z.b. Stabmagnet) stark magnetisieren zu lassen, im Gegensatz zum Ferromagneten jedoch nach Abschalten des Magnetfeldes keine Restmagnetisierung aufzuweisen (12). Im Biomedizinischen Bereich führte die Möglichkeit, am organischen Hüllmaterial solcher Partikel chemisch funktionelle Gruppen (Antikörper oder Antigene) zu binden, zur Verwendung dieser Partikel für die Trennung von biologischen Materialien unter Einfluss eines Magnetfeldes, z.b. in Immunoassays (117). Eine logische Konsequenz war daher im Jahr 1986 der Vorschlag, entsprechend markierte superparamagnetische Eisenoxidpartikel (superparamagnetic iron oxide, SPIO) als immunospezifisches Kontrastmittel für die damals aufkommende MR- Tomographie zu verwenden (181). Die Eigenschaft von Zellen des Mononukleären Phagozytierenden Systems (MPS), unspezifisch Partikel aus der Blutbahn aufzunehmen, führte1987 zur Entdeckung von SPIO als intravenös applizierbares MRT-Kontrastmittel für die Organe des MPS, insbesondere für die MR-Tomographie der Leber und der Milz (83, 192). Seit dieser Zeit sind SPIO in vielfältiger Weise weiterentwickelt worden. Neben der Diagnostik von Tumoren der Leber und Milz liegen Schwerpunkte auf der Lymphknotendiagnostik sowie auf morphologischen und funktionellen MR- Untersuchungen des Knochenmarks. Das Einsatzspektrum von SPIO beschränkt sich allerdings nicht mehr nur auf die Organe des MPS. Verschiedene Varianten dieser Partikel werden präklinisch oder klinisch als Kontrastmittel für mehrere Aspekte der Gefäßdiagnostik geprüft: Für die MR-Angiographie, für die funktionelle Diagnostik von atherosklerotischen Plaques sowie für die Thrombosediagnostik. Des Weiteren sind Ansätze zu nennen, SPIO als Kontrastmittel für Perfusionsstudien, z.b. des Myokards, oder auch zur Untersuchung der Vaskularisation von Tumoren zu verwenden. Schließlich liegen zahlreiche Publikationen zum Einsatz von SPIO als Kontrastmittel für die so genannte Molekulare Bildgebung vor. Neben diagnostischen Ansätzen sind gerade in jüngster Zeit auch therapeutische Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt worden, unter anderem mit SPIO in der Gentherapie oder auch als Vermittler für die Hyperthermie. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wesentlichen physikalisch-chemischen und biologischen Eigenschaften der verschiedenen SPIO, den aktuellen Stand der präklinischen und klinischen Entwicklung bzw. klinischen Anwendung sowie Ausblicke auf
2 6 zukünftige Indikationen. In Bezug auf den experimentellen und klinischen Teil der vorgelegten Arbeit sind hier besonders die einleitenden Kapitel zu Terminologie (Kapitel 2.2.1), Partikelzusammensetzung und Biodegradation (Kapitel 2.2.2), sowie zur Relaxationswirksamkeit (Kapitel 2.2.3) von Bedeutung, des Weiteren die Kapitel zur Anwendung von SPIO in der MR-Diagnostik der Leber (Kapitel 2.3.1) und in der MR- Angiographie (Kapitel 2.4.1). Ergänzend werden in Kapitel 2.8 die Struktur und magnetische Eigenschaften von Eisenoxiden sowie mögliche Herstellungswege erläutert. 2.2 Partikelarten und eigenschaften Terminologie SPIO ist der Überbegriff für alle in der MR-Tomographie als Kontrastmittel experimentell oder klinisch eingesetzten superparamagnetischen Eisenoxid-Partikel (SPIO: Superparamagnetic Iron Oxide). Innerhalb dieser Substanzgruppe findet sich die Untergruppe der Partikel mit vergleichsweise größerem Durchmesser (etwa nm oder größer), die historisch bedingt auch im engeren Sinne als SPIO bezeichnet wird. Der ebenfalls für diese Untergruppe der größeren Partikel verwendete Begriff der Standard SPIO (SSPIO) (251) ist weniger gebräuchlich. Hiervon wird die Untergruppe der Partikel mit kleinerem Durchmesser um etwa 20 nm abgegrenzt und als Ultrakleine Superparamagnetische Eisenoxid-Partikel bezeichnet (USPIO: Ultrasmall SPIO). Weitere Bezeichnungen berücksichtigen den Partikelaufbau, wie z.b. Monokristalline Eisenoxid- Partikel (MION: Monocrystalline Iron Oxide Nanoparticles), die sich jedoch nicht wesentlich von den als USPIO bezeichneten Partikeln unterscheiden. Die gezielte Quervernetzung des Hüllmaterials führt zur Bezeichnung CLIO (Cross Linked Iron Oxide). Die als SPIO, USPIO oder MION bekannten Partikel sind mit Polymeren, wie z.b. Dextran oder Carboxydextran umhüllt. Der Begriff Magnetite wurde frühzeitig in Verbindung mit magnetischen bzw. superparamagnetischen Eisenoxid-Partikeln für biomedizinische Anwendungen, insbesondere als Kontrastmittel für die MR-Tomographie, verwendet (9, 267). Allerdings ist dieser Begriff nicht ganz korrekt, da diese Eisenoxid-Partikel in der Regel aus einem Magnetit-Maghämit Gemisch bestehen (siehe Kapitel 2.8) Zusammensetzung, Biodegradation Grundlage für den Superparamagnetismus sind sehr kleine Eisenoxidkristalle mit einer so genannten inversen Spinell-Struktur mit einem Durchmesser von wenigen nm (251) (siehe Kapitel 2.8). Um eine für die intravenöse Injektion geeignete Präparation von SPIO zu erhalten, müssen die Partikel mit einer Umhüllung versehen werden (siehe auch Abschnitt
3 7 2.8 dieses Kapitels). In größeren Partikeln bilden zahlreiche Eisenoxidkristalle zusammen mit dem Hüllmaterial Konglomerate mit bis zu mehreren 100 nm Durchmesser, so genannte polykristalline Partikel (192). Bei sehr kleinen Partikeln sind einzelne Kristalle separat mit dem Hüllmaterial beschichtet (monokristalline Partikel). Als Hüllmaterial wurden bislang Polymere wie Dextran (z.b. AMI 25, AMI 227, AMI 228) (170, 192), Carboxydextran (SHU 555 A, SHU 555 C) (121), Albumin (267), Stärke (113), Polyethylenglycol (187) oder eine liposomale Umhüllung (161) verwendet (Tabelle 2.1 und Tabelle 2.2). Im Vergleich zum Körpereisenpool sind diagnostische Dosierungen von ca. 0,01 bis 0,05 mmol Fe/kg gering und entsprechen ca % der Gesamteisenmenge. Nach intravenöser Injektion werden die Partikel abgebaut, das Eisen wird in den Körpereisenpool überführt (265) Relaxationsverstärkende Eigenschaften: T 2 -Effekt versus T 1 -Effekt Alle MR-Kontrastmittel ( Relaxationsagentien ), sowohl Gadolinium-haltige Verbindungen als auch Eisenoxid-basierte, partikuläre Substanzen verkürzen gleichzeitig die T 1 - und die T 2 -Relaxationszeit ihres umgebenden Mediums. Diese Wirkung wird eher umgangssprachlich als T 1 - bzw. T 2 -Effekt oder -Verkürzung bezeichnet. Die korrektere Beschreibung ist die der T 1 - bzw. T 2 -Relaxationszeit verkürzende Wirkung. Als Maß für die Verkürzung der Relaxationszeiten einer bestimmten Substanz wird die Relaxivität (T 1 - Relaxivität (r 1 ) bzw. T 2 -Relaxivität (r 2 )) mit der Einheit l/(mmol*s) oder auch l*mmol -1 *s -1 verwendet. SPIO sind zu Beginn ihres Einsatzes als Kontrastmittel in der MR- Tomographie als so genanntes negatives MR-Kontrastmittel entdeckt und für die MR- Tomographie entwickelt worden. Grund für die Verwendung als negatives Kontrastmittel war die im Vergleich zu den Gadolinium-haltigen Substanzen wesentlich stärkere T 2 - und T 2 *-verkürzende Wirkung (hohe T 2 -Relaxivität) mit entsprechend stark signalminderndem Effekt nicht nur in T 2 - bzw. T 2 *-gewichteten Sequenzen sondern auch in T 1 -gewichteten Techniken. Theoretisch war für SPIO ihre ebenfalls starke T 1 -verkürzende Wirkung zwar bekannt, konnte jedoch aufgrund messtechnischer Limitationen nicht genutzt werden. Diese Limitationen bestanden in den relativ langen, minimalen Echozeiten, die an klinischen Geräten bis etwa 1995 eingestellt werden konnten. Mit Verfügbarkeit von MR- Tomographen mit leistungsfähigeren Gradientensystemen konnten insbesondere in Gradientenechosequenzen Echozeiten von 5 ms und weniger gewählt werden. Dies schaffte die Möglichkeit, auch den T 1 -verkürzenden Effekt von SPIO im Bild sichtbar zu machen.
4 8 Tabelle 2.1: Übersicht über die derzeit in klinischer Entwicklung befindlichen oder zugelassenen SPIO-basierten Kontrastmittel Substanz Indikation Dosis Applikation Handelsname Hersteller Status AMI-25 Leber/Milz 0,015 mmol Fe/kg (Europa) Infusion Endorem (Europa) Guerbet zugelassen 0,010 mmol Fe/kg (USA, Japan) Feridex (USA) Berlex zugelassen SHU 555 A Leber/Milz ca. 0,008 mmol Fe/kg Bolusinjektion Resovist Schering AG zugelassen AMI-227 Lymphknoten MR-Angiographie 0,030 0,045 mmol Fe/kg Infusion Sinerem Guerbet Phase III Combidex Advanced Magnetics Phase III Leber 1 AMI-228 MR-Angiographie bis 0,75 mmol Fe/kg Bolusinjektion - Advanced Magnetics Phase I NC MR-Angiographie µmol Fe/kg Perfusion 7 µmol Fe/kg Bolusinjektion Clariscan Amersham Phase III SHU 555 C MR-Angiographie Bolusinjektion Supravist Schering AG Phase II OMP Orale Kontrastierung 0,5 g Fe/l, ml oral Abdoscan Amersham zugelassen AMI-121 Orale Kontrastierung 1,5-3,9 mmol Fe/l, ml oral Lumirem Guerbet zugelassen Gastromark Advanced Magnetics zugelassen Anmerkung: 1 nach pilotartiger Studie nicht weiter geprüft 2 klinische Entwicklung wird derzeit nicht weitergeführt
5 9 Tabelle 2.2: Partikeleigenschaften einiger SPIO mit Indikationen für die intravenöser Injektion. Zum Vergleich sind ein makromolekulares Gd-haltiges (Gadomer) und ein niedermolekulares, Gd-haltiges (Gadopentetat Dimeglumin, Gd-DTPA) Kontrastmittel mit aufgeführt. Substanz Quelle Partikelgröße Hüllmaterial T 1 -Relaxivität (R 1 ) [l/(mmol*s)] T 2 -Relaxivität (R 2 ) [l/(mmol*s)] r 1 /r 2 AMI-25 (98) nm Dextran ,3 SHU 555 A (121) nm Carboxydextran ,15 AMI-227 (229) nm Dextran ,39 AMI-228 (170) (71) ca. 18 nm Carboxymethyldextran 35,3 64,8 0,54 NC (187) 20 nm Stärke/PEG ,57 SHU 555 C (108) ca. 20 nm Carboxydextran ,44 Gadomer (43) 35 kda - 18,7 29 0,64 Gd-DTPA 1 (98) 0,7 kda ,66 Anmerkung: Alle Werte wurden nach Angabe der Quelle bei 0,47 T ermittelt; zu ein und derselben Substanz können in verschiedenen Quellen gelegentlich leicht differierende Angaben zu den Relaxivitäten gefunden werden. PEG: Polyethylenglycol.
6 10 SPIO weisen in Abhängigkeit ihrer Größe deutlich unterschiedliche Werte für die T 1 - und T 2 -Relaxivität auf. Ob SPIO bei entsprechender Wahl der Pulssequenz eher als negatives oder positives Kontrastmittel nutzbar sind, wird durch das Verhältnis von T 1 - zu T 2 - Relaxivität (r 1 /r 2 ) bestimmt (Tabelle 2.2). Große Partikel mit einem Durchmesser von ca. 50 nm oder mehr besitzen ein niedriges r 1 /r 2 und sind eher nur als negatives Kontrastmittel nutzbar, kleine Partikel mit Durchmessern von etwa 20 nm oder weniger besitzen ein hohes r 1 /r 2 und können sowohl als positives als auch als negatives Kontrastmittel genutzt werden (29, 108). Neben der Partikelbeschaffenheit beeinflusst in vivo auch die zelluläre Aufnahme der Partikel ihre signalverändernde Wirkung. SPIO, die frei in der Blutbahn zirkulieren oder sich im Extrazellulärraum befinden, zeigen im wesentlichen die unter in vitro Bedingungen bestimmten Eigenschaften. Demgegenüber steigt nach intrazellulärer Aufnahme der Partikel, z.b. in den Kupffer-Zellen der Leber, der signalmindernde Effekt (155). 2.3 SPIO als Kontrastmittel für Organe des Mononukleären Phagozytierenden Systems Zu den Organen des Mononukleären Phagozytierenden Systems (MPS) zählen Leber, Milz, Knochenmark und Lymphknoten, die auch im engeren Sinne als Organe des Retikuloendothelialen Systems (RES) bezeichnet werden. Zur Phagozytose befähigte Zellen sind jedoch auch z.b. Gliazellen in Zentralen Nervensystem. Daher kann im weiteren Sinne von SPIO auch als Kontrastmittel für das MPS gesprochen werden Leber und Milz Der Einsatz von SPIO als Kontrastmittel für die MRT von Leber und Milz basiert auf der Eigenschaft von Zellen des RES, unspezifisch Partikel aus dem Blut aufzunehmen (192). Diese Phagozytose erfolgt im Allgemeinen für größere Partikel schneller und vollständiger als für kleinere Partikel. Daher sind für die MRT von Leber und Milz insbesondere größere Partikel geeignet. Bislang für die MRT von Leber und Milz zugelassene Substanzen sind Endorem (seit 1994) und Resovist (seit 2002). Es hat sich jedoch gezeigt, dass auch kleinere Partikel bei entsprechend höherer Dosierung zu einem nutzbaren Signalverlust in der Leber führen (29). Die Aufnahme der SPIO-Partikel in Leber und Milz hängt von der Verteilung und Funktionsfähigkeit der Kupffer-Zellen bzw. Milz-Makrophagen ab. Für die MRT der Leber ergibt sich daher als wichtige Indikation der Nachweis von nicht Makrophagen-haltigem Fremdgewebe (fokale Leberläsionen). Dies sind im Wesentlichen Metastasen, Cholangiozelluläre Karzinome, entdifferenzierte Hepatozelluläre Karzinome und
7 11 Lymphominfiltrationen. Neben dem Nachweis fokaler Leberläsionen wird die Beurteilung diffuser Leberveränderungen als Indikation für den Einsatz von SPIO geprüft. Für beide, heute klinisch in der Leberdiagnostik anwendbare Substanzen (Endorem, Resovist ) wurde gezeigt, dass im Vergleich zur Nativuntersuchung die Detektion fokaler Leberläsionen signifikant verbessert wird (10, 22, 55, 74, 103). Müller und Mitarbeiter fanden im Vergleich zur biphasischen Spiral-CT für die SPIO-verstärkte MRT eine verbesserte Detektion maligner Lebertumoren (152). In der präoperativen Diagnostik von Lebertumoren hatte bislang die CTAP aufgrund der hohen Sensitivität ihren Stellenwert. Es konnte gezeigt werden, dass die SPIO-verstärkte MRT im Vergleich zur CTAP eine ähnliche Sensitivität im Nachweis von Lebermetastasen hat bei jedoch geringerer Rate an falsch positiven Befunden (10). Die Verwendung von SPIO in der Diagnostik fokaler Leberläsionen liefert neben der verbesserten Detektion von Metastasen auch Zusatzinformationen zur Tumorcharakterisierung. Basis hierfür ist, dass Fokale Noduläre Hyperplasien, Adenome und gut differenzierte Hepatozelluläre Karzinome ebenfalls Kupffer-Zellen beinhalten. Dies führt nach SPIO Applikation zu einem Signalverlust der Läsionen, so dass diese primären Lebertumoren von sekundären Tumoren abgegrenzt werden können (70, 220, 244). Hierbei zeigen Adenome im allgemeinen eine geringere Aufnahme von SPIO als Fokale Noduläre Hyperplasien. Adenome und gut differenzierte Hepatozelluläre Karzinome zeigen allerdings eine große Variationsbreite der SPIO-Aufnahme, so dass zur weiteren Differenzierung dieser lebereigenen Tumoren untereinander Zusatzinformation wie die Binnenstruktur in der Nativuntersuchung und der Postkontrastaufnahme herangezogen werden müssen (11, 16). Neben der Nutzung des signalmindernden Effektes in statischen T 2 -gewichteten postkontrast Aufnahmen kann die Information aus T 1 -gewichteten dynamischen und statischen postkontrast Aufnahmen die Differenzierung von Lebertumoren verbessern (151, 188, 189, 190). Voraussetzung für die dynamische Untersuchung ist, dass die Substanz als Bolus injiziert werden kann. Da die Funktionsfähigkeit der Kupffer-Zellen durch diffuse Lebererkrankungen, z. B. Leberzirrhose oder Hepatitis, oder auch durch eine Bestrahlung eingeschränkt wird, resultiert eine verminderte oder inhomogene Aufnahme von SPIO im Leberparenchym. Hieraus resultieren Ansätze, nach intravenöser Injektion von SPIO Art und Ausmaß einer Leberparenchymschädigung zu bestimmen (45, 102). Des Weiteren gelingt es mit diesem Ansatz, eine Leberfibrose nachzuweisen und in ihrem Ausmaß zu bestimmen (134).
8 Lymphknoten In Analogie zur Lymphszintigraphie mit kolloidalen Isotopen-markierten Substanzen führte der Partikelcharakter von SPIO zu dem Schluss, dass diese Kontrastmittel auch für die MR-tomographische Lymphknotendiagnostik einsetzbar sein sollten. In der Lymphszintigraphie werden die Substanzen interstitiell in den Einzugsbereich der zu untersuchenden Lymphknotengruppen bzw. peritumoral injiziert. Somit war es nicht so bemerkenswert, dass sich im Experiment an der Ratte SPIO nach interstitieller Injektion in normalen Lymphknoten anreichern und hier im MR-Bild zu einem Signalabfall führen bzw. eine fehlende Anreicherung einen metastatischen Befall von Lymphknoten anzeigten (233, 258). Untersuchungen mit endolymphatischer Injektion am Kaninchen zeigten, dass schon sehr geringe Mengen von SPIO einen starken Signalabfall in gesunden Lymphknoten herbeiführen (76) und deuteten an, dass selbst kleine Metastasen in nicht vergrößerten Lymphknoten detektiert werden können (233). Überaus überraschend war die Entdeckung, dass USPIO nach intravenöser Injektion in normalen Lymphknoten akkumuliert werden (259). Voraussetzung hierfür ist ein sehr kleiner Partikeldurchmesser von etwa 20 nm (USPIO) sowie eine geeignete Oberflächenbeschichtung aus dicht gelagerten Dextranmolekülen. Diese beiden Merkmale kleine Partikelgröße, dichte Beschichtung mit Dextranen - führen zu einer Maskierung der Partikel gegenüber den Makrophagen, so dass die für größere Partikel typische rasche Aufnahme in Leber und Milz unterbleibt (260). Während der resultierenden langen intravasalen Zirkulationszeit (Halbwertszeit von mehreren Stunden) können diese kleinen Partikel in die Lymphknoten gelangen (44, 61, 150, 182). Die systemische Kontrastierung der Lymphknoten nach intravenöser Injektion dieser USPIO hat zum Begriff der intravenösen MR-Lymphographie geführt (259). Ein Problem hinsichtlich eines Erfolges dieser Methode ist die starke Variabilität des Lymphflusses in Abhängigkeit z.b. des Kreislaufzustandes oder der Muskelaktivität eines Individuums, was zu deutlichen intra- und interindividuellen Schwankungen der Anreicherung der USPIO in Lymphknoten nach intravenöser Injektion führt und damit auch die Detektion von Lymphknotenmetastasen beeinflussen kann (61, 182, 248). Die einzige Substanz, die derzeit klinisch für die intravenöse MR-Lymphographie geprüft wird, ist aus AMI-227 (Advanced Magnetics, Cambridge, USA) hervorgegangen (In Europa: Sinerem (Guerbet, Paris), in den USA: Combidex (Advanced Magnetics)). Seit etwa 1995 werden zu zahlreichen Indikationen klinische Studien zur intravenösen MR- Lymphographie mit Sinerem bzw. Combidex durchgeführt, z.b. bei Patienten mit HNO- Tumoren, Mammakarzinom, Bronchialkarzinom oder Malignomen des Beckens. Ziel der Studien ist zu prüfen, ob mit der intravenösen MR-Lymphographie gegenüber der nativen
9 13 MRT bzw. auch klinischer Beurteilung die Treffsicherheit bezüglich der Detektion von Lymphknotenmetastasen verbessert wird, weitergehend auch, ob für bestimmte Primärtumoren, z.b. das Prostatakarzinom, eine diagnostische Lymphadenektomie überflüssig wird oder das Ausmaß einer Lymphadenektomie besser geplant werden kann, wie z.b. bei HNO-Tumoren. In mehreren Studien hat sich gegenüber der nicht kontrastverstärkten Untersuchung ein Trend zu einer Verbesserung der Detektion oder auch eine signifikante Verbesserung der Detektion von Lymphknotenmetastasen gezeigt, auch mit potenzieller Auswirkung auf das weitere klinische Management (17, 56, 78, 80, 86, 89, 135). Allerdings wurde auch in mehreren Studien beobachtet, dass reaktiv vergrößerte Lymphknoten nicht sicher von metastatischen Lymphknoten unterschieden werden können (79, 158). Einem Durchbruch der Methode steht bislang noch die limitierte räumliche Auflösung und das Auftreten von Bewegungsartefakten entgegen, die eine Beurteilung der sehr kleinen Binnenstrukturen von nicht vergrößerten Lymphknoten verhindern (86, 214) Knochenmark Schon die native MRT ist bezüglich des Nachweises von fokalen Tumoren oder einer diffusen Infiltration des Knochenmarkraumes relativ aussagekräftig. Diagnostische Schwierigkeiten können bei der Unterscheidung von sehr zellreichem Knochenmark gegenüber malignen Veränderungen bestehen, z.b. im Kinder- und Jugendalter oder bei der so genannten Rekonversion. Intravenös applizierte SPIO werden auch von Makrophagen des Knochenmark aufgenommen, und zwar kleinere Partikel (USPIO) in stärkerem Masse als größere Partikel (SPIO). Hieraus resultiert eine verbesserte Abgrenzung von fokalen oder diffusen Tumormanifestationen im Knochenmark (212), insbesondere auch bei Vorliegen eines hyperplastischen Knochenmarks (54). Ein weiterer interessanter Aspekt der Anwendung von SPIO in der MRT des Knochenmarks ist die Möglichkeit, bestrahlungsbedingte funktionelle Veränderungen des Endothels oder der Makrophagenaktivität abzuschätzen (51, 53) Andere MPS-bezogene Anwendungen von SPIO Die im ZNS lokalisierten Mikrogliazellen zeigen unter normalen Verhältnissen keine Phagozytoseaktivität. Durch einen pathologischen Prozess, z.b. Entzündung oder Tumor, werden Mikrogliazellen im Rahmen der Immunantwort zur Phagozytose aktiviert. Begrenzung und Ausläufer von Gliomen lassen sich auch mit Gd-verstärkter MRT häufig nur schlecht bildgebend erfassen. Maligne Tumore des ZNS sind zu einem bedeutenden Teil von aktivierter Mikroglia durchsetzt und umgeben. Fleige und Mitarbeiter zeigten experimentell, dass aktivierte Mikroglia in hohem Maße USPIO phagozytiert und somit
10 14 einerseits morphologisch eine indirekte Darstellung der Tumorgrenzen über die Kontrastierung der aktivierten Mikroglia möglich wird, sowie, dass funktionelle Informationen über die immunologische Reaktion auf den Tumor zugänglich sein kann (64). Die Rejektion von transplantierten Organen wird von einer Infiltration des Organes durch Makrophagen begleitet. Hierauf beruht der Ansatz, nach intravenöser Injektion der Partikel und Signalintensitätsbestimmung im Transplantatorgan das Vorliegen bzw. das Ausmaß einer Rejektion zu bestimmen. Eine Signalabnahme weist auf eine vermehrte Akkumulation der Partikel und damit auf eine Rejektion hin. Hierzu liegen experimentelle Untersuchungen zum Rejektionsnachweis von Herz-, Lungen und Nierentransplantaten vor (13, 100, 101). Die Beurteilung einer Rejektion von Lebertransplantaten beruht demgegenüber auf einer verminderten Aufnahme der Partikel, da im Zuge der Rejektion die Funktion der Kupffer-Zellen beeinträchtigt wird (148). 2.4 Gefäßdiagnostik mit SPIO: MR-Angiographie, Plaquecharakterisierung, Thrombosediagnostik, Perfusionsstudien Kontrastverstärkte MR-Angiographie Wie im Abschnitt Relaxationsverstärkende Eigenschaften (Kapitel 2.2.3) ausgeführt, weisen SPIO neben einer hohen T 2 -Relaxivität (signalmindernde Wirkung) auch eine hohe T 1 -Relaxivität (signalsteigernde Wirkung) auf. Mit abnehmender Partikelgröße nimmt die T 2 -Relaxivität ab und in der Regel das Verhältnis zwischen T 1 - und T 2 -Relaxivität zu, so dass für die Gefäßdarstellung insbesondere kleine Partikel (USPIO) geeignet sind (3). SPIO gehören zu den Kontrastmitteln mit verlängerter intravasaler Verweildauer, die als Blut-Pool Kontrastmittel bezeichnet werden. Mit abnehmender Partikelgröße verlängert sich im Allgemeinen die intravasale Verweildauer und damit der Blut-Pool Effekt von SPIO. Schon für die vergleichsweise großen, für die MRT der Leber entwickelten SPIO mit überwiegender T 2 -Relaxationszeitverkürzung konnte mit entsprechend stark T 1 - gewichteten Sequenzen ein angiographischer Effekt nachgewiesen werden (242). Diese Erkenntnisse sind insofern von Bedeutung, dass im Rahmen einer MRT der Leber, z.b. mit Endorem oder Resovist, neben der Tumordarstellung in T 2 -gewichteter Technik auch die größeren Lebergefäße (Pfortader, Lebervenen) in T 1 -gewichteten Sequenzen verbessert beurteilt werden können (109, 173, 201). Der Blut-Pool Charakter von Endorem konnte bei der Fragestellung einer tiefen Venenthrombose bzw.
11 15 Lungenarterienembolie für eine umfassende MR-angiographische Untersuchung der tiefen Beinvenen, der großen Abdominalvenen und der Lungenarterien in einem Untersuchungsgang nach Infusion der Substanz genutzt werden (202). Der Einsatz dieser für die Leberdiagnostik optimierten, großen SPIO für die MR-Angiographie kann allerdings nur als hilfsweiser Ansatz gesehen werden. Mittlerweile sind verschiedene USPIO speziell für die Indikation der kontrastverstärkten MR-Angiographie entwickelt worden und befinden sich in der präklinischen oder klinischen Prüfung. Da SPIO in der Regel aus einem Gemisch von Partikeln verschiedener Größe bestehen, kann über bestimmte Auftrennungsverfahren die Fraktion der kleinen Partikel separiert werden. Allkemper und Mitarbeiter haben für verschiedene Fraktionen von SHU 555 experimentell belegt, dass auf diesem Weg die Eignung der Partikel für die MR-Angiographie optimiert werden kann. Die Fraktion der kleinsten Partikel war bezüglich der intravasalen Signalsteigerung während der ersten Kontrastmittelpassage vergleichbar mit einem niedermolekularen Gd-haltigen Kontrastmittel, hat jedoch gleichzeitig einen lang anhaltenden intravasalen Kontrast bewirkt (3). Clarke und Mitarbeiter zeigten in einer experimentellen Studie, dass diese kleinen Partikel (SHU 555 C) qualitativ einen ähnlich guten angiographischen Effekt aufweisen wie klassische Blut-Pool Kontrastmittel für die MR-Angiographie, z.b. Gdhaltige Makromoleküle, obwohl nach quantitativen Kriterien der signalsteigernde Effekt der USPIO nicht den des Gd-haltigen Makromoleküls erreicht (43). Eine andere Herangehensweise besteht in der Herstellung primär kleiner, für eine hohe Signalverstärkung optimierter Partikel, wie z.b. NC , oder die in der vorliegenden Arbeit behandelten VSOP (104, 231). Derzeit befinden sich drei USPIO-Kontrastmittel für die MR-Angiographie in der klinischen Prüfung (SHU 555 C, AMI 228, VSOP-C184). Angesichts der sehr guten Ergebnisse der First-Pass MR-Angiographie mit niedermolekularen, unspezifischen Kontrastmitteln (z.b. Magnevist, Omniscan ) in Kombination mit schnellen 3D-GRE Sequenzen in nahezu sämtlichen Gefäßterritorien (Arterien des Körperstamms, periphere Arterien, supraaortale Arterien) ist noch unklar, inwieweit überhaupt bzw. für welche Indikationen Bedarf an einem Blut-Pool Kontrastmittel besteht. Wenn der Blut-Pool Effekt mit länger dauernden Messungen und erhöhter Ortsauflösung ausgenutzt werden soll, muss mit einer venösen Überlagerung gerechnet werden, was die Auswertbarkeit der MR-Angiogramme beeinträchtigt (219). Eine Indikation, die zweifellos von der Verwendung eines Blut-Pool Kontrastmittels profitieren könnte, ist die MR-Angiographie der Koronararterien (87). Unter experimentellen Bedingungen konnten für verschiedene USPIO viel versprechende Ergebnisse hinsichtlich einer Verbesserung der Darstellung der Koronararterien erzielt
12 16 werden (95). Erste Ergebnisse klinischer Studien deuten zwar eine Verbesserung der kontrastunterstützten MR-Angiographie der Koronararterien mit NC an (14, 110, 194), hier sind jedoch noch technische Fortschritte bezüglich der Akquisitionstechnik notwendig, insbesondere, um nicht nur die proximalen Anteile der Koronararterien, sondern auch distale Segmente zu visualisieren. In der kardialen Bildgebung kann der Blut-Pool Charakter von USPIO neben der MR- Angiographie zur Darstellung der Koronararterien auch für die Kontrastierung des Herzbinnenraumes zur verbesserten Kontrastierung gegenüber dem Myokard eingesetzt werden, um in entsprechenden Cine Techniken die Auswertbarkeit von Funktionsuntersuchungen zu erleichtern (4) Charakterisierung atherosklerotischer Plaques Die Grundlage für die funktionelle Plaquediagnostik mit SPIO ist in der Pathophysiologie der Plaqueentstehung zu sehen. Nach heutiger Auffassung bestimmen nicht so sehr bereits verkalkte Plaques das Risiko eines ischämischen Ereignisses, z.b. eines Myokardinfarktes oder eines peripheren Gefäßverschlusses. Es sind vielmehr so genannte vulnerable Plaques, die unter Umständen keine oder nur eine geringe Gefäßverengung verursachen, jedoch eine hohe entzündliche Aktivität aufweisen mit gesteigertem Risiko für eine Plaqueruptur und damit verbundener Freisetzung von thrombogenen Substanzen mit konsekutivem thrombotischem Verschluss des Gefäßes. Derartige vulnerable Plaques weisen einen hohen Gehalt von Makrophagen auf. Es konnte für verschiedene USPIO am Tiermodell für atherosklerotische Plaques (Watanabe Heritable Hyperlipidemic rabbits, WHHL-Kaninchen (252)) eine Akkumulation der Partikel in Plaques mit entsprechendem fokalen Signalverlust in der Gefäßwand im MR-Bild nachgewiesen werden. Schmitz und Mitarbeiter zeigten, dass die Anreicherung von Carboxydextran-ummantelten USPIO für Dosierungen bis 0,2 mmol Fe/kg in diesem Tiermodell vor allem in Plaques mit erhöhter endothelialer Permeabilität und hohem Makrophagengehalt auftritt, somit in Plaques mit etablierten Kriterien entzündlicher Aktivität (203). Mit einer Substanz aus Dextran-ummantelten USPIO, die derzeit klinisch für die MR-Diagnostik von Lymphknoten geprüft wird (Sinerem), konnte ebenfalls am Tiermodell eine Anreicherung in atherosklerotischen Plaques demonstriert werden, allerdings mit der sehr hohen Dosierung von 1 mmol Fe/kg (186). Für dieses Kontrastmittel wurde im Rahmen einer klinischen Studie zur Lymphknotendiagnostik bei einem Teil des Patientenkollektivs auch eine fokale Kontrastierung in der Wand der Bauchaorta sowie der Beckenarterien gefunden (204). Ein Vergleich der MR-Bildgebung der tierexperimentellen Untersuchungen legt nahe, dass es sich hierbei um eine
13 17 Anreicherung der USPIO in atherosklerotischen Plaques handeln muss. Somit kann dies als die erste klinische Beobachtung einer funktionellen Plaquedarstellung in der MRT angesehen werden. Das überraschende an dieser Beobachtung war, dass eine kräftige Kontrastierung dieser mutmaßlichen Plaques im Gegensatz zu den experimentellen Studien bei der vergleichsweise geringen Dosis von 0,045 mmol Fe/kg auftrat Weitere vaskuläre Anwendungen von SPIO Thrombosediagnostik: Die intravasale Signalsteigerung von SPIO bzw. USPIO als Blut- Pool Kontrastmittel kann für die Visualisierung von venösen Thromben als Kontrastmittelaussparung in der MR-Angiographie genutzt werden (202). Mit diesem Ansatz kann Lokalisation und Ausmaß einer venösen Thrombose exakt dargestellt werden. Weiterführend wurde experimentell gezeigt, dass venöse Thromben nach intravenöser Injektion von USPIO altersabhängig Signalveränderungen zeigen und somit auch für eine Altersbestimmung von Thrombosen dienen könnten (205). Ein weiterer Ansatz zur Thrombosediagnostik ist die Verwendung des RGD-Peptid, einem Zelladhäsionspeptid, das in der Thrombusbildung eine Rolle spielt, als Oberflächenbestandteil von SPIO (93). Interventionsführung: Der lang anhaltende intravasale Signalanstieg von USPIO kann dazu genutzt werden, eine MR-kontrollierte Gefäßintervention, z.b. das Platzieren von Gefäßstents, über die verbesserte Visualisierung sowohl der Gefäße als auch des Katheters zu ermöglichen (245). Blutungsnachweis: Der Nachweis einer Blutungsquelle stellt häufig ein diagnostisches Problem dar. Blut-Pool Kontrastmittel akkumulieren am Blutungsort, ihre Akkumulation kann dann MR-tomographisch nachgewiesen werden. Experimentell gelang der Nachweis von pulmonalen Hämorrhagien nach intravenöser Injektion von NC in Verbindung mit einer 3D-MR-Angiographie Sequenz (255) Perfusionsstudien Bei Verwendung von niedermolekularen MR-Kontrastmitteln (z.b. Magnevist, Omniscan ), die rasch in das Interstitium extravasieren, können Parameter der Gewebeperfusion lediglich durch schnelle Messungen während der Anflutungsphase nach intravenöser Injektion erhoben werden. Dies limitiert die räumliche Auflösung bzw. das Volumen bei der Abbildung des Zielgebietes. Intravasal verbleibende Kontrastmittel, wie z.b. SPIO oder USPIO ermöglichen Messungen sowohl während der Anflutungs- als auch Equilibriumphase, wodurch mehr Flexibilität bezüglich der Messtechnik bzw. der Volumendeckung besteht. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von SPIO können
14 18 für die Bildgebung entweder T1-gewichtete oder T2-gewichtete Sequenzen eingesetzt werden. Die Bestimmung von Parametern für die Gewebeperfusion ist einerseits in der Bildgebung von Tumoren relevant, etwa im Zusammenhang mit Fragen der Angioneogenese, andererseits können Daten zur Perfusion von gesundem Gewebe, insbesondere jedoch von ischämischem Gewebe (z.b. Myokard, Cerebrum) erhoben werden. Tumorperfusion: Die dynamische, T1-gewichtete Bildgebung während der Anflutungsphase nach intravenöser Injektion von USPIO erlaubte an experimentellen Mammatumoren die Bestimmung der mikrovaskulären Permeabilität und des fraktionalen Plasmavolumens (239, 240). Aus der guten Korrelation der mikrovaskulären Permeabilität mit der histologisch ermittelten mikrovaskulären Dichte können daher nicht invasiv Parameter über die Angiogenese ermittelt werden. Es konnte auch gezeigt werden, dass aus den Daten der Perfusionsstudien mit USPIO Rückschlüsse auf das Tumorgrading möglich sind. Insbesondere deutet sich in diesen experimentellen Studien eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen benignen und malignen Mammatumoren an, wobei benigne Tumoren im Gegensatz zu Malignomen keine Zeichen einer mikrovaskulären Permeabilität aufweisen. USPIO scheinen in gleicher Weise wie die schon seit längerem hierfür verwendeten Gd-haltigen Makromoleküle (z.b. Gd-DTPA-Albumin) für experimentelle Untersuchungen der Tumorvaskularisation geeignet zu sein (241). In einer klinischen Studie zur MR-Diagnostik von Mammatumoren konnte für das USPIO NC (Clariscan ) gezeigt werden, dass der aus dem Signalverhalten ermittelte Wert für die mikrovaskuläre Permeabilität signifikant mit dem histologisch ermittelten Tumorgrad korrelierte und somit ein positiver prädiktiver Wert für den Nachweis von Malignität von 78% erzielt wurde (52). In einer klinischen Studie an Patienten mit hepatozellulären Karzinomen korrelierte das Ausmaß des intratumoralen Signalabfalles in der dynamischen T2-gewichteten Untersuchung nach bolusförmiger intravenöser Injektion von SPIO (SHU 555 A) gut mit dem Differenzierungsgrad der Tumoren (91). Myokardperfusion: Schon 1991 zeigten Rozenman und Mitarbeiter für AMI-25 experimentell in Messungen während der Equilibriumphase mit T2-gewichteten Sequenzen für normales Myokard eine Signalminderung, für Myokard, das einem Koronararterienverschluss nachgeschaltet war, eine unveränderte Signalintensität und für reperfundiertes Myokard eine im Vergleich zum normalen Myokard verstärkte Signalminderung. Sie schlossen hieraus die Möglichkeit, mit SPIO normales, ischämisches und reperfundiertes Myokard unterscheiden zu können (184). Bjerner und Mitarbeiter fanden in einer klinischen Anwendung von USPIO (NC100150) mit Untersuchungen in der Anflutungsphase einen signifikanten Signalabfall in normal
15 19 perfundiertem Myokard und schließen aus ihren Ergebnissen, dass mit der T2- gewichteten Messung während der Anflutungsphase die myokardiale Perfusion quantifiziert werden kann (20). Unter Ausnutzung des T1-Effektes von USPIO können mit T1-gewichteten Sequenzen die myokardiale Perfusion sowohl in der Anflutungs- als auch Equilibriumphase dargestellt und ischämische Areale abgegrenzt werden (19, 159). Es wird in einigen dieser Arbeiten auch aufgezeigt, dass weitere messtechnische Verbesserungen vor einem Einsatz in der klinischen Diagnostik erforderlich sind. 2.5 Rezeptor- und Antikörper-vermittelte Kontrastierung, Zellmarkierung Sehr kleine SPIO (z.b. USPIO, MION) bieten aus zwei Gründen gute Voraussetzungen für diese Formen der Molekularen Bildgebung. Zum einen können an die Hülle Antigene oder Antikörper gebunden werden, wobei der Gesamtdurchmesser der Partikel klein genug bleibt, um ihre Extravasation durch Kapillarfenestrae oder über interendotheliale Zwischenräume zu ermöglichen, was eine Voraussetzung für das Funktionieren derartiger Ansätze in vivo ist. Zum anderen können die Partikel durch ihre starke signalbeeinflussende Wirkung MR-tomographisch noch in geringen Konzentrationen nachgewiesen werden. Hieraus haben sich Ansätze zur Rezeptor- und Antikörpervermittelten Kontrastierung verschiedenen Zielgewebes sowie zur Markierung von Zellen zur in-vivo Darstellung der Zellmigration entwickelt. Ein generelles Problem dieser Ansätze besteht in der Anreicherung der Partikel in Leber und Milz durch unspezifische Phagozytose von RES-Zellen Rezeptor-vermittelte Kontrastierung Die Bindung eines Antigens an bestimmte Rezeptoren auf der Zelloberfläche führt zur Internalisierung dieses Komplexes in das Zellinnere, das Antigen wird hier freigesetzt, der Rezeptor erscheint erneut auf der Zelloberfläche. Es konnte experimentell beispielhaft gezeigt werden, dass die Kopplung von USPIO oder MION an ein Antigen zu einer intrazellulären Anreicherung der Partikel über eine solche Rezeptor-vermittelte Endozytose führen kann. USPIO, die mit Arabinogalactan oder Asialofetuin beschichtet sind, werden durch Asialoglykoproteinrezeptoren auf Hepatozyten gebunden und internalisiert. Es kommt daher zu einer Anreicherung der Partikel in der Leber nicht durch die unspezifische Phagozytose der Kupffer-Zellen, sondern durch die Rezeptor-vermittelte Aufnahme der Partikel in Hepatozyten (197, 264). Experimentell konnte weitergehend gezeigt werden, dass mit diesem Ansatz nicht nur Lebermetastasen verbessert MRtomographisch dargestellt werden, sondern auch lebereigene von sekundären
16 20 Lebertumoren differenziert werden können (175, 177). Des Weiteren zeigen experimentelle Daten, dass auf diesem Weg eine diffuse Leberschädigung oder eine Regeneration des Lebergewebes festgestellt werden kann (125). Pankreasgewebe konnte experimentell mit Cholecystokinin-beschichteten USPIO kontrastiert werden, wodurch sich Pankreastumore verbessert abgrenzen ließen (178). Zahlreiche Tumoren weisen auf ihren Zelloberflächen eine hohe Dichte an Transferrin-Rezeptoren auf. Daher reichern diese Tumoren Transferrin-beschichtete USPIO nach intravenöser Injektion an. Hieraus ergibt sich ein Ansatz zur verbesserten MR-tomographischen Diagnostik solcher Tumoren (114). Apoptotische Zellen lassen sich mit Konjugaten aus CLIO und Annexin V oder Synaptotagmin I markieren (198, 275). Aus diesen Ansätzen könnten sich Methoden zum Beispiel zur verbesserten Kontrolle einer Tumortherapie entwickeln Antikörper-vermittelte Kontrastierung Konjugate aus SPIO und Antikörpern werden seit langem zum in-vitro Nachweis von Bestandteilen von Blut oder Serum verwendet. Für etliche SPIO-Antikörper Kombinationen konnte experimentell eine prinzipielle Eignung zur spezifischen Kontrastierung pathologischer Gewebeveränderungen nachgewiesen werden (41, 180). Mit einem Komplex aus MION und polyklonalem IgG konnten Weissleder und Mitarbeiter entzündliche Muskelareale in einem Modell für Myositis MR-tomographisch darstellen. Allerdings wurde ein großer Anteil des Kontrastmittels auch unspezifisch in Leber und Milz aufgenommen (261). Weitere ähnliche Ansätze sind die Markierung eines Myokardinfarktes mit einem Konjugat aus MION und Antimyosin Fab (262) oder der Nachweis einer E-Selectin Expression mit einem Konjugat aus CLIO und Anti E-Selectin Fragmenten mit der Perspektive, Angiogenese oder Atherosklerose zu detektieren (99). Eine tumorspezifische Diagnose könnte aus der Kopplung von USPIO und Antikörpern gegen Carcinoembryonales Antigen (237), gegen Gliomzell-Oberflächenantigen (224) oder gegen Rezeptoren für epidermalen Wachstumsfaktor (223) resultieren. Die lokale Konzentration von SPIO-Antikörper Konjugaten hängt einerseits von seiner Gewebekonzentration und damit der applizierten Dosis und andererseits von der Dichte des entsprechenden Antigens im Zielgewebe ab. Da mit diesem Ansatz keine aktive Akkumulation verbunden ist, sind für einen im MR-Bild sichtbaren Effekt relativ hohe Dosen des Kontrastmittels notwendig (200 µmol Fe/kg und mehr) Magnetische Zellmarkierung In den letzten Jahren haben Entwicklungen in der Stammzelltherapie einen Bedarf an Techniken zur Kontrolle des Verbleibs der implantierten Zellen geweckt. Zu diesem so genannten in vivo Monitoring der Zellmigration sind SPIO besonders geeignet, da sie
17 21 durch Inkubation in der entsprechenden Zellkultur intrazellulär über spezifische oder unspezifische Mechanismen angereichert werden (65, 209, 257). Nach Implantation der Zellen in das Zielgewebe kann dann die MR-tomographische Kontrolle des Verbleibs dieser Zellen erfolgen. Magnetisch markierte neurale Progenitorzellen konnten in vivo bis zu sechs Wochen nach Implantation nachgewiesen werden (34, 35, 68, 126). Mit ähnlichen Ansätzen können auch Entzündungszellen wie z.b. T-Zellen oder Neutrophile Granulozyten ex vivo mit USPIO oder MION markiert werden. Nach ihrer Injektion reichern sich diese Zellen an Entzündungsherden an (42, 115, 272, 273). Hieraus ergibt sich eine Möglichkeit des MR-tomographischen Entzündungsnachweises. 2.6 Magen-Darm Kontrastierung Im Gegensatz zu den vorgenannten Präparationen von SPIO, die mit bioabbaubaren Materialien umhüllt sind, besitzen SPIO zur Kontrastierung des Magen-Darm-Traktes eine nicht abbaubare Umhüllung (131). Dies soll eine Resorption von Bestandteilen der Kontrastmittel verhindern. Zusätzlich sind diese oralen Präparationen mit Quellstoffen (z.b. Stärke oder Cellulose) versetzt, die eine gleichmäßige Verteilung der Partikel gewährleisten sollen. Hiermit wird verhindert, dass es zu lokalen Konzentrationen der Partikel und damit zu Suszeptibilitätsartefakten kommt (30). Es sind derzeit zwei Substanzen für die klinische Anwendung zugelassen (Abdoscan, Fa. Amersham und Lumirem, Fa. Guerbet). Die Partikel haben im Vergleich zu Substanzen zur intravenösen Anwendung größere Durchmesser (ca. 3,5 µm bzw. 300 nm) und führen vorwiegend zu einer T 2 -Verkürzung und damit zu einem Signalverlust im Lumen des Magen-Darm Traktes. Der diagnostische Nutzen besteht einerseits in einer Verminderung von Bewegungsartefakten von Inhalt des Magen-Darm Traktes durch Peristaltik und damit verbesserter Darstellung von Umgebungsstrukturen, z.b. retro- oder intraperitonealer Raumforderungen bzw. von Pankreasveränderungen, andererseits zu einer verbesserten Abgrenzbarkeit der Darmwand selbst. Hier hat sich die Beurteilung von entzündlichen Darmveränderungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) als wichtige Indikation erwiesen (50). 2.7 SPIO in der Therapie: Drug Carrier, Hyperthermie SPIO als Drug Carrier, Gentherapie Mit dem Ziel, Medikamente, insbesondere Zytostatika in der Tumortherapie, nach intravenöser oder intraarterieller Injektion in das Zielgewebe zu bringen, sind verschiedene so genannte Drug Carrier erprobt worden. Hierbei ist vor allem die liposomale Verkapselung von Doxorubicin experimentell und klinisch eingesetzt worden.
18 22 SPIO eignen sich theoretisch ebenfalls als Träger für Medikamente, die auf der Oberfläche der Partikel gebunden werden. Techniken, um die Partikel in das Zielgewebe zu bringen, umfassen die Akkumulation mit einem entsprechend platzierten, starken Magnetfeld, die transarterielle Embolisation der versorgenden Arterien oder auch die zusätzliche Beschichtung mit spezifisch in dem Zielgewebe bindenden Molekülen, z.b. mit entsprechenden Antikörpern (105, 161). Allerdings sind die Erfahrungen mit SPIO als Drug Carrier noch begrenzt. In diesem Zusammenhang sind experimentelle Ansätze interessant, SPIO gleichzeitig als Träger sowie auch als Marker für die Kontrolle einer Gentherapie einzusetzen (263). Bei der so genannten Magnetotransfektion werden Nukleotide an SPIO gebunden und diese Konstrukte mit einem Magnetfeld in das Zielgewebe dirigiert. Der Erfolg dieser Einbringung kann anschließend MR-tomographisch kontrolliert werden (199) SPIO in der Hyperthermie In der Tumortherapie ist der Effekt einer Hyperthermie seit langem bekannt (8). Eine lokalisierte Hyperthermie in einem externen elektromagnetischen Wechselfeld kann durch SPIO vermittelt werden. Nach Einbringung von SPIO in das Zielgewebe entweder über eine direkte perkutane Injektion oder über eine transarterielle Embolisation führt ein externes magnetisches Wechselfeld zu einer Erwärmung dieser Partikel und damit des Tumors mit Therapieeffekt (96, 97, 147, 193). Als Mechanismen für diese Erwärmung wird für superparamagnetische Partikel mit Größen unter ca. 100 nm die kinetische Erwärmung angeführt. Größere, ferromagnetische Partikel können ebenfalls zur Vermittlung einer Hyperthermie angewendet werden, hier führt die hysteretische Erwärmung zu dem gewünschten Effekt. Interessant erscheint hier das experimentelle Ergebnis, dass die Einbringung der Partikel über eine transarterielle Embolisation im Vergleich zur direkten perkutanen Injektion bei einer vergleichbaren intratumoralen Temperatursteigerung auf ca. 48 C zu einem deutlich besseren Therapieeffekt bis hin zur vollständigen Tumorremission führt (146). 2.8 Aufbau, Herstellung, physikalische Eigenschaften magnetischer Eisenoxid-Partikel Aufbau magnetischer Eisenoxid-Partikel Eisen existiert in der Natur hauptsächlich in Form von Verbindungen, z.b. als Eisenoxid (Magnetit). Heute werden Magnetite mit verschiedenen Herstellungsverfahren für zahlreiche technische (z.b. Datenträger) und medizinische Anwendungen (z.b. MR- Kontrastmittel) entwickelt (Abbildung 2.1). Metallisches Eisen findet sich nur im Erdinnern
19 23 und in Meteoriten. Neben der geologischen Verbreitung von Magnetiten gibt es auch physiologische Vorkommen z. B. in Pflanzen (138) und in niederen Tieren ( magnetotaktische Bakterien), aber auch in Säugern (Walfisch). Magnetische Eisenoxide sind auch im menschlichen Gehirn entdeckt worden (106). Die magnetischen Eigenschaften der Eisenoxide werden durch die Kristallstruktur festgelegt. Das Eisen-IIIoxid Fe 2 O 3 (Ferrioxid, Roteisenstein) tritt in verschiedenen rotbraunen Modifikationen auf: Das Alpha-Fe 2 O 3 (Hämatit, Rost ), die häufigste Form, ist paramagnetisch und kristallisiert in Rhomboedern ( hexagonal dichteste Packung des Sauerstoffes ). Das Gamma-Fe 2 O 3, kristallisiert kubisch ( kubisch dichteste Packung des Sauerstoffs ) und entsteht bei vorsichtiger Oxidation von nanopartikulärem Fe 3 O 4 unter 270 Grad Celsius. Das braunschwarze Eisen-II,III-oxid Fe 2+ (Fe 3+ ) 2 O 4 (Ferroferrioxid, Magnetit) ist auf nanopartikulärer Ebene das unbeständigste Eisenoxid (Abbildung 2.2). In Anwesenheit von Sauerstoff oxidiert es bereits bei Raumtemperatur zu Maghämit und bei hohen Temperaturen über 270 Grad Celsius zu dem stabilen Hämatit. Hieraus ergibt sich der Name Maghämit, welcher aus Magnetit und Hämatit zusammengesetzt wurde. Die Bezeichnung Magnetit geht wahrscheinlich auf den ersten Fundort nahe der kleinasiatischen Stadt Magnesia (Makedonien) zurück (Magnetis lithos = Stein aus Magnesia). Der Name Hämatit entstammt von dem griechischen Wort hämateios, welches blutig bedeutet. Ebenfalls auf die rote Farbe des Minerals spielt die deutsche Bezeichnung Roteisenstein an. A B Abbildung 2.1: (A) Natürlicher Magnetitkristall in oktaedrischer Form (aus (167)) (B) Synthetische nanopartikuläre Magnetitkristalle in einer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme (aus (85))
20 24 Fe2+ Fe3+ Sauerstoff Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Kristallgitters des Magnetit (nach (217)) Bei den magnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln, die Anwendung als Kontrastmittel in der MR-Tomographie finden, handelt es sich um ein Magnetit-Maghämit-Gemisch in der Regel mit einem Anteil von zweiwertigen Eisenionen unter 6% vom Gesamteisenanteil. Generell unterscheidet sich das Kristallgitter von Magnetit und Maghämit nicht. Die Sauerstoff-Ionen liegen in dichtester kubischer Kugelpackung vor, während die Eisen(II)- und Eisen(III)-Ionen genau festgelegte Plätze in oktaedrischen bzw. tetraedrischen Lücken dieser Packung einnehmen. In dem reinen Magnetit besetzen die Eisenionen die Hälfte der vorhandenen Oktaederlücken und die Hälfte der vorhandenen Tetraederlücken. Die Aufteilung der zwei- und dreiwertigen Eisenionen erfolgt entsprechend einem inversen Spinell, das heißt, eine Hälfte der dreiwertigen Eisenionen besetzt die Tetraederlücken und die andere Hälfte, zusammen mit den zweiwertigen Ionen besetzt die Oktaederlücken. Der Maghämit leitet sich von dieser Struktur ab, mit dem Unterschied, dass nur dreiwertiges Eisen existiert und zum Ladungsausgleich Leerstellen auf den Oktaederplätzen entstehen. Die Eisenleerstellen können sich je nach Darstellungsbedingungen auf zwei verschiedene Weisen anordnen. Einerseits erfolgt eine statistische Leerstellenverteilung, wobei die kubische Raumgruppe erhalten bleibt, oder andererseits führt eine regelmäßige Anordnung der Leerstellen dazu, dass die Elementarzelle in eine Raumrichtung verdreifacht werden muss, um den Maghämit zu beschreiben. Es entsteht somit eine tetragonale Struktur. Diese Anordnung bewirkt, dass der Elektronentransfer zwischen den Eisen-Ionen nur in bestimmten Richtungen abläuft. Aus dieser vektoriellen Stromrichtung resultieren gerichtete magnetische Felder, die zum magnetischen Verhalten des Magnetits und Maghämits führen.
21 Physikalische Eigenschaften magnetischer Eisenoxid-Partikel Bei makroskopischer Betrachtung sind Magnetit und Maghämit ferrimagnetisch. Der Ferrimagnetismus entspricht im Prinzip dem Ferromagnetismus. Dies bedeutet, dass bei Anlegen eines äußeren Magnetfeldes eine Magnetisierung stattfindet, die nach Abschalten im Sinne der magnetischen Remanenz erhalten bleibt. Aufgrund dieser Eigenschaften findet das Maghämit Anwendung bei elektronischen Datenspeichern, da die Magnetisierung nach Abschalten des äußeren Magnetfeldes bestehen bleibt und die Information speichert. Dem Maghämit wird dabei aufgrund der höheren chemischen Stabilität gegenüber dem Magnetit der Vorzug gegeben, da das Maghämit erst bei Temperaturen über 200 C zu dem Hämatit oxidiert. Beim Ferromagnetismus ist die Magnetisierung nur parallel zum äußeren Magnetfeld ausgerichtet. Beim Ferrimagnetismus kommt es aufgrund der unterschiedlichen Platzierung der dreiwertigen Eisenionen auf Oktaeder- bzw. Tetraederplätze im Magnetit und Maghämit zu einer parallelen und gleichzeitig antiparallelen Magnetisierung, welche die parallele Magnetisierung abschwächt. Ferrimagneten weisen daher eine schwächere Nettomagnetisierung auf als Ferromagneten. Anhand der Abbildung erkennt man zudem, dass beim Übergang des Magnetit zum Maghämit mit Abnahme der Eisenionen der Oktaederplätze (Kristallebene B) die Magnetisierung in paralleler Richtung abnimmt. Für das Maghämit ist daher die makroskopisch messbare Sättigungsmagnetisierung geringer als für das Magnetit. Abbildung 2.3: Ferrimagnetische Eigenschaft des Magnetit mit paralleler und antiparallel gerichteter Magnetisierung in Abhängigkeit der Ebene des Kristallgitters (A) mit dreiwertigen Eisenionen in den Tetraederlücken und (B) den zwei- und dreiwertigen Eisenionen in den Oktaederlücken. Da beim Maghämit die Anzahl der Eisenionen in den Oktaederlücken abnimmt, wird die Magnetisierung in die parallele Richtung geringer. Dadurch wird die Nettomagnetisierung geringer. Aus (37)
6 Zusammenfassung 6.1 Einleitung und Problemstellung
 159 6 Zusammenfassung 6.1 Einleitung und Problemstellung In der klinischen Magnetresonanz (MR)-Tomographie werden für zahlreiche diagnostische Fragestellungen i.v. zu injizierende Kontrastmittel eingesetzt.
159 6 Zusammenfassung 6.1 Einleitung und Problemstellung In der klinischen Magnetresonanz (MR)-Tomographie werden für zahlreiche diagnostische Fragestellungen i.v. zu injizierende Kontrastmittel eingesetzt.
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen. H. Diepolder
 Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Grundlagen. Lymphknotendiagnostik. (mit neuen Kontrastmittel) Level Klassifikation (AJCC) Level Klassifikation (AJCC) Anatomie Lymphknoten
 Lymphknotendiagnostik (mit neuen Kontrastmittel) Martin G. Mack Martin G. Mack Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie J.W. Goethe-Universität, Frankfurt Grundlagen Rationale Differenzierung
Lymphknotendiagnostik (mit neuen Kontrastmittel) Martin G. Mack Martin G. Mack Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie J.W. Goethe-Universität, Frankfurt Grundlagen Rationale Differenzierung
4.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC)
 4.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC) Hepatozelluläre Karzinome (HCC) sind die häufigsten primären Lebertumoren und machen etwa 85 % der primären Lebermalignome aus. In Europa tritt das HCC zumeist bei Patienten
4.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC) Hepatozelluläre Karzinome (HCC) sind die häufigsten primären Lebertumoren und machen etwa 85 % der primären Lebermalignome aus. In Europa tritt das HCC zumeist bei Patienten
MRT der Leber. Dirk Blondin Ltd. OA Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
 MRT der Leber Dirk Blondin Ltd. OA Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 1) Sequenzen 2) Kontrastmittel 3) gutartige Leberläsionen Zyste, Hämangiom, Adenom, Fokal noduläre Hyperplasie
MRT der Leber Dirk Blondin Ltd. OA Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 1) Sequenzen 2) Kontrastmittel 3) gutartige Leberläsionen Zyste, Hämangiom, Adenom, Fokal noduläre Hyperplasie
Bis vor einigen Jahren basierte die lokale Bildgebung der Prostata auf dem transrektalen Schall.
 Bis vor einigen Jahren basierte die lokale Bildgebung der Prostata auf dem transrektalen Schall. Heute sind neue ultraschallgestützte sowie CT und MRT-gestützte Bildgebungsverfahren verfügbar. Diese werden
Bis vor einigen Jahren basierte die lokale Bildgebung der Prostata auf dem transrektalen Schall. Heute sind neue ultraschallgestützte sowie CT und MRT-gestützte Bildgebungsverfahren verfügbar. Diese werden
MRT (und PET/CT) Onkologie Was kommt zuerst was kann man sparen? Institut für Röntgendiagnostik Technische Universität München
 MRT (und PET/CT) Onkologie Was kommt zuerst was kann man sparen? Leber und Pankreasdiagnostik Prof Dr Ernst J Rummeny Prof. Dr. Ernst J. Rummeny Institut für Röntgendiagnostik Technische Universität München
MRT (und PET/CT) Onkologie Was kommt zuerst was kann man sparen? Leber und Pankreasdiagnostik Prof Dr Ernst J Rummeny Prof. Dr. Ernst J. Rummeny Institut für Röntgendiagnostik Technische Universität München
MRT Diagnostik der Leber
 MRT Diagnostik der Leber Klaus Drechsler Gutartige Lebertumore Hämangiome (Blutschwämmchen) Gutartige Lebertumore Hämangiome (Blutschwämmchen) Fokal-noduläre Hyperplasien (FNH) Gutartige Lebertumore
MRT Diagnostik der Leber Klaus Drechsler Gutartige Lebertumore Hämangiome (Blutschwämmchen) Gutartige Lebertumore Hämangiome (Blutschwämmchen) Fokal-noduläre Hyperplasien (FNH) Gutartige Lebertumore
4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark
 4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über das Signalverhalten von Leber, Milz und Knochenmark geben. Die Organe wurden zusammen
4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über das Signalverhalten von Leber, Milz und Knochenmark geben. Die Organe wurden zusammen
Magnetische Pigmente. Jonas Berg & Michael Luksin
 Magnetische Pigmente Jonas Berg & Michael Luksin Inhaltsverzeichnis Pigmente Magnetismus Was für Magnetismen gibt es? Welche Bedingungen müssen magnetische Pigmente erfüllen? Magnetische Pigmente Magnetit
Magnetische Pigmente Jonas Berg & Michael Luksin Inhaltsverzeichnis Pigmente Magnetismus Was für Magnetismen gibt es? Welche Bedingungen müssen magnetische Pigmente erfüllen? Magnetische Pigmente Magnetit
Entzündung. Teil 18.
 Teil 18 www.patho.vetmed.uni-muenchen.de/matnew.html Proliferative Entzündungen: Granulomatöse Entzündung Unterschiede granulierende - granulomatöse Entzündung Mononukleäres Phagozyten System (MPS) Dendritische
Teil 18 www.patho.vetmed.uni-muenchen.de/matnew.html Proliferative Entzündungen: Granulomatöse Entzündung Unterschiede granulierende - granulomatöse Entzündung Mononukleäres Phagozyten System (MPS) Dendritische
Ultraschall Abdomen Niere Leber 36
 MR 32 Ultraschall Abdomensonographie Schilddrüsenuntersuchung Echokardiographie (Herzultraschall) Gefäßultraschall Untersuchung in der Schwangerschaft Vorteile: Schnell Bewegte Bilder Relativ kostengünstig
MR 32 Ultraschall Abdomensonographie Schilddrüsenuntersuchung Echokardiographie (Herzultraschall) Gefäßultraschall Untersuchung in der Schwangerschaft Vorteile: Schnell Bewegte Bilder Relativ kostengünstig
Lokale Bildgebung der Prostata
 Lokale Bildgebung der Prostata Lokale Bildgebung der Prostata Bis vor einigen Jahren basierte die lokale Bildgebung der Prostata auf dem transrektalen Schall. Heute sind neue ultraschallgestützte sowie
Lokale Bildgebung der Prostata Lokale Bildgebung der Prostata Bis vor einigen Jahren basierte die lokale Bildgebung der Prostata auf dem transrektalen Schall. Heute sind neue ultraschallgestützte sowie
Ferrofluide. Physikalische Grundlagen. http://en.wikipedia.org/wiki/file:ferrofluid_close.jpg
 Ferrofluide Physikalische Grundlagen http://en.wikipedia.org/wiki/file:ferrofluid_close.jpg Inhalt Definition Herstellung Maßnahmen zur Stabilisierung Abschätzung der Partikelgröße, Abstandsmechanismen
Ferrofluide Physikalische Grundlagen http://en.wikipedia.org/wiki/file:ferrofluid_close.jpg Inhalt Definition Herstellung Maßnahmen zur Stabilisierung Abschätzung der Partikelgröße, Abstandsmechanismen
4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen
 Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Gastrointestinale Blutungen Bildgebung Peter Heiss
 Institut für Röntgendiagnostik Gastrointestinale Blutungen Bildgebung Peter Heiss 2 Gastrointestinale Blutungen: Bildgebung Indikationen für die Bildgebung (Angiographie, CT, MRT): 1) Major-Blutung oder
Institut für Röntgendiagnostik Gastrointestinale Blutungen Bildgebung Peter Heiss 2 Gastrointestinale Blutungen: Bildgebung Indikationen für die Bildgebung (Angiographie, CT, MRT): 1) Major-Blutung oder
Sichere Diagnostik. Kernspintomographie Eine erfolgreiche Diagnostik und Behandlung für Ihr Tier
 Sichere Diagnostik Kernspintomographie Eine erfolgreiche Diagnostik und Behandlung für Ihr Tier Die Kernspintomographie... und die Ergebnisse Kernspintomographie - Was ist das? Ohne den Einsatz von Röntgenstrahlen
Sichere Diagnostik Kernspintomographie Eine erfolgreiche Diagnostik und Behandlung für Ihr Tier Die Kernspintomographie... und die Ergebnisse Kernspintomographie - Was ist das? Ohne den Einsatz von Röntgenstrahlen
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER
 NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
Antikörpertherapie beim Mammakarzinom
 Antikörpertherapie beim Mammakarzinom (Dr. S. Rückert) Trastuzumab (Herceptin ) ist ein gentechnisch hergestellter Antikörper, welcher gegen das HER2/neu-Protein gerichtet ist. Dieser Wachstumsfaktor kommt
Antikörpertherapie beim Mammakarzinom (Dr. S. Rückert) Trastuzumab (Herceptin ) ist ein gentechnisch hergestellter Antikörper, welcher gegen das HER2/neu-Protein gerichtet ist. Dieser Wachstumsfaktor kommt
Haben Sie externe Hilfestellungen in Anspruch genommen? Wenn ja, bitte geben Sie an, welche Hilfestellung Sie in Anspruch genommen haben?
 Haben Sie externe Hilfestellungen in Anspruch genommen? Wenn ja, bitte geben Sie an, welche Hilfestellung Sie in Anspruch genommen haben? 1.1 Angefragte Untersuchungs- und Behandlungsmethode (Kurzbezeichnung
Haben Sie externe Hilfestellungen in Anspruch genommen? Wenn ja, bitte geben Sie an, welche Hilfestellung Sie in Anspruch genommen haben? 1.1 Angefragte Untersuchungs- und Behandlungsmethode (Kurzbezeichnung
Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen.
 Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
1 Leber. 3 Pankreas. Inhaltsverzeichnis
 X 1 Leber Fokale Leberläsionen... 1 M. Taupitz und B. Hamm Einleitung... 1 Indikationen... 1 Untersuchungstechnik... 1 Bildgebung der normalen Anatomie... 11 Bildgebung pathologischer Befunde... 12 Anwendung
X 1 Leber Fokale Leberläsionen... 1 M. Taupitz und B. Hamm Einleitung... 1 Indikationen... 1 Untersuchungstechnik... 1 Bildgebung der normalen Anatomie... 11 Bildgebung pathologischer Befunde... 12 Anwendung
Aspekte der Eisenresorption. PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse Binningen
 Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Lymphknotenzytologie t bei benignen Erkrankungen. Klinische Zytologie in der Pneumologie Grundlagenkurs Teil II Bernhard Opitz
 Lymphknotenzytologie t bei benignen Erkrankungen Klinische Zytologie in der Pneumologie Grundlagenkurs Teil II 31.05. Bernhard Opitz Lymphknotenzytologie tologie Simple Methode Wenig Traumatisch (fast)
Lymphknotenzytologie t bei benignen Erkrankungen Klinische Zytologie in der Pneumologie Grundlagenkurs Teil II 31.05. Bernhard Opitz Lymphknotenzytologie tologie Simple Methode Wenig Traumatisch (fast)
Immundefizienz-Virus bei Mensch bzw. Katze. - der Infektion mit einem Immundefizienz-Virus (HIV, SIV, FIV, BIF) und
 HIV- SIV FIV Allgemeines (1): - es muß unterschieden werden zwischen - der Infektion mit einem Immundefizienz-Virus (HIV, SIV, FIV, BIF) und - der Ausbildung eines manifesten Krankheits- Syndroms, das
HIV- SIV FIV Allgemeines (1): - es muß unterschieden werden zwischen - der Infektion mit einem Immundefizienz-Virus (HIV, SIV, FIV, BIF) und - der Ausbildung eines manifesten Krankheits- Syndroms, das
Leberläsionen. Allgemeines zu Leberveränderungen
 Leberläsionen Antonia Wiggermann Julian Hägele Michael Beldoch Peter Bischoff Peter Hunold Allgemeines zu Leberveränderungen diffuse Parenchymveränderungen (Steatose, Zirrhose, Speicherkrankheiten) vs.
Leberläsionen Antonia Wiggermann Julian Hägele Michael Beldoch Peter Bischoff Peter Hunold Allgemeines zu Leberveränderungen diffuse Parenchymveränderungen (Steatose, Zirrhose, Speicherkrankheiten) vs.
Magnetische Nanopartikel
 radiologie forschung MATTHIAS TAUPITZ / BERND HAMM Magnetische Nanopartikel Klinische Forschergruppe 213 Die KFO 213»Magnetische Eisenoxid-Nanopartikel für die Zelluläre und Molekulare MR-Bildgebung«ist
radiologie forschung MATTHIAS TAUPITZ / BERND HAMM Magnetische Nanopartikel Klinische Forschergruppe 213 Die KFO 213»Magnetische Eisenoxid-Nanopartikel für die Zelluläre und Molekulare MR-Bildgebung«ist
SPECT/CT. Terminvergabe: (030) Funktionsweise Anwendung. Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ)
 Terminvergabe: (030) 293697300 SPECT/CT Funktionsweise Anwendung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) Nuklearmedizin Radiologie Strahlentherapie ALLGEMEIN Das DTZ Das DTZ Berlin
Terminvergabe: (030) 293697300 SPECT/CT Funktionsweise Anwendung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) Nuklearmedizin Radiologie Strahlentherapie ALLGEMEIN Das DTZ Das DTZ Berlin
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome
 3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
MRT Klinische Anwendungen
 MRT Klinische Anwendungen PD Dr. Florian Vogt 15.06.2011 Vorlesung Radiologie / Nuklearmedizin MRT im Allgemeinen Spulen (engl. Coils) für jede Region Hohe Aussagekraft Oft letzte Instanz der nicht invasiven
MRT Klinische Anwendungen PD Dr. Florian Vogt 15.06.2011 Vorlesung Radiologie / Nuklearmedizin MRT im Allgemeinen Spulen (engl. Coils) für jede Region Hohe Aussagekraft Oft letzte Instanz der nicht invasiven
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde an der Charité - Universitätsmedizin Berlin
 Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Aus der Medizinischen Klinik III Direktor: Prof. Dr. med. Eckhard Thiel Unterschiede in der T-Zell-Immunität gegen die Tumorantigene EpCAM,
Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Aus der Medizinischen Klinik III Direktor: Prof. Dr. med. Eckhard Thiel Unterschiede in der T-Zell-Immunität gegen die Tumorantigene EpCAM,
MRT Prostata (3 Tesla) Sicher und angenehm ohne Endorektalspule. Früherkennung Lokalisation Verlaufskontrolle
 MRT Prostata (3 Tesla) Sicher und angenehm ohne Endorektalspule Früherkennung Lokalisation Verlaufskontrolle Klinikum St. Georg > Allgemein Im Klinikum St. Georg ggmbh wurden seit 2008 über 250 diagnostische
MRT Prostata (3 Tesla) Sicher und angenehm ohne Endorektalspule Früherkennung Lokalisation Verlaufskontrolle Klinikum St. Georg > Allgemein Im Klinikum St. Georg ggmbh wurden seit 2008 über 250 diagnostische
Institute for Immunology and Thymus Research Laboratory for Autologous Adult Stem Cell Research and Therapy
 Institute for Immunology and Thymus Research Laboratory for Autologous Adult Stem Cell Research and Therapy Rudolf-Huch-Str. 14 D- 38667 Bad Harzburg Tel: +49 (0)5322 96 05 14 Fax: +49 (0)5322 96 05 16
Institute for Immunology and Thymus Research Laboratory for Autologous Adult Stem Cell Research and Therapy Rudolf-Huch-Str. 14 D- 38667 Bad Harzburg Tel: +49 (0)5322 96 05 14 Fax: +49 (0)5322 96 05 16
Chemie der Metalle (Nachklausur)
 Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte (je 10) Ich bin damit einverstanden, dass mein Klausurergebnis unter Angabe der Matrikelnummer im Web bekanntgegeben wird: Abschlußklausur zur Vorlesung Chemie der Metalle
Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte (je 10) Ich bin damit einverstanden, dass mein Klausurergebnis unter Angabe der Matrikelnummer im Web bekanntgegeben wird: Abschlußklausur zur Vorlesung Chemie der Metalle
Magnetisches Feld. Grunderscheinungen Magnetismus - Dauermagnete
 Magnetisches Feld Grunderscheinungen Magnetismus - Dauermagnete jeder drehbar gelagerte Magnet richtet sich in Nord-Süd-Richtung aus; Pol nach Norden heißt Nordpol jeder Magnet hat Nord- und Südpol; untrennbar
Magnetisches Feld Grunderscheinungen Magnetismus - Dauermagnete jeder drehbar gelagerte Magnet richtet sich in Nord-Süd-Richtung aus; Pol nach Norden heißt Nordpol jeder Magnet hat Nord- und Südpol; untrennbar
Immunbiologie. Teil 3
 Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Renate M. Hammerstingl, Dominik Faust. Renate M. Hammerstingl, Dominik Faust
 Leberdiagnostik Klinischer Hintergrund und Übersicht über die bildgebenden Methoden Renate M. Hammerstingl, Dominik Faust Renate M. Hammerstingl, Dominik Faust Vorlesung - Lebererkrankungen Johann Wolfgang
Leberdiagnostik Klinischer Hintergrund und Übersicht über die bildgebenden Methoden Renate M. Hammerstingl, Dominik Faust Renate M. Hammerstingl, Dominik Faust Vorlesung - Lebererkrankungen Johann Wolfgang
Nicht-invasives Monitoring molekularer Therapien in der Onkologie: Bench-to-Bedside Etablierung von Biomarkern in der Therapieresponse (PM7)
 Nicht-invasives Monitoring molekularer Therapien in der Onkologie: Bench-to-Bedside Etablierung von Biomarkern in der Therapieresponse (PM7) Dr. biol. hum. Heidrun Hirner Institut für Klinische Radiologie
Nicht-invasives Monitoring molekularer Therapien in der Onkologie: Bench-to-Bedside Etablierung von Biomarkern in der Therapieresponse (PM7) Dr. biol. hum. Heidrun Hirner Institut für Klinische Radiologie
Konventionelle nuklearmedizinische Diagnostik
 GE Healthcare Konventionelle nuklearmedizinische Diagnostik Fokus: SPECT und SPECT/CT Patienteninformation 2 Was ist die Nuklearmedizin? Die Nuklearmedizin nutzt Spürsubstanzen (sogenannte Tracer ), um
GE Healthcare Konventionelle nuklearmedizinische Diagnostik Fokus: SPECT und SPECT/CT Patienteninformation 2 Was ist die Nuklearmedizin? Die Nuklearmedizin nutzt Spürsubstanzen (sogenannte Tracer ), um
Mammographie. Terminvergabe: (030) Funktionsweise Anwendung. Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ)
 Terminvergabe: (030) 293697300 Mammographie Funktionsweise Anwendung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) Nuklearmedizin Radiologie Strahlentherapie ALLGEMEIN Das DTZ Das DTZ Berlin
Terminvergabe: (030) 293697300 Mammographie Funktionsweise Anwendung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) Nuklearmedizin Radiologie Strahlentherapie ALLGEMEIN Das DTZ Das DTZ Berlin
Schlaganfalldiagnostik
 Schlaganfalldiagnostik Michael Kirsch Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Schlaganfall Definition Als Schlaganfall bezeichnet man die Folge
Schlaganfalldiagnostik Michael Kirsch Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Schlaganfall Definition Als Schlaganfall bezeichnet man die Folge
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93
 3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
07. März Atherosklerose durch oxidativen Stress?
 07. März 2012 Atherosklerose durch oxidativen Stress? Dr. rer. nat. Katrin Huesker Atherosklerose durch oxidativen Stress? Pathogenese Diagnostik Therapie www.nlm.nih.gov/medlineplus Atherosklerose durch
07. März 2012 Atherosklerose durch oxidativen Stress? Dr. rer. nat. Katrin Huesker Atherosklerose durch oxidativen Stress? Pathogenese Diagnostik Therapie www.nlm.nih.gov/medlineplus Atherosklerose durch
Spezielle Pathologie des Atmungstraktes. 13. Teil
 Spezielle Pathologie des Atmungstraktes 13. Teil 7. Staublungen-Erkrankungen Pneumokoniosen Anthrakose Allgemeines (1): - Partikel bleiben je nach ihrer Größe im Atmungstrakt hängen - Nasenhöhle > 5 μm
Spezielle Pathologie des Atmungstraktes 13. Teil 7. Staublungen-Erkrankungen Pneumokoniosen Anthrakose Allgemeines (1): - Partikel bleiben je nach ihrer Größe im Atmungstrakt hängen - Nasenhöhle > 5 μm
Immunbiologie. Teil 6
 Teil 6 Lymphatische Organe - Übersicht (1) - zusätzlich zu der Einteilung primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - kann man zwei Gruppen unterscheiden: 1. Strukturen, die embryonal angelegt
Teil 6 Lymphatische Organe - Übersicht (1) - zusätzlich zu der Einteilung primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - kann man zwei Gruppen unterscheiden: 1. Strukturen, die embryonal angelegt
Darum liegt in mehr als der Hälfte der Fälle bereits bei Diagnosestellung ein fortgeschritteneres Stadium der Erkrankung vor.
 OVARIALKARZINOM EPIDEMIOLOGIE Das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) stellt die häufigste Todesursache durch ein Malignom bei der Frau dar. In Österreich erkranken jährlich rund 936 Frauen an einem Eierstockkrebs.
OVARIALKARZINOM EPIDEMIOLOGIE Das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) stellt die häufigste Todesursache durch ein Malignom bei der Frau dar. In Österreich erkranken jährlich rund 936 Frauen an einem Eierstockkrebs.
Bildgebung beim Multiplen Myelom - MRT/ CT/ Röntgen Dr. Jens Hillengaß
 Bildgebung beim Multiplen Myelom - MRT/ CT/ Röntgen Dr. Jens Hillengaß Sektion Multiples Myelom Medizinische Universitätsklinik Heidelberg und Abteilung E010 Radiologie Deutsches Krebsforschungszentrum
Bildgebung beim Multiplen Myelom - MRT/ CT/ Röntgen Dr. Jens Hillengaß Sektion Multiples Myelom Medizinische Universitätsklinik Heidelberg und Abteilung E010 Radiologie Deutsches Krebsforschungszentrum
07. März Atherosklerose durch oxidativen Stress?
 07. März 2012 Atherosklerose durch oxidativen Stress? Dr. rer. nat. Katrin Huesker Atherosklerose durch oxidativen Stress? Pathogenese Diagnostik Therapie www.nlm.nih.gov/medlineplus Atherosklerose durch
07. März 2012 Atherosklerose durch oxidativen Stress? Dr. rer. nat. Katrin Huesker Atherosklerose durch oxidativen Stress? Pathogenese Diagnostik Therapie www.nlm.nih.gov/medlineplus Atherosklerose durch
3.1. Die Auswertung unter Einbeziehung sowohl der Daten vor als auch nach Kontrastmittelgabe
 3. Ergebnisse Die Ergebnisse werden getrennt aufgeführt für: 1. Die kombinierte Untersuchungsmethode (Einbeziehung der Daten vor und nach Kontrastmittelgabe) 2. Die alleinige Untersuchung ohne Kontrastmittelgabe
3. Ergebnisse Die Ergebnisse werden getrennt aufgeführt für: 1. Die kombinierte Untersuchungsmethode (Einbeziehung der Daten vor und nach Kontrastmittelgabe) 2. Die alleinige Untersuchung ohne Kontrastmittelgabe
Monoklonale Antikörper sind Antikörper, immunologisch aktive Proteine, die von einer auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgehenden Zelllinie
 Monoklonale AK Monoklonale Antikörper sind Antikörper, immunologisch aktive Proteine, die von einer auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgehenden Zelllinie (Zellklon) produziert werden und die sich gegen
Monoklonale AK Monoklonale Antikörper sind Antikörper, immunologisch aktive Proteine, die von einer auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgehenden Zelllinie (Zellklon) produziert werden und die sich gegen
Dossierbewertung A14-28 Version 1.0 Apixaban (neues Anwendungsgebiet) Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Apixaban (neues Anwendungsgebiet) gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Apixaban (neues Anwendungsgebiet) gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung
Allgemeine Angaben der Diagnostischen Radiologie
 B-7 Diagnostische Radiologie B-7.1 Allgemeine Angaben der Diagnostischen Radiologie Fachabteilung: Art: Diagnostische Radiologie nicht Betten führend Abteilungsdirektor: Prof. Dr. Joachim Lotz Ansprechpartner:
B-7 Diagnostische Radiologie B-7.1 Allgemeine Angaben der Diagnostischen Radiologie Fachabteilung: Art: Diagnostische Radiologie nicht Betten führend Abteilungsdirektor: Prof. Dr. Joachim Lotz Ansprechpartner:
Proteinbestimmung. Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der Proteinbestimmung mit den folgenden Lehrzielen:
 Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Magnetisierung der Materie
 Magnetisierung der Materie Das magnetische Verhalten unterschiedlicher Materialien kann auf mikroskopische Eigenschaften zurückgeführt werden. Magnetisches Dipolmoment hängt von Symmetrie der Atome und
Magnetisierung der Materie Das magnetische Verhalten unterschiedlicher Materialien kann auf mikroskopische Eigenschaften zurückgeführt werden. Magnetisches Dipolmoment hängt von Symmetrie der Atome und
Nebenniere CT / MRT N. Zorger
 Institut für Röntgendiagnostik Nebenniere CT / MRT N. Zorger 2 Differentialdiagnose Allgemein Adenome Myelolipome Phaeochromozytome Karzinome Metastasen Nebennierenrindentumoren: Nebennierenmarktumoren:
Institut für Röntgendiagnostik Nebenniere CT / MRT N. Zorger 2 Differentialdiagnose Allgemein Adenome Myelolipome Phaeochromozytome Karzinome Metastasen Nebennierenrindentumoren: Nebennierenmarktumoren:
PET/CT. Tumorspezifische molekulare Bildgebung für eine individualisierte Krebstherapie. Funktionsweise Anwendungsgebiete Kostenerstattung
 PET/CT Tumorspezifische molekulare Bildgebung für eine individualisierte Krebstherapie Funktionsweise Anwendungsgebiete Kostenerstattung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) PET/CT
PET/CT Tumorspezifische molekulare Bildgebung für eine individualisierte Krebstherapie Funktionsweise Anwendungsgebiete Kostenerstattung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) PET/CT
1.1. Dauer Vorübergehend: Unter normalen Bedingungen für eine ununterbrochene Anwendung über einen Zeitraum von weniger als 60 Minuten bestimmt.
 Klassifizierung gemäß 93/42/EWG ANHANG IX KLASSIFIZIERUNGSKRITERIEN I. DEFINITONEN 1. Definitionen zu den Klassifizierungsregeln 1.1. Dauer Vorübergehend: Unter normalen Bedingungen für eine ununterbrochene
Klassifizierung gemäß 93/42/EWG ANHANG IX KLASSIFIZIERUNGSKRITERIEN I. DEFINITONEN 1. Definitionen zu den Klassifizierungsregeln 1.1. Dauer Vorübergehend: Unter normalen Bedingungen für eine ununterbrochene
Diagnose und Management der fokalen benignen Leberläsion. Dirk Bareiss, Joachim Hohmann
 Diagnose und Management der fokalen benignen Leberläsion Dirk Bareiss, Joachim Hohmann Anamnese bei fokalen Leberläsionen Hat der Patient Symptome oder handelt es sich um einen Zufallsbefund? Patientencharakteristika:
Diagnose und Management der fokalen benignen Leberläsion Dirk Bareiss, Joachim Hohmann Anamnese bei fokalen Leberläsionen Hat der Patient Symptome oder handelt es sich um einen Zufallsbefund? Patientencharakteristika:
CT Thorax. Lernziele. Peter Hunold
 CT Thorax Peter Hunold Lernziele Kurze Rekapitulation Technische Prinzipen der CT Nachverarbeitung CT Datensätze Anatomie des Thorax kennenlernen Indikationen zur Thorax-CT kennenlernen Typische Befundmuster
CT Thorax Peter Hunold Lernziele Kurze Rekapitulation Technische Prinzipen der CT Nachverarbeitung CT Datensätze Anatomie des Thorax kennenlernen Indikationen zur Thorax-CT kennenlernen Typische Befundmuster
Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms. Diagnostik
 Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms Diagnostik Diagnostik: Zielsetzung und Fragestellungen Diagnostik (siehe Kapitel 3.3) Welche Symptome weisen auf ein
Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms Diagnostik Diagnostik: Zielsetzung und Fragestellungen Diagnostik (siehe Kapitel 3.3) Welche Symptome weisen auf ein
Perjeta für die neoadjuvante Therapie zugelassen
 HER2-positives Mammakarzinom Perjeta für die neoadjuvante Therapie zugelassen Grenzach-Wyhlen (31. Juli 2015) - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat Perjeta (Pertuzumab) in Kombination mit Herceptin
HER2-positives Mammakarzinom Perjeta für die neoadjuvante Therapie zugelassen Grenzach-Wyhlen (31. Juli 2015) - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat Perjeta (Pertuzumab) in Kombination mit Herceptin
PET/MR. Terminvergabe: (030) Funktionsweise Anwendung. Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ)
 Terminvergabe: (030) 293697300 PET/MR Funktionsweise Anwendung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) Nuklearmedizin Radiologie Strahlentherapie ALLGEMEIN Das DTZ Das DTZ Berlin
Terminvergabe: (030) 293697300 PET/MR Funktionsweise Anwendung Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor (DTZ) Nuklearmedizin Radiologie Strahlentherapie ALLGEMEIN Das DTZ Das DTZ Berlin
Ergebnisse Immunhistochemie
 3.2.2.6 Immunhistochemie Zum Nachweis von Mikrometasasen wurden Antikörper gegen humanes Zytokeratin verwendet. Da alle implantierten Tumorgewebe epithelialen Ursprungs waren, konnte dieser Marker bei
3.2.2.6 Immunhistochemie Zum Nachweis von Mikrometasasen wurden Antikörper gegen humanes Zytokeratin verwendet. Da alle implantierten Tumorgewebe epithelialen Ursprungs waren, konnte dieser Marker bei
12. Gemeinsame Jahrestagung, 09. 11. September, Radebeul. Sächsische Radiologische Gesellschaft,
 12. Gemeinsame Jahrestagung, 09. 11. September, Radebeul Sächsische Radiologische Gesellschaft, Thüringische Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin Leber: Von der Morphe zur (MR)-Funktion 1 Schlussfolgerungen
12. Gemeinsame Jahrestagung, 09. 11. September, Radebeul Sächsische Radiologische Gesellschaft, Thüringische Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin Leber: Von der Morphe zur (MR)-Funktion 1 Schlussfolgerungen
Matthias Becker Nadine Bruns. FH Münster WS 2010/11
 Magnetische Pigmente Matthias Becker Nadine Bruns FH Münster WS 2010/11 2 Inhaltsverzeichnis Was sind Pigmente? Wie entsteht die Farbe? Historische Entwicklung Magnetismus Magnetische Pigmente Anwendung
Magnetische Pigmente Matthias Becker Nadine Bruns FH Münster WS 2010/11 2 Inhaltsverzeichnis Was sind Pigmente? Wie entsteht die Farbe? Historische Entwicklung Magnetismus Magnetische Pigmente Anwendung
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Aufgaben zum Umfeld: 7 Vergleichen Sie die Gitterenergien von NaF, NaCl und NaI bzw. MgO, CaO und BaO! Gitterenergien [kj/mol]
![Aufgaben zum Umfeld: 7 Vergleichen Sie die Gitterenergien von NaF, NaCl und NaI bzw. MgO, CaO und BaO! Gitterenergien [kj/mol] Aufgaben zum Umfeld: 7 Vergleichen Sie die Gitterenergien von NaF, NaCl und NaI bzw. MgO, CaO und BaO! Gitterenergien [kj/mol]](/thumbs/49/25486820.jpg) Seite 22 22 Auflösung von Si in NaOH-Lösung Weiterführende Infos Quarzsand und Alkalicarbonate werden bei ca. 1300 C zusammengeschmolzen und das Produkt ((Na/K) 2 O* n SiO 2 ) bei 150 C und 5 bar in Wasser
Seite 22 22 Auflösung von Si in NaOH-Lösung Weiterführende Infos Quarzsand und Alkalicarbonate werden bei ca. 1300 C zusammengeschmolzen und das Produkt ((Na/K) 2 O* n SiO 2 ) bei 150 C und 5 bar in Wasser
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Einfluss von Immunsuppressiva auf die antivirale T-Zellantwort ex vivo
 Aus der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen Abteilung Kinderheilkunde I mit Poliklinik Ärztlicher Direktor: Professor Dr. R. Handgretinger Einfluss von Immunsuppressiva auf die antivirale
Aus der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen Abteilung Kinderheilkunde I mit Poliklinik Ärztlicher Direktor: Professor Dr. R. Handgretinger Einfluss von Immunsuppressiva auf die antivirale
Balneomedizinisches Gutachten betreffend ein Silberquarzitvorkommen im Pfitschtal/Südtirol.
 Balneomedizinisches Gutachten betreffend ein Silberquarzitvorkommen im Pfitschtal/Südtirol. Von Ao. Univ. Prof. Dr. W. Marktl 1 1. Einleitung und Auftragstellung Der Verfasser des vorliegenden balneomedizinischen
Balneomedizinisches Gutachten betreffend ein Silberquarzitvorkommen im Pfitschtal/Südtirol. Von Ao. Univ. Prof. Dr. W. Marktl 1 1. Einleitung und Auftragstellung Der Verfasser des vorliegenden balneomedizinischen
DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES GRADES EINES DOKTORS DER MEDIZIN. der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes
 Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Arno Bücker Fachbereich 2 (Klinische Medizin) der Universität des Saarlandes Homburg / Saar Detektion hypervaskularisierter
Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Arno Bücker Fachbereich 2 (Klinische Medizin) der Universität des Saarlandes Homburg / Saar Detektion hypervaskularisierter
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Die Leber Entstehung der Leber. Histologie der Leber
 Die Leber Entstehung der Leber Die Hepatozyten sind endodermaler Herkunft und entwickeln sich aus den selben Vorläuferzellen, die auch den Darm bilden. Bindegewebe und Gefäße der Leber entstehen aus mesenchymalen
Die Leber Entstehung der Leber Die Hepatozyten sind endodermaler Herkunft und entwickeln sich aus den selben Vorläuferzellen, die auch den Darm bilden. Bindegewebe und Gefäße der Leber entstehen aus mesenchymalen
in vivo -- Das Magazin der Deutschen Krebshilfe vom
 Seite 1/5 in vivo -- Das Magazin der Deutschen Krebshilfe vom 11.11.2008 Expertengespräch zum Thema Leberkrebs Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Prof. Dr. Michael Manns, Direktor der Klinik für Gastroenterologie,
Seite 1/5 in vivo -- Das Magazin der Deutschen Krebshilfe vom 11.11.2008 Expertengespräch zum Thema Leberkrebs Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Prof. Dr. Michael Manns, Direktor der Klinik für Gastroenterologie,
PET/CT am Klinikum Minden
 Klinikum Minden - Radiologie Chefarzt Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold Hans-Nolte-Straße 1, 32429 Minden 0571 / 790 4601 radiologie-nuklearmedizin@klinikum-minden.de PET/CT am Klinikum Minden Was genau ist
Klinikum Minden - Radiologie Chefarzt Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold Hans-Nolte-Straße 1, 32429 Minden 0571 / 790 4601 radiologie-nuklearmedizin@klinikum-minden.de PET/CT am Klinikum Minden Was genau ist
Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen
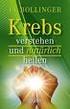 Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen Woher nimmt ein Tumor die Kraft zum Wachsen? Tumorzellen benötigen wie andere Zellen gesunden Gewebes auch Nährstoffe und Sauerstoff, um wachsen zu können.
Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen Woher nimmt ein Tumor die Kraft zum Wachsen? Tumorzellen benötigen wie andere Zellen gesunden Gewebes auch Nährstoffe und Sauerstoff, um wachsen zu können.
CT Methoden. Lernziele. Röntgen / CT Das Arbeitspferd. Computertomographie- Wie alles begann. Computertomographie: Prinzip Rohdaten.
 Lernziele CT Methoden Vergleich zum konventionellen Röntgen CT Inkremental- / Spiraltechnik Bildnachverarbeitung Florian Vogt Intravenöse und orale Kontrastmittel Unterschiedliche KM-Phasen Röntgen / CT
Lernziele CT Methoden Vergleich zum konventionellen Röntgen CT Inkremental- / Spiraltechnik Bildnachverarbeitung Florian Vogt Intravenöse und orale Kontrastmittel Unterschiedliche KM-Phasen Röntgen / CT
Sonographie und Endosonographie zum Staging von Ösophagus- und Magentumoren
 KLINIK UND POLIKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I Sonographie und Endosonographie zum Staging von Ösophagus- und Magentumoren I. Zuber-Jerger Endosonographie zum Staging von Ösophagus- und Magenkarzinom EUS beste
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I Sonographie und Endosonographie zum Staging von Ösophagus- und Magentumoren I. Zuber-Jerger Endosonographie zum Staging von Ösophagus- und Magenkarzinom EUS beste
Die Computertomographie
 Ratgeber für Patienten Die Computertomographie des Bauchraumes (Abdomen-CT) Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Krankheiten von Magen, Darm, Leber und Stoffwechsel sowie von Störungen der Ernährung
Ratgeber für Patienten Die Computertomographie des Bauchraumes (Abdomen-CT) Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Krankheiten von Magen, Darm, Leber und Stoffwechsel sowie von Störungen der Ernährung
Aktuelle Warnungen und Diskussion zum Einsatz von HAES
 Aktuelle Warnungen und Diskussion zum Einsatz von HAES Sitzung der DGTI-Sektion 3 in Frankfurt am 21.11.2013 Prof. Dr. med. Erwin Strasser Obmann der DGTI-Sektion 3 Präparative und therapeutische Hämapherese
Aktuelle Warnungen und Diskussion zum Einsatz von HAES Sitzung der DGTI-Sektion 3 in Frankfurt am 21.11.2013 Prof. Dr. med. Erwin Strasser Obmann der DGTI-Sektion 3 Präparative und therapeutische Hämapherese
Aus dem Johannes-Müller-Centrum für Physiologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION
 Seite 1 Aus dem Johannes-Müller-Centrum für Physiologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Mechanismen und pathophysiologische Konsequenzen einer hypoxievermittelten
Seite 1 Aus dem Johannes-Müller-Centrum für Physiologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Mechanismen und pathophysiologische Konsequenzen einer hypoxievermittelten
Richtlinie gemäß 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation - Auszug* -
 IV Anhang Seite 1 von 5 IV.1 Anlage 1 - Dokumentations- und Verlaufsbogen hepatozelluläres Karzinom (HCC) für die Lebertransplantation Anzahl der HCC Knoten Milan-Kriterien erfüllt Ja Nein HCC Diagnose
IV Anhang Seite 1 von 5 IV.1 Anlage 1 - Dokumentations- und Verlaufsbogen hepatozelluläres Karzinom (HCC) für die Lebertransplantation Anzahl der HCC Knoten Milan-Kriterien erfüllt Ja Nein HCC Diagnose
Labordiagnostik bei Tumorerkrankungen
 Labordiagnostik bei Tumorerkrankungen L. Binder Abteilung Klinische Chemie/Zentrallabor 04-06-29 Hämatoonkologisches Curriculum 1 Tumorepidemiologie Tumorerkrankungen 210.000 Todesfälle/a in Deutschland
Labordiagnostik bei Tumorerkrankungen L. Binder Abteilung Klinische Chemie/Zentrallabor 04-06-29 Hämatoonkologisches Curriculum 1 Tumorepidemiologie Tumorerkrankungen 210.000 Todesfälle/a in Deutschland
MRT. MRT im Allgemeinen. Klinische Anwendungen. MRT: Vom Scheitel bis zur Sohle. Spulen (engl. Coils) für jede Region
 03.06.14 MRT Klinische Anwendungen MRT im Allgemeinen Hohe Aussagekra5 O5 letzte Instanz der nicht- invasiven DiagnosAk Aufwändig, teuer Eingeschränkt verfügbar auch in Deutschland Nur eingeschränkt für
03.06.14 MRT Klinische Anwendungen MRT im Allgemeinen Hohe Aussagekra5 O5 letzte Instanz der nicht- invasiven DiagnosAk Aufwändig, teuer Eingeschränkt verfügbar auch in Deutschland Nur eingeschränkt für
Zielgerichtete Therapie bei Darmkrebs: Hemmung des Blutgefäßwachstums. Eine neue Chance für die Patienten
 Zielgerichtete Therapie bei Darmkrebs: Hemmung des wachstums Eine neue Chance für die Patienten Tumor-Angiogenese Was ist Angiogenese? Der Begriff Angiogenese leitet sich ab aus den altgriechischen Bezeichnungen
Zielgerichtete Therapie bei Darmkrebs: Hemmung des wachstums Eine neue Chance für die Patienten Tumor-Angiogenese Was ist Angiogenese? Der Begriff Angiogenese leitet sich ab aus den altgriechischen Bezeichnungen
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
 UNTERSUCHUNGEN ZUM NICHTVIRALEN GENTRANSFER IN DIE LUNGE IM MAUSMODEL EINFLUSS DER APPLIKATIONSART, MOLEKULARBIOLOGISCHER FAKTOREN UND MAGNETISCHER DRUG TARGETINGMECHANISMEN Dissertation zur Erlangung
UNTERSUCHUNGEN ZUM NICHTVIRALEN GENTRANSFER IN DIE LUNGE IM MAUSMODEL EINFLUSS DER APPLIKATIONSART, MOLEKULARBIOLOGISCHER FAKTOREN UND MAGNETISCHER DRUG TARGETINGMECHANISMEN Dissertation zur Erlangung
Immunbiologie. Teil 4
 Teil 4 Funktion der lymphatischen Organe: - es werden drei Arten von lymphatischen Organen unterschieden: - primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - die Organe unterscheiden sich in ihrer
Teil 4 Funktion der lymphatischen Organe: - es werden drei Arten von lymphatischen Organen unterschieden: - primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - die Organe unterscheiden sich in ihrer
Gute Überlebensqualität Trastuzumab beim metastasierten Magenkarzinom
 Gute Überlebensqualität Trastuzumab beim metastasierten Magenkarzinom München (24. April 2012) - Mit dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab (Herceptin ) steht bislang die einzige zielgerichtete Substanz
Gute Überlebensqualität Trastuzumab beim metastasierten Magenkarzinom München (24. April 2012) - Mit dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab (Herceptin ) steht bislang die einzige zielgerichtete Substanz
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Der neue HP ColorSphere Toner. Eine neue Formel und eine neue Technologie als Ergebnis von über 20 Jahren Forschung
 Der neue HP ColorSphere Toner Eine neue Formel und eine neue Technologie als Ergebnis von über 20 Jahren Forschung Beim Laserdruck, das heißt beim elektrofotografischen Druckprozess (EP), wird die Bedeutung
Der neue HP ColorSphere Toner Eine neue Formel und eine neue Technologie als Ergebnis von über 20 Jahren Forschung Beim Laserdruck, das heißt beim elektrofotografischen Druckprozess (EP), wird die Bedeutung
Radiologie und Nuklearmedizin PET/CT. Moderne Diagnostik von Tumorerkrankungen. Kompetenz, die lächelt.
 Radiologie und Nuklearmedizin PET/CT Moderne Diagnostik von Tumorerkrankungen Kompetenz, die lächelt. Was ist PET / CT? Die PET/CT dient der Bildgebung von Tumoren, Entzündungen und Hirnerkrankungen. Sie
Radiologie und Nuklearmedizin PET/CT Moderne Diagnostik von Tumorerkrankungen Kompetenz, die lächelt. Was ist PET / CT? Die PET/CT dient der Bildgebung von Tumoren, Entzündungen und Hirnerkrankungen. Sie
Fieber. B. Hug, Innere Medizin M. Weisser, Infektiologie & Spitalhygiene V. Hess, Onkologie U. Walker, Rheumatologie
 Fieber B. Hug, Innere Medizin M. Weisser, Infektiologie & Spitalhygiene V. Hess, Onkologie U. Walker, Rheumatologie Der febrile Patient aus onkologischer Sicht Viviane Hess Der febrile Patient aus onkologischer
Fieber B. Hug, Innere Medizin M. Weisser, Infektiologie & Spitalhygiene V. Hess, Onkologie U. Walker, Rheumatologie Der febrile Patient aus onkologischer Sicht Viviane Hess Der febrile Patient aus onkologischer
Patienteninformation
 Standort: Hardtwaldklinik I Hardtstraße 31 Telefon: 05626-99 97 0 Fax: 05626-99 97 23 www.radiologie.net Patienteninformation zur Prostata MRT (mit der Möglichkeit einer Spektroskopie) 1 Patienteninformation
Standort: Hardtwaldklinik I Hardtstraße 31 Telefon: 05626-99 97 0 Fax: 05626-99 97 23 www.radiologie.net Patienteninformation zur Prostata MRT (mit der Möglichkeit einer Spektroskopie) 1 Patienteninformation
Edelgas-polarisierte. NMR- Spektroskopie. Jonas Möllmann Jan Mehlich. SoSe 2005
 Edelgas-polarisierte NMR- Spektroskopie Jonas Möllmann Jan Mehlich SoSe 2005 NMR Prinzip Aufspaltung der Kernspins in verschiedene Niveaus durch angelegtes Magnetfeld Messung des Besetzungs- unterschiedes
Edelgas-polarisierte NMR- Spektroskopie Jonas Möllmann Jan Mehlich SoSe 2005 NMR Prinzip Aufspaltung der Kernspins in verschiedene Niveaus durch angelegtes Magnetfeld Messung des Besetzungs- unterschiedes
Neues aus Diagnostik und Therapie beim Lungenkrebs. Jürgen Wolf Centrum für Integrierte Onkologie Universitätsklinikum Köln
 Neues aus Diagnostik und Therapie beim Lungenkrebs Jürgen Wolf Centrum für Integrierte Onkologie Universitätsklinikum Köln Über was ich Ihnen heute berichten will: Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs
Neues aus Diagnostik und Therapie beim Lungenkrebs Jürgen Wolf Centrum für Integrierte Onkologie Universitätsklinikum Köln Über was ich Ihnen heute berichten will: Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs
MRT - Protokolle, Anwendungen
 9. Oktober 2007 1 MR Angiographie 2 Kardiale MRT 3 Mamma MRT 4 Abdominal MRT 5 MRT des Beckens 6 Muskuloskelettal MRT 7 Neuro MRT Kontraindikationen Wann darf keine MRT Untersuchung gemacht werden? Herzschrittmacher
9. Oktober 2007 1 MR Angiographie 2 Kardiale MRT 3 Mamma MRT 4 Abdominal MRT 5 MRT des Beckens 6 Muskuloskelettal MRT 7 Neuro MRT Kontraindikationen Wann darf keine MRT Untersuchung gemacht werden? Herzschrittmacher
Medizinische Immunologie. Vorlesung 6 Effektormechanismen
 Medizinische Immunologie Vorlesung 6 Effektormechanismen Effektormechanismen Spezifische Abwehrmechanismen Effektormechanismen der zellulären Immunantwort - allgemeine Prinzipien - CTL (zytotoxische T-Lymphozyten)
Medizinische Immunologie Vorlesung 6 Effektormechanismen Effektormechanismen Spezifische Abwehrmechanismen Effektormechanismen der zellulären Immunantwort - allgemeine Prinzipien - CTL (zytotoxische T-Lymphozyten)
Expression und Funktion. von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten. Hirngewebe der Maus
 Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Grundwassersanierung mit Nano-Technologie. CKW-Schaden Bornheim-Roisdorf
 Grundwassersanierung mit Nano-Technologie CKW-Schaden Bornheim-Roisdorf Beschreibung des Schadens und der bisherigen Maßnahmen zur Sanierung Der Schaden wurde vermutlich in den 70er Jahren durch eine chemische
Grundwassersanierung mit Nano-Technologie CKW-Schaden Bornheim-Roisdorf Beschreibung des Schadens und der bisherigen Maßnahmen zur Sanierung Der Schaden wurde vermutlich in den 70er Jahren durch eine chemische
