INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT
|
|
|
- Marie Diefenbach
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Westfälische Wilhelms-Universität INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis für das 1
2 Studieninformationen Sekretariate Abteilung I Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10:00-12:00 Uhr Tel: , Fax: Doris Pasch Christel Mügge Raum 220 b Raum 220 c Abteilung II Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10:00-12:00 Uhr Tel: , Fax: Christel Franek Magarete Kemper Raum 209 b Raum 209 b Hochschullehrer Prof. Dr. Gerhard W. Wittkämper Raum 220 a, Tel: (Geschäftsführender Direktor) Sprechstunde: Di 14:30-16:00 Prof. Dr. Paul Kevenhörster Raum 209 a, Tel: (Stellvertretender Direktor) Sprechstunde: Mi 15:00-16:00 Prof. Dr. Rainer Frey Raum 122, Tel: Sprechstunde: Di 11:00-12:00 Priv.-Doz. Dr. Irene Gerlach Raum 222 a, Tel: Sprechstunde: Fr 11:00-13:00 Prof. Dr. Karl Hahn Raum 205, Tel: Sprechstunde: siehe Aushang Prof. Dr. Norbert Konegen Raum 221 a, Tel: Sprechstunde: Mo 12:00-13:00 Prof. Dr. Reinhard Meyers Raum 208 a, Tel: Sprechstunde: Mi 18:00-22:00 2
3 Studieninformationen Prof. Dr. Jens Naumann (Professor für Erziehungswissenschaft im FB 09) Raum C 218 (Georgskommende 33) Tel: Dr. Rüdiger Robert Raum 225, Tel: Sprechstunde: Mi 14:00-15:00 Prof. Dr. Dietrich Thränhardt Raum 211 b, Tel: Sprechstunde: Do 16:00-17:00 Prof. Dr. Wichard Woyke Raum 223, Tel: Sprechstunde: Mi 16:00-17:30 Prof. Dr. Annette Zimmer Raum 210 b, Tel: Sprechstunde: Di 16:30-17:30 Wissenschaftliche Mitarbeiter Christiane Frantz, M.A. Raum: 223 b,tel: Sprechstunde: Mi 14:00-15:00 Uwe Hunger, M.A. Raum: 223 b, Tel: Sprechstunde: Do 11:00-12:00 Anke Kohl, M. A. Raum 222 a, Tel: Sprechstunde: Di. 10:00-11:00 Anja Kusenberg, M.A. Raum 228, Tel: Sprechstunde: siehe Aushang 3
4 Studieninformationen Studienberatung Christiane Frantz, M.A. Priv.-Doz. Dr. Irene Gerlach Uwe Hunger, M.A. Anke Kohl, M. A. Anja Kusenberg, M.A. Dr. Karin Meendermann Mi 14:00-15:00; R. 223 b Fr 11:00-13:00, R. 222 a Do 11:00-12:00, R. 223 b Di 10:00-11:00, R. 222 a (siehe Aushang) Di 11:00-12:00, R. 211 a Raum 215, Tel: Studentisches Servicebüro Im Studentischen Servicebüro sollen Fragen und Unsicherheiten zum Studienverlauf, zu Belegung, Stipendien, Magisterzwischenprüfung, Anmeldung zur Magisterarbeit usw. geklärt werden. Öffungszeiten: Di. bis Do. 10:00 bis 12:00 Fachschaft Politik Raum: Café B@racke hinter dem Institut, Tel: Der Fachschaftsrat (oder kurz: die Fachschaft) ist die Interessenvertretung der Studierenden am Institut für Politikwissenschaft. Ihre Arbeit besteht aus: Studienberatung, besonders für Erstsemester Verkauf der kommentierten Vorlesungsverzeichnisse Studentische Interessenvertretung in den Gremien des Instituts und des Fachbereichs Förderung der politischen Bildung Organisation von kulturellen Veranstaltungen (z.b. Politik-Partys) Die Fachschaft bietet zur Studienplanung und -beratung von Montag bis Donnerstag zwischen 12:00-13:30 einen Präsensdienst an. Jeden Montag um 20:00 Uhr findet eine öffentliche Fachschaftssitzung statt. Außerdem bietet die Fachschaft jeden Dienstag um 20:00 Uhr eine Erstsemester-Initiative im Café B@racke an. Raum: 222, Tel: Sprechstunde: 10:00-12:00 Praktikumsbüro Am Institut für Politikwissenschaft gib es seit 1984 ein Praktikumsbüro, in dem sich Studierende über Praktika, Bewerbungen und Berufseinstieg beraten und informieren 4
5 Studieninformationen können. Das Praktikumsbüro versteht sich als Angebot an alle Studierenden, die sich über ihre persönlichen Berufsperspektiven klar werden und deshalb ein Praktikum machen wollen. In einem persönlichen Gespräch wird versucht, gemeinsam mit dem/der Student/in einen für ihn/sie sinnvollen Praktikumsplatz zu finden. Durch eine gut sortierte Kartei mit Adressen von Wirtschaftsunternehmen, Medien, politischen Parteien, Stiftungen, Verbänden etc. können Kontakte vermittelt werden - bewerben muß man sich jedoch eigenständig. Das Praktikumsbüro hält nur wenige feste Stellen bereit, von dem/der Praktikumssuchenden wird daher erwartet, daß er/sie sich mit den Chancen und Risiken des Arbeitsmarktes vertraut macht. Belohnt wird dieser Einsatz für ein hochwertiges, mindestens sechswöchiges Praktikum mit einem Leistungsnachweis, der äquivalent zu einem Hauptseminarschein anerkannt wird. Nähere Informationen hierzu und zu Praktika allgemein enthält die neue Broschüre Praktikum für Sozialwissenschaftler, die im Praktikumsbüro und im EDZ kostenfrei erhältlich ist. Bibliotheken Die Bibliotheken des Instituts für Politikwissenschaft befinden sich in den Räumen der Zweigbibliothek Sozialwissenschaften in der Scharnhorststraße Offnungszeiten: Mo. - Fr. 10:00-20:00 Sa. 9:00-13:00 Es besteht die Möglichkeit der Nacht- und Wochenendausleihe. Europäisches Dokumentationszentrum (EDZ / CDE) Raum 213, Tel: Im Europäischen Dokumentationszentrum werden Publikationen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments, des Europäischen Gerichtshofes, des Europäischen Rechnungshofes und des Statistischen Amtes der Europäischen Union gesammelt und zur Verfügung gestellt. Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10:00-18:00 (während der Vorlesungszeit) Fr. 10:00-14:00 Während der Öffnungszeiten können im Dokumentationszentrum auch die Scheine und Bescheinigungen der Abteilung I und II des Instituts für Politikwissenschaft abgeholt werden. Raumübersicht 5
6 Studieninformationen Hörsäle Räume Adresse SCH 1, SCH 2, SCH f. Scharnhorststraße 100 SCH f. Erweiterungsbau I, Scharnhorststraße 121 SCH f. Erweiterungsbau II, Scharnhorststraße 103 Studio I + II, Mitschauanlage Scharnhorststraße 100 Spiegelsaal (R. 201) Turnhallengebäude, Scharnhorststraße 100 S - Räume: Schloß U - Räume: Hörsaalgebäude, Hindenburgplatz F - Räume: Fürstenberghaus, Domplatz B - Räume: Georgskommende 25 Impressum / Redaktion Herausgegeben vom Institut für Politikwissenschaft Redaktion: Carsten Müller 6
7 Vorlesungen Vorlesungen für das Grund- und Hauptstudium Frey, R Grundzüge der Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland (Sowi Sek I/II: A2; LB Ges.: B1) Zeit: Mo 9-11 Raum: Sch 2 Beginn: Die Kommunen mit ihrer langen Tradition spezifischer Aufgabenbestände sind heute in mehrfacher Weise einem immensen Handlungsdruck ausgesetzt. Die finanzpolitische Krise bedroht ihre Leistungsfähigkeit. Die europäische Integration stellt ihre bisher behauptete Position im nationalen Staatsgefüge in Frage. Forderungen nach Bürgernähe, Sparsamkeit, Transparenz des Verwaltungshandelns und Partizipation drängen auf eine kommunale Strukturreform. Die Vorlesung thematisiert die kommunale Verfassungsstruktur und nimmt Bezug auf die kommunalpolitischen Akteure und die beschreibbaren Verlaufslinien der politischen Entscheidungsprozesse. Darüber hinaus stellt die Vorlesung die Bemühungen um eine Reform kommunaler Verwaltung vor und wirft einen Blick aus kommunaler Perspektive auf den europäischen Integrationsprozeß. Kevenhörster, P. / Woyke, W Ringvorlesung: Europas Rolle in der Weltpolitik (Sowi Sek I/II: A3; LB Ges.: B1) Zeit: Mi Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Mit dem Ende des Blockantagonismus des Ost-West-Konfliktes hat sich die Rolle Europas von der eines protegierten Akteurs zu der eines gleichberechtigten Partners gewandelt. Das polyzentrische Staatensystem der 90er Jahre fordert vom europäischen Staatenverbund eine eigenständige Lastenverteilung ein, die er aufgrund mangelnder Bereitschaft und fehlender Übereinstimmung (konzeptioneller Mängel im Maastrichter Vertrag) zu leisten bisher nicht imstande ist. Ziel der Ringvorlesung ist es, die Rolle Europas als internationaler Akteur mit ausgewiesenen Experten aus Wissenschaft und Praxis zu diskutieren. Dabei sollen außen- und sicherheitspolitische, wirtschaftliche sowie entwicklungspolitische Fragen mit einbezogen werden. Konegen, N Finanzausgleich und föderatives Prinzip - der Landesfinanzausgleich in Deutschland (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Di Raum: Sch 2 Beginn: 2. Vorlw. 7
8 Vorlesungen Der Finanzausgleich regelt die Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung zwischen den einzelnen Körperschaften eines mehrstufigen Staatsaufbaus. Für das Regierungssystem der Bundesrepublik finden sich die grundlegenden verfassungsrechtlichen Vorgaben in den Art. 70ff., 83ff. und 104ff. GG. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen nicht nur Beschreibung und Analyse der Formen und Ziele eines Finanzausgleichs sowie seine bundesdeutsche Entwicklungsgeschichte, sondern auch Fragen nach seiner System- und Handlungsrationalität und damit schließlich nach seiner Wirksamkeit. Einstiegsliteratur: Berg, Hartmut, Cassel, Dieter, Theorie der Wirtschaftspolitik, in: Bender, D. u.a. (Hrsg), Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, München , S ; Peffekoven, Rolf, Einführung in die Grundbegriffe der Finanzwissenschaft, Darmstadt 3, (S. 83ff.) sowie die darin angegebene Literatur. Thränhardt, D Die fließenden Grenzen des Nationalstaates. Migration, Ausgrenzung und Solidarität (Sowi Sek I/II: A2,3: EW: C1) Zeit: Do Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Auf Grund der steigenden Geburtendefizite fast aller hochentwickelten Nationalstaaten ergibt sich in Zukunft ein Einwanderungsbedarf, der zu anderen Wanderungsursachen hinzukommt. Dies macht neue Formen der Akzeptanz in traditionellen Nichteinwanderungsländern nötig, wirkt sich auf die Zusammensetzung aller Gesellschaftsbereiche aus, steht in einem Spannungsverhältnis zu Arbeitslosigkeit oder Randständigkeit von Teilen der einheimischen Bevölkerung und kann zu neuen Formen intergenerationaler Konflikte führen. Neben dem Denken in größeren Räumen und Zusammenhängen bleibt der Nationalstaat aber die maßgebende Integrationsinstanz. Lektüre: Dietrich Thränhardt (Hg.), Europe. A New Immigration Continent. Policies and Politics in Comparative Perspective, Münster/ New Brunswick ; Hubert Heinelt (Hg.), Zuwanderungspolitik in Europa. Nationale Politiken. Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Opladen Wittkämper, G. W Umweltpolitik und -verwaltung (Sowi Sek I/II: A2,3; EW: C1; LB Ges.: B1) Zeit: Mo Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Die Vorlesung ist in 12 Lehreinheiten wie folgt gegliedert: 1. Der globale Wandel und Leitbilder sowie Ziele des Umweltschutzes 2. Grundbegriffe 3. Zur Lage der Umweltsphären und -medien 4. Merkmale des Umweltproblems 8
9 Vorlesungen 5. Transnationalität und geoökologische sowie sozioökologische Dimensionen des Umweltproblems 6. Die Umweltwissenschaften 7. Prinzipien der Umweltpolitik 8. Die Instrumente der Umweltpolitik und -verwaltung 9. Die nationalen Akteure 10. Die transnationalen Akteure 11. Die Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten von Bund, Ländern, Gemeinden und EU 12. Überblick über das Umweltrecht Wittkämper, G. W Die Politiken der Europäischen Union (Sowi Sek I/II: A3; LB Ges.: B1) Zeit: Mo Raum: Sch 2 Beginn:1. Vorlw. Durch die Vertragswerke über die Europäische Union hat insbesondere der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft viele Politikfelder tiefgreifend umgestaltet. Immer bedeutsamer wird die genaue Kenntnis der einzelnen europäischen Politiken und ihrer Vernetzung mit den nationalen Politiken. Diese Kenntnis ist neben der Kenntnis der Genese der Europäischen Gemeinschaften und der Kenntnis ihrer Institutionen die dritte Säule, die heute zu den in jedem Berufsfeld notwendigen Kenntnissen gehört. Diese Vorlesung soll durch einen detaillierten Überblick den Weg der eigenen vertieften Weiterarbeit ebnen. Zur Vorlesung wird gegen Ende eine Leseliste verteilt. Woyke, W Internationale Politik nach 1989 (Sowi Sek I/II: A3, EW: C2) Zeit: Mi Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Zwischen 1989 und 1991 hat es einen Strukturbruch im internationalen System gegeben. Der "real existierende Sozialismus" brach zusammen, der Warschauer Pakt löste sich auf, die Sowjetunion implodierte, die DDR trat der Bundesrepublik Deutschland bei, die ersten echten Abrüstungsabkommen (INF-Abkommen, START I und START II) wurden geschlossen sowie zahlreiche Konflikte wie z.b. der Südafrikakonflikt oder der Mittelamerikakonflikt konnten gelöst werden. Dagegen wurden Kriege in Europa wieder führbar, wie die Entwicklung auf dem Balkan in der ersten Hälfte der 90er Jahre dramatisch zeigte. Diese Vorlesung gibt einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Veränderungen der internationalen Politik seit dem Ende des Ost-West- Konflikts. Literatur: Daniel Colard: La société internationale après la guerre froide, Paris 1996; Curt Gasteyger: Europa von der Spaltung zur Einigung. Darstellung und Dokumentation 9
10 Vorlesungen , Bonn 1997; Wichard Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch Internationale Politik, Opladen 1998 (7.Auflage). 10
11 Grundkurse / Standardkurse Grundstudium Grundkurse, Standardkurse, Propädeutika Grundkurse Grundkurs I Wittkämper, G. W Grundkurs I: Einführung in das Studium der Politikwissenschaft (mit obligatorischem Tutorium) (Sowi Sek I/II: A1; EW: C1) Zeit: Di Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Der von Tutorien begleitete Grundkurs soll den Hörerinnen und Hörern einen Überblick über die Politikwissenschaft, auch unter Berücksichtigung beruflicher Perspektiven, geben. Nach einer Vorstellung der Organisation des Grundkurses, des Instituts und seiner Organisation werden folgende Themenschwerpunkte behandelt: Wissenschaft, Politik, Politikwissenschaft; Theorien der Politikwissenschaft; Methoden der Politikwissenschaft; Politische Philosophie; Innenpolitik; Europapolitik; Internationale Politik, Vergleichende Politikwissenschaft; Politische Ökonomie; Umweltpolitik. Der Grundkurs I endet mit einem Ausblick auf die Berufswege und Berufsfelder für Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler. Remke, A Einführung in die Politikwissenschaft für StudentInnen des Lernbereichs Sachunterricht / Gesellschaftslehre Zeit: Mo Raum: Sch 5 Beginn: 2. Vorlw. Im Seminar werden zunächst politikwissenschaftliche Grundbegriffe im Vordergrund der Diskussion stehen. Themenbereiche: - Politikwissenschaft und Politikbegriffe - Gegenstandsbereiche der Politikwissenschaft - Geschichte der Politikwissenschaft und der politischen Ideen - Politikwissenschaft und ihre Nachbardisziplinen 11
12 Grundkurse / Standardkurse Im Anschluß daran werden Fragen über politische Systeme und der politischen Soziologie näher erörtert. Themenbereiche: - Typen politischer Herrschaft - Grundelemente der Demokratie - Wahlen und öffentliche Meinung - Parteien und Verbände - Planung und Partizipation In einem dritten Teil sollen innenpolitische Probleme und politikwissenschaftliche Aspekte des Sachunterrichts diskutiert werden. Themenbereiche: - Bildungspolitik am Beispiel Nordrhein-Westfalens - Landespolitik am Beispiel Nordrhein-Westfalens - Probleme der kommunalen Selbstverwaltung - Politikrelevante Schwerpunkte im Sachunterricht der Grundschule Eine Literaturliste zu den Einzelthemen wird zu Beginn des Semesters vorliegen. Grundkurs II als propädeutische Lehrveranstaltung Gerlach, I Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1; LB Ges.: B1) Zeit: Di 9-11 Raum: Sch 2 Beginn: 2. Vorlw. Informationen zu diesem Seminar werden am Informationsbrett ausgehängt. Robert, R Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland - zwei Parallelkurse - (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1,2; LB Ges.: B1) Zeit: Di 9-11 Di Folgende Themen werden behandelt: Raum: R. 301 R. 301 Beginn: 1. Vorlw. I. Politisches System und Innenpolitik. Verständigung über Grundbegriffe 12
13 Grundkurse / Standardkurse II. Rahmenbedingungen und Grundlagen des politischen Systems 1. Die Bundesrepublik Deutschland im "Europäischen Haus" 2. Das Grundgesetz: Grundrechte und Staatszielbestimmungen 3. Die Wirtschafts- und Sozialordnung: "Soziale Marktwirtschaft" 4. Die politische Kultur: Das sozial-psychische "Ambiente" III. Bund, Länder und Gemeinden - Kompetenzen und Organe 1. Gemeinden und Staat 2. Bund und Länder 3. Parlamente und Regierungen 4. Regierungen und Verwaltung 5. Das Bundesverfassungsgericht IV. Akteure und Interessen im politischen System 1. Massenmedien und Meinungsbildung 2. Verbändesystem und Korporatismus 3. Neue soziale Bewegungen 4. Parteiensystem und Parteienstaat 5. Wahlen als Alternativentscheidungen Der Grundkurs wendet sich an Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Zum Erwerb eines Scheines sind notwendig: Regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung, Anfertigung eines Referates und einer Hausarbeit. Literaturhinweise: Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie, 3. Aufl., Opladen Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Grundwissen Politik, Schriftenreihe Bd. 302, Bonn Beyme, Klaus von: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland nach der Vereinigung, vollständig überarb. Neuausgabe, München/Zürich Gerlach, Irene / Robert, Rüdiger (Hrsg.): Politikwissenschaft II: Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Münster Grundkurs III als propädeutische Lehrveranstaltung Meyers, R Grundkurs III: Internationale Politik (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1; LB Ges.: B1) Zeit: Mi Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Die Veranstaltung soll einführen in Akteure, Prozesse und Strukturen der internationalen Beziehungen. In exemplarischer Vertiefung wird sie sich ferner mit den Problemen der Globalisierung auseinandersetzen und die Frage zu stellen haben, wie unter den Bedingungen von Globalisierung klassische zwischenstaatliche Politik noch möglich ist. 13
14 Grundkurse / Standardkurse Einführende Literaturhinweise: Reinhard Meyers: Grundbegriffe und theoretische Perspektiven der Internationalen Beziehungen, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Grundwissen Politik. 3.Aufl. Bonn 1997; Charles W. Kegley, Jr. / Eugene R. Wittkopf: World Politics. Trend and Transformation, 6. Aufl. New York 1997; John Baylis / Steve Smith (Hrsg.): The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford Standardkurse Hermans, A Standardkurs II: Politikwissenschaftliche Dimensionen der Ökonomie Zeit: Mi Raum:Sch 5 Beginn: 1. Vorlw. Der Standardkurs II behandelt die Politikbereiche Geldpolitik, Finanzpolitik, Einkommenspolitik und Außenwirtschaftspolitik sowie alternative Strategien der Wirtschaftspolitik. Für die Teilnahmen an diesem Kurs ist der erfolgreiche Besuch des Standardkurses I wünschenswert. Der Kurs kann mit einem Leistungsnachweis in Form einer Klausur abgeschlossen werden. Kuschel, A Standardkurs II: Politikwissenschaftliche Dimensionen der Ökonomie Zeit: Di 14 st -15:30 Raum: Sch 3 Beginn: (s. Aushang) Der Standardkurs II behandelt die Politikbereiche Geldpolitik, Finanzpolitik, Einkommenspolitik und Außenwirtschaftspolitik sowie alternative Strategien der Wirtschaftspolitik. Für die Teilnahmen an diesem Kurs ist der erfolgreiche Besuch des Standardkurses I wünschenswert. Der Kurs kann mit einem Leistungsnachweis in Form einer Klausur abgeschlossen werden. 14
15 Proseminare Proseminare Deutsche Innenpolitik Deutsche Innenpolitik Dreher, K Laß den Dicken machen (Sowi Sek I/II: A1,2; LB Ges.: B1) Zeit: Do Raum: Sch 3 Beginn: 1. Volw. Behandelt werden Leben und Wirken, Gelingen und Scheitern des amtierenden Bundeskanzlers Helmut Kohl. Untersucht werden unter anderem der Führungsstil, die Methodik des Regierens, der Umgang mit der Partei, die Regierungsrhetorik anhand der Regierungserklärungen, die Biographie. Ferner die einzelnen Zeitabschnitte und ihre Bedeutung für die deutsche Innenpolitik, wie der Reformkurs zur Zeit des Fraktionsvorsitzenden und Ministerpräsidenten Kohl ( ), die ohnmächtige Opposition in Bonn ( ), die außenpolitische Orientierung der Bundesregierung ( ), die deutsche Vereinigungspolitik ( ) und die Zeit der Aufarbeitung ( ). Gernert, W Von der freien Initiative zur perfekten Reglementierung? Einführung in die Rechtsgrundlagen der Jugendhilfe (Sowi Sek I/II: A2; EW: D2,3; LB Ges.: B1) Zeit: Do Raum: R. 315 Landesjugendamt, Warendorferstr. 25 Beginn: 2. Vorlw. Wenn seit einiger Zeit eine Verrechtlichung pädagogischer Arbeit beklagt wird, dann stellt sich die Frage nach der Situation im Sektor Jugendhilfe. Sie wird allgemein als sozialpädagogisches Praxisfeld gesehen, das Probleme der nachwachsenden Generation beim Übergang von der Kindheit und Jugend in die Erwachsenenwelt bearbeitet, und zwar außerhalb von Familie, Schule und Berufsausbildung. Ihre zentrale Rechtsgrundlage findet die Jugendhilfe im Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfegesetz. Darüber hinaus existieren zahlreiche Rechtsvorschriften, die für Jugendhilfe relevant sind, auch in anderen Gesetzen. In der Veranstaltung stellen wir uns die Frage der Sinnhaftigkeit dieser Regelungen und ihrem Charakter, der sich vor allem bei der Umsetzung in der Praxis dokumentiert. Aus einem Vergleich der heute geltenden Materie mit dem Beginn der Jugendarbeit kommen wir zu der Frage, inwieweit ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und hauptamtliche Fachkräfte tätig werden können und welches Ausbildungsprofil sie für ihre Arbeit brauchen. 15
16 Proseminare Gröschel, B. Deutsche Innenpolitik Status und Perspektiven nationaler Minderheiten in Deutschland: Dänen, Friesen und Sorben (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1; LB Ges.: B4) Zeit: Mo Raum: F 8 Beginn: 2. Vorlw. In Multikulturalismus -Debatten werden Probleme bodenständiger (alteingesessener) Minderheiten meist nur am Rande thematisiert. Dies dürfte primär damit zusammenhängen, daß infolge langdauernden Zusammenlebens innerhalb eines Staatswesens hier keine gravierenden zivilisatorischen oder mentalitätsbezogenen Distanzen zwischen Majorität und Minoritäten bestehen und daß Forderungen nach größerer Autonomie sich meist auf die wenig spektakulären Sektoren Kultur, Sprache und Bildungswesen beschränken. Den Rahmen der speziellen Seminarthematik bilden Regelungen des Minderheitenschutzes in internationalen Konventionen (UNO/UNESCO, OSZE, Europarat) sowie begriffliche Klärungen von Grundkategorien wie Nation, Nationalität, nationale, ethnische und sprachliche Minderheiten. Angesichts entsprechender Regelungen in den Landesverfassungen von Schleswig- Holstein (Dänen und Friesen) sowie Sachsen und Brandenburg (Sorben) - im Falle der Dänen zusätzlich durch bilaterale Verträge mit Dänemark - kann die rechtliche Situation dieser Minderheiten als befriedet betrachtet werden. Trotzdem beklagen Vertreter aller Minderheiten immer wieder einen kulturellen Assimilationsdruck vor allem im Kontext ökonomischer Faktoren sowie der überregionalen Massenmedien. Zur Klärung der Situation und der Perspektiven dieser Minderheiten bedarf es einer Analyse der historischen, siedlungs- und kulturgeschichtlichen Voraussetzungen ebenso wie aktueller rechtlicher, politischer, ökonomischer, demographischer und sozialer Determinanten ihrer Existenz sowie der Verankerung der Minoritätensprachen in Institutionen (Verwaltung, Rechtswesen, Bildungswesen, Kirchen, Medien). Ein detaillierter Seminarplan wird in der ersten Sitzung erstellt. Seminarscheine werden aufgrund individuell zu erarbeitender Referate erteilt, deren Thematik bereits vor Semesterbeginn (Tel ) vereinbart werden kann. Kuhr, W Die kommunalen Sparkassen in der Bundesrepublik Deutschland (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Fr 9-11 Beginn: 2. Vorlw. 1. Ausgangssituation: Raum: Freiherr-vom-Stein- Institut Die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik Deutschland wird von einer sozialorientierten Marktwirtschaft geprägt. Der Wettbewerb ist zwar der entscheidende Ordnungs- 16
17 Proseminare Deutsche Innenpolitik faktor, jedoch soll wirtschaftlich wie sozial ein Ausgleich der Interessen aller erreicht werden. Zur Erreichung dieses Zieles ist die Teilnahme der öffentlichen Hand im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung notwendig. Das gilt auch für die Kreditwirtschaft, also für die Betätigung der kommunalen Sparkassen. 2. Veranstaltungsziel: Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation soll die Veranstaltung Genese, Rechtsgrundlage, Standort, Bedeutung und Zukunftsperspektiven der kommunalen Sparkassen in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Binnenmarkt untersuchen. Folgende Grundfragen stehen dabei im Vordergrund: Die Situation des kommunalen Sparkassenwesens in der Bundesrepublik Deutschland. Die Entwicklung der Sparkassen in Deutschland. Rechtsgrundlage, Stellung und Funktion. Sparkassenpolitik, Bestimmung der Aufgaben als Rechtsprobleme und als ökonomische Probleme, Ziele, Akteure. Sparkassenorganisation: Binnenstruktur, Management, Führung, Umweltbeziehungen. Sparkassen im Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft. Sparkassen vor neuen Herausforderungen: Strukturwandel am internationalen Kapitalmarkt, Vollendung des europäischen Binnenmarktes 1992 Reformbereiche und Reformüberlegungen. Neuere Entwicklungen. 3. Literaturhinweise: Literaturhinweise werden in den Veranstaltungen gegeben werden. Robert, R Einführung in die Komunalpolitik (Sowi Sek I/II: A2; LB Ges.: B1) Zeit: Do 9-11 Raum: R. 301 Beginn: 1. Vorlw. Behandelt werden folgende Themen: GRUNDLAGEN 01. Kommunalforschung - Zwischen Kommunalrechtswissenschaft und empiri scher Sozialforschung 02. Ansätze und Konzepte der Gemeindesoziologie 03. Geschichte und Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland 04. Die verfassungsrechtliche Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland 05. Typen kommunaler Verfassung in Deutschland 06. Reform der Kommunalverfassung in Nordrhein-Westfalen AKTEURE 17
18 Proseminare Deutsche Innenpolitik 07. Parteien in der kommunalen Politik unter besonderer Berücksichtigung der Fraktionen 08. Bürgerbeteiligung in der kommunalen Politik 09. Medien und Macht in der kommunalen Politik 10. Kommunalpolitik und Wahlen POLITIKFELDER 11. Kommunale Sozialpolitik 12. Kommunale Städteplanung 13. Kommunale Finanzen 14. Kommunale Außenbeziehungen Das Proseminar wendet sich an Studierende im Grundstudium. Zum Scheinerwerb sind erforderlich die regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung, die Anfertigung einer Hausarbeit sowie die inhaltliche Gestaltung einer Unterrichtseinheit. Literatur: Schmals, Klaus M. / Siewert, Hans-Jörg (Hrsg.): Kommunale Macht- und Entscheidungsstrukturen, München 1982; Wehling, Hans-Georg (Hrsg.): Kommunalpolitik, Hamburg 1975; Andersen, Uwe (Hrsg.): Kommunale Selbstverwaltung und Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen, Köln 1987; Andersen, Uwe (Hrsg.): Kommunalpolitik und Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1984; Fischer, Dieter / Frey, Rainer / Paziorek, Peter (Hrsg.): Vom Lokalen zum Globalen. Die Kommunen und ihre Außenbeziehungen innerhalb und außerhalb der EG, Düsseldorf 1990; Roth, Roland / Wollmann, Hellmut (Hrsg.): Kommunalpolitik. Politisches Handeln in der Gemeinde, Opladen Robert, R Parteienfinanzierung in Deutschland (Sowi Sek I/II: A2; EW: D3; LB Ges.: B1) Zeit: Do Raum: R. 301 Beginn: 1. Vorlw. Es werden folgende Themen behandelt: 01. Parteienfinanzierung, Parteienstaat und Grundgesetz 02. Parteienfinanzierung im Überblick - Die Rechenschaftsberichte der Parteien 03. Parteienfinanzierung durch Mitgliedsbeiträge 04. Parteienfinanzierung durch Spenden 05. Parteienfinanzierung durch direkte Staatsfinanzierung 06. Parteienfinanzierung und Abgeordnetenentschädigung 07. Parteienfinanzierung durch Abgaben der Mandatsträger 08. Parteienfinanzierung und Fraktionen 09. Parteienfinanzierung und Parteistifungen 10. Parteienfinanzierung und Öffentliche Kontrolle Das Seminar wendet sich an Studierende im Grundstudium. Erwartet wird neben der 18
19 Proseminare Deutsche Innenpolitik regelmäßigen Teilnahme an der Lehrveranstaltung die Bereitschaft, sich systematisch in die umfangreiche Literatur einzuarbeiten. Insbesondere gilt es, sich mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vertraut zu machen. Zum Schein-erwerb ist die Anfertigung eines Referates ggf. auch einer Hausarbeit erforderlich. Literatur: Arnim, Hans Herbert von: Die Partei, der Abgeordnete und das Geld. Parteienfinanzierung in Deutschland, München 1996; Empfehlungen der Kommission unabhängiger Sachverständiger zur Parteienfinanzierung, Febr. 1992, BTags-Drucks. 12/4425; Horn, Robert: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung, Giessen 1991; Klee-Kruse, Gudrun: Öffentliche Parteienfinanzierung in westlichen Demokratien, Frankfurt/M. u.a. 1993; Schütte, Volker: Bürgernahe Parteienfinanzierung, Baden-Baden Rummelt, P Auf der Suche nach den blühenden Landschaften (Exkursion nach Sachsen-Anhalt) (Sowi Sek I/II: A2; EW: C2; LB Ges.: B1) Zeit: Mi Raum: Spiegelsaal Beginn: 1. Vorlw. Blühende Landschaften in den neuen Bundesländern hatte der Bundeskanzler nach der Einheit binnen kurzer Zeit versprochen. Inzwischen hat er selbst eingeräumt, daß dies eine etwas vorschnelle Prognose war. Gleichwohl wurde und wird mit Milliarden Investitionen versucht, das als Aufschwung Ost apostrophierte Wirtschaftsprogramm zum Blühen zu bringen. Dieses Seminar erschöpft sich nicht nur in der theoretischen Reflexion des bis dato erreichten status quo in den neuen Bundesländern, sondern durch die 4-tägige Exkursion nach Magdeburg sollen vertiefende Alltags-Einblicke in den real-existierenden Kapitalismus in Sachsen-Anhalt ermöglicht werden. Dabei sollen unterschiedliche Politikfelder in Augenschein genommen, verarbeitet und unter speziellen Fragestellungen analysiert werden. Einzelheiten der Exkursion werden in der 1. Vorbereitungssitzung bekanntgegeben. Aufgrund der begrenzten Unterbringungskapazitäten liegt die Höchstteilnehmerzahl bei 15 Studenten. Ein noch zu beziffernder finanzieller Eigenanteil für Unterkunft und Verpflegung ist Teilnahmevoraussetzung. Woyke, W Das politische System Deutschlands (für ERASMUS / SOKRATES - Studierende) (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Mo Raum: R. 313 Beginn: 1. Vorlw. 19
20 Proseminare Außenpolitik / Internationale Politik Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an ausländische Studenten und Studentinnen, insbesondere aus dem Erasmus/Socrates- und Tempus-Programm. Es werden die Grundzüge des politischen Systems - vor allem Bundesstaat, Rechtsstaat, Sozialstaat, Parteiendemokratie, Mediensystem und öffentliche Meinung, - ebenso untersucht wie ökonomische Grundlagen und die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Auch ist eine Exkursion zum Deutschen Bundestag und eventuell anderer Behörden geplant wie auch der Besuch anderer praxisrelevanter Einrichtungen. Literaturempfehlung: Uwe Andersen/Wichard Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, Opladen van den Boom, D. Außenpolitik / Internationale Politik Topics of international politics (Veranstaltung in englischer Sprache) (Sowi Sek I/II: A3) Zeit: Di Raum: Spiegelsaal Beginn: 2. Vorlw. The troubles in Bosnia - the future of the United Nations - prospects of European integration - the political situation in Russia and the implications - the Middle-East-peace process and the current stalemate - Northern Ireland and the new Labour government - Iran, Iraq, Turkey and the question of "islamic fundamentalism" - New hope for Africa after the end of the cold war? - Germany's foreign policy... These are some of the topics we will discuss in this seminar - in English! Everyone who wants to practise (and maybe improve?) his or her English is invited. To obtain a "Schein" it is necessary to introduce one of the topics to the seminar and to write a paper about it (in English as well, of course!). Ernst, J Non-Profit-Organisationen als politische Akteure (Sowi Sek I/II: A2,3) Zeit: Mo Raum: Spiegelsaal Beginn: 2. Vorlw. Kurzkommentar: In diesem Seminar soll die Rolle nichtstaatlicher, gemeinnütziger Organisationen im politischen Kräftespiel analysiert werden. Dabei stehen solche Organisationen im Mittelpunkt der Betrachtung, die sich in den Politikfeldern Menschenrechte, Umweltschutz oder Entwicklung engagieren. Hierzu zählen beispielsweise Amnesty International, World Wide Fund for Nature, Terre des Hommes und 'Brot für die Welt'. Die Gründungsmotive und Strukturmerkmale der Organisationen sollen aufgezeigt werden. Des weiteren wird anhand von Fallbeispielen zu klären sein, mit welchen Mitteln die Non-Profit-Organisationen ihre Ziele bzw. Interessen durchzusetzen versuchen und ob sie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. 20
21 Proseminare Außenpolitik / Internationale Politik Für den Scheinerwerb ist die Übernahme eines Referats und die Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit erforderlich. Einführende Literatur: Alemann, Ulrich von: Organisierte Interessen in der Bundesrepublik. Opladen 1987; Glagow, Manfred: Zwischen Markt und Staat: Die Nicht-Regierungsorganisationen in der deutschen Entwicklungspolitik. Bielefeld S ; Thränhardt, Dietrich: "Abenteuer im Heiligen Geiste". Universalistische Wohlfahrtskampagnen der Kirchen und der Aufbau sozialmoralischer Einstellungen. In: Thomas Rauschenbach, Christoph Sachße u. Thomas Olk (Hrsg.): Von der Wertgemeinschaft zum Dienstleistungsunternehmen. Jugend- und Wohlfahrtsverbände im Umbruch. Frankfurt/M S ; Thränhardt, Dietrich: Globale Probleme, globale Normen, neue globale Akteure. In: Politische Vierteljahresschrift. 33. Jg. 2/1992. S Frantz, Chr Ost-Erweiterung der EU - Testfall Polen (Sowi Sek I/II: A3) Blockseminar (siehe Aushang) Mit dem Ablauf des Jahres 1997 scheinen die entscheidenden Weichen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der ersten osteuropäischen Staaten mit der EU gestellt: Der Amsterdamer Gipfel, die Berichte der Europäischen Kommission zur Integrationsfähigkeit der osteuropäischen Beitrittskandidaten und die Regierungskonferenz in Luxemburg haben hier die wichtigen Eckpunkte gesetzt. Das Blockseminar wird versuchen, diese Eckdaten der Osteuropa-Politik der EU in politikwissenschaftlichen Zusammenhang mit den Fortschritten der politischen Konsolidierung in Polen zu setzen und einen weiteren Bogen zu schlagen zur Interdependenz der EU- und der NATO-Osterweiterung aus der Sicht Polens. Wenn möglich, sollen für das Blockseminar auch auswärtige Referenten gewonnen werden, da das Seminar vom Mai auch als Rahmen sein wird für das Symposium im Sommersemester der Forschungsgruppe Osteuropa am IfPol. Eine Fortsetzung im Wintersemester ist angedacht. Da die Bedingungen zum Scheinerwerb im Rahmen einer solchen Veranstaltung besonders angepaßt werden müssen, entnehmen Sie bitte die weiteren Planungen, den genauen Verlaufsplan und entsprechende Vorhinweise den aktuellen Aushängen Anfang März. Termine: Vorbesprechungen am Freitag den 17. und 24. April 1998 von 14:00-17:00 in Raum 201 (Spiegelsaal) Seminar vom Mai
22 Proseminare Außenpolitik / Internationale Politik Harris, P Das Politische System der Vereinigten Staaten (Veranstaltung in englischer Sprache) (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Di 9-11 Raum: Sch 5 Beginn: 2. Vorlw. Gegenstand des Seminars ist die systematische Analyse des politischen Systems der Vereinigten Staaten von Amerika. Welche Funktion hat der Präsident? Welche Kompetenzen haben Senat und Repräsentantenhaus? Auf welchen geistig-philosophischen Grundlagen beruht die amerikanische Demokratie? Was unterscheidet die 'Neue Welt' von Europa und Deutschland? Warum ist der Einfluß der politischen Parteien in Europa größer als in den Vereinigten Staaten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt meines Seminars. Eingeladen sind alle, die sich für die Vereinigten Staaten interessieren. Unterrichtssprache ist Englisch. Hunger, U Globalisierung, Arbeitsmarkt und Migration (Sowi Sek I/II: A2,3; EW: C1; LB Ges.: B1) Zeit: Do Raum: R. 301 Beginn: 2. Vorlw. Die Globalisierung ist eines der meist diskutierten sozioökonomischen Phänomene der Gegenwart. Wenngleich die Internationalisierungstendenzen mittlerweile nahezu alle Lebensbereiche erfaßt haben, so stehen doch die Entwicklungen auf wirtschaftlichem Gebiet im Mittelpunkt des Interesses, hier vor allem die Globalisierung des Güter- und Kapitalmarktes. Staatsgrenzen verlieren im internationalen wirtschaftlichen Austausch an Bedeutung, und sowohl Kapital als auch Güter können immer einfacher in andere Länder transferiert werden. Welche Einflüsse dies auf die verschiedensten Bereiche der Ökonomie und des täglichen Lebens hat, gilt als Kardinalfrage der (Politischen) Wissenschaft des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts. Der Arbeitsmarkt schien von all diesen Entwicklungen weitgehend unberührt zu bleiben und nach wie vor in nationalstaatlichen Kategorien zu funktionieren. Er wurde im Vergleich zum Güter- und Kapitalmarkt in sehr viel geringerem Maße von Internationalisierungsprozessen erfaßt, so daß die Überschreitung der Grenzen für Kapital und Güter noch immer einfacher ist als für Menschen. Dennoch ist in den letzten Jahren eine zunehmende internationale Vernetzung auch in diesem Bereich zu verzeichnen. Vor allem in höheren Arbeitsmarktsegmenten können Arbeitskräfte relativ problemlos grenzüberschreitend tätig werden. Aber auch in unteren Arbeitsmarktsegmenten haben sich in den letzten Jahren verschiedenartige Wanderungsbewegungen ergeben. Das Seminar will sich mit der Frage beschäftigten, welche Konsequenzen der Prozeß der Globalisierung speziell auf die verschiedenen Bereiche des Arbeitsmarktes und die zukünftige Bedeutung von Arbeitskräftewanderungen haben wird. Ein detaillierter Themenplan und eine Liste mit der einschlägigen Literatur wird zu Beginn des Sommersemesters bekanntgegeben. 22
23 Proseminare Außenpolitik / Internationale Politik Koppe, K Krieg und Frieden in den Neunzigern (Sowi Sek I/II: A1,3; EW: C1,2) Zeit: Do 13:30-16:00 Raum: Spiegelsaal (14-tägig) Beginn: 1. Vorlw. Beim Versuch, die Ursachen für die Gewalteruptionen nach dem Ende des Kalten Krieges zu benennen, wird meist auf klassische Szenarien zurückgegriffen, wie sie im 19. und bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts die Regel zu sein schienen: Nationalistisch und/oder ideologisch begründete Macht- und Territorialansprüche, weltweite Ressourcensicherung, nationale Unabhängigkeitsbestrebungen, koloniale Befreiungskriege und als Höhepunkt die Ost-West-Konfrontation bis an den Rand eines Atomkrieges. Die möglicherweise hinter den Konflikten der neunziger Jahre stehenden Verelendungstendenzen und politischen Umbrüche, obschon auf dem Balkan, in Osteuropa und in Afrika deutlich erkennbar, wurden bei präventiven Maßnahmen und militärischen Interventionen kaum gewürdigt. Humanitäre Hilfen erweisen sich ebenso wie Entwicklungszusammenarbeit als Tropfen auf heißen Steinen. Die häufig als Schlüssel zur Konfliktbeendigung angebotene Hilfe zur Demokratisierung kann nicht greifen, solange Menschen im Elend verharren und verhungern. Sie werden eher kriminellen oder fundamentalistischen Akteuren anheim fallen. Im Proseminar sollen diese Zusammenhänge aufgespürt und die Bedingungen für erfolgreiche Konfliktprävention und Friedensgestaltung erkundet werden, unter anderem am Beispiel des Bosnienkonflikts. Einführende Literatur: Calic, Marie-Jánine: Krieg und Frieden in Bosnien-Hercegowina, Frankfurt am Main Debiel, Tobias: Not und Intervention in einer Welt des Umbruchs. Zu Imperativen und Fallstricken humanitärer Einmischung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 33-34/1996, S (wird im Reader zur Verfügung gestellt). Elwert, Georg: Nicht ethnische sondern ökonomische Konflikte stehen hinter Kriegen, in: Dombrowski, Wolf (Hg.): Festschrift für Lars Clausen, Opladen 1996 (wird im Reader zur Verfügung gestellt). Koppe, Karlheinz: Der unerreichbare Frieden. Überlegungen zu einem komplexen Begriff und seinen forschungspolitischen Konsequenzen. AFB- TEXTE Nr. 1/95, Bonn Ders. Wenn die Vergangenheit zum Trauma wird - Bosnien zwischen Machtpolitik, Glaubenskampf und Verelendung, in: Ausweg aus dem Trauma? Berichte, Dokumente, Kommentare der Missionszentrale der Franziskaner, Heft 69, Bonn 1997 (wird im Reader zur Verfügung gestellt). Matthies, Volker (Hg.): Vom Krieg zum Frieden. Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung. Bremen Ders. (Hg.) Der gelungene Frieden. Beispiele und Bedingungen erfolgreicher friedlicher Konfliktbearbeitung. Matthies, Volker, Rohloff, Christoph, Klotz, Sabine: Frieden statt Krieg: Gelungene Aktionen der Friedenserhaltung und der Friedenssicherung 1945 bis Konzeptionelle Überlegungen und empirische Befunde. Reihe Interdependenz Nr. 21, Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn Meyers, Reinhard: Begriff und Probleme des Friedens. Opladen Senghaas, Dieter: (Hg.): Den Frieden denken. Si vis pacem, para pacem. Frankfurt am Main Ders. (Hg.): Frieden machen, Frankfurt am Main Stiftung Entwicklung und Frieden (Hauchler, Ingomar, Hg.): Globale Trends Fakten; Analysen, Prognosen, Frankfurt am Main Robert, R Der Nahe und Mittlere Osten - Grundlagen und 23
24 Proseminare Außenpolitik / Internationale Politik Strukturen (Sowi Sek I/II: A2,3; LB Ges.: B1,4) Zeit: Mi 9-11 Raum: Sch 2 (am im Sch 6) Beginn: 1. Vorlw. Folgende Themen werden behandelt: 01. Natürliche und historisch-sozio-ökonomische Grundlagen der Raumstruktur 02. Religionen, Sprachen und Völker 03. Politisches Denken im Zeichen von Kolonialismus, Unabhängigkeitsbewegung und Modernisierung 04. Legitimitäts- und Stabilitätsprobleme politischer Systeme 05. Regierungen, Parlamente, Parteien und Wahlen 06. Eliten- und Elitenwandel 07. Befreiungs- und Widerstandsorganisationen 08. Die Region als Wirtschaftsraum und Entwicklungsgebiet 09. Öl - Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung 10. Binnen- und zwischenstaatliche Migration 11. Frauenfrage und Islam 12. Wiederbelebung der islamischen Rechts- und Gesellschaftsordnung Das Seminar wendet sich Studierende, die sich erstmals mit der Region des Nahen und Mittleren Ostens befassen. Englische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung. Zum Scheinerwerb sind neben regelmäßiger Teilnahme an der Lehrveranstaltung die Anfertigung einer Hausarbeit und eines Referates Pflicht. Einführende Literatur: Steinbach, Udo / Robert, Rüdiger (Hrsg.): Der Nahe und Mittlere Osten Bd. 1: Grundlagen, Strukturen und Problemfelder, Opladen 1988; Koszinowski, Thomas und Hanspeter Mattes (Hrsg.): Nahost, Jahrbücher 1988 ff, Opladen 1989 ff; Aktueller Informationsdienst "Moderner Orient". Unterseher, L Lehren aus dem Jugoslawienkonflikt (Teil I) (Sowi Sek.I/II: A 1, 3) Blockseminar (siehe Aushang) Behandelt wird das Thema in vier Schwerpunkten: - Wissenschaftstheoretische Reflexion (Status von Lehren aus der Zeitgeschichte - insbesondere aus komplexen Vorgängen in benachbarten Regionen); 24
25 Proseminare Politische Theorie - Zur Genese des Konflikts (die inneren Widersprüche des jugoslawischen Modells, die Ereignisse von ); - Interessen relevanter Akteure (Slowenien, Kroatien, Serbien; USA und Staaten der EU); - Zur Rolle internationaler Institutionen. Termine: Der Termin für die Vorbesprechung wird am Informationsbrett ausgehängt 7. Mai 1998, 13:00-14:00, Raum: Blockseminar vom im Franz Hitze Haus Beckord, W. Politische Theorie Nationalismus (Sowi Sek.I/II: A1,2; EW: C1) Zeit: Do Raum: R.201 Beginn: 1. Vorlw. "Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern" (heute würde man! ergänzen: und Schwestern) / "Nichtswürdig die Nation, die nicht ihr alles freudig setzt an ihre Ehre" - bei dem Thema "Nation" folgt der Zitatenschatz überwiegend dem Muster der lyrischen Überhöhung. Ein lebensweiser Aphorismus "Jede Nation spottet über die andern, und alle haben recht", bildet schon eine deutliche Ausnahme. Mit einer gehörigen Portion Boshaftigkeit kommen wir der Wirklichkeit und dem Seminargegenstand näher: "Eine Nation ist eine Gruppe von Menschen, die durch einen gemeinsamen Irrtum hinsichtlich ihrer Abstammung und eine gemeinsame Abneigung gegen ihre Nachbarn geeint ist." Nation wird hier eben nicht als "sittliche Form" und "ethischer Imperativ" und auch nicht objektiv-lexikalisch bestimmt, sondern an den Knackpunkten der Schattenseite definiert. Ist der Nationalismus als "Mythos der Moderne" damit eine grundsätzlich böse Angelegenheit, wie die pädagogisch orientierte Literatur und die Physiognomien seiner Exponenten zu beweisen scheinen? Haben wir im vergleichenden Längs- und Querschnitt vielleicht auch positive Implikationen der Integrationsideologie Nationalismus zu verzeichnen? Oder gibt uns vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte die Moralität auf, von jedem Nationalrausch Abstand zu nehmen? Wie dem auch sei - die Zahl der möglichen Fragen scheint die der akzeptablen Antworten bei weitem zu übersteigen, was gemeinhin als Beweis für die Aktualität des Themas gelten kann. Die Themenschwerpunkte und die Vorgehensweise des Seminars werden in der ersten Sitzung festgelegt, die grundlegende Literatur wird in einem Handapparat zugänglich sein. 25
26 Proseminare van den Boom, D. Politische Theorie Der Anarchismus (Sowi Sek I/II: A1; EW: C1) Zeit: Di 9-11 Raum: R. 313 Beginn: 2. Vorlw. Der Anarchismus ist die politische Theorie und Handlungsanleitung, die in den bürgerlichen Köpfen den größten Schrecken verursacht. Die Bilder vermummter Steinewerfer und "Chaoten" werden automatisch mit dem Anarchismus in einen Topf geworfen, jeder, der randaliert, zerschlägt oder herumbrüllt, ist ein Anarchist. Dieses Vorurteil macht auch vor politikwissenschaftlicher Diskussion nicht immer Halt. Ziel dieses Seminars soll es daher sein, anhand der Grundlinien anarchistischen Denkens, einiger ausgewählter Biographien anarchistischer Denker und Akteure sowie diverser anarchistischer Spielarten (denn den Anarchismus gibt es gar nicht!) die Diskussion zu versachlichen und einen allgemeinen Überblick zu geben. Die Themen werden vom föderalistischen Anarchismus Proudhons über den Anarchoaktivismus Bakunins, den Individualanarchismus Stirners bis zum modernen amerikanischen Anarchokapitalismus der Libertarians gehen. Für den Erwerb eines Proseminarscheins sind ein Referat und eine Hausarbeit notwendig. Einführende Literatur: Lösche, Peter: Anarchismus, Darmstadt Hahn, K Ideengeschichtliche Grundlagen politisch - kultureller Identitäten repräsentativer deutscher Städte (Sowi Sek I/II: A1) Zeit: Mi Raum: R. 313 Beginn: In diesem Seminar werden politische Ideen der Neuzeit in Bezug zur Frage der politisch-kulturellen Repräsentativität Berlins als deutsche Hauptstadt, der Frage nach Berlins politischen Identitäten, behandelt. Folgende Themenbereiche sind vorgesehen: I. Deutsche politische Ideengeschichte der Prämoderne und ihre Relevanz bzw. Irrelevanz für die Markt- und Hansestadt Berlin, die Mark Brandenburg und Preußen. II. Der poltische Calvinismus in Holland und Deutschland sowie seine legitimationstheoretische und politisch-kulturelle Bedeutung für Berlin seit dem Großen Kurfürsten einschließlich der politisch-kulturellen und religionssoziologischen Bedeutung der Immigration der Hugenotten. III. Die Revolution des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelms I. IV. Hobbes politische Theorie und das ideengeschichtliche wie politische-kulturelle Umfeld des aufgeklärten Absolutismus und Despotismus Friedrichs II. V. Die Berliner Aufklärung und ihre politisch-kulturelle Relevanz unter besonderer Berücksichtigung der jüdischen Aufklärung Moses Mendelssohns. VI. Das politische Denken der klassischen deutschen Philosophie in seiner Relevanz für die Idee der Nation und den preußischen Staatsgedanken. 26
27 Proseminare Politische Theorie VII. Das ideengeschichtliche Umfeld der Reformpolitik in Preußen unter besonderer Berücksichtigung des Freiherrn vom Stein. VIII. Die Berliner Romantik und ihre politiktheoretische und politisch-kulturelle Bedeutung. IX. Die ideengeschichtlichen und politisch-kulturellen Grundlagen des deutschen Dualismus sowie des Berlin-Wien- (Berlin-München-) Antagonismus. X. a) Die ideengeschichtlichen und legitimationstheoretischen Grundlagen der Reichsgründung sowie ihre politisch-kulturellen und sozio-ökonomischen Auswirkungen auf Berlin als Reichshauptstadt. X. b) Berlin in ideen- und geistes- sowie kulturgeschichtlicher Perspektive von der Reichsgründung bis XI. Berlin und der Antisemitismus sowie Nationalsozialismus in ideen- oder vielmehr ideologiegeschichtlicher Perspektive. XII. Der ideologische Antagonismus Berlin/West - Berlin/Ost und seine politischekulturelle Auswirkungen hinsichtlich der politischen Identitäten der Berliner. XIII. Fragen an Berlins Zukunft: Berlin - Euroland-Metropole? Einführende Literatur: Rolf Hellmut Foerster: Die Rolle Berlins im europäischen Geistesleben, Berlin 1968; OSI (Hrsg.): Berlin. Brennpunkt deutschen Schicksals, Berlin Hoffschulte, H Lokale und regionale Selbstverwaltung in Mittel- und Ost-Europa - Aspekte der Demokratisierung von unten (Sowi Sek I/II: A2,3; LB Ges.: B1) Blockseminar (siehe Aushang) Demokratisierung kann sich auch in den Ländern Mittel- und Ost- Europas (MOE- Staaten) nicht in der gelegentlichen Wahl eines Staatspräsidenten und - alle vier oder fünf Jahre - des jeweiligen nationalen Parlaments erschöpfen. Der Strukturwandel der ehemaligen Länder des Warschauer Paktes und der anderen kommunistischen Staaten ist offenbar erst durch eine tiefgreifende Demokratisierung an der Basis, also in den Kommunen, möglich. Alle MOE-Staaten drängen in den EUROPARAT, der deshalb heute 40 Mitglieder zählt. Und alle verpflichten sich (mehr oder weniger konkret), als Voraussetzung der Mitgliedschaft, dessen noch relativ junge Charta der kommunalen Selbstverwaltung vom Oktober 1985 zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Das aber bedeutet für diese neuen Demokratien einen fundamentalen Wandel im Verfassungs- und Kommunalverfassungsrecht. Im Sinne einer echten Selbstverwaltung der Städte, Gemeinden und - wo sie geschaffen werden - der Kreise ist es ein weiter Weg bis zur tiefgreifenden Demokratisierung von unten nach oben. Die Kommunal- (und Regional-) Gesetze haben, so formulierte es der Vorsitzende des innenpolitischen Ausschusses des russischen Parlaments (der Duma), missionarischen Charakter. Besondere Bedeutung erhielten in diesem Zusammen- 27
28 Proseminare Vergleichende Politikwissenschaft hang das seit Maastricht auch in den Verfassungsverträgen der EU verankerte Prinzip der Subsidiarität. Das Hauptseminar versucht eine Einführung in diese weite Thematik der Reform der MOE-Staaten aus den Erfahrungen des Europarates seit der Wende und im Vergleich zu der Entwicklung kommunaler und regionaler Selbstverwaltung in den EU- Mitgliedstaaten. Termine: Vorbesprechung am (Raum und Zeit siehe Aushang) Blockseminar am 17. und Vergleichende Politikwissenschaft Reef, J Einführung in die politische Landeskunde der Niederlande (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1; LB Ges.: B1,4) Zeit: Di Raum: R im Haus der Niederlande Beginn: 1. Vorlw. Ausgehend vom Begriff der politischen Kultur, wird in diesem Seminar das politische System der Niederlande, worunter sämtliche im Zusammenhang stehenden Elemente und Ebenen der Politik zu verstehen sind, analysiert. Die Staatsorgane, Institutionen und Akteure werden bezüglich deren Stellung und Handlungen in diesem System sowie im Hinblick auf die Normen und Werte, an die sie gebunden sind bzw. sich gebunden fühlen, behandelt. Eine komparatistische Methode, die den Vergleich mit den entsprechenden Organen in der Bundesrepublik vorsieht, soll eine transparente Darstellung der spezifischen Eigenschaften des niederländischen politischen Systems gewährleisten. Literatur:.Th.J. van den Berg/D.J. Elzinga/J.J. Vis: Parlement en politiek, Den Haag 1992; Becker (red.): Maatschappij, macht, Nederlandse politiek, Amsterdam Reef, J Die Niederlande als Kleinstaat im internationalen System (Sowi Sek I/II: A2,3) Zeit: Do Raum: R im Haus der Niederlande Beginn: 1. Vorlw. Die Außenpolitik eines Staates wird nicht nur durch äußere Konstellationen und internationale Machtgefüge bestimmt, sondern daneben auch durch seine innere Situation. Historische Entwicklungen und Erfahrungen auf politischem, wirtschaftlichem, religiösem und kulturellem Gebiet haben ebenfalls beträchtlichen Einfluß auf die Art und 28
29 Proseminare Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik Weise, wie ein Staat sich in der internationalen Politik verhält. In diesem Zusammenhang spielt das Bewußtsein um den eigenen Status - sieht man sich selbst als Großmacht, Mittel- oder Kleinstaat - eine nicht zu unterschätzende Rolle. Vor diesem Hintergrund soll die niederländische Außenpolitik daraufhin untersucht werden, ob sie Strategien enthält, die als typisch für Kleinstaaten kategorisiert werden können. Sofern dieses der Fall sein sollte, stellt sich die Frage, inwieweit diese Strategien dem Bewußtsein um die eigene (relativ schwache) Stellung im internationalen System entsprungen sind. Ferner ist zu untersuchen, wie erfolgreich sie waren bzw. sind. Literatur: CAMPEN, S.I.P. VAN, The Quest of Security. Some Aspects of Netherlands Foreign Policy , Den Haag 1958; LEURDIJK, J.H. (Hrsg.), The Foreign Policy of the Netherlands, Alphen a.d. Rijn 1978; STADEN, A. VAN, Een trouwe bondgenoot: Nederland en het Atlantisch Bondgenootschap , Amsterdam 1974; VOORHOEVE, J.J.C., Peace, Profits, Principles - A Study of Dutch Foreign Policy, Leiden 1985; D. HELLEMA, Buitenlandse politiek van Nederland, Utrecht Santel, B Chance oder Ballast? Einwanderung in Europa und Nordamerika (Sowi Sek I/II: A2,3; EW: C1) Zeit: Mo Raum: R. 301 Beginn: 2. Vorlw. Einwanderung gehört zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Wie gehen demokratische Staaten mit diesem Thema um? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Welche Gefahren drohen? Sowohl Einwanderungs- als auch Einwandererpolitik unterliegen einem Prozeß ständiger Anpassung und Reformulierung. Verschärfungen der Aufnahme- und Aufenthaltsbedingungen für bestimmte Gruppen stehen Öffnungsprozesse bei anderen gegenüber, ohne daß ein einheitlicher Trend erkennbar wäre. Zweck dieses Beitrags ist es, die Einwanderungssituation in Deutschland und den Vereinigten Staaten in vergleichender Perspektive zu untersuchen, wobei besonderes Augenmerk auf neuere Entwicklungen gelegt wird. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, daß die Politiken beider Staaten wesentlich mehr Gemeinsamkeiten aufweisen als zumeist angenommen wird. Tillmann, B. / Funke, S. Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik Von der Kommunalverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsverbund - Teil 2: Markt statt Stadt? - Wirtschaftliche Betätigung, Outsourcing, Privatisierung (Sowi Sek I/II: A2; LB Ges.: B1) Zeit: Mo Raum: Stadtverwaltung / Stadtweinhaus Beginn: Gegenwärtig wird im Rahmen der Verwaltungsreform im kommunalen Bereich einerseits eine Rückbesinnung auf die klassischen Prinzipien der kommunalen Politik im 29
30 Proseminare Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft deutlich; andererseits gewinnen eher betriebswirtschaftliche Optionen im Hinblick auf eine erweiterte wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, der Privatisierung von Aufgaben und des sog. Outsourcings bestimmter Leistungen zunehmend Gewicht. Auf Grund des erheblichen finanziellen Drucks und der damit verbundenden Aufgabenkritik, wird in der kommunalpolitischen Praxis das dahinterstehende, zukunftsgerichtete Reformpotential nicht hinreichend ausgeschöpft: denn sowohl eine konsequente Umsetzung des ordnungspolitischen Prinzips des Subsidiarität, als auch eine ordnungspolitisch saubere Arbeitsteilung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor bieten gerade auf kommunaler Ebene erhebliche Chancen zu einer Weiterentwicklung bzw. Wiederbelebung der klassischen Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung als Partizipationsfeld für die Bürger und als Dienstleistungsorientierung für die Kommunalpolitik und -verwaltung. Diese Reformperspektive kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn der gegenwärtige Prozeß der kommunalen Verwaltungsreformen im engeren Sinne konzentriert wird. Das 2-semestrige Proseminar soll die beiden Schwerpunkte politisch-administrativbürgerschaftlicher/wirtschaftlicher Arbeitsteilung an konkreten Beispielen herausarbeiten. Im Teil I des Seminars soll der subsidiäre Zusammenhang vor allem an den Feldern des Sozial-, Jugend- und Kulturpolitik herausgearbeitet werden. Im Teil II soll der (betriebs-)wirtschaftliche Zusammenhang im Vordergrund stehen, der sich aus den Möglichkeiten und Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen ergibt. Das Seminar wird jeweils eingeleitet durch eine einführende Darstellung der relevanten Rahmenbedingung. Die inhaltlichen Schwerpunkte sollen jeweils im Rahmen eines Wochenend-Workshops (in Teil II: 19./20. Juni 1998) vertieft werden, zu dem jeweils durch die Seminarteilnehmer und durch externe Referenten Impulsreferate vorgesehen sind. Dem Teilnehmer/innen-Kreis steht für die beiden Seminare ein thematisch sortierter Handapparat zur Verfügung, der auch zusätzliche Literaturempfehlungen enthält. Der Seminarablauf im ist dem beiliegenden Ablaufplan zu entnehmen. Dieser Seminarteil setzt die Teilnahme am Teil I: Bürger statt Bürokratie? nicht voraus. Temine: Datum Phase Schwerpunkte Einführung in die Thematik, Bildung von Arbeitsgruppen Grundlagenphase Kommunale Selbstverwaltung und Aufgaben von Kommunalverwaltungen; Rechtliche Grundlagen und Erscheinungsformen der wirtschaftlichen Betätigung Akteure der Kooperation sowie Prinzipien im Spannungsverhältnis zwischen politischer und ökonomischer Rationalität bei der Aufgabenerfüllung durch kommunale Beteiligungsgesellschaften Erarbeitung der Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen: 30
31 Proseminare Entwicklungspolitik Projektphase Themenschwerpunkt 1: Verkehr (Stadtwerke Münster GmbH, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH) Themenschwerpunkt 2: Wohnen und Sozialer Wohnungsbau (Wohn+Stadtbau GmbH) Themenschwerpunkt 3: Infrastrukturbereitstellung (Westfälische Bauindustrie GmbH) Themenschwerpunkt 4: Entsorgung (Abfallwirtschaftsbetriebe Münster) Themenschwerpunkt 5: Freizeit und Veranstaltungen (Westf. Zoolog.Garten Münster GmbH und Halle Münsterland GmbH) ( ) Auswertungsphase (Block) Impulsreferate, Diskussion und Vertiefung der Themenschwerpunkte; Untersuchung vor dem Hintergrund der politischen und ökonomischen Anforderungen Entwicklungspolitik Herkendell, J Ausgewählte Themen der Umwelt- und Entwicklungspolitik (Sowi Sek I/II: A3; EW: C1,2; LB Ges.: B1) Zeit: Mi Raum: Sch 5 Beginn: 1. Vorlw. Die Themenschwerpunkte dieser Veranstaltung sind: -Teil I: Ressourcenzerstörung / Übernutzung Wasser, Boden, Wälder -Teil II: folgen der Urbanisierung / Metropolisierung. In Teil I werden die komplexen, vor allem sozialen, ökonomischen und umweltbezogenen Ursachen-Wirkungsgeflechte analysiert. Dabei werden die Ursachen-Folgewirkungen dieser Veränderungen vor dem Hintergrund der demographischen und sozioökonimischen sowie natürlichen Randbedingungen sowie die unterschiedlichen Formen der Boden- und Waldzerstörung / - degradierung, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, dargestellt. Auf die zunehmende Verschärfung des Problems begrenzter Trinkwasserverfügbarkeit wird ebenfalls eingegangen. Die Konsequenzen der derzeitigen Entwicklungstendenzen werden sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die Industrieländer aufgezeigt und die Möglichkeiten und Grenzen von wirksamen Maßnahmen diskutiert. Der Themenschwerpunkt II: Folgen der Urbanisierung / Metropolisierung behandelt insbesondere die Ursachen des Wachstums der städtischen Bevölkerung, die Migrationsund damit im Zusammenhang stehende Umweltproblematik, insbesondere das Problem der Ver- und Entsorgung der großstädtischen Gebiete, das Problem der Trinkwasser- 31
32 Proseminare Entwicklungspolitik versorgung, die in diesen Metropolen festzustellende hohe Schadstoffkonzentrationen in der Luft, das Problem der Überbauung und Versiegelung sowie der Lärmbelästigung der Bevölkerung. Die Möglichkeiten und engen Grenzen wirksamer Lösungen werden erörtert. Literaturhinweise zu den Themenblöcken werden zu Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Lagos, R Auswirkungen der Globalisierung auf Lateinamerika (Sowi Sek I/II: A1,3; EW: C2) Blockseminar (siehe Aushang) In dieser Veranstaltung werden folgende Themen behandelt: 1. Die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Dimension der Globalisierung 2. Die Herausforderungen der Globalisierung auf Lateinamerika 3. Die internationale Bedeutung Lateinamerikas 4. Wirtschaftspotential und Wirtschaftspolitik in Lateinamerika und die Globalisierung 5. Die Integrationsprozesse in Lateinamerika und die Weltwirtschaft 6. Die soziale Lage in Lateinamerika und die Konsequenzen der Globalisierung 7. Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Beziehungen Lateinamerikas mit der Europäischen Union, der NAFTA, u.a. Regionen. 8. Länderspezifische (z.b. Argentinien, etc.) und themenorientierte (z.b. Rolle der Kommunikations- und Dienstleisutungsgesellschaft) Hausarbeiten und Referate Beitrag: 50,- DM (inkl. 2 x Mittagessen, 2 x Abendessen, 4 x Kaffee und auf Wunsch 2 x Frühstück. Vegetarisch: bei Anmeldung im FHH am angeben.) Anmeldung. Während der Vorbesprechung oder danach telefonisch unter (02 28) bzw. schriftlich an: Dr. Ricardo Lagos, Botschaft von Honduras, Ubierstr. 1, Bonn. Termine: Vorbesprechung: , 14:00 Uhr, im Sch 2 Blockveranstaltung: (16:00 Uhr) bis (18:00 Uhr) im Franz Hitze Haus (FHH), Kardinal von Galen Ring 50, Münster. Methoden / Statistik 32
33 Proseminare Methoden / Statistik Bethusy-Huc, V Rhethorik für Politikwissenschaftler (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1) Blockseminar (siehe Aushang) Ausgehend von einer Einführung in verschiedene Kommunikationsmodelle werden im Mittelpunkt des Seminars praktische Übungen zu verschiedenen Rede- und Gesprächssituationen stehen. Themen: Aspekte der Kommunikation Regeln des Feedback Rede- und Vortragsgestaltung Logik und Psycho-Logik Argumentation und Manipulation Training des Sprechdenkens Bewerbertraining Die Termine der Veranstaltung werden am Informationsbrett ausgehängt Braun, D Lost in Hyperspace - Internet für PolitikwissenschaftlerInnen (Sowi Sek I/II: A2,3) Zeit: Mi Raum: CIP-Pool Beginn: 1. Vorlw. Internet, Multimedia, Informationsgesellschaft - sämtlich Schlagwörter und Themen der letzten Jahre, die zwar oft diskutiert werden, deren reale Umsetzung aber vielen noch weitgehend unbekannt ist. Gleichwohl entwickelt sich die Fähigkeit der elektronischen Kommunikation zunehmend zu einer Schlüsselqualifikation für viele Berufsfelder. In diesem Proseminar soll versucht werden, sowohl theoretische Grundlagen des Netzes der Netze zu erarbeiten als auch Nutzenpotentiale und Gefahrenpunkte zu diskutieren. Schwerpunkt des Seminars wird der praktische Umgang am PC mit den einzelnen Segmenten des Internets wie z.b. der gezielten Informationsbeschaffung via World- Wide-Web, -Kommunikation, Newsgroup-Nutzung oder auch des Online- Chatting und der Datenübertragung mittels FTP sein. Bedingung für den Erwerb eines Leistungsnachweises: Referat mit ausführlichem Thesenpapier oder Anfertigung einer Hausarbeit. Eine Themen-/Teilnahmeliste (begrenzte TeilnehmerInnenzahl) wird rechtzeitig ausgehängt. Windows-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Schmitz, H. 33
34 Proseminare Seminare zur Didaktik und Bildungspolitik Statistik II für Politikwissenschaftler Zuordnung Zeit: Di 15:30-17:00 Raum: Sch 3 Beginn: 2. Vorlw. Das Seminar baut auf die Veranstaltung aus dem Wintersemester 1997/98 auf und hat die schließende Statistik zum Gegenstand. Der Scheinerwerb erfolgt je nach Teilnehmerzahl über ein Referat mit anschließender Hausarbeit oder über eine Klausur. Seminare zur Didaktik und Bildungspolitik Meendermann, K Die Rechte der Kinder als Thema im Unterricht (Sowi Sek I/II: D2; EW: E1,2; LB Ges.: B1) Zeit: Di Raum: R.2030 (Fliednerstraße) Beginn: 2. Vorlw. Die Rechte der Kinder zu verwirklichen ist eine Aufgabe, die uns Pädagogen in besonderem Maße angeht. Grundlage bildet die 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete Konvention über die Rechte des Kindes. Ende Dezmenber 1995 haben 184 Staaten die Konvention ratifiziert bzw. sind ihr beigetreten. Die Konvention erkennt Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit spezifischen Bedürfnissen und Interessen an. Mit diesem veränderten Verständnis von Kindheit stehen Kindern grundlegende Menschenrechte zu. Dennoch: Kinderrechte werden weltweit verletzt - in Industrie- und Entwicklungsländern. Daher hat sich das Seminar das Ziel gesetzt, über die Konvention und über die Rechte der Kinder zu informieren und die Idee der Kinderrechte zu verbreiten. Dieses Seminar gibt dementsprechend Anregungen für eine kindgerechte Vermittlungsform. Es werden Wege aufgezeigt, wie in erfahrungs- und handlungsorientierten Lernprozessen Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit gegeben werden kann, ihre Rechte kennenzulernen und zu analysieren, diese aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und eigene Handlungsmöglichkeiten zur Verwirklichung ihrer und der Rechte anderer zu entwickeln. Meendermann, K Aufgabenfelder politischer Bildung und Erziehung in der Grundschule (Sowi Sek I/II: A2, D1; EW: C1,2, D2,3; LB Ges.: B1) Zeit: Di Raum: Spiegelsaal Beginn: 2. Vorlw. Die Vermittlung politischer Bildung und Erziehung zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Grundschule. In aktuellen Ansätzen der politischen Bildung und Erziehung, die den gewandelten Lebensbedingungen von Kindern Rechnung tragen, wird die politische Bildung in der Grundschule durchgängig in allen Fächern mit Hilfe von offenen Unterrichts- 34
35 Proseminare Seminare zur Didaktik und Bildungspolitik formen sowie explizit und schwerpunktmäßig im Sachunterricht umgesetzt. Dabei bestehen zwischen den pädagogischen Konzepten offener Unterrichtsformen, denen politisch-demokratische Intentionen zugrunde liegen und die sich gleichermaßen auf die Gestaltung von Unterricht und Schulleben beziehen, und dem Sachunterricht vielfälitige Bezüge. Das Anliegen dieses Seminars ist es, einzelne Themenfelder der politischen Bildung und Erziehung aufzugreifen und in umsetzbare Entwürfe für einen zeitgemäßen Unterricht zu überführen. Meendermann, K Lernwege entdecken: Konzepte für den sozialwissen-schaftlichen Unterricht (Sowi Sek I/II: D1,2; EW: E1,2,3; LB Ges.: D1,2,3,4) Zeit: Di 9-11 Raum: R (Fliednerstraße) Beginn: 2. Vorlw. Der Doppelauftrag von Schule, sowohl Unterrichts - als auch Erziehungsaufgaben zu erfüllen, gilt auch für den sozialwissenschaftlichen Unterricht. Dabei verweist der Begriff Unterricht primär auf die Vermittlung von Kenntnissen. Der Begriff der Erziehung zielt demgegenüber ab auf die Vermittlung sozialer Handlungsdispositionen und Verhaltensweisen. In der schulischen Praxis sind Unterricht und Erziehung nicht voneinander zu trennen. Beide Aufgabenbereiche beeinflussen sich wechselseitig. In Wissen, Können und Verhalten der Schülerinnen und Schüler haben sie ihre gemeinsamen Bezugspunkte. Auf diesen Zusammenhang weisen auch die Richtlinien für Sozialwissenschaften hin. Ausgangspunkt für die "Suche nach Lernwegen" ist demnach das einzelne Kind/der einzelne Jugendliche. Dieses Seminar, das sich mit Konzepten für den sozialwissenschaftlichen Unterricht befaßt, vermittelt Grundlagen im Bereich der Didaktik der Sozialwissenschaften. Es enthält neben der Vorstellung unterschiedlicher methodischer Konzepte auch Beispiele für die unterrichtliche Aufbreitung einzelner Themen und Inhalte aus dem schulischen Alltag. Meendermann, K Fachdidaktisches Tagespraktikum (LB Ges.: D1,2,3,4) (siehe Aushang) Meendermann, K Seminar zum Tagespraktikum (LB Ges.: D1,2,3,4) (siehe Aushang) 35
36 Hauptseminare Deutsche Innenpolitik Hauptstudium Hauptseminare Deutsche Innenpolitik Faulenbach, K Kommunales und regionales Kulturmanagement - Theorie und Praxis neuer Steuerungsmodelle in der Kultur (Sowi Sek I/II: A1,2; EW: C1,D2; LB Ges.: B1,C1) Zeit: Di Raum: R. 301 Beginn: Seit ca. 5 Jahren erproben Kommunen landauf landab neue Steuerungsmodelle in der Kultur. Sie sind z.t. Vorreiter in der Veränderung der Verwaltungspraxis. Die eingeführten Modelle unterscheiden sich durchaus in ihrer Organisationsform als auch in der Rechtsform. Sie zeigen auch unterschiedliche Ergebnisse. Neu angestoßen wurde vom Land Nordrhein-Westfalen die Bündelung der kommunalen Kulturpolitiken in regionalen Zusammenschlüssen. Dies wird eine zentrale Aufgabe der Zukunft sein, über den kommunalen Tellerrand hinaus Kulturpolitik, vergleichbar mit der Wirtschaftspolitik, in der gesamten Region zu betreiben. Dieses Seminar versucht vor allen Dingen, praktische Erfahrungen aus den Kommunen einzubringen und die Vor- und Nachteile der neuen Steuerung zu dokumentieren. Frey, R Parlamentarismus in Deutschland (Sowi Sek I/II: A2; LB Ges.: B1) Zeit: Mo Raum: R. 313 Beginn: Die parlamentarische Demokratie der Bundesrepublik Deutschland bedarf nicht nur eines Konsenses über Rechtsnormen, sondern auch funktionsfähiger Institutionen, um als Staat und soziale Gemeinschaft existenzfähig zu bleiben. Für eine gesellschaftliche Reformfähigkeit ist deshalb ein ausbalanciertes Verhältnis von Wertvorstellungen und parlamentarischem Verfahren Grundvoraussetzung. Das Hauptseminar legt sich die Frage vor, inwieweit bestehende parlamentarische Institutionen auf gewandelte gesellschaftliche Normvorstellungen noch angemessen zu reagieren vermögen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen dabei Fraktionen der Parlamente, und zwar nicht nur auf Bundesebene, sondern auch gerade in den neuen Bundesländern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beurteilung der Verbandstätigkeit im parlamentarischen Prozeß. Bedarf der Parlamentarismus in Deutschland einer zunehmenden Demokratisierung? Gerlach, I. / Zimmer, A. 36
37 Hauptseminare Deutsche Innenpolitik Die Prinzen sind die Thronfolger? - Strategien und Wege der Frauenförderung (Sowi Sek I/II: A2; EW: C2; LB Ges.: B2) Blockseminar am im Alexander von Humboldt-Haus, Hüfferstr. (siehe Aushang). Frau-Sein ist nach wie vor ein Arbeitsmarkthindernis. Trotz kontinuierlichen Anstiegs der Erwerbsquoten von Frauen sind die Machthierarchien in den Unternehmen und Organisationen der Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung veränderungsresistent. Aktive Frauenförderung versucht, hier anzusetzen und Bewegung in die geschlechtsspezifische Segmentierung des Arbeitsmarktes zu bringen. Doch wie sieht die Erfolgsbilanz der Frauenförderung aus? Und was wird aktuell in Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung in Deutschland und in ausgewählten EU-Ländern unternommen, um die Sache der Gleichberechtigung und Chancengleichheit voranzubringen. Diese Fragestellungen werden im Rahmen der Veranstaltung/Tagung von Expertinnen kritisch beleuchtet. Es wird zunächst ein Überblick über Stand und Entwicklung der Frauenförderung gegeben. Daran anschließend werden Praxisfelder der Frauenförderung vorgestellt sowie auf nationaler wie EU-Ebene die Steuerungspotentiale der Politik ausgelotet. Teilnahme an den Vor- und Nachbereitungsgesprächen, der Tagung sowie Anfertigung einer Hausarbeit sind Voraussetzung für den Scheinerwerb. Programm: Freitag, h Ein Jahrzehnt Frauenförderung: Viel passiert und nichts bewegt? Dr. Angelika Wetterer, Bochum/Kassel (angefragt) 11.15h Frauenförderung an der Hochschule Prof. Dr. Ayla Neusel, Universität Gesamthochschule Kassel 12.30h h Mittagspause 14.00h It s a Man s World? - Frauenförderung in der Wirtschaft Juliane Freifrau von Friesen, Vereinigte Energiewerke AG, Berlin 15.15h Frauenförderung in den Medien Rita Zimmermann, Gleichstellungsbeauftragte des WDR, Köln h Kaffeepause 17.00h Frauen im modernen Banking Frau David, Commerzbank Frankfurt (angefragt) 18.15h Frauenförderung in der öffentlichen Verwaltung Dr. Elke Wiechmann, Universität Marburg (angefragt) Samstag, h Gleichstellungspolitik in Nordrhein- Westfalen: Ziele, Strategien, Erfahrungen Ilse Ridder-Melchers, Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 11.15h Die Gleichstellungspolitik der Europäischen Union 37
38 Hauptseminare Deutsche Innenpolitik Soledad Blanco, Referat Chancengleichheit der Europäischen Kommission, Brüssel (angefragt) 12.30h A comparison of positive action programs in the European Union Dr. Attie de Jong (angefragt) 13.30h Ende der Tagung Termine: Vorbereitungsgespräch: 20. April Uhr im Tagung: Juni Nachbereitungsgespräch: 29. Juni Uhr im Literatur: Cordes, Mechtild, 1996: Frauenpolitik. Gleichstellung oder Gesellschaftsveränderung?, Opladen: Leske + Budrich; de Jong, Attie/Bock, Bettina, 1995: Positive Action within the European Union, in: van Doorne-Huiskers, Anneke/van Hoof, Jacques (Hrsg.): Women and the European Labor Markets, London; S ; Gerhard, Ute (Hrsg.), 1997: Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München: Beck ; Schunter-Kleemann, Susanne (Hrsg.), 1990: EG-Binnenmarkt - EuroPatriachat, Schriftenreihe der Wissenschaftlichen Einheit Frauenstudium und Frauenforschung an der Universität Bremen, Bd. 2; Wetterer, Angelika, 1994: Rhetorische Präsenz - faktische Marginalität. Zur Situation von Wissenschaftlerinnen in Zeiten der Frauenförderung, in: Zeitschrift für Frauenforschung, Heft 1+2, S ; Wiechmann, Elke/Kißler, Leo, 1997: Frauenförderung zwischen Integration und Isolation, Berlin: Sigma Gerlach, I Kommunen unter neuer Steuerung - Effizienz und Demokratie als Eckpunkte eines Spannungsverhältnisses (Sowi Sek I/II:A2; Lb Ges.: B1) Zeit und Raum: Beginn: 2. Vorlw. Di im Sch 3 und Fr 9-11 im Spiegelsaal Informationen zu diesem Seminar werden am Informationsbrett ausgehängt. Keim, W Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Spiegel der Karikatur (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Di Raum: F 6 Beginn: 2. Vorlw. Karikaturen sind Zeitzeugen, Zeitdokumente, Bekenntnisse von Zeitgenossen. Sie dienen dem gesellschaftlichen Zweck der Kritik. Vor allem durch ihre jeweilige Aktualität, ihre satirische Qualität und Ethik sind sie eng mit den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ereignissen und Prozessen in einem Land verbunden, werden 38
39 Hauptseminare Deutsche Innenpolitik Akteure und Strukturen verdeutlicht. Ziel des Seminars ist die Darstellung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Spiegelbild der Karikatur, verbunden mit Analysen zum Wesen und zur Wirkung der Bildsatire. Röper, E. / Wittkämper G. W Das Parlament in der (deutschen) Verfassungsordnung (Sowi Sek I/II: A2; LB Ges.: B1) Zeit: Samstags Raum: 313 Beginn: Im demokratischen Verfassungsstaat hat das Parlament die zentrale Stellung; seine Mitglieder repräsentieren das Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht (Art. 20 Abs. 2 Satz 1, 38 Abs. 1 Satz 2 GG) im Bund, in Ländern und Gemeinden (Art. 28 Abs. 1 Sätze 1,2, GG). In der Verfassungswirklichkeit der BRD/Deutschland verschieben sich die Gewichte jedoch zugunsten der Exekutive; die (Verfassungs-)Gerichte müssen zunehmend notwendige zusätzliche Kontrollaufgaben übernehmen. Ein wichtiger Grund ist die Überbetonung der parlamentarischen Legislativfunktion gegenüber der des Forums der und für die Bevölkerung sowie von Kreation und Kontrolle der Regierung. Zum Verständnis des Verhaltens der Akteure auf der politischen Bühne sind die Beurteilung der komplexen Verfassungsordnung und ihre Bezüge zum sich vereinigenden Europa unverzichtbar. Daran soll im Hauptseminar gearbeitet werden. Winkel, O Politik und Verwaltung in der digitalisierten Informationsgesellschaft (Sowi Sek I/II: A1,2; EW: C2; LB Ges.: B1,3) Zeit: Fr (14-tägig) Raum: R.301 Beginn: 2. Vorlw. Telematik steht für die digitale Synthese der Verarbeitung und Übertragung von Daten, Text, Bild und Sprache in der Individualkommunikation. Telematische Anwendungen durchdringen die Gesellschaft stärker und tragen mehr zu ihrer Veränderung bei als alle anderen vorausgegangenen technischen Innovationen. Mit der zunehmenden Verbindung von Individualkommunikation und Massenkommunikation bilden sich zudem multimediale Anwendungen heraus, die diesen Prozeß noch verstärken und die überkommenen Kategorien von Öffentlichkeit und Privatheit zur Disposition stellen. Im Hauptseminar sollen mit Blick auf ausgewählte Problemfelder Überlegungen darüber angestellt werden, welche Chancen, Risiken und Herausforderungen aus diesen Entwicklungen für Politik und Verwaltung erwachsen. Am Anfang stehen die Untersuchung der Steuerungsprobleme, die aus der durch informationstechnische Innovationen mitverursachten gesellschaftlichen Globalisierung und Ausdifferenzierung resultieren, und die Erörterung der Frage, ob und inwieweit multimediale Systeme in den Bereichen von Politik und Verwaltung im Gegenzug neue Handlungsräume und Lösungswege eröffnen können. In diesen Rahmen fällt neben der Analyse von Chancen und Risiken virtueller politischer Kommunikation ( Cyberdemokratie ) auch die Diskussion um die Verwaltungsmodernisierung, wobei das Bürgeramtsmodell und New Public Management zwei unterschiedliche Ansätze darstellen, die auf eine 39
40 Hauptseminare Deutsche Innenpolitik organisatorische Umgestaltung der Kommunalverwaltung unter Ausnutzung moderner informationstechnischer Potentiale abzielen. Wirtschaftspolitik, Standortpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Technologiepolitik (einschließlich unterschiedlicher Varianten der Technikfolgenabschätzung) im multimedialen Zeitalter bilden einen weiteren Themenblock der Veranstaltung. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit die Entwicklung und Nutzung der elektronischen Netzwerke inzwischen zum Gegenstand der internationalen und transnationalen Politik und der entsprechenden Bürokratien geworden ist, welche Rolle kommerzielle Interessen in diesem Rahmen spielen ( Electronic Commerce ), und wie sich die Haltung der Akteure im Hinblick auf die zentrale Herausforderung der Schaffung von Telekommunikationssicherheit darstellt. Literatur: Bollmann, Stefan (Hrsg.): Kursbuch neue Medien. Trends in Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. Mannheim 1995; Buchstein, Herbert: Bittere Bytes. Cyberbürger und Demokratietheorie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 4/1996. S ; Fedrowitz, Jutta u.a. (Hrsg.): Kultur und Technik im 21. Jahrhundert. Frankfurt u. New York 1993; Eichner, Volker und Mai, Manfred (Hrsg.): Sozialverträgliche Technik - Gestaltung und Bewertung. Wiesbaden 1993; Kevenhörster, Paul: Politik im elektronischen Zeitalter. Baden-Baden 1984; Kreowski, Thomas u.a. (Hrsg.): Realität und Utopien der Informationstechnik. Münster 1995; Reinermann, Heinrich: Die Krise als Chance. Speyer 1995; Riehm, Ulrich und Wingert, Bernd: Multimedia - Mythen, Chancen und Herausforderungen. Mannheim 1995; Winkel, Olaf: New Public Management und Bürgeramtsmodell: Wir brauchen beides. In: Verwaltung & Management 4/1997. S ; Winkel Olaf: Die private Verschlüsselung als öffentliches Problem. In: Leviathan 4/1997. S ; Wittkämper, Gerhard W. und Chladek, Walter: Politik und Technik. Münster Wittkämper, G. W Theorie und Praxis des Föderalismus (Sowi Sek I/II: A1,2; EW: D2; LB Ges.: B1) Zeit: Mo Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Aus der Sicht deutscher Kommentatoren zeigte der deutsche Föderalismus jüngst pathologische Züge. International hingegen scheinen föderalistische und regionalistische Ansätze Konjunktur zu haben. Dieses Seminar wird die Hauptprobleme von Theorie und Praxis des heutigen Föderalismus behandeln und dadurch Denkanstöße und Kenntnisse zur Arbeit an Problemen der Theorie und Praxis des Förderalismus geben. Zu Ende des Wintersemesters erscheint ein ausführliches Seminarprogramm mit Sachund Zeitplan sowie grundlegenden bibliografischen und sonstigen Informationen. Zimmer, A / Sauer, C. 40
41 Hauptseminare Deutsche Innenpolitik Aktive Arbeitsmarktpolitik und Nonprofit Sektor (Sowi Sek I/II: A2; EW: C2; LB Ges.: B1) Zeit: Di Raum: R. 301 Beginn: 2. Vorlw. Trotz Zusicherung der Politik, die Arbeitslosenzahlen bis zum Jahr 2000 zu halbieren, ist nach wie vor keine Trendwende in Sicht. Im Gegenteil, aus Nürnberg kommen stets neue Horrormeldungen über Arbeitsplatzvernichtung und Zunahme der Arbeitslosenzahlen. Auch eine positive Wirtschaftsentwicklung - d.h. eine gute Konjunktur - bietet keine Garantie mehr für Beschäftigung und allgemeine Wohlstandsgewinne. Die Gründe für die Beschäftigungsfalle sind längst bekannt: Effizienzgewinne durch Rationalisierung der Produktion sind hier ebenso so nennen wie die Verlagerung der Produktion in die sog. Billiglohnländer. Auch im Dienstleistungsbereich, insbesondere bei Banken und Versicherungen, sowie in der öffentlichen Verwaltung sind die Arbeitsplätze nicht mehr sicher; auch hier wird rationalisiert und nachhaltig verschlankt. In dieser Situation wird aktuell von Politik und Wissenschaft der gemeinnützige oder Nonprofit-Sektor als Ausweg aus dem Dilemma einer Gesellschaft entdeckt, der die Arbeit auszugehen droht. Waren Vereine, Wohlfahrtsverbände, Stiftungen, Initiativen und Kulturprojekte von der Arbeitsmarktpolitik bislang kaum eines Blickes gewürdigt worden, so sind sie inzwischen zu Hoffnungsträger von Beschäftigung und gleichzeitig gesellschaftlicher Sinnstiftung avanciert. So schreibt Warnfried Dettling in Die Zeit: Im Nonprofit-Sektor werden die Menschen neue Tätigkeitsfelder und neue Einkommensquellen finden. Hier gibt es für viele viel zu tun. Und die Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen schlägt unter Federführung von Ulrich Beck vor, die Erwerbsarbeit durch Bürgerarbeit - d.h. konkret durch unbezahlte Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich - zu ergänzen. Was ist von diesen Konzeptionen zu halten? Welche Zielsetzungen und Motive stecken hinter der Diskussion über die Neubestimmung von Arbeit, die Aufwertung des Bürgerengagements? Wird hier ein neuer Gesellschaftsvertrag "jenseits von rechts und links", eine neue Form des Zusammenlebens, die nicht ausschließlich auf Erwerbsarbeit basiert, vorbereitet? Oder handelt es sich nur um Zahlenkosmetik, die vorrangig der Zielsetzung dient, die Arbeitslosenstatistik zu frisieren und die Zahlen nach unten zu drükken? Diese Fragestellungen stehen im Zentrum des Seminars. Zunächst wird ein Überblick über den Nonprofit-Sektor und die Besonderheiten seiner Organisationen vermittelt. Daran anschließend werden neue Ansätze und Konzepte der gemeinnützigen Arbeit, wie etwa die Bürgerarbeit, behandelt. Regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit sind Voraussetzung für den Scheinerwerb. Literatur: Anheier, Helmut K. et al (Hrsg.), 1998: Der Dritte Sektor in Deutschland, Berlin: Sigma; Aus Politik und Zeitgeschichte: Heft B 48-49/97 ( ), Beiträge von Gerd Mutz, Irene Kühnlein; Badelt, Christoph, 1997: Ehrenamtliche Arbeit im Nonprofit-Sektor, in: Christoph Badelt (Hrsg.): Handbuch der Nonprofit Organisation, Stuttgart, S ; Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen (Hrsg.), 1997: Teil III. Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Entwicklung, Ursachen und Maßnahmen, Bonn: Büro der Kommission 41
42 Hauptseminare Außenpolitik / Internationale Politik Breitschuh, B. / Konegen, N. Außenpolitik / Internationale Politik Polen auf der Schwelle ins nächste Jahrtausend: Maastricht II und die Herausforderungen an Staat und Gesellschaft (Sowi Sek I/II: A2,3; EW: C2) Blockseminar (siehe Aushang) Polen ist auf dem Weg zu einem stabilen Wachstum, muß aber immer wieder Rückschläge aufgrund struktureller Probleme hinnehmen. Dafür sorgen vor allem strukturschwache Branchen wie Bergbau und Stahl, eine rückständige Landwirtschaft sowie die geringe Belastbarkeit des Verkehrs- und Kommunikationssystems. Aber auch Defizite im Bildungssystem und das zögerliche Angleichen an europäische Rechtsnormen sind Gründe, durch die es zu Schwierigkeiten bei den Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union kommen könnte. Das Seminar findet in Kooperation mit dem Franz-Hitze-Haus in Münster vom bis statt. Es dient der Vorbereitung für die Exkursion vom bis nach Lublin, Warschau und Breslau. In Lublin wird ein gemeinsamer Workshop zu dem oben genannten Thema mit Studierenden der Fakultät für Politologie der Marie Curie-Sklodowska Universität in Lublin (Polen) und Studierenden des Zentrums Junge Diplomatie der Fakultät für Internationale Beziehungen der Staatsuniversität Iwan Franco in Lwuw (Ukraine) durchgeführt. Für die Teilnahme an der Exkursion ist das vorbereitende Blockseminar verpflichtend. Die Teilnehmerzahl der Exkursion ist auf 18 Personen begrenzt. Bedingungen für den Erwerb eines Leistungsnachweises: Kurzreferat und Hausarbeit. Die Anmeldung erfolgt ab 1. Februar im Europäischen Dokumentationszentrum, R. 213, (Anmeldeliste) und evtl. noch in der verpflichtenden Einführungsveranstaltung am um Uhr Raum 625, Scharnhorststraße Frey, R. / Twenhöven, J Europäische Regionalpolitik. Zur Berücksichtigung regionaler Interessen und Strukturen durch die Kommission. (Sowi Sek I/II: A2,3) Blockseminar (siehe Aushang) Wie bringen Regionen ihre Interessen in den politischen Prozeß auf europäischer Ebene ein? Wie werden diese Interessen formuliert? Welche Institutionen sind maßgeblich? Welches Gewicht kann Regionalpolitik in Brüssel gewinnen? 42
43 Hauptseminare Außenpolitik / Internationale Politik Für das Blockseminar, das vor allem die Diskussion und Aufbereitung europapolitischer Entwicklungen mit Praktikern ermöglichen soll, ist eine persönliche Einladung in der Sprechstunde bei Prof. Dr. R. Frey notwendig. Hahn, K Föderale Perspektiven für Europa (Sowi Sek I/II: A3) Zeit: Mi Raum: Sch 3 Beginn: In diesem Hauptseminar sollen die Ergebnisse der von der Arbeitsstelle für Interdisziplinäre Deutschland- und Europaforschung durchgeführten Tagungen in kritischer Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zur Europapolitik diskutiert werden. Folgende Problembereiche werden behandelt: I. Der segmentierte Demos und die Zukunft der Demokratie in Europa (Lit.: Nitschke, P.: Der segmentierte Demos. Abschied vom traditionellen Konzept der Moderne, in: Kellermann / Nitschke (Hrsg.): Zur Natur des Föderalen, Münster 1997; u.a.) II. Fragen an Deutschlands nationale und demokratische Zukuft (Lit.: Hahn, K.: Die Aktualität von Fichtes Reden an die deutsche Nation, in: Czirjak, J. (Hrsg.): Wege der Deutung. Vorträge des Fichte-Forums in Kaposvár, Münster/Hamburg und Kaposvár 1992; Husemann, M. / Zwilling I.: Fragen an die deutsche Zukunft, Münster, u.a.) III. Die Aktualität der Mitteleuropa-Idee (Lit.: Hahn, K. / Husemann, M. (Hrsg.): Föderale Perspektiven für Europa, Münster 1996; u.a.) IV. Der Orient-Okzident-Antagonismus in seiner Relevanz für die europäische Identität und Kultur (Lit.: Simons, E.: Wirklichkeit und Begriff des Bundes. Zur politischen Dialektik und Dramatik von Ent-Bindung und Bindung, in: Kellermann / Nietschke (Hrsg.): Zur Natur des Föderalen; u.a. V. Eine regional strukturierte Föderation Europa als Alternative zum Euro-Zentralismus (Lit.: Hahn, K: Föderalismus. Die demokratische Alternative, München 1975; u.a.) VI. Probleme und Chancen des Standorts NRW (Lit.: Loth, W. / Nitsche, P.: NRW in Europa, Opladen 1997; u.a.) VII. Föderale Perspektiven für eine europäische Wirtschaftsordnung (Lit.: Schweiker, M.: Der Mutualismus Pierre-Joseph Proudhons als Grundlange einer föderativdemokratischen Neuordnung Europas, Göttingen 1996) VIII. Probleme und Perspektiven europäischer Sicherheitspolitik IX. Probleme und Chancen föderaler Demokratie in Mittel- und Osteuropa Einführende Literatur: Wentniis, N. (Hrsg.): Föderalismus und die Architektur der europäischen Integration, München 1994 (Südosteuropa-Studien, Bd. 55) Meyers, R A New Model Europe? Decisice Factors and Influences. Blockseminar in Verb. m. d. Faculty of European Studies, Babes-Bolyai 43
44 Hauptseminare Außenpolitik / Internationale Politik Universität Klauseburg (Sowi Sek I/II: A3) Blockeseminar vom bis (siehe Aushang) Ein ausführlicher Kommentar hängt bereits am Mitteilungsbrett von Prof. Meyers aus. Meyers, R Europe and the Agenda Part I: From Finance to Agriculture (Sowi Sek I/II: A3) Blockseminar vom April 1998 (siehe Ausahng) Ein ausführlicher Kommentar hängt bereits am Mitteilungsbrett von Prof. Meyers aus. Meyers, R Europe and the Agenda Part II: Regional and structural policy. The case for reform (Sowi Sek I/II: A3) Blockseminar vom Juli 1998 (siehe Aushang) Ein ausführlicher Kommentar hängt bereits am Mitteilungsbrett von Prof. Meyers aus. Robert, R Der israelisch-arabische Konflikt (Sowi Sek I/II: A2,3) Zeit: Mi Raum: Spiegelsaal Beginn: 1. Vorlw. Behandelt werden folgende Themen: Zur Entstehungsgeschichte des Staates Israel 01. Zionismus, arabischer Nationalismus und europäischer Kolonialismus 02. Palästina unter britischer Herrschaft 03. Die Teilung Palästinas und die Entstehung des Staates Israel 1947/48 Der Nahostkonflikt als israelisch-arabischer Konflikt 04. Die Lage der palästinensischen Araber in Israel und den besetzten Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der Intifadah 05. Die palästinensische Widerstandsbewegung: PLO 06. Der Nahostkonflikt und die arabischen Staaten Der Nahostkonflikt als internationaler Konflikt 44
45 Hauptseminare Außenpolitik / Internationale Politik 07. Der Nahostkonflikt zwischen Ost-West- und Nord-Süd-Konflikt 08. Die Haltung der USA im Nahostkonflikt 09. Die Haltung der Sowjetunion bzw. Rußlands im Nahostkonflikt 10. Die Europäische Gemeinschaft und der Nahostkonflikt Die Bemühungen um die Beilegung des Nahostkonflikts 11. Die Friedensbemühungen im Nahen Osten zwischen 1967 und Die Friedensbemühungen im Nahen Osten zwischen 1973 und Die aktuellen Bemühungen um einen Frieden im Nahen Osten Das Hauptseminar wendet sich an Studierende mittlerer Semester. Zum Erwerb eines Scheins ist neben regelmäßiger Teilnahme an der Lehrveranstaltung und kontinuierlicher Mitarbeit die Anfertigung einer Hausarbeit und eines Thesenpapiers erforderlich. Zur Vorbereitung auf das Hauptseminar wird folgende Literatur empfohlen: Walter Hollstein: Kein Friede um Israel - Zur Sozialgeschichte des Palästinakonflikts, Frankfurt/M (und Neuauflage); Heinz Wagner: Der Arabisch-israelische Konflikt im Völkerrecht, Berlin 1971; Udo Steinbach und Rüdiger Robert (Hrsg.): Der Nahe und Mittlere Osten, 2 Bde, Opladen Hoch, Martin: Der Palästinakonflikt und der Friedensprozeß im Nahen Osten. Positionen - Optionen - Perspektiven, Konrad-Adenauer-Stiftung: Interne Studien Nr. 38, Sankt Augustin Sandhövel, A. / Konegen, N Internationaler Handel, Finanzpolitik und Umweltpolitik im Zeitalter der Globalisierung (Sowi Sek I/II: A2,3; LB Ges.: C1) Blockseminar (siehe Aushang) Das ausgehende Jahrhundert schreibt die Geschichte einer immer kleiner erscheinenden Welt: Entfernungen werden schneller überbrückbar, Informationen können bis in den letzten Erdwinkel übertragen werden, die internationale Staatengmeinschaft ist fast untrennbar miteinander verflochten, die Handelsbeziehungen als ältester Motor dieser Entwicklung haben ungekannte Dimensionen erreicht. Weltweiter Börsencrash oder globale Umweltkatastrophen sind Ereignisse, die alle in unterschiedlicher Weise betreffen. Diese Phänomene werden unter dem Schlagwort Globalisierung diskutiert und erzeugen gleichermaßen Ängste und Visionen. Inhalt der Veranstaltung werden Fragestellungen sein, die an dieses Schlagwort anknüpfen: Was ist Globalisierung, welche Entwicklungen liegen diesem Prozeß zugrunde, wie wirken sich diese Vorgänge auf wichtige Politikfelder (Handels-, Finanz- und Umweltpolitik) aus? Begleitet werden die Inhalte des Seminars von Ausführungen eingeladener Gastreferenten. Einstiegsliteratur: Beck (Hrsg), Perspektiven der Weltgesellschaft, 1998; Ders., Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung, Termine: 45
46 Hauptseminare Außenpolitik / Internationale Politik Blockseminar vom 22. bis zum in Berg Neustadt Thränhardt, D. / Woyke, W Regionalismus in Europa (Sowi Sek I/II: A2,3) Zeit: Mo Raum: Spiegelsaal Beginn: 2. Vorlw. Die Europäische Union ist eine Vertragsgemeinschaft von Nationalstaaten, die über ihre innere territoriale Organisation autonom entscheiden. Die Verbindung zwischen EU und Regionen ist hauptsächlich über die europäische Regionalpolitik gegeben, mit der die schwächeren Gebiete gefördert werden. Gleichwohl hat die Existenz der EU Neuorientierungsprozesse begünstigt, in denen sich Frankreich, Spanien, Italien und Belgien schrittweise dezentralisiert haben, verbunden mit autonomistischen und regionalistischen Strömungen in unterschiedlichen politischen Kontexten. Das Seminar soll die institutionellen Kontexte in den verschiedenen Ländern vergleichen und mit der europäischen Ebene in Beziehung setzen. Ein Orientierungstext für das Seminar ist im EDZ erhältlich, der Themenplan hängt ab Ende des WS am Schwarzen Brett aus. Tudyka, K Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Forum sowie als normsetzende und konfliktverhütende Agentur (Sowi Sek I/II: A3) Do (14-tägig) oder nach Vereinbarung (siehe Aushang) Zu einem Begriff von umfassender und kooperativer Sicherheit bekennen sich 55 Staaten im Rahmen der OSZE. Dazu gehört eine politische, militärische, wirtschaftliche und menschenrechtliche Dimension von Sicherheit. Sie bietet dafür ein Forum, sie setzt Normen, sie sucht durch sicherheits- und vertrauensbildende Maßnahmen und durch Rüstungskontrolle Frieden zu stabilisieren, durch Prävention Konflikte zu vermeiden und die engagiert sich beim Aufbau einer durch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, insbesondere Minderheitenschutz bestimmten zivilen Gesellschaft. Der OSZE gehören alle europäischen Staaten gleichberechtigt an und sie schließt auch die USA, Kanada, die zentralasiatischen und transkaukasischen Länder ein. Die Teilnehmerstaaten der OSZE haben im Laufe eines längeren Prozesses Einrichtungen und Maßnahmen für die OSZE-Politik geschafften, wie den Ständigen Rat, das Forum für Sicherheitskooperation, den amtierenden Vorsitzenden, den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten, das System der langfristigen Missionen (u.a. in Bosinen, im Baltikum, in Moldau, in Tadschikistan), das Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte. 46
47 Hauptseminare Politische Theorie Das Seminar wird die Mittel zur Prävention und Bestreitung von Konflikten und die entsprechenden Institutionen der OSZE analysieren. Es wird insbesondere die Frage der europäischen Sicherheitscharta und damit das Verhältnis der OSZE zur NATO, zur WEU, zum Europäischen Rat und zu den Vereinten Nationen erörtern. Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist die Fertigkeit, englische Texte zu lesen und sich am Sitzungen in englischer Sprache aktiv beteiligen zu können. Im Rahmen des Seminarprogramms ist eine zweitägige Exkursion zu den Institutionen der OSZE in Wien geplant. Eine Voranmeldung für die Veranstaltung im Sekretariat der Abteilung II ist erwünscht. Literatur: Orientierung bieten IFSH (Hrsg.)/Kurt P. Tudyka (Red.): OSZE-Jahrbuch 1995 und 1996, Nomos-Verlag Baden-Baden 1995, 1996 u. 1997; Kurt P. Tudyka: OS- ZE-Handbuch, Leske-Budrich-Verlag, Opladen Eine ausführliche Literaturliste und eine Auswahl an Dokumenten, Aufsätzen und Monographien enthält der Seminarapparat in der Fachbibliothek. Hahn, K. Politische Theorie Globalisierung und europäische Solidarität im politischen Denken Max Schelers (Sowi Sek I/II: A1,3) Zeit: Mi Raum: R. 313 Beginn: Max Schelers politisches Denken verdient es, verstärkt in den politiktheoretischen Diskurs der Gegenwart eingebracht zu werden. Im Kontext der Globalisierungsproblematik soll dies in diesem Hauptseminar versucht werden. Folgende Themenbereiche sollen behandelt werden: I. Max Schelers Begriff des Politischen II. Die Konzeption des Nationalen, Internationalen und Kosmopolitischen III. Max Schelers Periodisierung der Geschichte sowie seine Neuzeit- und Gegenwartsbedeutung IV. Europa und Globalisierung V. Der Philister und Bourgeois - oder: der Verlust geistiger Substantialität VI. Max Scheler und Max Weber VII. Zentralismus und föderales Denken bei Max Scheler VIII. >> Europäische Solidarität << im politischen Denken Max Schelers IX. Dostojewskij und Europa in Max Schelers Sicht X. Ost-West-Ausgleich als Zukunftsperspektive Einführende Literatur: Henckmann, Wohlfahrt: Schelers Idee von Europa im Weltalter des Ausgleichs, in: Zeitschrift für Politik, Jg. 44 (NF) Heft 2 (1997); Avé-Lallemant, Eberhard: Die Auktualität von Schelers Politischer Philosophie, in Orth, Ernst Wolfgang (Hrsg.): Phänomenologische Forschungen. Studien zur Philosophie von Max Scheler,
48 Hauptseminare Hahn, K. Politische Theorie Politik und Kunst (Sowi Sek I/II: A1) Zeit: Fr 9-13 (14-tägig) Raum: R. 301 Beginn: Folgende Themenkomplexe sollen behandelt werden: I. P.J. Proudhon: Das Prinzip der Kunst und ihre soziale (sc. sowie politische) Bestimmung II. Kunst und Politik sowie das Geschlechterverhältnis in Mythos, Literatur und Philosophie der griechischen Antike III. Matriarchatsforschung IV. Politik und Kunst im antiken Rom, im Rom der Renaissance sowie die Darstellung der Römischen Idee in neuzeitlichen europäischen Staaten V. Ästhetik und Gewalt VI. Die Kunsttheorie der russischen Strukturalisten und die Oktoberrevolution VII. Politik und Kunst sowie die politische Relevanz des Geschlechterverhältnisses in der deutschen philosophischen und literarischen Klassik sowie in der Romantik bei Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche und Max Scheler VIII. Die politische Relevanz der Ästhetisierung der Lebensstile in der Postmoderne Kevenhörster, P Vom Autoritarismus zur Demokratie - aktuelle Fragen der Transitions- und Transformationsforschung (Sowi Sek I/II: A1,3; EW: C2) Zeit: Fr Raum: Spiegelsaal Beginn: 2. Vorlw. Das Hauptseminar/ Forschungskolloquium soll Hauptfachstudierenden der Politikwissenschaft die Vorbereitung einer Magister- oder Staatsexamensarbeit bzw. einer Dissertation in den Gebieten politikwissenschaftlicher Transitionsforschung, Außen- und Entwicklungspolitik und Vergleichender Politikforschung ermöglichen. Dazu werden in den ersten Sitzungen theoretische Fragen des demokratischen Transformationsprozesses erörtert. In den folgenden Sitzungen sollen einzelne Magister- und Doktorarbeiten vorgestellt und unter theoretischen, methodischen und forschungspraktischen Fragen erörtert werden. Im Vordergrund stehen theoretische und konzeptionelle Entwürfe für einen Transitions- und Ländervergleich. Literatur: Sandschneider, Eberhard: Stabilität und Transformation politischer Systeme. Opladen Zimmer, A. / Priller, E Demokratie und Ehrenamt (Sowi Sek I/II: A1,2; EW: C2; LB Ges.: B1) Blockseminar (siehe Aushang) 48
49 Hauptseminare Politische Theorie Aktuell steht es ganz hoch im Kurs: das Ehrenamt. In den Sonntagsreden der Politiker nimmt das freiwillige Engagement und die ehrenamtliche Tätigkeit einen immer größeren Stellenwert ein. Nachhaltig drängt sich hierbei der Verdacht auf: Dies hat eher etwas mit den leeren Kassen der öffentlichen Haushalte als mit der Förderung bürgerschaftlicher Partizipation zu tun. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte verfolgt die Veranstaltung zwei Zielsetzungen: Zum einen soll die Diskussion über Ehrenamt und freiwillige Tätigkeit rückgekoppelt werden an die demokratietheoretische Diskussion. Im Mittelpunkt steht hierbei die Bedeutung des Ehrenamtes für Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. Hierbei wird hinterfragt, ob in der Tat nur der Kommunitarismus als Leitbild eines Revivals von Ehrenamtlichkeit und freiwilligen Engagements zur Verfügung steht, oder ob sich nicht doch eigenständige Traditionslinien aufspüren lassen. Zum anderen soll die aktuelle Konjunktur des Ehrenamtes kritisch beleuchtet werden. Hierbei werden die Zielvorstellung und Konzeptionen der Parteien zum Ehrenamt und zur freiwilligen Mitarbeit auf der Grundlage von aktuellen Stellungnahmen und parteiinternen Papieren differenziert analysiert. Welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten lassen sich hinsichtlich der Ehrenamtskonzeptionen von Christ-, Frei- und Sozialdemokraten sowie Bündnisgrünen feststellen? Geht es in der Tat um einen neuen Gesellschaftsvertrag jenseits von links und rechts? Oder sucht man nur nach Möglichkeiten, das öffentliche Leistungsniveau in Zeiten der Haushaltsmisere zu halten? Teilnahme am Vorbereitungsgespräch, am Blockseminar sowie Referat und Anfertigung einer Hausarbeit sind Voraussetzung für den Scheinerwerb. Termine: Vorbereitungsgespräch: 21. April von Uhr Blockseminar: Juni Literatur: Almond, Gabriel A./Verba, Sidney (Hrsg.), 1980: The Civic Culture Revisited, Boston/Toronto; Aus Politik und Zeitgeschichte: Themenheft B 36/96, 30. August 1996 mit Beiträgen von Walter Reese-Schäfer, Sibylle Tönnies, Hauke Brunkhorst, Lothar Probst; Deutscher Kulturrat (Hrsg.), 1996: Ehrenamt in der Kultur. Stand und Perspektiven ehrenamtlicher Arbeit im Kulturbereich, Bonn; Gaskin, Katharine/Smith, Justin Davis/Paulwitz, Irmtraut u.a., 1996: Ein neues bürgerschaftliches Europa. Eine Untersuchung zur Verbreitung und Rolle von Volunteering in zehn Ländern (Herausgegeben von der Robert Bosch Stiftung), Freiburg; Olk, Thomas, 1987: Das soziale Ehrenamt, in: Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau, Nr. 14, S ; Ronge, Volker, 1994: Der Zeitaspekt ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen Heft 2, S Wilske, D. Vergleichende Politikwissenschaft Die amerikanische Politische Wissenschaft (Sowi Sek I/II: A1,2) Zeit: Mi Raum: R. 129 (Textilgestaltung) Beginn: 1. Vorlw. 49
50 Hauptseminare Vergleichende Politikwissenschaft Die Wissenschaft von der Politik als alte akademische Disziplin war besonders in den USA eng mit der tradierten klassischen Politischen Wissenschaft verbunden. Sie hatte sich jedoch gerade in den USA unter dem Einfluß der Naturwissenschaften und seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu einer vollständig neuen Disziplin gewandelt. Als solche beherrscht sie heute diesen Wissenschaftszweig weltweit. Das Seminar versucht den Gang dieser Entwicklung in den USA nachzuzeichnen: Politische Wissenschaft als normative "moral philosophy" einerseits und als "exakte" Wissenschaft andererseits. Unbedingt empfohlen: Ricci, David M., The Tragedy of Political Science, Yale University Press Thränhardt, D Einwanderungs-Kontrollpolitik im europäischen Vergleich (Sowi Sek I/II: A2; EW: C1) Zeit: Mo 9-11 Raum: R. 301 Beginn: 2. Vorlw. Geplant ist die Übersetzung eines neuen Buches zur Steuerung der Einwanderung in Europa, das die Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, Österreich und Ungarn behandelt und eine Theorie der Steuerung zu entwickeln versucht (interne und externe, implizierte und explizierte Steuerung). Ziel ist dabei, die Terminologie im Englischen und Deutschen zu vergleichen, die Probleme vertieft zu erfassen und aktuelle wissenschaftliche Diskussion kennenzulernen. Thränhardt, D Christlich-Demokratische Parteien im Vergleich (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Mo Raum: R.301 Beginn: 2. Vorlw. Die Christlichen Demokraten sind eine der beiden großen Parteifamilien im westlichen Europa. Sie repräsentieren eine spezifische Mischung aus Kirchenbezogenheit (überwiegend katholisch), holistischem Denken und politischer Aktionsbereitschaft, das sich in der Zerstörungssituation der Nachkriegszeit kreativ entfaltete und klar profilierte und gleichzeitig pragmatisch offene Politik ermöglichte. Fast ununterbrochen waren sie die stärksten Parteien in Deutschland, Belgien, Luxemburg und bis 1995 auch in den Niederlanden. Dagegen brachen die christlich-demokratischen Parteien in anderen Ländern ein: in Frankreich schon um 1950, in Italien 1990 nach 45jähriger Dominanz. Andererseits haben sich in den letzten Jahrzehnten neue Parteien des christlich-demokratischen Typs auf der iberischen Halbinsel, in Skandinavien, Osteuropa und in Lateinamerika gebildet. In unserem Seminar soll es darum gehen, anhand eines Sets von Fragestellungen (siehe Aushang) die verschiedenen "C"-Parteien in ihrem Profil und ihrer Politik zu bestimmen und Erklärungen für ihre Erfolge und Mißerfolge zu finden. Verbindliche Literatur: Veen, Hans-Joachium (Hrsg.), Christlich-demokratische und kon- 50
51 Hauptseminare Vergleichende Politikwissenschaft servative Parteien in Westeuropa, Schöningh, Paderborn 1983 ff. (4 Bde., UB 3E 91967/1-4/ Zweigbibliothek Sowi MG 11340/ 1/1-4.) Die einschlägigen Zeitschriften mit aktuellen Artikeln zum Stand der Forschung sind West European Politics und Party Politics. Zimmer, A. / Jütting, D Sportvereine in Europa zwischen Markt und Staat (Sowi Sek I/II: A2; EW: D3; LB Ges.: B1,C3) Blockseminar (siehe Aushang) Das Hauptseminar "Sportvereine in Europa zwischen Markt und Staat" wird im Rahmen der Sommer-Universität Münster (SUM) `98 angeboten, die das Institut für Sportkultur und Weiterbildung in Kooperation mit dem Institut für Freizeitwissenschaft der Sporthochschule Köln, der Europäischen Akademie des Sports in Velen sowie der Stadt Münster veranstaltet. Die Sommeruniversität wird die Sportvereine in Europa in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Betrachtungen und Diskussionen und persönlichen Erfahrungsaustausches stellen. Sie wird im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten "350 Jahre Westfälischer Friede" angeboten. Das Leitbild "Europa der Bürger" wird vor allem dann schrittweise Realität werden, wenn es im Alltag der BügerInnen in konkreten und wahrnehmbaren Strukturen und Organisationen verankert ist und als Normalität gelebt werden kann. Der Sport ist eine Realität in allen Ländern Europas, der den Alltag der meisten BügerInnen berührt, ja im Alltag vieler einen festen Platz als Freizeitbeschäftigung (entweder als Sporttreiben oder als Sportzuschauen) hat. Diese Spontaneität ist aber nicht in allen Ländern gleich. Neben Ähnlichkeiten gibt es auch markante Unterschiede, wobei sich die Differenzen aus der jeweils spezifischen Kultur der Länder und Regionen erklären. Die SUM besteht aus zwei Programmteilen: einem Wissenschaftsprogramm und einem internationalen Begegnungsprogramm. Im Mittelpunkt des Wissenschaftsprogramms stehen die Sportvereine in einzelnen europäischen Ländern und deren Einbindung in die verbandlichen Strukturen des organisierten Sports einerseits sowie ihren Verbindungen zu den lokalen bzw. internationalen politisch-administrativen Strukturen. Das Hauptseminar ist auf das Wissenschaftsprogramm bezogen, das aus Vorträgen (vormittags) und Workshops (nachmittags) besteht. Die Studierenden bereiten sich in der Vorbereitungsphase auf die Themen der Vorträge und Workshops durch die Anfertigung von Arbeitspapieren vor, protokollieren die Vorträge und Diskussionen und fertigen auf dieser Grundlage Hausarbeiten an. Termine: 1. Vorbereitungsgespräch: 27. April 98: Uhr im Seminarraum im ISW 2. Vorbereitungsgespräch: 22. Juni 98: Uhr im Seminarraum im ISW 3. Durchführungsphase: 7. September bis 10. September Nachbereitungsgespräch: 12. Oktober 98: Uhr im Seminarraum im ISW Literatur: Anheier, Helmut K. et al (Hrsg.), 1998: Der Dritte Sektor in Deutschland, Berlin: Sigma; Best, Heinrich (Hrsg.), 1993: Vereine in Deutschland, Bonn: Informationszentrum Sozi- 51
52 Hauptseminare Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik alwissen-schaften; Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), 1997: Die politischen Systeme Westeuropas, Opladen: Leske + Budrich; Zimmer, Annette 1996: Vereine - Basiselement der Demokratie, Opladen: Leske + Budrich Frey, R. / Krafft, D. Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik Europa im Wandel. Politische und ökonomische Aspekte (Sowi Sek I/II: A2,3; EW: C2) Blockseminar (siehe Aushang) Für das Seminar ist eine persönliche Anmeldung in den Sprechstunden von Prof. Dr. D. Krafft und Prof. Dr. R. Frey erforderlich. Konegen, N. / Krol, G Zur Leistungsfähigkeit der neuen Institutionenökonomie - Grundlagen, Anwendungen, Erklärungspotentiale (Sowi Sek I/II: A1,2) Blockesminar (siehe Aushang) In der Veranstaltung wird zunächst ein Überblick über die Neue Institutionentheorie gegeben. Zentrales Merkmal dieses Ansatzes ist die explizite Berücksichtigung von Institutionen, den grundlegenden Spielregeln, welche die neoklassische Theorie vernachlässigt hat. Zwei Ausrichtungen stehen im Mittelpunkt des Erkennisinteresses. Als choice within rules erhebt die Neue Institutionentheorie soziale Normen und andere institutionelle Rahmenbedingungen in den Rang von Erklärungsvariablen und trifft Aussagen über die verhaltenskanalisierenden Wirkungen formeller und informeller Institutionen. Als choice of rules liefert sie Erklärungsansätze für institutionelle Entstehungsund Gestaltungsbedingungen (institutional change). Im zweiten Teil der Veranstaltung soll die Neue Institutionentheorie auf ausgewählte Politikfelder (z.b. Finanzpolitik, Stabilitätspolitik, Umweltpolitik) angewendet und ihr Erklärungspotential kritisch gewürdigt werden. Einstiegsliteratur: Karpe, Jan, Institutionen und Freiheit. Grundlegende Elemente moderner Ökonomik, Münster Termin: Blockseminar vom 5.6 bis zum Konegen, N. / Siuts, C Vom europäischen Währungsinstitut (EWI) zur Europäischen Zentralbank (EZB) - Entscheidungen, Aufgaben, Probleme (Sowi Sek I/II: A2) 52
53 Hauptseminare Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik Zeit: Mo Raum: Sch 2 Beginn: 2. Vorlw. Im Januar 1999 soll die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Arbeit in Frankfurt a.m. aufnehmen. Sie wird dann, primär dem Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet, die Aufgabe haben, die an der Währungsunion teilnehmenden Volkswirtschaften mit der neuen Währung, dem EURO, zu versorgen. Von der Geld- und Zinspolitik der EZB wird in entscheidendem Maße abhängig sein, ob sich der EURO zu einer stabilen Währung entwickeln kann. In diesem Hauptseminar sollen die Übergangsbestimmungen zur dritten Stufe der Währungsunion behandelt werden. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt jedoch in der Untersuchung der institutionellen Struktur des Europäischen Systems der Zentralbanken und seiner Entscheidungs- und Abstimmungsmechanismen. Das Spannungsfeld zwischen politischer und ökonomischer Rationalität, in welchem die geldpolitischen Entscheidungsträger handeln werden, soll dargestellt und analysiert werden. Hierzu sind Grundkenntnisse der Neuen Politischen Ökonomie unerläßlich. Ebenso werden Kenntnisse der europäischen Währungsintegration vorausgesetzt. Einstiegsliteratur: Jahresberichte des EWI, fortlaufend; Läufer, Die Vertragstexte von Maastricht, Ausgabe 1997; Koenig u.a., Einführung in das Europarecht, Für den Erwerb eines Leistungsnachweises sind eine regelmäßige Teilnahme am Seminar, die Übernahme eines Referates und die Erstellung einer Hausarbeit erforderlich. Meyers, R Die Europäische Währungsunion - Projekt, Probleme, Perspektiven. (Sowi Sek I/II: A2,3) Blockseminar vom Juni 1998 (siehe Aushang) Bis Ende Juni 1998 soll der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs beurteilen, ob und welche Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Voraussetzungen zum Beitritt der Europäischen Währungsunion erfüllen. Für alle qualifizierten Staaten beginnt die Währungsunion am Diese Daten geben Anlaß dazu, das Projekt der Europäischen Währungsunion noch einmal kritisch auf Entstehung, Konzipierung und Auswirkungen zu hinterfragen. Über die in der jüngsten Vergangenheit beinahe ausschließlich geführte Debatte über bestimmte Bezugskriterien hinaus, soll die Veranstaltung die Währungsunion in den größeren Kontext der Finalität der Europäischen Integration stellen und vor allem auch danach fragen, ob eine mögliche Währungsunion sob specie der Osterweiterung der EU und der in Amsterdam angekündigten, dann aber vertagten EU-Reformpolitik (Strukturpolitik, Haushaltssanierung, Agrarpolitik) zu betrachten. Ist sie für eine Fortführung des Integrationsprozesses wirklich notwendig, oder stellt sie eher ein politisches Ziel dar, dessen Umsetzung um des Machterhalts ihrer Befürworter willen verfolgt wird. Zum Einlesen: Thilo Sarrazin: Der Euro. Chance oder Abenteuer. Bonn: Dietz-Verlag 1997; Peter Czada / Günter Renner: Euro und Cent. Europäische Integration und Währungsunion. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung
54 Hauptseminare Politische Ökonomie / Wirtschaftspolitik Stockmann, D Welthandelspolitik unter besonderer Berücksichtigung der Staaten Ost - und Südosteuropas (Sowi Sek I/II: A3; LB Ges.: C1) Zeit: Mi 9-11 Raum: R. 129 (Textilgestaltung) Beginn: 1. Vorlw. Im Seminar sollen die wirtschaftlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des Systemwechsels in den Staaten Osteuropas untersucht werden. Die erfolgreiche Transformation der wirtschaftlichen Ordnungen hin zu einem marktgesteuerten Wirtschaftssystem ist für den Erfolg der politischen Reformen und damit für ein funktionsfähiges, stabiles demokratisches System von großer Bedeutung. Bestimmte Bedingungskonstellationen müssen erfüllt sein, damit ökonomische Entwicklung gelingt. Das spezifische Problem der Transformation besteht darin, die nachholende Konstitution einer marktwirtschaftlichen Ordnung, d.h. einen monetär gesteuerten Prozeß der Produktion und Einkommensbildung in Konkurrenz zur entwickelten Marktwirtschaft zu etablieren. Restrukturierung der Volkswirtschaft, Konstituierung einer Geldwirtschaft, Weltmarktintegration, Privatisierung sowie soziale Sicherung als wichtige Gestaltungskriterien einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik sollen analysiert und bewertet werden. Die Umorientierung im Handel der osteuropäischen Staaten auf die Märkte der EU - Staaten soll aus entwicklungstheoretischer Perspektive untersucht und die Frage beantwortet werden, inwieweit die Eingliederung in bestehende Märkte Wachstumschancen für die osteuropäischen Volkswirtschaften eröffnet. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die internationale Arbeitsteilung, der internationale Handel zu Katalysator wirtschaftlicher Entwicklung werden? Vor diesem Hintergrund werden Optionen einer Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union erkundet und in ihrer Wirkung auf Unterstützung und Stabilisierung der Entwicklungsprozesse in Osteuropa bewertet. Es soll untersucht werden, inwieweit die Handelspolitik - national und international - auf das Entwicklungsziel ausgerichtet ist. Einführende Literatur: Hamel, Hannelore (Hrsg.): Soziale Marktwirtschaft - Sozialistische Planwirtschaft, München 1989; Schlüter, Rolf (Hrsg.): Wirtschaftsreformen im Ostblock in den 80er Jahren, Padaborn 1989; Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa (Strategien und Optionen für Europa), Gütersloh 1993; Ders. 1995; Wagner, Helmut: Einführung in die Weltwirtschaftspolitik, Munchen 1995; Hölscher, Jens / Jacobsen, Anke / Tomann, Horst / Weisfeld, Hans (Hrsg.): Bedingungen ökonomischer Entwicklung in Zentralosteuropa, Bd. 2; Marburg 1994; Ders. Bd. 4, Marburg Entwicklungspolitik 54
55 Hauptseminare Kevenhörster, P. Entwicklungspolitik Die Erfolgsbilanz der deutschen Entwicklungspolitik: Nachhaltigkeit und Evaluierung (Sowi Sek I/II: A3; LB Ges.: B1) Zeit: Mi 9-11 Raum: R.313 Beginn: 1. Vorlw. Die Entwicklungspolitik sieht sich seit Jahren einer heftigen Kritik sowohl von Seiten der Praxis als auch der Wissenschaft ausgesetzt. Nach dem verlorenen Jahrzehnt der 80er Jahre fällt die Bilanz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gegenwärtig nicht besser aus: Abgesehen von einer kleinen Zahl von Ländern in Südostasien weisen die meisten Länder des Südens eine stagnierende oder sogar negative wirtschaftliche Entwicklung auf. Über eine Milliarde Menschen leben in den Entwicklungsländern in absoluter Armut, Tendenz steigend. Vereinzelte Fortschritte können weltweit bisher nur im Gesundheits- und Bildungsbereich verbucht werden. Bei der Analyse der Wirksamkeit der Entwicklungspolitik muß diese jedoch auch als eine Dimension der Gesamtpolitik gesehen werden. Zur Beurteilung der Entwicklungszusammenarbeit soll in diesem Seminar das aktuelle Modell der Ex- post- Evaluierung und damit einer systematischen Erfolgskontrolle zunächst auf der Projektebene vorgestellt werden. Dabei soll das Konzept der Nachhaltigkeit einzelner Projekte untersucht werden. Schließlich werden neue Konzepte und Perspektiven der Entwicklungszusammenarbeit vor dem Hintergrund des steigenden Aufgabenumfangs diskutiert. In einem daran anschließenden Blockseminar, das in Zusammenarbeit mit dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn vom 25. bis 29. Mai 1998 stattfindet wird die Evaluierungspraxis der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam mit Vertretern entwicklungspolitischer Organisationen erörtert. Nähere Informationen und Anmeldung für das Blockseminar erfolgt in der Sprechstunde von Stephanie Schröder ( Mi von Uhr in Raum 215). Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt circa 180,-DM. Literatur: Stockmann, Reinhard/Wolf Gaebe (Hg.): Hilft die Entwicklungshilfe langfristig? Bestandsaufnahme zur Nachhaltigkeit von Entwicklungsprojekten, Opladen Seminare zur Didaktik und Bildungspolitik Meyers, R. / Woyke, W Hochschulpolitik und Hochschulreform Randbedingungen und Gründe der gegenwärtigen Bildungsmisere. Zeit: Fr Raum: Sch 3 Beginn: 1. Vorlw. Die Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen hat sich in den letzten drei Jahrzehnten versechsfacht; die materielle und personelle Ausstattung der Hochschulen hat damit keineswegs Schritt gehalten. Das Humboltsche Universitätsideal einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden wird von der Massenuniversität überrollt; 55
56 Hauptseminare Seminare zur Didaktik und Bildungspolitik zugleich bestimmt es aber immer noch den immer realitätsferneren Diskurs über Aufgaben und Zielsetzung universitärer Bildung. Dieser Diskurs realisiert nicht, daß sich die Universität schon seit langer Zeit von einer Stätte der Bildung für wenige, zu einer Stätte der Ausbildung für viele gewandelt hat: ein Gutteil der gegenwärtigen Hochschulmisere ist aus den Konsequenzen der Ignorierung dieser simplen Tatsache zu erklären. Die Veranstaltung soll zunächst rückblickend die Genese der Randbedingungen der heutigen Lage deutscher Universitäten erklären; sie soll zweitens verwirklichten bzw. gescheiterten Reformansätzen nachspüren und die Gründe für deren Erfolg bzw. Mißerfolg verdeutlichen; sie soll drittens eine Analyse der universitären Hauptprobleme der Gegenwart erstellen und mit Blick auf Erfolge und Mißerfolge vergangener Hochschulreformstrategien die Frage stellen, welche mittelfristig bestandskräftigen Ziele für universitäre Bildung/Ausbildung heute definiert werden können, welche Mittel zur Verwirklichung dieser Ziele zur Verfügung stehen, und wie Hochschule, Verwaltung, Politik und Gesellschaft dazu gebracht werden können, ihren Anteil an der Verwirklichung der definierten Zielsetzung zu übernehmen. Teilnahmebedingungen: Übernahme eines Referates oder Mitarbeit in einer studentischen Arbeitsgruppe + Hausarbeit. Weitere Informationen: siehe Aushang ab Mitte März 98. Traud, H Lehrer - Animateure oder Sozialarbeiter (Sowi Sek I/II: D1,2; EW: E1,2; Lb Ges.: B1,D1,2) Zeit: Mi Raum: R. 301 Beginn: 2. Vorlw. Landauf-landab schlägt die aktuelle schulpädagogische und bildungspolitische Diskussion hohe Wellen. Diskutiert, häufig eher lamentiert, wird über Erziehungskatastrophe, Werteverfall und Bildungsdefizite im internationalen Vergleich. Aufgabe des Seminars wird es sein, die Rolle die Lehrer in diesem Szenarium spielen, näher zu beleuchten und mögliche Lösungsmodelle zu diskutieren, die einer sich ständig wandelnden Schülergeneration Rechnung tragen. 56
57 Oberseminare Oberseminare Frey, R. / Stolorz, C Die Zukunft der Informationsgesellschaft. (Sowi Sek I/II: A1,2; EW: C2; LB Ges.: B1) Blockseminar (siehe Aushang) Die Revolution in der Informations- und Kommunikationstechnologie und der kometenhafte Aufstieg des Internet haben dazu geführt, daß mehr und mehr Menschen via Datenautobahn ihrem Beruf nachgehen, einkaufen, Reisen buchen, Aktien ordern, Versicherungen abschließen und mit anderen Menschen kommunizieren. Immer mehr Unternehmen nutzen dieselbe Infrastruktur, um sich mit ihren Kunden, Partnern und Lieferanten zusammenzuschließen. Durch die globale und sekundenschnelle Verfügbarkeit von Informationen werden zeitliche und räumliche Grenzen gesprengt, Menschen und Märkte rücken zusammen, die Welt wird zum globalen Dorf. Der soziale und technologische Wandel zur Informationsgesellschaft wirft aber auch viele Fragen auf: Wie kann die Informationsflut in Zukunft bewältigt werden? Wie ist es um den Persönlichkeitsschutz bestellt? Wie verwundbar ist die digitale Wirtschaft? Welche sinnvollen politischen Kontrollmöglichkeiten gibt es im Cyberspace? Im Rahmen des Seminars soll diskutiert werden, was sich hinter Schlagworten wie "Information Highway" oder "Electronic Commerce" verbirgt und welche politischen, sozialen und ökonomischen Folgen die Informationsgesellschaft nach sich zieht. 57
58 Kolloquien Kolloquien Frey, R Examenskolloquium (siehe Aushang) Hahn, K Examenskolloquium Fr R. 301 (14-tägig, Beginn: ) Kevenhörster, P Examenskolloquium: Grundsatzfragen der deutschen Verfassungsdiskussion (Sowi Sek I/II: A2) Zeit: Fr 9-11 Raum: Sch 2 Beginn: 1. Vorlw. Das Seminar dient der Vorbereitung auf das mündliche Examen und richtet sich vorrangig an Nebenfachstudenten. In den einzelnen Sitzungen besteht die Möglichkeit, die einzelnen Prüfungsthemen vorzustellen. Im Rahmen des Seminars findet am 26. Juni 1998 ein eintägiges Blockseminar im Franz Hitze Haus zur aktuellen Verfassungsdiskussion in der Bundesrepublik Deutschland mit Prof. Dr. Dieter Umbach, Universität Potsdam, statt. Die Anmeldung erfolgt in der ersten Sitzung. Kusenberg, A. / Kohl, A Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten der Politikwissenschaft Blockseminar (siehe Aushang) Das Kolloquium richtet sich an Studierende mit dem Haupt- oder Nebenfach Politikwissenschaft, die sich bereits zum Examen angemeldet haben oder in der unmittelbaren Vorbereitungsphase sind. Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, ihre politikwissenschaftlichen Examensarbeiten bzw. mündlichen Prüfungsthemen vorzustellen. Am zweiten Veranstaltungstag können grundlegende Fragen zur mündlichen Examensprüfung geklärt werden. Es ist vorgesehen, Prüfungsgespräche zu simulieren und anschließend zu evaluieren. 58
59 Kolloquien Die Veranstaltung findet am 16. und 17. Mai 1998 im Institut für Politikwissenschaft statt. Zur Vorbereitung wird am 08. Mai 1998 eine einführende Sitzung durchgeführt. Da die Teilnehmeranzahl auf 12 begrenzt ist, bitten wir Interessentinnen und Interessenten, sich bis zum in der Sprechstunde von Frau Kohl (Di 10-11, Raum 222a) anzumelden. Konegen, N. / Siuts, C Examenskolloquium Zeit: Di 15-16:30 Raum: Sch 2 Beginn: 2. Vorlw. Die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit bereitet teilweise große Schwierigkeiten. Die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens von der Anfertigung einer Bibliographie über den Aufbau der Gliederung bis zum Schreiben der Arbeit wirft oft Probleme auf, deren Bewältigung häufig viel Zeit und somit speziell in einer Examensphase eine äußerst knappe Ressource beansprucht. Das Kolloquium soll sich in drei Teile gliedern. Nachdem die formalen Aspekte einer Examensarbeit behandelt worden sind, sollen die Teilnehmer/innen ihre Thematik und die Art und Weise, wie sie sich ihr nähern wollen, dem Plenum vorstellen. Im Anschluß daran soll die Simulation einer mündlichen Abschlußprüfung erfolgen. Das Examenskolloquium soll darüber hinaus ein Forum bieten, auf dem sich die Kandidaten/innen untereinander über ihre Probleme beraten und austauschen können. Es richtet sich an Kandidaten/innen aller Abschlußformen. Thränhardt; D Dissertationen und Examensarbeiten Zeit: Mo Raum: R. 301 Beginn: 2. Vorlw. 59
60 Frauenforschung Lehrveranstaltungen der Professur für Frauenforschung Engler, S. / Lehnert, N Männer, Frauen und Frauenförderung Zeit: Mi Raum: R. 301 Beginn: Anfang der 80er Jahre begann die Diskussion um Maßnahmen zur Frauenförderung im Hochschulbereich. Ende der 90er Jahre ist es üblich, in Ausschreibungstexten zu lesen:»die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und fordert deshalb Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben«. Frauenförderung ist auf der Ebene sprachlicher Kommunikation mittlerweile weit verbreitet. Doch diese»rhetorische Präsenz«von Frauen sagt noch nichts darüber aus, was unter dem Begriff verstanden wird, wer für Frauenförderung zuständig ist und welche faktische Wirkung Maßnahmen haben. Im Seminar soll die Diskussion um Frauenförderung nachgezeichnet werden und gefragt werden, ob Männer und Frauen dasselbe meinen, wenn sie von Frauenförderung reden. Das Seminar findet in Form von Blockveranstaltungen statt. Die Termine werden an der Professur für Frauenforschung ausgehängt. Literatur: Lehnert u. a. 1998: Männer, Frauen und Frauenförderung. Münster u.a. Waxmann. Lehnert/Engler 1997:»Frauenförderung«Bibliographie. Erhältlich an der Professur für Frauenforschung. Münster. Engler, S Frauen und Geschlechterforschung Zeit: Mi Raum: R. 520 Beginn: Das Kolloquium Frauen- und Geschlechterforschung dient der Diskussion und dem Austausch von geplanten und laufenden Examensarbeiten, Dissertationen und Forschungsvorhaben. Angesprochen sind alle Interessentinnen, die eine frauen- bzw. geschlechtsbezogene Qualifikationsarbeit planen oder durchführen und diese im Kolloquium vorstellen und diskutieren möchten, um sowohl theoretische als auch empirische Anregungen zu erhalten. 60
61 Westfälische Wilhelms-Universität Institut für Politikwissenschaft KOMMENTIERTES VORLESUNGSVERZEICHNIS FÜR DAS SOMMERSEMESTER 1998
Modulhandbuch Master Politikwissenschaft (Nebenfach) Vertiefungsmodul: Politische Systeme, MA Politikwissenschaft (Nebenfach)
 Modulhandbuch Master Politikwissenschaft Modulübersicht: Vertiefungsmodul: Politische Systeme Vertiefungsmodul: Politische Ökonomie Vertiefungsmodul: Politische Theorie und Ideengeschichte Vertiefungsmodul:
Modulhandbuch Master Politikwissenschaft Modulübersicht: Vertiefungsmodul: Politische Systeme Vertiefungsmodul: Politische Ökonomie Vertiefungsmodul: Politische Theorie und Ideengeschichte Vertiefungsmodul:
Welcome StudienanfängerInnen. Politikwissenschaft
 Welcome StudienanfängerInnen 1 Politikwissenschaft 3.10.2016, 16-16:45 Uhr: HS 380 Informationen zu Studienplänen und Berufsperspektiven Franz Fallend 2 Homepage Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie
Welcome StudienanfängerInnen 1 Politikwissenschaft 3.10.2016, 16-16:45 Uhr: HS 380 Informationen zu Studienplänen und Berufsperspektiven Franz Fallend 2 Homepage Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie
Politikwissenschaft. Einführung Sommersemester 2016
 Politikwissenschaft Einführung Sommersemester 2016 Studium der Politikwissenschaft Was Sie mitbringen... Politisches Interesse und regelmäßige Zeitungslektüre Freude am wissenschaftlichen Arbeiten Lesen,
Politikwissenschaft Einführung Sommersemester 2016 Studium der Politikwissenschaft Was Sie mitbringen... Politisches Interesse und regelmäßige Zeitungslektüre Freude am wissenschaftlichen Arbeiten Lesen,
Vorlesung Forschungsdesign und Übung Montags Uhr
 Lehre WiSe 2015/16 Vorlesung Forschungsdesign und Übung Montags 16-20 Uhr Die Vorlesung zum Forschungsdesign richtet sich an Studierende der Politikwissenschaft im Masterprogramm. Sie bietet eine ausführliche
Lehre WiSe 2015/16 Vorlesung Forschungsdesign und Übung Montags 16-20 Uhr Die Vorlesung zum Forschungsdesign richtet sich an Studierende der Politikwissenschaft im Masterprogramm. Sie bietet eine ausführliche
Der europäische Integrationsprozess. Prof. Dr. Wichard Woyke Vorlesung SS 2006 Do 9-11 Uhr S 8
 Der europäische Integrationsprozess Prof. Dr. Wichard Woyke Vorlesung SS 2006 Do 9-11 Uhr S 8 1 Programm 06.04. Etappen der europäischen Einigung, Ziele, Motive und Interessen des Integrationsprozesses,
Der europäische Integrationsprozess Prof. Dr. Wichard Woyke Vorlesung SS 2006 Do 9-11 Uhr S 8 1 Programm 06.04. Etappen der europäischen Einigung, Ziele, Motive und Interessen des Integrationsprozesses,
Lehrveranstaltungen der Lehrstuhlmitarbeiter WiSe 2009/2010
 Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2009 am Lehrstuhl für Politikwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum Lehrveranstaltungen der Lehrstuhlmitarbeiter WiSe 2009/2010 Art der Veranstaltung Thema Dozent
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2009 am Lehrstuhl für Politikwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum Lehrveranstaltungen der Lehrstuhlmitarbeiter WiSe 2009/2010 Art der Veranstaltung Thema Dozent
Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland
 Joachim Jens Hesse/Thomas Ellwein Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland Band 1: Text 9., vollständig neu bearbeitete Auflage wde G RECHT De Gruyter Recht und Politik Berlin 2004 Vorwort zur
Joachim Jens Hesse/Thomas Ellwein Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland Band 1: Text 9., vollständig neu bearbeitete Auflage wde G RECHT De Gruyter Recht und Politik Berlin 2004 Vorwort zur
Dr. Reinhard C. Meier-Walser - Lehrveranstaltungen
 Dr. Reinhard C. Meier-Walser - Lehrveranstaltungen Lehrveranstaltungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München seit 1988 Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule München (FB Betriebswirtschaft)
Dr. Reinhard C. Meier-Walser - Lehrveranstaltungen Lehrveranstaltungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München seit 1988 Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule München (FB Betriebswirtschaft)
Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in
 Anlage 13. Politikwissenschaft (35 ) Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in POL-BM-THEO Einführung in das Studium der Prof. Dr. Hans Vorländer politischen Theorie und Ideengeschichte Dieses
Anlage 13. Politikwissenschaft (35 ) Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in POL-BM-THEO Einführung in das Studium der Prof. Dr. Hans Vorländer politischen Theorie und Ideengeschichte Dieses
Modul 1: Grundlagen der Politikwissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen
 Modul 1: Grundlagen der Politikwissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des Angebots 180 h 1.1 Einführung in die Politikwissenschaft und deren Grundbegriffe
Modul 1: Grundlagen der Politikwissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des Angebots 180 h 1.1 Einführung in die Politikwissenschaft und deren Grundbegriffe
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Politikwissenschaft und Forschungsmethoden 4 2 S P WS 1.
 Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Europa zwischen Spaltung und Einigung 1945 bis 1993
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Curt Gasteyger Europa zwischen Spaltung und Einigung 1945 bis 1993
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Curt Gasteyger Europa zwischen Spaltung und Einigung 1945 bis 1993
Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung
 Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Die Bundesrepublik Deutschland als außenpolitischer Akteur 06.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Die Bundesrepublik Deutschland als außenpolitischer Akteur 06.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Einführung in das Regierungssystems Deutschlands (V, 2 std.) Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union (S, 2 std.)
 Lehrveranstaltungen WS 2013/14 Einführung in das Regierungssystems Deutschlands Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union (S, 2 std.) Koalitionsbildung und Koalitionspraxis in Deutschland. Analysen
Lehrveranstaltungen WS 2013/14 Einführung in das Regierungssystems Deutschlands Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union (S, 2 std.) Koalitionsbildung und Koalitionspraxis in Deutschland. Analysen
Das Politische System Deutschlands
 Das Politische System Deutschlands Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Geschwister-Scholl-Institut Pflichtvorlesung im Wintersemester 2008/09 Donnerstag, 10-12 12 Uhr, Hörsaal B 138, Theresienstraße
Das Politische System Deutschlands Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Geschwister-Scholl-Institut Pflichtvorlesung im Wintersemester 2008/09 Donnerstag, 10-12 12 Uhr, Hörsaal B 138, Theresienstraße
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen
 Verzeichnis der Lehrveranstaltungen PD Dr. Viktoria Kaina Stand: Februar 2010 Lehre im Grund- und Hauptstudium (alter Ordnung) im Bereich Politikwissenschaft und Soziologie: Politisches System der Bundesrepublik
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen PD Dr. Viktoria Kaina Stand: Februar 2010 Lehre im Grund- und Hauptstudium (alter Ordnung) im Bereich Politikwissenschaft und Soziologie: Politisches System der Bundesrepublik
Der europäische Integrationsprozess. Historischer Überblick und theoretische Einordnung
 Der europäische Integrationsprozess Historischer Überblick und theoretische Einordnung Vincent Bergner/ Jana Belschner Referat am 01.11.2011 Gliederung I. Thesenübersicht II. Theorien der europäischen
Der europäische Integrationsprozess Historischer Überblick und theoretische Einordnung Vincent Bergner/ Jana Belschner Referat am 01.11.2011 Gliederung I. Thesenübersicht II. Theorien der europäischen
Beyme, Klaus von 1995 B 1013
 Beyme, Klaus von 1995 B 1016 Der Föderalismus in der Sowjetunion : der Föderalismus als Verfassungsproblem im totalitären Staat / Klaus von Beyme. - Heidelberg: Quelle u. Meyer, 1964. - 160 S. (Studien
Beyme, Klaus von 1995 B 1016 Der Föderalismus in der Sowjetunion : der Föderalismus als Verfassungsproblem im totalitären Staat / Klaus von Beyme. - Heidelberg: Quelle u. Meyer, 1964. - 160 S. (Studien
Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland
 Joachim Jens Hesse Thomas Ellwein Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland Band 1: Text 8., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage Westdeutscher Verlag Inhalt Vorwort zur achten Auflage
Joachim Jens Hesse Thomas Ellwein Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland Band 1: Text 8., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage Westdeutscher Verlag Inhalt Vorwort zur achten Auflage
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie. Lehramt Sozialwissenschaften (B.A.) Informationen für Studierende
 Lehramt Sozialwissenschaften (B.A.) Informationen für Studierende Inhalt I. Studienaufbau 3 Struktur des Studiengangs 3 Empfehlungen zur Studienplanung 4 Übersicht: Empfohlener Studienaufbau Lehramt Sozialwissenschaften
Lehramt Sozialwissenschaften (B.A.) Informationen für Studierende Inhalt I. Studienaufbau 3 Struktur des Studiengangs 3 Empfehlungen zur Studienplanung 4 Übersicht: Empfohlener Studienaufbau Lehramt Sozialwissenschaften
Politikwissenschaft. Hauptfach
 Politikwissenschaft Hauptfach 1 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 1.1 Erfolgreiche Teilnahme an 1.1.1 1 Proseminar aus dem unter 2.3 genannten Bereich 1.1.2 1 Proseminar aus den unter 2.4 und
Politikwissenschaft Hauptfach 1 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 1.1 Erfolgreiche Teilnahme an 1.1.1 1 Proseminar aus dem unter 2.3 genannten Bereich 1.1.2 1 Proseminar aus den unter 2.4 und
Tutorium für LehramtskandidatInnen Sommersemester 2008
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professur für Politikwissenschaft, insb. Politische Systeme Lehrstuhl für Internationale Beziehungen Lehrstuhl für Politikwissenschaft I Tutorium für LehramtskandidatInnen
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professur für Politikwissenschaft, insb. Politische Systeme Lehrstuhl für Internationale Beziehungen Lehrstuhl für Politikwissenschaft I Tutorium für LehramtskandidatInnen
Hölderlin-Gymnasium Nürtingen
 Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Kern- und Schulcurriculum Gemeinschaftskunde/Wirtschaft Klasse 9 Kern- und Schulcurriculum bilden im Fach Gemeinschaftskunde/Wirtschaft am Hölderlin-Gymnasium eine Einheit.
Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Kern- und Schulcurriculum Gemeinschaftskunde/Wirtschaft Klasse 9 Kern- und Schulcurriculum bilden im Fach Gemeinschaftskunde/Wirtschaft am Hölderlin-Gymnasium eine Einheit.
Politikwissenschaft. Einführung Sommersemester 2013
 Politikwissenschaft Einführung Sommersemester 2013 Studium der Politikwissenschaft Was Sie mitbringen... Politisches Interesse und regelmäßige Zeitungslektüre Freude am wissenschaftlichen Arbeiten Lesen,
Politikwissenschaft Einführung Sommersemester 2013 Studium der Politikwissenschaft Was Sie mitbringen... Politisches Interesse und regelmäßige Zeitungslektüre Freude am wissenschaftlichen Arbeiten Lesen,
Neue Biotechnologien zwischen wissenschaftlich-technischer Rationalisierung und öffentlichem Diskurs
 Univ.-Prof. Dr. Thomas Saretzki Lehrveranstaltungen 1. Lehraufträge an der Universität Hamburg Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften, Institut für Politische Wissenschaft Übungen bzw. Lektürekurs
Univ.-Prof. Dr. Thomas Saretzki Lehrveranstaltungen 1. Lehraufträge an der Universität Hamburg Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften, Institut für Politische Wissenschaft Übungen bzw. Lektürekurs
Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen
 Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland
 Bernhard Schäfers Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland Ein Studienbuch zu ihrer Soziologie und Sozialgeschichte 3 Abbildungen und &5 Tabellen 6 Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1976
Bernhard Schäfers Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland Ein Studienbuch zu ihrer Soziologie und Sozialgeschichte 3 Abbildungen und &5 Tabellen 6 Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1976
Geschichte des jüdischen Volkes
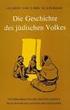 Geschichte des jüdischen Volkes Von den Anfängen bis zur Gegenwart Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger s Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menahem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben
Geschichte des jüdischen Volkes Von den Anfängen bis zur Gegenwart Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger s Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menahem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben
Modulbeschreibung: Bachelor of Arts Politikwissenschaft (Beifach) (Stand: März 2013)
 Modulbeschreibung: Bachelor of Arts Politikwissenschaft (Beifach) (Stand: März 2013) Modul 1: Einführung und methodische Grundlagen work load Leistungspunkte Studiensemester Dauer 360 h 12 LP 1./2. Semester
Modulbeschreibung: Bachelor of Arts Politikwissenschaft (Beifach) (Stand: März 2013) Modul 1: Einführung und methodische Grundlagen work load Leistungspunkte Studiensemester Dauer 360 h 12 LP 1./2. Semester
Anstöße. Gesellschaftslehre mit Geschichte. Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales
 Anstöße Gesellschaftslehre mit Geschichte Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales Didaktische Jahresplanung Gesellschaftslehre mit Geschichte Berufsfeld Erziehung und Soziales Schule
Anstöße Gesellschaftslehre mit Geschichte Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales Didaktische Jahresplanung Gesellschaftslehre mit Geschichte Berufsfeld Erziehung und Soziales Schule
NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8
 3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
Prof. Dr. Stefan Schieren
 SUB Hamburg A2010/3244 Föderalismus in Deutschland herausgegeben von Dr. Klaus Detterbeck, Prof. Dr. Wolfgang Renzsch und Prof. Dr. Stefan Schieren Oldenbourg Verlag München Inhalt Vorwort Über die Autoren
SUB Hamburg A2010/3244 Föderalismus in Deutschland herausgegeben von Dr. Klaus Detterbeck, Prof. Dr. Wolfgang Renzsch und Prof. Dr. Stefan Schieren Oldenbourg Verlag München Inhalt Vorwort Über die Autoren
Lehrplan Sozialwissenschaften im Überblick
 Inhaltsfeld 1 Inhaltsfeld 2 Inhaltsfeld 3 Die soziale Marktwirtschaft vor neuen Bewährungsproben Jugendliche im Prozess der Vergesellschaftung und der Persönlichkeitsbildung Demokratie zwischen Anspruch
Inhaltsfeld 1 Inhaltsfeld 2 Inhaltsfeld 3 Die soziale Marktwirtschaft vor neuen Bewährungsproben Jugendliche im Prozess der Vergesellschaftung und der Persönlichkeitsbildung Demokratie zwischen Anspruch
Paul. Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. Verlag C.H.Beck
 Paul Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart Verlag C.H.Beck INHALT I Einleitung: Fragen an Demokratie 9 II Anfänge Nicht wir: Die Erfindung der Demokratie in Athen 26 2 Herrschaft des Volkes: Funktionsweisen
Paul Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart Verlag C.H.Beck INHALT I Einleitung: Fragen an Demokratie 9 II Anfänge Nicht wir: Die Erfindung der Demokratie in Athen 26 2 Herrschaft des Volkes: Funktionsweisen
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 10. Vorlesung 22. Dezember Policy-Analyse 1: Einführung
 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Inhalt. Vorwort... Vorwort zur 2. Auflage... Vorwort zur 1. Auflage...
 Inhalt Vorwort... Vorwort zur 2. Auflage... Vorwort zur 1. Auflage... EINFÜHRUNG: EUROPA ALS POLITISCHE IDEE I. MENSCHENRECHTE DER EUROPARAT UND SEINE KULTURKONVENTION Der europäische Neubeginn... Allgemeine
Inhalt Vorwort... Vorwort zur 2. Auflage... Vorwort zur 1. Auflage... EINFÜHRUNG: EUROPA ALS POLITISCHE IDEE I. MENSCHENRECHTE DER EUROPARAT UND SEINE KULTURKONVENTION Der europäische Neubeginn... Allgemeine
SS05 Grundkurs I Grundkurs II Grundkurs III Einblicke in die empirische Forschung Einführung in die Entwicklungspolitik Die erweiterte EU
 Übersicht aller Klausuren Bitte beachten Sie, dass einige Klausuren nur zur Einsicht im SIC liegen. SS04 I V Ökonomik II Kuschel Verwaltungsrecht II Regieren im Mehrebenensystem der EU Pastoors Vergleich
Übersicht aller Klausuren Bitte beachten Sie, dass einige Klausuren nur zur Einsicht im SIC liegen. SS04 I V Ökonomik II Kuschel Verwaltungsrecht II Regieren im Mehrebenensystem der EU Pastoors Vergleich
8 Werte / Religion / Jugend
 8 Werte / Religion / Jugend Werte / Religion Thomas Schweer / Stefan Braun Religionen der Welt Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam 7. Auflage München 2005. Publ., 494 S. Entstehung, Lehre
8 Werte / Religion / Jugend Werte / Religion Thomas Schweer / Stefan Braun Religionen der Welt Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam 7. Auflage München 2005. Publ., 494 S. Entstehung, Lehre
3 Studienbeginn Das Studium kann jeweils zu Beginn des Winter- oder Sommersemesters aufgenommen werden.
 Studienordnung für das Haupt- und Nebenfach Politikwissenschaft im Magisterstudiengang an der Technischen Universität Chemnitz Vom 17. Mai 2001 Aufgrund von 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen
Studienordnung für das Haupt- und Nebenfach Politikwissenschaft im Magisterstudiengang an der Technischen Universität Chemnitz Vom 17. Mai 2001 Aufgrund von 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen
Präsenzseminar: Staat und Religion in Deutschland
 Präsenzseminar: Staat und Religion in Deutschland 25. bis 27. April 2014, FernUniversität in Hagen Staat und Religion in Deutschland 1 Inhalt Das Verhältnis von Staat und Religion hat sich in Deutschland
Präsenzseminar: Staat und Religion in Deutschland 25. bis 27. April 2014, FernUniversität in Hagen Staat und Religion in Deutschland 1 Inhalt Das Verhältnis von Staat und Religion hat sich in Deutschland
Schulcurriculum Gemeinschaftskunde (Stand: Juli 2012) Neigungskurs - Jahrgangsstufe 1und 2 (4-stündig)
 Schulcurriculum Gemeinschaftskunde (Stand: Juli 2012) Neigungskurs - Jahrgangsstufe 1und 2 (4-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise 1. Sozialstruktur und Sozialstaatlichkeit im Wandel 1.1 Gesellschaftlicher
Schulcurriculum Gemeinschaftskunde (Stand: Juli 2012) Neigungskurs - Jahrgangsstufe 1und 2 (4-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise 1. Sozialstruktur und Sozialstaatlichkeit im Wandel 1.1 Gesellschaftlicher
Europäische Integration
 Europäische Integration Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte Von Professor Dr. Ulrich Brasche R.Oldenbourg Verlag München Wien 1 Europäische Institutionen und Prozesse 11 1.1 Der europäische Integrationsprozess
Europäische Integration Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte Von Professor Dr. Ulrich Brasche R.Oldenbourg Verlag München Wien 1 Europäische Institutionen und Prozesse 11 1.1 Der europäische Integrationsprozess
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft. Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit. Modul-Handbuch
 Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
G R U N D S T U D I U M, Wintersemester 2002/2003
 G R U N D S T U D I U M, Wintersemester 2002/2003 Beginn der Lehrveranstaltungen: 28. Oktober 2002 Ende der Lehrveranstaltungen: 22. Februar 2003 MONTAG 1034 08-09 Kamp Erfahrungen aus Praktika zwischen
G R U N D S T U D I U M, Wintersemester 2002/2003 Beginn der Lehrveranstaltungen: 28. Oktober 2002 Ende der Lehrveranstaltungen: 22. Februar 2003 MONTAG 1034 08-09 Kamp Erfahrungen aus Praktika zwischen
Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland
 Thomas Ellwein Joachim Jens Hesse Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage Westdeutscher Verlag Inhalt Vorwort zur sechsten Auflage XIII Einführung
Thomas Ellwein Joachim Jens Hesse Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage Westdeutscher Verlag Inhalt Vorwort zur sechsten Auflage XIII Einführung
Vorbesprechung Thematischer Aufriss, Vergabe von Referaten, Organisatorisches AR - AR-UB 032 Senatssaal. Freitag,
 Nationalstaaten in Europa - Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Prozess der europäischen Integration Kompaktseminar von Dr. Christian Krell, BA SSc ES 2.1 GR, HR, GYM V1-V3 Vorbesprechung Thematischer
Nationalstaaten in Europa - Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Prozess der europäischen Integration Kompaktseminar von Dr. Christian Krell, BA SSc ES 2.1 GR, HR, GYM V1-V3 Vorbesprechung Thematischer
Globalisierung und soziale Ungleichheit. Einführung in das Thema
 Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19. jahrhundert 8
 3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
BA-Studium SWS Credits 1) Einführung in die Rechtswissenschaft Vorlesung mit Klausur 2 4 (Grundbegriffe des Rechts und der juristischen Methodik)
 Prof. Dr. J. Sieckmann Professur für Öffentliches Recht Lehrangebot für Bachelor-/Masterstudiengänge Übersicht BA-Studium SWS Credits 1) Einführung in die Rechtswissenschaft Vorlesung mit 2 4 (Grundbegriffe
Prof. Dr. J. Sieckmann Professur für Öffentliches Recht Lehrangebot für Bachelor-/Masterstudiengänge Übersicht BA-Studium SWS Credits 1) Einführung in die Rechtswissenschaft Vorlesung mit 2 4 (Grundbegriffe
Formen aktiver Teilnahme. Diskussion, Referat, Thesenpapier, Protokoll, Exzerpt, Arbeitsgruppen. 210 Modulprüfung
 Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Politikwissenschaft für das Lehramt und das -Leistungspunkte-Modulangebot Politikwissenschaft für das Lehramt im Rahmen anderer Studiengänge des Fachbereichs Politik-
Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Politikwissenschaft für das Lehramt und das -Leistungspunkte-Modulangebot Politikwissenschaft für das Lehramt im Rahmen anderer Studiengänge des Fachbereichs Politik-
Busse Löwenstein Roos. Vorlesung Einführung in die Außenwirtschaft (Busse oder Roos, 2 SWS)
 Name des Moduls Verantwortliche Einheit Dozentin/Dozent Verwendbarkeit und Verwertbarkeit des Moduls Frequenz und Zeitmodus Lehrveranstaltungen Grundlagen der Außenwirtschaft und Entwicklungspolitik Lehrstuhl
Name des Moduls Verantwortliche Einheit Dozentin/Dozent Verwendbarkeit und Verwertbarkeit des Moduls Frequenz und Zeitmodus Lehrveranstaltungen Grundlagen der Außenwirtschaft und Entwicklungspolitik Lehrstuhl
Modulbeschreibung: Bachelor of Arts Politikwissenschaft (Beifach) (Stand: Oktober 2014)
 Modulbeschreibung: Bachelor of Arts Politikwissenschaft (Beifach) (Stand: Oktober 2014) Modul 1B: Einführung und methodische Grundlagen Regelsemester (laut M.02.129.009 360 h 2 Semester 1./2. Semester
Modulbeschreibung: Bachelor of Arts Politikwissenschaft (Beifach) (Stand: Oktober 2014) Modul 1B: Einführung und methodische Grundlagen Regelsemester (laut M.02.129.009 360 h 2 Semester 1./2. Semester
STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK
 STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik
STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik
Modulhandbuch Politikwissenschaft im Fach Sozialkunde an Grund- und Hauptschulen sowie Gymnasien. Ab Wintersemester 2012/13
 Modulhandbuch Politikwissenschaft im Fach Sozialkunde an Grund- und Hauptschulen sowie Gymnasien Ab Wintersemester 2012/13 1. Modulhandbuch für Lehramt an Grund- und Hauptschule Modulübersicht: Modulgruppe
Modulhandbuch Politikwissenschaft im Fach Sozialkunde an Grund- und Hauptschulen sowie Gymnasien Ab Wintersemester 2012/13 1. Modulhandbuch für Lehramt an Grund- und Hauptschule Modulübersicht: Modulgruppe
SS05 Grundkurs I Grundkurs II Grundkurs III Einblicke in die empirische Forschung Einführung in die Entwicklungspolitik Die erweiterte EU
 Übersicht aller Klausuren Bitte beachten Sie, dass einige Klausuren nur zur Einsicht im SIC liegen. SS04 I Ökonomik II Kuschel Verwaltungsrecht II Regieren im Mehrebenensystem der EU Pastoors Vergleich
Übersicht aller Klausuren Bitte beachten Sie, dass einige Klausuren nur zur Einsicht im SIC liegen. SS04 I Ökonomik II Kuschel Verwaltungsrecht II Regieren im Mehrebenensystem der EU Pastoors Vergleich
Europäische. Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert
 Europäische Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert Überblick Krieg und Frieden Europa und die Welt Exklusion und Inklusion Demokratie, Partizipation, Zivilgesellschaft Organisatorisches Anwesenheit Sprechstunde:
Europäische Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert Überblick Krieg und Frieden Europa und die Welt Exklusion und Inklusion Demokratie, Partizipation, Zivilgesellschaft Organisatorisches Anwesenheit Sprechstunde:
Selbstüberprüfung: Europa und die Welt im 19. Jahrhundert. 184
 3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
LE K: Kommentar und wichtige Hinweise (1 von 10)
 Wirtschaft und Finanzen ihre internationale Ordnung und Steuerung WS 2012/13 LE K: Kommentar LE 1: Der Gegenstand der Vorlesung und Abgrenzungen LE 2: Die Theorienvielfalt, ein Theorienüberblick LE 3:
Wirtschaft und Finanzen ihre internationale Ordnung und Steuerung WS 2012/13 LE K: Kommentar LE 1: Der Gegenstand der Vorlesung und Abgrenzungen LE 2: Die Theorienvielfalt, ein Theorienüberblick LE 3:
Universität Trier. Informationen zum Sommersemester 2003
 Universität Trier Fachbereich I PÄDAGOGIK Informationen zum Sommersemester 2003 G R U N D S T U D I U M 1 G R U N D S T U D I U M Sommersemester 2003 Beginn der Lehrveranstaltungen: 28. April 2003 Ende
Universität Trier Fachbereich I PÄDAGOGIK Informationen zum Sommersemester 2003 G R U N D S T U D I U M 1 G R U N D S T U D I U M Sommersemester 2003 Beginn der Lehrveranstaltungen: 28. April 2003 Ende
Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A Qualifikationsziele vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen
 Modulbeschreibungen M.A. Politikwissenschaft Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Politikwissenschaft, der Forschungsmethoden der
Modulbeschreibungen M.A. Politikwissenschaft Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Politikwissenschaft, der Forschungsmethoden der
Europäisierung" der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik?
 Axel Lüdeke Europäisierung" der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Konsumtive und operative Europapolitik zwischen Maastricht und Amsterdam Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhaltsverzeichnis Vorwort
Axel Lüdeke Europäisierung" der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Konsumtive und operative Europapolitik zwischen Maastricht und Amsterdam Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhaltsverzeichnis Vorwort
Die Europäische Union
 Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter
Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig)
 Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Veranstaltungen Lehramt Grund- und Mittelschule, Sozialkunde Unterrichtsfach
 Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft Lehrprogramm WiSe 2016/17 Lehramt Sozialkunde (neue modularisierte Studiengänge) Stand: 20.10.2016 Veranstaltungen Lehramt Grund- und Mittelschule, Sozialkunde
Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft Lehrprogramm WiSe 2016/17 Lehramt Sozialkunde (neue modularisierte Studiengänge) Stand: 20.10.2016 Veranstaltungen Lehramt Grund- und Mittelschule, Sozialkunde
Vaiva Bernotaite. SUB Hamburg A 2008/8268
 Vaiva Bernotaite SUB Hamburg A 2008/8268 Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft (EG) mit den Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) PETER LANG Europäischer Verlag
Vaiva Bernotaite SUB Hamburg A 2008/8268 Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft (EG) mit den Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) PETER LANG Europäischer Verlag
Grundzüge des Europarechts. Prof. Dr. H. Goerlich WS
 Grundzüge des Europarechts Prof. Dr. H. Goerlich WS 2006-2007 Verwendete Illustrationen und Schaubilder: Europäische Gemeinschaften, 1995-2006 Grundzüge des Europarechts III. Politisches System der EU:
Grundzüge des Europarechts Prof. Dr. H. Goerlich WS 2006-2007 Verwendete Illustrationen und Schaubilder: Europäische Gemeinschaften, 1995-2006 Grundzüge des Europarechts III. Politisches System der EU:
Modulplan: M.A. Deutsche und Europäische Politik
 Modulplan: M.A. Deutsche und Europäische Politik V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich 1 (es sind 6 aus 9 Modulen zu wählen) Modul Dauer Teilnahmevoraussetzungen
Modulplan: M.A. Deutsche und Europäische Politik V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich 1 (es sind 6 aus 9 Modulen zu wählen) Modul Dauer Teilnahmevoraussetzungen
Manifest. für eine. Muslimische Akademie in Deutschland
 Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Vorwort 5. Einleitung 13. Erster Teil Kultur im Verfassungsrecht 19. Kapitel 1 Zur Bestimmung eines rechtlichen Kulturbegriffs 21
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Einleitung 13 Erster Teil Kultur im Verfassungsrecht 19 Kapitel 1 Zur Bestimmung eines rechtlichen Kulturbegriffs 21 A. Notwendigkeit und Probleme der Bestimmung eines rechtlichen
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Einleitung 13 Erster Teil Kultur im Verfassungsrecht 19 Kapitel 1 Zur Bestimmung eines rechtlichen Kulturbegriffs 21 A. Notwendigkeit und Probleme der Bestimmung eines rechtlichen
Modulhandbuch Bachelor of Education Sozialkunde für berufsbildende Schulen
 Modulhandbuch Bachelor of Education Sozialkunde für berufsbildende Schulen Modul 1: Grundlagen der Politikwissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen Einführung in die Politikwissenschaft 4 SWSx15= 2 Lehrform
Modulhandbuch Bachelor of Education Sozialkunde für berufsbildende Schulen Modul 1: Grundlagen der Politikwissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen Einführung in die Politikwissenschaft 4 SWSx15= 2 Lehrform
1. Institut für Politikwissenschaft, Fachbereich Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Prof. Dr. Reinhard Rode Lehrtätigkeit 1. Institut für Politikwissenschaft, Fachbereich Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg SS 2005 Forschungssemester
Prof. Dr. Reinhard Rode Lehrtätigkeit 1. Institut für Politikwissenschaft, Fachbereich Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg SS 2005 Forschungssemester
Hölderlin-Gymnasium Nürtingen
 Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Kern- und Schulcurriculum Gemeinschaftskunde Kursstufe (4-stündig) Kern- und Schulcurriculum bilden im Fach Gemeinschaftskunde/Wirtschaft am Hölderlin-Gymnasium eine Einheit.
Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Kern- und Schulcurriculum Gemeinschaftskunde Kursstufe (4-stündig) Kern- und Schulcurriculum bilden im Fach Gemeinschaftskunde/Wirtschaft am Hölderlin-Gymnasium eine Einheit.
Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges
 Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Modulhandbuch. für den Teilstudiengang. Wirtschaft / Politik
 Modulhandbuch für den Teilstudiengang Wirtschaft / Politik im Studiengang (gewerblich-technische Wissenschaften) der Universität Flensburg Fassung vom.07.010 Studiengang: Modultitel: Grundlagen der Politikwissenschaft
Modulhandbuch für den Teilstudiengang Wirtschaft / Politik im Studiengang (gewerblich-technische Wissenschaften) der Universität Flensburg Fassung vom.07.010 Studiengang: Modultitel: Grundlagen der Politikwissenschaft
Hans Adam, Peter Mayer. Europäische Integration. Einführung für Ökonomen. UVKVerlagsgesellschaft mbh Konstanz mit UVK/Lucius München
 Hans Adam, Peter Mayer Europäische Integration Einführung für Ökonomen UVKVerlagsgesellschaft mbh Konstanz mit UVK/Lucius München Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 13 Weiterführende Literatur
Hans Adam, Peter Mayer Europäische Integration Einführung für Ökonomen UVKVerlagsgesellschaft mbh Konstanz mit UVK/Lucius München Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 13 Weiterführende Literatur
Das Verhältnis des Heiligen Stuhls zur Europäischen Union im Lichte des Völkerrechts
 Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 4985 Das Verhältnis des Heiligen Stuhls zur Europäischen Union im Lichte des Völkerrechts Bearbeitet
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 4985 Das Verhältnis des Heiligen Stuhls zur Europäischen Union im Lichte des Völkerrechts Bearbeitet
Die Grundvorrausetzung für den Scheinerwerb ist eine aktive Teilnahme an den Seminar-sitzungen.
 Wintersemester 2008/ 09 Dr. Ulrich Glassmann Proseminar/Übung (1460): Vergleichende Politikwissenschaft: Das politische System der BRD Fr. 14.00 15.30 Uhr, Philosophicum (S58) Beginn: 17. Oktober 2008
Wintersemester 2008/ 09 Dr. Ulrich Glassmann Proseminar/Übung (1460): Vergleichende Politikwissenschaft: Das politische System der BRD Fr. 14.00 15.30 Uhr, Philosophicum (S58) Beginn: 17. Oktober 2008
Modulhandbuch. Modulbeschreibung Basismodul A 101 Einführung in das deutsche Rechtssystem 6 LP Pflichtmodul Basismodul Inhalt:
 Modulhandbuch A 101 Einführung in das deutsche Rechtssystem Pflichtmodul Der Student / Die Studentin kennt die Grundlagen des deutschen Rechtssystems. Er / Sie hat die Fertigkeit, aufbauend auf dem gelernten
Modulhandbuch A 101 Einführung in das deutsche Rechtssystem Pflichtmodul Der Student / Die Studentin kennt die Grundlagen des deutschen Rechtssystems. Er / Sie hat die Fertigkeit, aufbauend auf dem gelernten
1. politikgeschichtliche Dimension 2. wirtschaftsgeschichtliche Dimension 3. sozialgeschichtliche Dimension 4. kulturgeschichtliche Dimension
 Zentralabitur Jahrgangsstufe 11/I Thema: Die Idee Europa" Lernbereich I: Lernbereich II: Lernbereich III: Zeitfeld: 1. politikgeschichtliche Dimension 2. wirtschaftsgeschichtliche Dimension 3. sozialgeschichtliche
Zentralabitur Jahrgangsstufe 11/I Thema: Die Idee Europa" Lernbereich I: Lernbereich II: Lernbereich III: Zeitfeld: 1. politikgeschichtliche Dimension 2. wirtschaftsgeschichtliche Dimension 3. sozialgeschichtliche
Zivile Konfliktbearbeitung
 Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Master of Arts in Public Opinion and Survey Methodology
 Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Soziologisches Seminar Master of Arts in Public Opinion and Survey Methodology Das Bevölkerungswissen, die öffentliche Meinung und das Konsumverhalten wissenschaftlich
Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Soziologisches Seminar Master of Arts in Public Opinion and Survey Methodology Das Bevölkerungswissen, die öffentliche Meinung und das Konsumverhalten wissenschaftlich
- die Demokratie und politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland würdigen, auch auf lokaler Ebene
 Fachbereiche: Kommunaler Verwaltungsdienst Staatlicher Verwaltungsdienst Polizeivollzugsdienst Hinweis: Integrativ Fach: Politikwissenschaft Gesamtstunden 50 L E R N Z I E L Die Studierenden sollen - das
Fachbereiche: Kommunaler Verwaltungsdienst Staatlicher Verwaltungsdienst Polizeivollzugsdienst Hinweis: Integrativ Fach: Politikwissenschaft Gesamtstunden 50 L E R N Z I E L Die Studierenden sollen - das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur: Grundwissen Europäische Union IV - Die Finanzkrise und die Zukunft der EU Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur: Grundwissen Europäische Union IV - Die Finanzkrise und die Zukunft der EU Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
oder Klausur (60-90 Min.) Päd 4 Päd. Arbeitsfelder und Handlungsformen*) FS Vorlesung: Pädagogische Institutionen und Arbeitsfelder (2 SWS)
 Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Grundkurs Q 1/1 Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert Ein deutscher Sonderweg?
 Grundkurs Q 1/1 Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert Ein deutscher Sonderweg? Vorhabenbezogene Konkretisierung: Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen
Grundkurs Q 1/1 Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert Ein deutscher Sonderweg? Vorhabenbezogene Konkretisierung: Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen
Lehrangebot Master Politik und Master Verwaltung
 Lehrangebot Master Politik und Master Verwaltung MASTER POLITIKWISSENSCHAFT Kernmodul: Politische Theorie Politische Urteilskraft was ist das? S Do 14.00-16.00 3.06.S 28 Heinz Kleger Facetten der Macht
Lehrangebot Master Politik und Master Verwaltung MASTER POLITIKWISSENSCHAFT Kernmodul: Politische Theorie Politische Urteilskraft was ist das? S Do 14.00-16.00 3.06.S 28 Heinz Kleger Facetten der Macht
Universität Hamburg S TUDIENORDNUNG. für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (4. 10.
 Universität Hamburg Fachbereich Wirtschaftswissenschaften S TUDIENORDNUNG für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (4. 10. 1996) 2 Die Studienordnung konkretisiert die Prüfungsordnung und regelt
Universität Hamburg Fachbereich Wirtschaftswissenschaften S TUDIENORDNUNG für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (4. 10. 1996) 2 Die Studienordnung konkretisiert die Prüfungsordnung und regelt
Teil III: Politikfelder die inhaltliche Dimension der Politik
 Teil III: Politikfelder die inhaltliche Dimension der Politik Policy: bezeichnet den inhaltlichen (den materiellen) Teil von Politik, wie er im Deutschen üblicherweise durch verschiedene Politikbereiche
Teil III: Politikfelder die inhaltliche Dimension der Politik Policy: bezeichnet den inhaltlichen (den materiellen) Teil von Politik, wie er im Deutschen üblicherweise durch verschiedene Politikbereiche
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Unterrichts- Vorhaben 2
 Schulinterner Lehrplan der Fachschaft Geschichte für die Qualifikationsphase Halbjahr Anzahl der Unterrichtsstunden 1 Qualifikationsphase Unterrichts- Vorhaben 2 Inhaltsfelder des KLP 3 GK LK Q1/1 1. 15
Schulinterner Lehrplan der Fachschaft Geschichte für die Qualifikationsphase Halbjahr Anzahl der Unterrichtsstunden 1 Qualifikationsphase Unterrichts- Vorhaben 2 Inhaltsfelder des KLP 3 GK LK Q1/1 1. 15
Theorien der Europäischen Integration. LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien
 Theorien der Europäischen Integration LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien FAKULTÄT FÜR EUROPASTUDIEN WINTERSEMESTER 2016 Phasen der Integrationstheorie Phase Zeit
Theorien der Europäischen Integration LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien FAKULTÄT FÜR EUROPASTUDIEN WINTERSEMESTER 2016 Phasen der Integrationstheorie Phase Zeit
Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte
 Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte Modul Einführung in die slavische Sprach- und Literaturwissenschaft Veranstaltungen: Einführungsseminar Einführung in die Literaturwissenschaft (2 SWS, 6 ECTS, benotet);
Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte Modul Einführung in die slavische Sprach- und Literaturwissenschaft Veranstaltungen: Einführungsseminar Einführung in die Literaturwissenschaft (2 SWS, 6 ECTS, benotet);
Politische Kultur in Deutschland
 Politische Kultur in Deutschland Bilanz und Perspektiven der Forschung Herausgegeben von Dirk Berg-Schlosser und Jakob Schissler T i Westdeutscher Verlag Inhalt Vorwort 9 I. Einführung Dirk Berg-Schlosser/Jakob
Politische Kultur in Deutschland Bilanz und Perspektiven der Forschung Herausgegeben von Dirk Berg-Schlosser und Jakob Schissler T i Westdeutscher Verlag Inhalt Vorwort 9 I. Einführung Dirk Berg-Schlosser/Jakob
dtv Rechtsstellung Deutschlands Völkerrechtliche Verträge und andere rechtsgestaltende Akte
 410 Rechtsstellung Deutschlands Völkerrechtliche Verträge und andere rechtsgestaltende Akte Atlantik-Charta Potsdamer Abkommen Deutschlandvertrag Viermächte-Abkommen über Berlin Transitabkommen Moskauer
410 Rechtsstellung Deutschlands Völkerrechtliche Verträge und andere rechtsgestaltende Akte Atlantik-Charta Potsdamer Abkommen Deutschlandvertrag Viermächte-Abkommen über Berlin Transitabkommen Moskauer
1 Gesellschaft in Deutschland 11
 Themenübersicht 1 Gesellschaft in Deutschland 11 1.1 Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entwicklung 1. Bevölkerungsentwicklung - sind Trends erkennbar? 12 2. Wo und wie wohnen die
Themenübersicht 1 Gesellschaft in Deutschland 11 1.1 Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entwicklung 1. Bevölkerungsentwicklung - sind Trends erkennbar? 12 2. Wo und wie wohnen die
Einführungsveranstaltung Bachelor Interkulturelle Kommunikation
 Einführungsveranstaltung Bachelor Interkulturelle Kommunikation Referentin: Susanne Held M.A. 09.10.2014 1 Gliederung 1. Überblick über den Studiengang 2. Grundlegende Fragen und Themen 3. Interdisziplinarität
Einführungsveranstaltung Bachelor Interkulturelle Kommunikation Referentin: Susanne Held M.A. 09.10.2014 1 Gliederung 1. Überblick über den Studiengang 2. Grundlegende Fragen und Themen 3. Interdisziplinarität
Formen aktiver Teilnahme. Diskussionsbeteiligung, vorund nachbereitende Lektüre
 3n Kunstgeschichte Modul: Einführungsmodul Ostasien: Kunst und materielle Kultur Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunsthistorisches
3n Kunstgeschichte Modul: Einführungsmodul Ostasien: Kunst und materielle Kultur Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunsthistorisches
Gemeinschaftskunde / GWG Gemeinschaftskunde / GWG - Klasse 9 - Version 1 (Juli 2004)
 Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. - Gemeinschaftskunde / GWG Gemeinschaftskunde / GWG Gemeinschaftskunde / GWG - Klasse 9 - Version 1 (Juli 2004) Themenfeld Kerncurriculum
Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. - Gemeinschaftskunde / GWG Gemeinschaftskunde / GWG Gemeinschaftskunde / GWG - Klasse 9 - Version 1 (Juli 2004) Themenfeld Kerncurriculum
Das Politische System Deutschlands
 Das Politische System Deutschlands Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Geschwister-Scholl-Institut Vierte Sitzung: Die Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes Pflichtvorlesung im Wintersemester
Das Politische System Deutschlands Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Geschwister-Scholl-Institut Vierte Sitzung: Die Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes Pflichtvorlesung im Wintersemester
Schulinternes Curriculum Sek. II Geschichte des Gymnasium der Stadt Frechen Q2
 Unterrichtsvorhaben nach KLP Sek II Geschichte 1 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg : SK 3, SK 4 MK 2, MK 7 : UK 2, UK 7 Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen,
Unterrichtsvorhaben nach KLP Sek II Geschichte 1 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg : SK 3, SK 4 MK 2, MK 7 : UK 2, UK 7 Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen,
