Die Hässlichkeit des Kranken. Zur psychosozialen Bedeutung mittelalterlicher Schönheitsvorstellungen am Beispiel der Leprakranken
|
|
|
- Sarah Fuchs
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Hässlichkeit des Kranken. Zur psychosozialen Bedeutung mittelalterlicher Schönheitsvorstellungen am Beispiel der Leprakranken Antje Schelberg Schönheitsbeschreibungen in mittelalterlichen Schriftzeugnissen belegen, dass 'Schönheit' in jden Vorstellungen des laikalen und klerikalen Adels ein ebenso wichtiges individuelles Attribut wie auch einen bedeutenden sozialen Wert darstellte. Nun erweist bereits ein kursorischer Blick in Quellentexte wie beispielsweise das sozial- und mentalitätengeschichtlich so interessante hagiografische Schrifttum, dass es im Mittelalter eine große Zahl an Menschen gab, die aufgrund gravierender körperlicher Defekte zwangsweise nicht in der Lage waren, den körperbezogenen ästhetischen Idealvorstellungen ihrer Zeit zu entsprechen und daher nicht als 'schön' galten. Hierzu zählten beispielsweise Gebrechliche, Verstümmelte und andere Körperbehinderte - und nicht zuletzt die Leprakranken. Wenn im folgenden am Beispiel der Leprakranken sozialpsychologische Dimensionen von früh- und hochmittelalterlichen Schönheits- und Hässlichkeitsvorstellungen ansatzweise vorgestellt werden, dann soll hier mit dem Begriff 'Lepra' durchaus das moderne Krankheitsverständnis der schwer deformierenden Form der Hansen-Krankheit, der sogenannten lepromatösen oder auch Knotenlepra, als Ausgangsbasis zugrunde gelegt werden. Dieses dem ersten Anschein nach anachronistisch anmutende Vorgehen legitimiert sich aus der Beobachtung, dass bereits die gelehrte Medizin der spätrömischen Antike und dann vor allem wieder die des Hochmittelalters unter dem Begriff lepra ein Krankheitsbild konzipierte, welches den Grundstock für unser heutiges medizinisches Lepraverständnis legte 1. Es kam daher bei der Auswahl der hier zu betrachtenden Quellen vor allem darauf an, dass die Krankheits- oder Krankenbeschreibungen deutliche Hinweise auf gravierende lepratypische Symptome wie zum Beispiel Deformitäten der zentralen Gesichtspartien oder der Extremitäten, ferner Geschwürbildung, Lähmungserscheinungen, Insensibilität etc. enthalten. Bei der Besprechung mittelalterlicher Beschreibungen von Leprosen soll es im folgenden um dreierlei gehen: um eine Darlegung, aufgrund welcher konkreten
2 2 physischen Merkmale die Leprakranken im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium als 'hässlich' empfunden wurden (I.); um eine Präsentation von Belegen für den Sachverhalt, dass die Leprakranken in der gesellschaftlichen Wahrnehmung häufig als tierartige Wesen figurierten (II.), und schließlich um die Frage, welche tiefgreifenderen sozialpsychologischen Implikationen eine derartige Zuschreibung bedeutete (III.) 2. I. Für eine Untersuchung über Schönheits- und Hässlichkeitsvorstellungen im Mittelalter erscheinen auf den ersten Blick literarische Schönheitsbeschreibungen in der hochmittelalterlichen Epik und Lyrik als die geeignetste, weil sehr komprimierte Materialbasis; doch haben zahlreiche literaturwissenschaftliche Studien der vergangenen Dekaden übereinstimmend hochgradig fiktionalen wie stereotypen Charakter solcher Schönheitsdeskriptionen herausgestellt 3. Weder allgemeine Schönheitsbezeichnungen noch katalogartige Schönheitsbeschreibungen präsentieren demzufolge eine sprachliche Umsetzung einer realiter geschauten, individuellen Schönheit bei Frauen und Männern, sondern übernehmen als Idealbilder - zumal im Kontrast zu Darstellungen von 'Hässlichkeit' - in der höfischen Epik gattungsbedingte und literaturspezifische Funktionen im Hinblick auf die Konstruktion von Erzählgang, Themen, Personenkonstellationen, sozialen Identitäten usw. In diesem Sinn hat PETER JOHANEK zu Recht auf die Funktionalisierung auch von Leprosen in der höfischen Literatur hingewiesen, wo das Auftreten dieser Personengruppe vorrangig der Konstruktion einer "Gegenwelt" zur adligen Lebensweise dient: "Die höfische, ritterlich-adelige Welt des hohen Mittelalters [...] betrachtete die Lepra - die»miselsuht«- mit unverhohlener Abscheu. Die von ihr Befallenen erschienen ihr wie Bestien der Wildnis, die kaum Menschliches an sich haben, sie werden gezeichnet als absolute Gegenwelt zur Glanz und Pracht des Hofes, zur >>fröude<< des höfischen Festes" 4. Diese spezifisch literarische Stilisierung war keineswegs ausschließlich auf die
3 3 Krankengruppe der Leprosen begrenzt: Aufgrund seiner Studien kam HENRIK SPECHT zu dem Schluss, dass in der höfischen Literatur körperliche 'Hässlichkeit' allgemein eine Indikatorfunktion für einen niedrigen Sozialstatus einnahm und daher - mit HARRY KÜHNEL gesprochen - eine Chiffre für eine "kulturinterne Alterität, die»eigene Fremde«" darstellte 5. Mit Bezug auf die Schönheits- und Hässlichkeitsdarstellungen in Chrétien de Troyes' Yvain sprach Specht sogar von der literarischen Darbietung eines "clash between opposite aesthetic and ethical values, but also, most emphatically, a clash between contrasting social orders" 6. Darüber hinaus konnte physische Hässlichkeit auch die moralische Verwerflichkeit und Verderbtheit der dargestellten Personen versinnbildlichen; hierfür bieten neben literarischen Schilderungen vor allem spätmittelalterliche Bilddarstellungen von Verbrechern, Teufelsfiguren oder aber den Peinigern Christi auf Passionsbildern augenfällige und höchst eindringliche Beispiele 7. Allgemein weisen literarischen Darstellungsformen für 'schöne' und 'hässliche' Menschen im Mittelalter Komponenten auf, die in ihren Grundeigenschaften an Schönheitsdefinitionen wie beispielsweise jene des Theologen und Philosophen Thomas von Aquin (ca ) erinnern. Dessen (nicht systematisch ausgearbeitete) Definition von 'Schönheit' beruhte maßgeblich auf drei Basisqualitäten, welche beim Betrachter das Empfinden von 'Schönheit' auslösen: der "Vollkommenheit" (integritas), der "Wohlproportioniertheit" (proportio) und des "Glanzes" beziehungsweise der lichtartigen Helligkeit (claritas, splendor) einer 'Gestalt' 8. Bemerkenswerterweise integrierte der Aquinate ein subjektives Element in seinen Reflexionen zur 'Schönheit', indem er die Beteiligung der Beobachterwahrnehmung - konkret: des Gesichtssinnes - bei der Hervorbringung von Schönheit voraussetzte: pulchra enim dicuntur, quae visa placent, wie es in dem von der Forschung viel zitierten Satz des Scholastikers heißt 9. 'Schönheit' war demzufolge vor allem ein objektivistisch konzipiertes Phänomen, das allerdings zu seiner vollen Manifestation der aktiven Einsicht bedurfte. Hinsichtlich des ontologischen Status von 'Schönheit' im Denken des Thomas von Aquin hat gleichwohl JAN A. AERTSEN am vehementesten gegen die verbreitete Forschungsmeinung argumentiert, welcher zufolge Thomas von Aquin 'Schönheit' als
4 4 einen eigenständigen transzendenten Wert verstanden habe. Aertsen hingegen wies diese These anhand des Schrifttums des Aquinaten als nicht belegbar zurück; vielmehr habe 'Schönheit' im Denken des Thomas nur eine indirekte Ableitung aus den transzendenten Werten des 'Guten' und 'Wahren' dargestellt beziehungsweise lediglich ein zusätzliches, aber offenbar nicht notwendiges Attribut insbesondere des 'Guten' und 'Wahren' gebildet 10. Diese Befunde Aertsens hinsichtlich Konzept und Stellenwert von 'Schönheit' bei einem der einflussreichsten hochmittelalterlichen Scholastiker legitimieren im Gegenteil eine ungleich 'irdischere', das heißt: gegenständlichere wie pragmatischere Deutung mittelalterlicher Schönheitsbeschreibungen und -beurteilungen; sie gestatten folglich, die Frage nach den metaphysischen Sinndimensionen mittelalterlicher Körper- und Schönheitsvorstellungen zunächst zurückzustellen. Im Detail umfassen die männlichen und weiblichen Schönheitsideale in der höfischen Literatur Frankreichs, Englands, Spaniens, Deutschlands und anderer Länder Europas recht stereotype Attribute. 'Schöne' Männer zeichneten sich im allgemeinen aus durch eine athletische, kampfgestählte wie kampftaugliche Statur mit langen, geraden, starken Beinen, schlanker Taille, breitem Oberkörper, breiter Brust und muskulösen Armen. Der Kopf musste ausgewogen rund sein; gepflegtes, langes Haar von blonder oder heller Farbe galt als attraktiv. Für das Idealbild weiblicher Schönheit stand fast ausnahmslos die junge, blondhaarige Frau von eher kleinem Wuchs, aber schlanker Gestalt mit geraden Gliedmaßen, schmaler Taille, runden Hüften, festen kleinen Brüsten. Ihre Haut hatte hell, ja mitunter schneeweiß und weich zu sein 11. Hinsichtlich der Gesichtsphysiognomie galten für Männer und Frauen ähnliche Vorstellungen: Ein 'schönes' Gesicht zierten u. a. eine helle, leicht rosige Hautfarbe, eine hohe, breite und faltenlose Stirn; klar konturierte Augenbrauen; große Augen mit einem freundlichen und offenen Blick, eine wohlgeformte, gerade Nase mit kleinen Nasenlöchern, ein kleiner, doch nicht schmallippiger Mund und kleine, gleichmäßig geformte weiße Zähne 12. Doch nicht nur hinsichtlich der menschlichen Schönheit hatte sich in der mittelalterlichen höfischen Literatur ein bestimmter Kanon versatzstückartiger Idealelemente ausgebildet. Gleiches gilt für die literarische Schilderung hässlicher
5 5 Menschen und menschenartiger Mischwesen. Zu den am häufigsten wiederkehrenden Elementen, mit denen im Mittelalter - und zum Teil bis in die unsere moderne Massenunterhaltungskultur hinein - die Vorstellung von gefährlicher (!) 'Hässlichkeit' assoziiert und evoziert wurde, zählten nach Untersuchungen Henrik Spechts: dunkle oder schwarze Haut- oder Haarfarbe 13 ; unordentliche Haare; übermäßige Behaartheit des Körpers; große starrende Augen; ein breites und flaches Gesicht mit einer entweder übermäßig kleinen oder übermäßig großen Nase; ein grinsender Mund, der fangartige Zähne erkennen lässt; überproportionale Größe von Kopf, Rumpf oder einem anderen Körperteil (vorzugsweise der Extremitäten); schließlich anatomische Deformationen der Körpergestalt. 14 Auffallendes Signum an Spechts Katalog ist nun die Überzeichnung vieler dieser Komponenten ins Tierhafte: ein dichter Haarwuchs am Körper beispielsweise, der an das Fell von Tieren denken lässt; ungewöhnlich wirkende Nasenformen, die Assoziationen an Tiernasen wecken; Zahnformen, die an Raubtiergebisse erinnern; klauen- oder krallenförmige Finger usf. 15 Es entspricht der im Mittelalter weit verbreiteten dichotomischen Denkweise, dass die physischen Eigenschaften, mit denen 'Hässlichkeit' assoziiert wurde, denjenigen für 'Schönheit' diametral gegenüberstehen und sich komplementär zu ihnen verhalten: ausgewogenes Proportions- und Maßverhältnis der Körperpartien, gerader Wuchs sowie Schlankheit des Rumpfes und aller beweglichen Glieder, Symmetrie der Form und Anordnung von paarweise oder mehrfach auftretenden Körperteile (z. B. Augen; Zähne) sowie eine klar konturierte Physiognomie auf der einen Seite; hingegen Missproportionen, Unregelmäßigkeit und Unförmigkeit der ganzen Körpergestalt oder einzelner Körperpartien, Unbeweglichkeit ursprünglicher beweglicher Körperglieder, Maskenhaftigkeit oder Unkenntlichkeit der individuellen Gesichtszüge etc. auf der anderen Seite. II. Henrik Spechts Katalog mittelalterlicher Darstellungsstereotypen für 'hässliche' Menschen in der höfischen Literatur lenkt somit den Blick auf ein Spezifikum, welches im Zusammenhang mit Beschreibungen von Leprakranken schon seit der Antike in unterschiedlichen Textgattungen wiederkehrt: den Verweis auf das tierhafte Aussehen der Leprosen, den Vergleich ihres äußeren Erscheinungsbildes mit der
6 6 Tiergestalt. Wie äußern sich derartige Hinweise auf die Tierähnlichkeit konkret; und welche mentalitätengeschichtlichen Implikationen waren mit ihnen verbunden? Ein tierähnliches Aussehen von Kranken im fortgeschrittenen Stadium einer Leprainfektion konstatierte bereits die älteste erhaltene Leprabeschreibung im okzidentalen Raum: sie entstammt dem Medizinkompendium des kappadokischen Arztes Aretaios aus dem ersten Jahrhundert n. Chr.: Ein an der ('elephantiasis' = Lepra) Erkrankter sei "(e)ntsetzlich und scheusslich anzusehen, denn der Mensch hat die Gestalt eines Thieres bekommen" 16. Die Ähnlichkeitsbeziehung machte der in Rom wirkende Arzt an den Veränderungen der Stirn-Augen-Partie fest: "Die Augenbrauen treten stark hervor, sind dick und haarlos, werden durch ihre Schwere nach unten gezogen und schwellen an [...]. Die Haut in der Gegend der Augenbraue wird stark herabgezogen und verdeckt die Augen, wie dies bei zornigen Löwen zu sein pflegt". 17 Das Tier, das den Bezugspunkt für den Vergleich darstellt, ist - wie sich sich in aller Deutlichkeit zeigt - weder das Tier 'an sich' noch das domestizierte Haus- oder Nutztier, sondern das 'wilde' und damit für den Menschen gefährliche Tier. Der Vergleich mit dem Löwen gehört zu den prominentesten Mensch-Tier-Vergleichen in der Geschichte des 'Lepra'begriffs und der Leprakranken. Der Verweis auf das sogenannte 'Löwengesicht' wurde nahezu zu einem Standardelement in der spätantiken medizinischen Literatur: Er findet sich bei dem byzantinischen Arzt Oreibasios, wurde dann im 6. Jahrhundert auch von dem byzantinischen Arzt Aëtios von Amida in einer Krankheitsbeschreibung bemüht und ist schließlich im 11. Jahrhundert durch den persischen Arzt Avicenna (arab. Abu Ali al-husain ibn Abdallah Ibn Sina, 973/ ) und dessen ins Lateinische übertragene Medizinhandbuch 'Liber canonis' (arab. Qanun) auch in der okzidentalen Medizin bekannt gemacht geworden 18. Aber die Spätantike sowie das Früh- und Hochmittelalter kannten noch andere Varianten des Mensch-Tier-Vergleichs bei der Beschreibung der Leprakranken. Der römische Arzt Galen (2. Jhdt.) beispielsweise befand, dass "die Leprakranken, ihrer naturgegebenen Gestalt beraubt, ganz einem Satyr gleich würden" und erklärte dies aus der Ähnlichkeit der Physiognomie mit der eines Leprosen: flache Nase;
7 7 geschwollene, fleischige Lippen und spitze Ohren 19. Dieser Vergleich zieht zwar keine Bezüge zu einem 'echten' Tier, aber (immerhin) zu einem Mischwesen zwischen Tier und Mensch. Galens Leprosenbeschreibung wurde 1363 in der 'Chirurgia magna' des gelehrten französischen Arztes und Chirurgen Guy de Chauliac (um 1290-um 1367/79) rezipiert, der erläuternd anfügte, dass es sich bei dem Satyr um "ein in Arabien beheimatetes Tier von schrecklichem Anblick" handele 20. Hier ist nicht etwa Guy de Chauliac ein Vorwurf der Unbildung in klassisch-antiker Mythologie anzulasten; vielmehr bezeichnete der Begriff satyr bereits seit hellenistischer Zeit ganz allgemein bockartige Mischwesen in fernen, noch wenig erkundeten Landstrichen. 21 Wichtiger noch ist in diesem Zusammenhang, dass der gelehrte Arzt Galens Leprosenbeschreibung vor dem Hintergrund des eigenen Wissens offenbar treffend und für diagnostische wie didaktische Zwecke dienlich fand. Zugleich aber leistete er der Tradition des Mensch- Tier-Vergleichs Vorschub. Mit ähnlichen gesellschaftlichen Wahrnehmungsformen im Zusammenhang mit Leprakranken sahen sich bereits die Kirchenväter der Ostkirche konfrontiert. In seiner Predigt 'Über die Liebe zu den Armen' für einen humanen, christlich fundierten Umgang mit den Leprosen und Armen plädierend, sprach der kappadokische Bischof Gregor von Nazianz ( ) im 4. Jahrhundert offenbar eine weit verbreitete Ansicht aus, als er an sein Publikum die Frage nach dem rechten Umgang mit den Leprakranken richtete: "Sollen wir sie [d. h. die Kranken] verlassen [...] wie äußerst gefährliche Schlangen und andere Tiere?" 22 Mit dieser rhetorisch gemeinten und von dem Prediger selbst vehement verneinten Frage wird ein menschliches Verhaltensmuster, das aus der Begegnung mit gefährlichen Tieren bekannt ist und auf den Umgang mit Leprakranken übertragen wurde, angezeigt und angeprangert. In einem späteren Abschnitt seiner Predigt kehrte der Bischof sogar die abwertende Stoßrichtung des Mensch-Tier-Vergleichs um, um den noch von antiken Werthaltungen geprägten, nunmehr als unchristlich geltenden Lebensstil der spätantiken Oberschichten zu kritisieren und stigmatisieren, der sich zu Gregors Zeit vor allem durch ein von Überfluss, Pracht und Genussfreudigkeit gekennzeichnetes Konsumverhalten auszeichnete 23. Nicht mehr eine das menschliche Aussehen
8 8 entstellende Krankheit bildete im Rahmen von Gregors Umwertung das Inhumanum, das 'Tierisch-Verwilderte', sondern nunmehr eine spezielle geistige Gesinnung und ethische Orientierung - im Kontext von Gregors Rede: der mitleids- und rücksichtslose Hedonismus einer (byzantinischen) Wohlstandsschicht. Wie sein älterer Freund und Amtskollege Gregor von Nazianz betonte auch Bischof Gregor von Nyssa ( ) in einer Predigt zum selben Thema ('Über die Liebe zu den Armen') den Verlust des menschengleichen Aussehens, den Leprakranke infolge ihres Gebrechens erleiden können und der sie den vierfüßigen Tieren ähneln lasse. 24 An der gesellschaftlichen Meidung solcher Schwerstkranken übte Gregor von Nyssa vor seinen Zuhörern Kritik, indem er jenem abweisenden Verhalten in schärfstem Kontrast den furchtlosen, ja liebevollen Umgang der Menschen mit ihren Nutz- und Haustieren gegenüberstellte. 25. Neben Vergleichen, in denen mit 'Löwen', 'Schlangen' und 'gefährlichen Tieren' mehr oder minder explizit distinkte Tiergattungen angesprochen wurden, existierten weitere Vergleichsformen, die zwar die Menschenunähnlichkeit im Erscheinungsbild der Leprosen thematisierten, diese aber eher indirekt mit dem Eindruck einer Tierähnlichkeit assoziierten. In diesen Fällen wurden beispielsweise Begriff und Idee des monstrum bemüht, die sich als eine Steigerung des Mensch-Tier-Vergleichs deuten lassen. In der zeitgenössischen Vita der Zisterziensernonne Aleydis (Adelheid) von Schaarbeek (ca ), die in ihrem Heimatkonvent Konvent La Cambre wegen einer Lepraerkrankung bis zu ihrem Tod in jahrelanger, häuslicher Isolierung lebte, wird in realistischer Manier das Aussehen der bettlägerigen und völlig bewegungsunfähigen Kranken im Endstadium ihres Krankendaseins geschildert. Aleydis' gesamter Körper befand sich nach Schilderung des 'Biografen' wegen starker, eitriger Geschwürbildung in einem Zustand der Selbstauflösung; ihre verkrümmten Hände vermochte die Kranke nicht mehr zu bewegen; ihre Haut war nahezu am ganzen Körper borkenartig verschorft und mit Schrunden und Wundmalen überzogen; die Beine und Füße waren geschwollen; überdies war Aleydis im Laufe der Zeit erblindet und war an ihrem Lebensende nur noch des Sprechens mächtig - genauer: des Lobgesanges für Gott. 26 Von all diesen Krankheitsfolgen, deren Beschreibung von seltener medizinisch-klinischer Präzision
9 9 kaum Zweifel lassen, dass der Biograf oder die von ihm befragten Personen die kranke Aleydis persönlich kannte bzw. kannten, war der ganze Körper betroffen (horrenda infirmitas miserabiliter totum corpus ejus occuparat), so dass die Kranke ihr individuelles und menschliches Aussehen vollkommen einbüßte. "Alle, die sie erblickten", so schreibt der Biograf, "erstarrten sofort von Furcht gepackt wie vor einem schrecklichen Monster und glaubten, dass niemals ein Lebewesen [!] gefunden werden könnte, das ihr an Schrecken verbreitender Wirkung vergleichbar wäre" 27. Der Begriff 'Monster' dient dem Biografen als hyperbolisches sprachliches Etikettierungsmittel und damit uns Heutigen als wertvoller Indikator für eine durch den Anblick der Kranken ausgelöste emotionale Reaktion (Verstörung; Furcht; Meidung), deren Qualität wie Intensität die zu jener Zeit gewohnten Erfahrungs- und Vorstellungskategorien überstieg: Nicht nur schien die kranke Nonne ihren Mitschwestern nicht mehr menschenähnlich oder menschengleich zu sein; die körperliche Erscheinung und Verfassung der schwerkranken Aleydis boten offenbar nicht einmal mehr konkrete Ansatzpunkte für eine intellektuelle Erfassung und Statuszuschreibung durch das Mittel der Tiermetaphorik. Begriff und Idee des monstrum zeigen das geradezu schockhafte Erlebnis eines extremen Überschreitens gewohnter Erfahrungs- oder Vorstellungsmöglichkeiten an. Das Wesen dieser 'Grenz-Erfahrung' kommt darin zum Ausdruck, dass sogar die Möglichkeit der irdischen Existenz eines der kranken Aleydis gleichenden 'Monsters' in Zweifel gezogen wird. In diesem Kontext ist daran zu erinnern, dass Monstren im Mittelalter nicht unbedingt als 'Fabelwesen', als imaginäre Gebilde galten; vielmehr wurde die Möglichkeit ihrer vielleicht unentdeckten, jedoch irdischen Existenz in Betracht gezogen. 28 Definiert als 'Un-Tier', bildet im mittelalterlichen Denken das monstrum unter allen Lebewesen eine eigene Kategorie, gegenüber der so seltene und seltsam anmutende, im Mittelalter gleichwohl für real erachtete Spezies wie Einhorn, Greif, Basilisk oder Drache vielfach den Status 'regulärer' Tierarten einnehmen konnten. 29 Die Härte jenes Verdiktes über Aleydis etwas mildernd, lässt sich gleichwohl - und im Unterschied zum modernen Denken - als Signum der christlichen Vorstellungswelt im Mittelalter in Anschlag bringen, dass der christliche Schöpfungs- und
10 10 Kosmosgedanke kein absolut verstandenes 'Außerhalb' kannte: Auch 'Monstren' und anthropomorphe Lebewesen blieben Teile des Kosmos und der göttlichen Schöpfung, waren also creatura. In wohldurchdachter und künstlerisch meisterhafter Weise wurden diese Ordnungsvorstellungen in einem Elfenbeindiptychon aus dem späten 9. Jahrhundert zum Ausdruck gebracht: Eingerahmt von einem Pflanzen- Kleintier-Fries, zeigt das Relief in vier übereinandergestellten Stufen die Wildtiere im Paradies mit den Stammeltern, Adam und Eva, gewissermaßen als 'Krönung der Schöpfung' im obersten, siebten Register. Doch exakt zwischen den auf den unteren vier Stufen verteilten Tieren und den biblischen Stammeltern im oberen Bereich plazierte der Künstler in zwei Registern Mensch-Tier-Mischwesen mit Tierköpfen beziehungsweise Tierleibern (Abb. 1). 30 Im mittelalterlichen Weltbild gehörten solche Mischwesen und anthropomorphen Gestalten auch in nach-paradiesischer Zeit zum Bestand der Schöpfung, wenngleich man - antiken Vorstellungstraditionen folgend - ihre Lebensräume bevorzugt an den fernen, noch unbekannten Rändern der irdischen Welt lokalisierte 31. Was sich nun konkret mit der mittelalterlichen Vorstellung von 'Monstrosität' verband, was den 'monströsen' Charakter von Menschen auszeichnete, waren vor allem solche Merkmale, die sich als eine von dem Idealbild der Menschengestalt abweichende oder 'verkehrte' Körperlichkeit ansprechen lassen. 32 Zu den wichtigsten Manifestationsformen von 'Monstren' zählte das Mittelalter zum einen Mensch-Tier- Mischwesen und zum anderen anthropomorphe Völker mit hypertrophen Körperteilen und ähnlichen Leibesdefekten. Zu Letzteren, deren mutmaßliche Existenz wohl Staunen oder Grauen erregten, gehörten zum Beispiel die sogenannten Panotier mit ihren übergroßen Ohren wie auch die Sciapoden, einbeinige Menschenartige, die sich mit ihrem überdimensionierten Fuß Schatten spenden konnten. 33 Neben diesen 'Exoten' in fernen Erdteilen existierten 'Monstren', wenn auch in geringer Zahl, auch im heimischen Alltagsleben. Einen wichtigen Beleg für die Auffassung von der 'verkehrten' Körperlichkeit liefert die schon frühmittelalterliche Beschreibung eines von Geburt an schwer körperbehinderten Knaben in den 'Martinswundern' (De virtutibus s. Martini) des Gregor von Tours. 34 Dieser Erzählung zufolge waren die Knie des Jungen "zu dessen Bauch hin verwachsen, die Fersen hingegen zu den
11 11 Schienbeinen [Unterbeinen?] verdreht; die Hände waren ihm am Brustkorb angewachsen und die Augen vollständig erblindet." Zusammengenommen waren die anatomischen Fehlstellungen, die daraus resultierende Bewegungsunfähigkeit sowie die Sinnenbehinderung in Art und Ausmaß dergestalt, dass der Junge in den Augen Dritter "mehr irgendeinem Monster denn der Menschengestalt ähnelte". 35 In seiner ganzen Vehemenz zeigt sich das Empfinden eines übermäßig, ja geradezu unerträglich Absonderlichen, das der Anblick des körperbehinderten Knaben bei den Betrachtern auslöste, zusätzlich in den Verhaltensantworten der nicht-familialen sozialen Umwelt: in der häufigen Verspottung des Jungen (dirisione multorum) und in den - vermutlich von Nachbarn erhobenen - Vorwürfen gegen die Mutter, "so einen hervorgebracht zu haben" (mater argueretur, cur talis ex illa processerit). Auch die Rechtfertigungsworte der Mutter, dass sie ihr behindertes Kind nicht zu töten gewagt habe (Quem interemere non audens), deuten - ob real oder fiktiv - auf einen immensen sozialen Legitimationsdruck, der im Mittelalter auf Eltern schwerbehinderter Kinder lastete. 36 Aufschlussreich hinsichtlich des Sensations- und Novitätencharakters 'monströser' Erscheinungen ist schließlich die Schilderung Gregors über den weiteren Lebensweg des Knaben: Die als fremdartig wie drastisch charakterisierte optische Wirkung der Körpermängel, die bei den Betrachtern offenbar eine Gefühlsmischung aus anziehender Faszination, Schaulust und angstvoller Abscheu weckten, wurde von einer geschäftssinnigen Gruppe vagierender Bettler erkannt, denen die Mutter den herangewachsenen Jungen mitgab und die ihn auf ihren Bettelzügen überaus gewinnbringend der Bevölkerung zur Schau stellten. 37 III. Es zeigt sich also, dass der Anblick von Leprosen bei fortgeschrittener Erkrankung bei den Betrachtern unterschiedliche Gefühle, hauptsächlich aber Furcht auslöste und dass diese Bedrohungsgefühle der Angst vor dem wilden, ungezähmten Tier oder dem unbekannten 'Monster' gleichkamen. Der sich hieraus ergebende Kontrast zu dem den Menschen vertrauten Nutz- oder Haustier demonstriert, dass sich hinter der Angst gegenüber dem ungezähmten Tier oder Monster letztlich eine tiefer sitzende Furcht verbirgt: die Furcht vor dem Unkontrollierbaren und Irrationalen, vor
12 12 dem mit der menschlichen Ratio nicht Erklär- und nicht Beherrschbaren. Es steht zu vermuten, dass jene Furcht vor dem 'Tier', die mit dem Anblick der Leprakranken assoziiert oder auf jene projiziert wurde, auch dort gemeint war, wo im Kontext von Krankenbeschreibungen ein expliziter Mensch-Tier-Vergleich unterblieb und die historischen Texte lediglich den emotionalen Effekt auf die Betrachter ansprechen, ohne die Affektreaktionen näher zu erläutern. Schon Aëtios aus Amida nannte den Anblick der schwerkranken Leprosen "unerträglich für die Betrachtenden" (intolerabilis [...] conspicientibus). 38 Ein frühmittelalterliches Medizinkompendium wertete die Leprakrankheit, die dort mit dem Fachbegriff elefantia bezeichnet wird, als eine "allerschrecklichste Hautverhärtung im Gesicht und am ganzen Körper". 39 Eine emotional stärkere Aussage findet sich im Umkreis der heiligen Elisabeth von Thüringen (gest. 1231), die ihr Leben als Landgrafenwitwe der Armen- und Krankenfürsorge weihte. In dem sog. Libellus des dictis quatuor ancillarum, der die offiziellen Aussagen der einstigen Gefährtinnen Elisabeths im Kanonisationsprozess enthält, wird die beherzte, tatkräftige Art der Fürstin bei der Krankenpflege einer leprösen Frau herausgestrichen, indem die abschreckende Wirkung des Aussehens betont wird: Es war nämlich eine "äußerst unreine lepröse Frau [...], die anzusehen einen jeden schon von weitem schaudern machte" (quandam fetidissimam leprosam [...] quam quilibet a longe videre abhorruit). 40 Der gelehrte Mediziner Arnald von Villanova brachte das furchtauslösende Moment wiederum gezielt mit dem Gesicht eines leprakranken Menschen in Verbindung, als er erläuterte: "Ihr Gesicht [d. h. das der Kranken] ist sehr furchteinflößend, weil es sich in seiner natürlichen Gestalt verändert hat und ein sehr schreckliches Aussehen hat." 41 Das Vergleichsbeispiel aus Gregor von Tours' Martinswundern bestärkt die These, dass die sichtbaren physischen Körperdefekte, nicht aber Charaktereigenschaften der Betroffenen oder andere biologische Besonderheiten der Lepraerkrankungen den Anlass zu diesen Vergleichen mit Tierlebewesen gaben. Pathologisch bedingte Veränderungen der menschlichen Physis hinsichtlich Körpergestalt, Gang, Stimme, Mimik und Gestik erklären auch im Fall der Leprakranken die Assoziation mit der Tiergestalt, mit dem Inhumanum. Dabei kamen, wie beispielsweise die Aussage des Arnald von Villanova anzeigt, im Zusammenhang mit affektuellen und sozialen Reaktionen gegenüber
13 13 Leprakranken gerade dem Gesicht und hier besonders den zentralen Gesichtspartien (Augen, Nase, Mund) primäre Bedeutung zu. Einige Beispiele mögen dies konkretisieren. 42 So führt eine schwere Leprainfektion bei geringer Resistenz des Kranken zu physiologischen Versorgungsstörungen in den Extremitäten, was in der Rückbildung der Knochensubstanz und in Defomierungen von Händen ('Klauenhände') und Füßen resultieren kann. Hochgradig bedeutsam für die Wahrnehmung einer 'Tierähnlichkeit' waren auch Symptome wie das knotigwulstige Anschwellen des Hautgewebes in der Augenbrauen-Stirn-Partie, wodurch die Augen abgeschattet werden, diese optisch gleichsam in die Augenhöhlen zurücktreten und den Leprosen aufgrund der senkrechten Stirnfalten eine als 'zornig' empfundene Mimik verleiht. Dieses Phänomen machte zusammen mit dem Einfallen der Nase nach 'innen', in den Naseninnenraum hinein, das in der mittelalterlichen Medizin und der modernen Medizinhistorie so bekannte 'Löwengesicht' (facies leonina) aus (s.o. S. 5f.). Darüber hinaus können Lähmungen der Gesichtsnerven den Ausfall des Lidschlussreflexes herbeiführen und dadurch u. a. einen 'starren', unbewegten Blick bei den Kranken hervorrufen. Einen Betrachter mag dies an den Blick eines jagenden, seine Beute fixierenden Tieres erinnern und folglich Gefühle der Bedrohung (horror) auslösen - ein Effekt, dessen vermeintliche oder ungewollte Aggressivität auch nicht immer durch eine freundlich und versöhnlich stimmende Mimik des Leprosen konterkariert werden kann, wenn Lähmungserscheinungen auch andere Muskelpartien des Gesichts betreffen und somit Lächeln, Hochziehen der Augenbrauen, Zwinkern und anderes Mienenspiel verhindern. 43 Zudem beeinträchtigen pathologische Veränderungen im Nasen- und Rachenraum (z. B. Geschwürbildungen) Stimme und Atmung der Kranken: Die Stimme kann einen 'heiseren' oder gebrochenen Klang erhalten; zusätzlich können Atemgeräusche dem stimmlich-sprachlichen Ausdruck das Gepräge tierhafter Laute verleihen. Wurde bereits zuvor die Furcht in der Begegnung mit schwer erkrankten Leprosen aus der Furcht vor dem Irrationalen und dem (physisch wie geistig) nicht Kontrollierbaren hergeleitet, so wurde dieser Schrecken möglicherweise gerade durch den Umstand verstärkt, dass die Leprakranken im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte blieben und - im Unterschied zu anderen Krankengruppen wie beispielsweise
14 14 Epileptikern oder Syphilitikern - in dieser Hinsicht keine organischen Beeinträchtigungen durch die Erkrankung erlitten. Dieser Tatbestand musste eine vorschnelle soziale Kategorisierung als 'geistig Verwirrte' o. ä. und damit eine 'bequeme' emotionale Entlastung der sozialen Mitwelt verhindern. 44 Er musste darüber hinaus jene Versuche unterlaufen, im Mittel des Mensch-Tier-Vergleichs eine radikale Identitätsdifferenz und -disparität zwischen Leprosen und Gesunden als dauerhaft, statisch und naturgegeben zu konstituieren (s.o. S. 2). Diese Restriktionen in der Statuszuschreibung für Leprakranke mag Irritationen oder negative Gefühle wie Furcht, Aversion oder Ohnmacht auf seiten der Gesunden verstärkt haben, doch bedürfte diese Hypothese einer eingehenderen Historisierung und Verifizierung am historischen Material. Komplementär dazu bliebe zu fragen, ob und inwiefern geistesund sozialgeschichtliche Entwicklungen wie beispielsweise die Entfaltung der Scholastik mit ihrer Hochschätzung der Vernunft, ferner die Verwissenschaftlichung von Wissensbereichen wie der Medizin dazu beitrugen, dass sich seit dem Hochmittelalter nur noch selten Belege finden, die die 'Tierhaftigkeit' der Leprosen in ihrem physischen Erscheinungsbild evozieren. Selbst in einem Werk wie dem Versepos 'Testament of Cresseid' des schottischen Schulleiters und Dichters Robert Henryson (ca ), der dem körperlichen Verfall der mit Lepra gestraften 'Heldin' eine ebenso eindringliche wie detailrealistische Beschreibung widmete, unterblieben Vergleiche mit Tieren oder 'Monstren' völlig 45. Wenn sich solche Denkfiguren in der adlig-höfischen Kultur gehäuft finden, dann dürfte dies wohl weniger über das tatsächliche Aussehen nicht-adliger oder kranker Bevölkerungssegmente aussagen, aber als soziale Abwertungs- und Abgrenzungsstrategie hingegen um so mehr Auskunft geben über ein elitäres und harsches geistiges Milieu des Adels beziehungsweise der Produzenten jener Adelskultur. Dr. des. Antje Schelberg Mitteldorfstr. 21 A Göttingen Tel.: 0551 / Geschichte.Schelberg@web.de
15 15 1 Auf die Jahrhunderte lange, komplexe und wechselhafte Begriffs- und Bedeutungsgeschichte des griechischen Terminus ('lepra') vom fünften vorchristlichen Jahrhundert bis heute (mitsamt seinen lateinischen und vernakularsprachlichen Sinnäquivalenten) kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Siehe dazu meine Dissertation Leprosen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Physische Idoneität und sozialer Status von Kranken im Spannungsfeld säkularer und christlicher Wirklichkeitsdeutungen (im Druck; Georg-August-Universität 2000). 2 Die nachfolgenden Beobachtungen basieren auf Beschreibungen in der wissenschaftlichen und theologischen Literatur des Mittelalters. Für den Umstand, dass die Darstellung der äußeren Gestalt der Leprosen beispielsweise in der hochmittelalterlichen höfischen Epik weniger drastisch ausfiel, lassen sich verschiedene mögliche Gründe anführen. In Anbetracht der hohen körperästhetischen Ideale in der höfischen Kultur, die im folgenden dargestellt werden, steht zu vermuten, dass das unweigerliche Verfehlen dieser Ideale im Fall der Leprakranken im fortgeschrittenen Stadium selbstevident war und keiner expliziten Erläuterung bedurfte. Allgemein zur Darstellung von Leprosen in der mittelalterlichen Epik: NORBERT H. OTT, Miselsuht - Die Lepra als Thema erzählender Literatur des Mittelalters. In: Aussatz - Lepra - Hansen-Krankheit 2, hg. v. JÖRN HENNING WOLF, Würzburg 1986, S ; DIETRICH VON ENGELHARDT, Darstellung und Deutung der Lepra in der neueren Literatur. In: Aussatz - Lepra - Hansen-Krankheit 2, hg. v. JÖRN HENNING WOLF, Würzburg 1986, S ; NICOLE PATRICIA BEATRICE GOHRIG, Die Darstellung des Aussatzes in der mittelhochdeutschen Literatur. Diss. Klagenfurt KLAUS OSTHEEREN, "Zur Form und Funktion der Schönheitsbeschreibung im Mittelenglischen". In: Schöne Frauen - Schöne Männer. Literarische Schönheitsbeschreibungen, hg. v. THEO STEMMLER. Tübingen 1988, S , S. 165: "Intendiert ist nicht ein konkret vorzustellendes, auf die Sinne des Zuhörers konkret wirkendes Bild, sondern das einer im Grunde unvorstellbaren Vollkommenheit zugeordnete abstrakte Ideal". Vgl. auch ebd., S. 177: "Skopos der Frauenbeschreibung im Minnelied ist also nicht die Darstellung von Schönheit, sondern die Evokation einer Vorstellung von Schönheit".- Der erwähnte Sammelband 'Schöne Frauen - schöne Männer' wird im folgenden unter diesem Kurztitel zitiert. 4 PETER JOHANEK, "Stadt und Lepra". In: Lepra - Gestern und Heute. 15 wissenschaftliche Essays zur Geschichte und Gegenwart einer Menschheitsseuche, hg. v. RICHARD TOELLNER, Münster 1992, S. 42. Hinsichtlich der Funktion der Identitätsbildung trifft sich die Begriffsdichotomie 'schön'/'hässlich' mit derjenigen von 'fremd'/'eigen'. Siehe dazu den kurzen Überblick bei HARRY KÜHNEL, Art. "Das Fremde und das Eigene. Mittelalter". In: Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen, hg. v. PETER DINZELBACHER, Stuttgart 1993, S , bes. S HENRIK SPECHT, "The Beautiful, the Handsome, and the Ugly: Some Aspects of the Art of Character Portrayal in Medieval Literature." In: Studia Neophilologica 86 (1984) S , S. 139: "[An] important function of ugliness in medieval literature [...] consisted in serving as an emphatic and almost unequivocal indication of low social status [...]". KÜHNEL, Art. "Das Fremde und das Eigene. Mittelalter" (wie Anm. 4), S SPECHT, "The Beautiful, the Handsome, and the Ugly" (wie Anm. 5), S Siehe dazu die abundante und einzigartige Sammlung spätmittelalterlichen Bildmaterials von RUTH MELLINKOFF, Outcasts. Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages. 2 Bde. Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press 1993, bes. Bd. 2 (Illustrationen). 8 JAN A. AERTSEN, "Beauty in the Middle Ages: A Forgotten Transcendental?". In: Medieval Philosophy and Theology 1 (1991), S , S So RUPPRECHT ROHR, "Die Schönheit des Menschen in der mittelalterlichen Dichtung Frankreichs" In: Schöne Frauen - schöne Männer (wie Anm. 3), S , S. 94f. (ebd., S. 97f. zur Schönheitsdarstellung des Gesichts); ANDREAS SPEER, "'Kunst' und 'Schönheit'. Kritische Überlegungen zur mittelalterlichen Ästhetik." In: Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter. 2 Bde., hg. v. INGRID CRAEMER-RUEGENBERG / ANDREAS SPEER (Miscellanea Mediaevalia 22,2) Berlin-New York 1994, Bd. 2, S , bes. S. 950; AERTSEN, "Beauty in the Middle Ages" (wie Anm. 8), S Ebd. S. 83f. Vgl. hingegen SPEER, "'Kunst' und 'Schönheit'" (wie Anm. 9), S. 951, demzufolge man im Mittelalter das irdische Schöne als Emanation "des göttlich Überschönen" verstanden habe,
16 16 was für den von SPEER behandelten Bereich der kirchlich-sakralen Baukunst des Hochmittelalters gewiss zutrifft. Ein solches metaphysisches Verständnis mittelalterlicher Schönheitsauffassungen (physische Schönheit als Manifestation des göttlichen Schönen oder Guten) scheint meiner Meinung nach eine in der Forschung häufig ungesicherte Prämisse zu bilden, deren Geltung außerhalb der mittelalterlichen Theologie noch eingehender zu prüfen wäre. 11 Siehe die Zusammenstellungen männlicher und weiblicher Schönheitsattribute bei ROHR, "Die Schönheit des Menschen in der mittelalterlichen Dichtung Frankreichs" (wie Anm. 9), S. 95 und 97ff.; WALTER CLYDE CURRY, The Middle English Ideal of Personal Beauty, as Found in the Metrical Romances, Chronicles, and Legends of the XIII, XIV, and XV Centuries. Baltimore: Furst 1916, S ROHR, "Die Schönheit des Menschen in der mittelalterlichen Dichtung Frankreichs" (wie Anm. 9), S Ausnahmen bildeten jene Individuen, die von der Kirche oder auch durch literarische Konvention als religiöse Helden und Heldinnen bzw. als 'natürliche Christen' in die christliche Tradition aufgenommen worden waren: so z. B. die Königin von Saba und die orientalische Königin Belakane im 'Parzival', aber auch der heilige Mauritius und die Dreikönigsgruppe. Dazu jüngst: Dione Flühler- Kreis, "Er ist ein Schwarzer, Daran ist kein Zweifel. Zur Darstellung des Mohren und zum Toleranzbegriff im Mittelalter", in: Bild und Abbild vom Menschen im Mittelalter. Akten der Akademie Friesach 'Stadt und Kultur im Mittelalter'. Friesach (Kärnten), September 1998, hg. v. Elisabeth Vavra (Schriftenreihe der Akademie Friesach 6) Klagenfurt 1999, S SPECHT, "The Beautiful, the Handsome, and the Ugly" (wie Anm. 5), S Weniger deutlich wird von SPECHT herausgestellt, dass es sich bei den von ihm herangezogenen Beispielen aus der mittelalterlichen Epik um Darstellungen bedrohlich wirkender Hässlichkeit handelt und nicht etwa solche der 'lächerlichen', belustigenden Hässlichkeit, wie sie etwa durch die Gestalt des Hofnarren oder -zwerges verkörpert wurde. 15 Ebd. 16 Aretaios II,13, hier zitiert in der Übers. v. [Friedrich] ALEXIUS MANN, Die auf uns gekommenen Schriften des Kappadociers Aretaeus. Halle 1858, ND Wiesbaden 1969, S , S Ebd., S Oreibasios, Iatrikon synagogon XLV,28, in: Oeuvres d'oribase, 6 Bde., hg. und übers. v. ULCO CATS BUSSEMAKER / CHARLES DAREMBERG, Bd. 4, Paris:: Imprimerie Nationale 1862, S. 63f. Aëtios, Tetrabiblos IV,1,120, Lyon: Ian Cornarius 1549, Sp , Sp. 810 (über eine Unterform der von Aëtios 'Elephantiasis' genannten Leprakrankheit): Leontiasis autem appellatur, quum frons aegrorum cum quodam tumore laxior redditur, ad similitudinem pellis flexilis superciliorum leonis. Avicenna, Liber canonis IV, fen. III tract. III,i, Venedig 1507, ND Hildesheim 1964, S. 443A: [...] quoniam terribilem facit faciem patientis ea et ponit eam in forma leonum. Zur arabischen Lepramedizin im Mittelalter s. ANTOINETTE STETTLER-SCHÄR, "Leprologie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit". In: HULDRYCH M. KOELBING u. a., Beiträge zur Geschichte der Lepra (Zürcher Medizingeschichtliche Abhandlungen, N. R. 93). Zürich 1972, S , bes. S. 56ff.; HORST MÜLLER-BÜTOW, "Lepra in der arabischen Medizin." In: Aussatz - Lepra - Hansen-Krankheit. Ein Menschheitsproblem im Wandel. Hg. v. JÖRN HENNING WOLF. Bd. 2, Würzburg 1986, S Galen, De causis morborum VII, in: Claudius Galenus, Opera omnia, 20 Bde., hg. v. CARL GOTTLOB KÜHN, Bd. 7, Leipzig 1824, ND Hildesheim 1965, S. 1-41, Zitat: S. 29f.: Etenim nasus simus sit, labra crassa, atque aures extenuatae videntur, ac omnino satyris similes sunt, qui laborant elephantiasi. 20 Guy de Chauliac, Chirurgia magna VI,I,2, hg. v. LAURENT JOUBERT, Lyon 1585, ND Darmstadt 1975, S , dort S. 252: [...] vniuersaliter similes satyris elephantiam patientes fiunt. Satyrus autem in terra Arabica est animal horribilis aspectus, in quo sunt signa iam dicta. 21 So z. B. Plinius d. Ä., der Satyrn für menschenähnliche Völker in Indien bzw. im Innern Afrikas hielt: C. Plinii Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII / C. Plinius Secundus d. Ä., Naturkunde 5,45-46 und 7,24, hg. und übers. v. RODERICH KÖNIG u. a., 37 Bde., Darmstadt , dort Bd. 5 (1993), S und Bd. 7 (1975), S Gregor von Nazianz, Oratio XIV,15, übers. v. PHILIPP HÄUSER, Des Heiligen Bischofs Gregor von Nazianz Reden 1 (Bibliothek der Kirchenväter 59) München 1928, S , Zitat: S Ders., Or. XIV,23, übers. v. Häuser, S. 292: "(Wir) aber möchten uns zu Tieren machen und sind von solcher Sinnenlust so sehr verdorben [...], dass wir schon, wenn wir nur Gerstenbrei und
17 17 Kleie haben [...], glauben, wir seien bessere Menschen als die Aussätzigen". 24 Gregor von Nyssa, De pauperibus amandis oratio II, in: MIGNE PG 46 (Paris 1863), Sp , dort Sp. 475: Vides hominem ex improbitate morbi in quadrumpedis formam commutatum [...]. Hic autem, tanquam commutata natura, non id amplius, quod erat, sed aliud quoddam animal videtur esse. Pedum illi munere funguntur manus; genua praebent plantarum usum. 25 Ebd., Sp Vita b. Aleydis Scharembekana III,31, in: AA SS Iunii II, Paris-Rom , S , dort S. 476: [...] more cadaveris in terra putrescentis, in lectulo suo tradita, quasi putredine extitit consummanda. [...] Manus suae ad modicum usum erant sibi necessariae: nam ex nimia infirmitate [...] fuerint contractae [...]. Cutis quoque pectoris, capitis, et brachiorum, similis erat cortici arboris, varias rimas ex nimia ariditate continentis, [...] et ipsa [d. h. die Beine] una cum pedibus fuerunt inflata. [...] lumine privatur oculorum [...]. Nullum membrum quietum, nullum ad infirmitate impossessum retinebat, nisi solam linguam [...]. S. a. ALBERICH MARTIN ALTERMATT, Art. 'Adelheid (Aleydis, Alice, Alix) v. Schaarbeek', in: LThK 1 ( ) Sp. 152f. 27 Vita b. Aleydis Scharembekana III,31, in: AA SS Iunii II, S. 476: Omnes ipsum intuentes, timore quasi monstri horribilis subito steterunt perculsi; et aestimabant, aliam creaturam, ei in horrore comparandam, nusquam posse reperiri. 28 Auf diese Qualität des mittelalterlichen Konzepts von monstrum hat bereits DAVID WILLIAMS, Deformed Discourse. The Function of the Monster in Mediaeval Thought and Literature, Exeter: University of Exeter Press 1996, S. 12 deutlich aufmerksam gemacht. 29 Einhorn, Greif, Drache, Basilisk und andere Lebewesen, die nach moderner Anschauung als 'Fabelwesen' gelten, wurden schon in vielen mittelalterlichen Bestiarien, die vielfach auf die 'Physiologus'-Überlieferung sowie den Tierbeschreibungen nach Isidor von Sevilla ('Etymologiae XII: De animalibus') zurückgehen, zwanglos in die Reihe der Tiergeschöpfe eingeordnet; s. FLORENCE MCCULLOCH, Medieval Latin and French Bestiaries (University of North Carolina - Studies in the Romance Languages and Literatures 33), Chapel Hill: University of North Carolina Press 1962; NIKOLAUS HENKEL, Studien zum Physiologus im Mittelalter, Tübingen Zu Status und Integration von 'Monstren' im augustinisch geprägten, mittelalterlichen Weltbild s. a. RUDOLF STICHWEH, "Der Körper des Fremden", in: Der falsche Körper. Beiträge zu einer Geschichte der Monstrositäten, hg. v. MICHAEL HAGNER, Göttingen 1995, S ; RUDOLF WITTKOWER, "Marvels of the East: A study in the history of monsters", in: ders., Allegory and the Migration of Symbols, London: Thames and Hudson 1977, S , bes. S Konsulardiptychon des Areobindus (Paris, Musée du Louvre, OA 9064). Dazu: HERBERT SCHADE, "Die Tiere in der mittelalterlichen Kunst. Untersuchung zur Symbolik von zwei Elfenbeinreliefs", in: Studium Generale 20 (1967), S (mit Abb. 1 S. 223); DANIELLE GABORIT- CHOPIN, Elfenbeinkunst im Mittelalter, Berlin 1978, S. 61 und Auf mittelalterlichen Erdkarten konkretisierte sich diese Randstellung in sinnfälliger Weise in der Lokalisierung fremdartiger Völker in den äußersten Randgebieten des Erdkreises; s. KÜHNEL,' Das Fremde und das Eigene. Mittelalter' (wie Anm. 4), S. 418; HANNELORE SACHS / ERNST BADSTÜBNER / HELGA NEUMANN, Christliche Ikonographie in Stichworten, München-Berlin , S s. v. 'Monstren', bes. S Diesem Prinzip entsprechend bezeichnen in den im Mittelalter maßgeblichen 'Tierbüchern', im 'Physiologus' und in Isidor von Sevillas Ausführungen über die Tiere ('Etymologiae XII: De animalibus') jeweils Indien und Äthiopien die am häufigsten genannten Lebensregionen 'monströser' Tiere, wobei die Autoren natürlich das der Antike bekannte Weltbild zugrunde legten. 32 Zur Integrationskraft der christlich-mittelalterlichen Kosmosvorstellung, die selbst noch das Hässliche und Grauenvolle zu integrieren vermochte, s. ROSARIO ASSUNTO, Die Theorie des Schönen im Mittelalter, Köln , S. 69. Zur Geschichte der 'verkehrten' Körperlichkeit in der frühen Neuzeit s. den Sammelband: Der falsche Körper. Beiträge zu einer Geschichte der Monstrositäten, hg. v. HAGNER (wie Anm. 29). 33 Beispiele nach SACHS / BADSTÜBNER / NEUMANN, Christliche Ikonographie in Stichworten (wie Anm. 31), S S. a. GÖTZ POCHAT, Das Fremde im Mittelalter. Darstellung in Kunst und Literatur, Würzburg Die Frage, ob es sich bei der nachfolgenden Darstellung Gregors von Tours um einen Tatsachenbericht oder um eine rein fiktive Erzählung handelt, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht beurteilen. Sie ist für unsere Zwecke gleichwohl unerheblich, da davon ausgegangen wird, dass
18 18 der Autor authentische Sachverhalte und Denkformen thematisierte, um seiner Geschichte und ihrer Intention - die thaumaturgische Kraft des heiligen Martin von Tours zu preisen - Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft zu verleihen. 35 Gregor von Tours, De virtutibus s. Martini II,24, hg. v. BRUNO KRUSCH (MGH SSRM 2 1,2) Hannover , S , dort S. 167: [...] cuius poplites ad stomachum, calcanei ad crura contraxerant; manus enim adhaerentes pectori, sed et oculi clausi erant. Qui magis monstrum aliquod quam hominis speciem similabat. Vergleiche mit anderen Krankenbeschreibungen bei Gregor von Tours legen den Schluss nahe, dass die Aussage über das Aussehen des Knaben nicht die Sichtweise des Bischofs selbst, sondern eine von ihm referierte Ansicht wiedergibt; siehe dazu meine im Druck befindliche Dissertation (wie Anm. 1). 36 Alle Zitate: Gregor von Tours, De virtutibus s. Martini II,24 (MGH SSRM 2 1,2) (wie Anm. 36), S Ebd.: Adultumque tradidit [d. i. die Mutter] medicis, qui accipientes posuerunt in carrucam et trahentes ostendebant populis, multum per eum stipendii accipientes. 38 Aëtios, Tetrabiblos IV,i,120 (wie Anm. 17), Sp RUDOLF LAUX, "Ars medicinae. Ein frühmittelalterliches Kompendium der Medizin", in: Kyklos 3 (1930), S , Zitat: S Libellus de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus II, hg. v. ALBERT HUYSKENS, Kempten-München 1911, S , dort S Zitat nach: ALOIS PAWELETZ, Lepradiagnostik im Mittelalter und Anweisungen zur Lepraschau, Diss. med. Leipzig 1915, S , dort S. 27: Et facies eorum multum est terribilis, quia est mutata a dispositione naturali et habet aspectum multum terribilem. 42 Für die nachfolgenden Ausführungen zur Leprasymptomatik aus heutiger Sicht wurden benutzt: KARL FRIEDRICH SCHALLER, "Die Klinik der Lepra", in: Aussatz - Lepra - Hansen-Krankheit. Ein Menschheitsproblem im Wandel 2, hg. v. JÖRN HENNING WOLF, Würzburg 1986, S ; Leprosy, hg. v. ROBERT C. HASTINGS, Edinburgh u. a.: Churchill Livingstone Erhellende Reflexionen aus Sicht der Verhaltensbiologie zu den Auswirkungen der Krankheitsfolgen auf das Mimik-, Gestik- und Gebärdenrepertoire von Leprosen und zu den Konsequenzen für die nonverbale zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion bietet noch immer die kurze Studie von DETLEV PLOOG / FELIX BRANDT, "Die Zerstörung des Antlitzes - eine ethologische Betrachtung der Lepra", in, Aussatz - Lepra - Hansen-Krankheit. Ein Menschheitsproblem im Wandel 2, hg. v. JÖRN HENNING WOLF, Ingolstadt 1986, S Dieses im Beobachter angesiedelte Paradoxon von wahrnehmbarer Rationalität und gefürchteter Irrationalität wurde indirekt bereits von PLOOG / BRANDT (ebd., S. 331) mit der Feststellung benannt, "Während der Verstand auf den Inhalt der gesprochenen Mitteilung hört, reagiert das Gemüt auf den Ausdruck der gestörten Mimik und Gestik des Leprösen". 45 Robert Henryson, Testament of Cresseid, hg. v. Denton Fox, London-Edin-burgh: Nelson 1968, S. 73 Vv , S. 74 Vv und S. 75 Vv
19 19 Bild: Abbildung aus: Herbert Schade: Die Tiere in der mittelalterlichen Kunst. In: Studium Generale 20, 1967, S Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags Springer, Heidelberg.
1. Leseverstehen Text
 1. Leseverstehen Text Was ist schön? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Frauen dann besonders attraktiv sind, wenn ihr Gesicht kindchenhafte Merkmale aufweist, d.h. Merkmale,
1. Leseverstehen Text Was ist schön? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Frauen dann besonders attraktiv sind, wenn ihr Gesicht kindchenhafte Merkmale aufweist, d.h. Merkmale,
Frau und Mann im Mangastil zeichnen
 Frau und Mann im Mangastil zeichnen Ein Tutorial für Anfänger und fortgeschrittene Zeichner I. Proportion und Körperbau II. Gesicht III. Tipps und weiterführende Links I. Proportion und Körperbau Man kann
Frau und Mann im Mangastil zeichnen Ein Tutorial für Anfänger und fortgeschrittene Zeichner I. Proportion und Körperbau II. Gesicht III. Tipps und weiterführende Links I. Proportion und Körperbau Man kann
Liebe einer namenlosen Göttin
 Liebe einer namenlosen Göttin Teil 2 Begegnung mit der Shakti - Tantra-Yoga Alfred Ballabene 1 Einführung Bei den Texten handelt es sich um Gedanken darüber wie wir dem göttlichen Allbewusstsein begegnen
Liebe einer namenlosen Göttin Teil 2 Begegnung mit der Shakti - Tantra-Yoga Alfred Ballabene 1 Einführung Bei den Texten handelt es sich um Gedanken darüber wie wir dem göttlichen Allbewusstsein begegnen
Psychologie der Schönheit. Psychologie der Schönheit
 Dr. Lea Höfel Diplom-Psychologin Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz Schneewittchen ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude nicht lassen wusste und ein großes Fest anstellte.
Dr. Lea Höfel Diplom-Psychologin Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz Schneewittchen ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude nicht lassen wusste und ein großes Fest anstellte.
Großer Fragebogen Hund
 Großer Fragebogen Hund Konstitutionsbehandlung Um Ihren Hund im Sinne der klassischen Tierhomöopathie zu behandeln zu können, müssen Sie mir nun einige Fragen zu Ihrem Hund beantworten. Bitte nehmen sie
Großer Fragebogen Hund Konstitutionsbehandlung Um Ihren Hund im Sinne der klassischen Tierhomöopathie zu behandeln zu können, müssen Sie mir nun einige Fragen zu Ihrem Hund beantworten. Bitte nehmen sie
Redemittel für wissenschaftliche Texte (zusammengestellt von Natalia Schultis, PH Freiburg)
 1. Thema nennen Redemittel für wissenschaftliche Texte (zusammengestellt von Natalia Schultis, PH Freiburg) sich befassen mit in... geht es um der Vortrag, Text, ect. handelt von sich widmen + Dat. ( diese
1. Thema nennen Redemittel für wissenschaftliche Texte (zusammengestellt von Natalia Schultis, PH Freiburg) sich befassen mit in... geht es um der Vortrag, Text, ect. handelt von sich widmen + Dat. ( diese
Respekt. 1. Kapitel: Warum Respekt?
 Respekt 1. Kapitel: Warum Respekt? Ich bin s, Kurzi, bin kein großer Dichter Und in der Schule gibt s größre Lichter Doch eins check sogar ich Mann, gar keine Frage Respekt ist cool Mann, egal in welcher
Respekt 1. Kapitel: Warum Respekt? Ich bin s, Kurzi, bin kein großer Dichter Und in der Schule gibt s größre Lichter Doch eins check sogar ich Mann, gar keine Frage Respekt ist cool Mann, egal in welcher
Mk 1,40-45. Leichte Sprache
 Mk 1,40-45 Leichte Sprache Einmal kam ein Mann zu Jesus. Der Mann war krank. Die Krankheit heißt Aussatz. Aussatz ist eine ekelige Krankheit. Aussatz macht die Haut krank. Menschen mit Aussatz dürfen nicht
Mk 1,40-45 Leichte Sprache Einmal kam ein Mann zu Jesus. Der Mann war krank. Die Krankheit heißt Aussatz. Aussatz ist eine ekelige Krankheit. Aussatz macht die Haut krank. Menschen mit Aussatz dürfen nicht
Einstein glaubte fest daran, dass das Universum von 16 einem transzendenten und objektiven Wert durchdrungen ist, der weder ein Naturphänomen noch
 Einstein glaubte fest daran, dass das Universum von 16 einem transzendenten und objektiven Wert durchdrungen ist, der weder ein Naturphänomen noch eine subjektive Reaktion auf ein Naturphänomen ist. Deshalb
Einstein glaubte fest daran, dass das Universum von 16 einem transzendenten und objektiven Wert durchdrungen ist, der weder ein Naturphänomen noch eine subjektive Reaktion auf ein Naturphänomen ist. Deshalb
Rembrandt. Harmenszoon van Rijn (1606 1669) Sein Leben 1
 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 1669) Sein Leben 1 Rembrandt wurde am 15. Juli 1606 in Leiden (Holland) geboren. Sein vollständiger Name lautete: Rembrandt Harmenszoon (Sohn des Harmen) van Rijn (Rhein).
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 1669) Sein Leben 1 Rembrandt wurde am 15. Juli 1606 in Leiden (Holland) geboren. Sein vollständiger Name lautete: Rembrandt Harmenszoon (Sohn des Harmen) van Rijn (Rhein).
Altes Testament und christliche Gemeinde
 Altes Testament und christliche Gemeinde Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 10 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann
Altes Testament und christliche Gemeinde Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 10 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Der Apostel Paulus. Saulus fand es gut, wenn die Christen getötet wurden, damit wieder Ruhe im Land war und alles so blieb wie vorher.
 Der Apostel Paulus Vom Saulus zum Paulus : Das sagt man, wenn ein Mensch sich völlig zum Guten verändert. Vor allem, wenn ein schlechter oder gleichgültiger Mensch auf einmal anfängt, sich sehr für eine
Der Apostel Paulus Vom Saulus zum Paulus : Das sagt man, wenn ein Mensch sich völlig zum Guten verändert. Vor allem, wenn ein schlechter oder gleichgültiger Mensch auf einmal anfängt, sich sehr für eine
Selbst- und Fremdzuschreibungen zwischen Europa und "dem Orient"
 Der Islam, Europa und wir Selbst- und Fremdzuschreibungen zwischen Europa und "dem Orient" FACH UND SCHULFORM Geschichte und Politische Bildung, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, 9. 12.
Der Islam, Europa und wir Selbst- und Fremdzuschreibungen zwischen Europa und "dem Orient" FACH UND SCHULFORM Geschichte und Politische Bildung, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, 9. 12.
Thomas von Aquin. Einer der wichtigsten Philosophen der Scholastik; verbindet Philosophie des Aristoteles mit christlicher Theologie
 Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und
Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und
"G tt und die Sternzeichen":
 "G tt und die Sternzeichen": Jenny Mystikeye: Gott und die Sternzeichen:... Und es war Morgen, als Gott vor seinen zwölf Kindern stand und in jedes von ihnen den Samen menschlichen Lebens legte. Die Kinder
"G tt und die Sternzeichen": Jenny Mystikeye: Gott und die Sternzeichen:... Und es war Morgen, als Gott vor seinen zwölf Kindern stand und in jedes von ihnen den Samen menschlichen Lebens legte. Die Kinder
Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing
 Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
Pädagogik. Sandra Steinbrock. Wege in die Sucht. Studienarbeit
 Pädagogik Sandra Steinbrock Wege in die Sucht Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung S.1 2 Was versteht man unter Sucht? S.2 2.1 Begriffsbestimmung S.2 2.2 Abgrenzung der Begriffe Sucht und Abhängigkeit
Pädagogik Sandra Steinbrock Wege in die Sucht Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung S.1 2 Was versteht man unter Sucht? S.2 2.1 Begriffsbestimmung S.2 2.2 Abgrenzung der Begriffe Sucht und Abhängigkeit
BAUSTEIN 14: Weltkarten sind Weltsichten
 BAUSTEIN 14 Karten BAUSTEIN 14: Kurzbeschreibung: Die SchülerInnen lernen verschiedene, nicht europäisch zentrierte Weltkarten zu lesen. Dauer: 1 Unterrichts-Einheit Schulstufe: Sekundarstufe I+II Arbeitsmaterialien:
BAUSTEIN 14 Karten BAUSTEIN 14: Kurzbeschreibung: Die SchülerInnen lernen verschiedene, nicht europäisch zentrierte Weltkarten zu lesen. Dauer: 1 Unterrichts-Einheit Schulstufe: Sekundarstufe I+II Arbeitsmaterialien:
Von Jesus beten lernen
 Von Jesus beten lernen Predigt am 24.04.2013 zu Joh 17,1-23 Pfr. z.a. David Dengler Liebe Gemeinde, es ist ein sehr eindrücklicher Abschnitt aus der Passionsgeschichte, die Erzählung von Jesus im Garten
Von Jesus beten lernen Predigt am 24.04.2013 zu Joh 17,1-23 Pfr. z.a. David Dengler Liebe Gemeinde, es ist ein sehr eindrücklicher Abschnitt aus der Passionsgeschichte, die Erzählung von Jesus im Garten
Frauenrechte im Islam
 Geisteswissenschaft Sandra Schweiker Frauenrechte im Islam Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einführung Seite 1 2. Stellung der Frau im Islam Seite 1 2.1. Das Leben der Frau in der Gesellschaft Seite
Geisteswissenschaft Sandra Schweiker Frauenrechte im Islam Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einführung Seite 1 2. Stellung der Frau im Islam Seite 1 2.1. Das Leben der Frau in der Gesellschaft Seite
Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen - aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen
 Alfred Fries Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen - aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen ATHEN A sverzeichnis Einleitung 11 I Theoretischer Teil 23 1 Behinderung: Begriffliche
Alfred Fries Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen - aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen ATHEN A sverzeichnis Einleitung 11 I Theoretischer Teil 23 1 Behinderung: Begriffliche
1.3 Gottes Ideal für den Menschen
 1.3 Gottes Ideal für den Menschen Ein Muster der Liebe und des Guten Sie müssen wissen, dass Gott alle Dinge für die wahre Liebe und für den wahren Menschen geschaffen hat. Die Schöpfung ist so aufgebaut,
1.3 Gottes Ideal für den Menschen Ein Muster der Liebe und des Guten Sie müssen wissen, dass Gott alle Dinge für die wahre Liebe und für den wahren Menschen geschaffen hat. Die Schöpfung ist so aufgebaut,
Möglichkeiten und Grenzen der Burnout-Prävention
 Geisteswissenschaft Tobias Redeker Möglichkeiten und Grenzen der Burnout-Prävention Studienarbeit Inhaltverzeichnis 8. Literatur- und Quellenverzeichnis Das Thema Burnout ist heute so aktuell wie nie.
Geisteswissenschaft Tobias Redeker Möglichkeiten und Grenzen der Burnout-Prävention Studienarbeit Inhaltverzeichnis 8. Literatur- und Quellenverzeichnis Das Thema Burnout ist heute so aktuell wie nie.
Verbale und Nonverbale Kommunikation. Einführung in die Psychologie der Kommunikation in der Hausarztpraxis
 Verbale und Nonverbale Kommunikation Einführung in die Psychologie der Kommunikation in der Hausarztpraxis Verbale und nonverbale Kommunikation Lernziele Das 4 -Ohren-Modell von Schulz v. Thun kennen und
Verbale und Nonverbale Kommunikation Einführung in die Psychologie der Kommunikation in der Hausarztpraxis Verbale und nonverbale Kommunikation Lernziele Das 4 -Ohren-Modell von Schulz v. Thun kennen und
Informationen und Fragen zur Aufnahme eines ausländischen Kindes
 Vermittlungsstelle (Stempel) Name Datum: Informationen und Fragen zur Aufnahme eines ausländischen Kindes Sie haben Interesse geäußert ein ausländisches, eventuell dunkelhäutiges Kind aufzunehmen. Die
Vermittlungsstelle (Stempel) Name Datum: Informationen und Fragen zur Aufnahme eines ausländischen Kindes Sie haben Interesse geäußert ein ausländisches, eventuell dunkelhäutiges Kind aufzunehmen. Die
Adventliche Verheißungen 2011. 1. Ursprung der Verheißungen zu Gen 3,15
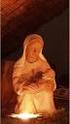 Adventliche Verheißungen 2011 1. Ursprung der Verheißungen zu Gen 3,15 1. Advent als Ankunft und Erwartung Wenn wir heute über den Advent sprechen, dann meinen wir die vier Wochen vor Weihnachten, in denen
Adventliche Verheißungen 2011 1. Ursprung der Verheißungen zu Gen 3,15 1. Advent als Ankunft und Erwartung Wenn wir heute über den Advent sprechen, dann meinen wir die vier Wochen vor Weihnachten, in denen
Umsetzung des Lehrplans für Oberschulen (Mittelschulen) im Schulbuch Abenteuer Ethik 3 Sachsen
 Umsetzung des Lehrplans für Oberschulen (Mittelschulen) im Schulbuch Abenteuer Ethik 3 Sachsen DS: Doppelseite Klassenstufe 9 Lehrplan Lernbereich 1: Das menschliche Leben ein Weg Kapitel Lebenswege (S.
Umsetzung des Lehrplans für Oberschulen (Mittelschulen) im Schulbuch Abenteuer Ethik 3 Sachsen DS: Doppelseite Klassenstufe 9 Lehrplan Lernbereich 1: Das menschliche Leben ein Weg Kapitel Lebenswege (S.
GESUNDHEIT ANDERS BETRACHTET
 GESUNDHEIT ANDERS BETRACHTET GESUND WERDEN AUF ANDERE WEISE 2 Durchblutung Gewebereparatur Entzündung Schmerz Gesund zu sein ist für die meisten Menschen etwas ganz Selbstverständliches. Doch manchmal
GESUNDHEIT ANDERS BETRACHTET GESUND WERDEN AUF ANDERE WEISE 2 Durchblutung Gewebereparatur Entzündung Schmerz Gesund zu sein ist für die meisten Menschen etwas ganz Selbstverständliches. Doch manchmal
Ergotherapeutische Befunderhebung
 Ergotherapeutische Befunderhebung.1 ICF als Grundlage der ergotherapeutischen Befunderhebung 24.2 Wie kann eine ergothera-peutische Befunderhebung bei demenzkranken Menschen aussehen? 25. Bogen zur ergotherapeutischen
Ergotherapeutische Befunderhebung.1 ICF als Grundlage der ergotherapeutischen Befunderhebung 24.2 Wie kann eine ergothera-peutische Befunderhebung bei demenzkranken Menschen aussehen? 25. Bogen zur ergotherapeutischen
Montaigne über die Freundschaft und warum sie die stärkste Liebe ist.
 1 Andre Schuchardt präsentiert Montaigne über die Freundschaft und warum sie die stärkste Liebe ist. Inhaltsverzeichnis Montaigne über die Freundschaft und warum sie stärker als die Liebe ist...1 1. Einleitung...1
1 Andre Schuchardt präsentiert Montaigne über die Freundschaft und warum sie die stärkste Liebe ist. Inhaltsverzeichnis Montaigne über die Freundschaft und warum sie stärker als die Liebe ist...1 1. Einleitung...1
Modul 2 Ego MANN oder Gib dem Affen Zucker
 Modul 2 Ego MANN oder Gib dem Affen Zucker 2015 Christian Stehlik, www.typisch-mann.at Kontakt: office@typisch-mann.at Alle in diesem Report enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen des Autors
Modul 2 Ego MANN oder Gib dem Affen Zucker 2015 Christian Stehlik, www.typisch-mann.at Kontakt: office@typisch-mann.at Alle in diesem Report enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen des Autors
Inhalt. Vorwort des Herausgebers. Harry Lehmann Zehn Thesen zur Kunstkritik 11. Peter Bürger Begriff und Grenzen der Kritik 37
 Inhalt Vorwort des Herausgebers Zehn Thesen zur Kunstkritik 11 Peter Bürger Begriff und Grenzen der Kritik 37 Christian Demand Kritik der Kritik der Kritik Ein metadiagnostischer Zwischenruf in eigener
Inhalt Vorwort des Herausgebers Zehn Thesen zur Kunstkritik 11 Peter Bürger Begriff und Grenzen der Kritik 37 Christian Demand Kritik der Kritik der Kritik Ein metadiagnostischer Zwischenruf in eigener
über das Thema Liebe mit dem Papst:
 Sokratischer Dialog über das Thema Liebe mit dem Papst: 1. Aufbau des Sokratischen Dialogs: 1. Erste Stufe: Selbsterkenntnis 2. Zweite Stufe: Resultat der Selbsterkenntnis, das man nichts weiß. 3. Dritte
Sokratischer Dialog über das Thema Liebe mit dem Papst: 1. Aufbau des Sokratischen Dialogs: 1. Erste Stufe: Selbsterkenntnis 2. Zweite Stufe: Resultat der Selbsterkenntnis, das man nichts weiß. 3. Dritte
Predigt im Gottesdienst gemeinsam gefeiert mit Menschen mit Demenz Paul Klee: Vergesslicher Engel Pastor Tobias Götting. Liebe Gemeinde!
 Predigt im Gottesdienst gemeinsam gefeiert mit Menschen mit Demenz Paul Klee: Vergesslicher Engel Pastor Tobias Götting Liebe Gemeinde! Als Gott dich geschaffen hat hat er bei sich abgeguckt. Gott hat
Predigt im Gottesdienst gemeinsam gefeiert mit Menschen mit Demenz Paul Klee: Vergesslicher Engel Pastor Tobias Götting Liebe Gemeinde! Als Gott dich geschaffen hat hat er bei sich abgeguckt. Gott hat
Die Evangelische Allianz in Deutschland. Gemeinsames Zeugnis für Gott durch die abrahamitischen Religionen?
 Die Evangelische Allianz in Deutschland Gemeinsames Zeugnis für Gott durch die abrahamitischen Religionen? Gemeinsames Zeugnis für Gott durch die abrahamitischen Religionen? Gern wird heute, vor allem
Die Evangelische Allianz in Deutschland Gemeinsames Zeugnis für Gott durch die abrahamitischen Religionen? Gemeinsames Zeugnis für Gott durch die abrahamitischen Religionen? Gern wird heute, vor allem
Medizinische Entscheidungstheorie
 WW Z, Stiftungsprofessur Health Economics Prof. Dr. Stefan Felder Medizinische Entscheidungstheorie Lösung der Übungen Aufgabe 1.1 Mithilfe des diagnostischen s für Prostatakrebs wird die Konzentration
WW Z, Stiftungsprofessur Health Economics Prof. Dr. Stefan Felder Medizinische Entscheidungstheorie Lösung der Übungen Aufgabe 1.1 Mithilfe des diagnostischen s für Prostatakrebs wird die Konzentration
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Erörterungen schreiben im Unterricht. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Bestellnummer: 58073 Kurzvorstellung: Das Verfassen einer Erörterung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Bestellnummer: 58073 Kurzvorstellung: Das Verfassen einer Erörterung
Wenn die Liebe zum Leben wird
 Hans-Joachim Eckstein Wenn die Liebe zum Leben wird Zur Beziehungsgewissheit Reihe: Grundlagen des Glaubens 3 Gott als Vater das zentrale christliche Gottesverständnis? 31 U nter den zahlreichen neutestamentlichen
Hans-Joachim Eckstein Wenn die Liebe zum Leben wird Zur Beziehungsgewissheit Reihe: Grundlagen des Glaubens 3 Gott als Vater das zentrale christliche Gottesverständnis? 31 U nter den zahlreichen neutestamentlichen
Die 4 besten Yoga-Übungen vor dem Einstieg in die Route
 Die 4 besten Yoga-Übungen vor dem Einstieg in die Route Fokussierter klettern Mehr Konzentration Mehr Selbstsicherheit www.con-todo.com Warum Yoga vor dem Einstieg? Früher wäre es mir nie in den Sinn gekommen,
Die 4 besten Yoga-Übungen vor dem Einstieg in die Route Fokussierter klettern Mehr Konzentration Mehr Selbstsicherheit www.con-todo.com Warum Yoga vor dem Einstieg? Früher wäre es mir nie in den Sinn gekommen,
Was ist wahre Gemeinschaft mit Christus? (4) Johannes 14,27; 15,8.9; 15,11; 17,24
 Was ist wahre Gemeinschaft mit Christus? (4) Johannes 14,27; 15,8.9; 15,11; 17,24 Willem J. Ouweneel SoundWords,online seit: 03.10.2008 soundwords.de/a5326.html SoundWords 2000 2016. Alle Rechte vorbehalten.
Was ist wahre Gemeinschaft mit Christus? (4) Johannes 14,27; 15,8.9; 15,11; 17,24 Willem J. Ouweneel SoundWords,online seit: 03.10.2008 soundwords.de/a5326.html SoundWords 2000 2016. Alle Rechte vorbehalten.
Ich möchte Sie daher bitten, diesen Fragebogen vor der Untersuchung bei mir auszufüllen.
 Schwindelfragebogen Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Schwindel tritt bei einer Vielzahl von Erkrankungen auf. Eine genaue Schilderung der Beschwerden ist wichtig, da die Ursache von Schwindel
Schwindelfragebogen Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Schwindel tritt bei einer Vielzahl von Erkrankungen auf. Eine genaue Schilderung der Beschwerden ist wichtig, da die Ursache von Schwindel
Ansprache zu Psalm 139 beim ökumenischen Gedenkgottesdienst für Verstorbene ohne Trauerfeier 9. Mai 2014 (St. Laurentius)
 Ansprache zu Psalm 139 beim ökumenischen Gedenkgottesdienst für Verstorbene ohne Trauerfeier 9. Mai 2014 (St. Laurentius) Wir sind gedenken heute der Verstorbenen in unserer Stadt, für die es keine Trauerfeier
Ansprache zu Psalm 139 beim ökumenischen Gedenkgottesdienst für Verstorbene ohne Trauerfeier 9. Mai 2014 (St. Laurentius) Wir sind gedenken heute der Verstorbenen in unserer Stadt, für die es keine Trauerfeier
MBSR Kurs Bodyscan kurz (15 min)
 Alfred Spill 3 mal Glocke (Einführung) Sie haben sich Zeit genommen für eine angeleitete, achtsame Körperwahrnehmung. Begeben sie sich dazu an einem geschützten Ort, an dem sie nicht gestört werden auch
Alfred Spill 3 mal Glocke (Einführung) Sie haben sich Zeit genommen für eine angeleitete, achtsame Körperwahrnehmung. Begeben sie sich dazu an einem geschützten Ort, an dem sie nicht gestört werden auch
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation
 Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören.
 Für Immer???... Was ist AA? AA ist die Abkürzung für Anonyme Alkoholiker nicht für Anti-Alkoholiker oder viele andere Begriffe, mit denen Außenstehende oft fälschlicherweise AA erklären. AA ist kein Abstinenzlerverein.
Für Immer???... Was ist AA? AA ist die Abkürzung für Anonyme Alkoholiker nicht für Anti-Alkoholiker oder viele andere Begriffe, mit denen Außenstehende oft fälschlicherweise AA erklären. AA ist kein Abstinenzlerverein.
12 Einstellungen zur Rolle der Frau
 12 Einstellungen zur Rolle der Frau Die Rolle der Frau in Familie und Beruf hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert: Die Zahl der Ehescheidungen nimmt zu, die Geburtenrate sinkt und es sind
12 Einstellungen zur Rolle der Frau Die Rolle der Frau in Familie und Beruf hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert: Die Zahl der Ehescheidungen nimmt zu, die Geburtenrate sinkt und es sind
Geisteswissenschaft. Carolin Wiechert. Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen.
 Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
RHEUMA. Ausdruck Einblicke Verarbeitung
 RHEUMA Ausdruck Einblicke Verarbeitung Meine Bilder zeigen, was in mir abläuft und was diese Krankheit mit mir macht. Ich musste erst zusammenbrechen, um in einer Therapie zu lernen, dass nicht nur eine
RHEUMA Ausdruck Einblicke Verarbeitung Meine Bilder zeigen, was in mir abläuft und was diese Krankheit mit mir macht. Ich musste erst zusammenbrechen, um in einer Therapie zu lernen, dass nicht nur eine
Ich glaube auch, weil ich gedacht habe, dem gehört die Kirche.
 Gottesdienst zur Amtseinführung von Wilfried Fussenegger, am 7. November 2010 Lutherischen Stadtkirche in Wien Es geht eine langer Traum in Erfüllung... heute. - Dass mein Arbeitsplatz eine Kirche ist.
Gottesdienst zur Amtseinführung von Wilfried Fussenegger, am 7. November 2010 Lutherischen Stadtkirche in Wien Es geht eine langer Traum in Erfüllung... heute. - Dass mein Arbeitsplatz eine Kirche ist.
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus. Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen. Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.
 Hinweise zur Nutzung und zu den Kopierrechten dieser Materialien --------------------------------------------------------------------- 1. Didaktische Hinweise 2. Nutzung und Kopierrechte 3. Bitte um Unterstützung
Hinweise zur Nutzung und zu den Kopierrechten dieser Materialien --------------------------------------------------------------------- 1. Didaktische Hinweise 2. Nutzung und Kopierrechte 3. Bitte um Unterstützung
Kritik der Urteilskraft
 IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Herausgegeben von KARLVORLÄNDER Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme FELIX MEINER VERLAG HAMBURG Vorbemerkung zur siebenten Auflage Zur Entstehung der Schrift.
IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Herausgegeben von KARLVORLÄNDER Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme FELIX MEINER VERLAG HAMBURG Vorbemerkung zur siebenten Auflage Zur Entstehung der Schrift.
Präsentieren auf Englisch
 Präsentieren auf Englisch Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für
Präsentieren auf Englisch Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für
Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch
 Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Dr. Uwe Meyer Universität Osnabrück Fachbereich 2 - Philosophie Katharinenstr. 5 49069 Osnabrück. 0541-9694424
 Dr. Uwe Meyer Universität Osnabrück Fachbereich 2 - Philosophie Katharinenstr. 5 49069 Osnabrück 0541-9694424 uwmeyer@uos.de Essay: Descartes über die Erkenntnis von Wachs Die Rolle der Wahrnehmung, der
Dr. Uwe Meyer Universität Osnabrück Fachbereich 2 - Philosophie Katharinenstr. 5 49069 Osnabrück 0541-9694424 uwmeyer@uos.de Essay: Descartes über die Erkenntnis von Wachs Die Rolle der Wahrnehmung, der
Erwerbstätigkeit und Rente
 Erwerbstätigkeit und Rente Datenbasis: 1.001 Befragte (Arbeitnehmer in NRW) Erhebungszeitraum: 11. bis 30. April 2014 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: DAK Gesundheit 39 Prozent
Erwerbstätigkeit und Rente Datenbasis: 1.001 Befragte (Arbeitnehmer in NRW) Erhebungszeitraum: 11. bis 30. April 2014 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: DAK Gesundheit 39 Prozent
SCHLAGANFALL RATGEBER
 SCHLAGANFALL RATGEBER 0 Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich geschützt.
SCHLAGANFALL RATGEBER 0 Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich geschützt.
1. Warum wird der Begriff Vaterherz Gottes verwendet?
 Was hat es mit dem Vaterherzen Gottes auf sich? 1. Warum wird der Begriff Vaterherz Gottes verwendet? Weil er in der Schrift selbst vorkommt: Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und
Was hat es mit dem Vaterherzen Gottes auf sich? 1. Warum wird der Begriff Vaterherz Gottes verwendet? Weil er in der Schrift selbst vorkommt: Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und
Unterschiedliche und gleiche Hautfarbe bei Mann und Frau in der fruehchristlichen Kunst
 Unterschiedliche und gleiche Hautfarbe bei Mann und Frau in der fruehchristlichen Kunst Bearbeitet von Georg Zluwa 1. Auflage 2010. Buch. 188 S. Hardcover ISBN 978 3 631 60294 2 Format (B x L): 14,8 x
Unterschiedliche und gleiche Hautfarbe bei Mann und Frau in der fruehchristlichen Kunst Bearbeitet von Georg Zluwa 1. Auflage 2010. Buch. 188 S. Hardcover ISBN 978 3 631 60294 2 Format (B x L): 14,8 x
Geschichte und Gegenstand der Kriminalsoziologie
 Geschichte und Gegenstand der Kriminalsoziologie König, René: Theorie und Praxis in der Kriminalsoziologie. In: Sack, König (1968): Kriminalsoziologie. Frankfurt am Main: Akademischer Verlagsgesellschaft,
Geschichte und Gegenstand der Kriminalsoziologie König, René: Theorie und Praxis in der Kriminalsoziologie. In: Sack, König (1968): Kriminalsoziologie. Frankfurt am Main: Akademischer Verlagsgesellschaft,
Tinnitus (Ohrensausen) ein Volksleiden Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Dr. med. Isabella Wagner HNO-Facharzt LKH Wiener Neustadt
 ein Volksleiden Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten Dr. med. Isabella Wagner HNO-Facharzt LKH Wiener Neustadt Was bezeichnet man als Tinnitus? Der Begriff Tinnitus aurium (lat. das Klingeln der Ohren
ein Volksleiden Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten Dr. med. Isabella Wagner HNO-Facharzt LKH Wiener Neustadt Was bezeichnet man als Tinnitus? Der Begriff Tinnitus aurium (lat. das Klingeln der Ohren
V Academic. Felix Albrecht, Die Weisheit Salomos
 V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die eisheit Salomos Übersetzt und eingeleitet von Felix Albrecht Vandenhoeck
V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die eisheit Salomos Übersetzt und eingeleitet von Felix Albrecht Vandenhoeck
2. Persönliche und berufliche Veränderungsprozesse bei den MentorInnen
 2. Persönliche und berufliche Veränderungsprozesse bei den MentorInnen Die primäre Zielsetzung aller Mentoring-Programme bezieht sich auf die Entwicklung der Mentees. Doch impliziert der Charakter einer
2. Persönliche und berufliche Veränderungsprozesse bei den MentorInnen Die primäre Zielsetzung aller Mentoring-Programme bezieht sich auf die Entwicklung der Mentees. Doch impliziert der Charakter einer
Buddhismus. Ingrid Lorenz. Buddhismus 1
 Buddhismus Ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, soll es auch nicht für ihn sein. Und ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, wie kann ich ihn einem anderen
Buddhismus Ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, soll es auch nicht für ihn sein. Und ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, wie kann ich ihn einem anderen
Die ethnologische Feldforschung. Vorlesung 1 Dichte Beschreibung
 Die ethnologische Feldforschung Vorlesung 1 Dichte Beschreibung Beschreiben Verstehen Deuten Wiedergeben; Erfassen, Einfangen Einzelfallstudie Ethnographisches Detail Ein lebendiges Bild einer Situation/
Die ethnologische Feldforschung Vorlesung 1 Dichte Beschreibung Beschreiben Verstehen Deuten Wiedergeben; Erfassen, Einfangen Einzelfallstudie Ethnographisches Detail Ein lebendiges Bild einer Situation/
...nach Italien! Das Bild Italiens in "Aus dem Leben eines Taugenichts" von Joseph von Eichendorff
 Germanistik Katharina Tiemeyer...nach Italien! Das Bild Italiens in "Aus dem Leben eines Taugenichts" von Joseph von Eichendorff Studienarbeit Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Deutsches Seminar II
Germanistik Katharina Tiemeyer...nach Italien! Das Bild Italiens in "Aus dem Leben eines Taugenichts" von Joseph von Eichendorff Studienarbeit Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Deutsches Seminar II
Mangas zeichnen. w w w. t k - l o g o. d e
 1. Schritt: ein Motiv überlegen Um ein Manga zeichnen zu können, musst Du Dir erst mal eine Person (Manga) ausdenken. Wenn Du keine Idee hast, wen Du zeichnen könntest, blättere einfach in einer Zeitschrift
1. Schritt: ein Motiv überlegen Um ein Manga zeichnen zu können, musst Du Dir erst mal eine Person (Manga) ausdenken. Wenn Du keine Idee hast, wen Du zeichnen könntest, blättere einfach in einer Zeitschrift
Wir werden nun einen Test machen, welcher sich `Delta-Muskel-Test` nennt.
 Der 5. Schlüssel Sie haben sich dazu entschlossen, die rote Pille zu nehmen: Die Pille der Wahrheit. Es war Ihre freie Entscheidung. Alle daraus resultierenden Erkenntnisse und Gefahren unterliegen Ihrer
Der 5. Schlüssel Sie haben sich dazu entschlossen, die rote Pille zu nehmen: Die Pille der Wahrheit. Es war Ihre freie Entscheidung. Alle daraus resultierenden Erkenntnisse und Gefahren unterliegen Ihrer
Wege aus der Angst. Entspannung 25. Beruhigendes Wissen 36. Negative Gedanken in positive umwandeln 38. Gedanken-Stopp 40
 Wege aus der Angst Entspannung 25 Beruhigendes Wissen 36 Negative Gedanken in positive umwandeln 38 Gedanken-Stopp 40 Gedanken konsequent zu Ende denken 41 Angstbewältigung vor dem Flug und an Bord 43
Wege aus der Angst Entspannung 25 Beruhigendes Wissen 36 Negative Gedanken in positive umwandeln 38 Gedanken-Stopp 40 Gedanken konsequent zu Ende denken 41 Angstbewältigung vor dem Flug und an Bord 43
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre am Städtischen Gymnasium Gütersloh
 Unterrichtsvorhaben 1 : Thema: Was ist Religion? Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Konkretisierte Kompetenzerwartungen: Inhaltliche Schwerpunkte:
Unterrichtsvorhaben 1 : Thema: Was ist Religion? Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Konkretisierte Kompetenzerwartungen: Inhaltliche Schwerpunkte:
Tagebuch. Predigt am 03.03.2013 zu Jer 20,7-13 Pfr. z.a. David Dengler
 Tagebuch Predigt am 03.03.2013 zu Jer 20,7-13 Pfr. z.a. David Dengler Liebe Gemeinde, so ein Tagebuch ist eine spannende Sache. Da schreibt man nämlich Dinge rein, die man sonst niemandem erzählen würde.
Tagebuch Predigt am 03.03.2013 zu Jer 20,7-13 Pfr. z.a. David Dengler Liebe Gemeinde, so ein Tagebuch ist eine spannende Sache. Da schreibt man nämlich Dinge rein, die man sonst niemandem erzählen würde.
Schade, wenn es so wäre! Denn dann hätten Sie vielleicht etwas versäumt: nämlich das Wunder von Weihnachten ganz und gar auszukosten.
 Liebe Gemeinde, eine Frage vorweg: steht in Ihrem Wohnzimmer noch der Weihnachtsbaum? Oder haben Sie in bereits entsorgt? Möglich wäre da ja. Sie erinnern sich: bereits am 24. Dezember, also an Heiligabend,
Liebe Gemeinde, eine Frage vorweg: steht in Ihrem Wohnzimmer noch der Weihnachtsbaum? Oder haben Sie in bereits entsorgt? Möglich wäre da ja. Sie erinnern sich: bereits am 24. Dezember, also an Heiligabend,
Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben?
 Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben? 1. Entwickeln Sie ausgehend von a. den übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen b. den inhaltlichen
Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben? 1. Entwickeln Sie ausgehend von a. den übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen b. den inhaltlichen
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Selbstständig als Unternehmensberater interna
 Selbstständig als Unternehmensberater interna Ihr persönlicher Experte Inhalt Vorwort... 7 Was tut ein Unternehmensberater?... 7 Tätigkeitsbereiche eines Unternehmensberaters... 9 Voraussetzungen... 22
Selbstständig als Unternehmensberater interna Ihr persönlicher Experte Inhalt Vorwort... 7 Was tut ein Unternehmensberater?... 7 Tätigkeitsbereiche eines Unternehmensberaters... 9 Voraussetzungen... 22
Kind + Epilepsie = Emotionen
 Kind + Epilepsie = Emotionen Dr. med. Jürg Unger-Köppel Chefarzt KJPD Aargau www.pdag.ch 1. Oktober 2010 Seite 1 3 Hauptfelder der Emotionen Eltern, Grosseltern, Geschwister, weitere Angehörige Das Kind
Kind + Epilepsie = Emotionen Dr. med. Jürg Unger-Köppel Chefarzt KJPD Aargau www.pdag.ch 1. Oktober 2010 Seite 1 3 Hauptfelder der Emotionen Eltern, Grosseltern, Geschwister, weitere Angehörige Das Kind
Epilepsie im Wandel der Zeit - Morbus sacer - Die heilige Krankheit. Epilepsie im Wandel der Zeit Morbus sacer - Die heilige Krankheit
 Epilepsie im Wandel der Zeit Morbus sacer - Die heilige Krankheit Hamburg (18. Oktober 2007) - Selbst für uns moderne Menschen hat es etwas Unheimliches, ja Be ängstigendes, wenn wir erstmals einen epileptischen
Epilepsie im Wandel der Zeit Morbus sacer - Die heilige Krankheit Hamburg (18. Oktober 2007) - Selbst für uns moderne Menschen hat es etwas Unheimliches, ja Be ängstigendes, wenn wir erstmals einen epileptischen
Was ist psychisch gesund? Was ist psychisch krank?
 Welt-Suizid-Präventionstag 2013 Was ist psychisch gesund? Was ist psychisch krank? Dr.med. Thomas Maier, Chefarzt St. Gallische Kantonale Psychiatrische Dienste Sektor Nord Zwei Fallbeispiele 2 Frau L.,
Welt-Suizid-Präventionstag 2013 Was ist psychisch gesund? Was ist psychisch krank? Dr.med. Thomas Maier, Chefarzt St. Gallische Kantonale Psychiatrische Dienste Sektor Nord Zwei Fallbeispiele 2 Frau L.,
1) Checkliste zur Vor- und Nachbereitung schwieriger Gespräche. TeilnehmerInnen des Gesprächs:
 1) Checkliste zur Vor- und Nachbereitung schwieriger Gespräche Datum: TeilnehmerInnen des Gesprächs: Wer hat Gesprächsbedarf? Ich? Mein Gesprächspartner? Wir beide? Jemand anders? Welche Beweggründe habe
1) Checkliste zur Vor- und Nachbereitung schwieriger Gespräche Datum: TeilnehmerInnen des Gesprächs: Wer hat Gesprächsbedarf? Ich? Mein Gesprächspartner? Wir beide? Jemand anders? Welche Beweggründe habe
JAHRGANGSSTUFE 7 LEHRPLANBEZUG. Thematischer Schwerpunkt
 JAHRGANGSSTUFE 7 Philosophieren anfangen 1, 5, 6 Methodenschwerpunkt Die Gefühle und der Verstand 1 Gefühl und Verstand Fremden begegnen 1, 2, 6 Glückserfahrungen machen zwischen Schein und Sein 4, 6,
JAHRGANGSSTUFE 7 Philosophieren anfangen 1, 5, 6 Methodenschwerpunkt Die Gefühle und der Verstand 1 Gefühl und Verstand Fremden begegnen 1, 2, 6 Glückserfahrungen machen zwischen Schein und Sein 4, 6,
Morphologie und Physiologie des Menschen
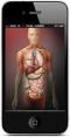 Joachim Stiller Morphologie und Physiologie des Menschen Alle Rechte vorbehalten Morphologie und Physiologie des Menschen Die dreigliedrige Leibesorganisation des Menschen Sehen wir uns zunächst den Knochenaufbau
Joachim Stiller Morphologie und Physiologie des Menschen Alle Rechte vorbehalten Morphologie und Physiologie des Menschen Die dreigliedrige Leibesorganisation des Menschen Sehen wir uns zunächst den Knochenaufbau
Hilary Putnam: Hirne im Tank
 Hilary Putnam: Hirne im Tank Das Tank Putnam entwirft eine moderne Variante des klassischen Skeptizismus bezüglich der Außenwelt und versucht, sie zurückzuweisen. Man stelle sich vor, ein Mensch (du kannst
Hilary Putnam: Hirne im Tank Das Tank Putnam entwirft eine moderne Variante des klassischen Skeptizismus bezüglich der Außenwelt und versucht, sie zurückzuweisen. Man stelle sich vor, ein Mensch (du kannst
Matthias Junge. Georg Simmel. kultur- und sozialwissenschaften
 Matthias Junge Georg Simmel kultur- und sozialwissenschaften 2 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG UND ÜBERBLICK 5 2 BIOGRAPHIE UND KONTEXT 7 3 ÜBER SOCIALE DIFFERENZIERUNG 10 3.1 Was ist
Matthias Junge Georg Simmel kultur- und sozialwissenschaften 2 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG UND ÜBERBLICK 5 2 BIOGRAPHIE UND KONTEXT 7 3 ÜBER SOCIALE DIFFERENZIERUNG 10 3.1 Was ist
Landesbildungsserver Baden-Württemberg Ethik - Religionen und Weltanschauungen: Islam. Islamische Kunst
 Islamische Kunst 5 10 15 20 25 30 35 Oft wird behauptet, der Islam untersage die bildliche Darstellung von Menschen und Tieren, doch dem ist nicht so. Tatsächlich gibt es zu dieser Frage im Koran nur wenige
Islamische Kunst 5 10 15 20 25 30 35 Oft wird behauptet, der Islam untersage die bildliche Darstellung von Menschen und Tieren, doch dem ist nicht so. Tatsächlich gibt es zu dieser Frage im Koran nur wenige
LEHRERINFORMATION SCHÖNHEIT. Oberstufe Deutsch. Schönheit in der Literatur. Material:
 Oberstufe Deutsch Bunt gemischte Texte aus verschiedenen literarischen Epochen und ein Thema: die menschliche Schönheit. Es äußern sich ein mittelalterlicher Dichter, ein Dichter aus dem Barock, Carlo
Oberstufe Deutsch Bunt gemischte Texte aus verschiedenen literarischen Epochen und ein Thema: die menschliche Schönheit. Es äußern sich ein mittelalterlicher Dichter, ein Dichter aus dem Barock, Carlo
Lepra im Mittelalter - Ein Überblick
 Geschichte Janin Huse Lepra im Mittelalter - Ein Überblick Studienarbeit Inhalt Einleitung... 3 1. Ausbreitung von Lepra im mittelalterlichen Europa... 3 2. Das Bakterium Mycobacterium leprae (Hansens
Geschichte Janin Huse Lepra im Mittelalter - Ein Überblick Studienarbeit Inhalt Einleitung... 3 1. Ausbreitung von Lepra im mittelalterlichen Europa... 3 2. Das Bakterium Mycobacterium leprae (Hansens
ELEKTRONISCHES TESTARCHIV
 Leibniz Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ELEKTRONISCHES TESTARCHIV Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer, wir freuen uns, dass
Leibniz Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ELEKTRONISCHES TESTARCHIV Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer, wir freuen uns, dass
Sie haben für den Prüfungsteil Schreiben (Teil 1 und Teil 2) insgesamt 80 Minuten Zeit.
 TEIL 1 Sie haben für den Prüfungsteil Schreiben (Teil 1 und Teil 2) insgesamt 80 Minuten Zeit. Eine Freundin möchte einen Brief an Familie Schuster in Deutschland schreiben. Sie bittet Sie, ihren Brief
TEIL 1 Sie haben für den Prüfungsteil Schreiben (Teil 1 und Teil 2) insgesamt 80 Minuten Zeit. Eine Freundin möchte einen Brief an Familie Schuster in Deutschland schreiben. Sie bittet Sie, ihren Brief
Arbeitsblatt 3: Glaube, der spricht zum 18. Textabschnitt
 Kontakt: Anna Feuersänger 0711 1656-340 Feuersaenger.A@diakonie-wue.de 1. Glaube, der spricht Arbeitsblatt 3: Glaube, der spricht zum 18. Textabschnitt Foto: Wolfram Keppler Hier sind vier Bilder. Sie
Kontakt: Anna Feuersänger 0711 1656-340 Feuersaenger.A@diakonie-wue.de 1. Glaube, der spricht Arbeitsblatt 3: Glaube, der spricht zum 18. Textabschnitt Foto: Wolfram Keppler Hier sind vier Bilder. Sie
1. Korinther 12, 4-11: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
 1. Korinther 12, 4-11: teilt sie zu. 5Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. 6Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie er, 7Doch an
1. Korinther 12, 4-11: teilt sie zu. 5Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. 6Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie er, 7Doch an
5. Optische Täuschungen
 5. Hat der Betrachter den Eindruck, es besteht ein Unterschied zwischen dem was er sieht und dem was er vor sich hat, spricht er von einer optischen Täuschung. So stellen optische Täuschungen die Ansicht
5. Hat der Betrachter den Eindruck, es besteht ein Unterschied zwischen dem was er sieht und dem was er vor sich hat, spricht er von einer optischen Täuschung. So stellen optische Täuschungen die Ansicht
Informationen und Fragen. zur Aufnahme eines. unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings
 Informationen und Fragen zur Aufnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings Sie haben Interesse geäußert einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aufzunehmen. Die folgenden Fragen haben zwei
Informationen und Fragen zur Aufnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings Sie haben Interesse geäußert einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aufzunehmen. Die folgenden Fragen haben zwei
Wir erklären. Mehrfach-Zugehörigkeit. und Mehrfach-Benachteiligung. Text in Leichter Sprache. Geschrieben von LesMigraS,
 Wir erklären Mehrfach-Zugehörigkeit und Mehrfach-Benachteiligung Text in Leichter Sprache Geschrieben von LesMigraS, Anti-Diskriminierungs-Bereich und Anti-Gewalt-Bereich der Lesben-Beratung Berlin e.v.
Wir erklären Mehrfach-Zugehörigkeit und Mehrfach-Benachteiligung Text in Leichter Sprache Geschrieben von LesMigraS, Anti-Diskriminierungs-Bereich und Anti-Gewalt-Bereich der Lesben-Beratung Berlin e.v.
Leitfaden AAI - Adult-Attachment-Interview
 Leitfaden AAI - Adult-Attachment-Interview nach Carol George und Mary Main Modifiziert für SAFE - Mentorenausbildung nach PD Dr. Karl Heinz Brisch 1. Vielleicht können Sie mir zunächst einen kurzen Überblick
Leitfaden AAI - Adult-Attachment-Interview nach Carol George und Mary Main Modifiziert für SAFE - Mentorenausbildung nach PD Dr. Karl Heinz Brisch 1. Vielleicht können Sie mir zunächst einen kurzen Überblick
Jahresplanung für den Katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 1. KLASSE
 Jahresplanung für den Katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 auf der Grundlage von fragen suchen entdecken 1/2. Neuausgabe (Kösel Schulbuch/Klett) 1. KLASSE Zeitraum Kapitel und
Jahresplanung für den Katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 auf der Grundlage von fragen suchen entdecken 1/2. Neuausgabe (Kösel Schulbuch/Klett) 1. KLASSE Zeitraum Kapitel und
Mama/Papa hat Krebs. Ein Projekt der Krebshilfe Wien
 Mama/Papa hat Krebs Ein Projekt der Krebshilfe Wien Mag. Esther Ingerle, Mag. Sonja Metzler & Mag. Jutta Steinschaden 3. Juni 2016 Lebens.Med Zentrum Bad Erlach Kostenfreie Beratung und Begleitung für
Mama/Papa hat Krebs Ein Projekt der Krebshilfe Wien Mag. Esther Ingerle, Mag. Sonja Metzler & Mag. Jutta Steinschaden 3. Juni 2016 Lebens.Med Zentrum Bad Erlach Kostenfreie Beratung und Begleitung für
LEONARDO BOFF. Was kommt nachher? DAS LEBEN NACH DEM TODE OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG
 LEONARDO BOFF Was kommt nachher? DAS LEBEN NACH DEM TODE OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG Inhalt Einleitung 13 1. Kapitel: Tod und Gericht, Hölle, Fegefeuer und Paradies - Woher wissen wir das? 15 1. Die Gründe
LEONARDO BOFF Was kommt nachher? DAS LEBEN NACH DEM TODE OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG Inhalt Einleitung 13 1. Kapitel: Tod und Gericht, Hölle, Fegefeuer und Paradies - Woher wissen wir das? 15 1. Die Gründe
Philosophie. als Leistungskurs? Philosophie / Hr
 Philosophie als Leistungskurs? 1 Philosophie als Leistungskurs? 2 Philo-Sophia: Liebe zur Weisheit Ein wunderbares Zeichen dafür, dass der Mensch als solcher ursprünglich philosophiert, sind die Fragen
Philosophie als Leistungskurs? 1 Philosophie als Leistungskurs? 2 Philo-Sophia: Liebe zur Weisheit Ein wunderbares Zeichen dafür, dass der Mensch als solcher ursprünglich philosophiert, sind die Fragen
