Gabriel Schoyerer Carola Frank Margarete Jooß-Weinbach Steffen Loick Molina Professionelle Praktiken
|
|
|
- Nikolas Wetzel
- vor 3 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Gabriel Schoyerer Carola Frank Margarete Jooß-Weinbach Steffen Loick Molina Professionelle Praktiken
3 Kindheitspädagogische Beiträge Herausgegeben von Tanja Betz Peter Cloos Die Handlungsfelder der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern bis zehn Jahren haben sich in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Sie stehen zunehmend im Fokus politischer Aufmerksamkeit und sind Gegenstand von Reformbemühungen. Kindheitspädagogische Forschung reagiert hierauf, indem sie den Blick nicht mehr allein auf das Kernarbeitsfeld des Kindergartens richtet, sondern den gesamten Bildungs- und Betreuungsmix kindheitspädagogischer Dienstleistungen fokussiert und dabei die Schnittstellen von öffentlicher und privater Bildung, Betreuung und Erziehung, von informellen, formalen und non-formalen Bildungs- und Betreuungssettings sowie neue Formen der Zusammenarbeit berücksichtigt. Die Reihe Kindheitspädagogische Beiträge trägt den skizzierten Veränderungen Rechnung, indem sie einen erweiterten, forschenden Blick auf die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern entwickelt und einen Ort für theoretisch fundierte und empirisch elaborierte Diskussionen bietet.
4 Gabriel Schoyerer Carola Frank Margarete Jooß-Weinbach Steffen Loick Molina Professionelle Praktiken Ethnografische Studien zum pädagogischen Alltag in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
5 Eine Veröffentlichung des Deutschen Jugendinstituts e.v. (DJI) Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute Europas. Seit über 50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder und Gemeinden und liefert wichtige Impulse für die Fachpraxis. Träger des 1963 gegründeten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitgliedern aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im Rahmen von Projektförderungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Europäischen Kommission, Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschaftsförderung. Aktuell arbeiten und forschen 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon 252 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler) an den beiden Standorten München und Halle (Saale). Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Dieses Buch ist erhältlich als: ISBN Print ISBN E-Book (PDF) 1. Auflage Beltz Juventa in der Verlagsgruppe Beltz Weinheim Basel Werderstraße 10, Weinheim Alle Rechte vorbehalten Herstellung: Hannelore Molitor Satz: text plus form, Dresden Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza Printed in Germany Weitere Informationen zu unseren Autor_innen und Titeln finden Sie unter:
6 Vorwort Die vorliegende Publikation ist im Rahmen des ethnografischen Forschungsprojekts Profile der Kindertagesbetreuung (ProKi) Alltag und Interaktion in Kita und Kindertagespflege entstanden, das von Januar 2015 bis Dezember 2017 am Deutschen Jugendinstitut e. V. München durchgeführt wurde. Ausgangspunkt des Forschungsprojektes war die Beobachtung, dass Angebote der Kindertagesbetreuung aus einem reichen Fundus an konzeptionellen Vorschlägen und programmatischen Entwürfen schöpfen können, hingegen relativ wenig darüber bekannt ist, wie dort Alltag praktisch gestaltet wird. Interessant ist eine solche Perspektive insofern, als die unterschiedlich strukturierten Betreuungssettings Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Großtagespflege in formalrechtlicher Hinsicht gleichen Anforderungen in punkto Bildung, Betreuung und Erziehung unterliegen bei gleichzeitiger erheblicher konzeptioneller Vielfalt innerhalb der Settings. Es geht in der ProKi-Studie aus einer vergleichenden Perspektive um die Frage, wie der Alltag in den verschiedenen Settings der Kindertagesbetreuung gestaltet wird und welche Leistungen die pädagogischen Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen hierbei erbringen. Auf der Grundlage von länger andauernden, teilnehmenden Beobachtungen konnte schrittweise die jeweilige Praxislogik in den untersuchten Fällen analytisch nachgezeichnet und damit ein Verständnis für spezifische, unterschiedliche wie vergleichbare Phänomene der Betreuungspraxis entwickelt werden. An der Durchführung des Forschungsprojekts Profile der Kindertagesbetreuung (ProKi) waren eine Reihe von Institutionen und Akteure beteiligt. Zunächst bedanken wir uns sehr herzlich beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) für die finanzielle Förderung. Unser großer Dank gilt daneben den Kindertagespflegepersonen und pädagogischen Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen, die als Orte der aufgesuchten Praxis mit uns über viele Monate hinweg zusammengearbeitet haben und mit großer Offenheit und fachlichem Interesse ihren Beitrag für das Gelingen des Forschungsprojekts geleistet haben. Ebenso gilt unser Dank denjenigen Organisationen und Personen, die uns bereitwillig beim Feldzugang unterstützt und den Weg in die Praxis geebnet haben. Darüber hinaus danken wir den Kolleginnen und Kollegen, die uns im Rahmen von projektbegleitenden Workshops sehr konstruktiv begleitet haben. Hervorheben möchten wir hier insbesondere Prof. Dr. Christina Huf (Universität Münster) und Prof. Dr. Peter Cloos (Universität Hildesheim). Ausdrücklich danken möchten wir auch unseren damaligen wissenschaftlichen Hilfskräften 5
7 Clarissa Bach und Juliane Engel, die das Forschungsprojekt äußerst engagiert unterstützt haben. München, im Juli 2019 Gabriel Schoyerer, Carola Frank, Margarete Jooß-Weinbach und Steffen Loick Molina 6
8 Inhalt Einleitung 11 Teil I Theoretische Zugänge und Forschungsansatz Kapitel 1 Professionalität als organisationale Praxis Professionstheoretische Grundlegung und ihre Gegenstände Mandat und professionelles Handeln Ungewissheit und Zuständigkeit Professionelle Leistungen Praxis- und performativitätstheoretische Zugänge 27 Kapitel 2 Praxeologisierung von Professionalität Kindheitspädagogische Professionalität: Erwartungshorizont des Felds als professionelle Prämissen Forschungsgegenstand und Forschungsfragen: Professionelles Handeln und die Logik seiner Praxis 38 Kapitel 3 Ethnografie als Forschungsprogramm Fall und Feld Datenerhebung und Datenauswertung im Forschungsprozess Vergleich und Kontrastierung Methodische Reflexionen 51 Teil II Ergebnisse Kapitel 4 Gruppenbezogene und kindzentrierte Praktiken in organisationalen Vollzügen Gruppenbezogene Praktiken Die Kinder versammeln 58 7
9 4.1.2 Versammlungsorte schaffen Praktiken des gruppenbezogenen Vollzugs gegenüber einzelnen Gruppenkindern Kindzentrierte Praktiken Kindzentrierung mittels Fokussierungszentrum Die exklusive Kleingruppe als kindzentriertes Angebot Kindzentrierung als Separierung von der Gruppe Partielle kindzentrierte Praktiken als Teil der Sicherung des gruppenbezogenen Vollzugs Praktiken der Integration kindlicher Gestaltungsanteile in einen gruppenbezogenen Vollzug Kindzentrierung in starker gruppenbezogener Ausführung Zusammenfassung 98 Kapitel 5 Inszenierungsformen von Bildung Angebote Gruppenkreise Mahlzeiten Weitere Alltagssituationen Zusammenfassung 136 Kapitel 6 Zuständigkeitspraktiken: Personen Zeiten Räume Zuständigkeitspraktiken im Team Handlungsmodi formalisierter Zuständigkeit im Team Handlungsmodi informalisierter Zuständigkeit im Team Zuständigkeitspraktiken im zeitlichen Vollzugsgeschehen Zuständigkeitspraktiken im multiörtlichen Raumgefüge Zusammenfassung 203 Kapitel 7 Abgrenzung und Integration von Öffentlichem und Privatem in der Kindertagespflege Abgrenzung und Sicherung des privaten Rahmens Abgrenzung des Privatraums Sicherung des Privatraums Integration von Öffentlichem und Privatem Integration familiärer Bedürfnisse Öffnung des privaten Rahmens Kindertagespflege als Familienbetrieb Zusammenfassung 237 8
10 Kapitel 8 Die Praxis von Professionalität in Kindertagesbetreuung Das einzelne Kind in der Gruppe und Praktiken professioneller Ordnungen Bildung als pädagogisches Leitmotiv und ihre professionelle Inszenierung Zuständigkeiten und ihre Realisation im organisationalen Kontext Familienähnlichkeit und Praktiken der Grenzziehung Ertrag und Fazit 249 Literatur 252 Anhang Fallporträts Kindertageseinrichtungen Kinderkrippe Blumenwiese Elterninitiative Die Murmeltiere e. V Kinderkrippe Purzelbaum Kinderkrippe Sonnenschein Kindertageseinrichtung Kinderland Großtagespflegestellen Großtagespflege Zwergenbande Großtagespflege Wichtelstube Kindertagespflegestellen Kindertagespflegeperson Angelika Euringer Kindertagespflegeperson Marianne Mayer Kindertagespflegeperson Barbara Kurz 276 Die Autorinnen und Autoren 278 9
11
12 Einleitung Wenn eine Untersuchung als professionstheoretische Studie angelegt ist, steht am Anfang die Frage, was ihr Gegenstand ist. Dies kann als ein in mehrfacher Hinsicht herausforderndes Programm gelesen werden, wenn man daran interessiert ist, die Frage darauf zu richten, wie sich Professionalität im Handeln bzw. in den Praktiken des Feldes darstellt. Mit einer solchen Praxeologisierung (Schmidt 2017, 2012) von Professionalität untersucht man die Praxis nicht etwa hinsichtlich ihrer Professionalisierungsbedürftigkeit (Neumann 2014a, S. 146) entlang normativer Kriterien, wonach bestimmte Vorstellungen einer Entwicklungsrichtung bestehen. Dezidiert geht es auch nicht darum, Gegenstände im Sinne der inzwischen als überholt geltenden merkmalsbezogenen Bestimmungen (vgl. Cloos 2016) als mehr oder weniger professionell auszuweisen. Vielmehr richtet man den Blick auf die Mikroebene von Professionalität selbst und fragt danach, wie sich in gegenstandsbezogener Hinsicht Professionalität empirisch herausarbeiten lässt und zwar als spezifische Logik von Praxis und ihrer Bedingungen. Gegenstandstheoretisch rücken damit die sozialen Praktiken der professionell Tätigen und die organisationalen Bedingungen ihrer Herstellung in den Vordergrund. Das aufgesuchte Feld sind in der vorliegenden Studie unterschiedliche Formen bzw. Settings der Kindertagesbetreuung für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Konkret sind dies Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Großtagespflegestellen. Diese Formen zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch eine gemeinsame Bundesrechtsvorschrift zur Förderung von Kindern ( 22 SGB VIII) gerahmt sind. Deshalb haben sie formalrechtlich den gleichen Auftrag hinsichtlich der Bildung, Erziehung und Betreuung und sollen damit zunächst vergleichbare Aufgaben der Förderung erfüllen, obgleich sie unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen und Bedingungen unterliegen. In formalrechtlicher Hinsicht ist es auf Ebene der Erbringung des Förderauftrags zur Bildung, Erziehung und Betreuung zunächst irrelevant, ob die dafür notwendigen Leistungen durch eine Kindertagespflegeperson erbracht werden, die in ihrem privaten Haushalt vier Kinder gleichzeitig betreut, oder durch mehrere pädagogische Fachkräfte, die gleichzeitig in einer mehrgruppigen, altersübergreifenden Kindertageseinrichtung Förderleistungen erbringen. Allerdings bestimmen die strukturellen, personellen und organisationalen Bedingungen, unter denen der formalrechtlich gleiche Förderauftrag umgesetzt werden soll so unsere zentrale These das konkrete Handeln in den unterschiedlichen Settings ganz wesentlich mit. Jenseits einer verengten Fokussierung auf 11
13 den Binnenbereich pädagogischer Interaktionen scheint es uns deshalb wichtig, die konkreten Bedingungen von Praxis als ihre konstituierenden Elemente empirisch in den Blick zu nehmen. Damit schließen wir auch an den von Sascha Neumann (2014a) vorgeschlagenen reflexiven Zugang zu Professionalisierung an. Er plädiert dafür, die Folgen frühpädagogischer Institutionalisierung und Professionalisierung im Rahmen einer Professionalisierungsfolgenforschung in den Blick zu nehmen, wenn z. B. das Aufwachsen in der Bildungskindheit davon geprägt [sei], dass an die Stelle der familiären Sonderwelt eine Sonderwelt frühpädagogischer Institutionen tritt, die ihrerseits eigene Regeln und Routinen durchsetzen muss, um den Ansprüchen an ihre Bildungsbedeutsamkeit gerecht werden zu können (ebd., S. 155). Schließlich entsteht mit einer Vermischung von Professionalisierungsansinnen und professionstheoretischen Fragen nicht nur eine gesteigerte Erwartungshaltung gegenüber den Leistungspotentialen von Kindertagesbetreuung, sondern auch in forschungsmethodologischer Hinsicht die Frage nach der Relevanzsetzung von Forschungsfragen und Forschungsansätzen. Daneben sind die Bedingungen der Praxis in Kindertagespflege, Großtagespflegestelle und Kindertageseinrichtungen in gleicher Weise von den Prämissen eines gesetzlichen Förderauftrags und daraus resultierender Mandatierungen bestimmt (vgl. dazu Nittel/Wahl 2014). Dies führt dazu, dass das, was dort als Leistungen von den pädagogisch Tätigen erbracht wird, grundsätzlich als professionelles Handeln im Kontext spezifischer organisationaler Strukturen zu verstehen ist (z. B. Kindertagespflegeperson im eigenen Haushalt vs. mehrgruppige Kindertageseinrichtung mit offenem Konzept). Unter professionellem Handeln fassen wir deshalb zunächst alles Handeln, das von öffentlich mandatierten Personen mit Förderauftrag an dafür legitimierten Orten hervorgebracht wird. Aus dieser Perspektive sind dies in gleicher Weise Kindertagespflegepersonen wie pädagogische Fachkräfte. Dennoch können die dabei bearbeiteten Gegenstände bzw. daraus resultierende Phänomene professionellen Handelns und ihre Praxislogiken keinesfalls als gleich angenommen werden. Schließlich sind die Modi der Herstellung professionellen Handelns und ihre Gegenstände in empirischer Hinsicht weitgehend ungeklärt. Im Gegenteil: Deutlich ist vielmehr, dass das aufgesuchte Feld der Kindertagesbetreuung durch eine sehr stark normierte Feldstruktur und Erwartungshaltung an die dort zu erbringenden Leistungen geprägt ist (vgl. Schoyerer u. a. 2018). Hier sind Forschende insofern auf mehreren Ebenen aufgefordert, dekonstruierend sowie befremdend mit den Feldern umzugehen, um die Differenzkategorien und Normierungen dieses Felds oder dieser Felder reflexiv in den Blick zu bekommen und sie nicht erneut zu reproduzieren. Deshalb rücken als Forschungsgegenstand in der vorliegenden Studie diese konkreten professionellen Praktiken der pädagogisch Tätigen in den Blick. Zusammenfassend geht es dabei um die Frage, wie sich Professionalität im Feld 12
14 durch die Logiken von Handeln und Praktiken herstellt, das heißt um die Betrachtung dessen, auf welchen Gegenstand sich Professionalität bzw. professionelles Handeln situativ bezieht und durch welche professionellen Leistungen in dem jeweiligen Kontext was bearbeitet bzw. praktisch hervorgebracht wird. Im Forschungsfeld der Kindheitspädagogik wurde in den vergangenen Jahren eine zunehmende Anzahl von methodologisch ähnlich angelegten Untersuchungen mit unterschiedlichen theoretischen Schwerpunkten vorgelegt. Zu unterscheiden sind z. B. eine professionstheoretische Perspektive (vgl. Kuhn 2013; Jooß-Weinbach 2012; Cloos 2008) ein akteursbezogener Fokus (vgl. Honig/ Neumann 2013; Huf 2013; Jung 2008) sowie praxis- bzw. organisationstheoretische Fragestellungen (vgl. Flämig 2017; Honig u. a. 2013; Cloos 2008; Bollig 2004). Unter Berücksichtigung einer sich selbst erst konturierenden Profession der Kindheitspädagogik (vgl. Betz/Cloos 2014) lässt sich allerdings festhalten, dass die bisherigen Arbeiten wenig systematisch aufeinander Bezug nehmen. Dies gilt zum einen in Abgrenzung zu Studien, die die Praxis in Kindertageseinrichtungen nach ihrer Angemessenheit in Bezug auf die Förderung kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse bewerten und sie danach als mehr oder weniger professionalisierungsbedürftig (Neumann 2014a, S. 146, vgl. dazu auch Honig u. a. 2013) betrachten (vgl. z. B. Mischo/Fröhlich-Gildhoff 2011; Schelle 2011; Fthenakis/Oberhuemer 2010). Zum anderen lässt sich im Besonderen ein überschaubarer Forschungsstand für professionstheoretisch gelagerte Fragestellungen feststellen, die auf die Logik des Handelns sowie den Vollzug von Praktiken in verschiedenen Settings der Kindertagesbetreuung fokussieren und thematisieren, durch welche Leistungen und Bedingungen sich die jeweiligen Settings als professionelle Settings bzw. spezifische Felder konstituieren (vgl. z. B. Cloos 2008). Wenn vor dem Hintergrund dieser thematischen Zusammenhänge die Praktiken der Professionellen von besonderem Interesse sind, sind sowohl methodologische als auch gegenstandstheoretische Herausforderungen zu bewältigen. Ziel der vorliegenden Publikation ist es insofern, zum einen bereits veröffentlichte inhaltliche Ergebnisdimensionen zu erweitern bzw. zu vertiefen (vgl. Schoyerer u. a. 2018) sowie zum anderen auf der Basis bisheriger Überlegungen (vgl. Frank u. a. 2019; Schoyerer u. a. 2016) besonders auch in methodologischer und gegenstandsbezogener Hinsicht zu verdeutlichen, wie sich Professionalität in der Kindertagesbetreuung als Logik der Praxis darstellt. Daneben soll auch in reflexiver Hinsicht aufgezeigt werden, welche Herausforderungen sich ergeben, wenn die Frage auf den Gegenstand gerichtet wird, wie sich Professionalität in den Praktiken des Feldes darstellt. Thematisch gliedert sich die vorliegende Publikation in zwei große Teile: Teil I skizziert die theoretischen Zugänge und den Forschungsansatz. Dabei werden in Kapitel 1 zunächst die erkenntnis- und gegenstandstheoretischen 13
15 Grundlagen der Studie vorgestellt, die mit Professionalität als organisationale Praxis gefasst werden. Dieser Analysefokus geht als Resultat hervor aus einer Verknüpfung von professionstheoretischen Konzepten mit Fokus auf das Mandat professionellen Handelns, die strukturelle Ungewissheitsbedingung und mit Blick auf die Frage nach den professionellen Leistungen (siehe Kap. 1.1) mit praxis- und performativitätstheoretischen Zugängen (siehe Kap. 1.2). Vor diesem Hintergrund arbeitet Kapitel 2 Professionalität als praxeologisch gerahmten Forschungsgegenstand heraus und skizziert im Kontext der professionellen Prämissen im kindheitspädagogischen Feld die zentralen Fragestellungen der Studie nach den Modi professionellen Handelns und die Logik ihrer Praktiken. Mit einer solchen Forschungsperspektive sollen die Logiken von professioneller Praxis als konstitutive Elemente professioneller Alltagsgestaltung und ihrer Interaktionen in den ihnen zugrundeliegenden professionellen Feldern erschlossen werden und somit aufgezeigt werden, auf welche Weise etwas vollzogen wird, das sich als eine bestimmte Realisationsform in den unterschiedlichen Feldern (z. B. als Erziehungswirklichkeit ) generiert. Kapitel 3 stellt die Ethnografie als Forschungsprogramm der zugrundeliegenden Studie vor. Dabei wird das Verhältnis von Fall und Feld herausgearbeitet, die Prozesse der Datenerhebung und Datenauswertung beschrieben sowie die Prinzipien von Vergleich und Kontrastierung erläutert. Im Sinne der Einhaltung von Gütekriterien qualitativer Forschung werden methodische Reflexionen angeschlossen. Der zweite große Teil dieser Publikation präsentiert bislang unveröffentlichte, erweiterte und spezifisch perspektivierte Ergebnisse der Studie, die sich in vier thematische Kapitel untergliedern Gruppenbezogene und kindzentrierte Praktiken in organisationalen Vollzügen (siehe Kap. 4), Inszenierungsformen von Bildung (siehe Kap. 5), Zuständigkeitspraktiken: Personen Zeiten Räume (siehe Kap. 6) sowie Abgrenzung und Integration von Öffentlichem und Privatem in der Kindertagespflege (siehe Kap. 7). Dies geschieht entlang von Protokollauszüge und ihren Analysen, sodass zum einen Einblicke in der Praxislogik der untersuchten Felder ermöglicht, als auch die Schritte der Interpretation, der Kontrastierung und Generalisierung nachvollzogen werden können. Das abschließende Kapitel 8 diskutiert die vier Ergebnisdimensionen im Kontext der daran jeweils geknüpften professionellen Prämissen des aktuellen Forschungsstands und zeigt damit auf, wie voraussetzungsvoll Praxis in der Kindertagesbetreuung angesichts ihres Auftrags ist und dass ihre Realisierung Sphären berührt, die weit über ihre normativen Zuschreibungen hinausreichen. 14
16 Teil I Theoretische Zugänge und Forschungsansatz
17 Kapitel 1 Professionalität als organisationale Praxis 1.1 Professionstheoretische Grundlegung und ihre Gegenstände Als Hauptgegenstände professionsbezogener Forschung formuliert Peter Cloos (2012, S. 177) zum einen die historische und biografische Genese von professionsbezogenen Profilen und weiterhin die Beschreibung professioneller Selbstbilder, Antinomien und Paradoxien professionellen Handelns sowie die Deutungs- und Handlungsmuster von Professionellen. Damit wird deutlich, dass sich der Fokus der deutschen Professionalisierungsdebatte in der Erziehungswissenschaft verändert hat. Er hat sich in den letzten drei Dekaden immer weiter weg von der Merkmalsbeschreibung einer Profession hin zur genauen Betrachtung der Spezifik professionellen Handelns, ihrer Herstellung im jeweiligen (institutionellen) Kontext sowie der expliziten und impliziten Wissensdimensionen verschoben. Damit hat sich die Theorie der Professionen in den letzten Jahren zu einer Theorie professionellen Handelns entwickelt, mithilfe derer die Kernaktivitäten der Professionen in den Blick genommen werden können (Cloos 2012, S. 181). Diese Perspektive verzichtet darauf, eine Diskussion um den professionellen Status einer Berufsgruppe als Profession oder Semi-Profession zu führen, was in diesem Kontext nicht weiterführen würde. Der Fokus liegt hingegen auf der Betrachtung von Situationen des Alltags von pädagogischen Institutionen, die wir mit Ulrich Oevermann (2002) als unplanbar und nicht-standardisierbar verstehen, womit bewusst irritierende und brüchige Handlungsvollzüge der Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen in den Blick genommen werden können: Ungewissheit und Paradoxien rahmen das Handeln und die Interaktion zwischen Professionellen und Klienten, in diesem Fall den Fachkräften bzw. Kindertagespflegepersonen und den Kindern. Dieser Fokus auf die konstitutiven Binnenlogiken von Praktiken in einer Profession soll das professionelle Handeln und seine Herstellungsmodi beschreibbar und verstehbar machen. Professionelles Handeln wird dabei zunächst gesehen als ein personenbezogenes, kommunikatives Handeln und stellvertretendes Agieren auf der Basis eines relativ abstrakten Sonderwissensbestandes ( ) und der hermeneutischen Fähigkeit der Rekonstruktion ( ) eine bessere Problemwahrnehmung und in deren Folge eine (Verhaltens-)Veränderung bei den betroffenen Personen herbeizuführen (Dewe/Otto 1984, S. 788). 16
18 Diese Verschiebung des Fokus auf die Handlungsvollzüge der Professionellen zeigt sich auch im Strukturkern der drei prägendsten Richtungen, der die Ungewissheit, die Antinomien und die Paradoxien im Handeln und in der Interaktion zwischen Professionellem und Klienten in den Blick nimmt, wobei nicht nur das individuelle Handeln, sondern auch dessen konstitutive Bedingungen Gegenstand der Betrachtung werden (vgl. Fabel/Tiefel 2004, S. 12). Der system- und strukturtheoretische sowie der interaktionistische Ansatz betrachten die Konzentration auf Dilemmata und Ungewissheiten professionellen Handelns als ein Strukturproblem, das aus makrosoziologischer Sicht durch technische und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse sowie dem zunehmenden Charakter der Professionen als Dienstleitung erwächst und in diesem Spannungsfeld rekonstruiert werden muss (vgl. Kraul/Marotzki/Schweppe 2002, S. 8). Das bedeutet, dass der empirische Nachvollzug professionellen Handelns primär nicht als unbewusste oder bewusste Leistung eines Individuums gesehen werden kann als mentale Konzeptionen einer solchen Leistung allenfalls sekundär von Interesse ist, sondern professionelles Handeln eingebettet in einen Erwartungshorizont betrachtet wird, der sich aus dem Mandat der Dienstleistung sowie seinen spezifischen damit verknüpften organisationalen, gesellschaftlichen und fachlichen Strukturen, Aufträgen und Lizenzen ergibt. Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, welche professionstheoretische Grundlage für eine Untersuchung professionellen Handelns in Frage kommt und welche Begrifflichkeiten als stringente Beschreibung der beobachteten Phänomene verwendet werden können, wenn man sich für die Logik von professionellen Handlungsbezügen und ihren konstitutiven Bedingungen interessiert. Dabei ist es notwendig, eine Entscheidung für eine bestimmte professionstheoretische Rahmung zu treffen. Professionelles Handeln als symbolisch vermittelte Interaktionen Ausgehend von den Prämissen des Symbolischen Interaktionismus der Chicago-Soziologie und den zugehörigen Arbeiten (vgl. Freidson 1988; Strauss 1978; Hughes 1971) ist zunächst ein wichtiger Bezugspunkt der vorliegenden Studie der von Fritz Schütze formulierte symbolisch-interaktionistische, ethnomethodologische Ansatz. Damit wendet man sich nicht nur gegen die generalisierende Komponente eines idealtypischen Konstrukts, das hinter jedem professionellem Handeln liegt (vgl. dazu z. B. Oevermann 1996), sondern geht ebenso von den vorfindbaren Entwicklungen im pädagogischen Handeln selbst aus (Helsper/Krüger/Rabe-Kleberg 2000, S. 8). Dabei sehen die symbolischen Interaktionisten das autonome Individuum in der Praxis als Akteur, der selbstbestimmt und reflektiert handelt, auch wenn dieses Handeln von strukturbildenden Regeln, Prozessen oder materiellen Ressourcen begrenzt wird. Voraussetzung für diese Art von Interaktionsbeziehung ist die Konstellation, dass professionelle Akteurinnen und Akteure gesellschaftliche Dienstleis- 17
19 tungen für ihnen per gesellschaftlichem Mandat anbefohlene Klienten vollbringen (Schütze 1992, S. 135). Für die Legitimation einer professionellen Handlung ist also ein gesellschaftliches Mandat notwendig, das den Professionellen mit einer bestimmten Aufgabe betraut. Diese soll dem Gemeinwesen zugutekommen und spricht dem Professionellen eine Legitimation zu, bestimmte Problembearbeitungsmaßnahmen (Schütze 1992, S. 143) gegenüber dem Klienten einzusetzen. Diese sind im Sinne des interaktionistischen Verständnisses nach Fritz Schütze für den Bereich der Sozialen Arbeit vor allem als prekäre Hilfeleistung definiert. Übertragbar auf kindheitspädagogische Felder ist diese Perspektive insofern, als dass eine vergleichbare Problematik aus dem Spannungsfeld erwächst, bestimmte Diagnose- und Bearbeitungsverfahren (ebd.) einzusetzen, auch wenn dies bei der Arbeit mit jungen Kindern noch mehr mit diffuser emotionaler Zuwendung zu verschwimmen scheint und durch eine verfahrensmäßige Machtposition gegenüber dem Kind (Schütze 2015, S. 164) gekennzeichnet ist. Dieses Machtgefälle zwischen Professionellem und Kind zeigt sich in der Deutungs- und Verfahrensmacht-Orientierung des Professionellen (Schütze 1992, S. 152) und fußt auf der genuin in diesem Beziehungsgeflecht angelegten Asymmetrie, die von Professionellen und Kindern gemeinsam hervorgebracht wird bzw. auch in den konstitutiven Bedingungen der Betreuungssituation angelegt ist. Fritz Schütze sieht dann besonders in Situationen, die von widerstreitenden Impulsen gekennzeichnet sind, die Gefahren der Machtentfaltung des professionellen Verfahrensverwalters dies insbesondere mit der Tendenz zur gefährlichen Aushöhlung der Interaktions- und Beziehungsreziprozität (Schütze 2000, S. 79). Konstitutiv für professionelles Handeln ist insofern das spannungsreiche Wechselverhältnis aus routinierten, wiederkehrenden Handlungsschemata und individualisierter situativer Interpretation. Fritz Schütze (2000) spricht in diesem Zusammenhang von einer Handlungsschemata-Aushandlung zur Aufrechterhaltung eines Arbeitsbogens (S. 59), der eine spezifische Stringenz für eine bestimmte Handlungssituation definiert. Die die Aushandlung charakterisierenden Merkmale beschreibt Fritz Schütze als widerstreitende Impulse im Zuge der internen Arbeitsnotwendigkeiten professionellen Handelns (Schütze 2000, S. 67) was angesichts der permanenten Gefährdung der ambivalent gelagerten Handlungsvollzüge auf ihre situative Handlungsschemata-Aushandlung verweist. Für die erkenntnistheoretische Konkretisierung der vorliegenden Studie liegt insofern der Fokus im interaktionistischen Ansatz im Sinne einer empirischen Rekonstruktion von professionellen, paradoxen Handlungsbedingungen und darauf, wie diese von den Professionellen bearbeitet werden. Dabei fassen wir Paradoxien als feldkonstituierende Herausforderungen, die in Wechselwirkung mit den Binnenlogiken der Praxis stehen. Das bedeutet, dass für diese 18
20 professionellen Handlungszusammenhänge darin eingelagerte Handlungsmodi empirisch herausgearbeitet und dazu ihre (situativen) Interaktionsformen und organisationalen Bedingungen rekonstruiert werden. Damit kann ein erkenntnistheoretischer Fokus auf Professionalität entwickelt werden, der den Blick schwerpunktmäßig lenkt auf die dem Handlungsfeld zugrunde liegenden spannungsreichen Ungewissheiten (vgl. Rabe-Kleberg 1993), Paradoxien (vgl. Schütze 2000, 1992) und Antinomien (vgl. Helsper 2002). Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass solche Annahmen zum einen überwiegend einem sozialpädagogischen Kontext entstammen und die Anknüpfungspunkte für die Beschreibung des kindheitspädagogischen Betreuungsfeldes sich erst empirisch-analytisch erweisen müssen. Zum anderen legen solche erkenntnistheoretischen Heuristiken den Schwerpunkt auf das Problematische in diesem Feld, wenn gerade das Unüberwindbare und Widersprüchliche betont wird. Die von einer solchen Vorab-Definition ausgehende Gefahr einer Subsumtionslogik thematisieren wir eingehend im Zusammenhang mit dem praxeologisch gewendeten Forschungsgegenstand von Praktiken der Professionellen in dieser Studie (siehe dazu Kap. 2). Vor diesem Hintergrund stellen wir im Folgenden die uns zunächst relevant erscheinenden professionstheoretischen Fokussierungen vor, die erkenntnistheoretische Heuristiken im engeren Sinne bilden, sich jedoch im weiteren Verlauf der Studie an der Empirie bzw. vice versa zu erweisen haben Mandat und professionelles Handeln Ziel von professionellem pädagogischem Handeln ist es, die Autonomie der Lebenspraxis bei den Kindern zu generieren, wiederherzustellen oder zu stärken (Helsper 2002, S. 72). Für diese Aufgabe erhalten die Fachkräfte ein gesellschaftliches Mandat zur Vermittlung eines zentralen Guts (z. B. Bildung und Erziehung), das schließlich die Stärkung der Autonomie der Kinder im Blick hat (ebd.). Da die Bedingungen der Praxis in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen in gleicher Weise von den Prämissen eines öffentlichen Förderauftrags bestimmt sind, wird das, was dort als Leistung von den pädagogisch Tätigen erbracht wird, grundsätzlich als professionelles Handeln im Kontext spezifischer organisationaler Strukturen verstanden (z. B. Kindertagespflegeperson im eigenen Haushalt vs. mehrgruppige Kindertageseinrichtung mit offenem Konzept). Schließlich wird ihr Handeln in einem professionellen Bildungs- und Erziehungskontext erbracht. Aus dieser Perspektive ist professionelles Handeln zunächst alles Handeln, das von öffentlich mandatierten Personen mit Förderauftrag an dafür legitimierten Orten hervorgebracht wird. Innerhalb dieses Rahmens bearbeiten sie Kernaufgaben professionellen Handelns und damit die 19
21 ständige fallspezifische Gestaltung von Situationen, die von Ungewissheit, Komplexität und Unvorhersehbarkeit gekennzeichnet sind (vgl. Oevermann 2002; Schütze 1996, 1992). Da pädagogische Prozesse keiner technischen Input- Output-Regel folgen, bleibt das Ergebnis oder die Wirkung ungewiss (vgl. Rabe-Kleberg 2006). Somit laufen die Fachkräfte permanent Gefahr, durch ihre ausgewählten Diagnose- und Bearbeitungsverfahren, sprich durch die Art und Weise der Interaktion und Alltagsgestaltung, neue Krisen bei den Kindern auszulösen (Schütze 1992, S. 143). Allerdings werden die mandatierten Vorgaben von den pädagogisch Tätigen im Rahmen ihrer Handlungszusammenhänge keineswegs in einer Eins-zu-eins-Relation umgesetzt. Vielmehr müssen die pädagogisch Tätigen zur Erfüllung ihres Mandats auf spezifische Wissensbestände und Handlungsmodi zurückgreifen. Damit erhalten sie auch das Recht, ihre Zielgruppen mit bestimmten Zumutungen zu konfrontieren, ihnen metaphorisch gesprochen auch weh tun zu dürfen (Nittel/Wahl 2014, S. 86 f.). Dieser Auftrag der herzustellenden Erfahrungen für die Kinder im Kontext des Förderauftrags der Bildung, Erziehung und Betreuung umfasst auf Seiten der Professionellen bestimmte Handlungs- und Interaktionsverfahren, die vor dem Hintergrund spezifischer Wissensdimensionen darauf ausgerichtet sind, trotz oder im Wissen um die vorhandenen Paradoxien stellvertretende fallverstehende Ermöglichungsräume für die Kinder anzustreben (Schütze 1996, S. 187). Dabei bewegt sich professionelles Handeln mit Blick auf die Ungewissheitsstrukturen pädagogischer Situationen im Spannungsfeld zwischen erwartbaren methodisch kontrollierten, routinisierten Handlungsmodi und ihrer situativen individuellen Modulation (vgl. Schulz/Cloos 2015). Diese Leistungen werden außerdem vor dem Hintergrund gesellschaftlicher (organisationaler) Strukturen erbracht, die dieses professionelle Handeln als solches rahmen und wiederum konstituieren bzw. ebenso davon konstituiert werden. Das Mandat von Dienstleistung umfasst immer zwei Dimensionen, denen es sich verantwortlich zeigen muss. Zum einen besteht eine Verantwortlichkeit gegenüber den (Norm-)Vorstellungen der Gesellschaft und zum anderen gegenüber dem Individuum, für das die jeweiligen Dienste erbracht werden müssen (vgl. Rabe-Kleberg 1996, S. 296). Damit entsteht ein fortwährend auszugleichender Balanceakt zwischen dem an die Organisation gerichteten Mandat und dem Wohl oder den Bedürfnissen des Individuums. So lassen sich beispielsweise empirisch bestimmte Störungen und Widerstände von Kindern einsortieren, die damit zwei widerstreitende Aufträge des Mandats gefährden könnten. 20
22 1.1.2 Ungewissheit und Zuständigkeit Einen fokussierenden Zugang zu den Bedingungen professionellen Handelns liefert die Perspektive auf von Ungewissheit geprägte Interaktionsprozesse innerhalb von Dienstleistungsberufen. Das Thema Ungewissheit begleitet die erziehungswissenschaftliche Debatte seit geraumer Zeit, insbesondere wenn es um Fragen des professionellen Selbstverständnisses, des pädagogischen Handelns bzw. der pädagogischen Interventionen, sowie um dessen Wirkungen und Effekte geht (vgl. Helsper/Hörster/Kade 2003, S. 8). Ursula Rabe-Kleberg identifiziert dabei gerade die modernen Dienstleistungsberufe und die Erziehungsberufe als besonders von Ungewissheit gekennzeichnet (vgl. Rabe-Kleberg 1996, S. 293). Ungewissheit kann gewissermaßen als Konstitutionsbedingung von pädagogischem Handeln gesehen werden. Denn der unbestimmte Mensch mit seinen individuellen und somit wenig bestimmbaren Verhaltensweisen auf der einen Seite und die teilweise sehr spezifisch ausgerichteten Anforderungen an die Erziehenden auf der anderen Seite erfordern eine hochkomplexe Passung in pädagogischen Situationen. Die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind ebenfalls mit diesen Ungewissheiten eines Dienstleistungsberufs konfrontiert. Der bzw. die Professionelle unterliegt einem Handlungsmandat, zu dem es gehört, nach bestem Wissen und Gewissen und vor dem Hintergrund von Fachwissen und Fertigkeiten in die soziale, psychische und physische Existenz des Kindes zu intervenieren. Die Wirkungen, die Effekte und die Angemessenheit dieser verschiedenen Interventionen bleiben dabei letztlich ungewiss und verunmöglichen damit auch eine endgültige Sicherheit im Handeln (vgl. Rabe-Kleberg 1996, S. 293 f.; Parsons 1964, S. 447 ff.). In der öffentlichen Debatte um Erziehung und Bildung bezieht sich die große Ungewissheit im Handeln vor allem auf den doppelten Prozesscharakter (Rabe-Kleberg 1996, S. 294) von Dienstleistung. Erziehung gilt als Teil eines Dienstleistungsprozesses besonders von Unsicherheit geprägt, da z. B. der Arbeitsprozess und das Arbeitsprodukt nicht in ein technisches Input-Output- Schema zerfallen, sondern zusammenfallen und aufgrund des großen Einflusses der Umwelt nicht voraussehbar sind (vgl. Rabe-Kleberg 1996, S. 294). Diese Ungewissheit speise sich einerseits aus der Ungewissheit der Wirkung der Handlung, die in den seltensten Fällen vollständig erwartbar oder messbar ist. Andererseits aus Funktion und Ziel, wobei letzteres unbestimmt und möglicherweise umstritten ist und in der Erziehungsarbeit ebenfalls häufig als prospektive Vermeidungs- und Vorbeugungsarbeit für die Bewältigung von zukünftigen Aufgaben gesehen werden kann (ebd.). In diesem Zusammenhang wird auch die Verfolgung von Erziehungs- und Bildungszielen problematisiert, weil sich Menschen nicht nach Zielvorstellungen verschieden programmieren lassen oder gemäß des Vermittelten verhalten und auch ein professioneller 21
23 Wissenskanon nicht verlässlich nach einem im Vorhinein explizierbaren Algorithmus gleichsam appliziert (Köngeter 2009, S. 12) werden kann. Denn auch oder gerade Wissen was man wie und warum tun kann unterliegt einer fallspezifischen Anwendung und kann sich damit der Ungewissheit nicht entledigen. Um aber diesen Prozess zumindest transparent zu machen, müssen Interpretations- und Handlungsspielräume so realisiert werden, dass zwischen den konkreten Akten und seinen Bedingungen ein Begründungsverhältnis besteht (Liesner/Wimmer 2003, 39). Damit gewinnen die Frage nach der generellen und situativen Zuständigkeit und das Abwägen einer pädagogischen Intervention an Bedeutung, die aus dem Handlungszwang hervorgehen und gleichzeitig der oben beschriebenen Ungewissheit ausgesetzt sind. Das Problem der Zuständigkeit erweist sich bei pädagogischen Fachkräften allerdings als besonders virulent, weil sie an der Persönlichkeitsbildung des Kindes beteiligt sind. Das bedeutet zum einen, dass diese Zuständigkeit einen Anspruch auf die Bereitstellung von adäquatem Wissen erhebt, um die jeweilige Situation des Kindes in seinem Sinne verändern zu können. Zum anderen bedeutet dieser Zugriff innerhalb eines pädagogischen Rahmens auf das Kind, dass ein gesellschaftlich legitimierter Anspruch auf Zuständigkeit (eben ein Mandat) und damit auf professionelles Handeln vorliegen muss. Das heißt, dass dieses Handeln nicht von einem Laien übernommen wird (oder werden kann), sondern von Mitgliedern der eigenen Profession (vgl. Rabe-Kleberg 1993, S. 98). Das Vertrauen in die Selbstkontrolle und die Selbstorganisation der Profession ist dabei wichtiger Bestandteil des Zuständigkeitskonstrukts, weil er Unabhängigkeit von anderen Instanzen und eigenes Organisationsvermögen als notwendig aufzeigt (vgl. Rabe-Kleberg 1993, S. 99). Dieser uneingeschränkte autonome Anspruch ist in den letzten Jahren vermehrt in die Kritik geraten, weil die Bereiche, das Verhältnis zu den Adressaten sowie die Wissensbasis der proklamierten Zuständigkeit, insbesondere auch im frühpädagogischen Feld (vgl. Schoyerer u. a. 2018) angesichts einer scheinbar unbegrenzten Erwartungshaltung sowie einer schwer zu überblickenden vermeintlichen Expertise zunehmend verschwimmen und damit die Professionalität (früh-)pädagogischer Arbeit infrage gestellt wird. Diese Diffusion von Zuständigkeiten charakterisieren das frühpädagogische Feld und lassen sich mit Ursula Rabe-Kleberg (1993, S. 99 ff.) entlang von drei Sphären beschreiben. Zunächst geht es um den Anspruch auf Zuständigkeit, den die Professionellen geltend machen müssen und der immer eine Differenzsetzung zu anderen (Laien-)Zuständigen erfordert, im Fall der Kindertagesbetreuung vor allem zu den Eltern. Sie stellen zwar keine konkurrierende Profession dar, spielen aber in dem Alter der 0- bis 3-Jährigen nicht nur eine existenzielle Rolle, sondern werden in der Diskussion um öffentliche Betreuung auch als die Alleinigen angesehen, die mit der Betreuung des Kindes betraut werden sollten. 22
24 Deshalb verschwimmt bei der Frage der Zuständigkeit die Definition des Klienten und muss auch auf die Eltern erweitert werden. Denn wenn wir davon ausgehen, dass sich die Professionellen gegenüber den Eltern als Expertinnen und Experten des Kindes erweisen müssen, lässt sich das Kind und dessen angemessene Betreuung durchaus als ein konkurrierendes Terrain ausmachen, auf das beide Seiten Anspruch erheben und das einer ständigen Aushandlung unterworfen ist. Für eine professionstheoretisch gelagerte Studie ist dieser Aspekt insofern interessant, als dass sich daraus Normative ergeben, zu denen sich die pädagogisch Tätigen in ihrer praktischen Arbeit in ein Verhältnis setzen müssen, d. h. praktisch auf diese Feldbedingung Bezug nehmen müssen. Von besonderer Relevanz, so zumindest unsere Vermutung, kann dieser Analysefokus bei Erwartungen an die familienähnliche Betreuungsform der Kindertagespflege sein. Schließlich proklamiert die Kindertagespflege als programmatische Bezugspunkte eine besonders an den Bedarfen von Eltern orientierte Ausrichtung des Betreuungsalltags. Ganz allgemein kann eine daraus erwachsende ungeklärte oder sich überschneidende Zuständigkeit als ein zentrales Charakteristikum des Feldes herausgehoben werden, zu dem sich die professionellen Fachkräfte verhalten müssen, um ihre Position bzw. ihren Status als professionelle Fachkraft zum Ausdruck zu bringen (vgl. Rabe-Kleberg 1996, S. 291, 1993, S. 99). Ein zweiter Punkt der Diffusion von Zuständigkeit betrifft die professionelle Kontrolle (Rabe-Kleberg 1996, S. 296). Diese bezieht sich einmal auf die Legitimation ihrer Entscheidung, wie professionelles Handeln im Einzelfall auszusehen hat und zum anderen auf die Kontrolle über Kooperationen mit anderen Professionen ähnlicher Zuständigkeiten und die darin eingelagerte Kontrolle über die Anwendung des eigenen Wissens. Dieser Punkt berührt bereits zentrale Ergebnisse der Studie, nämlich wie die pädagogisch Tätigen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ihre spezifisch gerahmten Zuständigkeiten deutlich machen. Professionstheoretisch besonders interessant ist dabei, dass die professionell Tätigen in Angeboten der Kindertagesbetreuung formalrechtlich in gleicher Weise Zuständigkeitsleistungen zu bringen haben auch wenn sich das Fördermandat bei einer Kindertageseinrichtung auf die Institution bezieht ( 22a SGB VIII) und bei einer Kindertagespflegeperson gemäß einer höchstpersönlich zu erbringenden Dienstleistung auf die Leistung eben dieser Kindertagespflegeperson gegenüber den ihr vertraglich zugeordneten Kindern ( 23 SGB VIII). Empirisch interessant ist deshalb der Zusammenhang, wie eigene spezifische Zuständigkeiten ( Kontrolle ) im Kontext von unterschiedlichen praktischen Bedingungen und organisationalen Rahmungen in unterschiedlichen Formen der Kindertagesbetreuung konkret erbracht werden. Dabei stellt sich die Frage der Hervorbringung von abgrenzenden Zuständigkeiten nicht nur am Beispiel der Unterscheidung zwischen Kindertagespflege, Kindertageseinrich- 23
25 tungen und Großtagespflege, sondern auch im Binnenbereich unterschiedlich konzeptionalisierter und strukturierter Settings innerhalb der Betreuungsformen. Der dritte Punkt schließt an diesen Aspekt der Struktur- und Konzeptvielfalt innerhalb der Angebote der Kindertagesbetreuung an und beschreibt eine Diffusion um Zuständigkeiten auf der konkreten Handlungsebene, die mit der Einbindung in eine Organisation entstehen. Dabei hat sich z. B. ein machtbezogener Vollzug als durchaus konstitutives Element des institutionellen sozialen Beziehungsarrangements ausgewiesen, bei dem bestimmte innerbetriebliche organisationale Logiken verschiedene machtvolle Interaktionsmodalitäten hervorbringen, die dann in der jeweiligen Situation immer wieder neu enaktiert werden (Schütze 2000, S. 67). Dadurch können vermeintlich klar verteilte Zuständigkeiten durch Zuständigkeitsbeschränkungen eine hierarchische Unterordnung erfahren und Aushandlungsprozesse in Gang setzen (vgl. Rabe-Kleberg 1993, S. 99 f.). Das verdeutlicht, dass professionelles Handeln nicht eine isolierte Einzelleistung einer pädagogischen Fachkraft darstellt, sondern innerhalb von bestimmten ordnungsleitenden Regelstrukturen zu erbringen ist, die interpretativ auf die jeweiligen konkreten praktischen Bedingungen anzuwenden sind (vgl. Fend 2008). Damit unterliegen die pädagogisch Tätigen in Angeboten der Kindertagesbetreuung der doppelten Anforderung, zum einen kraft ihres professionellen Mandats autonom, im Sinne verantwortlich zu gestaltetender Praxis, handeln zu müssen. Zum anderen wird professionelles Handeln stets innerhalb eines organisatorischen Rahmens hervorgebracht, der bestimmten mehr oder weniger handlungsleitenden Ordnungsprinzipien für alle darin tätigen Fachkräfte vorgibt. Dieses Spannungsfeld zwischen (individueller) Autonomie und (organisationaler und teambezogener) Struktur hat sich in der Studie auch empirisch als situativ ständig zu bewältigende Aufgabe erwiesen Professionelle Leistungen Im Zusammenhang mit professionellem Handeln wird auch von professioneller Leistung als Gegenstand gesprochen, der von den Professionellen im Rahmen ihres professionellen Mandats zu erbringen ist. Dabei geht es um die dezidierte Eigenleistung der Professionellen bei der kollektiven Herstellung einer Situation innerhalb eines organisationalen Kontexts. Fritz Schütze sieht professionelles Handeln im Zusammenspiel von individueller Fallbearbeitung und organisationalen Zwängen als Bearbeitungs- und Selbstreflexionsverfahren von Paradoxien, die auch den erzieherischen Kontext klar kennzeichnen. Diese theoretische Perspektive rückt vor allem die Bedingungen und Modi professionellen Handelns in Interaktionen in den Vorder- 24
26 grund. Die professionelle Leistung besteht demnach vornehmlich im Verändern und Unterstützen von Personen, im people processing (Mieg 2003, S. 32). Dabei besteht allerdings die Gefahr, die Professionalisierungsproblematik lediglich an das Individuum zu binden und zu delegieren, das die Widersprüche zwischen Organisation und Individuum auszubalancieren hat. Damit wäre professionelle Leistung vor allem in Gestalt der Beziehung zu den Kindern und der persönlichen Haltung abzulesen. Weiterhin kann durch diese Sichtweise der Eindruck entstehen, dass die Organisation entweder aus dem Blick gerät oder bereits als genuin paradoxieauslösendes Professionalisierungshindernis gesetzt ist (vgl. Maeder/Nadai 2003, S. 149). Christoph Maeder und Eva Nadai (2003) formulieren zur besseren Ausdifferenzierung der professionellen Leistung drei Ebenen der Leistungserbringung, die bei der Rekonstruktion professioneller Leistung im Alltag in Betracht gezogen werden müssen: die Organisationsebene, die Handlungsebene und die Deutungsebene. Übertragen auf die Fragestellung unserer Studie stellt sich im Anschluss an die bisherigen Ausführungen die Frage nach den spezifischen konstitutiven (organisationalen) Kontextbedingungen, welche die professionellen Leistungsmöglichkeiten und Leistungsaufträge der Professionellen rahmen. Vor diesem Hintergrund kann formuliert werden, welche konkreten Leistungen im Alltag von Kindertagesbetreuung mithilfe welcher Strategien erbracht werden und wie die Professionellen ihr Handeln praktisch interpretieren (vgl. dazu auch Fend 2008). Professionelle Leistung wird dann als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses in einer sozialen Arena betrachtet, die die Organisation in ihrem sozial- und gesellschaftspolitischen Kontext sowie Personal und Klientel umfasst (Maeder/ Nadai 2003, S. 149). Diese Perspektive erweitert das professionelle Mandat der pädagogisch Tätigen um die Perspektive, dass die Praxis in Kindertagesbetreuung eine ko-produktiv zu erbringende Leistung aller daran beteiligten Akteure und Akteurinnen darstellt. Die Betonung der Bedeutung von Aushandlungsprozessen im Kontext von professionellen Leistungen stellt in dieser Lesart eine Praxeologisierung des Leistungsbegriffs dar und öffnet ihn für seine empirische Erschließung. Aus einer praxistheoretischen Perspektive (siehe Kap. 1.2), die sich hieran anschließen lässt, rücken die konkreten Praktiken der professionellen Leistungen in den Fokus. Im Anschluss daran ist für die gegenstandstheoretische Fundierung der Studie insofern der Hinweis von Michaela Pfadenhauer (2003) interessant, die das Spektrum professioneller Leistung aus interaktionistischer Perspektive um eine inszenierungstheoretische Sichtweise ergänzt. Sie geht davon aus, dass es für Professionelle nicht ausreicht, Leistung zu erbringen, sondern diese auch sichtbar zu machen, sowohl intern als auch gegenüber äußeren Arbeitskontexten (z. B. in Form von Flyern, Aushängen oder explizierten Schwerpunkten) (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 81). Dabei interessiert sich diese Perspektive vor allem für 25
27 die Modi der Leistungsdarstellung, also wie Professionelle ihre Leistungen gegenüber anderen vorführen und sich damit als professionell ausweisen. Diese Perspektive folgt der Annahme, dass jede Leistung nur über Darstellung erfolgt und als solche begriffen werden kann (vgl. auch Goffman 1969). Die Leistungsinszenierung bezieht sich dabei auf eine bestimmte professionelle Handlungslogik, die es im jeweiligen Kontext zu erwerben und auszuführen gilt. Michaela Pfadenhauer bezeichnet diese Leistung als Selbstinszenierung des Professionellen, die Teil seiner Darstellung von Bereitschaft, Befugnis und Befähigung über ganzheitliche Lösungen für essentielle Probleme zu verfügen ist (Pfadenhauer 2003, S. 84). Als Begründung für diese Annahme führt sie an, dass Professionelle verschiedene Erwartungen antizipieren, die an sie herangetragen werden, um adressatenbezogene Leistungen anbieten, erfüllen und diese Funktionserfüllung zur Darstellung bringen zu können. In dieser Hinsicht sind die pädagogisch Tätigen in Angeboten der Kindertagesbetreuung durch ihr gesellschaftliches Fördermandat der Bildung, Erziehung und Betreuung angehalten, eine gemeinwohlorientierte Leistung zu erbringen und stehen somit quasi im Zugzwang, diese auch öffentlich auszuweisen, in geeigneter Form zur Darstellung zu bringen sowie damit deutlich zu machen, dass sie diesem Mandat angesichts unterschiedlicher Stakeholder mit ihren jeweiligen Erwartungen auch nachkommen. 1 Mit Blick auf die Selbstpositionierung und Ausweisung der Fachkräfte als professionelle Fachkräfte ist auf die empirischen Ergebnisse von Christoph Maeder und Eva Nadai (2003) zu verweisen. Sie gehen davon aus, dass praktisches Alltagswissen mit den formellen und informellen Regeln der Organisation bzw. des organisierten öffentlichen Betreuungssettings, sowie den festgestellten Problemlagen der Klienten vor dem Hintergrund allgemeiner oder individueller gesellschaftlicher Normen kombiniert zum Berufswissen herausgebildet wird (Maeder/Nadai 2003, S. 156). Diese Wissensbestände teilen die Professionellen mit anderen im Beruf erfolgreich sozialisierten Personen (ebd.) und bringen diese in eingeübten und für sie wirksamen Handlungen zur Darstellung. 1 Die dabei zum Einsatz kommenden Modi der Darstellung und Inszenierung der Leistungen lassen sich mithilfe eines performativitätstheoretischen Analysefokus (siehe Kap. 1.2) in den Blick nehmen, da er die Leistungsdarstellung stärker als einen praktischen Leistungsvollzug betrachtet. Wir verwenden diese performativitätstheoretische Analysedimension in Abhängigkeit von der Relevanz der Empirie, das bedeutet: wenn der Darstellungscharakter professioneller Leistungen sich empirisch nachweisen lässt, kann die Anwendung einer performativitätstheoretischen Analysedimension bereits selbst Aufschluss über die Erschließung von bestimmten Phänomenen geben, während andere Fälle dahingehend zu vernachlässigen sind. 26
Zur Konstitution von Alltag und Interaktion in Kita und Kindertagespflege oder: Was passiert in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege?
 Profile der Kindertagesbetreuung (ProKi) - Zur Konstitution von Alltag und Interaktion in Kita und Kindertagespflege oder: Was passiert in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege? Prof. Dr. Gabriel
Profile der Kindertagesbetreuung (ProKi) - Zur Konstitution von Alltag und Interaktion in Kita und Kindertagespflege oder: Was passiert in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege? Prof. Dr. Gabriel
Teamsitzungen: Orte professioneller Fallarbeit und Praktiken der Reflexivität. Prof. Dr. Peter Cloos Dipl. Soz. Anika Göbel
 Teamsitzungen: Orte professioneller Fallarbeit und Praktiken der Reflexivität Prof. Dr. Peter Cloos Dipl. Soz. Anika Göbel Überblick zum Vortrag 1. Einführung 2. Forschungsdesign des Projektes 3. Hintergrund
Teamsitzungen: Orte professioneller Fallarbeit und Praktiken der Reflexivität Prof. Dr. Peter Cloos Dipl. Soz. Anika Göbel Überblick zum Vortrag 1. Einführung 2. Forschungsdesign des Projektes 3. Hintergrund
Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns
 Cathleen Grunert Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns Einführung zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch
Cathleen Grunert Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns Einführung zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession
 Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
kultur- und sozialwissenschaften
 Christiane Hof Kurseinheit 1: Lebenslanges Lernen Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften Redaktionelle Überarbeitung und Mitarbeit Renate Schramek
Christiane Hof Kurseinheit 1: Lebenslanges Lernen Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften Redaktionelle Überarbeitung und Mitarbeit Renate Schramek
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft. Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit. Modul-Handbuch
 Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Was passiert in Kindertageseinrichtungen. Kindertagespflege?
 Gabriel Schoyerer, Carola Frank, Margarete Jooß-Weinbach, Steffen Loick Molina Was passiert in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege? Phänomene professionellen Handelns in der Kindertagesbetreuung
Gabriel Schoyerer, Carola Frank, Margarete Jooß-Weinbach, Steffen Loick Molina Was passiert in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege? Phänomene professionellen Handelns in der Kindertagesbetreuung
Sebastian Lerch. Selbstkompetenzen. Eine erziehungswissenschaftliche Grundlegung
 Selbstkompetenzen Sebastian Lerch Selbstkompetenzen Eine erziehungswissenschaftliche Grundlegung Sebastian Lerch Johannes Gutenberg-Universität Mainz Deutschland ISBN 978-3-658-12974-3 DOI 10.1007/978-3-658-12975-0
Selbstkompetenzen Sebastian Lerch Selbstkompetenzen Eine erziehungswissenschaftliche Grundlegung Sebastian Lerch Johannes Gutenberg-Universität Mainz Deutschland ISBN 978-3-658-12974-3 DOI 10.1007/978-3-658-12975-0
Karsten Häschel Kitainklusion
 Karsten Häschel Kitainklusion 1 2 Karsten Häschel Kitainklusion Wege zur gelingenden Umsetzung 3 Der Autor Karsten Häschel arbeitete als Diplom-Sozialarbeiter/-pädagoge 24 Jahre lang für freie Träger der
Karsten Häschel Kitainklusion 1 2 Karsten Häschel Kitainklusion Wege zur gelingenden Umsetzung 3 Der Autor Karsten Häschel arbeitete als Diplom-Sozialarbeiter/-pädagoge 24 Jahre lang für freie Träger der
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend
 Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Qualifikationsprofil Bewegung in der frühen Kindheit
 Qualifikationsprofil Bewegung in der frühen Kindheit Jutta Schneider Aida Kopic Christina Jasmund Qualifikationsprofil Bewegung in der frühen Kindheit Was frühpädagogische Fachkräfte wissen, können und
Qualifikationsprofil Bewegung in der frühen Kindheit Jutta Schneider Aida Kopic Christina Jasmund Qualifikationsprofil Bewegung in der frühen Kindheit Was frühpädagogische Fachkräfte wissen, können und
Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit
 Hiltrud von Spiegel Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis Mit 4 Abbildungen, 4 Tabellen und 30 Arbeitshilfen 5., vollständig überarbeitete Auflage Ernst
Hiltrud von Spiegel Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis Mit 4 Abbildungen, 4 Tabellen und 30 Arbeitshilfen 5., vollständig überarbeitete Auflage Ernst
Junge Menschen für das Thema Alter interessieren und begeistern Lebenssituation von älteren, hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen verbessern
 Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Marianne Kleiner-Wuttke. Kollegiale Beratung in Kindertagesstätten. Als Team gemeinsam durch Klärung zu Lösungen finden
 Marianne Kleiner-Wuttke Kollegiale Beratung in Kindertagesstätten Als Team gemeinsam durch Klärung zu Lösungen finden Marianne Kleiner-Wuttke Kollegiale Beratung in Kindertagesstätten 1 2 Marianne Kleiner-Wuttke
Marianne Kleiner-Wuttke Kollegiale Beratung in Kindertagesstätten Als Team gemeinsam durch Klärung zu Lösungen finden Marianne Kleiner-Wuttke Kollegiale Beratung in Kindertagesstätten 1 2 Marianne Kleiner-Wuttke
Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache
 Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache DJI-Reihe Kinder Band 10 Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen
Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache DJI-Reihe Kinder Band 10 Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland
 Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Wissenschaftstheoretische Grundlagen qualitativer Forschung. Ulrike Froschauer (Institut für Soziologie)
 25.07. 28.07.2016 Wissenschaftstheoretische Grundlagen qualitativer Forschung (Institut für Soziologie) Wissenschaftstheoretische Grundlagen: Sozialer Konstruktivismus Soziale Welt ist eine sozial konstruierte
25.07. 28.07.2016 Wissenschaftstheoretische Grundlagen qualitativer Forschung (Institut für Soziologie) Wissenschaftstheoretische Grundlagen: Sozialer Konstruktivismus Soziale Welt ist eine sozial konstruierte
3. Sitzung des Fachbeirats. Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre
 3. Sitzung des Fachbeirats Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre Erfurt am 26.04.2012 TOPs 2 Protokoll vom 19.03.2012 und Aktuelles Kapitel 1, Unterkapitel 1.1 (Bildungsverständnis) Einleitende Bemerkungen
3. Sitzung des Fachbeirats Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre Erfurt am 26.04.2012 TOPs 2 Protokoll vom 19.03.2012 und Aktuelles Kapitel 1, Unterkapitel 1.1 (Bildungsverständnis) Einleitende Bemerkungen
Die Bedeutung der Zusammenhänge von biografischen Erfahrungen und Beziehungen
 Die Bedeutung der Zusammenhänge von biografischen Erfahrungen und Beziehungen Otte Christian, BA Holztrattner Melanie, MA Pro Juventute Fachtagung Nähe und Distanz St. Virgil Salzburg, 19. April 2018 Workshop:
Die Bedeutung der Zusammenhänge von biografischen Erfahrungen und Beziehungen Otte Christian, BA Holztrattner Melanie, MA Pro Juventute Fachtagung Nähe und Distanz St. Virgil Salzburg, 19. April 2018 Workshop:
2. Sitzung des Fachbeirats. Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre
 2. Sitzung des Fachbeirats Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre Erfurt am 19.03.2012 TOPs 2 Protokoll vom 19.01.2012 und Aktuelles Kapitel 1 Struktur des TBP-18 Jahre Ausführungen Unterkapitel 1.1 (Bildungsverständnis)
2. Sitzung des Fachbeirats Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre Erfurt am 19.03.2012 TOPs 2 Protokoll vom 19.01.2012 und Aktuelles Kapitel 1 Struktur des TBP-18 Jahre Ausführungen Unterkapitel 1.1 (Bildungsverständnis)
Otger Autrata Bringfriede Scheu. Soziale Arbeit
 Otger Autrata Bringfriede Scheu Soziale Arbeit VS RESEARCH Forschung, Innovation und Soziale Arbeit Herausgegeben von Bringfriede Scheu, Fachhochschule Kärnten Otger Autrata, Forschungsinstitut RISS/Universität
Otger Autrata Bringfriede Scheu Soziale Arbeit VS RESEARCH Forschung, Innovation und Soziale Arbeit Herausgegeben von Bringfriede Scheu, Fachhochschule Kärnten Otger Autrata, Forschungsinstitut RISS/Universität
Frühe Bildung eine kommunale Aufgabe?
 Frühe Bildung eine kommunale Aufgabe? Vortrag zum Fachtag Kommunen gestalten: Frühe Bildung am 11.10.2016 Dr. Susanne v. Hehl 2 Gliederung 1. Frühe Bildung und ihre Bedeutung für die Kommunen 2. Rolle
Frühe Bildung eine kommunale Aufgabe? Vortrag zum Fachtag Kommunen gestalten: Frühe Bildung am 11.10.2016 Dr. Susanne v. Hehl 2 Gliederung 1. Frühe Bildung und ihre Bedeutung für die Kommunen 2. Rolle
Hilf mir, es selbst zu tun! Die Pädagogik Maria Montessoris als reformpädagogisches Konzept
 UNTERRICHTSVORHABEN 1 Hilf mir, es selbst zu tun! Die Pädagogik Maria Montessoris als reformpädagogisches Konzept Entwicklung, Sozialisation und Erziehung () Werte, Normen und Ziele in Erziehung und Bildung
UNTERRICHTSVORHABEN 1 Hilf mir, es selbst zu tun! Die Pädagogik Maria Montessoris als reformpädagogisches Konzept Entwicklung, Sozialisation und Erziehung () Werte, Normen und Ziele in Erziehung und Bildung
Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz
 Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Distanzierte Nähe Ein Spannungsfeld bei der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen
 Distanzierte Nähe Ein Spannungsfeld bei der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen Prof. Dr. René Stalder T direkt +41 41 367 48 78 rene.stalder@hslu.ch Siders, 29.5.2017 Semaine Nationale: Proximeté
Distanzierte Nähe Ein Spannungsfeld bei der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen Prof. Dr. René Stalder T direkt +41 41 367 48 78 rene.stalder@hslu.ch Siders, 29.5.2017 Semaine Nationale: Proximeté
Professionalisierung und pädagogische Qualität
 Professionalisierung und pädagogische Qualität Woran zeigt sich professionelles Handeln? Kolloquium: Professionalisierung in der Kindertagesbetreuung WiFF, DJI und Münchner Hochschulen Prof`in Dr. Anke
Professionalisierung und pädagogische Qualität Woran zeigt sich professionelles Handeln? Kolloquium: Professionalisierung in der Kindertagesbetreuung WiFF, DJI und Münchner Hochschulen Prof`in Dr. Anke
Verbindung von Forschung und Praxis
 Verbindung von Forschung und Praxis Erwerb von Praxiskompetenzen an Fachhochschulen Fachschulen im Dialog mit der Praxis, LVR-Landesjugendamt Rheinland, 23.11.2011 Prof. Dr. Claus Stieve BA Pädagogik der
Verbindung von Forschung und Praxis Erwerb von Praxiskompetenzen an Fachhochschulen Fachschulen im Dialog mit der Praxis, LVR-Landesjugendamt Rheinland, 23.11.2011 Prof. Dr. Claus Stieve BA Pädagogik der
Barbara Keddi Projekt Liebe
 Barbara Keddi Projekt Liebe DJI-Reihe Gender Band 15 Barbara Keddi Projekt Liebe Lebensthemen und biografisches Handeln junger Frauen in Paarbeziehungen Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2003 Das Deutsche
Barbara Keddi Projekt Liebe DJI-Reihe Gender Band 15 Barbara Keddi Projekt Liebe Lebensthemen und biografisches Handeln junger Frauen in Paarbeziehungen Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2003 Das Deutsche
Teamarbeit in Kindertageseinrichtungen
 Teamarbeit in Kindertageseinrichtungen Eine ethnografisch-gesprächsanalytische Studie Bearbeitet von Barbara Lochner 1. Aufl. 2017. 2017. Buch. X, 338 S. Kartoniert / Broschiert ISBN 978 3 658 16707 3
Teamarbeit in Kindertageseinrichtungen Eine ethnografisch-gesprächsanalytische Studie Bearbeitet von Barbara Lochner 1. Aufl. 2017. 2017. Buch. X, 338 S. Kartoniert / Broschiert ISBN 978 3 658 16707 3
Verena Mayr-Kleffel Frauen und ihre sozialen Netzwerke
 Verena Mayr-Kleffel Frauen und ihre sozialen Netzwerke Verena Mayr-Kleffel Frauen und ihre sozialen Netzwerke Auf der Suche nach einer verlorenen Ressource Leske + Budrich, Opladen 1991 Die vorliegende
Verena Mayr-Kleffel Frauen und ihre sozialen Netzwerke Verena Mayr-Kleffel Frauen und ihre sozialen Netzwerke Auf der Suche nach einer verlorenen Ressource Leske + Budrich, Opladen 1991 Die vorliegende
Armut und Überschuldung
 Armut und Überschuldung Sally Peters Armut und Überschuldung Bewältigungshandeln von jungen Erwachsenen in finanziell schwierigen Situationen Sally Peters Hamburg, Deutschland Das Buch entstand im Kontext
Armut und Überschuldung Sally Peters Armut und Überschuldung Bewältigungshandeln von jungen Erwachsenen in finanziell schwierigen Situationen Sally Peters Hamburg, Deutschland Das Buch entstand im Kontext
Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung 1
 Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung 1 Niklas Luhmann Soziologische Aufklärung 1 Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme 6. Auflage Westdeutscher Verlag 6. Auflage, 1991 Der Westdeutsche Verlag ist ein
Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung 1 Niklas Luhmann Soziologische Aufklärung 1 Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme 6. Auflage Westdeutscher Verlag 6. Auflage, 1991 Der Westdeutsche Verlag ist ein
Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion
 Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion Band 2 Herausgegeben von K. Böllert, Münster, Deutschland Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion ist der Name und das Arbeitsprogramm einer Forschungsgruppe, die
Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion Band 2 Herausgegeben von K. Böllert, Münster, Deutschland Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion ist der Name und das Arbeitsprogramm einer Forschungsgruppe, die
4.4 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung Verknüpfung und zusammenfassende Ergebnisdarstellung Schlussfolgerungen für eine
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 7 1 Einleitung...9 2 Das soziale Phänomen der Stigmatisierung in Theorie und Empirie...10 2.1 Stigmatisierung in theoretischen Konzepten...10 2.1.1 Ausgangspunkte...11 2.1.2
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 7 1 Einleitung...9 2 Das soziale Phänomen der Stigmatisierung in Theorie und Empirie...10 2.1 Stigmatisierung in theoretischen Konzepten...10 2.1.1 Ausgangspunkte...11 2.1.2
Qualitätsansprüche von und an Fachberatung
 21.05.2014 Qualitätsansprüche von und an Fachberatung FORUM FACHBERATUNG KINDERTAGESBETREUUNG AUGUSTINERKLOSTER, ERFURT DR. REGINA REMSPERGER, STEFAN WEIDMANN M.A. 2 01 Zum Forschungsprojekt Die Rolle
21.05.2014 Qualitätsansprüche von und an Fachberatung FORUM FACHBERATUNG KINDERTAGESBETREUUNG AUGUSTINERKLOSTER, ERFURT DR. REGINA REMSPERGER, STEFAN WEIDMANN M.A. 2 01 Zum Forschungsprojekt Die Rolle
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft
 Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft Barbara RendtorffNera Moser (Hrsg.) Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft Eine Einführung Mit Beiträgen
Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft Barbara RendtorffNera Moser (Hrsg.) Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft Eine Einführung Mit Beiträgen
Burkhard Fuhs Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft
 Burkhard Fuhs Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft Grundwissen Erziehungswissenschaft Die Reihe Grundwissen Erziehungswissenschaft stellt Studierenden, Lehrenden und pädagogisch Interessierten
Burkhard Fuhs Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft Grundwissen Erziehungswissenschaft Die Reihe Grundwissen Erziehungswissenschaft stellt Studierenden, Lehrenden und pädagogisch Interessierten
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Inhalt. Inhaltsverzeichnis 7
 Inhalt Inhaltsverzeichnis 7 1 Einleitung 13 1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas.......... 13 1.2 Stand der Forschung....................... 17 1.3 Aufbau und Gliederung der Arbeit...............
Inhalt Inhaltsverzeichnis 7 1 Einleitung 13 1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas.......... 13 1.2 Stand der Forschung....................... 17 1.3 Aufbau und Gliederung der Arbeit...............
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
SOZIALWISSENSCHAFTEN
 SOZIALWISSENSCHAFTEN Lisa Eckhardt, Annika Funke, Christina Pautzke Bergische Universität Wuppertal WiSe 17/18 Sichtweisen der Sozialwissenschaften Dr. Bongardt Sozialwissenschaften Bereiche Politikwissenschaften
SOZIALWISSENSCHAFTEN Lisa Eckhardt, Annika Funke, Christina Pautzke Bergische Universität Wuppertal WiSe 17/18 Sichtweisen der Sozialwissenschaften Dr. Bongardt Sozialwissenschaften Bereiche Politikwissenschaften
Didaktische Unterrichtsforschung
 Didaktische Unterrichtsforschung Astrid Baltruschat Didaktische Unterrichtsforschung Astrid Baltruschat Erlangen, Deutschland Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Projektnummer 208643309
Didaktische Unterrichtsforschung Astrid Baltruschat Didaktische Unterrichtsforschung Astrid Baltruschat Erlangen, Deutschland Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Projektnummer 208643309
Die Rückkehr einer autoritären Jugendhilfe? Kontrolle und Strafe unter dem Deckmantel von Schutz und Fürsorge
 Prof. Dr. Reinhold Schone FH Münster, FB Sozialwesen Die Rückkehr einer autoritären Jugendhilfe? Kontrolle und Strafe unter dem Deckmantel von Schutz und Fürsorge Dresden am 29.05.2013 KomDAT Jugendhilfe
Prof. Dr. Reinhold Schone FH Münster, FB Sozialwesen Die Rückkehr einer autoritären Jugendhilfe? Kontrolle und Strafe unter dem Deckmantel von Schutz und Fürsorge Dresden am 29.05.2013 KomDAT Jugendhilfe
Wolfgang Ludwig Schneider Objektives Verstehen
 Wolfgang Ludwig Schneider Objektives Verstehen Wolfgang Ludwig Schneider Objektives Verstehen Rekonstruktion eines Paradigmas: Gadamer, Popper, Toulmin, Luhmann Westdeutscher Verlag Die Deutsche Bibliothek
Wolfgang Ludwig Schneider Objektives Verstehen Wolfgang Ludwig Schneider Objektives Verstehen Rekonstruktion eines Paradigmas: Gadamer, Popper, Toulmin, Luhmann Westdeutscher Verlag Die Deutsche Bibliothek
Arbeitsaufwand (workload) Moduldauer (laut Studienverlaufsplan) (laut Studienverlaufsplan)
 2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
Soziale Arbeit in der Sozialhilfe
 Soziale Arbeit in der Sozialhilfe Rahel Müller de Menezes Soziale Arbeit in der Sozialhilfe Eine qualitative Analyse von Fallbearbeitungen RESEARCH Rahel Müller de Menezes Bern, Schweiz Zugl. Dissertation
Soziale Arbeit in der Sozialhilfe Rahel Müller de Menezes Soziale Arbeit in der Sozialhilfe Eine qualitative Analyse von Fallbearbeitungen RESEARCH Rahel Müller de Menezes Bern, Schweiz Zugl. Dissertation
3. infans-steg- Kongress am 19. Mai 2017 in BAD KROZINGEN Beziehung gestalten Bildungsprozesse sichern
 3. infans-steg- Kongress am 19. Mai 2017 in BAD KROZINGEN Beziehung gestalten Bildungsprozesse sichern Workshop 5 infans- und Sprachförderprogramme? Alltagsintegrierte Sprachförderung durch Beziehungs-und
3. infans-steg- Kongress am 19. Mai 2017 in BAD KROZINGEN Beziehung gestalten Bildungsprozesse sichern Workshop 5 infans- und Sprachförderprogramme? Alltagsintegrierte Sprachförderung durch Beziehungs-und
Personalentwicklung an der Hochschule ein Einblick
 Praxisforum 2015 «Personalentwicklung im Fokus» Olten, 4. November 2015 Personalentwicklung an der Hochschule ein Einblick Prof. Dr. Luzia Truniger Direktorin Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Personalentwicklung
Praxisforum 2015 «Personalentwicklung im Fokus» Olten, 4. November 2015 Personalentwicklung an der Hochschule ein Einblick Prof. Dr. Luzia Truniger Direktorin Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Personalentwicklung
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit
 Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen
zu überprüfen und zu präzisieren. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
 1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
Andrea Hausmann. Kunst- und Kulturmanagement
 Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kunst- und Kulturmanagement Herausgegeben von Andrea Hausmann Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kompaktwissen
Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kunst- und Kulturmanagement Herausgegeben von Andrea Hausmann Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kompaktwissen
NAVIGIEREN IN ZEITEN DES UMBRUCHS
 Fredmund Malik NAVIGIEREN IN ZEITEN DES UMBRUCHS Die Welt neu denken und gestalten Campus Verlag Frankfurt/New York ISBN 978-3-593-50453-7 (Print) ISBN 978-3-593-43206-9 (PDF-E-Book) ISBN 978-3-593-43204-5
Fredmund Malik NAVIGIEREN IN ZEITEN DES UMBRUCHS Die Welt neu denken und gestalten Campus Verlag Frankfurt/New York ISBN 978-3-593-50453-7 (Print) ISBN 978-3-593-43206-9 (PDF-E-Book) ISBN 978-3-593-43204-5
Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Teamqualifizierungen
 Sprache ist der Schlüssel zur Welt Teamqualifizierungen Für Sie... Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, der Erwerb von Sprache ist einer der elementarsten kindlichen Entwicklungsprozesse, der jedoch sehr
Sprache ist der Schlüssel zur Welt Teamqualifizierungen Für Sie... Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, der Erwerb von Sprache ist einer der elementarsten kindlichen Entwicklungsprozesse, der jedoch sehr
SOLIDARISCHE ARBEITSVERHÄLTNISSE. Stephan Lessenich, Frank Engster und Ute Kalbitzer
 WORKSHOP #4 SOLIDARISCHE ARBEITSVERHÄLTNISSE Stephan Lessenich, Frank Engster und Ute Kalbitzer Die Gesellschaft befindet sich weltweit in einer eigentümlichen Situation. Als das Institut Solidarische
WORKSHOP #4 SOLIDARISCHE ARBEITSVERHÄLTNISSE Stephan Lessenich, Frank Engster und Ute Kalbitzer Die Gesellschaft befindet sich weltweit in einer eigentümlichen Situation. Als das Institut Solidarische
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Workshop. Workshop. Die Schulpraxis durch den Einsatz von Unterrichtsvideos forschend erkunden
 Workshop Fakultät Erziehungswissenschaften Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken Professur für Gesundheit und Pflege/Berufliche Didaktik Workshop Die Schulpraxis durch den Einsatz von
Workshop Fakultät Erziehungswissenschaften Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken Professur für Gesundheit und Pflege/Berufliche Didaktik Workshop Die Schulpraxis durch den Einsatz von
Auf die Haltung kommt es an!
 Auf die Haltung kommt es an! ANREGUNGEN ZUR ENTWICKLUNG EINER PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG IM KINDERGARTEN SONJA SCHMID, BA Ein Beispiel aus dem Berufsalltag https://www.youtube.com/watch?v=m7e
Auf die Haltung kommt es an! ANREGUNGEN ZUR ENTWICKLUNG EINER PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG IM KINDERGARTEN SONJA SCHMID, BA Ein Beispiel aus dem Berufsalltag https://www.youtube.com/watch?v=m7e
Rezeption der Umweltproblematik in der Betriebswirtschaftslehre
 Roswitha Wöllenstein Rezeption der Umweltproblematik in der Betriebswirtschaftslehre Eine empirische Rekonstruktion und strukturationstheoretische Analyse der ökologieorientierten Forschung in der Betriebswirtschaftslehre
Roswitha Wöllenstein Rezeption der Umweltproblematik in der Betriebswirtschaftslehre Eine empirische Rekonstruktion und strukturationstheoretische Analyse der ökologieorientierten Forschung in der Betriebswirtschaftslehre
Nomos. Gemeinwohl. Forschungsstand Politikwissenschaft. Peter Schmitt-Egner
 Forschungsstand Politikwissenschaft Peter Schmitt-Egner Gemeinwohl Konzeptionelle Grundlinien zur Legitimität und Zielsetzung von Politik im 21. Jahrhundert Nomos Forschungsstand Politikwissenschaft Peter
Forschungsstand Politikwissenschaft Peter Schmitt-Egner Gemeinwohl Konzeptionelle Grundlinien zur Legitimität und Zielsetzung von Politik im 21. Jahrhundert Nomos Forschungsstand Politikwissenschaft Peter
Nomos. Gestaltungsparameter und verhaltensbeeinflussende Wirkung ökologisch orientierter Steuerungssysteme. Eine fallstudienbasierte Untersuchung
 Controlling und Management Alexander Stehle Gestaltungsparameter und verhaltensbeeinflussende Wirkung ökologisch orientierter Steuerungssysteme Eine fallstudienbasierte Untersuchung Nomos Die Reihe Controlling
Controlling und Management Alexander Stehle Gestaltungsparameter und verhaltensbeeinflussende Wirkung ökologisch orientierter Steuerungssysteme Eine fallstudienbasierte Untersuchung Nomos Die Reihe Controlling
Wir haben uns demgegenüber entschlossen, eine systematische und stringente Theorie der Sozialen Arbeit vorzulegen. Grundsätzlich wird dabei vorausgese
 Einführung Seit vielen Jahren und in verschiedenen Veröffentlichungen haben wir uns mit Sozialer Arbeit in Theorie und Praxis auseinandergesetzt. Das geschah keineswegs immer zustimmend zu den Entwicklungen
Einführung Seit vielen Jahren und in verschiedenen Veröffentlichungen haben wir uns mit Sozialer Arbeit in Theorie und Praxis auseinandergesetzt. Das geschah keineswegs immer zustimmend zu den Entwicklungen
Inhaltsbeschreibung Langworkshops
 GIEßENER METHODEN-WERKSTATT Bildungsforschung 2018 Datum: vom 22.2. bis 24.2.2018 Ort: Justus-Liebig-Universität Gießen Alter Steinbacher Weg 44 (Neues Seminargebäude Philosophikum 1) 35394 Gießen Inhaltsbeschreibung
GIEßENER METHODEN-WERKSTATT Bildungsforschung 2018 Datum: vom 22.2. bis 24.2.2018 Ort: Justus-Liebig-Universität Gießen Alter Steinbacher Weg 44 (Neues Seminargebäude Philosophikum 1) 35394 Gießen Inhaltsbeschreibung
Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit
 Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit Funktionen und Formen aus soziologischer Perspektive Bearbeitet von Hemma Mayrhofer 1. Auflage 2012. Taschenbuch. viii, 324 S. Paperback ISBN 978 3 658 00192
Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit Funktionen und Formen aus soziologischer Perspektive Bearbeitet von Hemma Mayrhofer 1. Auflage 2012. Taschenbuch. viii, 324 S. Paperback ISBN 978 3 658 00192
Gute-KiTa-Checkliste. Gesetzliche Anforderungen an die Umsetzung des KiTa-Qualitätsund Teilhabeverbesserungsgesetzes in den Ländern
 Gute-KiTa-Checkliste Gesetzliche Anforderungen an die Umsetzung des KiTa-Qualitätsund Teilhabeverbesserungsgesetzes in den Ländern Seit dem 1. Januar 2019 sind wesentliche Teile des KiTa-Qualitäts- und
Gute-KiTa-Checkliste Gesetzliche Anforderungen an die Umsetzung des KiTa-Qualitätsund Teilhabeverbesserungsgesetzes in den Ländern Seit dem 1. Januar 2019 sind wesentliche Teile des KiTa-Qualitäts- und
Mediation mit psychisch kranken Menschen
 Mediation mit psychisch kranken Menschen Sonja Schlamp Mediation mit psychisch kranken Menschen Wenn Merkmalsausprägungen psychischer Störungen den Mediationsprozess beeinflussen Bibliografische Informationen
Mediation mit psychisch kranken Menschen Sonja Schlamp Mediation mit psychisch kranken Menschen Wenn Merkmalsausprägungen psychischer Störungen den Mediationsprozess beeinflussen Bibliografische Informationen
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden)
 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden) Voraussetzungen für Zeugnis Regelmäßige Teilnahme (80%) (11,2 Montage) schreiben von kleinen Texten (1 ECTS) kleine
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden) Voraussetzungen für Zeugnis Regelmäßige Teilnahme (80%) (11,2 Montage) schreiben von kleinen Texten (1 ECTS) kleine
BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit. Studienabschnitt. 1./2. Semester
 BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit 1./2. Semester 12 LP 360 h Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ SWS 1 Einführung in die Soziale Arbeit V 4 LP 2 2 Einführung
BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit 1./2. Semester 12 LP 360 h Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ SWS 1 Einführung in die Soziale Arbeit V 4 LP 2 2 Einführung
Mit dem kollegialen Audit die Vorteile von Systemakkreditierung und Audit zusammenführen das Mainzer Experiment
 Mit dem kollegialen Audit die Vorteile von Systemakkreditierung und Audit zusammenführen das Mainzer Experiment 17 Hochschulmanagement 1. Erfahrungen mit Verfahren der internen und externen Qualitätssicherung
Mit dem kollegialen Audit die Vorteile von Systemakkreditierung und Audit zusammenführen das Mainzer Experiment 17 Hochschulmanagement 1. Erfahrungen mit Verfahren der internen und externen Qualitätssicherung
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Was Coaching wirksam macht
 Was Coaching wirksam macht Marc Lindart Was Coaching wirksam macht Wirkfaktoren von Coachingprozessen im Fokus 123 Marc Lindart Münster, Deutschland D6 OnlinePLUS Material zu diesem Buch nden Sie auf http://www.springer.de/978-3-658-11760-3
Was Coaching wirksam macht Marc Lindart Was Coaching wirksam macht Wirkfaktoren von Coachingprozessen im Fokus 123 Marc Lindart Münster, Deutschland D6 OnlinePLUS Material zu diesem Buch nden Sie auf http://www.springer.de/978-3-658-11760-3
Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung. Unterrichtsform Punkte I II III IV
 Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Janine Linßer. Bildung in der Praxis Offener Kinder- und Jugendarbeit
 Janine Linßer Bildung in der Praxis Offener Kinder- und Jugendarbeit VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte
Janine Linßer Bildung in der Praxis Offener Kinder- und Jugendarbeit VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte
LVR-Landesjugendamt. Junge Kinder in den Angeboten der stationären Erziehungshilfe
 Junge Kinder in den Angeboten der stationären Erziehungshilfe Rahmenbedingungen und fachliche Grundlagen der Angebote mit Plätzen für junge Kinder zur Erteilung der Betriebserlaubnis nach 45 SGB VIII in
Junge Kinder in den Angeboten der stationären Erziehungshilfe Rahmenbedingungen und fachliche Grundlagen der Angebote mit Plätzen für junge Kinder zur Erteilung der Betriebserlaubnis nach 45 SGB VIII in
2.2 Übersichtsebene Jahrgang (Q1, Q2) Grundkurs (Abitur 2017/2018)
 2.2 Übersichtsebene Jahrgang 12-13 (Q1, Q Grundkurs (Abitur 2017/2018) Fokussierungen sind rot gedruckt Jahrgang 12/ I (Q Lust und Frust - Eine pädagogische Sicht auf Modelle psychoanalytischer und psychosozialer
2.2 Übersichtsebene Jahrgang 12-13 (Q1, Q Grundkurs (Abitur 2017/2018) Fokussierungen sind rot gedruckt Jahrgang 12/ I (Q Lust und Frust - Eine pädagogische Sicht auf Modelle psychoanalytischer und psychosozialer
Schulinterner Kernlehrplan Erziehungswissenschaft
 Schulinterner Kernlehrplan Erziehungswissenschaft Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Der Mensch wird zum Menschen nur durch Erziehung Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungsfähigkeit Inhaltsfeld I: Bildungs-
Schulinterner Kernlehrplan Erziehungswissenschaft Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Der Mensch wird zum Menschen nur durch Erziehung Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungsfähigkeit Inhaltsfeld I: Bildungs-
Berater-Klienten-Interaktion in der PR-Beratung
 Berater-Klienten-Interaktion in der PR-Beratung Clarissa Schöller Berater-Klienten- Interaktion in der PR-Beratung Theoretische Fundierung und empirische Analyse einer komplexen Dienstleistung Clarissa
Berater-Klienten-Interaktion in der PR-Beratung Clarissa Schöller Berater-Klienten- Interaktion in der PR-Beratung Theoretische Fundierung und empirische Analyse einer komplexen Dienstleistung Clarissa
WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG ZUM MODELLPROJEKT
 Prof. Dr. Simone Seitz und Catalina Hamacher WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG ZUM MODELLPROJEKT Kooperation Kitas & Frühförderstellen: Teilhabe stärken Agenda 1 Leitgedanken Zielsetzungen Konkrete Forschungsfragen
Prof. Dr. Simone Seitz und Catalina Hamacher WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG ZUM MODELLPROJEKT Kooperation Kitas & Frühförderstellen: Teilhabe stärken Agenda 1 Leitgedanken Zielsetzungen Konkrete Forschungsfragen
Arnd-Michael Nohl. Interview und dokumentarische Methode
 Arnd-Michael Nohl Interview und dokumentarische Methode Qualitative Sozialforschung Band 16 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Arnd-Michael Nohl Interview und dokumentarische Methode Qualitative Sozialforschung Band 16 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Lebensbewältigung zwischen Bildungsansprüchen und gesellschaftlicher Anpassung
 Internationale Hochschulschriften 382 Lebensbewältigung zwischen Bildungsansprüchen und gesellschaftlicher Anpassung Zum Verhältnis von Sozialarbeitswissenschaft und Sozialpädagogik Bearbeitet von Ursula
Internationale Hochschulschriften 382 Lebensbewältigung zwischen Bildungsansprüchen und gesellschaftlicher Anpassung Zum Verhältnis von Sozialarbeitswissenschaft und Sozialpädagogik Bearbeitet von Ursula
Partner auf Augenhöhe? Zusammenarbeit von Familien, Kitas und Schulen mit Blick auf Bildungschancen
 Partner auf Augenhöhe? Zusammenarbeit von Familien, Kitas und Schulen mit Blick auf Bildungschancen Prof. Dr. Tanja Betz Kindheitsforschung und Elementar-/Primarpädagogik Fachbereich Erziehungswissenschaften
Partner auf Augenhöhe? Zusammenarbeit von Familien, Kitas und Schulen mit Blick auf Bildungschancen Prof. Dr. Tanja Betz Kindheitsforschung und Elementar-/Primarpädagogik Fachbereich Erziehungswissenschaften
Professionalisierung von Berufsschullehrkräften aus Sicht der beruflichen Schulen
 Professionalisierung von Berufsschullehrkräften aus Sicht der beruflichen Schulen Kurzvortrag in Essen am 24.11.2017 24.11.2017 Fachbereich Humanwissenschaften Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik
Professionalisierung von Berufsschullehrkräften aus Sicht der beruflichen Schulen Kurzvortrag in Essen am 24.11.2017 24.11.2017 Fachbereich Humanwissenschaften Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik
Inhaltsverzeichnis. O. Einleitung I. Problemdarstellung... 23
 5 Inhaltsverzeichnis O. Einleitung... 11 I. Problemdarstellung... 23 1. Der Pflegeprozess als Grundlage für die Umsetzung einer professionellen Pflege... 24 1.1. Einführung in den Pflegeprozess... 25 1.1.1.
5 Inhaltsverzeichnis O. Einleitung... 11 I. Problemdarstellung... 23 1. Der Pflegeprozess als Grundlage für die Umsetzung einer professionellen Pflege... 24 1.1. Einführung in den Pflegeprozess... 25 1.1.1.
Wissenschaftlich denken, handeln, wirken
 Wissenschaftlich denken, handeln, wirken Aufgaben der Hochschullehre Forum Hochschuldidaktik 2013 Georg-August-Universität Göttingen Überblick Wissenschaft ist (sagt ein altes Lexikon) profiteri et studere
Wissenschaftlich denken, handeln, wirken Aufgaben der Hochschullehre Forum Hochschuldidaktik 2013 Georg-August-Universität Göttingen Überblick Wissenschaft ist (sagt ein altes Lexikon) profiteri et studere
Modulhandbuch Pädagogische Hochschule Weingarten. Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen WHRPO I. Erweiterungsstudiengang
 Modulhandbuch Pädagogische Hochschule Weingarten Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen WHRPO I Erweiterungsstudiengang Interkulturelle Pädagogik Interkulturelle Pädagogik Modul Nr. 1 Bildungsforschung
Modulhandbuch Pädagogische Hochschule Weingarten Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen WHRPO I Erweiterungsstudiengang Interkulturelle Pädagogik Interkulturelle Pädagogik Modul Nr. 1 Bildungsforschung
Jeder ASD ist irgendwie anders!
 Jeder ASD ist irgendwie anders! Verschiedenheit zwischen Selbstverständlichkeit und fachlicher Profildiskussion - Tagung DIFU/ BAG ASD 22.10.2018 Berlin - Prof. Dr. Joachim Merchel Fachhochschule Münster,
Jeder ASD ist irgendwie anders! Verschiedenheit zwischen Selbstverständlichkeit und fachlicher Profildiskussion - Tagung DIFU/ BAG ASD 22.10.2018 Berlin - Prof. Dr. Joachim Merchel Fachhochschule Münster,
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen
 Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden
 Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Bildungspolitik und Leistungsvergleichsstudien
 Bildungspolitik und Leistungsvergleichsstudien Christian Kuhlmann Bildungspolitik und Leistungsvergleichsstudien PISA 2000 und die Ganztagsschulentwicklung Christian Kuhlmann Bielefeld, Deutschland Voestalpine
Bildungspolitik und Leistungsvergleichsstudien Christian Kuhlmann Bildungspolitik und Leistungsvergleichsstudien PISA 2000 und die Ganztagsschulentwicklung Christian Kuhlmann Bielefeld, Deutschland Voestalpine
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
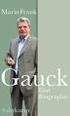 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
1. Was ist Reflexivität? 1.1 Notwendigkeit von Reflexion für pädagogisches Handeln 1.2 Einnehmen einer reflexiven Haltung 2. Wie kommt Reflexivität
 WIFF-Bundeskongress 2018 Panel 8: Kompetenzorientierte Weiterbildung in der frühpädagogischen Arbeit: Welche Potenziale bietet Lebenslanges Lernen für die (berufliche) Weiterentwicklung? Reflexivität Prof.
WIFF-Bundeskongress 2018 Panel 8: Kompetenzorientierte Weiterbildung in der frühpädagogischen Arbeit: Welche Potenziale bietet Lebenslanges Lernen für die (berufliche) Weiterentwicklung? Reflexivität Prof.
Wissenswertes über Kultur, Interkulturelle Kommunikation in der Praxisausbildung
 Wissenswertes über Kultur, Interkulturelle Kommunikation in der Praxisausbildung Kompetenzprofil und Praxisausbildung Kompetenzprofil Soziale Arbeit FHNW Professionskompetenz Fach- und Methodenkompetenz
Wissenswertes über Kultur, Interkulturelle Kommunikation in der Praxisausbildung Kompetenzprofil und Praxisausbildung Kompetenzprofil Soziale Arbeit FHNW Professionskompetenz Fach- und Methodenkompetenz
