CVD-Synthese von Kohlenstoff-Nanoröhren zur Nutzung als Mikroelektroden für neuronale Anwendungen
|
|
|
- Til Siegel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 CVD-Synthese von Kohlenstoff-Nanoröhren zur Nutzung als Mikroelektroden für neuronale Anwendungen Von Boris Stamm 1, Kerstin Schneider 2, Thoralf Herrmann 1, Claus Burkhardt 1, Wilfried Nisch 1, Monika Fleischer 2, Dieter P. Kern 2 und Alfred Stett 1 1 NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen 2 Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Angewandte Physik In der Forschung werden häufig Mikroelektroden-Arrays (MEAs) für Experimente mit Zellkulturen eingesetzt. Neben dem etablierten Elektrodenmaterial Titannitrid kommen auch kohlenstoffbasierte Materialen wie beispielsweise Kohlenstoffnanoröhren in Frage, von denen man sich verbesserte Elektrodeneigenschaften verspricht. Die Synthese und Charakterisierung von Kohlenstoffnanoröhren- Elektroden auf MEAs wird im folgenden Artikel näher beschrieben. Micro electrode arrays (MEAs) are often deployed in research for experiments with cell cultures. Besides the established electrode material titanium nitride, carbon based materials like carbon nanotubes come into consideration, which are deemed to have enhanced electrode properties. The synthesis and characterisation of carbon nanotube electrodes on MEAs is described in the following article. Einleitung MEAs (Abb. 1), sind in der Forschung etablierte Mikrosysteme zur Detektion und Stimulation elektrischer Aktivität von Zellen in Zell- und Gewebekulturen [1]. Anwendung finden sie beispielsweise in der Grundlagenforschung bei der Untersuchung der Dynamik und Plastizität von neuronalen Netzwerken oder in der angewandten Forschung bei der Untersuchung der Wirkung pharmazeutischer Wirkstoffe auf die Aktivität von Herzmuskel- und Nervenzellen in Zellkultur. MEAs enthalten bis zu 256 Mikroelektroden (Durchmesser zwischen 10 µm und 100 µm), die über isolierte Zuleitungen kontaktiert werden können. Die Mikroelektroden können sowohl für die Messung zellulärer Signale als auch zur elektrischen Stimulation verwendet werden. Hierzu müssen sie im Kontakt mit dem Kulturmedium im Zellkulturgefäß eine möglichst hohe Grenzflächenkapazität aufweisen. Dies ist die Voraussetzung für eine geringe Impedanz und damit für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei der Messung und für eine hohe Ladungsübertragungskapazität für eine effiziente elektrische Stimulation. Grundlagen zu CNTs CNTs sind eine Modifikation des Kohlenstoffs, welche in CVD- (Chemical Vapor Deposition) Verfahren substratbasiert und gleichzeitig strukturiert synthetisiert werden können. Charakteristisch für CNTs sind die dem Graphit entsprechende Wandstruktur der zylindrischen Röhren, das heißt hexagonale Anordnung der Kohlenstoffatome, ein Durchmesser von bis zu 100 nm und Längen typischerweise im µm-bereich. Mehrwandige CNTs sind typischerweise metallisch und zeichnen sich durch ihre sehr hohe Stromleitfähigkeit sowie ihre hohe mechanische Stabilität aus. Voraussetzung zur CNT-Synthese ist das Vorhandensein einer dünnen Schicht aus einer der katalytisch wirkenden ferromagnetischen Metalle Nickel, Kobalt oder Eisen. Anforderungen an MEAs Neben der notwendigen Biokompatibilität und -stabilität sowohl der Mikroelektroden als auch der restlichen MEA-Oberfläche sind eine möglichst geringe Impedanz und eine möglichst hohe Ladungsübertragungskapazität wünschenswerte Merkmale eines MEAs. Geringe Impedanzen gehen einher mit einem kleinen Grenzflächenrauschen und damit mit einem hohen Signal-Rausch- Als besonders geeignet zur Herstellung von multifunktionalen Elektroden gelten Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs, Carbon Nanotubes), da sie aufgrund ihrer besonderen Struktur große Grenzflächen ausbilden und besondere elektrochemische Eigenschaften haben. Abb. 1: Mikroelektroden-Array für elektrophysiologische Untersuchungen an Zellkulturen. Das Elektrodenfeld im Zentrum eines Kulturgefäßes ist über Leiterbahnen mit den außenliegenden Kontaktpads verbunden WOMag 1
2 Verhältnis. Eine hohe Ladungsübertragungskapazität ermöglicht eine effiziente elektrische Stimulation mit kleiner Spannung, was zur Vermeidung unerwünschter, irreversibler Grenzflächenreaktionen wünschenswert ist. Über elektrochemische Eigenschaften hinaus müssen die Elektroden eine gute Haftfestigkeit auf dem Substrat aufweisen, damit sich die MEAs nach einem Experiment mit einer Zellkultur reinigen und sterilisieren und somit wiederverwenden lassen. Fertigung und Experimente Als Ausgangssystem und MEA-Referenz diente ein Standard-MEA mit 59 Arbeitselektroden aus kolumnaren Titannitrid (TiN) mit einem Durchmesser von je 30 µm in einem Abstand von 200 µm in quadratischer 8 x 8-Anordnung, sowie eine Referenzelektrode auf. Die Elektroden sind über Titanleiterbahnen mit am Rande des Float-Glassubstrates (Größe 5 cm x 5 cm) angeordneten Kontaktpads verbunden. Als Isolator kommt eine Siliziumnitrid (SiN)-Schicht zum Einsatz. Die Strukturierung des Leiterbahn- Elektroden-Systems und der Isolatorschicht erfolgt photolithographisch mit nasschemischen Ätzverfahren der Leiterbahnen und trockenchemischen Ätzverfahren des Isolators. Für die Versuche zur Synthese von CNTs wurden TiN-Elektroden auf einem temperaturstabilen Quarzglas abgeschieden. Der ursprüngliche Leiterbahn-Isolator-Aufbau erwies sich dabei jedoch als nicht geeignet, da aufgrund der bei der Synthese auftretenden Temperaturen in Höhe von 600 C bis 650 C die Isolationsschicht aufbrach. Die Ursache hierfür ist eine Kombination aus recht unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (a Ti = 10, /K [2], a SiN = 1, /K [3]) und aus der Tatsache, dass bei hohen Temperaturen Wasserstoff aus der Siliziumnitridschicht herausdiffundiert, welcher das Auftreten von Rissen begünstigt [4]. Zur Lösung dieses Problems wurde ein temperaturstabiles Leiterbahn-Isolatorschichtsystem mit TiN-Leiterbahnen und SiO x -Isolatorschicht entwickelt (Abb. 2). Diese beiden Materialien haben mit a TiN = 9, /K [5] und a SiO = 8, /K [6] deutlich näher beieinander liegende thermische Ausdehnungskoeffizienten. Dieses Schichtsystem blieb auch nach dem Hochheizen auf bis zu 900 C mechanisch stabil und behält auch nach dieser thermischen Belastung seine Abb. 2: Prozessschema der MEA-Herstellung. 1.) Aufsputtern von TiN, 2.) Belacken, Belichten und Entwickeln der 1. Photolackschicht, 3.) Strukturierung der Leiterbahnen via Trockenätzen, 4.) Abscheiden einer SiO-Schicht, 5.) Belacken, Belichten und Entwickeln der 2. Photolackschicht, 6.) Strukturierung des Isolators, 7.) Abdecken der freigeätzten Kontaktpads mit Photolack, 8.) Aufsputtern des Katalysators, 9.) Lift-Off des Katalysators, 10.) Synthese der CNT-Elektroden und 11.) Anwenden eines O 2 -Plasmas 2 WOMag
3 Abb. 3: Anlagenschema des um einen Keramikheizer erweiterten Vakuumrezipienten Isolationseigenschaften. Das Titannitrid hat zudem die zur CNT-Synthese notwendige Eigenschaft einer Diffusionsbarriere für die Katalysatorschicht. Das Titannitrid wurde in einer PVD-Anlage reaktiv auf die Quarzglassubstrate aufgesputtert. Zur Strukturierung des Titannitrids in Leiterbahn-, Elektroden- und Kontaktpad- Struktur wurde nach erfolgter Strukturierung der Lackmaske ein neu entwickelter Trockenätzprozess angewandt. Zum Entfernen des Lackes wurden die Substrate für mindestens 12 Stunden in 80 C heißes Lösungsmittel eingelegt. Die SiO x -Isolatorschicht stammt aus einem plasmaverstärkten CVD (PECVD-) Prozess mit Distickstoffmonoxid (N 2 O) und Monosilan (SiH 4 ) als Ausgangsstoffen. Die Strukturierung der Isolatorschicht, das heißt die Öffnung der Isolatorschicht über Elektroden und Kontaktpads, erfolgte ebenfalls mittels eines Trockenätzprozesses. Der zur CNT- Synthese notwendige Katalysator wurde nach dem Abdecken der Kontaktpads auf das MEA-Substrat aufgesputtert. Es wurden hierfür 10 nm Nickel verwendet, welche über einen finalen Lift-Off-Prozess in einer Acetonlösung derart strukturiert wurden, dass nur die Elektrodenfläche mit Nickel versehen ist. Die Strukturierung der Katalysatorschicht entspricht der Strukturierung der CNT-Schicht. Die CNT-Synthese erfolgte in einem modifizierten Vakuumrezipienten, welcher hierfür mit einem von einem Trenntransformator gespeisten Keramikheizelement nachgerüstet wurde (Abb. 3 Anlagenschema). Die Temperaturmessung erfolgt über ein Thermoelement vom Typ K (NiCr-Ni). Die CNT-Synthese erfolgt nach Hochheizen des MEA-Substrates auf eine Temperatur von 630 C in einer Ammoniak-Acetylen- (NH 3 - C 2 H 2 ) Gasatmosphäre. Eine 5-minütige Prozessdauer resultiert bei diesen Parametern in einer CNT-Höhe von etwa 15 µm (Abb. 4 und Abb. 5). In einem letzten Prozessschritt wird mittig auf das MEA-Substrat ein Glasring aufgeklebt, welcher in späteren Versuchen als Zellkulturgefäß dient. Charakterisierung Zur Charakterisierung der CNT-Elektroden wurden deren Impedanz bei der Frequenz von 1 khz und deren Ladungsübertrag bei Spannungspulsen bis 1 V gemessen. Hierzu wird der Verlauf des Stromes während eines 500 µs langen Spannungspulses gemessen. Das Zeitintegral dieses Stromverlaufes entspricht der übertragenen Ladung. Ihr Maximalwert Q max am Ende des Pulses wird zur Charakterisierung von Stimulationselektroden herangezogen. Vor diesen elektrochemischen Messungen wurden die CNT-Elektroden für 1 Sekunde einem O 2 -Plasma ausgesetzt. Grund hierfür ist eine dünne Schicht amorphen Kohlenstoffs, welche unmittelbar nach der Synthese die CNTs umgibt und zu hohen Impedanzwerten führt [7]. Das O 2 -Plasma ätzt diese Kohlenstoffschicht weg und erniedrigt die Impedanzen um eine Größenordnung. Für MEAs mit CNT-Elektroden (CNT-MEA) wurde eine Impedanz in Höhe von 20 kω gemessen. Im Vergleich hierzu liegt die Impedanz von Standard-MEAs mit TiN-Elektroden unter gleichen Messbedingungen bei 40 kω. Eine ähnlich deutliche Verbesserung zeigt sich bei den vergleichenden Messwerten des maximalen Ladungsübertrages: Hier erreichen CNT-Elektroden einen Ladungsübertrag von 10,1 nc anstatt 5,9 nc bei TiN-Elektroden (Abb. 6). Zur Überprüfung der Biokompatibilität und der Tauglichkeit der CNT-MEAs zum Aufzeichnen extrazellulärer elektrischer Signale wurden Zellkulturtests durchgeführt. Hierfür wurden Kulturen von Neuronen aus dissoziierten Hirnpräparaten von Ratten auf den MEAs verwendet. Zuvor wurde der CNT-MEA zur Sterilisation für 12 Stunden UV-Licht ausgesetzt. Die Zellen wurden in das Zellkulturgefäß auf dem CNT-MEA einpipettiert, bei 37 C in einem Brutschrank gelagert und drei mal pro Woche zum Wech WOMag 3
4 Aktivität in der Multi-Elektroden-Ableitung in Abbildung 9 und Abbildung 10 zeigt. Die Biokompatibilität sowohl der neu verwendeten SiO x -Isolatoroberfläche als auch der CNT-Elektroden und deren generelle Tauglichkeit für die Verwendung in neuronalen Zellkulturen kann somit als gegeben betrachtet werden. In einer weiteren Versuchsreihe wurde ein CNT-MEA autoklaviert und im Anschluss seine Impedanz gemessen. Diese war im Vergleich zur anfänglichen Impedanz vor dem Autoklavieren um etwa 20 % erhöht, blieb jedoch deutlich unter der für die MEA-Tauglichkeit akzeptierten Grenze von 100 kω. In zwei weiteren Autoklaviervorgängen blieb die Impedanz auf diesem Niveau stabil und erhöhte sich nicht weiter. Zusammenfassung Abb. 4: CNT-Mikroelektrodenarray in 150-facher Vergrößerung nach Synthese der CNT-Elektroden Für neuronale MEA-Anwendungen wurden CNTs zur Nutzung als Mikroelektrode synthetisiert. Aufgrund der hohen Temperaturen (630 C) bei der Synthese kam statt des konventionellen, nicht-temperaturstabilen Ti-SiN Leiterbahn-Isolator-Schichtsystems der MEAs ein neu entwickeltes, temperaturstabiles TiN-SiO x Leiterbahn- Isolator-Schichtsystem samt dazugehöriger neu entwickelter Lithographieprozesse zum Einsatz. Elektrochemische Messungen der CNT-Elektroden ergaben eine um 50 % verringerte Impedanz bei gleichzeitig 71 % höherem maximalen Ladungsübertrag im Vergleich zu TiN-Elektroden. Der CNT-MEA erwies sich in 12-wöchigen Zellkulturtests mit Nervenzellen biokompatibel. Netzwerkbildung der Neuronen und deren gut messbare elektrische Zellaktivität belegen die Tauglichkeit von CNT-Elektroden für neuronale MEA-Anwendungen. Die CNT-MEA lassen sich autoklavieren und sind somit wiederverwendbar. Literatur [1] A. Stett, U. Egert, E. Guenther, F. Hofmann, T. Meyer, W. Nisch, H. Haemmerle: Biological application of microelectrode arrays in drug discovery and basic research, Analytical and bioanalytical chemistry, 377(3): , 2003 Abb. 5: Nahaufnahme einer CNT-Elektrode [8] sel des Nährmediums sowie für Messungen zellulärer Aktivität aus dem Brutschrank herausgenommen (Abb. 7). Die Zellkultur auf dem CNT-MEA konnte für den verhältnismäßig langen Zeitraum von 12 Wochen aufrecht erhalten werden. Die Neuronen zeigten während dieser Zeit messbare elektrische Zellaktivität, so genannte Spikeaktivität (Abb. 8). Die kultivierten Nervenzellen bilden auf den CNT-MEAs Netzwerke aus, was sich an der synchronen [2] K. Akagi, Y. Okamoto, T. Matsuura, T. Horibe: Properties of test metal ceramic titanium alloys, the Journal of prosthetic dentistry, 68(3): , 1992 [3] T. F. Retajczyk, A. K. Sinha, et al.: Elastic stiffness and thermal expansion coefficients of various refractory silicides and silicon nitride fims, Thin Solid Films, 70(2): , 1980 [4] M. Gupta, V. K. Rathi, R. Thangaraj, O. P. Agnihotri, K. S. Chari: The preparation, properties and applications of silicon nitride thin fims deposited by plasma-enhanced chemical vapor deposition, Thin Solid Films, 204(1):77-106, 1991 [5] J. Mukerji, S. K. Biswas: Synthesis, properties, and oxidation of alumina-titanium nitride composites, Journal of the American Ceramic Society, 73(1): , WOMag
5 Abb. 6: Maximaler Ladungsübertrag Q max von CNT- und TiN-Elektroden (jeweils 30 µm Durchmesser) in Abhängigkeit von der Amplitude mit Spannungspulsen von 500 µs Dauer. Bei der Spannung von +1 V ist der maximale Ladungsübertrag einer CNT-Elektrode mit 10,1 nc im Vergleich zur herkömmlichen TiN-Elektrode mit 5,9 nc um 71 % erhöht [8] Abb. 7: Schematische Darstellung eines MEA mit Zellkulturgefäß, Zellkultur und Elektrolytlösung (PBS, Phosphate Buffered Saline) Abb. 8: Elektrische Aktivität von kultivierten Nervenzellen (Kortexneurone, Ratte), gemessen mit einem CNT-MEA. Die Spannungsspitzen (Spikes) in Höhe von -40 µv bis +40 µv lassen sich klar vom 10 µv starken Rauschlevel unterscheiden. Mit diesen Werten ergibt sich ein Signal-zu-Rausch- Verhältnis von 8:1 (peak-to-peak) [8] WOMag 5
6 Abb. 9: Multi-Elektroden-Ableitung mit einem CNT-MEA. In der unteren Bildhälfte markieren die Punkte die Spikes, die mit den 59 Elektroden des MEAs während eines Zeitfensters von 300 s gemessen wurden. Die Nummerierung der vertikalen Achse (1 bis 60) entspricht der Anzahl der Elektroden (59 Arbeitselektroden + Referenzelektrode). In der oberen Bildhälfte wurden die Spikes aller Elektroden in einem Histogramm zusammengefasst, um synchrone Aktivität im Netzwerk zu ermitteln. Die Messung wurde zwei Wochen nach dem Anlegen der Zellkultur vorgenommen. Die Vernetzung der Neurone ist hier noch unvollständig: Nicht auf allen Elektroden ist gleichzeitig ein Spike messbar Abb. 10: Histogramm der gemessenen Spikeaktivität sieben Wochen nach dem Anlegen der Zellkultur auf einem CNT-MEA, gemessen in einem Zeitfenster von 300 s. Hier ist im Vergleich zu Abbildung 9 eine ausgeprägte Vernetzung der Neurone zu erkennen: Nahezu alle Elektroden registrieren gleichzeitig Spike-Aktivität oder gleichzeitig keine Spike-Aktivität [6] F. Jansen, M. A. Machonkin, N. Palmieri, D. Kuhman: Thermal expansion and elastic properties of plasma-deposited amorphous silicon and silicon oxide fims, Applied physics letters, 50(16): , 1987 [7] H. C. Su, C. M. Lin, S. J. Yen, Y. C. Chen, C. H. Chen, S. R. Yeh, W. Fang, H. Chen, D. J. Yao, Y. C. Chang, et al.: A cone-shaped 3d carbon nanotube probe for neural recording, Biosensors and Bioelectronics, 26(1): , 2010 [8] B. Stamm, K. Schneider, T. Herrmann, M. Fleischer, C. Burkhardt, W. Nisch, D. P. Kern, A. Stett: Carbon nanotube electrodes for neuronal recording and stimulation, Proceedings MEA Meeting 2012, , 2012 Kontakt: boris.stamm@nmi.de DOI: /2012/Stamm1 6 WOMag
Kapitel 4.5. Nanoporöses Alumimiumoxid (AAO*)
 Kapitel 4.5. Nanoporöses Alumimiumoxid (AAO*) Prozessfolge Am Beispiel: Metallische Nanodrähte in AAO 1. Herstellung von Templaten mit Nanoporen in Aluminiumoxid durch nasschemisches Ätzen mit äußerer
Kapitel 4.5. Nanoporöses Alumimiumoxid (AAO*) Prozessfolge Am Beispiel: Metallische Nanodrähte in AAO 1. Herstellung von Templaten mit Nanoporen in Aluminiumoxid durch nasschemisches Ätzen mit äußerer
Solarzellen aus Si-Drähten
 Solarzellen aus Si-Drähten Fabian Schmid-Michels fschmid-michels@uni-bielefeld.de Universität Bielefeld Vortrag im Nanostrukturphysik 2 Seminar 31. Mai 2010 1 / 27 Überblick 1 Einführung Motivation 2 Herkömmliche
Solarzellen aus Si-Drähten Fabian Schmid-Michels fschmid-michels@uni-bielefeld.de Universität Bielefeld Vortrag im Nanostrukturphysik 2 Seminar 31. Mai 2010 1 / 27 Überblick 1 Einführung Motivation 2 Herkömmliche
Optimierung der Analytik nanostrukturierter Schichten
 Projektverbund Umweltverträgliche Anwendungen der Nanotechnologie Zwischenbilanz und Fachtagung, 27. Februar 2015 Wissenschaftszentrum Straubing Optimierung der Analytik nanostrukturierter Schichten Prof.
Projektverbund Umweltverträgliche Anwendungen der Nanotechnologie Zwischenbilanz und Fachtagung, 27. Februar 2015 Wissenschaftszentrum Straubing Optimierung der Analytik nanostrukturierter Schichten Prof.
Peter Iskra (Autor) Entwicklung von siliziumbasierten Transistoren für den Einsatz bei hohen Temperaturen in der Gassensorik
 Peter Iskra (Autor) Entwicklung von siliziumbasierten Transistoren für den Einsatz bei hohen Temperaturen in der Gassensorik https://cuvillier.de/de/shop/publications/89 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Peter Iskra (Autor) Entwicklung von siliziumbasierten Transistoren für den Einsatz bei hohen Temperaturen in der Gassensorik https://cuvillier.de/de/shop/publications/89 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Precursoren zur Plasmajetbeschichtung
 Precursoren zur Plasmajetbeschichtung Manuela Janietz, Thomas Arnold, Leipzig 1 Gliederung Literaturübersicht Versuchsaufbau Precursoren und Schichtcharakterisierung -SiO 2 -ah-cn x Zusammenfassung 2 Überblick
Precursoren zur Plasmajetbeschichtung Manuela Janietz, Thomas Arnold, Leipzig 1 Gliederung Literaturübersicht Versuchsaufbau Precursoren und Schichtcharakterisierung -SiO 2 -ah-cn x Zusammenfassung 2 Überblick
Quanteneffekte in Nanostrukturen
 Quanteneffekte in Nanostrukturen Physik Oscar 2001 Thomas Berer 04.04.2002 Nanostrukturen nano Physik Oscar 2001 griech.: Zwerg Prefix: 10-9 1nm = 1 Milliardstel Meter Nanostrukturen Strukturen zwischen
Quanteneffekte in Nanostrukturen Physik Oscar 2001 Thomas Berer 04.04.2002 Nanostrukturen nano Physik Oscar 2001 griech.: Zwerg Prefix: 10-9 1nm = 1 Milliardstel Meter Nanostrukturen Strukturen zwischen
Metallkatalysierte Herstellung von Nanostrukturen aus Fullerenen
 Metallkatalysierte Herstellung von Nanostrukturen aus Fullerenen Henning Kanzow Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 1 Inhaltsverzeichnis VORWORT. 1. KOHLENSTOFF. 1.1 MODIFIKATIONEN 3 1.1.1 GRAPHIT 3
Metallkatalysierte Herstellung von Nanostrukturen aus Fullerenen Henning Kanzow Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 1 Inhaltsverzeichnis VORWORT. 1. KOHLENSTOFF. 1.1 MODIFIKATIONEN 3 1.1.1 GRAPHIT 3
ELEMENT ELektromechanische sensoren Mit Eindimensionalen NanoobjekTen
 ELEMENT ELektromechanische sensoren Mit Eindimensionalen NanoobjekTen Helmut F. Schlaak, Jörg J. Schneider, Dimitris Pavlidis, Franko Küppers, Wolfgang Ensinger Statusmeeting MNI, 18. und 19. Juni, Berlin,
ELEMENT ELektromechanische sensoren Mit Eindimensionalen NanoobjekTen Helmut F. Schlaak, Jörg J. Schneider, Dimitris Pavlidis, Franko Küppers, Wolfgang Ensinger Statusmeeting MNI, 18. und 19. Juni, Berlin,
Abschlussbericht. Prof. Regina Palkovits, Tanja Franken (M. Sc.)
 Abschlussbericht Struktur-Aktivitätsbeziehungen von Cu x Co 3-x O 4 Spinellen als Katalysatoren in der katalytischen Zersetzung von N 2 O 1. Einleitung und Motivation Prof. Regina Palkovits, Tanja Franken
Abschlussbericht Struktur-Aktivitätsbeziehungen von Cu x Co 3-x O 4 Spinellen als Katalysatoren in der katalytischen Zersetzung von N 2 O 1. Einleitung und Motivation Prof. Regina Palkovits, Tanja Franken
4. Nanostrukturierte Elektroden
 4. Nanostrukturierte Elektroden Vorstellung des Instituts Forschungsthemen und Methoden Ziele Prof. J. Bachmann, FAU Erlangen Nürnberg Folie 0/125 23/11/2012 Standort Erlangen in der Material und Energieforschung
4. Nanostrukturierte Elektroden Vorstellung des Instituts Forschungsthemen und Methoden Ziele Prof. J. Bachmann, FAU Erlangen Nürnberg Folie 0/125 23/11/2012 Standort Erlangen in der Material und Energieforschung
GD-OES Kalibrationen für die Analyse dünner Schichten in der siliziumbasierten Photovoltaik: Herausforderungen und Lösungen
 GD-OES Kalibrationen für die Analyse dünner Schichten in der siliziumbasierten Photovoltaik: Herausforderungen und Lösungen Jonathan Steffens Anwendertreffen Analytische Glimmentladungsspektrometrie, Bremen,
GD-OES Kalibrationen für die Analyse dünner Schichten in der siliziumbasierten Photovoltaik: Herausforderungen und Lösungen Jonathan Steffens Anwendertreffen Analytische Glimmentladungsspektrometrie, Bremen,
Chemische Synthese von Keramik- und Kompositfasern mittels Elektrospinnen und CVD zur Anwendung als Anodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien
 Chemische Synthese von Keramik- und Kompositfasern mittels Elektrospinnen und CVD zur Anwendung als Anodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der
Chemische Synthese von Keramik- und Kompositfasern mittels Elektrospinnen und CVD zur Anwendung als Anodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der
Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs. Ein Vortrag von Julian Franzgrote, Thorben Hagedorn und Niklas Weitkemper
 Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs Ein Vortrag von Julian Franzgrote, Thorben Hagedorn und Niklas Weitkemper 1 Inhaltsverzeichnis Allotropie Übersicht Diamant Graphit Graphen Fullerene Carbon Nanotubes
Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs Ein Vortrag von Julian Franzgrote, Thorben Hagedorn und Niklas Weitkemper 1 Inhaltsverzeichnis Allotropie Übersicht Diamant Graphit Graphen Fullerene Carbon Nanotubes
Polymer- Carbon Nanotube- Komposite. Lysander Jankowsky (136309)
 Polymer- Carbon Nanotube- Komposite Lysander Jankowsky (136309) Lysander.jankowsky@uni-jena.de Gliederung Was sind Carbon Nanotubes (CNTs) Herstellung von CNTs Funktionalisierung von CNTs - Defekt- Funktionalität
Polymer- Carbon Nanotube- Komposite Lysander Jankowsky (136309) Lysander.jankowsky@uni-jena.de Gliederung Was sind Carbon Nanotubes (CNTs) Herstellung von CNTs Funktionalisierung von CNTs - Defekt- Funktionalität
3ω Messung an dünnen Schichten Eine Unsicherheitsanalyse
 Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.v. 3ω Messung an dünnen Schichten Eine Unsicherheitsanalyse S. Rausch AK Thermophysik, Graz 2012 3ω METHODE - PRINZIP Messverfahren zur Bestimmung
Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.v. 3ω Messung an dünnen Schichten Eine Unsicherheitsanalyse S. Rausch AK Thermophysik, Graz 2012 3ω METHODE - PRINZIP Messverfahren zur Bestimmung
C a r b o S c a l e. Optimierte Katalysatoren für die Synthese von SW/DW-Carbon Nanotubes
 Entwicklung von Katalysatoren zur Synthese von SW/DW-CNTs Optimierte Katalysatoren für die Synthese von SW/DW-Carbon Nanotubes Manfred Ritschel, Albrecht Leonhardt IFW Dresden Zielstellung: Synthese von
Entwicklung von Katalysatoren zur Synthese von SW/DW-CNTs Optimierte Katalysatoren für die Synthese von SW/DW-Carbon Nanotubes Manfred Ritschel, Albrecht Leonhardt IFW Dresden Zielstellung: Synthese von
Pilotproduktion von CIS-Dünnschichtsolarmodulen: Status und TCO-Aspekte
 Pilotproduktion von CIS-Dünnschichtsolarmodulen: Status und TCO-Aspekte 1. Einleitung Rolf Wächter, Michael Powalla ZSW rolf.waechter@zsw-bw.de Bernhard Dimmler Würth Solar GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße
Pilotproduktion von CIS-Dünnschichtsolarmodulen: Status und TCO-Aspekte 1. Einleitung Rolf Wächter, Michael Powalla ZSW rolf.waechter@zsw-bw.de Bernhard Dimmler Würth Solar GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße
Höchste Effizienz durch dünnste Schichten als Schutz von elektronischen Schaltungen unter harschen Umgebungen
 Höchste Effizienz durch dünnste Schichten als Schutz von elektronischen Schaltungen unter harschen Umgebungen Prof. Dr. Volker Bucher, HFU und Steinbeis-Transferzentrum Oberflächen- und Beschichtungstechnik
Höchste Effizienz durch dünnste Schichten als Schutz von elektronischen Schaltungen unter harschen Umgebungen Prof. Dr. Volker Bucher, HFU und Steinbeis-Transferzentrum Oberflächen- und Beschichtungstechnik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente. Prof. Dr.-Ing. H. Ryssel. vhb-kurs Halbleiterbauelemente
 Friedrich-Alexander-Universität Prof. Dr.-Ing. H. Ryssel vhb-kurs Halbleiterbauelemente Übungsaufgaben Teil 3: Feldeffekttransistoren Übung zum vhb-kurs Halbleiterbauelemente Seite 15 Feldeffekttransistoren
Friedrich-Alexander-Universität Prof. Dr.-Ing. H. Ryssel vhb-kurs Halbleiterbauelemente Übungsaufgaben Teil 3: Feldeffekttransistoren Übung zum vhb-kurs Halbleiterbauelemente Seite 15 Feldeffekttransistoren
HVG-Mitteilung Nr Modifikation von Glasoberflächen mit Metallhalogeniden und Ammoniumverbindungen
 HVG-Mitteilung Nr. 2136 Modifikation von Glasoberflächen mit Metallhalogeniden und Ammoniumverbindungen A. Nadolny, TU Bergakademie Freiberg Vortrag in der gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse II und
HVG-Mitteilung Nr. 2136 Modifikation von Glasoberflächen mit Metallhalogeniden und Ammoniumverbindungen A. Nadolny, TU Bergakademie Freiberg Vortrag in der gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse II und
Die Herstellung von Mikrostrukturen mittels selektiver Laserablation mit ultrakurzen Laserpulsen und deep-uv Strahlquellen
 Die Herstellung von Mikrostrukturen mittels selektiver Laserablation mit ultrakurzen Laserpulsen und deep-uv Strahlquellen Dr. Sandra Stroj DOMIT 8/6/2010 Laserquellen am FZMT Excimerlaser Ultrakurzpulslaser
Die Herstellung von Mikrostrukturen mittels selektiver Laserablation mit ultrakurzen Laserpulsen und deep-uv Strahlquellen Dr. Sandra Stroj DOMIT 8/6/2010 Laserquellen am FZMT Excimerlaser Ultrakurzpulslaser
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
Magnetische Eigenschaften von periodisch angeordneten Nanopartikeln aus Nickel
 Naturwissenschaft Martina Meincken Magnetische Eigenschaften von periodisch angeordneten Nanopartikeln aus Nickel Diplomarbeit Magnetische Eigenschaften von periodisch angeordneten Nanopartikeln aus Nickel
Naturwissenschaft Martina Meincken Magnetische Eigenschaften von periodisch angeordneten Nanopartikeln aus Nickel Diplomarbeit Magnetische Eigenschaften von periodisch angeordneten Nanopartikeln aus Nickel
1 Metallisierung. 1.1 Mehrlagenverdrahtung Mehrlagenverdrahtung BPSG-Reflow. 1.1 Mehrlagenverdrahtung
 1 Metallisierung 1.1 Mehrlagenverdrahtung 1.1.1 Mehrlagenverdrahtung Die Verdrahtung kann in einer integrierten Schaltung über 80 % der Chipfläche einnehmen, darum wurden Techniken entwickelt, mit denen
1 Metallisierung 1.1 Mehrlagenverdrahtung 1.1.1 Mehrlagenverdrahtung Die Verdrahtung kann in einer integrierten Schaltung über 80 % der Chipfläche einnehmen, darum wurden Techniken entwickelt, mit denen
Hahn-Meitner-Institut Berlin
 Nickel-induzierte schnelle Kristallisation reaktiv gesputterter Wolframdisulfid-Schichten Stephan Brunken, Rainald Mientus, Klaus Ellmer Hahn-Meitner-Institut Berlin Abteilung Solare Energetik (SE 5) Arbeitsgruppe
Nickel-induzierte schnelle Kristallisation reaktiv gesputterter Wolframdisulfid-Schichten Stephan Brunken, Rainald Mientus, Klaus Ellmer Hahn-Meitner-Institut Berlin Abteilung Solare Energetik (SE 5) Arbeitsgruppe
Nanotubes. Bauelemente für eine neue Nanoelektronik. Moritz Bubek
 Nanotubes Bauelemente für eine neue Nanoelektronik Moritz Bubek Übersicht Struktur von Nanotubes Defekte an Nanotubes klassischer Schottky-Effekt Elektrische Eigenschaften von SWNTs SWNT-Schottky-Diode
Nanotubes Bauelemente für eine neue Nanoelektronik Moritz Bubek Übersicht Struktur von Nanotubes Defekte an Nanotubes klassischer Schottky-Effekt Elektrische Eigenschaften von SWNTs SWNT-Schottky-Diode
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG. Versuch: Elektrische Leitfähigkeit (Sekundarstufe I) Moduli: Physikalische Eigenschaften
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG Schülerlabor Science meets School Werkstoffe & Technologien in Freiberg Versuch: (Sekundarstufe I) Moduli: Physikalische Eigenschaften 1 Versuchsziel Die Messung
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG Schülerlabor Science meets School Werkstoffe & Technologien in Freiberg Versuch: (Sekundarstufe I) Moduli: Physikalische Eigenschaften 1 Versuchsziel Die Messung
REPORT. Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektromagnetischen Felder an verschiedenen elektrochirurgischen Generatoren.
 REPORT Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektromagnetischen Felder an verschiedenen elektrochirurgischen Generatoren Nummer 24 Forschungsbericht 1998 Messung und sicherheitstechnische
REPORT Messung und sicherheitstechnische Beurteilung der elektromagnetischen Felder an verschiedenen elektrochirurgischen Generatoren Nummer 24 Forschungsbericht 1998 Messung und sicherheitstechnische
Nanotechnologien: Chance für die Nachhaltigkeit?
 Nanotechnologien: Chance für die Nachhaltigkeit? Dr. Péter Krüger Bayer Jahrestagung des Öko-Institutes, Darmstadt 14. September 2010 Herausforderungen für die Gesellschaft Nanotechnologie ist eine Querschnittstechnologie
Nanotechnologien: Chance für die Nachhaltigkeit? Dr. Péter Krüger Bayer Jahrestagung des Öko-Institutes, Darmstadt 14. September 2010 Herausforderungen für die Gesellschaft Nanotechnologie ist eine Querschnittstechnologie
Nichtlineare Absorption von ultra-kurzen Laserimpulsen in dünnen dielektrischen Schichten - Kann eine Laserstrukturierung schädigungsfrei sein?
 Nichtlineare Absorption von ultra-kurzen Laserimpulsen in dünnen dielektrischen Schichten - Kann eine Laserstrukturierung schädigungsfrei sein? Gerrit Heinrich CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik
Nichtlineare Absorption von ultra-kurzen Laserimpulsen in dünnen dielektrischen Schichten - Kann eine Laserstrukturierung schädigungsfrei sein? Gerrit Heinrich CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik
Einblick in die Nanotoxikologie: erste zytotoxikologische Ergebnisse von Nanopartikeln
 Ma te ria ls Sc ie nc e &Te c hnolo gy Einblick in die Nanotoxikologie: erste zytotoxikologische Ergebnisse von Nanopartikeln Dr. Peter Wick, Pius Manser, Philipp Spohn, Dr. Arie Bruinink Materials-Biology
Ma te ria ls Sc ie nc e &Te c hnolo gy Einblick in die Nanotoxikologie: erste zytotoxikologische Ergebnisse von Nanopartikeln Dr. Peter Wick, Pius Manser, Philipp Spohn, Dr. Arie Bruinink Materials-Biology
Marina Fabry LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
 Self-Assembled Nanoparticle Probes for Recognition and Detection of Biomolecules Dustin J. Maxwell, Jason R. Taylor & Shuming Nie Journal of the American Chemical Society 2002 Marina Fabry LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
Self-Assembled Nanoparticle Probes for Recognition and Detection of Biomolecules Dustin J. Maxwell, Jason R. Taylor & Shuming Nie Journal of the American Chemical Society 2002 Marina Fabry LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
Beschichtungen mit Polyparylen durch (plasmaunterstützte) Dampfabscheidung
 Beschichtungen mit Polyparylen durch (plasmaunterstützte) Dampfabscheidung Gerhard Franz mailto:info @ plasmaparylene.de Kompetenzzentrum Nanostrukturtechnik FH München Plasma Parylene Coating Services,
Beschichtungen mit Polyparylen durch (plasmaunterstützte) Dampfabscheidung Gerhard Franz mailto:info @ plasmaparylene.de Kompetenzzentrum Nanostrukturtechnik FH München Plasma Parylene Coating Services,
11. ThGOT 2015. Funktionelle Beschichtungen auf Basis der Sol-Gel-Technik
 INNOVENT e.v. Technologieentwicklung Wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung Gründung 1994 11. ThGOT 2015 Funktionelle Beschichtungen auf Basis der Sol-Gel-Technik Grenz- und Oberflächentechnologie Biomaterialien
INNOVENT e.v. Technologieentwicklung Wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung Gründung 1994 11. ThGOT 2015 Funktionelle Beschichtungen auf Basis der Sol-Gel-Technik Grenz- und Oberflächentechnologie Biomaterialien
Dynamik des lokalen Strom/Spannungsverhaltens von Nafion-Membranen
 Dynamik des lokalen Strom/Spannungsverhaltens von Nafion-Membranen Präsentation der Ergebnisse der Aversumsprojekte 2009 Steffen ink a Wolfgang G. Bessler, b A. Masroor, b Emil Roduner a a Universität
Dynamik des lokalen Strom/Spannungsverhaltens von Nafion-Membranen Präsentation der Ergebnisse der Aversumsprojekte 2009 Steffen ink a Wolfgang G. Bessler, b A. Masroor, b Emil Roduner a a Universität
Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I
 Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I 1. Prinzipieller Aufbau eines Nervensystems 2. Zelltypen des Nervensystems 2.1 Gliazellen 2.2 Nervenzellen 3. Zellbiologie von Neuronen 3.1 Morphologische
Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I 1. Prinzipieller Aufbau eines Nervensystems 2. Zelltypen des Nervensystems 2.1 Gliazellen 2.2 Nervenzellen 3. Zellbiologie von Neuronen 3.1 Morphologische
PS II - Verständnistest
 Grundlagen der Elektrotechnik PS II - Verständnistest 31.03.2010 Name, Vorname Matr. Nr. Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 3 4 4 2 5 2 2 erreicht Aufgabe 8 9 10 11 Summe Punkte 2 4 3 4 35 erreicht Hinweise:
Grundlagen der Elektrotechnik PS II - Verständnistest 31.03.2010 Name, Vorname Matr. Nr. Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 3 4 4 2 5 2 2 erreicht Aufgabe 8 9 10 11 Summe Punkte 2 4 3 4 35 erreicht Hinweise:
Allotrope Kohlenstoffmodifikationen
 Übersicht Was ist Allotropie? Graphit Diamant Lonsdaleit Fullerene Carbon Nanotubes 2 Allotropie unterschiedliche Modifikationen eines Elements unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften
Übersicht Was ist Allotropie? Graphit Diamant Lonsdaleit Fullerene Carbon Nanotubes 2 Allotropie unterschiedliche Modifikationen eines Elements unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften
Funktionsschichten in kristallinen Solarmodulen
 Funktionsschichten in kristallinen Solarmodulen Dr. L. Bauch Conergy SolarModule GmbH & Co. KG Frankfurt (Oder) Inhalt Solarmodul - Fertigung bei Conergy SolarModule GmbH & Co. KG Frankfurt (Oder) Solarmodul
Funktionsschichten in kristallinen Solarmodulen Dr. L. Bauch Conergy SolarModule GmbH & Co. KG Frankfurt (Oder) Inhalt Solarmodul - Fertigung bei Conergy SolarModule GmbH & Co. KG Frankfurt (Oder) Solarmodul
Labor für Mikrosystemtechnik Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik
 Fakultät angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik Prof. Dr.-Ing. Christina Schindler Übersicht Praktika Projektstudien Bachelor- und Masterarbeiten Dissertation Titel Präsentation wieholt (Ansicht
Fakultät angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik Prof. Dr.-Ing. Christina Schindler Übersicht Praktika Projektstudien Bachelor- und Masterarbeiten Dissertation Titel Präsentation wieholt (Ansicht
E5: Faraday-Konstante
 E5: Faraday-Konstante Theoretische Grundlagen: Elektrischer Strom ist ein Fluss von elektrischer Ladung; in Metallen sind Elektronen die Ladungsträger, in Elektrolyten übernehmen Ionen diese Aufgabe. Befinden
E5: Faraday-Konstante Theoretische Grundlagen: Elektrischer Strom ist ein Fluss von elektrischer Ladung; in Metallen sind Elektronen die Ladungsträger, in Elektrolyten übernehmen Ionen diese Aufgabe. Befinden
Versuch Kalibrierung eines Beschleunigungssensor
 Versuch Kalibrierung eines Beschleunigungssensor Vorbereitende Aufgaben: Diese Aufgaben dienen der Vorbereitung auf den Praktikumsversuch, der Sie mit den grundlegenden Messgeräten und einigen Messprinzipien
Versuch Kalibrierung eines Beschleunigungssensor Vorbereitende Aufgaben: Diese Aufgaben dienen der Vorbereitung auf den Praktikumsversuch, der Sie mit den grundlegenden Messgeräten und einigen Messprinzipien
Möglichkeiten zum Erfassen der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen
 Möglichkeiten zum Erfassen der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen Hofmann, S. Für die Messung der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) im Versuch und laufendem Betrieb existieren
Möglichkeiten zum Erfassen der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen Hofmann, S. Für die Messung der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) im Versuch und laufendem Betrieb existieren
Herstellung, Eigenschaften und Anwendungen technischer Schichten auf textilen Trägern
 Herstellung, Eigenschaften und Anwendungen technischer Schichten auf textilen Trägern Gudrun Andrä Jonathan Plentz, Guobin Jia, Annett Gawlik, Gabriele Schmidl, K. Richter* LeibnizInstitut für Photonische
Herstellung, Eigenschaften und Anwendungen technischer Schichten auf textilen Trägern Gudrun Andrä Jonathan Plentz, Guobin Jia, Annett Gawlik, Gabriele Schmidl, K. Richter* LeibnizInstitut für Photonische
Sputtern von aluminium dotierten Zinkoxid -Schichten mit dem Rotatable-Magnetron
 Sputtern von aluminium dotierten Zinkoxid -Schichten mit dem Rotatable-Magnetron Einleitung M. Dimer dimer.martin@ vonardenne.biz A. Köhler J. Strümpfel VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH Transparentes und
Sputtern von aluminium dotierten Zinkoxid -Schichten mit dem Rotatable-Magnetron Einleitung M. Dimer dimer.martin@ vonardenne.biz A. Köhler J. Strümpfel VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH Transparentes und
Versuchsprotokoll. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik. Versuch O8: Fraunhofersche Beugung Arbeitsplatz Nr.
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum I Versuchsprotokoll Versuch O8: Fraunhofersche Beugung Arbeitsplatz Nr. 1 0. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum I Versuchsprotokoll Versuch O8: Fraunhofersche Beugung Arbeitsplatz Nr. 1 0. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.
Elektrisches Feld. Aufgabe und Material. Lehrer-/Dozentenblatt. Lehrerinformationen. Zusätzliche Informationen. Lernziel.
 Lehrer-/Dozentenblatt Elektrisches Feld Aufgabe und Material Lehrerinformationen Zusätzliche Informationen Lernziel In diesem Versuch sollen sich die Schüler mit den Begriffen Äquipotentiallinie und Feldlinie
Lehrer-/Dozentenblatt Elektrisches Feld Aufgabe und Material Lehrerinformationen Zusätzliche Informationen Lernziel In diesem Versuch sollen sich die Schüler mit den Begriffen Äquipotentiallinie und Feldlinie
Analyse der Messfehler einer Mikrowaage bei der Inline-Schichtdickenbestimmung auf Silizium-Wafern
 Analyse der Messfehler einer Mikrowaage bei der Inline-Schichtdickenbestimmung auf Silizium-Wafern Belegverteidigung Dresden, 08.07.2007 Marco Gunia marco.gunia@gmx.de Gliederung Motivation der Aufgabenstellung
Analyse der Messfehler einer Mikrowaage bei der Inline-Schichtdickenbestimmung auf Silizium-Wafern Belegverteidigung Dresden, 08.07.2007 Marco Gunia marco.gunia@gmx.de Gliederung Motivation der Aufgabenstellung
Nanostrukturen für intelligente Implantate, Sensoren und Neurochips
 Das NMI ist Bündnispartner der Innovationsallianz Baden-Württemberg 23.11.2015 Deutschen Plattform NanoBioMedizin Prof. Dr. H. Hämmerle Nanostrukturen für intelligente Implantate, Sensoren und Neurochips
Das NMI ist Bündnispartner der Innovationsallianz Baden-Württemberg 23.11.2015 Deutschen Plattform NanoBioMedizin Prof. Dr. H. Hämmerle Nanostrukturen für intelligente Implantate, Sensoren und Neurochips
Aufbringen eines Haftvermittlers und Entfernen von Wasser auf dem Wafer
 1 Lithografie 1.1 Belichten und Belacken 1.1.1 Übersicht In der Halbleiterfertigung werden Strukturen auf liciumscheiben mittels lithografischer Verfahren hergestellt. Dabei wird zuerst ein strahlungsempfindlicher
1 Lithografie 1.1 Belichten und Belacken 1.1.1 Übersicht In der Halbleiterfertigung werden Strukturen auf liciumscheiben mittels lithografischer Verfahren hergestellt. Dabei wird zuerst ein strahlungsempfindlicher
SILATHERM. Weitere Informationen finden Sie hier in unserem SILATHERM video
 SILATHERM Weitere Informationen finden Sie hier in unserem SILATHERM video INNOVATIVE WÄRMELEITFÄHIGE Die Anforderungen an neue und innovative Kunststoffe steigen immer weiter. Daher werden zukünftig wärmeleitende
SILATHERM Weitere Informationen finden Sie hier in unserem SILATHERM video INNOVATIVE WÄRMELEITFÄHIGE Die Anforderungen an neue und innovative Kunststoffe steigen immer weiter. Daher werden zukünftig wärmeleitende
Permeability prediction by NMR and SIP
 Permeability prediction by NMR and SIP A laboratory study Annick Fehr N.Klitzsch,, F. Bosch, C. Clauser Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University Kernmagnetische Resonanz Spins präzedieren
Permeability prediction by NMR and SIP A laboratory study Annick Fehr N.Klitzsch,, F. Bosch, C. Clauser Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University Kernmagnetische Resonanz Spins präzedieren
Einführung in die optische Nachrichtentechnik. Herstellung von Lichtwellenleitern (TECH)
 TECH/1 Herstellung von Lichtwellenleitern (TECH) Dieses Kapitel behandelt drei verschiedenen Verfahren zur Herstellung von Vorformen für Glasfasern: das OVD-Verfahren (outside vapour deposition), das VAD-Verfahren
TECH/1 Herstellung von Lichtwellenleitern (TECH) Dieses Kapitel behandelt drei verschiedenen Verfahren zur Herstellung von Vorformen für Glasfasern: das OVD-Verfahren (outside vapour deposition), das VAD-Verfahren
3D Konforme Präzisionsbeschichtungen für den Korrosionsschutz effektive Werkzeugbeschichtungen
 3D Konforme Präzisionsbeschichtungen für den Korrosionsschutz effektive Werkzeugbeschichtungen Gliederung Motivation Prozesstechnologie Schichtwerkstoffe Schichtaufbau Eigenschaften Entformungsverhalten
3D Konforme Präzisionsbeschichtungen für den Korrosionsschutz effektive Werkzeugbeschichtungen Gliederung Motivation Prozesstechnologie Schichtwerkstoffe Schichtaufbau Eigenschaften Entformungsverhalten
Untersuchungen zur lokalen Abscheidung von SiO x -Schichten mittels Plasmajet
 Untersuchungen zur lokalen Abscheidung von SiO x -Schichten mittels Plasmajet M. Janietz, Th. Arnold e.v. Permoserstraße 15, 04318 Leipzig 1 Inhalt Motivation Experimenteller Aufbau Plasma Abscheidung
Untersuchungen zur lokalen Abscheidung von SiO x -Schichten mittels Plasmajet M. Janietz, Th. Arnold e.v. Permoserstraße 15, 04318 Leipzig 1 Inhalt Motivation Experimenteller Aufbau Plasma Abscheidung
TCO-Schichten für die CIGS- Solarmodulproduktion
 TCO-Schichten für die CIGS- Solarmodulproduktion Die Firma Würth Solar GmbH & Co. KG hat im Jahre 2000 eine Pilotfertigung für CIGS-Dünnschichtsolarzellen in Betrieb genommen. Diese Linie mit einer maximalen
TCO-Schichten für die CIGS- Solarmodulproduktion Die Firma Würth Solar GmbH & Co. KG hat im Jahre 2000 eine Pilotfertigung für CIGS-Dünnschichtsolarzellen in Betrieb genommen. Diese Linie mit einer maximalen
Untersuchung metallischer Kontakte auf porösen Siliziumstrukturen
 Institut für Nano- und Mikroelektronische Systeme Prof. Dr.-Ing. J. N. Burghartz Institut für Mikroelektronik Stuttgart Prof. Dr.-Ing. J. N. Burghartz Untersuchung metallischer Kontakte auf porösen Siliziumstrukturen
Institut für Nano- und Mikroelektronische Systeme Prof. Dr.-Ing. J. N. Burghartz Institut für Mikroelektronik Stuttgart Prof. Dr.-Ing. J. N. Burghartz Untersuchung metallischer Kontakte auf porösen Siliziumstrukturen
Plasmaschmelze ein neuartiges Verfahren zur Herstellung keramischer Werkstoffe
 QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau Plasmaschmelze ein neuartiges Verfahren zur Herstellung keramischer Werkstoffe 6. April 2016 Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt (Copyright). Urheberrechte bei QSIL,
QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau Plasmaschmelze ein neuartiges Verfahren zur Herstellung keramischer Werkstoffe 6. April 2016 Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt (Copyright). Urheberrechte bei QSIL,
Entwicklung eines textilen thermoelektrischen Generators
 Entwicklung eines textilen thermoelektrischen Generators Gudrun Andrä 1, A. Gawlik 1, J. Plentz 1 K. Richter 2, S. Hauspurg, J.Kynast, L.Bölecke, M. Schlenker Leibniz-Institut für Photonische Technologien
Entwicklung eines textilen thermoelektrischen Generators Gudrun Andrä 1, A. Gawlik 1, J. Plentz 1 K. Richter 2, S. Hauspurg, J.Kynast, L.Bölecke, M. Schlenker Leibniz-Institut für Photonische Technologien
Thermische Stabilität von Ti-Si-C Schichten
 Thermische Stabilität von Ti-Si-C Schichten im Hinblick auf evtl. Hochtemperatur MAX-Phasen Bildung Martin Rester Jörg Neidhardt Christian Mitterer Christian Doppler Labor Dep.. Metallkunde & Werkstoffprüfung
Thermische Stabilität von Ti-Si-C Schichten im Hinblick auf evtl. Hochtemperatur MAX-Phasen Bildung Martin Rester Jörg Neidhardt Christian Mitterer Christian Doppler Labor Dep.. Metallkunde & Werkstoffprüfung
Elektromagnetische Felder und Wellen
 Elektromagnetische Felder und Wellen Name: Vorname: Matrikelnummer: Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4: Aufgabe 5: Aufgabe 6: Aufgabe 7: Aufgabe 8: Aufgabe 9: Aufgabe 10: Aufgabe 11: Aufgabe 12:
Elektromagnetische Felder und Wellen Name: Vorname: Matrikelnummer: Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4: Aufgabe 5: Aufgabe 6: Aufgabe 7: Aufgabe 8: Aufgabe 9: Aufgabe 10: Aufgabe 11: Aufgabe 12:
Elektrisch leitfähige transparente Beschichtungen auf organischer Basis
 Elektrisch leitfähige transparente Beschichtungen auf organischer Basis Workshop: "Carbon-Nano-Technologie" Weimar, den 23. Mai 2012 Dominik Nemec 1 Anwendungsgebiete Flachbildschirme Touchscreens organische
Elektrisch leitfähige transparente Beschichtungen auf organischer Basis Workshop: "Carbon-Nano-Technologie" Weimar, den 23. Mai 2012 Dominik Nemec 1 Anwendungsgebiete Flachbildschirme Touchscreens organische
1 Abscheidung. 1.1 CVD-Verfahren. 1.1.1 Siliciumgasphasenepitaxie. 1.1 CVD-Verfahren
 1 Abscheidung 1.1 CVD-Verfahren 1.1.1 Siliciumgasphasenepitaxie Epitaxie bedeutet obenauf oder zugeordnet, und stellt einen Prozess dar, bei dem eine Schicht auf einer anderen Schicht erzeugt wird und
1 Abscheidung 1.1 CVD-Verfahren 1.1.1 Siliciumgasphasenepitaxie Epitaxie bedeutet obenauf oder zugeordnet, und stellt einen Prozess dar, bei dem eine Schicht auf einer anderen Schicht erzeugt wird und
1 Metallisierung. 1.1 Kupfertechnologie Kupfertechnologie. 1.1 Kupfertechnologie
 1 Metallisierung 1.1 Kupfertechnologie 1.1.1 Kupfertechnologie Ab einer Strukturgröße von weniger als 250nm erfüllt Aluminium auch mit Kupferanteilen kaum noch die benötigten Anforderungen zur Verwendung
1 Metallisierung 1.1 Kupfertechnologie 1.1.1 Kupfertechnologie Ab einer Strukturgröße von weniger als 250nm erfüllt Aluminium auch mit Kupferanteilen kaum noch die benötigten Anforderungen zur Verwendung
Sauerstoffzuleitung Widerstandsheizung Quarzrohr Wafer in Carrier. Bubblergefäß mit Wasser (~95 C) Abb. 1.1: Darstellung eines Oxidationsofens
 1 Oxidation 1.1 Erzeugung von Oxidschichten 1.1.1 Thermische Oxidation Bei der thermischen Oxidation werden die Siliciumwafer bei ca. 1000 C in einem Oxidationsofen oxidiert. Dieser Ofen besteht im Wesentlichen
1 Oxidation 1.1 Erzeugung von Oxidschichten 1.1.1 Thermische Oxidation Bei der thermischen Oxidation werden die Siliciumwafer bei ca. 1000 C in einem Oxidationsofen oxidiert. Dieser Ofen besteht im Wesentlichen
Schulversuchspraktikum Großtechnische Elektrolyseverfah- ren/galvanisierung Kurzprotokoll
 Schulversuchspraktikum Johanna Osterloh Sommersemester 2015 Klassenstufen 11 & 12 Großtechnische Elektrolyseverfahren/Galvanisierung Kurzprotokoll Auf einen Blick: Das folgende Protokoll enthält einen
Schulversuchspraktikum Johanna Osterloh Sommersemester 2015 Klassenstufen 11 & 12 Großtechnische Elektrolyseverfahren/Galvanisierung Kurzprotokoll Auf einen Blick: Das folgende Protokoll enthält einen
Prüfstandards für intelligente Implantate
 06. Mai 2014 MST-BW Clusterkonferenz Freiburg Volker Bucher, Rene von Metzen Prüfstandards für intelligente Implantate Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen Herausforderung
06. Mai 2014 MST-BW Clusterkonferenz Freiburg Volker Bucher, Rene von Metzen Prüfstandards für intelligente Implantate Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen Herausforderung
HERSTELLUNG UND CHARAKTERISIERUNG VON INVERSIONSSCHICHT SOLARZELLEN AUF POLYKRISTALLINEM SILIZIUM
 Schriftenreihe zur Energieforschung Herausgegeben von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung Edmund Paul Burte HERSTELLUNG UND CHARAKTERISIERUNG VON INVERSIONSSCHICHT SOLARZELLEN AUF POLYKRISTALLINEM
Schriftenreihe zur Energieforschung Herausgegeben von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung Edmund Paul Burte HERSTELLUNG UND CHARAKTERISIERUNG VON INVERSIONSSCHICHT SOLARZELLEN AUF POLYKRISTALLINEM
LernJob Naturwissenschaften - Physik Wie funktioniert ein Foliendrucksensor?
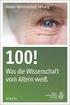 LernJob Naturwissenschaften - Physik Wie funktioniert ein Foliendrucksensor? Lernbereich: Kräfte als Modell zur Erklärung und Vorhersage von Kraftwikungen benutzen Zeitrichtwert: 90 Minuten Index: BGY
LernJob Naturwissenschaften - Physik Wie funktioniert ein Foliendrucksensor? Lernbereich: Kräfte als Modell zur Erklärung und Vorhersage von Kraftwikungen benutzen Zeitrichtwert: 90 Minuten Index: BGY
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Versuch Leitfähige Polymere (engl. Conductive Polymer)
 Versuch Leitfähige Polymere (engl. Conductive Polymer) Themenbereiche Konjugierte Polymere, Elektropolymerisation, dünne Filme, (spezifische) Leitfähigkeit, (spezifischer/flächen-) Widerstand, Stromdichte,
Versuch Leitfähige Polymere (engl. Conductive Polymer) Themenbereiche Konjugierte Polymere, Elektropolymerisation, dünne Filme, (spezifische) Leitfähigkeit, (spezifischer/flächen-) Widerstand, Stromdichte,
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
Wissenschaftliches Schreiben in der AC
 Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 03.07.2015 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 03.07.2015 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Zeitaufgelöste Fluoreszenzmessung zur Verwendung bei der Realtime-PCR
 Zeitaufgelöste Fluoreszenzmessung zur Verwendung bei der Realtime-PCR Nils Scharke, inano Abstract Die Verwendung neuartiger Seltenerd-Komplexe in Verbindung mit zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung liefert
Zeitaufgelöste Fluoreszenzmessung zur Verwendung bei der Realtime-PCR Nils Scharke, inano Abstract Die Verwendung neuartiger Seltenerd-Komplexe in Verbindung mit zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung liefert
Wissenschaftliches Schreiben in der AC
 Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 22.07.2016 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 22.07.2016 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Dünne Schichtelektroden durch Kombination von PVD- und PECVD-Verfahren
 Dünne Schichtelektroden durch Kombination von PVD- und PECVD-Verfahren J. Meinhardt, W. Bondzio Gliederung: 1. Motivation 2. Voraussetzungen für 3D-Vertikalelektroden 3. Experimentelle Ergebnisse 4. Zusammenfassung
Dünne Schichtelektroden durch Kombination von PVD- und PECVD-Verfahren J. Meinhardt, W. Bondzio Gliederung: 1. Motivation 2. Voraussetzungen für 3D-Vertikalelektroden 3. Experimentelle Ergebnisse 4. Zusammenfassung
Photokatalytischer NO x -Abbau: Von den wissenschaftlichen Grundlagen zur Anwendung im Straßenverkehr
 Photokatalytischer NO x -Abbau: Von den wissenschaftlichen Grundlagen zur Anwendung im Straßenverkehr Astrid Engel, Ralf Dillert und Detlef Bahnemann, Leibniz Universität Hannover Kolloquium Luftqualität
Photokatalytischer NO x -Abbau: Von den wissenschaftlichen Grundlagen zur Anwendung im Straßenverkehr Astrid Engel, Ralf Dillert und Detlef Bahnemann, Leibniz Universität Hannover Kolloquium Luftqualität
Das ätherische Magnetfeld (Teil 2) Steuerung
 1 Eugen J. Winkler / Das ätherische Magnetfeld (Teil 2) Das ätherische Magnetfeld (Teil 2) Steuerung Hier möchte ich Ihnen anhand von Diagrammen darstellen, wie die Form des ätherischen Magnetfeldes bei
1 Eugen J. Winkler / Das ätherische Magnetfeld (Teil 2) Das ätherische Magnetfeld (Teil 2) Steuerung Hier möchte ich Ihnen anhand von Diagrammen darstellen, wie die Form des ätherischen Magnetfeldes bei
Neurochipexposition mit generischem UMTS-Signal
 Neurochipexposition mit generischem UMTS-Signal Anlage 2 zum Abschlussbericht zum Projekt: Untersuchung zu Mechanismen an Zellen unter Exposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern der Mobilfunktechnologie
Neurochipexposition mit generischem UMTS-Signal Anlage 2 zum Abschlussbericht zum Projekt: Untersuchung zu Mechanismen an Zellen unter Exposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern der Mobilfunktechnologie
HANDOUT. Vorlesung: Hochleistungskeramik. Keramiken für Energiespeicher und -wandler
 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Hochleistungskeramik Keramiken für Energiespeicher und -wandler 21.01. 28.01.2016 Leitsatz: "Planar SOFCs
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Hochleistungskeramik Keramiken für Energiespeicher und -wandler 21.01. 28.01.2016 Leitsatz: "Planar SOFCs
Interconnect-Simulation. E. Bär (Fraunhofer IISB) Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik, Fraunhofer IISB, 12.
 Interconnect-Simulation E. Bär () zur Halbleitertechnologie und Messtechnik,, Gliederung Einführung Simulation des Ätzens - Oxid-Ätzen in C 2 F 6 - Sputter-Ätzen Abscheidesimulation - Plasmagestützte chemische
Interconnect-Simulation E. Bär () zur Halbleitertechnologie und Messtechnik,, Gliederung Einführung Simulation des Ätzens - Oxid-Ätzen in C 2 F 6 - Sputter-Ätzen Abscheidesimulation - Plasmagestützte chemische
Wiederholung: praktische Aspekte
 Wiederholung: praktische Aspekte Verkleinerung des Kathodendunkelraumes! E x 0 Geometrische Grenze der Ausdehnung einer Sputteranlage; Mindestentfernung Target/Substrat V Kathode (Target/Quelle) - + d
Wiederholung: praktische Aspekte Verkleinerung des Kathodendunkelraumes! E x 0 Geometrische Grenze der Ausdehnung einer Sputteranlage; Mindestentfernung Target/Substrat V Kathode (Target/Quelle) - + d
Wärmeleitfähige Polyamide
 VDI- Arbeitskreis Kunststofftechnik Bodensee Rorschach 08.05.2014 Dr. Georg Stöppelmann, Research & Development EMS-Chemie AG Business Unit EMS-GRIVORY, Europe + 41 81 632 6558 georg.stoeppelmann@emsgrivory.com
VDI- Arbeitskreis Kunststofftechnik Bodensee Rorschach 08.05.2014 Dr. Georg Stöppelmann, Research & Development EMS-Chemie AG Business Unit EMS-GRIVORY, Europe + 41 81 632 6558 georg.stoeppelmann@emsgrivory.com
Das Vikasonic. Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH. Messung der Festigkeitsentwicklung mit Ultraschall. Messprinzip.
 Teubert u. Greim GmbH Messprinzip Vikasonic Messung der Festigkeitsentwicklung mit Ultraschall Üblicherweise wird der Erstarrungsverlauf mit einem Penetrometer wie dem Vicat Gerät gemessen. Dieses mechanische
Teubert u. Greim GmbH Messprinzip Vikasonic Messung der Festigkeitsentwicklung mit Ultraschall Üblicherweise wird der Erstarrungsverlauf mit einem Penetrometer wie dem Vicat Gerät gemessen. Dieses mechanische
Professur Leistungselektronik und elektromagnetische Verträglichkeit Lehre und Forschung
 IEEE German Chapter Meeting 11. / 12. 05. 06 Professur Leistungselektronik und elektromagnetische Verträglichkeit Lehre und Forschung Prof. Dr. Josef Lutz, TU Chemnitz Leistungselektronik und elektromagnetische
IEEE German Chapter Meeting 11. / 12. 05. 06 Professur Leistungselektronik und elektromagnetische Verträglichkeit Lehre und Forschung Prof. Dr. Josef Lutz, TU Chemnitz Leistungselektronik und elektromagnetische
Laborübungen aus Physikalischer Chemie (Bachelor) Universität Graz
 Arbeitsbericht zum Versuch Temperaturverlauf Durchführung am 9. Nov. 2016, M. Maier und H. Huber (Gruppe 2) In diesem Versuch soll der Temperaturgradient entlang eines organischen Kristalls (Bezeichnung
Arbeitsbericht zum Versuch Temperaturverlauf Durchführung am 9. Nov. 2016, M. Maier und H. Huber (Gruppe 2) In diesem Versuch soll der Temperaturgradient entlang eines organischen Kristalls (Bezeichnung
Dipl.-Ing. Alicja Schlange
 Funktionalisierung neuartiger Kohlenstoffmaterialien und deren Einsatz in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften vorgelegt von
Funktionalisierung neuartiger Kohlenstoffmaterialien und deren Einsatz in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften vorgelegt von
A Basic Study of Electrical Impedance Spectroscopy for Intravascular Diagnosis and Therapy Monitoring of Atherosclerosis
 A Basic Study of Electrical Impedance Spectroscopy for Intravascular Diagnosis and Therapy Monitoring of Atherosclerosis Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Ingenieurwissenschaften der
A Basic Study of Electrical Impedance Spectroscopy for Intravascular Diagnosis and Therapy Monitoring of Atherosclerosis Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Ingenieurwissenschaften der
Zugversuch. 1. Einleitung, Aufgabenstellung. 2. Grundlagen. Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 2009
 Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 29 Zugversuch Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm Mitarbeiter: Philipp Kaller, Paul Rossi 1. Einleitung, Aufgabenstellung Im Zugversuch sollen
Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 29 Zugversuch Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm Mitarbeiter: Philipp Kaller, Paul Rossi 1. Einleitung, Aufgabenstellung Im Zugversuch sollen
1 Einleitung. Einleitung und Zielsetzung 3
 EinleitungundZielsetzung 3 1 Einleitung Rund80ProzentallerProdukte,dieinchemischenProzessenhergestelltwerden,beinhalten mindestens einen katalytischen Prozessschritt während ihrer Herstellung. Damit zählt
EinleitungundZielsetzung 3 1 Einleitung Rund80ProzentallerProdukte,dieinchemischenProzessenhergestelltwerden,beinhalten mindestens einen katalytischen Prozessschritt während ihrer Herstellung. Damit zählt
4.2 Halbleiter-Dioden und -Solarzellen
 4.2 Halbleiter-Dioden und -Solarzellen Vorausgesetzt werden Kenntnisse über: Grundbegriffe der Halbleiterphysik, pn-übergang, Raumladungszone, Sperrschichtkapazität, Gleichrichterkennlinie, Aufbau und
4.2 Halbleiter-Dioden und -Solarzellen Vorausgesetzt werden Kenntnisse über: Grundbegriffe der Halbleiterphysik, pn-übergang, Raumladungszone, Sperrschichtkapazität, Gleichrichterkennlinie, Aufbau und
Das Christian Doppler Labor für Nanokomposit-Solarzellen
 Institute for Chemistry and Technology of Materials Graz University of Technology Das Christian Doppler Labor für Nanokomposit-Solarzellen 8. Österreichische Photovoltaik Tagung 28. Oktober 2010 Thomas
Institute for Chemistry and Technology of Materials Graz University of Technology Das Christian Doppler Labor für Nanokomposit-Solarzellen 8. Österreichische Photovoltaik Tagung 28. Oktober 2010 Thomas
Labor für Mikrosystemtechnik Fakultät 6
 Fakultät 6 Prof. Dr.-Ing. Christina Schindler, Michael Kaiser (M.Sc. FH) Übersicht Lithographie Dünnschichttechnik Messtechnik Beispiele Titel Präsentation wieholt (Ansicht >Folienmaster) Prof. Dr.-Ing.
Fakultät 6 Prof. Dr.-Ing. Christina Schindler, Michael Kaiser (M.Sc. FH) Übersicht Lithographie Dünnschichttechnik Messtechnik Beispiele Titel Präsentation wieholt (Ansicht >Folienmaster) Prof. Dr.-Ing.
1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte
 1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte 1.1 Es gibt 7 Kristallsysteme, aus denen sich 14 Bravais-Typen ableiten lassen. Charakterisieren Sie die kubische, tetragonale, hexagonale und orthorhombische
1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte 1.1 Es gibt 7 Kristallsysteme, aus denen sich 14 Bravais-Typen ableiten lassen. Charakterisieren Sie die kubische, tetragonale, hexagonale und orthorhombische
Verbesserung des Thermoschockverhaltens thermisch gespritzter Wärmedämmschichten durch Einsatz nanostrukturierter Spritzzusatzwerkstoffe
 Verbesserung des Thermoschockverhaltens thermisch gespritzter Wärmedämmschichten durch Einsatz nanostrukturierter Spritzzusatzwerkstoffe Stefanie Wiesner Prof. Dr.-Ing. Kirsten Bobzin 01.12.2011 Jugend
Verbesserung des Thermoschockverhaltens thermisch gespritzter Wärmedämmschichten durch Einsatz nanostrukturierter Spritzzusatzwerkstoffe Stefanie Wiesner Prof. Dr.-Ing. Kirsten Bobzin 01.12.2011 Jugend
2.2 Was bringt Keramik in Form Die keramische Prozesskette
 Vortragsblock 1 2.2 Was bringt Keramik in Form Die keramische Prozesskette Dr. Stephan Ahne, Dr. Ilka Lenke Carmen Hesch CeramTec AG Plochingen Die Folien finden Sie ab Seite 76. 2.2.1. Einleitung: Vielfalt
Vortragsblock 1 2.2 Was bringt Keramik in Form Die keramische Prozesskette Dr. Stephan Ahne, Dr. Ilka Lenke Carmen Hesch CeramTec AG Plochingen Die Folien finden Sie ab Seite 76. 2.2.1. Einleitung: Vielfalt
Fraunhofer IWS. Atmosphärendruck-Mikrowellen-PECVD zur Abscheidung von SiO 2 - Schichten. Mikrowellen-PECVD bei Atmosphärendruck
 Mikrwellen-PECVD bei Atmsphärendruck Atmsphärendruck-Mikrwellen-PECVD zur Abscheidung vn SiO - Schichten Fraunhfer IWS Mtivatin Experimenteller Aufbau SiO Schichteigenschaften Zusammenfassung Ines Dani
Mikrwellen-PECVD bei Atmsphärendruck Atmsphärendruck-Mikrwellen-PECVD zur Abscheidung vn SiO - Schichten Fraunhfer IWS Mtivatin Experimenteller Aufbau SiO Schichteigenschaften Zusammenfassung Ines Dani
Festplattenkomponenten & -struktur
 Festplattenkomponenten & -struktur 2x2µm Magnetokraftaufnahme aktuelle Bit-Größe 50x20nm 82,90: 1&(2-'#;%3+3"
Festplattenkomponenten & -struktur 2x2µm Magnetokraftaufnahme aktuelle Bit-Größe 50x20nm 82,90: 1&(2-'#;%3+3"
