- 1 - Das Taxon hat eine gemeinsame Stammform und umfasst alle Untergruppen. Das Taxon hat eine gemeinsame Stammform und umfasst einige Untergruppen
|
|
|
- Timo Holst
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 - 1 - Termini Definition Z O O L O G I E Lehre des Lebenden Biospezies Eine nach biologischen Kriterien definierte Art Morphospezies Eine nach morphologischen Kriterien definierte Art Chronospezies Eine nach chronologischen Kriterien definierte Art Kladistik Beruht auf der phylogenetischen Systematik von Willi Hennig Taxon Eine als systematische Einheit erkannte Gruppe von Lebewesen Adelphotaxon Schwestergruppe eines Taxons Monophylum Das Taxon hat eine gemeinsame Stammform und umfasst alle Untergruppen Autapomorphie Neues Grundmerkmal eines Monophylums (kann sek. reduziert sein) Synapomorphie Neues Grundmerkmal e. Schwestergruppe in einem Monophylum Paraphylum Das Taxon hat eine gemeinsame Stammform und umfasst einige Untergruppen Plesiomorphie Ursprüngliches Merkmal, ergo nicht neu abgeleitet Synplesiomorphie Homologes Merkmal von mehreren Taxa (z.b. Wirbelsäule) Polyphylum Umfasst Gruppen mit ähnlichen Merkmalen (z.b. Würmer) Homologie Wenn versch. Merkmale verschiedener Taxa den selben Ursprung haben Homoplasie = Analogie = Konvergenz wenn das Merkmal unabhängig entsteht Homologiekriterien Lage Gleiche Lagebeziehung im Bauplan spez. Qualität Ähnliche Strukturen stimmen in komplexen Sondermerkmalen überein Kontinuität Zwischenformen lassen Lageveränderungen erkennen Gastrulation: Teil der Embryonalentwicklung Bei den Bilateria tritt zusätzlich die sekundäre Leibeshöhle, das Mesoderm hinzu. Ontogenese Entwicklung vom Ei zum Erwachsenen Morphen (Gestalten) Männ./Weib. ; Larve/Adult ; Frühling/Sommer ; Polypen/Medusen Generationswechsel ungeschlechtlich/geschlechtlich ; parthenogenetisch/biparental
2 - 2 - Eukary(ot)a S T Ä M M E D E S T I E R R E I C H S Stammart aller Eukarioten vor ~ 2 Milliarden Jahren Autapomorphe Merkmale: Cytoskelett assoziierte Proteine [α β γ Tubuline] Tubulin assoziierte Proteine [Mikrotubuli, Kines-, Dyneine] Actin, Myosin Vesicle-coat-Komponenten [Clathrin] ATPasen in Vakuolen Signal-Proteine [Calmodul-,Ubiquitin, GTP-Bindungsprot.] Cyclin B und Zellzyklus-Checkpointproteine [Kinasen] Nucleus assoziierte Proteine [Histone: H2A,H2B,H3,H4] Histon assoziierte Proteine Transkriptionsfaktoren Spliceosomen Nukleus-Proteine Kernporen-Proteine Chromosomen 347 eukaryontische Signaturgene [später z.b. Hox-Gen] gepaarte Kinetosomen Mitotischer Verteilungsapparat aus Mikrotubulimikrofilamenten 80s-Ribosomen Mitochondrien oder Hydrogenosomen (z.b. Bei Trichomonas) Eukaryota Protozoa Tetramastigota (Fl) Euglenoida (Fl) Ur-tierische Einzeller S.3 Nr.1 S.3 Nr.2 Kinetoplasta (Fl) S.4-5 "Heliozoa" (Rh) - Dinoflagellata (Fl) S.5 Apicomplexa (Sp) S.6 Ciliophora (Ci) S.7 Foraminifera (Rh) "Heliozoa" (Rh) "Radiolaria" (Rh) Gehäusetragende Protisten Sonnentierchen mit Axopodien SiO 2 -Endoskelett u. Axopodien "Alveolata" "Rhizaria" Planta Endosymbiose mit Cyanobakterium Amoebozoa (Rh) Fungi Metazoa Pilze Tierische Vielzeller
3 Tetramastigota (Flaggelata) - Trichomonas Vaginalis 10-30µm - Diplomonadea Diplomonadina Giardia lamblia (intestinalis) P R O T O Z O A 4 Geißeln (2 gepaarte Kinetosomen) 1 Geißel schlägt rückwärts (SynAPM) Geißelschaft von Zellmembran überzogen Im Geisselschaft (2 zentr. Mikrotub. darum 9 Doppelmikrotub.) Mikrotubuli: Röhre Ø 25nm Tubuläre Basis: Kranz von 9 Dreifachtubuli Cytostom(Einsenkung durch Mikrotubuli gestützt) Kontraktile Vakuole: feste Position im Geißelsäckchen Inhalt der Vakuole wird über spez. Porus entlassen 4-6 Geißeln (Flagellum) am Basalapparat Schleppgeißel: Schubgeißel Parabasalstränge Costa: beweglicher Proteinstab Axostyl: Mikrotubuliachse mit Cytoskelettfunktion Nukleus: Kern Hydrogenosomen: Glukose Pyruvat Acetyl-CoA Acetat + ATP (anaerob) diplozontische Form: 2 Kerne,2 Cytostome, 8 Geißeln Aerotolerante Anaerobier Mitosom: Mitochondrienrelikt Kommensal/parasitisch in (E)verebraten Humanpathogen verankert im Darmepithel blockiert Nährstoffzufuhr blutige Diarrhö Übertragung durch Zysten (faecal/oral) Vermehrung durch Längsteilung ~20µm 2. Discicristata SynAPM: Mitochondrien mit discoidalen Cristae - Euglenozoa ~65µm 2 Geißeln (1 extremst reduziert) Geißeln entspringen apikaler Einbuchtung (Geißelsäckchen) Lange Geißel mit Paraxialstab zarte Geißelanhänge: Mastigonen (Flimmern) kleine Geißel: Schleppgeißel Beutefang / Substratanheftung submembranös/schraubige Proteinkomplexe + Mikrotubuli + Actomyosin metabole Kriechbewegung Zellkernhülle bleibt bei Mitose erhalten Reservestoffe: Lipide, Glucane (Paramylum) im Cytoplasma 1/3 Phototroph Euglena virdis: Paraflagellatkörper + Stigma Lichtorientierung Plastiden 3 Membranen; Chlorophyll a,b (evtl. Grünalgensymbiont) 2/3 Heterotroph Anisotrema truncatum
4 Heterolobosa z.t. "Amöben" u. "azelluläre Schleimpilze" zweiteiliger Besitz von unbeflimmerten Geißeln Schizopyrenida PAME Naegleria floweri 18-25µm Naegleria australensis 14-30µm Baden Nasenhöhle Gehirn Massenvermehrung PAME Tod Primäre Amöben Meningoencephalitis -Euglenozoa -Kinetoplasta Salivaria Stercoraria 5-20µm Krankheiten (wichtige Arten) Trypano. Cruzi Frei lebende Bakterienfresser/ Kommensalen/ Parasiten Kinetoplast: DNA-reicher Bereich im Mitochondrium Ein einziges körperlanges Mitochondrium apikales Geißelsäckchen m. 2 Geißeln (1 oft reduziert) Geißeln durch Paraxialbündel versteift und heterodynamisch undulierende(gewellte) Membran kl. Viskosität (im Blut) Cytoskelett aus MT, Kern, Golgi, ER Pellicula (Zellrinde) u. Cytostom durch Mikrotubuli befestigt Surface coat (Zellrindenrinde) aus Glykocalyx Geißel: Achsenstab + Axonem (9x2+2 MT) Im Speichel des Überträgers Im Fäzes des Überträgers Schlafkrankheit (Trypanosoma brucei gambiense/rhodesiense) Nagana ( Trypanosoma brucei brucei) Tsetse-Fliegen-Speichel Chagas-Krankheit (Tryp. Cruzi) Fäzes blutsaugender Wanzen Wirt: Herzmuskel platzt Entwicklung: amastigot trypomastigot amastigot mikro- kryptomastigot: Geißellose Form 4µm lang trypomastigot Länglich gewunden 20µm lang mit Geißelbasis nahe dem Zellkern epimastigot trypomastigot nur Geißelbasis ist in anderer Position promastigot epimastigot nur Geißelbasis noch weiter nach hinten verschoben
5 Kinetoplasta -Trypansomatidea Meist extrazellulär aber amastigote Stadien intrazellulär keine parasitophore Vakuole Phatogenität: toxische sog. Kinine (Gewebehormone) Verbreitung mittels Vektoren (Überträger) obligater Entwicklungszyklus im Vektor mechanische Übertragung (Blutübertragung) 1-3 Wochen Fieber u. Parasiten im Blut Jahrelange intrazelluläre Vermehrung (Herz,Darm,Nerven) Myocarditis, Cardiomegalie (Cor bovinum) Xenodiagnose über Raubwanzenkot (Chagas) Therapie: Nifurtimox (Lampit) - Schlafkrankheit 2-3 Wochen Fieberanfälle bis 41 C Lymphknoten-schwellung, -übertragung ZNS-Befall nach 3 Monaten Meningoencephalitis (Erreger im Liquor) oft Myokarditis Herzversagen Endstadium Schlafkrankheit Therapie: Suramin, Pentamidin, Nifurtimox (Lampit) - Leishmania donovani Stich von Sandmücken promastigotes Stadium WZ: Makrophagen amastigote Form in Vakuolen in der WZ Teilung: bis zu 200 Parasiten Makrophage (WZ) platzt Befall neuer WZn Therapie: Amphtericin B, Diamidine 3. Alveolata Molekularbiologisch: Homologie d. Strukturkomplexe 1. Amphiesmata d. Dinoflagellata [unterhalb der Membran liegenden Alveolen mit Zellulose] 2. Innere Membrankomplexe d. Apicomplexa 3. Alviolen der Ciliophora Alveolata -Dinoflagellata 150µm-1mm 2 Geißeln mit untersch. Bewegungsdynamik (apikal/ventral) 1 in Äquatorialrinne (Cingulum), 1 in Längsfurche (Sulcus) transversalschlagende G. m. Saum (paraxiales Band) ohne Flimmerhaare Schleppgeißel ohne Haare oder m. 2 Reihen steifer Flimmern i.d.r. Gepanzert: Celluloseplatten, Alveolen, Amphiesmata haploid, Chromosomen dauerkondensiert, wenige/keine Histone phototroph(chlorophyll) extrem red. eukaryot. Symbiont β Carotin, Xanthophyll (gelbbraun-rote Färbung) prim.,sek.,tert. Endosymbionten (z.b. Cnidarien) Reservestoffe: Stärke, Öl keine kontraktile Vakuole Osmoregulation Einstülpungen Extrusomen: Trichocysten, Nematocysten "Red tide" giftige Alkaloidea (Saxitoxin) Fische/Muscheln
6 - 6 - Alveolata -Apicomplexa (Sporozoa) 2-20µm Apikalkomplex Obligatorische Endoparasiten, haploid viele hoch pathogen 2-3phasiger Generationswechsel Infektionsstadien: spindelförmige Sporozoiten in Sporo-, Oocyste; oder Vektor Cortex: längsverlaufende Mikrotubulifasern 3 Membranen: 1. 1 Periphere Zellmembran 2. 2 flache innere alveoläre Membrankomplexe [Homologie zu Amphiesmata d. Dinoflagellata] Mikroporen: kl. Einsenkungen d. Zelloberfl. [Nahrungsaufnahme] Sporozyten: Apicoplast m. Photosynthesepigm. und DNA [betreiben keine Photosynthese trotzdem sind Pigmente wichtig] 1. Konusförmiger Conoid (s.abb.) [zum Durchdringen der Wirtszell-Membran] 2. Polringkomplex am apikalen Ende als MTOC (?) 3. Rhoptrien [lytische Enzyme und Serin/Threonin-Kinasen] [z.b. an der Auflösung roter Blutkörperchen beteiligt] Penetrationsapparat Apicomplexa -Coccidia [typ.: Formen m. u. ohne Wirtswechsel] Cocc. Eimeriida Generationswechsel mit 3 Phasen: 1. Schizogonie: ungeschl. Vermehrungsphase 2. Gamogonie (Oogamie): Es enstehen viele -Mikrogamenten Es ensteht ein -Makrogamet Es ensteht eine Zygote 3. Sporogonie: infekt. Sporozoiten aus d. Zygote (Dauerstadien) 4 Sporocysten Oocyste ; Sporocyste mit je 2 Sporozoiten Eime. Isospora 2 Sporocysten mit je 4 Sporozoiten Homoxener monoxenem Entwicklungsgang: einwirtig. Heteroxener Toxoplasma gondii Eimeriida -Sarcocystidae (Sarkosprodien) m. fakultativem o. Obligatorischem(notwendigem) Wirtswechsel Oocyste; 2 Sporocysten á 4 [Sporozoiten] [1-2 Zwischenwirte] [Sporogonie] [Schitzogonie] [Gamogonie] Infektion: Katzenkot, rohes Schweinefleisch auf Fötus (diaplazentar) übertragbar Lymphknoten-Erkrankung / (Depressionen) Wahrsch. e. Infektion steigt mit dem Alter Obligatorischer Wirtswechsel "Raubtier-Beute" Im Beutetier (Herbi-Omnivore) nur Schitzogonie Im Raubtier (Endwirt) Gamo- u. Sporogonie z.b. Sarcocystis sui(zw)-hominis(ew) Schwein(ZW)-Mensch(EW) Sarcocystis equi(zw)-canis(ew) Pferd(ZW)-Hund(EW)
7 - 7 - Schizonten Merozoit Trophozoiten Coccidia -Haematozoea Apicalkomplex reduziert aus Zygote direkt Sporozoiten [keine encystisierte Phase] Infektionsstadien immer im flüssigen Milieu Wirbeltier (ZW) Arthropoden(EW) Haemosporida [Diptera Anopheles;Aedes[Mücke](EW)] [Mensch(ZW)] Plasmodium spec. Malaria-Erreger [mala aria = schlechte Luft] Vektor: Mücken der Gattung Anopheles tier. Reservoir: nur einige Affen, ergo streng wirtsspezifisch 4 Humanpathogene: 1. Plasmodium vivax Malaria tertiana (48h-Schübe) 2. Plasmodium ovale Malaria tertiana (48h-Schübe) 3. Plasmodium malariae '' quartana (72h-Schübe) 4. Plasmodium falciparum '' tropica (unregelmäßig) [Mischinfektion ist möglich] P. vivax, ovale überleben 30 Jahre als Dormozoiten in d. Leber [Rezidive: d.h. kann erneut ausbrechen ] P. malariae überleben bis 30 Jahre; geringe Blutparasitämie P. falciparum bildet "knobs" auf d. Blut Verklumpung Thromben cerebrale Malaria, Hirnödem, Nierenversagen [oft keine Schizonten im periph. Blut nur ringf. Trophozoiten] Apicomplexa - Piroplasmida Schitzogone (merogone) Ph; Mutterzelle m. Vielen Zellkernen Zerfällt der Schizont (Mutterzelle) entstehen Merozoiten Vegetative Ph. adulter Protisten; Keine Vermehrung; Stoffwechselaustausch weltweite Parasitenarten WZ: Lymphozyten,Erythrozyten, Blutbildungszellen W: warm- und kaltblütige Wirbeltiere Mikrogameten geißellos EZ: Wie bei Haemosporida Vektor: Zecke (Ixodes-Typ) Texas-Fieber; Theileriose, afr. Ostküsten- Mittelmeerfieber Sporogonie[Mücke(Darm)] Schizogonie[Mensch(Leber,Blut)] Gamogonie [Mensch(Blut)]
8 - 8 - Alveolata -Ciliophora (Wimpertierchen) Paramecium caudatum µm Makronuklei Mikronuklei Konjugation s. Anhang S. Heterotrophe Einzeller Zahlreiche kurze Cilien Spezifischer Aufbau des Cortex (Hülle) Zwischen Cortex und Endoplasma gibt es Filamente 1-4µm dick aus Pellicula u. Infraciliatur Pellicula: Zellmembran + evtl. Perilemma (aufgelagert) parasomale Säcke (Einsenkungen Pinocytose) Alveolen (System agbeflachter Vakuolen) Organellen: Extrusomen Myomere (kontraktile Fibrillen) Mitochondrien,ER-Zisternen, Vesikel Infraciliatur : Wurzelstrucktur der Cilien (Kineten) Kerndualismus einen oder mehrere Makronuklei(somatisch) einen oder mehrere Mikronuklei(generativ) besondere Gamontogamie: Konjugation Kinetiden(Basalkörper, Kinetosomen) durch MT longitudinal verknüpft; Mundregion spez. Periorale Kineten. Cytostom (Mundtrichter) Phagocytose Cytopyge (Zellafter) Exocytose Cirren, Membranellen = dicht stehende Cilien Oft polyploid sorgt für Zellmetabolismus (Stoffwechsel) [Werden vor Konjugation aufgelöst und neu aus Mikronuklei gebildet] Gen. Information sorgt für Zellteilung (mitotisch; meiotisch) Außerdem gehören zu den Alveolata: z.t. Ascetospora,Perkinsozoa und Colpodellidae 4. Rhizaria Wurzelfüßer Rhizaria -Foraminifera (Granuloreticulosa) Reticulopodien: Netzwerk v. vernetzten, -steiften Pseudopodien Bidirektionalströmung im Cytoplasma Plasmastränge o. Gehäuse (ein oder vielkammerig) hohe Formenvielfalt 1 bis viele Kerne Schalen aus Proteinen Gehäuse aus versch. (an)org. Material (Fe- bzw.. Si- haltig) Gehause aus CaCO 3 (Calciumcarbonat) auf basaler org. Schicht Axopodien: MT versteifte Pseudopodien Axoplasten: MT wird am Axoplasten im CP gebildet Vermutung: bis 1cm Heterophasischer Generationswechsel zwischen a- und sexueller Phase
9 Amoebozoa bis 5mm Minuta-Form Magna-Form phagotrophe Einzeller Pseudopodien selten mit MT verhärtet Fortbewegung Geißeln und Centriolen reduziert cytoplasmatisches MT nur bei Mitose Fortpflanzung oft sexuell, meist durch Vielfachteilung Taxon: Lobosea u. Gymnamoebina Parasiten : Eutamoeba histlytica, invadens Übertragung: Mensch Mensch [per Cysten] Immunsuppresion (Zerstören v. T-Zellen; Makrophagen) durch exocyt. granulisynähnliches Protein Parasit im Darmlumen Parasit im Gehirn, Leber, Lunge Abszess (umkapselte Eiteransammlung) M E T A Z O A 3 Organisationsstufen: 1. Parazoa (Hauptanteil: Schwämme (Porifera)) 2. Coelenterata (Haupta: Nesseltiere (Cnidaria) + Rippenquallen(Ctenophora )) 3. Bilateria (Zweiseitentiere) Abstammung der Metazoa: Ultrastruckturforschung sagt: Choanoflagellata Choanoflagellata bis 10µm Kragengeißeltierchen Biochemie: Signaltransduktionskaskaden Wachstumsfaktoren chemische Abwehrstoffe
10 Wie sind die Metazoa entstanden? 1. Zellteilungskolonien [Zellklone sind über extrazelluläre Matrix verbunden] 2. Aggregationskolonien [spez. unabhängige Rezeptoren führen zur Chemotaxis] 3. Zellbildung in einem vielkernigen Einzeller Es gab eine frühzeitige Trennung von somatischen und generativen Zellen Ursprungliche Körpersymmetrien: 1. Porifera (Larve: Radiärsymmetrie; Adult: Radiär- oder Asymmetrie) 2. Coelenteraten ( Medusen, Polypen: RS; Rippenquallen: Disymmetrie) 3. Blumentiere ( Octocorallia: Bilateralsymmetrie) Asymmetrie Radiärsymmetrie Disymmetrie Bilateralsymmetrie Zellen der Metazoa Extrazelluläre Matrix (EZM) Die EZM besteht aus faserigen Bestandteilen und Flüssigkeit mit den darin gelösten Substanzen Kollagen [Struckturprotein] macht ¼ aller Proteine 30% d. ges. Proteinmasse Es gibt keine Symmetrieebene Es gibt eine drei- oder mehrzählige Drehsymmetrie Es gibt zwei Symmetrieebenen die um 90 versetzt sind Die linke Körperhälfte ist spiegelbildlich zur rechten Körperhälfte EZM wird von einzelnen Zellen abgesondert und dient der Kommunikation, Zusammenhalt, Energieverteilung [mgl. APM] 3 räuml. getrennte Typen: 1. Cuticula Abscheidungen 2. Basale Matrix (oft zweischichtig) 3. Interzelluläre Substanz v. Bindegeweben Biochemie: Faserkollagene, Elastine, Chitin, evtl. Cellulosederivate Proteoglykane (aus Protein u. Glykosaminglykanen) Glykoproteine (Proteine mit Oligopolysaccharidketten) [Fibronectin, Laminin] spez. Matrixrezeptormoleküle in der Zellmembran [Integrine Zusammenhang extrazell. Matrixmoleküle] [Integrine Transportprotein (Embryonalentwicklung!)] [Integrine Kommunikationsprotein] Kollagen, Chitin, CaCO 3 -Kristalle: Stützfunktion temp. EZM : Schleim Wichtiges Bauplanprotein i.d. ECM mit enormer Zugfestigkeit Besteht aus 3 linksgängigen α-helices, welche durch H- Brücken eine rechtsgängige Superhelix [Trippelhelix] ausbilden Jede dritte Aminosäure ist Glycin, auch viel (Hydroxi)prolin unterschiedlich glykos- und hydroxylierte Kollagen-Polypeptide Supramolekulare Fibrillen (Untergruppen): 1. Fibrilläre Kollagene ( I, II ) 2. Fibrillen assoz. Ko. ( III ) 3. Vernetztes Kollagen ( IV ) 4. Kleine Kollagene (z.b. Kapselwand Cuiden) Perlenschnurartige Kollagene ( VI ) Verankerungsfibrillen ( VII ) Kollagene mit Transmembr.domänen (XIII, XVII, XVII, XXV)
11 Gewebetypen 1. Schichtenbildende Epithelzellen am apikalen Pol der Zellmembran: Glykokalyx, Cuticula am basalen Pol der Zellmembran: basale Matrix Basale Matrix: Basallamina: lamina lucidia lamina densa darunterliegend: lamina fibroreticularis an Epitheloberfläche: Zell-Zellverbindungen Stabilität und Stoffaustauschkontrolle [paracellular pathway] Cadherin-Catenin-Komplex 2. Einzelzellen beweglich in EZM; nur punktförmige Kontakte produzieren EZM-Proteine (Kollagene, Glykoproteine) Zusammengefasst Bei embryonalen Metazoa: Epithelgewebe Zell-Zell-Kontakte Zell-Zell- Verbindungskomplexe Tonofilamenten Punktförmige Zell-Zell-Kontakte Bei adulten Metazoa: Mesenchym Epithelgewebe Bindegewebe evol. Differenzierung: Epithel-,Binde-, Muskel-, Nerven, Drüsengewebe Zusammenhalt und Kommunikation 1. bandförmige Struckturen um die Zelle herum (nur bei Epithelzellen) 2. punktförmige Kontakte (Epithel,Binde, und embry. Mesenchym) 3. [Grenzstelle zwischen apikaler und basolateraler Zellmembran] 1. Zonula occludens (= tight junction, Schlussleiste) dichtet den Hohlraum zwischen Zellen ab (Claud-, Occuline) 2. Zonula adhaerens (= Gürteldesmosom) Zellen sind deutlich getrennt aber verbunden (C-C-Komplex) verankerte Aktinfilamente im CP + (Myosin Kontraktion) [wichtig für Bildung des Neuralrohres] 3. Macula adhaerens (= Desmosomen) spez. Stellen sind mit Tonofilamenten verbunden (häufig i.d. Haut) welche seitlich in die desmosom. Platten (Desmoplakine) eintreten Intermediärfilament aus Cytokeratin Stabilität 1. Mech. Wirksame Punktdesmosomen 2. Nexus (= Gap junction) direkte hydrophile Kanalverbindung Ø = 1,6-3 nm MG bis 1200D scheibenförmig aus hexagonal geordneten Connexonen Connexonen bestehen aus 6 Proteinen. Auch für Ionen permeabel elek. Synapse im Herzmuskel
12 P A R A Z O A -Placozoa Gewebelose Tiere ohne Organe und Symmetrie Trichoplax adhaerens als einzig vertretene Art der Placozoa -Porifera (Schwämme) Aquatische (v.a. Marine[Antarktis]), sessile Tiere Strudler: Strudeln einen Wasserstrom durch ihr Kanalsystem erzeugt wird dieses durch Choanocyten (Kragengeißelzellen) Pinakoderm m. Poren (zweischichtiges Epithel d. Schwämme) Endo- (Kanalauskleidung) und Exopinakocyten (Epithel) Mesohyl (spez. Bindegewebe/EZM) umhüllt v. Pinakoderm Osculum (Ausflussöffnung) Nährstoffe werden von Choanocyten und Endopinakoderm aufgenommen. Reaktion auf Reize OHNE Nervenzellen "prä-nervöses System" Kontraktionsvermögen OHNE Muskelzellen Getrenntgeschlechtlich o. Zwittrig (ohne Geschlechtsorgane) Fortpflanzung Gemmulae Amoebocyten Archaeocyten Trophocyten Skelettelemente Spicula Ascon -Typ Syncon -Typ Leucon -Typ Bioaktive Substanzen -Hexactinellida -Calcarea -Demospongiae Spongin Spermien werden freigesetzt und befruchten in der Mesogloea Eizellen Abschnürung von Zellverbänden b.d. Asexuellen Fortpflanzung Bewegliche Zellen mit Pseudopodien (Nahrungsverteilung) Totipotent: Nahrungstransport, Defäkation, Wachstum, Oogenese, Regeneration Bilden Lipideinschlüsse u. Ernähren so die Oogenese und Gemmulation Skleroblasten: Kalk-,Kieselnadeln; Spongioblasten: bilden Spongin Nadeln aus Kalk oder Kiesel bilden das Gesamtskelett Sehr kleine Schwämme mit kleiner undifferenzierter Oberfläche Kleine Schwämme mit größerer Oberfläche (Radialtuben) Große Schwämme. Mesohyl von Geißelkammern durchsetzt Manoalid: hemmt grammpositiv Bakterien; Schmerzlindernd Avarol: Wirkt gegen HIV Ara-A: Hemmt Herpesviren Glasschwämme m. Riesigen Kiesel-Basalspiculum als Anker (3m) Venus flower basket: 1 Paar symbiont. Garnelen (Gefängnis der Ehe) Kalkschwämme mit Kalkspicula Hornschwämme mit hauptsächlich Sponginfasern ohne Skelett; (Leucon) Kollagenähnliches Protein welches formgebend Nadeln verbindet.
13 E U M E T A Z O A Metazoa mit echtem Gewebe (Gewebetiere) Autapomorphe Merkmale: Echtes Epithelgewebe: schichtenförmige Zellverbände, die über apikale bandförmige Zell-Zell-Verbindungen besitzen und eine basale Matrix. Meiose zur Gametenbildung Spermatozoenaufbau [Spermien mit Kopf-Mittel-Schwanzregion] Polkörperchen der Oocysten (Eizellen) Diplodie: Chromosomensatz doppelt (2n) Gastrula mit zwei Keimblättern (Ento- und Ektoderm) Epithelgewebe -Coelenteraten (Radiata / Hohltiere) Epithelgewebe Umgibt flüssigkeitsgefüllte Hohlräume (Darm, Coelom, Gonaden und Ausleitungsgänge von Nephridien) Kontrolle der Ionenzusammensetzung im Gewebe Dipoblastische Eumetazoa: Ektoderm: Epidermis, Schlundrohr,Nervensystem Entoderm: Gastrodermis Radialsymmetrisch Nervensystem und Netze mit Lokalenverdickungen Muskulatur: glatte, quer- und schräg-gestreifte Muskelzellen Epithelmuskelzelle: Kernverband (apikal), Myofilamente (basal) Fasermuskelzelle: im Epithel oder unterhalb Cuticula an der Apikalseite; basal die basale Matrix/Lamina/Membran bei Arthropoda ist Chitin eingelagert bei Tunicaten Zellulose Rezeptorzellen Prim. Sinneszellen: mit eigenem Axon Sek. Sinneszellen: ohne eigenes Axon 1. Photorezeptorzellen in der apikalen Zellmembran (Licht) 2. Collarrezeptorzellen für Bewegungswahrnehmung 3. Statische Sinnesorgane für Lageorientierung 4. Monociliäre Rezeptorzelle ohne Mikrovillikrank?? 5. Rezeptor m. Abgewandelter Axonem-Strucktur (Chemorez.?) -Cnidaria (Nesseltiere) Nematocyste Nesselkapseln Metagenese Körperaufbau Gastrovaskularsystem Muskelsystem Nervensystem Besitz von Nesselkapseln extreme Regenerationsfähigkeit Symbiosen mit Grünalgen und Dinoflagellaten 3 Untergruppen mit Metagenese (Scypho-, Cubo-, u. Hydrozoa) Gefüllt mit komplizierten toxisch wirkenden Sekreten zur Abwehr/Angriff [hochkomplexe Proteine Histamin,Serotonin,Prostaglandine] Wechsel von asexueller mit sexueller Vermehrung Polypstadium (asex.) Meduse (sex.) Planula-Larve Polypst... Zwei Schichten: Außen Ektoderm Mesogloea Innen Entoderm Nahrung wird über den Mund aufgenommen (da es kein After gibt) wird diese später dann auch über den Mund ausgestoßen Epithelmuskelzellen im Ekto und Entoderm Sinneszellen zwischen Epithelzellen. Kein ZNS
14 Anthozoa (Korallentiere) Akontien Skelett Basalplatte Sklerosepten Theca Columella Fortpflanzung -Scyphozoa (Scheibenquallen) Fortpflanzung Ephyra -Cubozoa (Würfelquallen) Fortpflanzung Anthopolyp: Nur in Polypenform auftretend Tentakel am Rand der Mundscheibe (starke Muskulatur) Nematocysten auch im Entoderm an den Akontien werden durch den Mund/Poren hinausgeschleudert Mit Nematocysten beladener Faden, der herausgeschleudert wird. Nach Außen und Innen von Ektodermzellen (Kollagen- Apatit-Ähnlich) Kreisrunde Fußplatte aus Kalk 12 radiäre Kalklamellen auf der Basalplatte Ringförmige Mauer, zu den Septen peripher liegend Säulenartige Erhebung in der Mitte der Basalplatte Keine Metagenese! Ergo kein Medusenstadium. Geschlechtszellen gebildet im Entoderm und über den Mundabgegeben. Es entsteht die Planula Larve. 4 entodermale Septen 4 kantiger Rüssel (Proboscis) Tentakeln aus einer einreihigen Achse von Entodermalzellen Polyp teilt sich mehrmals quer und es entstehen wie Medusenanlagen wie Becher gestapelt (Strobilation) Diese entwickeln sich zu Ephyren Jungstadium einer Meduse welche sich zur geschlechtsreifen entwickelt Polypen ohne Gastraltaschen Medusen würfelförmig mit vielen Ecktentakeln Pedalium: Verdickte Tentakelbasis Velarium: Ventilklappe in der Vertiefung des Schirmes Rhopalien: Sinneskörper mit Statolithen ( Sehorgan) Statolithen: mikroskopisch kleine Körnchen Metagenese; Polyp kann sich auch durch knospung Fortpflanzen -Hydrozoa Tentakeln mit Nesselzellen Zweischichtige Körperwand Epidermis Mesogloea Gastrodermis Epi bzw. Ektoderm sondert cuticuläres Periderm, Perisark ab Fortpflanzung Geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung nebeneinander Polyp / Medusa Dimorphismus -Ctenophora (Rippenquallen) Fortpflanzung Sessiler / frei beweglicher Cnidaria [Dimorphismus] Selbes Individuum hat zwei verschiedene Körperformen Keine Nesselzellen Zweischichtige Körperwand Epidermis Mesogloea Gastrodermis Disymmerisch Bewegung: 8 "Rippen" mit Ruderplättchen Schweresinneorgan koordiniert Wimpernschlag 2 Tentakel zurückziehbar mit Kolloblasten (Klebzellen) Gastrovaskularsystem mit "Pseudoanus" (Exkretionsorgan) Zwittrig: Eier und Spermien gelangen durch den Mund nach Außen
15 Bilateria Autapomorphe Merkmale: Bilateralsymmetrie Cephalisation (Vorder und Hinterpol) Gehirn und Zentrales Nervensystem Sagitalebene (Links und Rechts) Gastrula mit drei Keimblättern (Ento- Ekto- und Mesoderm) Filtrationsnephridien Larventypen Coelom Trochophora-Larve Acoelom (Schizocoel) Mixocoel Pseudocoel 1. Trochophora-Larve (Spiralia) 2 Wimperkränze schlagen gegeneinander [Downstream-Collecting-Type] multicilliäre Zellen 2. Dipleurula-Larve (Deuterostomia/Radialia) Band monocilliärer Zellen [Upstream-Collecting-Type] Flüssigkeitsgefüllte sekundäre Leibeshöhle mesodermalen Ursprungs mit eigenem Coelothel hat sich 2 mal konvergent entwickelt aus: Mesenchym, Zellsträngen, Mesodermsäcken daraus entstehen: Coelothel mit Muskulatur, Bindegewebe, Mesenterien u. Dissepimente Mesoderm aber kein Coelom - Körperinneres mit Parenchym erfüllt. Sek. Leibeshöhle verschmilzt mit der prim. Leibeshöhle (Blastocoel) Leibeshöhle wird nicht von dem eigenem Epithel abgegrenzt Exkretionsorgane Filtrationssysteme: Protonephridien (typ. f. Acoelomaten) Metanephridien (typ. f. Coelomaten) Nephron (typ. f. Verebraten) Protonephridien (Acoelomaten, Larven der Anneliden und Molluscen) Metanephridien Nephron Malpighischen Schläuche Sekretionssysteme: Malpighischen Schläuche (typ. f. Arthropoda) Paarige, oft stark verzweigte Kanälchen, die durch Exkretionsporen nach außen führen. Terminalzelle(Reußelgeißelzelle)-Wimpernflamme Bild endende Terminalzellen (Ultrafiltration und Resorption) d.h es entsteht ein Primärharn und ein Sekundärharn. Mit Coelom verbundene Wimperntrichter; treibende Kraft: Blutdruck Die Ultrafiltration findet zuerst durch die Basalmembran der Blutgefäße und danach abermals durch Podocyten statt, die sich am Coelomepithel beim Wimperntrichter befinden Nierenkörperchen filtriert Primärharn aus dem Blut. Anschließende Tubulussysteme resorbieren wie bei Proto und Metanephridien. Bowmansche Kapsel ist der Filterapparat Tubulussysteme resorbieren und erstellen prim. u. sek. Harn Bei Aves und Mammalia: Helensche Schleife um hyperosmotischen Harn gegenüber dem Blut bilden zu können. Sekretionsnieren: Anhänge des Verdauungstraktes die keine Ultrafiltration durchführen wie Proto und Metanephridien
16 Synzytium -Acoelomata -Plathelminthes (Plattwürmer) -Turbellaria (Strudelwürmer) -Trematoda (Saugwürmer) 0,5-70mm Fortpflanzung -Kleiner Leberegel Clonorchis sinensis Acoelomaten (Mesoderm bildet keine Hohlräume) Körperinneres mit Parenchym erfüllt. Darm mit nur einer Öffnung wie bei den Hohltieren After, Blutgefäße, Atmungsorgane u. Segmentierung fehlen Da Atmungsorgane fehlen ist er platt Protonephridialsystem gut entwickelt Marin, freilebende Plattwürmer Kein After; Darm oft verzweigt u. blind Auf der Bauchseite bewimpert Ungeschlechtlich o. Zwitter; Einfache Eier mit Spiralfurchung Wenn Larve dann vom Protrochula-Typ (Müllersche Larve) Ausschließlich Parasiten Hermaphroditsch (sind vollständig männl. u. weibl.) Haben einen Generationswechsel Meist Tropenkrankheiten da der ZW wechselwarm ist Neodermis (Tegument): sek. Körperbedeckung wird von einem Synzytium gebildet. Polyenergide (mehrkernige) Zelle (durch Verschmelzung o. Mitose) [ZW: Schnecken/Insekten(asex.)] [EW: Wirbeltiere (sex.)] [Embryoeier im Fäzes] [Schenke] [Fisch] [Wirbeltier(sex.)] Miracidia; Sporocyst; Rediae; Cercariae // Metacercariae;Cyste // Adult -Schistosoma Weibchens sitzt in der Bauchfalte des Männchens Erreger der Bilharzia-Krankheit [Humanpathogen] [Embryoeier im Fäzes] [freie Miracide im Wasser infiziert Schenke] [Cercarien kommen frei] [durchbohren v. Wirbeltierhaut (EW)] -Cestoda (Bandwürmer) bis 20m -Echinococcus (Fuchsbandwurm) -Taenia solium (Schweinebandwurm) Proglotiden Excurs: Fortpflanzung + Ausschließlich Parasiten (im Darm/Leibeshöhle v. Wirbeltieren) Nahrungsaufnahme durch Körperoberfläche (kein Darm) Scolex (Kopf) mit paarigem Cerebralganglion und Haftorganen Proglotiden (Schwanzsegmente) mit zwittrigen Gonadenpaar Neodermis (Tegument): sek. Körperbedekung [Eier im Fäzes d. Hundes(EW)] [Cysten im Gewebe v. Wirbelt.(ZW)] [Humanpathogen] [Eier o. Proglotiden d. Mensch (EW)] [Cysten '' ] Zuerst werden männl. Geschlechtsorgane dann weibl. reif. 1. Biparental ( 2 Eltern) Zwei Individuen befruchten sich gegenseitig 2. Uniparental (1 Elter) Vegetativ (asexuell/amitotisch) nur hier Klone! Parthenogenese (meiotische Prozesse der Eizelle) Selbstbefruchtung (Zwitter befruchten sich selbst) homozygotisierung der Allele
17 Pseudocoelomata -Aschelminthes (Rundwürmer) -Rotatorien (Rädertierchen) Besitzen erstmals einen After Zellkonstanz: Zellen sind schon ganz früh im Entwicklungsstadium (Furchung) in ihrem Schicksal festgelegt. Geringe Regenerationsfähigkeit Keine Asexuelle Vermehrung Räderorgan: Wimpernkranz im Mund 0,05-3mm Fortpflanzung -Nematoda (Fadenwürmer) Fortpflanzung "Bdelloidea existiert seit 35 Mio. Jahren ohne Sex" Generationswechsel: von uni- zu biparental Normale Bedingungen: Weibchen machen diploide Parthenogenese Kritische Bedingungen: Weibchen machen haploide Parthenogenese es entstehen Zwergmännchen, die ihre Mütter befruchten Häufigstes aller Tiere / Modelorg.: C. Elegans / Ascaris wegen Eutelie (Zellkonstanz) meist getrenntgeschlechtlich; freilebend o. Parasitisch Epidermis bildet ein Syncytium, Cuticula wird gehäutet Ovarium Eileiter Uterus Vereinigung der beiden Schläuche Vagina Hoden Samenleiter ( Ductus ejaculatoris ) Kloake mit 2 Spicula Parasit als Trichine im Gewebe des Wirtes -Protostomia Nervensystem liegt ventral, Herz dorsal Blastoporus (Urmund) Mund / After bricht sek. durch. Coelom aus Zellhaufen (Würmer, Molluscen, Insecten) -Deuterosomia Nervensystem liegt dorsal, Herz ventral Blastoporus (Urmund) After / Mund bricht sek. durch. Coelom aus Darmausstülpung (Wirbeltiere) -Protostomia -Spiralia -Mollusca (Weichtiere) 0,5mm-18m Kopf Fuß Mantel Spiralfurchung: Zellquartette gegeneinander versetzt und schräg zur Eiachse (Mitosespindeln) 2d-Oberflächenepithelien Zellen der Blastula determiniert 4d-Urmesodermzelle (Muskel) Orthogon: Längs-Quer-Nervennetzwerk Cephalopodium (Kopffuß) Mund. Fortbewegungsstrukturen, Nervensystem, Sinne Visceropallium (Eingeweide+Mantel) Eingeweide, Pallium (dors. Epithel), Schutzfunktionen Oft asymmetrisch ( Larve: Trochophora, Veliger) Coelom auf Gonaden und Herzregion beschränkt [Gonocoel und Perikard] Körper durch partielle Druckänderung beweglich Mit ZNS, Augen, Mechano-, Chemorezeptoren und Mundöffnung Bewimpert, 3-D Muskelnetzwerk Kriechen, Graben, Schwimmen Drüsen chitinöse Cuticula, Stacheln,Schuppen, Schalen(platten) Blutgefüllte Sinusräume und Lakunen
18 Conchifera (Schalenweichtiere) Darmtrakt Buccaldrüsen Zirkulationssystem Herz Blut Nervensystem Larve -Polyplacophora (Käferschneken) Exkretion Schale einfach angelegt (außer bei Bivalvia-Muscheln) Bei Larve Schale aus Ektodermzellen Conchin(Glykoproteid), Aragonit (Ca[CO 3 ])(trigonal/rhomisch) Pallialhöhle (Mantelhöhle) mit Anus, Kiemen (Ctenidien) und chem. Sinnesorgane (Osphradien) Mundöffnung Buccalapparat Oesophagus Magen Mittel/Enddarm Anus Radula (Zähne aus Chitin+Conchin) wird hinter dem Pharynx gebildet Speicheldrüsen Offen (ohne epitheliale Gefäswände): Sinus und Lakunen 1 Ventrikel (Herzkammer), >2 Atrien (Vorhof), Aorta ant-, posterior Haemolymphe, Atmungspigmente, Haemocyanin, Haemoglobin Echte Ganglien, tetraneural (4 Längsstränge), Nervenzellen uni-,bi-,multipolar Phaosomzellen (Haut-Lichtsinn), Riesenaxone Ø = 700µm Streptoneurie: Überkreuzung v. Hauptnervensträngen durch ontogen. Torision Cerebralganglien Fühler, Augen, Statocysten Pleuralganglien Pleurovisceralstränge(Innervation) Manterrand Visceralganglion " ( " ) Eingeweide Pedalganglien Fußmuskulatur Parietalganglien Herz, Kiemen Trochophoraähnliche Veligerlarve Marin mit stark haftendem Kriechfuß 8 dorsale Schalenplatten umgeben vom Gürtel (Perinotum) Kopf durch Furche vom Fuß abgesetzt Mantelraum umzieht Kopf und Fuß Bewimperte Kiemen Wasserstrom Ausläufer d. Teguments: Speicher, Sinnesfortsätze, Ästheten Ästheten (können zum Auge mit Retina differenziert sein) Radula mit Magnetid verhärtet Durch Podocyten über Atriumwand in d. Perikard Renoperikardial Nierensäcke hinten in der Mantelrinne. Genitalsyst. Getrenntgeschl., Gonaden verschmolzen, Gonodukte paarig, Genitalöffnung -Lepidopleurida -Chitonida -Monoplacophora / Tryblidia (Napfschaler) -Solenogastres (Furchenfüßer) 1-30mm Ctenidien adanal; Osphradien ersetzt Ctenidien abanal; immer Osphradien 8 Paar dorsoventrale Muskeln verbinden Schale und Fuß Mantelraum mit 3-6 Paar Ctenidien (Ventilationsfunktion) Mantelepithel übernimmt die Atmung Zwischen Sandkörnern Querschnitt rund, ventral bewimperte Gleitrinne mit Schleim Mantelhöhle (ohne prim. Kiemen) subterminal Atriales Sinnesorgan am Mund Cuticula: Stacheln, Schuppen aus Aragonit Saugen gerne Hydroidpolypen aus Radula mit Pinzettenstrucktur
19 Bivalvia (Muscheln) Muschel mit Sipho Aquatisch, kiemenatmend 2 asym. Schalen u. 2 laterale Lappen, d. d. Körper einschließen Schalen über elastisches Ligament (Scharnierband) verbunden Scharnierschloss: Zähne, Leiste, Ligament 3 Mantelfalten 1. Innen: muskulöser Verschlussraum (= Adduktoren) 2. Mittel: trägt Sinneszellen und Organe 3. Außen: Schalenbildung Grab-, Kriechfuß // Springmuskel bei Herzmsucheln Fuß drüsenreich: Byssusdrüse: produziert Byssus-Haftfäden venrtal: Ingestions(Einstrom)öffnung; Fußdurchtritt dorsal: Egestions(Ausstrom)öffnung Geschlechtswechsel möglich! Schlosstypen Taxodont: viele gleichartige kl. Zähne Heterodont: wenige unterschiedliche Zähne Desmodont: 2 Zähne löffelartig verschmolzen Dyodont: ohne Zähne Isodont: wenige symm. Zähne Hemidapedont: wenige ausgeprägte Zähne Kiementypen Protobranchien: Ventilations-Atmungsfunktion Septibranchien: Mantelhöhle durch horiz. Septum unterteilt Filibranchien: Abfiltrierung von Nahrungspartikeln Eulamellibranchien: Abtransport von Exkreten, Gameten Darmtrakt Herz Zirkulationssystem Exkretionssystem -Gastropoda (Schnecken) Helix Pomatia Fortpflanzung Zwitterdrüse Mund Oesophagus Magen Mitteldarm(drüse) Enddarm Anus Im Mitteldarm Anlagerung: Quecksilber; Red tides (Dinoflagellatentoxin) Filtrierer, Holzverwerter, Räuber mit Saugsipho 2 Laterale Atrien + Ventrikel, der den Enddarm umschließt V. Ventrikel mit anteriorer und posteriorer Aorta Kiemen,Mantel Über Atrien via Podocyten Ultrafiltration Asymmetrie des Körpers durch Torision (gegen Uhrzeigersinn) Streptoneurie s.o. (bzw. Sek. aufgehoben Euthyneurie) Schale fast immer einteilig und Weichkörper zurückziehbar Operculum: Deckel aus Conchin und Kalk auf dem Hinterfuß Diaphragma: Kalkiger "Winterdeckel" bei Helix pomatia Clausilim: Spez. Verschlussapparat Gedächtnisleistung bis zu 4 Monaten Sipho: Strömungsmesung / Phaosomen u.v.w. Rezeptoren Veliger-Larve Meist Zwitter (Hermaphroditen); Liebespfeil mit Hormonen; Austausch von Spermatophoren; Receptaculum seminis speichert diese und befruchtet von der Zwitterdrüse kommende Eizellen. Produziert Spermien und Eizellen deswegen Zwitterdrüse
20 Cephalopoden (Kopffüßer) Darmtrakt Tintenfisch Zirkulationssystem Coelom Fortpflanzung -Articulata (Gliedertiere) Kommissur Konnektiv -Anneliden (Ringelwürmer) Lumbricus terrestris 50µm-3m Prostomium Peristomium Pygidium Chaetoblast Zirkulationssystem aus prim. Leibeshöhle Enorme Sinnesfähigkeit (z.b. Paul) [Riesenfasernsystem] Mundöffnung mit 1-2 Kränzen von Armen (z.t. mit Saugnäpfen) Hectocotylus: Begattungsarm ; Fangarme; Arme mit Zähnchen Trichter: Fußderivat zum Schwimmen (Rückstoßprinzip) Gekammerte Schale Großer Eingeweidesack Hauptganglien zu Gehirn verschmolzen mit Knorpelschutzhülle everser Augentyp (Hauteinstülpung) bei Vertebraten invers (ZNS) Buccalhöhle mit Kiefer Radula Oesophagus Vor- Magen Mitteldarmdrüsen Caecum Intestinum Rectum Anus Fast geschlossen; Haemocyanin in Haemolymphe gelöst Stark erweitert: Perikard, Nierensäcke, Genitalhöhle Innere Befruchtung; Eier groß, dotterreich discoidale Furchung! Gliedrung in Acron / Telson ( Vorder- / Hinterregion) Homonome Gliederung der Segmente (Metamere) Metamere da praeanale Sprossungszone (Teloblastie) Teloblastie: Wachsen von hinten nach vorne Paarige Körperanhänge (Parapodien bzw. Extremitäten) Ein paar Coelomsäckchen und Metanephridien Paariges Ganglion mit Kommissuren und Konnektiven Querverbindung zwischen zwei Ganglien Längsverbindung zwischen zwei Ganglien Homonome( Heteronome) Segmentierung [2 uralte Gene] Teloblastische (praeanale) Sprossung homonomer Segmente Jedes Segment prim. 1 Paar Parapodien Segmente durch Dissepimente getrennt (lateral durch Mesenterien) Prostomium,Pygidium (unechte Segmenete ohne Coelom) Strickleiternervensystem Epidermis einschichtig m. vielen Drüsen und Borsten in Borstenfollikeln Borsten beweglich durch Muskelantagonisten an der Basis Hautmuskelschlauch: Außen Ring- ; Innen Längsmuskulatur schräggestreifte Muskulatur + Coelom = hydrostatisches Skelett Wurzeln der Schlundkonnektive oft verschmolzen Aus Epispäre d. Trochophora. Sitz d. Oberschlundganglions Hinter d. Prostomium; Trägt die Mundöffnung m. Tentakelcirren Aus caudalem Bereich d. Trochophora; m. Analcirren Borstenbildende Zelle 1. Bauchgefäß: Blut von vorne nach hinten 2. Rückengefäß: kontraktil, von hinten nach vorne (Dorsalherz)
21 Darmtrakt Exkretion Fortpflanzung Autotomie Paratomie -Polychaeta (Borstenwürmer) Vorderdarm(ektod.) Mitteldarm(entod.) Enddarm(ektod.) Larve Protonephridien ; Adult Metanephridien (homolog) Gameten prim. In Wasser Befruchtung Trochophora Aus einem Segment ensteht ungeschlechtlich ein neuer Organismus Bildung von Tierketten die in Einzelindividuen zerfallen Kein Clitellum Parapodien mit Chitinborsten (Setae) Pharynx kiefertragend Schizogame Epitokie mit Stolo( + ) aus Amme( ) Lunarperiodizität Clitellum Epitokie Atokie Stolo Amme -Oligochaeta (Wenigborster) Darmtrakt Darmwand Verdickter Segmentgürtel mit Drüsen klebriges Sekret für Eikokons Neuorganisation! Individuum geht meist nach Gametenabgabe zu Grunde Ohne Epitokie Vegetativer Abschnitt der zu Individualentwicklung fähig ist Weibchen-Amme besteht aus 2 Stolonen ( + ) Proterandrische Zwitter (Hermaphroditen) ohne Parapodien mit Clitellum Proterandrisch: männl. Gonaden wachsen zuerst 4 Borstenpaare /Segment ; Gonaden in max. 4 Segmenten Coelom durchzieht kammerartig den ganzen Körper Auskleidung mit Coelomepithel (Peritoneum) Metanephridien mit Nephrostom (Wimperntrichter) "Gehirn" verlagert sich weiter nach hinten Vollständige Verschmelzung der Wurzelkonnektive/Bauchmark peristaltische Kontraktionsbewegung Mund, Kropf, Kaumagen, Blindsäcke, After Peritoneum, Chloragogzellen Chloragoggewebe Leberähnliches Speicher und Exkretionsgewebe aus Peritonealepithel Fortpflanzung -Hirudinea (Egel) Befruchtung innerhalb d. Körpers im Gegensatz zu Polychaeten Entweder direkte Entwicklung oder Metamorphose (Trochophora) Abgeflacht ohne Borsten mit Saugnäpfen an beiden Körperenden Zwitter, Brutpflege, Kokonbildung; Räuber oder Blutsauger Konstante Segmentzahl Kiefer Verengung des Coeloms mit Parenchym zu Coelomkanälen Blutegel häufig genutzt für medizinische Fälle
22 Arthropoden (Gliederflüßer) α-chitin Ecdysis Zirkulationssystem Individuen weltweit Keine äußeren Bewegungscilien Gegliederte Extremitäten (Coxa,Trochanter,Femur,Tibia,Tarsus) Heteronome Gliederung ( Kopf-Thorax-Schwanz) Syncerebrum (Komplexgehirn) Starres α-chitin-cuticula-exoskelett Ecdysis (Häutung) Trichome: unechte Haare mit Haftfunktion (Cuticulaauswüchse) Mixocoel und offenes Kreislaufsystem Antennen, Maxillen etc. und Extremitäten sind homolog Eier dotterreich (centrolecithal) Superfizielle Furchung 1,4-β-glykosidisch verknüpftes N-Acetylglucosamin Polymer wird von der Unterliegenden Epidermis abgegeben (3 Schichten) Exuvie wird abgetragen. Bildung von Häutungsmembran und -spalt Blut + Coelomflüssigkeit = Haemolymphe (Haemocyanin, Hexamerin) 3 Etagen durch dorsales und ventrales Diaphragma getrennt: 1. dorsale Etage: Pericardialsinus 2. mittlere Etage: Perivisceralsinus 3. ventrale Etage: Perineuralsinus Herz(Dorsalgefäß) abgetrennt von d. Leibeshöhle v. Pericardialseptum Exkretionssystem Metanephridien mit Coelomsack (Sacculus aus Podocyten) Ultrafiltration Nur bei Onychophora beginnen Nephridien mit Nephrostom Außerdem Malpighische Gefäße Fortpflanzung -Onychophora (Stummelfüßer) Nervensystem Komplexaugen Nur geschlechtlich Ursprüngliste Arthropoden [Krallenträger] Körper wurmförmig; homonom gegliedert (geringelt) Körper dicht mit beschuppten Papillen bedeckt (Rezeptorzellen) Extremitäten zeigen die Segmentabfolge an Oralpaillen mit Wehr- und Schleimdrüsen Subepidermale Matrix aus Kollagenfasern (Elastizität) Muskulatur nicht segmental (Ring-Diagonal-Längsmuskeln) Paariges Gehirn über dem Pharynx, 2 vent. Bauchmarkstränge geben pro Segment 8 Segment- und 2 Fußnerven ab Bestehen ihrerseits aus Ommatidien Exkretionssystem Nephridien (diff.) in jedem Segment. z.t. mit/ohne Nephrostom Derivate: Anal- Speicheldrüsen und Ausführgänge der Geschlechtlsprodukte Epimorphose -Tardigrada (Bärtierchen) Junge werden mit voller Segmentzahl geboren Kopf - 4 Rumpfsegmente 4x2 Beine mit Zehen und Krallen Keine Gliederextremitäten Beine teleskopartig einziehbar Stilettapparat zum Anstechen von Nahrung Saugen m. Pharynx Oberschlund und Bauchganglion: Strickleiterförmig verknüpft
23 Euarthropoda Plattenskelett und Auflösung des Hautsmuskelschlauchs dors. 1 Tergum, lat. 2 Pleurite, vent. 1 Sternum Verbunden über bewegliche Intersegmentalhäute (Resilin) Cephalon (Acron) aus 5 Segmenten 6. angeschmolzen 1 Paar Facettenaugen; 4 Medianaugen Gliederextremitäten Muskel im Körper an der Gliederbasis 6 Nephridienpaare Besitzen Tracheenkanalsystem zum Atmen gegliederte Extremität Extr.abwandlungen 1 P. Antennen, 1 P. Antennen, Oberlippe (Labrum), 1 P. Mandibeln, 2 P. Maxillen Nervensystem Oberschlundganglion: Proto-, Deuto-, Tritocerbrum u. Unterschlundganglion [Sehnerven-, 1. Antennen-, 2. Antennen-, Mandibeln u. Maxillen] -Chelicerata Prosoma und Opistosoma (Verschmelzung d. Segmente) Ohne Antennen und Mandibeln Vordere Gliedmaßen mit Scheren (Cheliceren) 2. Gliedmaßen Kiefertaster (Pedialpus) Exkretionssystem Nephridienderivat: Coxaldrüsen + Nephrocyten + Malpighische Schläuche Zirkulationssystem Fortpflanzung Systematik -Arachnida (Spinnentiere) Systematik -Crustacea (Krebstiere) offen Gonaden prim. paarig Pedipalpen (u.a. Skorpione), Arachnida, Xiphosura 4 Laufbeinpaare am Prosoma keine am Opistosoma Geißelspinnen und Geißelskorpione 3 Laufbeinpaare 1 Tastbein Buchlungen (Fächerlunge) [Pedipalpus] Entodermale Malpighigefäße Max. 8 Augen Superfizielle Furchung Patella (Knie) zwischen Femur und Tibia Scorpiones, Araneae (Weberspinnen), Acari (Milben), Pantopoda (Asselspinnen) Tagmata: Cephalo thorax Abdomen (Pleon) Peraeon: Verbliebener freier Thoraxanteil Carapax: Kopffalte die den Thorax überdeckt Spaltbein: Exopodit (Schwimmast) und Endopodit (Schreitast) Epipodit (Kiemen) Petasma: gekoppelte Pleopoden Facettenaugen mit Kristallkegel ventrale Geschlechtsöffnung Naupilus-Larve, Zoea (Decapoda)-Larve oder direkte Entwickl. Naupilus: 3 Metamere, 1 unpaares Medianauge zentr. a.d. Acron Extr.abwandlungen 1 P. Antennen I, 1 P. Antennen II, 1 P. Mandibeln, 2 P. Maxillen I, 2 P. Maxillen II Fortpflanzung Meist getrenntgeschlechtlich sonst Parthenogenese u. Heterogonie
24 Branchiopoda -Cladocera (Kiemenfüßer) (Wasserfloh) Spezieller Filterapparat Bau der Naupiluslarve spez. Spermienstruktur Komplexaugen zu unpaarem Auge verschmolzen 2 Antennen: Hauptbewegungsorgane Ephippium: Carapax-Derivat: dors. Brutraum -Maxillopoda 1 Thoraxsegment Maxillipeden (Mundwerkzeug) -Malacostraca höhere Krebstiere -Iospoda (Asseln) -Entomostraca niedere Krebstiere -Insecta (Hexapoda) Darmtrakt Entwicklung Holometabolie Hemimetabolie 8 Thoraxsegmente: Thoracopoden Maxillipeden /Stabbeine 7 Hinterleibssegm.: Pleopoden Spaltbeine Uropoden+Telson = Schwanzfächer Herz im Hinterleibssegm Pleotelsom; Chephalothorax 3 heteronome Tagmata: Caput (6), Throax (3), Abdomen (11) Thorax: Pro-, Meso-, Metathorax 6x6 Gliedrige Throrakalbeine: Coxa,Trochanter,Femur,Tibia,Tarsus Flügel an Meso oder Metathorax Thorax erfüllt von Bein und Flügelmuskulatur dors. Tergigt; lat. 2 Pleurite, vent. Sternit jeweils 1 Paar Stigemen, Ganglien und Extremitäten Integument Protein-Chitin-Cuticula MWZ: Labrum, Mandibeln, Maxillen, Labium Flügel aus Imaginalscheiben (2-Zellschichtig) Tömosvarysche Organe (postantennal): Feuchtigkeitsrezeptor Mund m. Speicheldrüse Pharynx Oesophagus Kropf Vormagen... Caecum... Colon Rektum Anus Vorderdarm und Enddarm sind ektodermal; Mitteldarm entodermal. Involution d. Keims Amnion u. Serosa (Verschmelzung) Mit Puppenstadien Vollständige Änderung (Larve Puppe Imago) Ohne Puppenstadien Unvollständige Änderung (Larve Imago) Heterometabolie Sukzessive Ausbildung der Flügel in d. Entwicklungsstadien Neometabolie L1-L2-prae P1- P2 - Imago Imaginalscheiben Anlagen der prospektiven Adultorgane (z.b. Flügel) Metamorphose Oligomer Eumer Protopod Eucephal Acephal Wenige Segmente "zahlreiche" Segmente Erste (vordere) Extremität vorhanden Mit Kopf Ohne Kopf
25 Ectognatha (Freikiefler) -Entognatha (Sackkiefler) -Apterygota (Freikiefler) -Pterygota (Freikiefler) -Myrapoda (Tausendfüßler) Pleuralfalten stark verkürzt, Mundwerkzeuge sind frei. Geißelantennen Pleuralfalten mit Labium (2.Maxillen) verwachsen Kiefertasche Stech- und Spatelwerkzeugen // Gliederantennen Ohne Flügel Mit Flügel Eumer Besitzen ab dem 3 Segment doppelte Beinpaare -Deuterostomia Coelomräume in offener Verbindung mit Genital-,Nephridialsystem mesoderm. Skelett und Kiemenspalten Besitzen ein echtes Coelom Eucoelomata Radiärfurchung /Blastoporus wird zum After Kiemendarm Binnenskelett -Hemichordata (Branchiotremata) -Echinodermata (Stachelhäuter) Trimerie: Pro-, Meso-, Metasoma bzw. -coel Vorderdarm als Kiemendarm Stromochord: Vorderdarmdivertikel (Chordaähnlich) Adulte mit fünfstrahliger Symmetrie mesodermales Skelett Protocoel (Axocoel), Mesocoel (Hydrocoel), Metacoel (Somatocoel) Axo & Mesocoel über Steinkanal verbunden. Ambulacralsystem aus Hydrocoel (u.a.fortbewegung) Epidermis, mesodermale Dermis, Bindegewebe (mutabil) Pedicellarien: Greifzangen auf der Epidermis Laterne des Aristoteles (Kauapparat) offenes Zirkulationssystem zwischen Coelothelien kein ZNS / ekto-hyponeurales, apikal u. Aborales System kein direktes Exkretionssystem/ Podocyten Dipleurula-Larve -Chordata Biphasischer Lebenszyklus Neuralrohr, Neuralporus und Canalis neurentericus Kiemendarm mit Schleimfilter Chorda (dorsalis) -Acrania (Schädellose) Mesodermale flexible tugoreszente Stützstrucktur + Chordascheide Cephalochordata -Branchiostoma lanceolatum Modeltypus ursprünglicher Chordaten 180 Kiemenspalten (rot) / 60 Myomere (Muskelsegmente) im Peribranchialraum; über Atrioporus nach Außen Hypobranchialrinne homolog zur Schilddrüse Neuralrohr (gelb)(ektodermal) mit Pigmentbecherocellen Chordascheide durch kleine Muskelpakete ersetzt
26 Acrania Oralcirren (grün) Halbsessil lebend im Psammon (Sandboden) Chorda (schwarz) mit Muskelpaketen bis zur Kopfspitze Coeloemaufteilung im Bereich des Kiemendarms -Urchordata -Tunicata (Manteltiere) -Craniota -Vertebrata (Wirbeltiere) Paedomorphose Progenese Neotenie Heterochronie Tunica aus Tunicin Mangel an Coelom Herz mit Schlagrichtungswechsel Filtrierer mit Kiemendarm Nur bei Larven Chorda und Neuralrohr Chordascheide durch glykogenreiche Zellen ersetzt offenes Zirkulationssystem meist Zwitter / Knospung Neuralleiste vorderer Teil entwickelt sich zum Gehrin Cephalisation: Bildung von Kopf mit echtem Gehirn aus 5 Abschnitten: Telen-,Dien-,Mesen-,Meten-,Myelenchephalon gechützt von Schädelkapsel (prim. nur Neurocranium) 12 Hirnnerven Lange Chorda dorsalis Metamerie Paarige Gonaden; paarige laterale Augen Endoskelett aus Knochen oder Knorpel oder beidem knöchernes Dermalskelett Mehrschichtige Epidermis Placoden: Verdickungen der embryonalen Epidermis Adultus mit Larvenmerkmalen Beibehaltung juveniler Merkmale in späteren Entwicklungsstadien Paedomorphose, die durch frühreife sexuelle Reifung eines Organismus entsteht, der noch in einem morphologisch juvenilen Stadium ist die Verlangsamung der Entwicklung eines somatischen Merkmals, so dass es auch in späteren Entwicklungsstadien juvenil erhalten bleibt; Fortpflanzung auf juvenilem Status Evolutionärer Wandel des Phänotyps, der auf einer Änderung der zeitlichen Steuerung der Entwicklung beruht. Exkretionssystem Nieren aus Pro- und Opistonephrons Zirkulationssystem Cephalisation Rhombenchephalon Geschlossenes Blutgefäßsystem mit ventlalem 4 Kammern-Herz Pros-,Deuterencephalonbläschen Tel-, Di-, Mes-, Rhombenchephalon Metencephalon und Myelencephalon Seitenlinienorgan Haarsinneszellen,die Wasserbewegungen wahrnehmen können Labyrinthorgan Thyreoidea Gleichgewichtsorgan aus Plakoden im Innenohr Schilddrüse; Aus Endostyl (Hypobranchialrinne) d. Lanzettfischchen
27 Nephron Integument Exoskelett Endoskelett Glomerlulus, Bowmansche Kapsel, Tubulus, Helensche Schleife, Tubulus Epidermis, Dermis, Subcutis Bildungen Haare, Zähne, Federn, Schuppen Ostracodermi (urspr. Agnatha) mit Knochenpanzer // o. Arthropoden Mechanische innere Stützstruktur, über Muskeln bewegbar Bindegewebsknochen Knochen die aus dem Mesenchym hervorgehen ohne Knorpel zu ersetzen Ersatzknochen -Cyclostomata (Rundmäuler) -Pteromyzonta (Neunaugen) -Myxinoida (Schleimaale) -Gnathostomata (Kiefermäuler) Knorpeliges Skelett wird in der Ontogenese von Knochen ersetzt Nackter Körper (keine Schuppen[Reduktion d. Dermalskeletts]) Zungenapparat aber kein Kiefer [ Knorpelskelett] Kiemenbeutel Labyrinthorgan mit 2 Bogengänge Gonaden unpaarig // Flossen unpaarig Anadromer Wanderfisch biphasischer Lebenszyklus unpaare Nasenöffnung 8 paar Kiemenschlitze Ammocoetes-Larve Lamperta fluviatilis Direkte Entwicklung isoosmotisch Myxine glutinosa Ober- und Unterkiefer; mit Zähnen // Schuppen Endoskelett mit Neuro- und Splanchiocranium // Spritzloch Hyoidbogen und 5 Branchialbögen // aus 1.Kiemenbogen paarige Flossen (2 Extremitätenpaare Flossen abgewandelt ) Axone mit Myelinscheide Labyrinthorgan mit drei Bogengängen Splanchiocranium Mit Kieferbogen; ventraler Schädelteil aus 1. u. 2. Kiemenbogen Mandibularbogen 1. Kiemenbogen dors. zum Plantoquadratum; ventr. zum Mandibulare Hyoidbogen -Chondrichtyes (Knorpelfische) Blauhai Osmoregulation 2. Kiemenbogen dors. zum Hyomandibulare; venr. zum Hyoid Geschlossenes Neurocranium knorpeliges Endoskelett keine Schwimmblase/Lunge Rektaldrüsen (Salzdrüse) einige vivipaar Darm mit Spiralfalte 1. Krone - Schmelz - Dentin - Blutader 2. Dermis Bluversorgung der Placoidschuppe Behalten Harn im Blut um nicht hypotonisch zu werden Verdursten -Haie Schwanzflosse heterocerk -Rochen Dorso-ventral Abgeflacht -Chimären Marin, ohne Placoidschuppen
28 Osteognathostomata (Knochenfische) Verknöchertes Endoskelett (Ersatzknochen) knöcherne Flossenstrahlen Kiemenhöhle vom Operculum (Kiemendeckel) bedeckt. i.d.r. beschuppt (Knochenschuppen) Schwimmblase (Vorderdarmausstülpung) [hydrostatisches Organ] -Actinopterygii (Strahlenflosser) Systematik -Neopterygii (Neuflosser) -Teleostei (Neuflosser) -Sarcopterygii (Quastenflosser) Schuppenarten Flossenarten Lepidotrichia: Operculum "Fischlunge" als Derivat des Vorderdarms Chondrostei, Acipenser ; Clasista, Polypterus Eigentliche Knochenfische (99% aller Rezenten Osteognathost.) Monoblastische, paarige Flossen Actinistia: Latimeria chalumnae: red. Wirbelsäule, vivipar 1. Cycloidschuppe 2. Granoidschuppe 3. Ctenoidschuppe 1. Homocerk 2. Heterocerk 3. Protocerk 4. Diphycerk -Sarcopterygii -Rhipidista (Choanata) -Dipnoi (Lungenfische) -Tetrapoda (Vierfüßer) Nasen-Rachengang mit Choanen Rücken-,Schwanz und Analflosse bilden Flossensaum Kiemen und Lungenatmung Protopterus, Lepidosiren, Neoceratodus, Ichtyostega Quadrupedie; Pentadactylie Verschluss der Kiemenspalten Lunge alleiniges Atemorgan der Adulti (Trachea=Luftröhre) Aestivation: Sommerpause m. Kokon gegen Wasserverlust Tränengang Schädel mit unpaarem Gelenkhöcker Schultergürtel nicht mehr mit Kopf verbunden Becken aus: Illium, Ischium, Pubis (Darm-,Sitz-,Schambein) Hyomandibulare wird zum Stapes (Columella) Mandibularbogen: dors. Quadratum; ventr. Articulare (Reste) Vorder- und Hinterextremität: Stylo-, Zeugo-, Autopodium
29 Tetrapoda Verhornte Epidermis/ Augenlider (Verdunstungsschutz) Neuro- und Viscerocranium Endocranium + Dermatocranium (äußere Schädelteile) Choanen Stylo-, Zeugo-, Autopodium Columella -Amphibia (Amphibien) Nasen-Rachen-Gang Schulter(gürtel)-Ober-Unterarm-Handwurzel,Mittelhand,Finger Gehörknöchelchen: Quadratum Amboss ; Articulare Hammer 4 Finger/ 5 Zehen; geteilter Zahn Ectotherm Schädel mit 2 Gelenkhöckern zusätzlicher Mittelohrknochen mit Schultergürtel verbunden epidermale Gift und Schleimdrüsen Hautatmung + Lungenatmung durch Druckventilation Biphasischer Lebenszyklus // Schalenlose Eier -Batrachia Fehlen von Knochenschuppen Höhrsysteme für niedere Frequenzen (Schallwellen ü. d. Boden) - Anura (Froschlurche ) Kaulquappenlarve -Urodela (Schwanzlurche) -Gymnophiona (Blindwühlen) -Amniota (Amnioten) Sprungvermögen Verkürzung der Wirbelsäule // Aposomatische Warnfärbung Urostyl: entsteht durch Verschmelzung der Schwanzwirbel Elle und Speiche bzw. Waden- und Schienbein verschmelzen. Rana (Wasserfrosch), Bufo (Erdkröte), Hyla (Laubfrosch) Langestreckte Körper mit langem Schwanz Neotenie (Werden im Larvenstadium geschlechtsreif) Triturus (Molche), Salamandra, Ambystoma (Axolotl) Wurm- Schlangenähnlich mit reduzierten Extremitäten Hohe Wirbelanzahl Reduktion der Augen Phallodeum: Ausklappbares Kloaken-Korpulationsorgan Monophasischer Lebenszyklus Direkte Entwicklung (kein auq. Larvenstadium) Beschalte Eier Meroblastische Furchung mit Keimscheibe Amnion, Serosa (Chorion), Allantois, Dottersack. Ektodermale Falten des Embryos (Osmoreg.,Blutversorg.,Schutz) -Sauropsidia Iris und Ciliarmuskel im Auge -Chelonia (Schildkröten) Starrer Rumpfpanzer (Theca) aus Knochen und Hornplatten Carapax (Rücken-) und Plastron (Brustharnisch) Verlust der Zähne Hornscheide Verlust der Schläfenfenster (Anapsider Schädel) Verlust des Median-Scheite-Parietalauges Können Kopf einziehen Wirbelsäule S-Förmig (Cryptodira)
30 Diapsida 2 Schläfenfenster (Diapsider Schädel) verknöchertes Sternum -Diapsida -Lepidosauria -Squamata (Schlangen & Eidechsen) -Diapsida -Archosauria -Crocodyla (Krokodile) -Aves (Vögel) viele Knochen verschmolzen Rynchocephalia (Brückenechsen), Squamata (Schlangen) Caudale Autotomie; querstehende Kloakenspalte Hornschuppen: Derivat der Epidermis nicht der Dermis Hornschuppen mit Mikroleiste (Schwimmen durch Sand) Paariger Penis (Hemipenis) und Hemiclitoris, Spaltzunge Katapsider Schädel // Homodonte Bezahnung Krokodile, Vögel Thekodonte Bezahnung; Seitlich abgeflachte Zähne Öffnung im Unterkiefer Pubis und Ischium stabförmig verlängert Brutpflege Verlust der Harnblase Unpaares Nasenloch Sek. Gaumen Seitlich abgeplatteter Schwanz 4-Kammern-Herz; Vetrikel vollständig getrennt! Flugvermögen; Federn Homoiothermie Nur rechter Aortenbogen Hornschnabel Sattelgelenke der Halswirbel Starres Rumpfskelett mit wenigen, fest verwachsenen Brustwirbeln Synsacrum: Hintere Wirbel, Lendenwirbel, Becken verwachsen Pygostyl: Verwachsene Schwanzwirbel Bipedie: Tibia und Fibula Verwachsen // keine 5. Zehe Hallux (4. Zehe) zeigt nach hinten Syrinx am Tracheagabelung: Lautorgan Lunge mit Luftsäcken Bürzeldrüse zur Federreinigung Ovipar (Eierlegend) // Nur ein Eierstock // Reduktion d. Penis Systematik -Palaeognatha (Altkieferaves), Neognatha (Neukieferaves) Federn und Schuppen aus β-ceratin Haare aus α-ceratin Zähne 1. Konturfedern (auf Federfluren) Schaft mit Federfahne Federfahne aus Federästchen mit Bogen und Hakenstrahl 2. Daunenfedern Monophyodontonie: Kein Zahnwechsel Diphyodontie: Milch-Dauergebisswechsel Polyphyodontonie: Mehrfachzahnwechsel Incisivi,Canini,Prämolaren,Molaren Schneide,Eck, Vor-, Backenzähne (Heterodont)
* Phylogenie Im Umbruch begriffen
 Arthropoda Gliederfüßer Annelida Ringelwürmer Mollusca Weichtiere Protostomia* Deuterostomia Chordata Chordatiere Echinodermata Stachelhäuter Bilateria Eumetazoa Nematoda Fadenürmer Plathelminthes Plattwürmer
Arthropoda Gliederfüßer Annelida Ringelwürmer Mollusca Weichtiere Protostomia* Deuterostomia Chordata Chordatiere Echinodermata Stachelhäuter Bilateria Eumetazoa Nematoda Fadenürmer Plathelminthes Plattwürmer
Funktionelle Organisation der Tiere
 Zoologie Funktionelle Organisation der Tiere BIO-ZOO-02-V-2 Vorlesung (1./2. Sem.) Jan Pielage Zoologie & Neurobiologie Prof. Jan Pielage, Zoologie/Neurobiologie, Vorlesung Zoologie, Sommersemester 2016
Zoologie Funktionelle Organisation der Tiere BIO-ZOO-02-V-2 Vorlesung (1./2. Sem.) Jan Pielage Zoologie & Neurobiologie Prof. Jan Pielage, Zoologie/Neurobiologie, Vorlesung Zoologie, Sommersemester 2016
Knorpelfische, Knochenfische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säuger
 Stamm: Chordata Ust. Tunicata Manteltiere Ust. Acrania Schädellose Ust. Vertebrata (Craniota) Wirbeltiere Agnatha Rundmäuler, ohne Kiefer Gnathostomata mit Kiefer, Klassen: kennzeichnende Merkmale: Knorpelfische,
Stamm: Chordata Ust. Tunicata Manteltiere Ust. Acrania Schädellose Ust. Vertebrata (Craniota) Wirbeltiere Agnatha Rundmäuler, ohne Kiefer Gnathostomata mit Kiefer, Klassen: kennzeichnende Merkmale: Knorpelfische,
Articulata (Gliedertiere) : Annelida + Arthropoda
 Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) Onychophora (Stummelfüßer) Trilobita (+++) Chelicerata (Pfeilschwänze; Spinnentiere) Crustacea (Krebse) Tracheata (Tausendfüßer; Insekten) Weitaus artenreichster Tierstamm:
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) Onychophora (Stummelfüßer) Trilobita (+++) Chelicerata (Pfeilschwänze; Spinnentiere) Crustacea (Krebse) Tracheata (Tausendfüßer; Insekten) Weitaus artenreichster Tierstamm:
Die Zelle: Das Leben ist zellulär Gewebe I: Die Basis für Organe und Organismen. Phylogenie der Vertebraten I: Chordata Die Wurzeln der Vertebraten
 Vorlesung Allgemeine Zoologie I Teil: Cytologie, Anatomie und Phylogenie der Wirbeltiere Prof. Dr. U. Wolfrum www.ag-wolfrum.de.vu Password für PDF-Files von ausgewählten Folien und Arbeitsvorlagen: Retina
Vorlesung Allgemeine Zoologie I Teil: Cytologie, Anatomie und Phylogenie der Wirbeltiere Prof. Dr. U. Wolfrum www.ag-wolfrum.de.vu Password für PDF-Files von ausgewählten Folien und Arbeitsvorlagen: Retina
Überblick der Systematik des Tierreiches Stand 2012
 Überblick der Systematik des Tierreiches Stand 2012 Bildquellen: http://www.digitalefolien.de/biologie/tiere/system.html; PURVES et al. (2012): Biologie. Spektrum Verlag, 9..A., Wie viele Tier-und Pflanzenarten
Überblick der Systematik des Tierreiches Stand 2012 Bildquellen: http://www.digitalefolien.de/biologie/tiere/system.html; PURVES et al. (2012): Biologie. Spektrum Verlag, 9..A., Wie viele Tier-und Pflanzenarten
Baupläne im Tierreich Fragenkatalog SS2004/05
 Baupläne im Tierreich Fragenkatalog SS004/05 Verfasst von Sebastian Stabinger Fragen aus dem Biologieforum Letzte Änderung am: 0. Juni 005 email: csad799@uibk.ac.at = http://www.pi.com Kapitel Allgemeines
Baupläne im Tierreich Fragenkatalog SS004/05 Verfasst von Sebastian Stabinger Fragen aus dem Biologieforum Letzte Änderung am: 0. Juni 005 email: csad799@uibk.ac.at = http://www.pi.com Kapitel Allgemeines
Phylogenie der Vertebraten II: Agnatha Gnathostomata Wasser-Land-Übergang Phylogenie der Vertebraten III: Tetrapoda: Der Weg zu den Mammalia zu uns
 Vorlesung Allgemeine Zoologie I Teil A: Cytologie, Anatomie und Phylogenie der Wirbeltiere Prof. Dr. U. Wolfrum www.ag-wolfrum.de.vu Retina Password für PDF-Files von ausgewählten Folien und Arbeitsvorlagen:
Vorlesung Allgemeine Zoologie I Teil A: Cytologie, Anatomie und Phylogenie der Wirbeltiere Prof. Dr. U. Wolfrum www.ag-wolfrum.de.vu Retina Password für PDF-Files von ausgewählten Folien und Arbeitsvorlagen:
ohne mit eukaryontische Pflanzen Pilze Tiere zusammenschliessen unterschiedliche Aufgaben Vielzeller
 Merkmale des Lebens 1. Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. 2. Alle Lebewesen bewegen sich aus eigener Kraft. 3. Alle Lebewesen haben einen Stoffwechsel. 4. Alle Lebewesen wachsen. 5. Alle Lebewesen
Merkmale des Lebens 1. Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. 2. Alle Lebewesen bewegen sich aus eigener Kraft. 3. Alle Lebewesen haben einen Stoffwechsel. 4. Alle Lebewesen wachsen. 5. Alle Lebewesen
Cephalopoda - Kopffüß. üßer. Eine Übersicht
 Cephalopoda - Kopffüß Eine Übersicht Inhalt 1. Wo befinden wir uns eigentlich? 2. Allgemeines über Cephalopoden 3. Wie sieht s von Außen und Innen aus? Körperbau Blaues Blut Nervensystem / Sinnesorgane
Cephalopoda - Kopffüß Eine Übersicht Inhalt 1. Wo befinden wir uns eigentlich? 2. Allgemeines über Cephalopoden 3. Wie sieht s von Außen und Innen aus? Körperbau Blaues Blut Nervensystem / Sinnesorgane
Autotrophe Ernährung. Heterotrophe Ernährung. Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien
 2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8
 Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
1. Erklären Sie das Konzept der Biospecies. Warum kann man sagen, dass dieses nicht merkmalsbezogen ist?
 Biodiversität Teil Kropf 1. Erklären Sie das Konzept der Biospecies. Warum kann man sagen, dass dieses nicht merkmalsbezogen ist? Arten sind Gruppen sich miteinander kreuzender Populationen, welche hinsichtlich
Biodiversität Teil Kropf 1. Erklären Sie das Konzept der Biospecies. Warum kann man sagen, dass dieses nicht merkmalsbezogen ist? Arten sind Gruppen sich miteinander kreuzender Populationen, welche hinsichtlich
Parasitologie. Univ.Prof.. Mag.Dr. Franz F. Reinthaler
 Parasitologie Univ.Prof.. Mag.Dr. Parasitismus = Leben oder zumindest Vermehrung durch Energieraub in oder an einem anderen lebenden Organismus (=Wirt) Parasiten = alle Erreger von Infektionen und Infestationen,
Parasitologie Univ.Prof.. Mag.Dr. Parasitismus = Leben oder zumindest Vermehrung durch Energieraub in oder an einem anderen lebenden Organismus (=Wirt) Parasiten = alle Erreger von Infektionen und Infestationen,
Fortpflanzung bei Tieren
 Fortpflanzung bei Tieren Von Lothar Leuschner und Hans Herrlich Ernst Klett Verlag Stuttgart Düsseldorf Leipzig imslnialittswerasoonras 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
Fortpflanzung bei Tieren Von Lothar Leuschner und Hans Herrlich Ernst Klett Verlag Stuttgart Düsseldorf Leipzig imslnialittswerasoonras 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
Parasitismus (Schmarotzertum)
 Parasitismus (Schmarotzertum) Schädigende Wirkung eines Organismus (Parasit) auf einen anderen Organismus (Wirt). Sonderfall Parasitoide (Raubparasiten): obligate Tötung des Wirtes durch den Parasiten.
Parasitismus (Schmarotzertum) Schädigende Wirkung eines Organismus (Parasit) auf einen anderen Organismus (Wirt). Sonderfall Parasitoide (Raubparasiten): obligate Tötung des Wirtes durch den Parasiten.
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
 In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
Biologie. Was ist das? Was tut man da? Womit beschäftigt man sich?
 Biologie Was ist das? Was tut man da? Womit beschäftigt man sich? Wiederholung Merkmal des Lebens Aufbau aus Zellen Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Man kann grob drei verschiedene Zelltypen unterscheiden?
Biologie Was ist das? Was tut man da? Womit beschäftigt man sich? Wiederholung Merkmal des Lebens Aufbau aus Zellen Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Man kann grob drei verschiedene Zelltypen unterscheiden?
Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen
 Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 1 Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen Verwandt? Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 2 Inhalt Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen...1 Inhalt... 2 Ordnung
Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 1 Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen Verwandt? Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 2 Inhalt Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen...1 Inhalt... 2 Ordnung
Sammlung von elektronenmikroskopischen Aufnahmen
 Sammlung von elektronenmikroskopischen Aufnahmen Hilfsmaterial für die Prüfungen zusammengestellt von Prof. Dr. Pál Röhlich Zellkern Kernhülle Golgi-Apparat Transport- Vesikeln Mitochondrium Lysosom Mitochondrien
Sammlung von elektronenmikroskopischen Aufnahmen Hilfsmaterial für die Prüfungen zusammengestellt von Prof. Dr. Pál Röhlich Zellkern Kernhülle Golgi-Apparat Transport- Vesikeln Mitochondrium Lysosom Mitochondrien
Wirbeltierpaläontologie
 Wirbeltierpaläontologie Institut für Geowissenschaften, Tübingen http://image38.webshots.com/38/7 /77/32/316077732BeffvN_fs.jpg Begleitend zur der Vorlesung benötigen Sie dieses Buch ISBN 978 3 89937 072
Wirbeltierpaläontologie Institut für Geowissenschaften, Tübingen http://image38.webshots.com/38/7 /77/32/316077732BeffvN_fs.jpg Begleitend zur der Vorlesung benötigen Sie dieses Buch ISBN 978 3 89937 072
1 Grundlagen. Inhalt. Vorwort... des Lebens Zelle Struktur und Funktion Evolution Biodiversität VII
 VII Inhalt Vorwort........... 1 Grlagen des Lebens........ 1 1.1 Entstehung der belebten Materie................. 1 1.2 Die wichtigsten Baustoffe der belebten Materie..... 2 1.2.1 Lipide Lipoide (Fette)
VII Inhalt Vorwort........... 1 Grlagen des Lebens........ 1 1.1 Entstehung der belebten Materie................. 1 1.2 Die wichtigsten Baustoffe der belebten Materie..... 2 1.2.1 Lipide Lipoide (Fette)
Kennzeichen des Lebens. Zelle. Evolution. Skelett (5B1) (5B2) (5B3) (5B4)
 Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
5. Tutorium AMB/OBOE 24.11.05
 5. Tutorium AMB/OBOE 24.11.05 1. Teil Zoologie 1) Spermatogenese - Entwicklung der männlichen Gameten von der Urkeimzelle bis zum reifen Spermium - kontinuierlich - erfolgt beim Mann - alle 4 Zellen der
5. Tutorium AMB/OBOE 24.11.05 1. Teil Zoologie 1) Spermatogenese - Entwicklung der männlichen Gameten von der Urkeimzelle bis zum reifen Spermium - kontinuierlich - erfolgt beim Mann - alle 4 Zellen der
Schlammschnecken. bis 6 cm in Teichen mit schwacher Strömung Güteklasse II
 Schlammschnecken bis 6 cm in Teichen mit schwacher Strömung Güteklasse II Die Schlammschnecken gehören wie die Tellerschnecken zu den Wasserlungenschnecken mit einer echten Lunge. Die Spitzschlammschnecke
Schlammschnecken bis 6 cm in Teichen mit schwacher Strömung Güteklasse II Die Schlammschnecken gehören wie die Tellerschnecken zu den Wasserlungenschnecken mit einer echten Lunge. Die Spitzschlammschnecke
Evolution, Systematik und Tierstämme
 Evolution, Systematik und Tierstämme Evolution A.R. Wallace (1858) On the tendency of varieties to depart indefinitely From the original type 1 Zentrale These der Darwin schen Evolutionstheorie: Die rezenten
Evolution, Systematik und Tierstämme Evolution A.R. Wallace (1858) On the tendency of varieties to depart indefinitely From the original type 1 Zentrale These der Darwin schen Evolutionstheorie: Die rezenten
Biologie für Mediziner
 Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Prof. Dr. Reiner Peters Institut für Medizinische Physik und Biophysik/CeNTech Robert-Koch-Strasse 31 Tel. 0251-835 6933, petersr@uni-muenster.de Dr. Martin Kahms
Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Prof. Dr. Reiner Peters Institut für Medizinische Physik und Biophysik/CeNTech Robert-Koch-Strasse 31 Tel. 0251-835 6933, petersr@uni-muenster.de Dr. Martin Kahms
Form und Funktion der Tiere. Mechanismen der Sensorik und Motorik
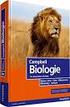 Form und Funktion der Tiere Mechanismen der Sensorik und Motorik Bewegung und Lokomotion 49.25 Die energetischen Kosten der Fortbewegung. Diese Grafik vergleicht die Energie pro Kilogramm Körpermasse pro
Form und Funktion der Tiere Mechanismen der Sensorik und Motorik Bewegung und Lokomotion 49.25 Die energetischen Kosten der Fortbewegung. Diese Grafik vergleicht die Energie pro Kilogramm Körpermasse pro
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse
 Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
1. Funktionelle Organisation der Tiere und deren Baupläne
 Gegenstände der Vorlesung 1. Funktionelle Organisation der Tiere und deren Baupläne 15 Vorlesungen Kössl, Grünewald 2. Sinne,Nerven,Verhalten 9 Vorlesungen Volknandt, Gaese 3. Evolutionsbiologie 4 Vorlesungen
Gegenstände der Vorlesung 1. Funktionelle Organisation der Tiere und deren Baupläne 15 Vorlesungen Kössl, Grünewald 2. Sinne,Nerven,Verhalten 9 Vorlesungen Volknandt, Gaese 3. Evolutionsbiologie 4 Vorlesungen
Merkmale des Lebens. - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel
 Merkmale des Lebens - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel Alle Lebewesen bestehen aus Zellen Fragen zum Text: - Was sah Hooke genau?
Merkmale des Lebens - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel Alle Lebewesen bestehen aus Zellen Fragen zum Text: - Was sah Hooke genau?
Zellen. Biologie. Kennzeichen des Lebens. Das Skelett des Menschen. Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen.
 1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
Entwicklungsbiologie 02
 Entwicklungsabschnitte Embryonalphase: entscheidende Entwicklungsprozesse: (Embryogenese) Furchung, Gastrulation, Organogenese Entwicklungsbiologie 02 Ernst A. Wimmer Abteilung Entwicklungsbiologie Juvenilphase:
Entwicklungsabschnitte Embryonalphase: entscheidende Entwicklungsprozesse: (Embryogenese) Furchung, Gastrulation, Organogenese Entwicklungsbiologie 02 Ernst A. Wimmer Abteilung Entwicklungsbiologie Juvenilphase:
Procyte. Eucyte. Zellorganell. Autotrophe Organismen. (die) (die) (das; -organellen) Reservestoffe. Bakterienzellwand (Murein) Zellmembran.
 45 Ribosomen Schleimkapsel Reservestoffe Bakterienzellwand (Murein) Procyte (die) Zellplasma Bakterienchromosom Zellmembran Bakteriengeißel keine membranumgrenzten Organellen 46 Pflanzliche Zelle Dictyosom
45 Ribosomen Schleimkapsel Reservestoffe Bakterienzellwand (Murein) Procyte (die) Zellplasma Bakterienchromosom Zellmembran Bakteriengeißel keine membranumgrenzten Organellen 46 Pflanzliche Zelle Dictyosom
Vom Genom zum adulten Lebewesen
 Vom Genom zum adulten Lebewesen Frühe Forschungen zur Embryogenese Ernst Haeckel Der deutsche Gelehrte Karl Ernst von Baer (1792-1876, Alexander von Humboldt des Nordens, wirkte in Dorpat) entdeckte 1826
Vom Genom zum adulten Lebewesen Frühe Forschungen zur Embryogenese Ernst Haeckel Der deutsche Gelehrte Karl Ernst von Baer (1792-1876, Alexander von Humboldt des Nordens, wirkte in Dorpat) entdeckte 1826
Biodiversität der Tiere I
 Biodiversität der Tiere I Leistungskontrolle HS 2011 Wiederholung Mittwoch, 30. August 2012 14:00-16:00, UG 113 Name, Vorname: Matrikelnummer: E-mail-Adresse: Hinweise: Die Prüfung erfolgt im Closed Book
Biodiversität der Tiere I Leistungskontrolle HS 2011 Wiederholung Mittwoch, 30. August 2012 14:00-16:00, UG 113 Name, Vorname: Matrikelnummer: E-mail-Adresse: Hinweise: Die Prüfung erfolgt im Closed Book
Muskelgewebe. Glatte Muskulatur Eingeweide; Spindelförmige Zellen, Zellkern liegt zentral
 Muskelgewebe Muskelgewebe Zellen meist langgestreckt. Können sich verkürzen und mechanische Spannung entwickeln durch kontraktile Fibrillen (Myofibrillen). Glatte Muskulatur Eingeweide; Spindelförmige
Muskelgewebe Muskelgewebe Zellen meist langgestreckt. Können sich verkürzen und mechanische Spannung entwickeln durch kontraktile Fibrillen (Myofibrillen). Glatte Muskulatur Eingeweide; Spindelförmige
Microscopy. Light microscope (LM) TEM
 Microscopy Light microscope (LM) TEM Microscopes Light microscope (LM) Transmission electron microscope (TEM) Scanning electron microscope (SEM) Transmission electron microscope (TEM) Die tierische Zelle
Microscopy Light microscope (LM) TEM Microscopes Light microscope (LM) Transmission electron microscope (TEM) Scanning electron microscope (SEM) Transmission electron microscope (TEM) Die tierische Zelle
Die Embryonalentwicklung: Schlüssel zum Verständnis von Stammzellen
 Modul 1-2 Die Embryonalentwicklung: Schlüssel zum Verständnis von Stammzellen Wenn aus einer befruchteten Eizelle (Zygote) durch Zellteilungen viele Zellen entstehen, die sich reorganisieren, spezialisieren,
Modul 1-2 Die Embryonalentwicklung: Schlüssel zum Verständnis von Stammzellen Wenn aus einer befruchteten Eizelle (Zygote) durch Zellteilungen viele Zellen entstehen, die sich reorganisieren, spezialisieren,
Aufbau der Nervenzelle. Zentrales Nervensystem
 Aufbau der Nervenzelle 2 A: Zellkörper (Soma): Stoffwechselzentrum B: Axon: Weiterleitung der elektrischen Signale C: Dendrit: Informationsaufnahme D: Hüllzellen: Isolation E: Schnürring: Unterbrechung
Aufbau der Nervenzelle 2 A: Zellkörper (Soma): Stoffwechselzentrum B: Axon: Weiterleitung der elektrischen Signale C: Dendrit: Informationsaufnahme D: Hüllzellen: Isolation E: Schnürring: Unterbrechung
Hinweise zum Grundwissen Biologie 8. Jahrgangsstufe
 Hinweise zum Grundwissen Biologie 8. Jahrgangsstufe Stationen der Evolution grünes Lesezeichen Reiche der Lebewesen Das Einteilen der Organismen in Reiche ist ein noch unvollendetes Werk. Momentan bevorzugen
Hinweise zum Grundwissen Biologie 8. Jahrgangsstufe Stationen der Evolution grünes Lesezeichen Reiche der Lebewesen Das Einteilen der Organismen in Reiche ist ein noch unvollendetes Werk. Momentan bevorzugen
Die roten Fäden durch die Biologie
 Die roten Fäden durch die Biologie LPG-Grundwissen: 5. Klasse Energie ebene Energie Oberfläche Oberfläche...... Organisations- Fortpflanzung Fortpflanzung Stoffwechsel Stoffwechsel 5. Jgst. 1 5. Jgst.
Die roten Fäden durch die Biologie LPG-Grundwissen: 5. Klasse Energie ebene Energie Oberfläche Oberfläche...... Organisations- Fortpflanzung Fortpflanzung Stoffwechsel Stoffwechsel 5. Jgst. 1 5. Jgst.
Kennzeichen des Lebendigen. Reiche der Lebewesen. Bau einer Bakterienzelle
 Kennzeichen des Lebendigen - Bau aus Zellen - Reizbarkeit / Reaktion auf Umwelteinflüsse - Stoffwechsel - Fortpflanzung - Wachstum - Entwicklung - Einzeller ohne Zellkern = Prokaryoten Reiche der Lebewesen
Kennzeichen des Lebendigen - Bau aus Zellen - Reizbarkeit / Reaktion auf Umwelteinflüsse - Stoffwechsel - Fortpflanzung - Wachstum - Entwicklung - Einzeller ohne Zellkern = Prokaryoten Reiche der Lebewesen
..den Sinneszellen. zu schützen. optimal zuzuführen. die Qualität des Reizes festzustellen die Quantität des Reizes festzustellen
 9.1 Welche Funktionen haben Sinneszellen und Sinnesorgan? Sinneszellen nehmen die Reize auf und wandeln die Information in elektrische Signale um. Die Sinnesorgane dienen unter anderem dazu. Beispiel Auge
9.1 Welche Funktionen haben Sinneszellen und Sinnesorgan? Sinneszellen nehmen die Reize auf und wandeln die Information in elektrische Signale um. Die Sinnesorgane dienen unter anderem dazu. Beispiel Auge
Tenktakula (Protostomia) und Hemichordata (= Branchiotremata,Deuterostomia)
 Tenktakula (Protostomia) und Hemichordata (= Branchiotremata,Deuterostomia) Beide Gruppen besitzen drei Coelomhöhlen (Proto-, Meso-, Metacoel). Dies führt zur Dreigliedrigkeit der Körpers in Proto-, Meso-
Tenktakula (Protostomia) und Hemichordata (= Branchiotremata,Deuterostomia) Beide Gruppen besitzen drei Coelomhöhlen (Proto-, Meso-, Metacoel). Dies führt zur Dreigliedrigkeit der Körpers in Proto-, Meso-
Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2007/8 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Membranverbindungen
 Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2007/8 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Membranverbindungen Membranverbindungen - Grundlagen Grundlage für Ausbildung von Vielzellern, Gewebe Mechanische
Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2007/8 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Membranverbindungen Membranverbindungen - Grundlagen Grundlage für Ausbildung von Vielzellern, Gewebe Mechanische
Referat über: Entwicklung von Lebenwesen von Einzellern bis hin zu Vielzellern.
 Info 20.01.05 -Einzeller => Haben alles zum Leben notwendige (keine andere Lebenshilfe nötig) -Bei Vielzelligen Organismen: Im Laufe der Individualentwicklung: => Spezialisierung der Zellen und Arbeitsteilung
Info 20.01.05 -Einzeller => Haben alles zum Leben notwendige (keine andere Lebenshilfe nötig) -Bei Vielzelligen Organismen: Im Laufe der Individualentwicklung: => Spezialisierung der Zellen und Arbeitsteilung
Organisationsebenen. Prokaryot. Eukaryot. Organelle. Zellwand. Zellmembran. Zellkern. 8. Jahrgangsstufe Grundwissen Biologie Gymnasium Donauwörth
 8. Jahrgangsstufe Grundwissen Biologie Gymnasium Donauwörth Organisationsebenen sichtbare Ebene mikroskopische Ebene Teilchen-Ebene Prokaryot Komplexe biol. Strukturen sind immer aus kleineren, einfacheren
8. Jahrgangsstufe Grundwissen Biologie Gymnasium Donauwörth Organisationsebenen sichtbare Ebene mikroskopische Ebene Teilchen-Ebene Prokaryot Komplexe biol. Strukturen sind immer aus kleineren, einfacheren
4 Fortpflanzungs und Entwicklungsbiologie
 4 Fortpflanzungs und Entwicklungsbiologie 4.1 Vegetative und sexuelle Fortpflanzung Aufgabe 4.1 1: Vergleiche Vor und Nachteile der vegetativen Fortpflanzung mit den Vor und Nachteilen der sexuellen Fortpflanzung.
4 Fortpflanzungs und Entwicklungsbiologie 4.1 Vegetative und sexuelle Fortpflanzung Aufgabe 4.1 1: Vergleiche Vor und Nachteile der vegetativen Fortpflanzung mit den Vor und Nachteilen der sexuellen Fortpflanzung.
1. Nennen Sie die vier charakteristischen Grundorganisationsformen der Protozoen und beschreiben Sie jeweils stichpunktartig die wichtigsten Merkmale.
 Allgemeine Zoologie (Vorlesung) WiSe 1996/1997 1. Nennen Sie die vier charakteristischen Grundorganisationsformen der Protozoen und beschreiben Sie jeweils stichpunktartig die wichtigsten Merkmale. 2.
Allgemeine Zoologie (Vorlesung) WiSe 1996/1997 1. Nennen Sie die vier charakteristischen Grundorganisationsformen der Protozoen und beschreiben Sie jeweils stichpunktartig die wichtigsten Merkmale. 2.
Kapitel Weichtiere
 1 Kapitel 01.03 Weichtiere Eine Weinbergschnecke 2 Inhalt Kapitel 01.03 Weichtiere... 1 Inhalt... 2 Weichtiere (Mollusken)... 3 Der Stammbaum der Weichtiere...3 Der Körperbau der Weichtiere am Beispiel
1 Kapitel 01.03 Weichtiere Eine Weinbergschnecke 2 Inhalt Kapitel 01.03 Weichtiere... 1 Inhalt... 2 Weichtiere (Mollusken)... 3 Der Stammbaum der Weichtiere...3 Der Körperbau der Weichtiere am Beispiel
Biologie für Hauptschule lt. hess. Lehrplan f. Nichtschüler
 Biologie für Hauptschule lt. hess. Lehrplan f. Nichtschüler http://worgtsone.scienceontheweb.net/worgtsone/ - mailto: worgtsone @ hush.com Tue Dec 1 17:34:40 CET 2009 13. Oktober 2011 Inhaltsverzeichnis
Biologie für Hauptschule lt. hess. Lehrplan f. Nichtschüler http://worgtsone.scienceontheweb.net/worgtsone/ - mailto: worgtsone @ hush.com Tue Dec 1 17:34:40 CET 2009 13. Oktober 2011 Inhaltsverzeichnis
Plasmodium falciparum
 Plasmodium falciparum Plasmodium falciparum (Welch 1897) D: Erreger der Malaria tropica E: tropical malaria, malignant malaria Systematik Stamm: Apicomplexa (Sporozoa) Klasse: Haematozoea Ordnung: Haemosporida
Plasmodium falciparum Plasmodium falciparum (Welch 1897) D: Erreger der Malaria tropica E: tropical malaria, malignant malaria Systematik Stamm: Apicomplexa (Sporozoa) Klasse: Haematozoea Ordnung: Haemosporida
Kapitel 06.02: Die Zelle I: Zelltypen und ihr Aufbau
 1 2 Inhalt...1 Inhalt... 2 Schärfe Deinen Blick: Die Zelle ist nicht platt und zweidimensional!...3 Die Pflanzenzelle... 4 Die Stadt Celle... 4 Die Pflanzenzelle... 5 Zellorganellen der tierischen Zelle...5
1 2 Inhalt...1 Inhalt... 2 Schärfe Deinen Blick: Die Zelle ist nicht platt und zweidimensional!...3 Die Pflanzenzelle... 4 Die Stadt Celle... 4 Die Pflanzenzelle... 5 Zellorganellen der tierischen Zelle...5
Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn
 Einführung in die Grundlagen der Genetik Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn Molekularbiologische Grundlagen Die Zelle ist die grundlegende, strukturelle und funktionelle
Einführung in die Grundlagen der Genetik Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn Molekularbiologische Grundlagen Die Zelle ist die grundlegende, strukturelle und funktionelle
Gastrulation, Neurulation, Keimblätter. Prinzipien der Embryogenese/Organogenese
 Begattung Spermien im weiblichen Genitaltrakt Dauer der Befruchtungsfähigkeit Ort der Spermienablage intravaginal intrauterin Kapazitation Akrosomenreaktion Besamung Eindringen des Spermiums in die Eizelle,
Begattung Spermien im weiblichen Genitaltrakt Dauer der Befruchtungsfähigkeit Ort der Spermienablage intravaginal intrauterin Kapazitation Akrosomenreaktion Besamung Eindringen des Spermiums in die Eizelle,
Teilchenmodell. Reinstoffe. Stoffgemische. Luft ist ein Gasgemisch. Gasnachweise. Naturwissenschaftliches Arbeiten. Reinstoffe.
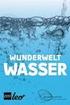 1 1 Teilchenmodell Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, die sich in Größe und Masse unterscheiden. Sie sind selbst unter dem Mikroskop noch nicht sichtbar. Zwischen den kleinsten Teilchen ist nichts.
1 1 Teilchenmodell Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, die sich in Größe und Masse unterscheiden. Sie sind selbst unter dem Mikroskop noch nicht sichtbar. Zwischen den kleinsten Teilchen ist nichts.
22 DIE KÖRPERHÜLLE SEITE ZELLSTOFFWECHSEL DNA ZELLTEILUNG GEWEBE UND ORGANE HAUT, HAARE UND NÄGEL
 SEITE Unser Körper besteht aus Millionen spezialisierter Einheiten - den Zellen die fast ebenso viele Funktionen erfüllen. Zwar ist jede Zelle anders, doch enthalten alle Zellkerne den identischen Code
SEITE Unser Körper besteht aus Millionen spezialisierter Einheiten - den Zellen die fast ebenso viele Funktionen erfüllen. Zwar ist jede Zelle anders, doch enthalten alle Zellkerne den identischen Code
Morphologische Grundlagen der Zelle Bakterienzelle
 Morphologische Grundlagen der Zelle Bakterienzelle Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie Tier-Zelle Pflanzen-Zelle Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie (aus Weiler/Nover:
Morphologische Grundlagen der Zelle Bakterienzelle Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie Tier-Zelle Pflanzen-Zelle Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie (aus Weiler/Nover:
Biologie 8. In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
 Biologie 8 In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte
Biologie 8 In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte
Allgemein. Allgemein. Grundwissenskatalog Biologie 8. Definiere den Begriff Art! Erkläre die Begriffe Gattung und binäre Nomenklatur!
 Allgemein Definiere den Begriff Art! Alle Lebewesen, die in wesentlichen Merkmalen überein- stimmen und miteinander fruchtbare Nachkommen er- zeugen, fasst man zu einer Art zusammen. Allgemein Erkläre
Allgemein Definiere den Begriff Art! Alle Lebewesen, die in wesentlichen Merkmalen überein- stimmen und miteinander fruchtbare Nachkommen er- zeugen, fasst man zu einer Art zusammen. Allgemein Erkläre
Grundwissen 5. Jahrgangsstufe 1. Teil
 Grundwissen 5. Jahrgangsstufe 1. Teil Kennzeichen der Lebewesen! Bau des Handskeletts und des Armskeletts! Aufbau und Funktionsweise zweier unterschiedlicher Gelenktypen! Gegenspielerprinzip am Beispiel
Grundwissen 5. Jahrgangsstufe 1. Teil Kennzeichen der Lebewesen! Bau des Handskeletts und des Armskeletts! Aufbau und Funktionsweise zweier unterschiedlicher Gelenktypen! Gegenspielerprinzip am Beispiel
Exkretion (Ausscheidung)
 Exkretion (Ausscheidung) * Ausscheidung von Abfallprodukten des Stoffwechsels (Abbau von Proteinen) * Ausscheidung giftiger Substanzen * Reabsorption lebenswichtiger Stoffe (Wasser, Salze, Glucose) Exkretion
Exkretion (Ausscheidung) * Ausscheidung von Abfallprodukten des Stoffwechsels (Abbau von Proteinen) * Ausscheidung giftiger Substanzen * Reabsorption lebenswichtiger Stoffe (Wasser, Salze, Glucose) Exkretion
Zelltypen des Nervensystems
 Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
If you can't study function, study structure. Vom Molekül in der Ursuppe bis zur ersten Zelle war es ein langer Weg:
 Kapitel 4: ANATOMIE EINER EUKARYOTENZELLE Inhalt: EINLEITUNG... 53 BESTANDTEILE EINER EUKARYOTENZELLE... 55 MEMBRANVERBINDUNGEN... 57 GEWEBE UND ORGANE... 57 LITERATUR...57 LINKS... 57 Einleitung If you
Kapitel 4: ANATOMIE EINER EUKARYOTENZELLE Inhalt: EINLEITUNG... 53 BESTANDTEILE EINER EUKARYOTENZELLE... 55 MEMBRANVERBINDUNGEN... 57 GEWEBE UND ORGANE... 57 LITERATUR...57 LINKS... 57 Einleitung If you
Glia- sowie Nervenzellen (= Neuronen) sind die Bausteine des Nervensystems. Beide Zellarten unterscheiden sich vorwiegend in ihren Aufgaben.
 (C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
(C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
Biologie. I. Grundlegende Begriffe im Überblick:
 I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
Unterschied Tiere, Pflanzen, Bakterien u. Pilze und die Zellorganellen
 Unterschied Tiere, Pflanzen, Bakterien u. Pilze und die Zellorganellen Die Organellen der Zelle sind sozusagen die Organe die verschiedene Funktionen in der Zelle ausführen. Wir unterscheiden Tierische
Unterschied Tiere, Pflanzen, Bakterien u. Pilze und die Zellorganellen Die Organellen der Zelle sind sozusagen die Organe die verschiedene Funktionen in der Zelle ausführen. Wir unterscheiden Tierische
Biomembranen Zellkontakte (adhesive junction, tight junction, gap junction, Plasmodesmata)
 Biomembranen Zellkontakte (adhesive junction, tight junction, gap junction, Plasmodesmata) Zellkontakte: dienen der mechanischen Fixierung der Zellen => Gewebestabilisierung: adhesive junction dienen der
Biomembranen Zellkontakte (adhesive junction, tight junction, gap junction, Plasmodesmata) Zellkontakte: dienen der mechanischen Fixierung der Zellen => Gewebestabilisierung: adhesive junction dienen der
Fortpflanzungsstrategien der Tiere
 Fortpflanzungsstrategien der Tiere Sexuelle und Asexuelle Reproduktion Asexuelle Fortpflanzung Nachkommen mit Genen von einem Individuum Keine Fusion von Ei mit Spermium Genetische Variation der Nachkommen
Fortpflanzungsstrategien der Tiere Sexuelle und Asexuelle Reproduktion Asexuelle Fortpflanzung Nachkommen mit Genen von einem Individuum Keine Fusion von Ei mit Spermium Genetische Variation der Nachkommen
6. Tutorium AMB/OBOE
 6. Tutorium AMB/OBOE 01.12.05 1. Teil Zoologie 1) Larve - Selbstständige, aber noch nicht geschlechtsreife Entwicklungsstadien mit eigenen charakteristischen Merkmalen, die beim adulten Tier fehlen 2)
6. Tutorium AMB/OBOE 01.12.05 1. Teil Zoologie 1) Larve - Selbstständige, aber noch nicht geschlechtsreife Entwicklungsstadien mit eigenen charakteristischen Merkmalen, die beim adulten Tier fehlen 2)
Joachim Ude und Michael Koch. Die Zelle. Atlas der Ultrastruktur. 3. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin
 0. Joachim Ude und Michael Koch Die Zelle Atlas der Ultrastruktur 3. Auflage Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Inhaltsverzeichnis Teill Teil II Das Elektronenmikroskop Die Zelle und ihre Organelle
0. Joachim Ude und Michael Koch Die Zelle Atlas der Ultrastruktur 3. Auflage Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Inhaltsverzeichnis Teill Teil II Das Elektronenmikroskop Die Zelle und ihre Organelle
Zelldifferenzierung und Morphogenese
 Zelldifferenzierung und Morphogenese Fragestellung: Wie ist es möglich, daß sich aus einer einzigen Zelle ein hochkomplexes Lebewesen mit hohem Differenzierungsgrad entwickeln kann? weniger gut verstanden
Zelldifferenzierung und Morphogenese Fragestellung: Wie ist es möglich, daß sich aus einer einzigen Zelle ein hochkomplexes Lebewesen mit hohem Differenzierungsgrad entwickeln kann? weniger gut verstanden
Kükenthal - Zoologisches Praktikum
 Kükenthal - Zoologisches Praktikum von Volker Storch, Ulrich Welsch 1. Auflage Kükenthal - Zoologisches Praktikum Storch / Welsch schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Kükenthal - Zoologisches Praktikum von Volker Storch, Ulrich Welsch 1. Auflage Kükenthal - Zoologisches Praktikum Storch / Welsch schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Fragen medizinische Terminologie
 Fragen medizinische Terminologie 1. Wie nennt man das größte stabile Teilchen 2. Aus was bestehen Atome 3. Aus was bestehen Moleküle 4. Was heisst DNS 5. Aus was bestehen Proteine 6. Funktion der DNS 7.
Fragen medizinische Terminologie 1. Wie nennt man das größte stabile Teilchen 2. Aus was bestehen Atome 3. Aus was bestehen Moleküle 4. Was heisst DNS 5. Aus was bestehen Proteine 6. Funktion der DNS 7.
Prüfungsfragenkatalog für Allgemeine Zellbiologie inkl. Mikrobiologie für Studenten der Pharmazie (Prof. Mascher Franz / Prof.
 Prüfungsfragenkatalog für Allgemeine Zellbiologie inkl. Mikrobiologie für Studenten der Pharmazie (Prof. Mascher Franz / Prof. Reinthaler Franz) Stand: Dezember 2014 Termin: 18.12.2014 - Gruppe 1 1. Die
Prüfungsfragenkatalog für Allgemeine Zellbiologie inkl. Mikrobiologie für Studenten der Pharmazie (Prof. Mascher Franz / Prof. Reinthaler Franz) Stand: Dezember 2014 Termin: 18.12.2014 - Gruppe 1 1. Die
Teil I Grundlagen der Zell- und Molekularbiologie
 Teil I Grundlagen der Zell- und Molekularbiologie Molekulare Biotechnologie: Konzepte, Methoden und Anwendungen, 2. Aufl. Herausgegeben von Michael Wink Copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
Teil I Grundlagen der Zell- und Molekularbiologie Molekulare Biotechnologie: Konzepte, Methoden und Anwendungen, 2. Aufl. Herausgegeben von Michael Wink Copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
Abbildung 1: Ein höheres Oberfläche/Volumen-Verhältnis begünstigt den Stoffaustausch
 4.2 Struktur und Aufbau von Zellen 1. Zellen sind mikroskopisch klein. Weshalb? Die Oberfläche einer Zelle muss im Verhältnis zu ihrem Volumen möglichst gross sein, damit der lebenswichtige Stoffaustausch
4.2 Struktur und Aufbau von Zellen 1. Zellen sind mikroskopisch klein. Weshalb? Die Oberfläche einer Zelle muss im Verhältnis zu ihrem Volumen möglichst gross sein, damit der lebenswichtige Stoffaustausch
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Robert Koch-Gymnasium Deggendorf GRUNDWISSENKARTEN NATUR UND TECHNIK. 5. Jahrgangsstufe
 Robert Koch-Gymnasium Deggendorf GRUNDWISSENKARTEN NATUR UND TECHNIK 5. Jahrgangsstufe Es sind insgesamt 24 Karten für die 5. Jahrgangsstufe erarbeitet, die als ständiges Grundwissen für alle Jahrgangsstufen
Robert Koch-Gymnasium Deggendorf GRUNDWISSENKARTEN NATUR UND TECHNIK 5. Jahrgangsstufe Es sind insgesamt 24 Karten für die 5. Jahrgangsstufe erarbeitet, die als ständiges Grundwissen für alle Jahrgangsstufen
Struktur und Funktion der Insekten
 Struktur und Funktion der Insekten Prof. Dr. Bernd Grünewald Institut für Bienenkunde Oberursel Polytechnische Gesellschaft FB Biowissenschaften, Goethe-Universität b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de www.institut-fuer-bienenkunde.de
Struktur und Funktion der Insekten Prof. Dr. Bernd Grünewald Institut für Bienenkunde Oberursel Polytechnische Gesellschaft FB Biowissenschaften, Goethe-Universität b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de www.institut-fuer-bienenkunde.de
1. Benennen Sie die dargestellten Zellorganellen! 2. Beschreiben Sie jeweils den Aufbau! 3. Erläutern Sie jeweils kurz ihre Funktion!
 Sek.II Arbeitsblatt 1 Zellorganellen mit Doppelmembran 1. Benennen Sie die dargestellten Zellorganellen! 2. Beschreiben Sie jeweils den Aufbau! 3. Erläutern Sie jeweils kurz ihre Funktion! Zellkern Mitochondrium
Sek.II Arbeitsblatt 1 Zellorganellen mit Doppelmembran 1. Benennen Sie die dargestellten Zellorganellen! 2. Beschreiben Sie jeweils den Aufbau! 3. Erläutern Sie jeweils kurz ihre Funktion! Zellkern Mitochondrium
1. Klausur in Histologie SS 2010
 1. Klausur in Histologie SS 2010 1. Beim gezeigten Gewebe handelt es sich A) straffes Bindegewebe B) Skelettmuskulatur C) kollagene Fasern D) glatte Muskulatur E) Geflechtknochen F) Sehne G) Nerv H) Herzmuskulatur
1. Klausur in Histologie SS 2010 1. Beim gezeigten Gewebe handelt es sich A) straffes Bindegewebe B) Skelettmuskulatur C) kollagene Fasern D) glatte Muskulatur E) Geflechtknochen F) Sehne G) Nerv H) Herzmuskulatur
Gliederung der Pflanzenwelt (Stammbaum)
 Gliederung der Pflanzenwelt (Stammbaum) Böhlmann, 1994 Die Systematik (Spezielle Botanik) Die Systematik hat die Aufgabe, die Vielfalt der lebenden oder fossilen Organismen (Organisationsformen) überschaubar
Gliederung der Pflanzenwelt (Stammbaum) Böhlmann, 1994 Die Systematik (Spezielle Botanik) Die Systematik hat die Aufgabe, die Vielfalt der lebenden oder fossilen Organismen (Organisationsformen) überschaubar
10% des Volumens Membran Poren Nucleoplasma Chromatin Proteinen DNS (DNA) Nucleoli (Einzahl: Nucleolus). Endoplasmatische Reticulum
 Zellkern (Nucleus) Der Zellkern ist die Firmenzentrale der Zelle. Er nimmt ca. 10% des Volumens der Zelle ein. Der Zellkern: - Ist von einer Membran umgeben. - Enthält Poren für den Austausch mit dem Cytosol
Zellkern (Nucleus) Der Zellkern ist die Firmenzentrale der Zelle. Er nimmt ca. 10% des Volumens der Zelle ein. Der Zellkern: - Ist von einer Membran umgeben. - Enthält Poren für den Austausch mit dem Cytosol
Bau des Nervengewebes
 Bau des Nervengewebes Das Nervengewebe hat eine zelluläre Gliederung und wird prinzipiell in die erregbaren Neuronen und die nicht erregbaren Zellen der Neuroglia unterteilt. Das Nervengewebe organisiert
Bau des Nervengewebes Das Nervengewebe hat eine zelluläre Gliederung und wird prinzipiell in die erregbaren Neuronen und die nicht erregbaren Zellen der Neuroglia unterteilt. Das Nervengewebe organisiert
1 Einleitung. 1.1 Systematische Einordnung der Clitellata
 1 Einleitung Clitellaten unterscheiden sich von anderen Anneliden durch die besondere Form der Reproduktion und durch die limnische oder terrestrische Lebensweise der meisten Clitellatentaxa. Der für Clitellaten
1 Einleitung Clitellaten unterscheiden sich von anderen Anneliden durch die besondere Form der Reproduktion und durch die limnische oder terrestrische Lebensweise der meisten Clitellatentaxa. Der für Clitellaten
Prüfungsfragenkatalog für Allgmeine Zellbiologie inkl. Mikrobiologie für Studenten der Pharmazie (Prof. Mascher Franz / Prof.
 Prüfungsfragenkatalog für Allgmeine Zellbiologie inkl. Mikrobiologie für Studenten der Pharmazie (Prof. Mascher Franz / Prof. Reinthaler Franz) Stand: Dezember 2013 Termin: 19.12.2013, Gruppe A Es können
Prüfungsfragenkatalog für Allgmeine Zellbiologie inkl. Mikrobiologie für Studenten der Pharmazie (Prof. Mascher Franz / Prof. Reinthaler Franz) Stand: Dezember 2013 Termin: 19.12.2013, Gruppe A Es können
Schulinterner Lehrplan. für das Fach. Biologie. (Sekundarstufe I Kurzversion)
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Biologie (Sekundarstufe I ) Jahrgangsstufe: 5 Schulinterner Lehrplan Biologie I. Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen I.I Was lebt in meiner Nachbarschaft? Artenkenntnis
Schulinterner Lehrplan für das Fach Biologie (Sekundarstufe I ) Jahrgangsstufe: 5 Schulinterner Lehrplan Biologie I. Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen I.I Was lebt in meiner Nachbarschaft? Artenkenntnis
Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie
 Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie Tier-Zelle Pflanzen-Zelle Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie (aus Weiler/Nover: Allgemeine und molekulare Botanik) Tierzelle Morphologische
Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie Tier-Zelle Pflanzen-Zelle Entstehung der Eukaryontenzelle Endosymbiontentheorie (aus Weiler/Nover: Allgemeine und molekulare Botanik) Tierzelle Morphologische
Inhaltsverzeichnis. Phänomene der Mikrobiologie. Reise in die Welt des Winzigen... 8
 Inhaltsverzeichnis Phänomene der Mikrobiologie 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das hast du gelernt...
Inhaltsverzeichnis Phänomene der Mikrobiologie 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das hast du gelernt...
Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg. 9. Klasse. Biologie
 Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg 9. Klasse Biologie Es sind insgesamt 10 Karten für die 9. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg 9. Klasse Biologie Es sind insgesamt 10 Karten für die 9. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium. 8. Klasse. Biologie
 Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 8. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 8. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 8. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 8. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit
Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten
 Inhaltsverzeichnis Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das
Inhaltsverzeichnis Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das
Coelenteraten - Paläontologisch-Stratigraphische Übungen I. Block 4 : Sonstige Coelenteraten
 Coelenteraten - Paläontologisch-Stratigraphische Übungen I Block 4 : Sonstige Coelenteraten Universitäre Lehrressource - zur für Teilnehmer der PalStrat-Übungen (Teil Leinfelder). Beinhaltet Fremdcopyrights
Coelenteraten - Paläontologisch-Stratigraphische Übungen I Block 4 : Sonstige Coelenteraten Universitäre Lehrressource - zur für Teilnehmer der PalStrat-Übungen (Teil Leinfelder). Beinhaltet Fremdcopyrights
Grundwissen Natur und Technik 5
 Grundwissen Natur und Technik 5 Die roten Fäden durch die Biologie: Basiskonzepte 1 Kennzeichen des Lebens: Bewegung Stoffwechsel Aufbau aus Zellen Wachstum Fortpflanzung Information (Aufnahme, Verarbeitung,
Grundwissen Natur und Technik 5 Die roten Fäden durch die Biologie: Basiskonzepte 1 Kennzeichen des Lebens: Bewegung Stoffwechsel Aufbau aus Zellen Wachstum Fortpflanzung Information (Aufnahme, Verarbeitung,
Histopathologie. Fall 30
 Histopathologie Fall 30 Präp.-Nr.: 30 Färbung: HE Organ: Knochen Tierart: Hund Allgemeines (1): Osteosarkome kommen in unterschiedlichen Lokalisationen vor Axiales Skelett: - Wirbelsäule - Rippen - Brustbein
Histopathologie Fall 30 Präp.-Nr.: 30 Färbung: HE Organ: Knochen Tierart: Hund Allgemeines (1): Osteosarkome kommen in unterschiedlichen Lokalisationen vor Axiales Skelett: - Wirbelsäule - Rippen - Brustbein
