Baryogenese. 3 Sakharovkriterien im Standartmodell Mechanismus der elektroschwachen Baryogenese Elektroschwacher Phasenübergang...
|
|
|
- Ferdinand Brauer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Baryogenese Jim Bachmann Nachbearbeitung zum Vortrag am im Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster Inhaltsverzeichnis 1 Empirische Befunde 1 2 Sakharovkriterien 2 3 Sakharovkriterien im Standartmodell Mechanismus der elektroschwachen Baryogenese Elektroschwacher Phasenübergang Baryogenese jenseits des SM Minimal supersymmetrisches Modell SU(5) GUT Leptogenese Zusammenfassung Empirische Befunde Die Baryonenasymmetrie im Universum lässt sich auf verschiedene Arten beobachten. Auf der Erde kommt Antimaterie nicht in natürlicher Form vor. Mit der Weltraumsonde WMAP wurde der Anteil der Antimaterie in der kosmischen Strahlung bestimmt und dabei festgestellt, dass auch in der kosmischen Strahlung nur Antimaterie in einer Grössenordnung vorkommt, wie sie bei Kollisionen mit interplanetarem Gas erzeugt wird. Unser Sonnensystem besteht somit offensichtlich aus Materie. Nun könnte man annehmen, dass Materie und Antimaterie im Universum auf grossen Skalen voneinander getrennt sind. In den leersten Bereichen des Universums findet sich noch Wasserstoffgas. Beispielsweise könnte zwischen zwei Galaxien (im Falle getrennter Antimaterie/Materie Galaxien) im mittleren Abstand der beiden Galaxien Vernichtungsstrahlung beobachtet werden. Dies ist nicht der Fall. Nun könnte entweder eine Materie/Antimaterie Asymmetrie vorliegen, oder die Blase aus Materie in der wir uns befinden, müsste so gross sein, wie das beobachtbare Universum. Da dies ausgeprägte Bereiche von Materie und Antimaterie im frühen Universum vorraussetzen würde, ist dieser Fall als sehr unwahrscheinlich einzustufen. 1
2 Die vorliegende Asymmetrie lässt sich auch quantifizieren, über das Baryon zu Photon Verhältnis: µ = n B n B = B n γ n γ Dieses Verhältnis steht in direkter Beziehung zu den Elementverhältnissen in alten Sternen. Andererseits steht es auch in Beziehung zu den auftretenden Multipolmomenten in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Beide unabhängigen Messungen liefern konsistente Ergebnisse. Die Theorien der Baryogenese müssen dieses Verhältnis erzeugen. 2 Sakharovkriterien Bereits im Jahr 1967 erkannte der sowjetische Physiker... Sakharow die Notwendigkeit der dynamischen Erzeugung der Baryonenasymmetrie. Er formulierte die drei Sakharovkriterien, welche jede Theorie erfüllen muss, um eine Baryonenasymmetrie erzeugen zu können. Die drei Sakharowkriterien lauten: 1. Verletzung der Baryonenzahlerhaltung 2. C, CP-Verletzung 3. Verlassen des thermischen Gleichgewichts Die Notwendigkeit einer Baryonenzahlverletzung ist offensichtlich, um eine Baryonenasymmetrie zu erzeugen. Die Notwendigkeit des zweiten Kriteriums zeigt sich, sobald man die Übergangswahrscheinlichkeiten eines Teilchens X betrachtet, welches in ein Teilchen Y und Baryonen mit einer Baryonenzahl B zerfällt: X Y + B. Sei Γ die Übergangsrate: Unter C-Symmetrie: Γ(X Y + B) Γ(X Y + B) = C(Γ(X Y + B)) Die ladungskonjugierte Übergangsrate entspricht der Übergangsrate der ladungskonjugierten Teilchen: C(Γ(X Y + B)) = Γ( X Ȳ + B) Somit: Γ(X Y + B) = Γ( X Ȳ + B) Der Zerfall der X erzeugt genau so viele Baryonen, wie der Zerfall der X Antibaryonen erzeugt. Somit muss die C-Symmetrie gebrochen sein. Wird die CP-Symmetrie betrachtet, ergibt sich eine ähnliche Rechnung. Das Teilchen X besitzt nun zwei Zerfallskanäle in rechtshändige und linkshändige Quarks: X q L q L X q R q R Unter Brechung der C-Symmetrie gilt: Γ(X q L q L ) Γ( X q L q L ) 2
3 Die CP-Symmetrie sorgt dafür, dass immernoch gleich viele Baryonen wie Antibaryonen erzeugt werden: Insgesamt also: Γ(X q L q L ) = Γ( X q R q R ) Γ(X q R q R ) = Γ( X q L q L ) Γ(X q L q L ) + Γ(X q R q R ) = Γ( X q R q R ) + Γ( X q L q L ) Die CP-Symmetrie muss demnach gebrochen sein. Das dritte Kriterium ist das Verlassen des thermischen Gleichgewichts. Eine Teilchensorte befindet sich im thermischen Gleichgewicht, wenn die Erzeugungsrate der Teilchen ihrer Vernichtungsrate entspricht: Γ(X Y + B) = Γ(Y + B X) Es kann also keine Asymmetrie erzeugt werden. Dieses Ergebnis lässt sich auch mit dem Erwartungswert der Baryonenzahl unter Nutzung der CPT-Symmetrie des Hamiltonoperators zeigen: < B > T = T r(e βh B) = T r((cp T ) 1 (CP T )e βh B) = T r(e βh (CP T ) 1 B(CP T )) = T r(e βh ( B)) = T r(e βh (B)) = 0 3 Sakharovkriterien im Standartmodell Im Standartmodell tauchen in der Lagrangedichte quantisierter, massebehafteter Teilchensysteme Axialvektorströme auf, welche unter einer chiralen Transformation ψ e iβγ5 ψ nichtmehr invariant sind. Dies hat zur Folge, dass die Baryonen- und Leptopnenzahl nichtmehr erhalten sind. Die Kontinuitätsgleichugen lauten: µ j µ B = 3 16π 2 Tr(F µν F µν ) µ j µ L = 3 16π 2 Tr(F µν F µν ) Die Differenz B L ist hier eine Erhaltungsgrösse. Über die Spur der Feldstärketensoren lässt sich der Chern-Simons Strom K µ definieren: µ K µ = Tr(F µν Fµν ) In der Vakuumstruktur der SU(2) Eichtheorie können Übergange zwischen verschiedenen Vakuumskonfigurationen der beteiligten Eichfelder stattfinden. Geht das System von einem Zustand reiner Eichung (die Eichfelder verschwinden) zu einem Zustand reiner Eichung über, so ändert sich die Chern-Simons Zahl N CS um eine ganze Zahl: t1 N CS (t 1 ) N CS (t 0 ) = d 3 x µ K µ = ν Z t 0 3
4 Die Änderung der Chern-Simons Zahl ist direkt proportional zur Änderung der Baryonen- und Leptopnenzahl, wobei die Familienzahl N f = 3 die Proportionalität festlegt: µ J µ B+L = N f µ K µ = 3 µ K µ Eine Änderung der Chern-Simons Zahl um 1 bedeutet demnach die Vernichtung von 3 Baryonen/Leptonen und die Erzeugung dreier Antileptonen/Antibaryonen und umgekehrt. Es können somit beispielsweise drei Antileptonen in drei Baryonen umgewandelt werden. Der Eichfeldkonfiguration kann dabei eine Energie, abhängig von der Chern- Simons Zahl, zugewiesen werden. Die Energie hat eine periodische Struktur, wie in Abbildung 1 gezeigt. Mit der Masse des W -Bosons ist die Barrierehöhe bekannt: E sph 2M W α W f( λ g ) 6, 76TeV. 2 Abbildung 1: Sphaleron Energie in Abhängigkeit von der Chern-Simons Zahl. Ein Übergang kann nun auf verschiedene Weisen realisiert werden. Entweder kann die Barriere durchtunnelt werden, was als Instanton bezeichnet wird, oder die Barriere kann durch thermische Anregung überschritten werden, durch einen sogenannten Sphaleronprozess. Da ein Energiemaximum von E sph 6, 76TeV durchtunnelt werden muss, liefert der Instantonprozess, mit einer Tunnelwahrscheinlichkeit: A , keine signifikante Baryonenzahlverletzung. Da zum Überschreiten der Barriere eine Energie von mindestens 6, 76TeV nötig ist, führen Sphaleronen im heutigen Universum nicht zur Baryonenzahlverletzung. An dieser Stelle ist es also einsichtig, wieso die Annahme der Baryonenzahl- und Leptonenzahlerhaltung in der Teilchenphysik lange eine gerechtfertigte Annahme war. Bei thermischen Energien, in dieser Größenordnung, spielt die Symmetriebrechung der schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkung eine wichtige Rolle. Bei Energien von T m W war die Symmetrie der elektroschwachen Wechselwirkung noch nicht gebrochen und daher das W -Boson noch masselos. Da E Sph m W = 0 gilt, verschwindet bei diesen Temperaturen die Energiebarriere und Sphaleronübergänge sind nichtmehr unterdrückt. Das Standartmodell erfüllt hier das erste Sakharowkriterium, die B-Verletzung. Im Standartmodell sind Prozesse bekannt, die die CP-Symmetrie verletzen. So wird beispielsweise die Wechselwirkung eines Quarkzustandes dreier Flavour Generationen mit einem W -Boson durch die CKM-Matrix beschrieben: V ud V us V ub d V cd V cs V cb s = V td V ts V tb b Die CKM-Matrix wird über drei reelle Parameter und eine komplexe Phase beschrieben, die sich nicht über das Standartmodell vorhersagen lassen. Dies d s b 4
5 sind 4 der Parameter, welche im Standartmodell vorgegeben werden müssen. Die komplexe Phase in der CKM-Matrix verursacht eine CP-Verletzung. Ein Beispiel ist der Zerfall des neutralen Kaons, welches in zwei CP-Zuständen vorliegen kann: K 0 : CP ( K 0 1 >) = +1, CP ( K 0 2 >) = 1. Jeder dieser Zustände besitzt einen CP-erhaltenden Zerfallskanal: K 0 1 π + +π, K 0 2 π + +π + +π wurde von Christenson, Cronin, Fitch und Turlay der Zerfall eines Kaons nach: K 0 2 π + + π beobachtet. Hier liegt eine CP-Verletzung vor, ein System mit dem CP-Eigenwert 1 zerfällt in Teilchen mit CP-Eigenwert +1. Das zweite Sakharovkriterium wird damit ebenfalls vom Standartmodell erfült. Das dritte Sakharovkriterium erfordert das Verlassen des thermischen Gleichgewichts der beteiligten Teilchen. Wie oben beschrieben, sind die Sphaleronen nach dem elektroschwachen Phasenübergang (EWPT) nichtmehr im thermischen Gleichgewicht. Der EWPT ist somit der für die Baryogenese im Standartmodell relevante Punkt. Die Ordnung des Phasenübergangs spielt dabei eine entscheidende Rolle. In Abb. 2 ist der Verlauf des effektiven Potentials für einen Übergang erster und einen Übergang zweiter Ordnung gezeigt. Abbildung 2: Effektives Potential bei einem Phasenübergang 1. Ordnung (links) und 2. Ordung (rechts). Das effektive Potential ist so definiert, dass sich der Vakuumerwartungswert des Higgs-Feldes beim Minimum des eff. Potentials einstellt. Für einen Übergang erster Ordung gibt es bei der kritischen Temperatur T C zwei Minima. Das System kann in das Minimum mit H > 0 tunneln, wodurch sich Bereiche ausbilden, in welchen die Teilchen Masse besitzen und Bereiche, in welchen die Teilchen noch masselos sind (Abb. 3). In den masselosen Bereichen sind Spaleronübergänge ungehindert möglich, in Bereichen mit nicht verschwindender Masse sind die Sphaleronübergänge unterdrückt. Somit ist im Standartmodell auch das 3. Sakharovkriterium realisiert. 3.1 Mechanismus der elektroschwachen Baryogenese Wie im vorherigen Kapitel diskutiert sorgt ein Phasenübergang 1. Ordnung dafür, dass das thermische Gleichgewicht von den Sphaleronen verlassen wird und eine Blasenbildung auftritt. Bewegen sich nun Teilchen durch die Blasenwand, sorgen CP -verletzende Prozesse für grössere Reflexionswahrscheinlichkeit von q R als q L. Vor der Blasenwand herrscht also ein Überschuss an q R, wodurch der Sphaleronprozess mit neun q R und somit B = 3 schneller abläuft als der konkurrierende Prozess. Es entsteht also ein Überschuss an Baryonen, der durch die Bewegung der Blasenwand nach Aussen ins Innere der Blase gelangt. Im In- 5
6 Abbildung 3: Blasenbildung bei einem elektroschwachen Phasenübergang 1. Ordnung. neren sind Spaleronübergänge unterdrückt, wodurch die Baryonenasymmetrie erhalten bleibt. 3.2 Elektroschwacher Phasenübergang Unsere Argumentation setzt das entstehen von Blasen vorraus. Für einen Phasenübergang der nicht 1. Ordnung ist, erhalten alle Higgs-Bosonen gleichzeitig Masse (Abb. 2). Damit Baryonen in ausreichender Menge generiert werden, muss der Pasenübergang nicht nur 1. Ordnung, sondern stark 1. Ordnung sein. Dies ist für vc T c 1 gewährleistet, wobei T c die krit. Temp. beim EWPT und v c den VEW des Higgsfeldes bei T c bezeichnen. Diese Grössen sind mit der Masse des Higgs Bosons verknüpft. Für eine Masse von m H < 72 GeV wird ein starker Übergang 1. Ordnung erwartet. Die Messung am ATLAS lieferte m H = (125, 36 ± 0, 18) GeV. Somit gilt die elektroschwache Baryogenese im Standardmodell als gescheitert. 4 Baryogenese jenseits des SM 4.1 Minimal supersymmetrisches Modell Im MSSM gibt es einen Operator, welcher jedem Fermion einen bosonischen und jedem Boson einen fermionischen Superpartner zuordnet: Q f > b >, Q b > f >. Dem top-quark wird so das stop-quark zugeordnet. Das stop koppelt an das Higgs-Feld derart, dass der EWPT stark 1. Ordnung ist. Auch hier lässt sich eine Massenschranke finden: m t R < 172 GeV. m t R ist verknüpft mit der soft SUSY-breaking Energie, welche in der Grössenordnung von O(TeV) liegen muss, um die Masse des stop zu gewährleisten. Um weiteres fine-tuning zu vermeiden, sollte die Soft SUSY-breaking Energie in der Grössenordnung von O(100GeV) liegen. Das MSSM liefert also keinen Mechanismus für die Baryogenese, welcher mit den anderen Werten der Theorie konsistent ist. 6
7 4.2 SU(5) GUT In der SU(5) Eichtheorie treten schwere Eichbosonen X µ und schwere Higgs Bosonen Y auf. Da die Masse m Y sehr gross ist, findet der Zerfall ab einer bestimmten Temperatur des Universums nicht im therm. Gleichgewicht statt. Y zerfällt CP-verletzend, derart, dass Γ YA eu 2 Γ YA ēū 2 0. Beim Zerfall dieser Higgs-Bosonen wird demnach die Baryonenasymmetrie generiert. Dabei ist es möglich µ in der richtigen Größenordnung zu erhalten. Allerdings sagt die SU(5)-GUT den bisher nicht beobachteten Protonzerfall vorraus. Der SU(5) Symmetriebruch wird bei GeV erwartet. Die Energien liegen also weit über den am LHC erreichbaren Energien (Die Plank-Energie liegt bei GeV!). Auch in Zukunft wird diese Theorie also nicht experimentell verifizierbar sein. Es lässt sich also nicht unterscheiden, ob die Baryonenasymmetrie auf diese, oder eine andere Art entstanden ist. 4.3 Leptogenese Bei der Leptogenese erzeugt der Zerfall schwerer Teilchen eine Leptonenasymmetrie (ähnlich dem Mechanismus der SU(5)-GUT). Die Erzeugung der Baryonen erfolgt dann durch den Zerfall der Leptonen, welche als Majorana-Leptonen keine Leptonenzahl tragen. Da es sich um Majorana-Teilchen handelt, müssen diese ungeladen sein, da sonst Antiteilchen eine konjugierte Ladung besitzen würden. Die einzigen bekannten Leptonen, von denen noch nicht ausgeschlossen wird, dass sie Majorana-Teilchen sein könnten, sind die Neutrinos. Da Neutrinos nur schwach wechselwirken, wechselwirken ν R kaum (nur über das Z 0 ). Sollen Neutrinos mit Lorentz kovarianter Masse beschrieben werden, ist dies nur möglich über eine Matrix: [ ] [ 0 m νl ν D R m T D M ] [ ] νl Dabei ist M >> m D. Die Massen der Neutrinos ergeben sich durch die Eigenwerte: λ 1 M, λ 2 y 2 v 2 /M, wobei y die Yukawa Kopplungskonstante bezeichnet. Die Eigenwerte stehen in der Beziehung m 1 1/M 2 zueinander. Damit führt ein leichtes, linkshändiges Neutrino zu einem schweren, rechtshändigen Partner. Mit der Masse des ν τ : ν R ν τ,l = 0, 05 ev N τ,r = y GeV. Sobald die Temperatur des Universums so weit gesunken ist, dass M >> T befinden sich die N R im thermischen Ungleichgewicht. Das N R zerfällt nun CP verletzend, sodass ein Leptonenüberschuss erzeugt wird. Dieser wird nun durch den Sphaleronprozess: 3 L 3 B in Baryonenzahl umgewandelt. Dabei stellt sich bei B f 1 2 L i, L f 1 2 L i ein Gleichgewicht ein. Die Leptonenasymmetrie führt also zu einer Baryonenasymmetrie. µ ist dabei berechenbar und konsistent mit den Beobachtungen. Dabei ist µ(m ν ) ebenfalls konsistent mit der Masse der linkshändigen Neutrinos m ν 0, 3 ev. Die schweren N R werden von SO(10) GUT vorhergesagt, wobei mit M 1 > GeV eine untere Massenschranke für die leichtesten N 1 vorhergesagt wird. Diese Energien könnten bald von Beschleunigern erreicht werden. Offene Fragen sind noch die Auswirkungen der N R auf die Inflation. Die Leptogenese ist die heute favorisierte Theorie der Baryogenese. 7
8 Wird der neutrinolose doppel-β Zerfall bald in einem Experiment beobachtet, wäre dies ein weiterer Hinweis, das die Idee der Leptogenese der Wirklichkeit entsprechen könnte. 4.4 Zusammenfassung Die Baryonenasymmetrie im Universum lässt sich auf verschiedene Weisen beobachten und quantifizieren (CMB Multipolmomente, kosmische Strahlung, keine Vernichtungsprozesse sichtbar). Dabei liefern unabhängige Messungen konsistente Werte. Jede Theorie, welche eine Baryogenese erklären will, muss die Sakharow-Kriterien: B, CP Verletzung, thermisches Ungleichgewicht, erfüllen. Diese sind im Standartmodell durch die Sphaleronen erfüllt. Allerdings ist der EWPT nicht stark genug 1. Ordnung und die CP Verletzung im SM zu gering. Die Leptogenese ist die momentan favorisierte Theorie. Literatur [1] James M. Cline: BARYOGENESIS. McGill University, Dept. of Physics, Montreal, Qc H3A 2T8, Canada. [2] Wilfried Buchmüller: Baryogenesis - 40 Years Later. DESY , October 2007 [3] Michael Dine, Alexander Kusenko: The Origin of the Matter-Antimatter Asymmetry. Department of Physics and Astronomy, University of California, Los Angeles, CA , and RIKEN BNL Research Center, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY [4] Yosef Nir: Leptogenesis: A Pedagogical Introduction. Department of Particle Physics Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel 8
Baryogenese I - Grundlagen und Baryogenese im Standardmodell der Teilchenphysik. Christopher Kranz
 Baryogenese I - Grundlagen und Baryogenese im Standardmodell der Teilchenphysik Christopher Kranz 17. Dezember 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung - Warum Baryogenese? 2 1.1 Evidenz der Baryonenasymmetrie.................
Baryogenese I - Grundlagen und Baryogenese im Standardmodell der Teilchenphysik Christopher Kranz 17. Dezember 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung - Warum Baryogenese? 2 1.1 Evidenz der Baryonenasymmetrie.................
Baryogenese II Alternative Szenarien jenseits des SM
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Zusammenfassung des Seminarvortrags zum Seminar Theorie der Teilchen und Felder im WS 11/12 Baryogenese II Alternative Szenarien jenseits des SM Marcel Rothering
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Zusammenfassung des Seminarvortrags zum Seminar Theorie der Teilchen und Felder im WS 11/12 Baryogenese II Alternative Szenarien jenseits des SM Marcel Rothering
Dunkle Materie - Kandidaten aus der Teilchenphysik Proseminar WS 2010/2011: Kosmologie und Astroteilchenphysik
 Dunkle Materie - Kandidaten aus der Teilchenphysik Proseminar WS 2010/2011: Kosmologie und Astroteilchenphysik Andreas Kell 15.12.2011 Gliederung Überblick Kandidaten Standardmodell der Teilchenphysik
Dunkle Materie - Kandidaten aus der Teilchenphysik Proseminar WS 2010/2011: Kosmologie und Astroteilchenphysik Andreas Kell 15.12.2011 Gliederung Überblick Kandidaten Standardmodell der Teilchenphysik
Physik jenseits des Standardmodells
 Physik jenseits des Standardmodells 1 Inhalt Wiederholung/Probleme des Standardmodells Grand Unified Theories Supersymmetrie Zusammenfassung 2 Inhalt Wiederholung/Probleme des Standardmodells Fermionen
Physik jenseits des Standardmodells 1 Inhalt Wiederholung/Probleme des Standardmodells Grand Unified Theories Supersymmetrie Zusammenfassung 2 Inhalt Wiederholung/Probleme des Standardmodells Fermionen
Der Higgssektor des MSSM
 Der Higgssektor des MSSM Dominik Beutel 1. Januar 016 1 / 7 Übersicht Motivation Das MSSM Elektroschwache Symmetriebrechung im MSSM Die Massen der Higgsbosonen Higgskopplungen Vergleich mit HDM / 7 Motivation
Der Higgssektor des MSSM Dominik Beutel 1. Januar 016 1 / 7 Übersicht Motivation Das MSSM Elektroschwache Symmetriebrechung im MSSM Die Massen der Higgsbosonen Higgskopplungen Vergleich mit HDM / 7 Motivation
Symmetrien Symmetriebrechung CP-Verletzung Vorhersage neuer Quarks. Symmetriebrechung. Kevin Diekmann
 Symmetriebrechung Kevin Diekmann 5.6.2013 Inhaltsverzeichnis 1 Symmetrien Allgemeines Noether-Theorem 2 Symmetriebrechung spontane explizite 3 CP-Verletzung Kaon-Zerfall 4 Vorhersage neuer Quarks Nobelpreis
Symmetriebrechung Kevin Diekmann 5.6.2013 Inhaltsverzeichnis 1 Symmetrien Allgemeines Noether-Theorem 2 Symmetriebrechung spontane explizite 3 CP-Verletzung Kaon-Zerfall 4 Vorhersage neuer Quarks Nobelpreis
Baryogenese. Janine Hütig 1. Februar Baryonenasymmetrie Evidenzen Größe... 2
 Baryogenese Janine Hütig 1. Februar 2007 Die Frage, warum es überhaupt Materie gibt, ist bis heute ungelöst und stellt gut bewährte Theorien wie das Standardmodell der Elementarteilchentheorie vor ein
Baryogenese Janine Hütig 1. Februar 2007 Die Frage, warum es überhaupt Materie gibt, ist bis heute ungelöst und stellt gut bewährte Theorien wie das Standardmodell der Elementarteilchentheorie vor ein
Das Standardmodell der Teilchenphysik. Clara Fuhrer
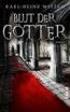 1 Das Standardmodell der Teilchenphysik Clara Fuhrer 2 Das Standardmodell der Teilchenphysik Gliederung: Einführung Was ist das Standardmodell Die Elementarteilchen Leptonen Hadronen Quarks Die Wechselwirkungen
1 Das Standardmodell der Teilchenphysik Clara Fuhrer 2 Das Standardmodell der Teilchenphysik Gliederung: Einführung Was ist das Standardmodell Die Elementarteilchen Leptonen Hadronen Quarks Die Wechselwirkungen
Standardmodell der Materie und Wechselwirkungen:
 Standardmodell der Materie und en: (Quelle: Wikipedia) 1.1. im Standardmodell: sind die kleinsten bekannten Bausteine der Materie. Die meisten Autoren bezeichnen die Teilchen des Standardmodells der Teilchenphysik
Standardmodell der Materie und en: (Quelle: Wikipedia) 1.1. im Standardmodell: sind die kleinsten bekannten Bausteine der Materie. Die meisten Autoren bezeichnen die Teilchen des Standardmodells der Teilchenphysik
H ± Das Higgs-Teilchen. Manuel Hohmann Universität Hamburg. 11. Januar 2005
 H 0 Das Higgs-Teilchen Manuel Hohmann Universität Hamburg 11. Januar 2005 H 0 Inhaltsverzeichnis 1 Der Higgs-Mechanismus 3 2 Das Higgs im Standardmodell 11 3 Das Higgs und die Neutrinos 19 H 0 1. Der Higgs-Mechanismus
H 0 Das Higgs-Teilchen Manuel Hohmann Universität Hamburg 11. Januar 2005 H 0 Inhaltsverzeichnis 1 Der Higgs-Mechanismus 3 2 Das Higgs im Standardmodell 11 3 Das Higgs und die Neutrinos 19 H 0 1. Der Higgs-Mechanismus
Moderne Experimentalphysik III: Hadronen und Teilchen (Physik VI)
 Moderne Experimentalphysik III: Hadronen und Teilchen (Physik VI) Thomas Müller, Roger Wolf 05. Juli 2018 INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS (IETP) PHYSICS FACULTY KIT University of the State of
Moderne Experimentalphysik III: Hadronen und Teilchen (Physik VI) Thomas Müller, Roger Wolf 05. Juli 2018 INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS (IETP) PHYSICS FACULTY KIT University of the State of
Supersymmetrie. Jan Uphoff. 19. August Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Jan Uphoff Goethe-Universität Frankfurt am Main 19. August 2008 Jan Uphoff 1/42 Gliederung Physik jenseits des Standardmodell Grand unification theory (GUT) Das Hierarchieproblem 1 Motivation Physik jenseits
Jan Uphoff Goethe-Universität Frankfurt am Main 19. August 2008 Jan Uphoff 1/42 Gliederung Physik jenseits des Standardmodell Grand unification theory (GUT) Das Hierarchieproblem 1 Motivation Physik jenseits
Vorlesung 8/10, Augsburg, Sommersemester 1998 Einführung in die moderne Teilchenphysik Dr. Stefan Schael Max-Planck Institut für Physik Werner Heisenb
 Einführung in die moderne Teilchenphysik Dr. Stefan Schael Max-Planck Institut für Physik Werner Heisenberg Institut Föhringer Ring 6 D-80805 München 1. Das Standardmodell der Teilchenphysik 2. Teilchenbeschleuniger
Einführung in die moderne Teilchenphysik Dr. Stefan Schael Max-Planck Institut für Physik Werner Heisenberg Institut Föhringer Ring 6 D-80805 München 1. Das Standardmodell der Teilchenphysik 2. Teilchenbeschleuniger
SUSY - TEILCHEN. als Dunkle Materie. Theorie und Nachweis. Hauptseminar über Dunkle Materie Hilmar Schachenmayr
 SUSY - TEILCHEN als Dunkle Materie Theorie und Nachweis Hauptseminar über Dunkle Materie Hilmar Schachenmayr 1) Einleitung Inhalt 2) Supersymmetrie a) Was ist Supersymmetrie? b) Aussagen der SUSY-Theorie
SUSY - TEILCHEN als Dunkle Materie Theorie und Nachweis Hauptseminar über Dunkle Materie Hilmar Schachenmayr 1) Einleitung Inhalt 2) Supersymmetrie a) Was ist Supersymmetrie? b) Aussagen der SUSY-Theorie
Higgs und Elektroschwache WW
 Higgs und Elektroschwache WW Vorlesung Higgs und Elektroschwache Wechselwirkung mit Übungen Achim Geiser, Benno List Zeit: Mittwoch, 14:15-15:45 (VL) Ort: Sem. 3, Jungiusstraße Erster Termin: Mittwoch,
Higgs und Elektroschwache WW Vorlesung Higgs und Elektroschwache Wechselwirkung mit Übungen Achim Geiser, Benno List Zeit: Mittwoch, 14:15-15:45 (VL) Ort: Sem. 3, Jungiusstraße Erster Termin: Mittwoch,
Grundlagen Theorie BaBar-Experiment. CP-Verletzung. Andreas Müller. 06. Juni 2007
 Andreas Müller 06. Juni 2007 Inhalt 1 Symmetrien Schwache Wechselwirkung im Kaon-System 2 Quarkmischung - CKM-Matrix Unitaritätsdreieck B-Mesonen 3 Detektor 2β-Messung CKM-Fit Gliederung Symmetrien Schwache
Andreas Müller 06. Juni 2007 Inhalt 1 Symmetrien Schwache Wechselwirkung im Kaon-System 2 Quarkmischung - CKM-Matrix Unitaritätsdreieck B-Mesonen 3 Detektor 2β-Messung CKM-Fit Gliederung Symmetrien Schwache
Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik
 V 1.0 Seminar SS 2010 RWTH Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik Erdmann, Hebbeker, Stahl, Wiebusch et al. III. Phys. Inst. A+B Elementarteilchenphysik und Astroteilchenphysik Seminarthemen
V 1.0 Seminar SS 2010 RWTH Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik Erdmann, Hebbeker, Stahl, Wiebusch et al. III. Phys. Inst. A+B Elementarteilchenphysik und Astroteilchenphysik Seminarthemen
Teilchenphysik III, Wintersemester 2018 Prüfungsfragen
 Teilchenphysik III, Wintersemester 2018 Prüfungsfragen 19. Standardmodell der Teilchenphysik 19.1. Schreiben Sie alle im Standardmodell (Minimalversion) vorkommenden Felder, geordnet nach Multipletts bezüglich
Teilchenphysik III, Wintersemester 2018 Prüfungsfragen 19. Standardmodell der Teilchenphysik 19.1. Schreiben Sie alle im Standardmodell (Minimalversion) vorkommenden Felder, geordnet nach Multipletts bezüglich
Institut für Strahlenphysik Dr. Daniel Bemmerer Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Altes und Neues zum Standardmodell
 Institut für Strahlenphysik Dr. Daniel Bemmerer www.fzd.de Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Altes und Neues zum Standardmodell Von den Quarks zum Universum QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor
Institut für Strahlenphysik Dr. Daniel Bemmerer www.fzd.de Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Altes und Neues zum Standardmodell Von den Quarks zum Universum QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor
Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik
 V 1.0 Seminar SS 2009 RWTH Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik Boersma, Erdmann,, Hebbeker, Hoepfner, Klimkovich, Magass, Meyer, Merschmeyer, Pooth, Wiebusch Elementarteilchenphysik und Astroteilchenphysik
V 1.0 Seminar SS 2009 RWTH Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik Boersma, Erdmann,, Hebbeker, Hoepfner, Klimkovich, Magass, Meyer, Merschmeyer, Pooth, Wiebusch Elementarteilchenphysik und Astroteilchenphysik
Einführung in die Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung - verschiedene Prozesse der schwachen WW - Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix Standardmodell
 Kern- und Teilchenphysik Einführung in die Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung - verschiedene Prozesse der schwachen WW - Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix Standardmodell Typische Prozesse der schwachen
Kern- und Teilchenphysik Einführung in die Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung - verschiedene Prozesse der schwachen WW - Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix Standardmodell Typische Prozesse der schwachen
Standardmodelltests: W- und Z-Bosonen
 Hauptseminar: Höchstenergetische Teilchenbeschleuniger Standardmodelltests: W- und Z-Bosonen Claudio Heller Inhalt Einführung und Theorie Produktion der Eichbosonen bei Cern und Fermilab Massenbestimmung
Hauptseminar: Höchstenergetische Teilchenbeschleuniger Standardmodelltests: W- und Z-Bosonen Claudio Heller Inhalt Einführung und Theorie Produktion der Eichbosonen bei Cern und Fermilab Massenbestimmung
Dunkle Materie und Teilchenphysik
 Universität Hamburg Weihnachtliche Festveranstaltung Department Physik 17. Dezember 2008 Woher weiß man, dass es Dunkle Materie gibt? Sichtbare Materie in Galaxien (Sterne, Gas) kann nicht die beobachteten
Universität Hamburg Weihnachtliche Festveranstaltung Department Physik 17. Dezember 2008 Woher weiß man, dass es Dunkle Materie gibt? Sichtbare Materie in Galaxien (Sterne, Gas) kann nicht die beobachteten
Das 2-Higgs-Dublett-Modell (2HDM)
 Das 2-Higgs-Dublett-Modell 2HDM Lukas Emmert, 17.12.2015 KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE KIT 1 KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und Das 2-Higgs-Dublett-Modell Lukas Emmert nationales Forschungszentrum
Das 2-Higgs-Dublett-Modell 2HDM Lukas Emmert, 17.12.2015 KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE KIT 1 KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und Das 2-Higgs-Dublett-Modell Lukas Emmert nationales Forschungszentrum
Moderne Methoden/Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik
 Seminar WS 2001/2002 RWTH: Moderne Methoden/Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik Flügge, Grünewald, Hebbeker, Lanske, Mnich, Schael, Struczinski, Wallraff Elementarteilchenphysik/Astroteilchenphysik
Seminar WS 2001/2002 RWTH: Moderne Methoden/Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik Flügge, Grünewald, Hebbeker, Lanske, Mnich, Schael, Struczinski, Wallraff Elementarteilchenphysik/Astroteilchenphysik
Heute: Gibt es noch mehr Neutrinos?
 Heute: Gibt es noch mehr Neutrinos? Eine Präsentation von Martin Spinrath Seminar: Neutrinos Rätselhafte Bausteine der Materie (SoSe '06) Betreuer: Steffen Kappler 1 Inhaltsübersicht: Bisherige experimentelle
Heute: Gibt es noch mehr Neutrinos? Eine Präsentation von Martin Spinrath Seminar: Neutrinos Rätselhafte Bausteine der Materie (SoSe '06) Betreuer: Steffen Kappler 1 Inhaltsübersicht: Bisherige experimentelle
Von der Entdeckung des Higgs-Teilchens zur Suche nach Dunkler Materie -Neues zur Forschung am LHC-
 Von der Entdeckung des Higgs-Teilchens zur Suche nach Dunkler Materie -Neues zur Forschung am LHC- Prof. Karl Jakobs Physikalisches Institut Universität Freiburg Von der Entdeckung des Higgs-Teilchens
Von der Entdeckung des Higgs-Teilchens zur Suche nach Dunkler Materie -Neues zur Forschung am LHC- Prof. Karl Jakobs Physikalisches Institut Universität Freiburg Von der Entdeckung des Higgs-Teilchens
Handout zum Hauptseminarvortrag. Supersymmetrie. Von Simon Kast vom Hauptseminar Der Urknall und seine Teilchen
 Handout zum Hauptseminarvortrag Supersymmetrie Von Simon Kast vom 03.06.2011 Hauptseminar Der Urknall und seine Teilchen Inhaltsverzeichnis 1. Das Standardmodell... 2 1.1. Überblick Teilchen und Kräfte...
Handout zum Hauptseminarvortrag Supersymmetrie Von Simon Kast vom 03.06.2011 Hauptseminar Der Urknall und seine Teilchen Inhaltsverzeichnis 1. Das Standardmodell... 2 1.1. Überblick Teilchen und Kräfte...
Supersymmetrie. Der Urknall und seine Teilchen. Simon Kast
 Supersymmetrie Der Urknall und seine Teilchen Simon Kast 03.06.2011 www.kit.edu Inhalt Kurzer Rückblick auf das Standardmodell Probleme des Standardmodells Erster Versuch einer Grand Unified Theory Verlauf
Supersymmetrie Der Urknall und seine Teilchen Simon Kast 03.06.2011 www.kit.edu Inhalt Kurzer Rückblick auf das Standardmodell Probleme des Standardmodells Erster Versuch einer Grand Unified Theory Verlauf
Quarks, Higgs und die Struktur des Vakuums. Univ. Prof. Dr. André Hoang
 Quarks, Higgs und die Struktur des Vakuums Univ. Prof. Dr. André Hoang Was bewegt 700 Physiker, in Wien zur größten Konferenz über Elementarteilchen des Jahres 2015 zusammenzukommen? Quarks, Higgs und
Quarks, Higgs und die Struktur des Vakuums Univ. Prof. Dr. André Hoang Was bewegt 700 Physiker, in Wien zur größten Konferenz über Elementarteilchen des Jahres 2015 zusammenzukommen? Quarks, Higgs und
Einführung in die Supersymmetrie (SUSY) Martin Reitz
 Einführung in die Supersymmetrie (SUSY) Martin Reitz 07.12.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Das Standardmodell 3 1.1 Überlick über das Standardmodell................................... 3 1.2 Kritik am Standardmodell........................................
Einführung in die Supersymmetrie (SUSY) Martin Reitz 07.12.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Das Standardmodell 3 1.1 Überlick über das Standardmodell................................... 3 1.2 Kritik am Standardmodell........................................
Masse des Top-Quarks
 Einleitung Masse des Top-Quarks Julius Förstel Fakultät für Physik und Astronomie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Seminar Präzisionsexperimente der Teilchenphysik 16. Mai 2014 Julius Förstel Masse
Einleitung Masse des Top-Quarks Julius Förstel Fakultät für Physik und Astronomie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Seminar Präzisionsexperimente der Teilchenphysik 16. Mai 2014 Julius Förstel Masse
DIE THERMISCHE GESCHICHTE DES UNIVERSUMS & FREEZE-OUT. 14. Dezember Kim Susan Petersen. Proseminar Theoretische Physik & Astroteilchenphysik
 DIE THERMISCHE GESCHICHTE DES UNIVERSUMS & FREEZE-OUT 14. Dezember 2010 Kim Susan Petersen Proseminar Theoretische Physik & Astroteilchenphysik INHALT 1. Das Standardmodell 2. Die Form des Universums 3.
DIE THERMISCHE GESCHICHTE DES UNIVERSUMS & FREEZE-OUT 14. Dezember 2010 Kim Susan Petersen Proseminar Theoretische Physik & Astroteilchenphysik INHALT 1. Das Standardmodell 2. Die Form des Universums 3.
Einheit 13 Subatomare Physik 2
 Einheit 13 Subatomare Physik 2 26.01.2012 Markus Schweinberger Sebastian Miksch Markus Rockenbauer Subatomare Physik 2 Fundamentale Wechselwirkungen Das Standardmodell Elementarteilchen Erhaltungssätze
Einheit 13 Subatomare Physik 2 26.01.2012 Markus Schweinberger Sebastian Miksch Markus Rockenbauer Subatomare Physik 2 Fundamentale Wechselwirkungen Das Standardmodell Elementarteilchen Erhaltungssätze
Handout zur Suche nach dem Higgs
 Handout zur Suche nach dem Higgs Martin Ripka 21.6.2010 1 Theorie 1.1 Physikalischer Hintergrund In der Lagrangedichte des Standardmodells müssen die Eichbosonen wegen der Eichinvarianz masselos sein.
Handout zur Suche nach dem Higgs Martin Ripka 21.6.2010 1 Theorie 1.1 Physikalischer Hintergrund In der Lagrangedichte des Standardmodells müssen die Eichbosonen wegen der Eichinvarianz masselos sein.
Elementarteilchenphysik
 Christoph Berger Elementarteilchenphysik Von den Grundlagen zu den modernen Experimenten Zweite, aktualisierte und überarbeitete Auflage Mit 217 Abbildungen, 51 Tabellen und 88 Übungen mit Lösungshinweisen
Christoph Berger Elementarteilchenphysik Von den Grundlagen zu den modernen Experimenten Zweite, aktualisierte und überarbeitete Auflage Mit 217 Abbildungen, 51 Tabellen und 88 Übungen mit Lösungshinweisen
Frühes Universum. Katharina Müller Universität Zürich
 Frühes Universum Katharina Müller Universität Zürich kmueller@physik.unizh.ch 28. Juni 2002 Inhaltsverzeichnis 0.1 Bigbang Modell................................. 2 Katharina Müller 1 Frühes Universum
Frühes Universum Katharina Müller Universität Zürich kmueller@physik.unizh.ch 28. Juni 2002 Inhaltsverzeichnis 0.1 Bigbang Modell................................. 2 Katharina Müller 1 Frühes Universum
Supersymmetriebrechung
 Sommerakademie Neubeuern August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Lagrangedichte Ursprung der SUSY Brechung 2 Protonenzerfall Konsequenzen 3 LSP als direkte Suche indirekte Suche Einleitung Warum wurde bis jetzt
Sommerakademie Neubeuern August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Lagrangedichte Ursprung der SUSY Brechung 2 Protonenzerfall Konsequenzen 3 LSP als direkte Suche indirekte Suche Einleitung Warum wurde bis jetzt
Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Supersymmetrie
 Alexander Hock a-hock@gmx.net Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Supersymmetrie Datum des Vortrags: 28.05.2014 Betreuer: Prof. Dr. J. Heitger Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland
Alexander Hock a-hock@gmx.net Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Supersymmetrie Datum des Vortrags: 28.05.2014 Betreuer: Prof. Dr. J. Heitger Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland
Die Bausteine der Natur
 Die Bausteine der Natur Teilchenwelt - Masterclass 2011 Matthias Schröder, Jan Thomsen Fragen der Teilchenphysik Woraus bestehen wir und unsere Welt? Was sind die fundamentalen Kräfte in unserem Universum?
Die Bausteine der Natur Teilchenwelt - Masterclass 2011 Matthias Schröder, Jan Thomsen Fragen der Teilchenphysik Woraus bestehen wir und unsere Welt? Was sind die fundamentalen Kräfte in unserem Universum?
Physik jenseits des Standardmodells
 Physik jenseits des Standardmodells Hauptseminar Der Urknall und seine Teilchen Peter Krauß Hauptseminar WS 07/08 Gliederung Einführung Das Standardmodell (SM) Physik jenseits des Standardmodells Allgemeines
Physik jenseits des Standardmodells Hauptseminar Der Urknall und seine Teilchen Peter Krauß Hauptseminar WS 07/08 Gliederung Einführung Das Standardmodell (SM) Physik jenseits des Standardmodells Allgemeines
Oszillationen. Seminar über Astroteilchenphysik 23. Januar Betreuer: Prof. Dr. K. Rith. Theorie der Neutrino Massen und.
 s Theorie der Betreuer: Prof. Dr. K. Rith Seminar über Astroteilchenphysik 23. Januar 2006 Gliederung s 1 2 3 s Gliederung s 1 2 3 s Gliederung s 1 2 3 s Standardmodell s Das Modell zur Vereinheitlichung
s Theorie der Betreuer: Prof. Dr. K. Rith Seminar über Astroteilchenphysik 23. Januar 2006 Gliederung s 1 2 3 s Gliederung s 1 2 3 s Gliederung s 1 2 3 s Standardmodell s Das Modell zur Vereinheitlichung
Die Präzisionsmessung der Z0-Masse am LEP
 Die Präzisionsmessung der Z0-Masse am LEP Hauptseminar - Methoden der experimentellen Teilchenphysik Christoph Eberhardt 27.01.12 KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Die Präzisionsmessung der Z0-Masse am LEP Hauptseminar - Methoden der experimentellen Teilchenphysik Christoph Eberhardt 27.01.12 KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Kern- und Teilchenphysik
 Kern- und Teilchenphysik Johannes Blümer SS22 Vorlesung-Website KIT-Centrum Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik KCETA KIT Universität KT22 des Landes Johannes Baden-Württemberg Blümer und nationales
Kern- und Teilchenphysik Johannes Blümer SS22 Vorlesung-Website KIT-Centrum Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik KCETA KIT Universität KT22 des Landes Johannes Baden-Württemberg Blümer und nationales
CP-Verletzung. Zusammenfassung des Seminarvortrags zum Fortgeschrittenen Praktikum an der Universität Mainz im Sommersemester 10. Andreas Ludwig Weber
 CP-Verletzung Zusammenfassung des Seminarvortrags zum Fortgeschrittenen Praktikum an der Universität Mainz im Sommersemester Andreas Ludwig Weber Symmetrien waren und sind in immer stärkerem Maße von fundamentaler
CP-Verletzung Zusammenfassung des Seminarvortrags zum Fortgeschrittenen Praktikum an der Universität Mainz im Sommersemester Andreas Ludwig Weber Symmetrien waren und sind in immer stärkerem Maße von fundamentaler
Der Large Hadron Collider internationaler Vorstoß in unbekanntes Neuland des Mikro- und des Makrokosmos
 Der Large Hadron Collider internationaler Vorstoß in unbekanntes Neuland des Mikro- und des Makrokosmos Michael Kobel (TU Dresden) 1.11.2006 1.11.2006 Deutscher Journalistentag CERN, Michael Kobel 1 Die
Der Large Hadron Collider internationaler Vorstoß in unbekanntes Neuland des Mikro- und des Makrokosmos Michael Kobel (TU Dresden) 1.11.2006 1.11.2006 Deutscher Journalistentag CERN, Michael Kobel 1 Die
Effektive Feldtheorien in Higgs-Physik
 19 Januar 2017 Übersicht 1 EFT Grundlagen 2 Higgsmechanismus 3 Effektive Feldtheorien in Higgsphysik 4 Literatur Effektive Feldtheorien Effektive Feldtheorien sind Näherungen, bei denen über Oszillationen
19 Januar 2017 Übersicht 1 EFT Grundlagen 2 Higgsmechanismus 3 Effektive Feldtheorien in Higgsphysik 4 Literatur Effektive Feldtheorien Effektive Feldtheorien sind Näherungen, bei denen über Oszillationen
Experimentelle Elementarteilchenphysik
 Experimentelle Elementarteilchenphysik Hermann Kolanoski Humboldt-Universität zu Berlin Woraus besteht das Universum, wie ist es entstanden, wohin wird es sich entwickeln? Was ist Materie, was ist um uns
Experimentelle Elementarteilchenphysik Hermann Kolanoski Humboldt-Universität zu Berlin Woraus besteht das Universum, wie ist es entstanden, wohin wird es sich entwickeln? Was ist Materie, was ist um uns
7 Teilchenphysik und Kosmologie
 7.1 Entwicklung des Universums 7 Teilchenphysik und Kosmologie 7.1 Entwicklung des Universums 64 Die Spektrallinien sehr entfernter Galaxien sind gegenüber denen in unserer Galaxie rot-verschoben, d.h.
7.1 Entwicklung des Universums 7 Teilchenphysik und Kosmologie 7.1 Entwicklung des Universums 64 Die Spektrallinien sehr entfernter Galaxien sind gegenüber denen in unserer Galaxie rot-verschoben, d.h.
Hadron-Kollider-Experimente bei sehr hohen Energien
 V 1.1 Seminar WS 2006/07 RWTH Hadron-Kollider-Experimente bei sehr hohen Energien Erdmann, Feld, Hebbeker, Hoepfner, Kappler, Klein, Kreß, Meyer, Pooth, Weber Elementarteilchenphysik Hadron-Kollider-Experimente
V 1.1 Seminar WS 2006/07 RWTH Hadron-Kollider-Experimente bei sehr hohen Energien Erdmann, Feld, Hebbeker, Hoepfner, Kappler, Klein, Kreß, Meyer, Pooth, Weber Elementarteilchenphysik Hadron-Kollider-Experimente
6. Elementarteilchen
 6. Elementarteilchen Ein Ziel der Physik war und ist, die Vielfalt der Natur auf möglichst einfache, evtl. auch wenige Gesetze zurückzuführen. Die Idee hinter der Atomvorstellung des Demokrit war, unteilbare
6. Elementarteilchen Ein Ziel der Physik war und ist, die Vielfalt der Natur auf möglichst einfache, evtl. auch wenige Gesetze zurückzuführen. Die Idee hinter der Atomvorstellung des Demokrit war, unteilbare
Supersymmetrie und das Minimale Supersymmetrische Standardmodell. Lena Feld, 8. Dezember 2016
 Supersymmetrie und das Minimale Supersymmetrische Standardmodell Lena Feld, 8. Dezember 2016 Überblick Nachteile des Standardmodells Hierarchieproblem Einführung von Supersymmetrie Lösung des Hierarchieproblems
Supersymmetrie und das Minimale Supersymmetrische Standardmodell Lena Feld, 8. Dezember 2016 Überblick Nachteile des Standardmodells Hierarchieproblem Einführung von Supersymmetrie Lösung des Hierarchieproblems
Standardmodell der Kosmologie
 ! "# $! "# # % & Standardmodell der Kosmologie Urknall und Entwicklung des Universums Inhalt Einleitung Experimentelle Hinweise auf einen Urknall Rotverschiebung der Galaxien kosmische Hintergrundstrahlung
! "# $! "# # % & Standardmodell der Kosmologie Urknall und Entwicklung des Universums Inhalt Einleitung Experimentelle Hinweise auf einen Urknall Rotverschiebung der Galaxien kosmische Hintergrundstrahlung
Massive Neutrinos: Theory und Phänomenologie. Werner Rodejohann PIzzA Night 02/11/09
 Massive Neutrinos: Theory und Phänomenologie Werner Rodejohann PIzzA Night 02/11/09 1 ERC: European Research Council, gegründet 2007 von der EU, finanziert durch das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU,
Massive Neutrinos: Theory und Phänomenologie Werner Rodejohann PIzzA Night 02/11/09 1 ERC: European Research Council, gegründet 2007 von der EU, finanziert durch das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU,
Gespiegelte Antiwelten: Die experimentelle Bestätigung der Nobelpreis-2008-Theorie. Prof. Dr. Michael Feindt Karlsruher Institut für Technologie KIT
 Gespiegelte Antiwelten: Die experimentelle Bestätigung der Nobelpreis-2008-Theorie Prof. Dr. Michael Feindt Karlsruher Institut für Technologie KIT Physik-Nobelpreis 2008 2008 ,,für die Entdeckung der
Gespiegelte Antiwelten: Die experimentelle Bestätigung der Nobelpreis-2008-Theorie Prof. Dr. Michael Feindt Karlsruher Institut für Technologie KIT Physik-Nobelpreis 2008 2008 ,,für die Entdeckung der
PHÄNOMENOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MINIMALEN R-SYMMETRISCHEN SUPERSYMMETRISCHEN STANDARDMODELLS
 Bereich Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Institut für Kern- und Teilchenphysik PHÄNOMENOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MINIMALEN R-SYMMETRISCHEN SUPERSYMMETRISCHEN STANDARDMODELLS Disputationsvortrag
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Institut für Kern- und Teilchenphysik PHÄNOMENOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MINIMALEN R-SYMMETRISCHEN SUPERSYMMETRISCHEN STANDARDMODELLS Disputationsvortrag
CP-Verletzung im K-System
 Kapitel 3. CP-Verletzung im K-System B. Cahn 3. CP-Verletzung im K-System Gliederung: Teil 3..: Hist.: Experimentelle Beobachtung CPV Teil 3..: CP-Phänomenologie Teil 3..3: Erklärung CPV im Standardmodell
Kapitel 3. CP-Verletzung im K-System B. Cahn 3. CP-Verletzung im K-System Gliederung: Teil 3..: Hist.: Experimentelle Beobachtung CPV Teil 3..: CP-Phänomenologie Teil 3..3: Erklärung CPV im Standardmodell
Die Suche nach dem Higgs-Teilchen am LHC
 Die Suche nach dem Higgs-Teilchen am LHC Seminarvortrag am 17.06.2010 Marco Brandl Inhalt Das Standardmodell und die Eichtheorien Der Higgs-Mechanismus Die Suche nach dem Higgs-Boson am LHC Das Standardmodell
Die Suche nach dem Higgs-Teilchen am LHC Seminarvortrag am 17.06.2010 Marco Brandl Inhalt Das Standardmodell und die Eichtheorien Der Higgs-Mechanismus Die Suche nach dem Higgs-Boson am LHC Das Standardmodell
Einführung in Supersymmetrie und das MSSM
 1/27 Einführung in Supersymmetrie und das 14.01.2016 Übersicht SUSY Motivation SUSY-Operator Poincaré-Superalgebra Brechung Wess-Zumino-Modell Eigenschaften des R-Parität Parameterfreiheit Weitere supersymmetrische
1/27 Einführung in Supersymmetrie und das 14.01.2016 Übersicht SUSY Motivation SUSY-Operator Poincaré-Superalgebra Brechung Wess-Zumino-Modell Eigenschaften des R-Parität Parameterfreiheit Weitere supersymmetrische
1) Teilchenbeschleunigung am LHC und im Kosmos
 1 Übungsblatt 06112013 1) Teilchenbeschleunigung am LHC und im Kosmos Kosmische Beschleuniger wie aktive galaktische Kerne, sog AGN s (active galactic nuclei), beschleunigen Teilchen auf Energien von bis
1 Übungsblatt 06112013 1) Teilchenbeschleunigung am LHC und im Kosmos Kosmische Beschleuniger wie aktive galaktische Kerne, sog AGN s (active galactic nuclei), beschleunigen Teilchen auf Energien von bis
Einführung in das Standardmodell
 Einführung in das Standardmodell 28.11.2006 Markus Lichtnecker Übersicht Entwicklung des Standardmodells Materieteilchen Austauschteilchen Vereinheitlichung der Theorien Grenzen des Standardmodells Entwicklung
Einführung in das Standardmodell 28.11.2006 Markus Lichtnecker Übersicht Entwicklung des Standardmodells Materieteilchen Austauschteilchen Vereinheitlichung der Theorien Grenzen des Standardmodells Entwicklung
Alternativen zum Standardmodell
 Alternativen zum Standardmodell Ideen und Konzepte Wolfgang Kilian (DESY) DPG-Frühjahrstagung Mainz März 2004 Standardmodell 2004 SM: Minimales Modell, das mit allen Daten der Teilchenphysik vereinbar
Alternativen zum Standardmodell Ideen und Konzepte Wolfgang Kilian (DESY) DPG-Frühjahrstagung Mainz März 2004 Standardmodell 2004 SM: Minimales Modell, das mit allen Daten der Teilchenphysik vereinbar
Higgs, B-Physik und Co. die ersten 4 Jahre Physik am LHC
 Higgs, B-Physik und Co. die ersten 4 Jahre Physik am LHC Michael Schmelling MPI für Kernphysik Einführung in die Teilchenphysik Der LHC und das Higgs Teilchen Physik mit schweren Mesonen Zusammenfassung
Higgs, B-Physik und Co. die ersten 4 Jahre Physik am LHC Michael Schmelling MPI für Kernphysik Einführung in die Teilchenphysik Der LHC und das Higgs Teilchen Physik mit schweren Mesonen Zusammenfassung
Elementarteilchen. wie wir sie bei LHC sehen können
 Elementarteilchen und wie wir sie bei LHC sehen können Manfred Jeitler Institut für Hochenergiephysik der Öt Österreichischen ihi h Akademie Akd der Wissenschaften hft 1 Das Wasserstoffatom e - Photonaustausch
Elementarteilchen und wie wir sie bei LHC sehen können Manfred Jeitler Institut für Hochenergiephysik der Öt Österreichischen ihi h Akademie Akd der Wissenschaften hft 1 Das Wasserstoffatom e - Photonaustausch
Das Higgs Boson und seine Masse Was lernen wir von der Entdeckung am LHC?
 Das Higgs Boson und seine Masse Was lernen wir von der Entdeckung am LHC? LHC : Higgs Boson gefunden? CMS 2011/12 ATLAS 2011/12 Higgs Boson gefunden! Masse 125-126 GeV Higgs Boson des Standard-Modells
Das Higgs Boson und seine Masse Was lernen wir von der Entdeckung am LHC? LHC : Higgs Boson gefunden? CMS 2011/12 ATLAS 2011/12 Higgs Boson gefunden! Masse 125-126 GeV Higgs Boson des Standard-Modells
Kerne und Teilchen. Moderne Physik III
 Kerne und Teilchen Moderne Physik III Vorlesung # 0 8. Moderne Elementarteilchen-Physik 8.1 Phänomene der Schwachen Wechselwirkung a) Klassifikation schwacher Prozesse b) Elektroschwache Vereinigung c)
Kerne und Teilchen Moderne Physik III Vorlesung # 0 8. Moderne Elementarteilchen-Physik 8.1 Phänomene der Schwachen Wechselwirkung a) Klassifikation schwacher Prozesse b) Elektroschwache Vereinigung c)
Vorlesung 11: Roter Faden: 1. Neutrino Hintergrundstrahlung 2. Kernsynthese. Photonen (410/cm 3 ) (CMB) Neutrinos (350/cm 3 ) (nicht beobachtet)
 Vorlesung 11: Roter Faden: 1. Neutrino Hintergrundstrahlung 2. Kernsynthese Universum besteht aus: Hintergrundstrahlung: Photonen (410/cm 3 ) (CMB) Neutrinos (350/cm 3 ) (nicht beobachtet) Wasserstoff
Vorlesung 11: Roter Faden: 1. Neutrino Hintergrundstrahlung 2. Kernsynthese Universum besteht aus: Hintergrundstrahlung: Photonen (410/cm 3 ) (CMB) Neutrinos (350/cm 3 ) (nicht beobachtet) Wasserstoff
Urknall rückwärts: Experimente an den Grenzen der Physik. Peter Schleper Universität Hamburg
 Urknall rückwärts: Experimente an den Grenzen der Physik Peter Schleper Universität Hamburg 4.11.2017 1 Teilchen + Kräfte Entwicklung des Universums Grenzen der Naturgesetze 2 Wasser H2O heizen: Rückwärts
Urknall rückwärts: Experimente an den Grenzen der Physik Peter Schleper Universität Hamburg 4.11.2017 1 Teilchen + Kräfte Entwicklung des Universums Grenzen der Naturgesetze 2 Wasser H2O heizen: Rückwärts
Physics at LHC Mini Schwarze Löcher am ATLAS-Detektor
 Physics at LHC Seminar am 21.01.2009 Größe und Masse Hawkingstrahlung und -Temperatur Arten Allgemeine Relativitätstheorie jede Form von Energie erzeugt eine Raumzeitkrümmung Bei einem Schwarzen Loch
Physics at LHC Seminar am 21.01.2009 Größe und Masse Hawkingstrahlung und -Temperatur Arten Allgemeine Relativitätstheorie jede Form von Energie erzeugt eine Raumzeitkrümmung Bei einem Schwarzen Loch
Das Standardmodell der Teilchenphysik
 Das Standardmodell der Teilchenphysik Clara Fuhrer Einführung Das Ziel des Standardmodells der Teilchenphysik ist es, die grundlegende Struktur der sichtbaren Materie in Form von punktförmigen Elementarteilchen,
Das Standardmodell der Teilchenphysik Clara Fuhrer Einführung Das Ziel des Standardmodells der Teilchenphysik ist es, die grundlegende Struktur der sichtbaren Materie in Form von punktförmigen Elementarteilchen,
Der Higgs-Mechanismus. Max Camenzind Akademie Heidelberg Juli 2015
 Der Higgs-Mechanismus Max Camenzind Akademie Heidelberg Juli 2015 Pluto New Horizons @ 9.7.2015 Pluto New Horizons @ 13.7.2015 Reines Neutrino Nachweis 1956 Cowan & Reines Experiment Elektron-Antineutrinos
Der Higgs-Mechanismus Max Camenzind Akademie Heidelberg Juli 2015 Pluto New Horizons @ 9.7.2015 Pluto New Horizons @ 13.7.2015 Reines Neutrino Nachweis 1956 Cowan & Reines Experiment Elektron-Antineutrinos
Die Suche nach dem Higgs-Teilchen
 Die Suche nach dem Higgs-Teilchen Eva Ziebarth. Dezember 005 Theoretische Herleitung. Eichsymmetrien Das aus der Elektrodynamik bewährte Prinzip der Eichsymmetrien wird auf die Teilchenphysik übertragen.
Die Suche nach dem Higgs-Teilchen Eva Ziebarth. Dezember 005 Theoretische Herleitung. Eichsymmetrien Das aus der Elektrodynamik bewährte Prinzip der Eichsymmetrien wird auf die Teilchenphysik übertragen.
Die Entdeckung der neutralen Ströme & Die Entdeckung der W- und Z-Bosonen. Sabine Blatt Betreuer: Prof. Dr. J. Mnich 28.
 Die Entdeckung der neutralen Ströme & Die Entdeckung der W- und Z-Bosonen Sabine Blatt Betreuer: Prof. Dr. J. Mnich 28. Januar 2003 Inhalt I. Theorie der schwachen Wechselwirkung - Fermis Strom-Strom-Theorie
Die Entdeckung der neutralen Ströme & Die Entdeckung der W- und Z-Bosonen Sabine Blatt Betreuer: Prof. Dr. J. Mnich 28. Januar 2003 Inhalt I. Theorie der schwachen Wechselwirkung - Fermis Strom-Strom-Theorie
Neue Horizonte in der Teilchenphysik - Vom Higgs-Teilchen zur Dunklen Materie im Universum -
 Neue Horizonte in der Teilchenphysik - Vom Higgs-Teilchen zur Dunklen Materie im Universum - Prof. Dr. Karl Jakobs Physikalisches Institut Universität Freiburg Zielsetzung der Physik Einheitliche und umfassende
Neue Horizonte in der Teilchenphysik - Vom Higgs-Teilchen zur Dunklen Materie im Universum - Prof. Dr. Karl Jakobs Physikalisches Institut Universität Freiburg Zielsetzung der Physik Einheitliche und umfassende
Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Kosmologie
 Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Kosmologie Das frühe Universum: Inflation und Strahlungsdominanz Thorsten Beck Universität Stuttgart Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Kosmologie p. 1/14 Die
Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Kosmologie Das frühe Universum: Inflation und Strahlungsdominanz Thorsten Beck Universität Stuttgart Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Kosmologie p. 1/14 Die
Teilchenphysik. Was wir heute wissen. Philipp Lindenau Dresden Herzlich willkommen!
 Teilchenphysik Was wir heute wissen Philipp Lindenau Dresden 14.03.2016 Herzlich willkommen! Teil 1: Einführung Warum Teilchenphysik? Warum Teilchenphysik? Interesse und Neugier! Erkenntnisgewinn über
Teilchenphysik Was wir heute wissen Philipp Lindenau Dresden 14.03.2016 Herzlich willkommen! Teil 1: Einführung Warum Teilchenphysik? Warum Teilchenphysik? Interesse und Neugier! Erkenntnisgewinn über
Wechselwirkung von Neutrinos und Kopplung an W und Z
 Wechselwirkung von Neutrinos und Kopplung an W und Z Bosonen Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 16. Mai 2007 Agenda der Neutrinos 1 der Neutrinos 2 Erhaltungsgrößen
Wechselwirkung von Neutrinos und Kopplung an W und Z Bosonen Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 16. Mai 2007 Agenda der Neutrinos 1 der Neutrinos 2 Erhaltungsgrößen
Moderne Physik: Elementarteilchenphysik, Astroteilchenphysik, Kosmologie
 Moderne Physik: Elementarteilchenphysik, Astroteilchenphysik, Kosmologie Ulrich Husemann Humboldt-Universität zu Berlin Sommersemester 2008 Klausur Zeit: Donnerstag, 24.07.08, 9:00 11:00 (s.t.) Ort: dieser
Moderne Physik: Elementarteilchenphysik, Astroteilchenphysik, Kosmologie Ulrich Husemann Humboldt-Universität zu Berlin Sommersemester 2008 Klausur Zeit: Donnerstag, 24.07.08, 9:00 11:00 (s.t.) Ort: dieser
10 Schwache Wechselwirkung und Elektroschwache Vereinigung
 10 Schwache Wechselwirkung und Elektroschwache Vereinigung Seite 1 10.1 Grundlagen/Überblick Schwache Wechselwirkung ist eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen Schwache Wechselwirkung koppelt an
10 Schwache Wechselwirkung und Elektroschwache Vereinigung Seite 1 10.1 Grundlagen/Überblick Schwache Wechselwirkung ist eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen Schwache Wechselwirkung koppelt an
verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält
 Elementarteilchenphysik II RWTH WS 2007/08 Thomas Hebbeker Markus Merschmeyer, Arnd Meyer verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält... und die Evolution des Universums Wiederholung Grundlagen Elementarteilchenphysik
Elementarteilchenphysik II RWTH WS 2007/08 Thomas Hebbeker Markus Merschmeyer, Arnd Meyer verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält... und die Evolution des Universums Wiederholung Grundlagen Elementarteilchenphysik
Expedition ins Innerste der Materie und zum Anfang des Universums
 Expedition ins Innerste der Materie und zum Anfang des Universums DPG FRÜHJAHRSTAGUNG TEILCHENPHYSIK MÜNCHEN, MÄRZ 2009 WOLFGANG HOLLIK, MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PHYSIK, MÜNCHEN p.1 p.2 Die Welt im Großen
Expedition ins Innerste der Materie und zum Anfang des Universums DPG FRÜHJAHRSTAGUNG TEILCHENPHYSIK MÜNCHEN, MÄRZ 2009 WOLFGANG HOLLIK, MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PHYSIK, MÜNCHEN p.1 p.2 Die Welt im Großen
Symmetrien und Erhaltungssätze
 Symmetrien und Erhaltungssätze Noether Theorem (1918): Symmetrien Erhaltungsgröße Transformation Erhaltungsgröße Kontinuierliche Transformationen: Raum Translation Zeit Translation Rotation Eichtransformation
Symmetrien und Erhaltungssätze Noether Theorem (1918): Symmetrien Erhaltungsgröße Transformation Erhaltungsgröße Kontinuierliche Transformationen: Raum Translation Zeit Translation Rotation Eichtransformation
Teilchen, Strings und dunkle Materie
 Teilchen, Strings und dunkle Materie Die offenen Fragen der Elementarteilchenphysik Hartmut Wittig Institut für Kernphysik und Exzellenzcluster PRISMA Johannes Gutenberg-Universität Mainz Nell-Breuning-Symposium,
Teilchen, Strings und dunkle Materie Die offenen Fragen der Elementarteilchenphysik Hartmut Wittig Institut für Kernphysik und Exzellenzcluster PRISMA Johannes Gutenberg-Universität Mainz Nell-Breuning-Symposium,
Sprengt der Urknall den Schöpfungsglauben?
 Sprengt der Urknall den Schöpfungsglauben? Bestandteile der Materie Erzeugung von Elementarteilchen Beschleunigung von Elementarteilchen Nachweis von Elementarteilchen Antimaterie Erzeugung von Antimaterie
Sprengt der Urknall den Schöpfungsglauben? Bestandteile der Materie Erzeugung von Elementarteilchen Beschleunigung von Elementarteilchen Nachweis von Elementarteilchen Antimaterie Erzeugung von Antimaterie
Ein neues Teilchen am LHC Ist es ein Higgs-Boson?
 Ein neues Teilchen am LHC Ist es ein Higgs-Boson? Klaus Desch Physikalisches Institut der Universität Bonn Kontaktstudium 7. November 2012 1. Kontext: elementare Bausteine und Kräfte 2. Symmetrie als Konstruktionsprinzip
Ein neues Teilchen am LHC Ist es ein Higgs-Boson? Klaus Desch Physikalisches Institut der Universität Bonn Kontaktstudium 7. November 2012 1. Kontext: elementare Bausteine und Kräfte 2. Symmetrie als Konstruktionsprinzip
Virialsatz. Fritz Zwicky. Vera Rubin. v 2 = GM r. Carsten Hensel Suche nach Dunkler Materie am LHC 1
 Fritz Zwicky Virialsatz Vera Rubin v 2 = GM r v 1 r Carsten Hensel Suche nach Dunkler Materie am LHC 1 Suche nach Dunkler Materie am LHC Dr. Carsten Hensel Physikalisches Institut, Friedrich-Alexander
Fritz Zwicky Virialsatz Vera Rubin v 2 = GM r v 1 r Carsten Hensel Suche nach Dunkler Materie am LHC 1 Suche nach Dunkler Materie am LHC Dr. Carsten Hensel Physikalisches Institut, Friedrich-Alexander
Symmetriebrechung und Goldstone-Theorem
 Symmetriebrechung und Goldstone-Theorem Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Ingo Burmeister 0. Juli 008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 1.1 Symmetrie........................................
Symmetriebrechung und Goldstone-Theorem Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Ingo Burmeister 0. Juli 008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 1.1 Symmetrie........................................
Elementarteilchenphysik I RWTH SS 2007
 Elementarteilchenphysik I RWTH SS 2007 Thomas Hebbeker verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält... und die Evolution des Universums Übersicht: Teilchen und Wechselwirkungen Methoden: Beschleuniger
Elementarteilchenphysik I RWTH SS 2007 Thomas Hebbeker verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält... und die Evolution des Universums Übersicht: Teilchen und Wechselwirkungen Methoden: Beschleuniger
Hinweise auf dunkle Materie
 Seminar zum F-Praktikum: Kern- und Teilchenphysik Hinweise auf dunkle Materie Victor Bergmann (victor_bergmann@gmx.de) Betreuer: Prof. Dr. Volker Büscher 07.02.2011 1 Seite: 2 1 Hinweise 1.1 Rotationskurven
Seminar zum F-Praktikum: Kern- und Teilchenphysik Hinweise auf dunkle Materie Victor Bergmann (victor_bergmann@gmx.de) Betreuer: Prof. Dr. Volker Büscher 07.02.2011 1 Seite: 2 1 Hinweise 1.1 Rotationskurven
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik
 Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2002/2003 Struktur
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2002/2003 Struktur
1.3 Historischer Kurzüberblick
 1.3 Historischer Kurzüberblick (zur Motivation des Standard-Modells; unvollständig) Frühphase: 1897,,Entdeckung des Elektrons (J.J. Thomson) 1905 Photon als Teilchen (Einstein) 1911 Entdeckung des Atomkerns
1.3 Historischer Kurzüberblick (zur Motivation des Standard-Modells; unvollständig) Frühphase: 1897,,Entdeckung des Elektrons (J.J. Thomson) 1905 Photon als Teilchen (Einstein) 1911 Entdeckung des Atomkerns
A. Straessner FSP 101 ATLAS. Lange Nacht der Wissenschaften 5. Juli 2013
 Das Higgs-Teilchen und der Ursprung der Masse Teilchenphysik am Large Hadron Collider A. Straessner Lange Nacht der Wissenschaften 5. Juli 2013 FSP 101 ATLAS Das Higgs-Boson 2 Das Higgs-Boson (genauer
Das Higgs-Teilchen und der Ursprung der Masse Teilchenphysik am Large Hadron Collider A. Straessner Lange Nacht der Wissenschaften 5. Juli 2013 FSP 101 ATLAS Das Higgs-Boson 2 Das Higgs-Boson (genauer
Standardmodell der Teilchenphysik
 Standardmodell der Teilchenphysik Eine Übersicht Bjoern Walk bwalk@students.uni-mainz.de 30. Oktober 2006 / Seminar des fortgeschrittenen Praktikums Gliederung Grundlagen Teilchen Früh entdeckte Teilchen
Standardmodell der Teilchenphysik Eine Übersicht Bjoern Walk bwalk@students.uni-mainz.de 30. Oktober 2006 / Seminar des fortgeschrittenen Praktikums Gliederung Grundlagen Teilchen Früh entdeckte Teilchen
String Theory for Pedestrians (Stringtheorie für Fußgänger)
 String Theory for Pedestrians (Stringtheorie für Fußgänger) Johanna Knapp Institut für Theoretische Physik, TU Wien Resselpark, 17. Mai 2016 Inhalt Fundamentale Naturkräfte Was ist Stringtheorie? Moderne
String Theory for Pedestrians (Stringtheorie für Fußgänger) Johanna Knapp Institut für Theoretische Physik, TU Wien Resselpark, 17. Mai 2016 Inhalt Fundamentale Naturkräfte Was ist Stringtheorie? Moderne
Tag der offenen Tür 16. Oktober 2007
 Experimentelle Teilchenphysik RWTH Aachen Tag der offenen Tür 16. Oktober 2007 Thomas Hebbeker Teilchenphysik = Elementarteilchenphysik +Astroteilchenphysik Institute und Ansprechpartner Forschungsprojekte
Experimentelle Teilchenphysik RWTH Aachen Tag der offenen Tür 16. Oktober 2007 Thomas Hebbeker Teilchenphysik = Elementarteilchenphysik +Astroteilchenphysik Institute und Ansprechpartner Forschungsprojekte
Kerne und Teilchen. Symmetrien. Moderne Experimentalphysik III Vorlesung MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK
 Kerne und Teilchen Moderne Exerimentalhysik III Vorlesung 11 MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK Symmetrien KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Kerne und Teilchen Moderne Exerimentalhysik III Vorlesung 11 MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK Symmetrien KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Experimente zur Physik jenseits des Standard-Modells
 Experimente zur Physik jenseits des Standard-Modells Peter Schleper Institut für Experimentalphysik Universität Hamburg Sommer 2014 P. Schleper Physik jenseits des Standard- Modells 1 Gliederung P. Schleper
Experimente zur Physik jenseits des Standard-Modells Peter Schleper Institut für Experimentalphysik Universität Hamburg Sommer 2014 P. Schleper Physik jenseits des Standard- Modells 1 Gliederung P. Schleper
1.6 Aufbau der Hadronen. In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet.
 1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. 1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. Beobachtbare stark wechselwirkende
1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. 1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. Beobachtbare stark wechselwirkende
Struktur der Materie für Lehramt
 Struktur der Einführung: Kern und Teilchenphysik Michael Martins, Georg Steinbrück Universität Hamburg Sommer-Semester 1 Inhalt Teilchen, Quantenzahlen und Wechselwirkungen Physik jenseits des Standardmodells
Struktur der Einführung: Kern und Teilchenphysik Michael Martins, Georg Steinbrück Universität Hamburg Sommer-Semester 1 Inhalt Teilchen, Quantenzahlen und Wechselwirkungen Physik jenseits des Standardmodells
Die Entdeckung der W- und ZBosonen am CERN
 Die Entdeckung der W- und ZBosonen am CERN Das erste Z0-Boson Übersicht: Historische Bemerkungen und Theorie der schwachen Wechselwirkung SPS Der pp-beschleuniger des CERN Die Detektoren: UA1 und UA2 Suche
Die Entdeckung der W- und ZBosonen am CERN Das erste Z0-Boson Übersicht: Historische Bemerkungen und Theorie der schwachen Wechselwirkung SPS Der pp-beschleuniger des CERN Die Detektoren: UA1 und UA2 Suche
