Bestandsmanagement im Virtuellen Lager
|
|
|
- Matthias Gerhardt
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Technical Report ISSN Bestandsmanagement im Virtuellen Lager Dietmar Ebel Sonderforschungsbereich 559 Modellierung großer Netze in der Logistik Universität Dortmund Dortmund
2 Technical Report ISSN Bestandsmanagement im Virtuellen Lager Teilprojekt T01: Dietmar Ebel Technische Universität Dortmund Dortmund Dortmund, 16. Juni 2008
3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis I. Abbildungsverzeichnis Einleitung Bestandsmanagement Geschäftsmodell Anwendungsszenario Bewertung von Aktivitäten und Prozessen Geschäftsmodell des virtuellen Lagers Ziele eines Geschäftsmodells Abgrenzung des Virtuellen Lagers zu vorhandenen Konzepten Ebenen des Geschäftsmodels Dimensionen des Geschäftsmodells Erläuterungen zu den Dimensionen Ableitung eines Anwendungsszenarios Phase 1: Vermittlung freier Ressourcen Phase 2: Vertragsabschluss und Einlagerung Phase 3: Auslagerung und Warenausgang Phase 4: Abrechnung der erbrachten Leistungen Bewertung von Aktivitäten im Virtuellen Lager Transaktionskostenorientierter Ansatz Transaktionen und Transaktionskostenarten Merkmale von Transaktionen Analyse der Transaktionskosten für das Virtuelle Lager Prozesskostenorientierter Ansatz Analyse und Bestimmung der Prozesse und Prozessgrößen Prozesskostenkalkulation Einsatz der Prozesskostenrechnung im Virtuellen Lager Schlussbetrachtung Literaturverzeichnis Seite 2
4 Abbildungsverzeichnis I. Abbildungsverzeichnis Seite 2-1: Konfliktbereiche im Bestandsmanagement (in Anlehnung an [Hart99], S.32) : Strukturmodell zur Ableitung eines Geschäftsmodells : Allokation von Ressourcen im Virtuellen Lager : Vergleich von Geschäftsmodeldimensionen : Phase 1: Vermittlung freier Ressourcen : Phase 2: Vertragsabschluss und Einlagerung : Phase 3: Auslagerung und Warenausgang : Phase 4: Abrechnung der erbrachten Leistungen : Klassifizierung von Prozessen (in Anlehnung an: [Str88], S.62) Seite 3
5 Technical Report Einleitung Das primäre Ziel des Bestandsmanagements im Virtuellen Lager ist eine verbesserte Nutzung der vorhandenen Lagerkapazitäten innerhalb eines frei zugänglichen Logistiknetzwerks. Im Sinne einer virtuellen Organisationsform handelt es sich dabei um einen Lagerverbund verschiedener, rechtlich unabhängiger Lagerbetreiber, die Lagerflächen temporär zur Verfügung stellen. Die kooperierenden Einheiten beteiligen sich an der horizontalen und/oder vertikalen Zusammenarbeit vorrangig mit ihren Kernkompetenzen und wirken bei der Leistungserstellung gegenüber Dritten als ein einheitliches Unternehmen. Dabei wird auf die Institutionalisierung zentraler Funktionen weitgehend verzichtet und der notwendige Kommunikationsund Abstimmungsbedarf durch geeignete Informations- und Kommunikationssysteme realisiert. Die Planung und Steuerung der logistischen Abläufe zwischen den Kooperationspartnern, die sich dem Virtuellen Lager anschließen, erfordert einen Ordnungsrahmen, in dem die Regeln der Zusammenarbeit definiert werden. Dies umfasst eine effektive und effiziente Zuordnung der angebotenen und nachgefragten Kapazitäten unter Berücksichtigung logistischer und finanzieller Rahmenbedingungen. 2 Bestandsmanagement Bestände erfüllen unterschiedliche Funktionen. Auf der einen Seite ermöglichen Lagerbestände auf Grund ihrer Pufferfunktion das Auffangen von Produktion- und Absatzschwankungen. Bestände erhöhen die Sicherheit bei Störungen im Beschaffungs-und Produktionsprozess und ermöglichen bei entsprechender Disposition eine gleichmäßige Auslastung der Fertigungskapazitäten. Auf der anderen Seite bergen überhöhte Bestände auch Risiken. Insbesondere die hohe Kapitalbindung und die ineffiziente Nutzung von Lagerressourcen stellen negative Konsequenzen einer zu hohen Bestandsführung im Lager dar. 2-1: Konfliktbereiche im Bestandsmanagement (in Anlehnung an [Hart99], S.32) Seite 4
6 Technical Report Der Ordnungsrahmen für das Bestandsmanagement im Virtuellen Lager wird im vorliegenden Technical Report anhand der vorliegenden Eckpunkte vorgestellt: Geschäftsmodell des virtuellen Lagers Ableitung eines Anwendungsszenarios Ansatz zur Bewertung von Aktivitäten im Virtuellen Lager Geschäftsmodell Zur formalen Festlegung der geschäftlichen Rahmenbedingungen des Virtuellen Lagers ist ein Geschäftsmodell erforderlich, das die spezifische Aufgabenstellung des Virtuellen Lagers berücksichtigt. Im Bereich der New-Economy gibt es bereits zahlreiche internetbasierte Geschäftsmodelle. Die Dimensionen dieser Geschäftsmodelle werden im Rahmen des vorliegenden Technical Reports zunächst verglichen. Anschließend wird überprüft, ob auf Grund der spezifischen Aufgabenstellung des Virtuellen Lagers eine Erweiterung der Dimensionen erforderlich ist. Die Modellierung eines Virtuellen Lagers wird vor dem Hintergrund einer Referenzbranche vorgenommen, der Ersatzteillogistik im Automotive-Sektor. Sämtliche inner- und zwischenbetrieblichen Prozesse für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage im Virtuellen Lager basieren auf dieser Referenzbranche Anwendungsszenario Zur Unterstützung der operative Planung und Steuerung des Informations- und Materialflusses zwischen den kooperierenden Partnern im Virtuellen Lager im Rahmen der Disposition wird ein Anwendungsszenario zur Kunden- und Materialdisposition definiert. Dieses umfasst zum einen die Prüfung und Bearbeitung der eingehenden Anfragen und Angebote, zum anderen das Bestandsmanagement, um frühzeitig Informationen über potenzielle Engpässe und die Einleitung von Gegenmaßnahmen zu erreichen. Die Disposition beruht auf Standprozessen, die in einer Prozessworkbench hinterlegt sind [Figg08]. Die Funktion des Virtuellen Lagers als Vermittlungsinstanz von Angebot und Nachfrage logistischer Prozesse und Leistungen wird durch das Logistikinformationssystem unterstützt. Die Abwicklung der Prozesse für das Bestandsmanagement basieren auf autonomen Softwareagenten, die Informationen über Spezifikationen, Prozessschritte und zeitliche Verfügbarkeit bereitstellen [Zel08]. Für den Anwendungsfall Ersatzteillogistik im Automotive-Sektor wurden Anforderungen an die Lagerhaltung und die Disposition im Virtuellen Lager definiert [Haa07]. Jedes Gut stellt entsprechend seiner Eigenschaften unterschiedliche Anforderungen an die Lagerhaltung. Dispositionsstrategien im Virtuellen Lager müssen neben der Lagerhaltung auch den zeitnahen Abgleich von Angebot und Nachfrage berücksichtigen. Für diesen Abgleich werden neben den technischen Voraussetzungen auch Anwendungsszenarien definiert, nach denen Abfragen über das agentenbasierten Logistikinformationssystem in Zusammenarbeit mit der Prozessworkbench ermöglicht werden. Seite 5
7 Technical Report Im Rahmen der Anwendungsszenarien sind einerseits die Prozessschritte zu formulieren, die für den Anwender des Logistikinformationssystem sichtbar sind. Andererseits sollen die Prozessschritte abgebildet werden, die im Hintergrund durch das Logistikinformationssystem abgewickelt werden. Neben dem Logistikinformationssystem werden hierbei insbesondere der Einsatz und die möglichst echtzeitnahe Anbindung von Warehouse-Management-Systemen (WMS) vorausgesetzt. Die Warehouse-Management-Systeme der beteiligten Kooperationspartner im Virtuellen Lager stellen einen grundlegenden Datenspeicher für Bestandsinformationen innerhalb des Netzwerks dar Bewertung von Aktivitäten und Prozessen Die Abwicklung von Prozessen im Virtuellen Lager unterliegt betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zunächst müssen für potenzielle Teilnehmer des Virtuellen Lagers Entscheidungskriterien definiert werden, die eine Aussage erlauben, ob es aus ihrer Sicht sinnvoll ist ihre logistischen Prozesse über das Virtuelle Lager abzuwickeln. Für den potenziellen Teilnehmer handelt es sich um eine Make-or-buy-Entscheidung. Nachdem sich ein Interessent für das Virtuelle Lager angemeldet und Leistungen in Anspruch nimmt, müssen diese über ein prozesskostenorientiertes Kalkulationsschema abgebildet werden, um eine abschließende Fakturierung zu ermöglichen. Die Leistungen, die in Anspruch genommen werden können, entsprechen den standardisierten Prozessen, die in der Prozessworkbench hinterlegt sind. Seite 6
8 Technical Report Geschäftsmodell des virtuellen Lagers 3.1 Ziele eines Geschäftsmodells Ein Geschäftsmodell basiert auf Prozessen, die mit einer langfristigen Geschäftsstrategie in Verbindung stehen. Es dient also als Instrument der strategischen Planung und zur Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren, Investoren, Mitarbeitern und Kunden. Zur Ableitung eines Geschäftsmodells für das Virtuelle Lager werden zunächst existierende Geschäftsmodelle hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit verglichen und anschließend um aufgabenspezifische Kriterien ergänzt. Ein Geschäftsmodell dient zur Definition der nachfolgenden Unternehmensziele: Nutzen Leistungsbeschreibung zur Nutzengenerierung Ertragsmodell Beschreibung des materiellen/finanziellen Nutzens aus der Kooperation für Kunden und andere Partner. Die Architektur der Wertschöpfung beschreibt, wie der Nutzen des Kunden generiert wird. Die Architektur beinhaltet die verschiedenen Stufen der Wertschöpfung und der verschiedenen wirtschaftlichen Agenten und deren Rolle in der Wertschöpfung. Die Architektur gibt Aufschluss über die Leistungen, deren Konfiguration und die Marktsegmente, auf denen die jeweiligen Leistungen angeboten werden Beschreibung, aus welchen Quellen ein Unternehmen seine Einnahmen schöpft. Damit ist eine Aussage über die Nachhaltigkeit des Unternehmens möglich. Seite 7
9 Technical Report Die Vorgehensweise für die Ableitung eines Geschäftsmodels für das Virtuelle Lager wird anhand des nachfolgenden Strukturmodells veranschaulicht (vgl. Abbildung 3.1 Strukturmodell des Virtuellen Lagers ). 3-1: Strukturmodell zur Ableitung eines Geschäftsmodells 3.2 Abgrenzung des Virtuellen Lagers zu vorhandenen Konzepten Im Internet finden sich bereits Plattformen für den Austausch von Lager- oder Transportkapazitäten [ZEb06]. Die vorhandenen Geschäftsmodelle unterscheiden sich aber in ihrer Ausprägung vom Virtuellen Lager. Abgrenzung zu Güterverkehrszentren (GVZ): Das Virtuelle Lager nutzt im Gegensatz zum GVZ die vorhandene logistische Infrastruktur (Lagerkapazitäten) seiner Teilnehmer. Dies hat den Vorteil, dass keine neue physische Infrastruktur geplant und errichtet werden muss. Dadurch bleiben sowohl die Anzahl der Kooperationspartner als auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen dynamisch und die Flexibilität kann im Vergleich zum GVZ erhöht werden. Die Kooperation der GVZ-Partner ist eher strategischer Natur. Das Virtuelle Lager hingegeben zielt auf eine flexible und kurzfristige Vermittlung von freien Ressourcen ab. Abgrenzung zu Lager- und Transportbörsen: Im Internet existieren zahlreiche Angebote, bei denen es um die Vermittlung freier Lager- oder Transportkapazitäten geht. Hierbei wird das Internet als»schwarzes Brett«genutzt, um Informationen über Angebot und Nachfrage abzulegen. Seite 8
10 Technical Report Eine funktionale Unterstützung, wie sie mit dem Logistikinformationssystem des Virtuellen Lagers ermöglicht wird, ist bei diesen Konzepten nicht vorgesehen. Das Logistikinformationssystem stellt den Teilnehmern des Virtuellen Lagers unternehmensübergreifend echtzeitnahe Informationen über die Ressourcen (Lagerkapazitäten, Bestände) im Virtuellen Lager zur Verfügung. 3.3 Ebenen des Geschäftsmodels Das Virtuelle Lager stellt folgendes Leistungsspektrum zur Verfügung: Internetbasiertes Portal zur Anfrage- und Auftragsabwicklung Allokation von Ressourcen mit Hilfe des Logistikinformationssystems LIS, das auf Kapazitäts- und Bestandsinformationen aus den Standorten zurückgreift Prozessstandardisierung der Logistikprozesse für den Bereich Ersatzteillogistik im Automotive-Sektor Die Allokation von Ressourcen im Virtuellen Lager erfolgt über drei Ebenen. Auf der obersten Ebene erfolgen Anmeldung, Vermittlung logistischer Leistungen, Dokumentation der erbrachten logistischen Leistungen und die Abrechnung. Die oberste Ebene ist mit Hilfe einer browserbasierten Anwendung über das Internet zu realisieren. Die Allokation der Ressourcen erfolgt auf der mittleren Ebene über das Logistikinformationssystem, das wiederum auf Informationen aus den Lagerverwaltungs (WMS) - und Tourenplanungssystemen (TMS) auf der untersten Ebene zurückgreifen kann. 3-2: Allokation von Ressourcen im Virtuellen Lager Seite 9
11 Technical Report Dimensionen des Geschäftsmodells Die Beschreibung von Geschäftsmodellen setzt die Definition von Dimensionen zur Beschreibung ihrer Charakteristika voraus. Aus der New-Economy wurden zahlreiche internetbasierte Geschäftsmodelle entwickelt. Die Dimensionen zur Beschreibung dieser Geschäftsmodelle sind nachfolgender Abbildung zu entnehmen (in Anlehnung an [SDL03]). 3-3: Vergleich von Geschäftsmodeldimensionen Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Dimensionen zunächst mit ihren allgemeinen Aussagen aufgeführt. Daneben werden die Dimensionen hinsichtlich Ihrer Relevanz für das Virtuelle Lager überprüft und ausformuliert. Seite 10
12 Technical Report Erläuterungen zu den Dimensionen Dimensionen Allgemein Geschäftsmodell»Virtuelles Lager«Akteure Unter Akteure werden alle Beteiligten eines sozioökonomischen Systems verstanden. Darunter fallen zum einen das Unternehmen selbst, aber auch seine Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Geschäftspartner. Ebenso werden die Aktivitäten der einzelnen Akteure näher beschrieben. Akteure eines Virtuellen Lagers sind Anbieter von Lager- und Transportkapazitäten, Nachfrager dieser Kapazitäten und das Virtuelle Lager als Intermediär selbst, über das die Angebote und Nachfragen verwaltet, passende angebotene und nachgefragte Kapazitäten zusammengestellt und die Ergebnisse an die Anbieter und Nachfrager weitergeleitet werden. Güter/ Dienstleistungen Unter Güter/Dienstleistungen fallen alle Produkte inklusive Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet. Für die Produkte werden die Produktlebenszyklen mit ihren Phasen der Erstellung, der Vermarktung und der Auslieferung sowie verschiedene Produkt-Markt- Kombinationen erläutert. Es werden alle Flüsse entlang der Lieferkette und die benötigten Hilfsmittel, die für einen problemlosen Materialfluss erforderlich sind, genauer erläutert. Güter bietet das Virtuelle Lager im eigentlichen Sinne nicht an. Als Dienstleistung werden die Vermittlung logistischer Ressourcen über das Internet und das Bestandsmanagement auf Grundlage echtzeitnaher Lagerinformationen angeboten. Ein großer Vorteil eines Virtuellen Lagers liegt darin, dass sich Unternehmen je nach Kapazitätsbedarf/-angebot an- und wieder abmelden können. Seite 11
13 Technical Report Dimensionen Allgemein Geschäftsmodell»Virtuelles Lager«Informationsfluss, I&K Systeme Kritische Erfolgsfaktoren "Informationen" sind alle Informationsflüsse, die von einem Akteur entsandt werden und von einem anderen empfangen werden. Es wird zwischen internen Flüssen innerhalb eines Unternehmens und externen Flüssen zwischen dem Unternehmen und den außenstehenden Akteuren unterschieden. Der Informationsfluss muss durch entsprechende technische Hilfsmittel für die korrekte Datenübermittlung unterstützt werden. Die kritischen Erfolgsfaktoren dienen als Unterstützung einer Chancen- und Risikoanalyse. Da sie sehr stark von der Unternehmenssituation abhängig sind, können sie nur für den jeweiligen Anwendungsfall genauer erläutert werden. Um die Prozesse im Virtuellen Lager beherrschen zu können, müssen die eingesetzten I & K-System sehr vielseitig, sicher und schnell sein. Das Kernstück der I&K-Systeme, das Logistikinformationssystem LIS, wird auf Basis von ASP zur Verfügung gestellt. Die Verfahren basieren auf autonomen, mobilen Softwareagenten, die Informationen über Spezifikationen, Prozesskomponenten und zeitliche Verfügbarkeit auf der Anbieterseite bereitstellen. Die Abwicklung der Geschäftsprozesse erfolgt elektronisch über das Internet und kann mit Unterstützung von RFID durchgeführt werden. Die dezentrale Materialflusssteuerung wird durch verteilte IT-Systeme verwaltet und bearbeitet. Dafür sind spezielle Methoden und algorithmenbasierte Instrumente erforderlich, die das verteilte Systemverhalten unterstützen. Wichtige Aspekte, die im LIS sichergestellt sein müssen, sind vor allem Integritätssicherung und Nachweis der Echtzeitfähigkeit. Ein Virtuelles Lager kann nur bei einer gut funktionierenden, unternehmensübergreifenden Kooperation bestehen. Dafür sind standardisierte Prozesse zwischen allen beteiligten Subsystemen Grundvoraussetzung und die Einhaltung dieser Prozesse unerlässlich. Seite 12
14 Technical Report Dimensionen Allgemein Geschäftsmodell»Virtuelles Lager«Nutzen Als Nutzen werden alle Vorteile definiert, die die Akteure aus der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen erzielen können (Motivation für die Kooperation). Nutzen für Anbieter: Die Anbieter erreichen eine bessere Auslastung der eigenen Lager- und Transportkapazitäten, besonders in einlagerungsschwachen Perioden (z. B. bei Produktionsreduzierung). Organisations -form Mit der Wahl der Organisationsform eines Unternehmens werden die Rahmenbedingungen für den Geschäftsbetrieb grundlegend bestimmt. Nutzen für Nachfrager: Die Reaktionszeit für die Beseitigung der Engpasssituation im eigenen Lager ist sehr kurz ist. Außerdem erfolgt das Anmieten der Lagerplätze flexibel und ist meist auf eine kurze Periode beschränkt. Fixkosten entfallen. Das Virtuelle Lager stellt eine virtuelle Organisationsform dar. Eine virtuelle Organisation kennzeichnet sich dadurch, dass Unternehmen temporär kooperieren um eine Leistung auf Grund eines gemeinsamen Geschäftsverständnisses zu erbringen. Rechtlich eigenständige Unternehmen schließen sich zu symbiotischen Netzwerken zusammen und treten gegenüber Dritten als einheitliches Unternehmen auf. Die Organisationsform lässt sich als offenes System beschreiben, da die Flexibilität hinsichtlich anzuschließender Partner und der zu handhabender Güter sehr hoch ist. Das Virtuelle Lager besteht aus vielen verschiedenen Geschäftsprozessen, die untereinander verflochten sind. Diese Prozesse bestehen wiederum aus einem Netzwerk funktionsübergreifender Aktivitäten, innerhalb derer Inputs und Outputs transformiert und dabei Ressourcen verbraucht werden. Seite 13
15 Technical Report Dimensionen Allgemein Geschäftsmodell»Virtuelles Lager«Prozesse Prozesse stellen alle Geschäftsaktivitäten und ihre Informationssysteme dar. Sie sind in verschiedene Phasen der Handelstransaktionen unterteilt und ermöglichen eine detaillierte, ablauforientierte Sicht auf die Reihenfolge aller Leistungen und Gegenleistungen. Allgemein werden für die Prozesse im Virtuellen Lager standardisierte Logistikprozesse für die Lagerhaltung zu Grunde gelegt, die in einer Prozessworkbench hinterlegt sind. Ein Anwendungsszenario ist Kapitel 4 zu entnehmen. Strategie/ Vision/Ziel Die übergeordneten strategischen Unternehmensziele bestimmen das Verhalten, die Kommunikation und das Erscheinungsbild eines Unternehms. Aus der Vision leiten sich Ziele und Strategien für ein Unternehmen ab. Die Vision des Virtuellen Lagers ist die Beherrschung der Komplexität in logistischen Systemen und die optimale Nutzung unternehmensbezogener, logistischer Ressourcen. Ziele des Virtuellen Lagers sind eine verbesserte Nutzung vorhandener Lager- und Transportkapazitäten und die Möglichkeit zur Überwindung von Standortgrenzen durch Telekooperation über das Internet. Damit einher gehen eine Erhöhung der Lieferqualität und eine Kostensenkung im Lager-, Transportund Administrationsbereich. Seite 14
16 Technical Report Ableitung eines Anwendungsszenarios Im Rahmen der Anwendungsszenarien werden Attribute für Angebots- und Nachfrageseite formuliert, die mit Unterstützung des Logistikinformationssystem unter Berücksichtigung iterativer Prüfmechanismen abgeglichen werden. Das Ziel dieses Überprüfungslaufs ist die Darstellung des Ergebnisraums, in dem sich Angebot und Nachfrage von Lagerkapazitäten im Virtuellen Lager ausgleichen lassen. Das Anwendungsszenario gliedert sich in vier Phasen: Phase 1: Vermittlung freier Ressourcen Phase 2: Vertragsabschluss und Einlagerung Phase 3: Auslagerung und Warenausgang Phase 4: Abrechnung der erbrachten Leistungen Die vier Phasen werden nachfolgend grafisch dargestellt. 4.1 Phase 1: Vermittlung freier Ressourcen Begleitender Zusatzinformation Prozessergebnis LIS Materialfluss Prozess-Workbench Vorauseilender Informationsfluss Informationsfluss Login/Registrierung des Anbieters bzw. Nachfragers Neue Oberfläche öffnen Daten eintragen Abfrage starten Aufrufen der Standardprozesse Abfrage, ob Prozesse 1 bis n vorhanden sind Daten absenden Log Out Matching zw. Anbietern und Nachfragern Überprüfung Speicherung der Bestätigung Eingaben Daten senden Abfrage Angebot ablehnen Ende Bestätigungsschreiben Abfrage nach Restriktionen (Ausschusskriterien)/ Prioritäten der eingegebenen Attribute Angebote auflisten Keine Übereinstimmung Angebote filtern Absage senden Sortierkriterien wie: Entfernung, Preis, Zeitraum, spezielle Lageranforderungen, etc. Kooperationsanfrage Abfrage Ende Anfrage Geschäftsvermittlung 1 Sonderforschungsbereich 559 Modellierung eines virtuellen Lagers 4-1: Phase 1: Vermittlung freier Ressourcen Seite 15
17 Technical Report Phase 2: Vertragsabschluss und Einlagerung Begleitender Zusatzinformation Prozessergebnis LIS Materialfluss Prozess-Workbench Vorauseilender Informationsfluss Informationsfluss 1 Kooperationsvertrag erstellen Ablehnungsschreiben erstellen Vertragsdokumente Ablehungsschreiben Vertrag versenden Angebot aus DB löschen Vertragsdokumente an Anbieter und Nachfrager Wenn Zeitraum verstrichen ist Ende Vertragsabschluss Auftragsfreigabe Transportauftrag erstellen Ware auslagern Zur Verladung bereitstellen Transportauftrag Begleitpapiere Ausbuchung im System Lieferscheine drucken Ware verladen Lieferschein Meldung über ankommende Lagerplatzzuordnung Lieferung ans VL durch LVS Transport zum VL Ware entladen Wareneingang Begleitpapiere Mengenabgleich, Sichtkontrolle, evtl. Qualitätsstichproben; bei Mängeln Meldung an Versender und Abklärung des weiteren Vorgehens 2 Sonderforschungsbereich 559 Modellierung eines virtuellen Lagers 4-2: Phase 2: Vertragsabschluss und Einlagerung Seite 16
18 Technical Report Phase 3: Auslagerung und Warenausgang Begleitender Zusatzinformation Prozessergebnis LIS Materialfluss Prozess-Workbench Vorauseilender Informationsfluss Informationsfluss Auftragseingang Freigabe zur Meldung an LIS: Transportpapiere Auslagerung Auslagerung Transport drucken abgeschlossen 2 Warenausgang Empfänger Ware einlagern Ware verladen Transport Transportbelege Begleitpapiere Auslagerungsauftrag Lieferscheine Mengenabgleich, Sichtkontrolle, evtl. Qualitätsstichproben; bei Mängeln Meldung an Versender und Abklärung des weiteren Vorgehens 3 Sonderforschungsbereich 559 Modellierung eines virtuellen Lagers 4-3: Phase 3: Auslagerung und Warenausgang Seite 17
19 Technical Report Phase 4: Abrechnung der erbrachten Leistungen Begleitender Zusatzinformation Prozessergebnis LIS Materialfluss Prozess-Workbench Vorauseilender Informationsfluss Informationsfluss 3 Rechnungslegung Rechnung Rechnung verschicken Zahlungseingang Ablage 1. Mahnung 2. Mahnung 3. Mahnung Zahlungseingangsbelege Kunde zahlt Reklamation Sonderforschungsbereich 559 Modellierung eines virtuellen Lagers 4-4: Phase 4: Abrechnung der erbrachten Leistungen Seite 18
20 Technical Report Bewertung von Aktivitäten im Virtuellen Lager Zur Bewertung der Aktivitäten und Prozesse im Virtuellen Lager werden zwei unterschiedlichen Ansätzen vorgestellt: Transaktionskostenorienter Ansatz Prozesskostenorientierter Ansatz 5.1 Transaktionskostenorientierter Ansatz Transaktionen und Transaktionskostenarten Coase [Coa37] definierte als erstes Transaktionskosten als Kosten der Nutzung des Marktes. Später beschrieb Dahlman [Dah79] sie als Such- und Informationskosten, Verhandlungs- und Entscheidungskosten, Überwachungs- und Durchsetzungskosten [Voi02]. Bei Transaktionskosten handelt es sich um Kosten, die bei Anbahnung und dem Abschluss von Verträgen sowie nach Vertragsabschluss (Überwachung, mögliche Sanktionen) entstehen. Während in den Modellen der traditionellen neoklassischen Wirtschaftstheorie davon ausgegangen wird, dass der Güteraustausch selbst kostenlos ist, finden die Transaktionskosten, die in der Praxis zum Teil erhebliche Dimensionen erreichen, in der Transaktionskostentheorie (auch Transaktionskostenökonomik) verstärkt Berücksichtigung. Mithilfe der Theorie der Transaktionskosten lassen sich alternative Formen der institutionellen Einbettung wirtschaftlicher Transaktionen und deren Effizienz untersuchen sowie unterschiedliche vertragliche Beziehungen und das Verhalten der Vertragspartner erklären [Mey08]. Transaktionskosten stellen somit "Marktbenutzungskosten" dar, die bei Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen über den Markt entstehen, da reale Austauschprozesse bei unvollkommener Information und auf unvollkommenen Märkten stattfinden. Im Zuge der Standardisierung und der umfassenden Nutzung des Internets verringern sich die Transaktionskosten und damit auch die Vorteile der betriebsinternen Leistungserbringung. Dies hat unter Anderem die Entstehung und Verbreitung neuer Kooperationsformen, insbesondere der virtuellen Organisationen, zur Folge [Ole08]. Seite 19
21 Technical Report Merkmale von Transaktionen Zu den Transaktionskostenarten, die für eine Entscheidungsfindung (Make-or-Buy) herangezogen werden, zählen [Ole08]: - Vertragsanbahnungskosten wie Such- und Informationskosten, - Vertragsgestaltungskosten, - Verhandlungs- und Entscheidungskosten, - Kosten der Vertragsüberwachung und Vertragsanpassung, - Kosten der Durchsetzung von Leistungsverpflichtungen, - Kosten bei Insolvenz des Vertragspartners Die Kosten einer Transaktion werden in der Transaktionskostentheorie durch drei Merkmale beeinflusst [Wil85]: 1. Faktorspezifität (asset specifity) Die Spezifität beschreibt den Grad der Anpassung von (Produktions-) Faktoren an unternehmensspezifische Gegebenheiten. Mit zunehmendem Spezialisierungsvorteil können komparative Kostenvorteile gewonnen werden, wodurch die Herstellungskosten gesenkt werden können. Die Transaktionskosten können aber im Gegensatz dazu durch transaktionsspezifische Investitionen steigen. Durch eine Erhöhung der Spezifität der Einsatzfaktoren wird ein Wechsel der Transaktionspartner zunehmend schwerer. Für Akteure steigt der Reiz die Abhängigkeit ex post auszunutzen und höhere Preise zu veranschlagen, woraus erneute Verhandlungen über Vertragskonditionen und somit höhere Transaktionskosten entstehen können. 2. Unsicherheit (uncertainty) Parametrische Unsicherheit: Ungewissheit über zukünftige Umweltzustände und ihre Wirkung auf die Transaktion Verhaltensunsicherheit: Ungewissheit über opportunistisches Verhalten der Akteure durch Informationsasymmetrien, d.h. unterschiedliche Wissensstände der Akteure. Beide Formen der Unsicherheit haben eine Erhöhung der ex ante- und ex post-transaktionskosten zur Folge. 3. Häufigkeit (frequency) Mit zunehmender Anzahl identischer Transaktionen besteht die Möglichkeit zur Realisierung von (Fix-) Kostendegressions-, Skalen- und Synergieeffekten. Bei Nutzung dieser Potenziale sinken die Transaktionskosten je Transaktion mit Zunahme identischer Transaktionen. Seite 20
22 Technical Report Analyse der Transaktionskosten für das Virtuelle Lager Die Entscheidung zur Teilnahme am Virtuellen Lager stellt für nachfragende Unternehmen eine Outsourcing-Entscheidung (Make-or-Buy) dar: Ein Nachfrager muss sich entscheiden, ob die Abwicklung bestimmter Prozesse und Nutzung von Lagerkapazitäten besser intern im eigenen Unternehmen durchgeführt werden kann, oder ob es extern am Markt eine günstigere Alternative, in diesem Fall das Virtuellen Lager, gibt. Eine Analyse der Transaktionskosten für das Virtuelle Lager basiert auf folgenden Annahmen (vgl. auch Kapitel 5.1.2): Faktorspezifität Die angebotenen Leistungen im Virtuellen Lager zeichnen sich durch eine geringe Spezifität aus. Die Lagerprozesse sind für die Branche Ersatzteillogistik im Automotive-Sektor standardisiert und in einer Prozessworkbench hinterlegt. Unsicherheit Die Unsicherheit der Akteure bezüglich der künftigen Umweltzustände ist gering. Die Akteure akzeptieren die standardisierten Prozesse und können den angebotenen Leistungsumfang im Virtuellen Lager richtig einschätzen. Häufigkeit Die Transaktionen (Lagerprozesse) im Virtuellen Lager finden häufig statt und sind auf Grund ihrer Standardisierung beliebig wiederholbar. Die angebotenen Leistungen des Virtuellen Lagers sind grundsätzlich jedem Akteur frei zugänglich. Die angebotenen Logistikleistungen, insbesondere die Abwicklung der Lagerprozesse über eine Prozessworkbench, ermöglichen ein hohes Maß an Transparenz und reduzieren die Unsicherheit der Akteure. Seite 21
23 Technical Report Unter diesen Annahmen lässt sich folgendes Schema zur Analyse der Transaktionskosten für einen Nachfrager von Leistungen im Virtuellen Lager aufstellen (in Anlehnung an [NieJ04]). Durchführung des Bestandsmanagements und der Prozesse im eigenen Haus (Make) Durchführung des Bestandsmanagements und der Prozesse über das virtuelle Lager (Buy) Faktorkosten 40 Tsd. 30 Tsd. Merkmale der Transaktionen: Entwicklung der Transaktionskosten: Entwicklung der Transaktionskosten: Häufigkeit Häufig Häufig Spezifität Unsicherheit Gering (Standardprozesse): Keine Nachverhandlungen notwendig. Die eigenen Prozesse sind dem Akteur bestens bekannt. Eine Anpassung der Prozesse ist unproblematisch. Kosten: der Information gering der Kontrolle und Überwachung gering weniger komplizierte Vertragsgestaltung geringe Gefahr der Qualitätsverschlechter ung, keine Gefahr der Preiserhöhung Gering (Standardprozesse): Nachverhandlungen sind nicht zu erwarten, weil alle Akteure mit gleichen Prozessen arbeiten und somit keine große Abhängigkeit zwischen den Akteuren besteht (Wechsel des Anbieters mit minimalen Aufwand möglich) Anbieter grundsätzlich unbekannt. Dauer der Kooperation ungewiss. Vertragskündigung ist aber kurzfristig möglich, bei Bedarfsschwankungen ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter problemlos möglich. Es gibt Alternativen innerhalb des Virtuellen Lagers. Kosten: für Informationen über den Anbieter sind nachrangig für Kontrolle und Überwachung gering, da alle Akteure auf Grundlage der gleichen standardisierten Prozesse arbeiten, also sehr gut vergleichbar sind einfache Vertragsgestaltung Gefahr der Qualitätsverschlechterung/ Preiserhöhung besteht zwar prinzipiell, aber ist leicht durch Anbieterwechsel reduzierbar. Ergebnis: Kosten insgesamt höher Kosten insgesamt geringer Seite 22
24 Technical Report Die Annahmen, die getroffen wurden, führen zu einem Vorzug des Virtuellen Lagers vor der Abwicklung im eigenen Unternehmen. Die Höhe der Transaktionskosten kann zunächst nur relativ angegeben werden. Zur genauen Quantifizierung sind weitere empirische Studien erforderlich. 5.2 Prozesskostenorientierter Ansatz Im Rahmen des SFB 559 wurden bereits umfangreiche Forschungsarbeiten zum Thema»Prozesskostenmanagement«veröffentlicht [JevH07]. Nachfolgend werden die Ansätze der Prozesskostenrechnung zur Bewertung von Aktivitäten im Virtuellen Lager herangezogen Analyse und Bestimmung der Prozesse und Prozessgrößen Ein wesentliche Voraussetzung für die Prozesskostenrechnung sind repetitive Prozesse mit verhältnismäßig wenig Entscheidungsspielraum. 5-1: Klassifizierung von Prozessen (in Anlehnung an: [Str88], S.62) Folgende betriebliche Transaktionen zur Systematisierung der Prozesse können unterschieden werden [Coe99]: Logistische Transaktionen: Steuerung und Ausführung des gesamten Materialflusses im Betrieb Seite 23
25 Technical Report Ausgleichende Transaktionen: Sicherstellung der Vorhaltung von Materialien, Fertigungskapazitäten und Arbeitskräfte entsprechend dem Bedarf in der Produktion Qualitätsbezogene Transaktionen: Maßnahmen der betrieblichen Qualitätskontrolle, sowie Festlegung und Konstruktion von Produktspezifikationen sowie Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung von anderen Transaktionen. Aktualisierende Transaktionen: Sicherung der Aktualität der Datenbestände der betrieblichen Informationssysteme. Bei der Erhebung der Prozesse bzw. den Transaktionen ist der Output der Kostenstelle sowie deren Mittelbedarf festzustellen und deren Höhe der Kosten den einzelnen Prozessen zuzuordnen. Die ermittelten Transaktionen bzw. Prozesse sind zu kategorisieren bzw. können in einer Prozessliste zusammengefasst werden. Die Grundlage der prozessorientierten Kalkulation bilden die Hauptprozesse, die durch die kostenstellenübergreifende Zusammenfassung von mehreren sachlich zusammenhängenden Teilprozessen entstehen, wobei sich an den Maßgrößen der einzelnen Teilprozessen orientiert werden soll. Hierdurch werden die hinter den Prozessen stehenden Kostenantriebskräfte (cost driver) identifiziert. Diese cost driver stellen die eigentlichen Bezugsgrößen für die Verrechnung der angefallenen Gemeinkosten dar. Die Prozess- oder Maßgrößen (z. B. Mengen, Positionen, Raum in m³, Prüfungen, Vorgänge etc.) können nach verschiedenen Bezugskriterien systematisiert bzw. zusammengefasst werden: - Wert- und Mengenabhängig bzw. - Volumen-, Komplexitäts- und Effizienzabhängig. Sogenannte Prozessmengen können als Ausprägung der Maßgröße eines Hauptprozesses anhand des Fertigungsplans ermittelt werden oder als Ist-Wert zur Verfügung stehen. Seite 24
26 Technical Report Prozesskostenkalkulation Die Prozesskostenkalkulation spiegelt die Beanspruchung der betrieblichen Ressourcen durch die bereitgestellten Dienstleistungen im Virtuellen Lager wider. Mit Hilfe der Prozesskosten, für die vorab entsprechende Prozessgrößen definiert wurden, und der ermittelten Prozessmengen können die Prozesskostensätze ermittelt werden: Pr ozesskosten Pr ozesskostensatz = Pr ozessmenge Der Prozesskostenansatz stellt die Kosten in Geldeinheiten je Prozessgröße dar. Durch die verursachungsgerechte Zuordnung von Leistungen und Kosten, können Preise besser gebildet und beurteilt und Entscheidungen besser getroffen werden. Die verwendeten Kosten sind die so genannten leistungsmengeninduzierten (lmi) Kosten, also Kosten, denen eindeutig eine Maßgröße zugeordnet werden kann. Demgegenüber stehen die Kosten, die prozessmengenunabhängig entstehen, sie stellen leistungsmengenneutrale (lmn) Kosten dar und müssen weiterhin über prozentuale Zuschlagssätze auf die Produkte verrechnet werden. Horváth/Mayer empfehlen die Umlage der leistungsmengenneutralen Prozesskosten proportional zur Höhe der leistungsmengeninduzierten Prozesskostensätze [Hor89]: Pr ozesskosten( lmn) Umlagefakt or = 1+ *100 Pr ozesskosten( lmi) Der Gesamtprozesskostensatz stellt das Ergebnis dar, der durch die Multiplikation von Umlagefaktor und Prozesskostensatz entsteht Einsatz der Prozesskostenrechnung im Virtuellen Lager Die Prozesse, die im Virtuellen Lager abwickelt werden, sind standardisiert und in einer Prozessworkbench hinterlegt [Figg08]. Die Prozesse im Virtuellen Lager werden als Kostentreiber definiert und stellen die Maßgröße für die leistungsmengeninduzierten Kosten dar. Basierend auf den Prozessen werden zunächst Teilprozesskostensätze (TPKS) ermittelt [Jeh07]. Anschließend werden die Kostensätze pro Teilprozess den tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen gegenübergestellt. Seite 25
27 Technical Report Nachfolgend wird ein Schema zur Ermittlung der Prozesskosten im Wareneingang für einen Nachfrager im Virtuellen Lager vorgestellt: Hauptprozess: Teilprozess: Nr.: TPKS [Kosten in Teilprozess Nr. 1-n für Kostenart k] Wareneingang Wareneinang anfahren Einheiten abladen Lieferung mit Lieferschein abgleichen Lieferschein quittieren Lieferung auf Transportschäden untersuchen Leergut austauschen Teilprozess von Nachfrager in Anspruch genommen [Häufigkeit] 1 TPKS 1,k 10 2 TPKS 2,k 10 3 TPKS 3,k 8 4 TPKS 4,k 5 5 TPKS 5,k 9 6 TPKS 6,k 0 Ausgehend von Art und Häufigkeit der erbrachten Leistungen (= Teilprozesse) im Virtuellen Lager lassen sich nun die Gesamtkosten pro Teilprozess und anschließend pro Hauptprozess ermitteln. Diese Kosten sind noch um die leistungsmengenneutralen Kosten zu ergänzen, die z.b. für die Vorhaltung des Logistikinformationssystems anfallen. Mit diesem Ansatz ist eine Grundlage zur Berechnung logistischer Dienstleistungen im Virtuellen Lager geschaffen worden. Seite 26
28 Technical Report Schlussbetrachtung Im vorliegenden Report wurden wesentliche Rahmenbedingungen für das Bestandsmanagement im Virtuellen Lager definiert. Hierfür musste aus einer Vielzahl an Instrumenten und Methoden eine Selektion vorgenommen. Die Rahmenbedingungen für das Geschäftsmodell des Virtuellen Lagers wurden in diesem Report beschrieben. Die softwaretechnische Umsetzung durch eine Programmierung einer entsprechenden Oberfläche stellt eine Aufgabe für die Zukunft dar. Das vorgestellte Anwendungsszenario bildet einen Einstieg zur Darstellung des Informationsaustausches zwischen den Ebenen des Virtuellen Lagers. Die aufgezeigten Phasen sind vor dem Hintergrund der technischen Weiterentwicklung des Logistikinformationssystems und der Umsetzung einer benutzerorientierten Oberfläche weiter zu verfeinern. Die aufgezeigten Ansätze zur finanziellen Bewertung der Aktivitäten im Virtuellen Lager stellen nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten dar, die in der Literatur zur Verfügung stehen. Eine Überprüfung der Methoden und ihrer Annahmen ist während der weiteren Umsetzung des Virtuellen Lagers erforderlich. Die finanzielle Abwicklung im Virtuellen Lager sollte als ein integrales Modul im Logistikinformationssystem entwickelt werden, um die Abrechnung der erbrachten möglichst ohne Schnittstellen zu externen Systemen zu ermöglichen. Seite 27
29 Literaturverzeichnis 7 Literaturverzeichnis [Coa37] Coase, R.: The nature of the Firm, Economica, 4, 1937, S [Coe99] Coenenberg, A.: Kostenrechnung und Kostenanalyse, 1999, S [Dah79] Dahlman, C.: The Problem of Externality, Journal of Law and Economics, 22, 1979, S [Figg08] Figgener, O.: Beitrag zur Prozessstandardisierung in der Intralogistik. Verlag Praxiswissen, Dortmund, 2008 [Haa07] Haarhoff, A. K.: Entwicklung einer unternehmensübergreifenden Dispositionsstrategie für das Virtuelle Lager, Studienarbeit, Dortmund, 2007, S. 8-33, 2007 [Hart99] Hartmann, H.: Bestandsmanagement und controlling, Deutsche Betriebswirte Verlag GmbH, Gernsbach, 1999, S. 32 [Hor89] Horváth, P. / Mayer, R.: Prozesskostenrechnung Der neue Weg zu mehr Kostentransparenz und wirkungsvolleren Unternehmensstrategien, in: Controlling 1989, S [JevH07] Jehle,E. /. Von Haaren, B.: Fortschritts- und Ergebnisbericht, M3 Netzwerk-Controlling, , S. 3-8 [Mey08] Meyers Lexikon Online; Transaktionskosten, , [NieJ04] Nienhüser, W./ Jans, M: Grundbegriffe und Grundideen der Transaktionskostentheorie - am Beispiel von "Make-or-Buy"- Entscheidungen über Weiterbildungsmaßnahmen (01/2004), , [Ole08] Online-Verwaltungslexikon, Transaktionskosten, , [SDL03] Scheer, C., Deelmann, T., Loos, P.: Geschäftsmodelle und internetbasierte Geschäftsmodelle Begriffsbestimmung und Teilnehmermodell, 2003 [Str88] Striening, H.-D.: Prozess-Management, Frankfurt am Main, 1988, S.62 [Voi02] Voigt, S.: Institutionenökonomik, Wilhelm Fink Verlag GmbH Co. KG, 2002, S [Wil85] Williamson, O.E.: The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, New York, 1985 [ZEb06] Zellerhoff, J.; Ebel, D.: Transportvergabe online. In: IT-Mittelstand (2006) 12, S Seite 28
30 Literaturverzeichnis [Zel08] Zellerhoff, J.: Modellierung eines Informationssystems für ein Virtuelles Lager. Technical Report Sonderforschungsbereich 559 Modellierung großer Netze in der Logistik 08002, Seite 29
31 Sonderforschungsbereich 559 Bisher erschienene Technical Reports Jochen Bernhard, Dirk Jodin, Kay Hömberg, Sonja Kuhnt, Christoph Schürmann, Sigrid Wenzel: Vorgehensmodell zur Informationsgewinnung Prozessschritte und Methodennutzung Doris Blutner, Stephan Cramer, Sven Krause, Tycho Mönks, Lars Nagel, Andreas Reinholz, Markus Witthaut: Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe 5 Assistenzsysteme für die Entscheidungsunterstützung Falko Bause, Tobias Hegmanns, Stefan Pietzarka, Veye Tatah, Markus Witthaut: Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe Neues Problemverständnis: Ergänzung des Modellierungsparadigmas Arnd Bernsmann, Peter Buchholz, Stephan Kessler, Andreas Reinholz, Britta von Haaren, Markus Witthaut: Bewertungs- und Dimensionierungsmethoden im Sonderforschungsbereich Jochen Bernhard, Kay Hömberg, Lars Nagel, Iwo Riha, Christoph Schürmann, Harald Sieke, Marcus Völker: Standardisierte Modelle zur Systemlastbeschreibung Kay Hömberg, Jan Hustadt, Dirk Jodin, Joachim Kochsiek, Lars Nagel, Iwo Riha: Basisprozesse für die Modellierung in großen Netzen der Logistik Kay Hömberg, Dirk Jodin, Reineke: Bewertung und Kategorisierung der Methoden zur Datenerhebung Jochen Bernhard, Miroslaw Dragan: Bewertung der Informationsgüte in der Informationsgewinnung für die modellgestützte Analyse großer Netze der Logistik Britta von Haaren, Tatjana Malyshko: Integration of Velos-Simulation- Results into the Supply Chain Balanced Scorecard Britta von Haaren, Ivana Humpolcová: Ansätze zur Systematisierung des Instrumentariums zum Supply-Chain-Risikomanagement Jan Hombergs, Iwo Riha: Softwareauswahl für den Einsatz von Cost Benefit Sharing in Logistiknetzwerken Jörg Zellerhoff: Modellierung eines Informationssystems für ein Virtuelles Lager Egon Jehle: Bereitstellungswege- und organisatorische Zuordnungsmodelle für das Supply Chain Finance Dietmar Ebel: Bestandsmanagement im Virtuellen Lager Alle Technical Reports können im Internet unter abgerufen werden. Für eine Druckversion wenden Sie sich bitte an die SFB-Geschäftsstelle andrea.zoeller@iml.fraunhofer.de
Prozessmanagement Modeerscheinung oder Notwendigkeit
 1 von5 Prozessmanagement Modeerscheinung oder Notwendigkeit Autor: Dr. Gerd Sonntag Beratender Ingenieur disocon (Unternehmensberatung Diekelmann & Sonntag) Das Thema Prozessmanagement wurde in einem kompakten
1 von5 Prozessmanagement Modeerscheinung oder Notwendigkeit Autor: Dr. Gerd Sonntag Beratender Ingenieur disocon (Unternehmensberatung Diekelmann & Sonntag) Das Thema Prozessmanagement wurde in einem kompakten
Haben Sie noch Fragen? Zu letzter Woche? Zu einem bestimmten Thema? Sonstiges?
 Haben Sie noch Fragen? Zu letzter Woche? Zu einem bestimmten Thema? Sonstiges? Prozesskostenrechnung Prozesskostenrechnung Prozesskostenrechnung - Die Prozesskostenrechung ist auf eine detaillierte Erfassung
Haben Sie noch Fragen? Zu letzter Woche? Zu einem bestimmten Thema? Sonstiges? Prozesskostenrechnung Prozesskostenrechnung Prozesskostenrechnung - Die Prozesskostenrechung ist auf eine detaillierte Erfassung
1. Einführung. 1.1 Tourenplanung als Teilbereich der Logistik
 1. Einführung 1.1 Tourenplanung als Teilbereich der Logistik Die Logistik steht heute nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der unternehmerischen Praxis stärker im Mittelpunkt als in den früheren
1. Einführung 1.1 Tourenplanung als Teilbereich der Logistik Die Logistik steht heute nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der unternehmerischen Praxis stärker im Mittelpunkt als in den früheren
Aufgabe 1: Schnittstellencontrolling. Dipl.-Ök. Christine Stockey
 Aufgabe 1: Schnittstellencontrolling Dipl.-Ök. Christine Stockey Aufgabe 1a, 20 Punkte Skizzieren Sie das Grundkonzept der Prozesskostenrechnung. Gehen Sie hierbei auch auf den Zusammenhang zwischen Aktivitäten,
Aufgabe 1: Schnittstellencontrolling Dipl.-Ök. Christine Stockey Aufgabe 1a, 20 Punkte Skizzieren Sie das Grundkonzept der Prozesskostenrechnung. Gehen Sie hierbei auch auf den Zusammenhang zwischen Aktivitäten,
1 Einleitung. 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung
 1 Einleitung 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung Obgleich Tourenplanungsprobleme zu den am häufigsten untersuchten Problemstellungen des Operations Research zählen, konzentriert sich der Großteil
1 Einleitung 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung Obgleich Tourenplanungsprobleme zu den am häufigsten untersuchten Problemstellungen des Operations Research zählen, konzentriert sich der Großteil
Gliederung. 1 Einleitung. 2 Transaktionskostentheorie. 2.1 Zentrale Aussagen. 2.2 Determinanten der Transaktionskosten. 2.
 Gliederung 1 Einleitung 2 Transaktionskostentheorie 2.1 Zentrale Aussagen 2.2 Determinanten der Transaktionskosten 2.3 Zusammenfassung 3 Problemfelder und Anwendungsgebiete Hagen, 19.12.2005 21.12.2005
Gliederung 1 Einleitung 2 Transaktionskostentheorie 2.1 Zentrale Aussagen 2.2 Determinanten der Transaktionskosten 2.3 Zusammenfassung 3 Problemfelder und Anwendungsgebiete Hagen, 19.12.2005 21.12.2005
WSO de. <work-system-organisation im Internet> Allgemeine Information
 WSO de Allgemeine Information Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorwort 3 2. Mein Geschäftsfeld 4 3. Kompetent aus Erfahrung 5 4. Dienstleistung 5 5. Schulungsthemen 6
WSO de Allgemeine Information Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorwort 3 2. Mein Geschäftsfeld 4 3. Kompetent aus Erfahrung 5 4. Dienstleistung 5 5. Schulungsthemen 6
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
1.1 Ausgangssituation 1
 1.1 Ausgangssituation 1 1 Einleitung 1.1 Ausgangssituation Das produzierende Gewerbe hat maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. 2012 erwirtschafteten 209.370 Unternehmen
1.1 Ausgangssituation 1 1 Einleitung 1.1 Ausgangssituation Das produzierende Gewerbe hat maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. 2012 erwirtschafteten 209.370 Unternehmen
Wissenschaftlicher Bericht
 Ein Auszug aus... Wissenschaftlicher Bericht Augmented Reality als Medium strategischer medialer Kommunikation Die komplette Studie ist bei amazon.de käuflich zu erwerben. Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
Ein Auszug aus... Wissenschaftlicher Bericht Augmented Reality als Medium strategischer medialer Kommunikation Die komplette Studie ist bei amazon.de käuflich zu erwerben. Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
DIE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IN DER PRAXIS: WEBMARK SEILBAHNEN IM EINSATZ
 Kurzfassung DIE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IN DER PRAXIS: WEBMARK SEILBAHNEN IM EINSATZ Mag. Klaus Grabler 9. Oktober 2002 OITAF Seminar 2002 Kongresshaus Innsbruck K ennzahlen sind ein wesentliches Instrument
Kurzfassung DIE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IN DER PRAXIS: WEBMARK SEILBAHNEN IM EINSATZ Mag. Klaus Grabler 9. Oktober 2002 OITAF Seminar 2002 Kongresshaus Innsbruck K ennzahlen sind ein wesentliches Instrument
OUTSOURCING ADVISOR. Analyse von SW-Anwendungen und IT-Dienstleistungen auf ihre Global Sourcing Eignung. Bewertung von Dienstleistern und Standorten
 Outsourcing Advisor Bewerten Sie Ihre Unternehmensanwendungen auf Global Sourcing Eignung, Wirtschaftlichkeit und wählen Sie den idealen Dienstleister aus. OUTSOURCING ADVISOR Der Outsourcing Advisor ist
Outsourcing Advisor Bewerten Sie Ihre Unternehmensanwendungen auf Global Sourcing Eignung, Wirtschaftlichkeit und wählen Sie den idealen Dienstleister aus. OUTSOURCING ADVISOR Der Outsourcing Advisor ist
Checkliste zur qualitativen Nutzenbewertung
 Checkliste zur qualitativen Nutzenbewertung Herausgeber Pentadoc Consulting AG Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Tel +49 (0)69 509 56-54 07 Fax +49 (0)69 509 56-55 73 E-Mail info@pentadoc.com
Checkliste zur qualitativen Nutzenbewertung Herausgeber Pentadoc Consulting AG Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Tel +49 (0)69 509 56-54 07 Fax +49 (0)69 509 56-55 73 E-Mail info@pentadoc.com
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Netz der Möglichkeiten eg i.g. Deckblatt Übersicht. Virtuelle Unternehmen Eine Übersicht
 Virtuelle Unternehmen Eine Übersicht Deckblatt Übersicht Was ist virtuell? Was ist virtuell? Was it virtuell?!virtuell ist, was sich nur so verhält, als sei es real.!ein reales Unternehmen ist ein Unternehmen
Virtuelle Unternehmen Eine Übersicht Deckblatt Übersicht Was ist virtuell? Was ist virtuell? Was it virtuell?!virtuell ist, was sich nur so verhält, als sei es real.!ein reales Unternehmen ist ein Unternehmen
MIT NEUEN FACHTHEMEN
 ZUM UMGANG MIT Version: 1.0 Datum: 15.10.2012 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 1.1 Ziel und Zweck... 3 1.2 Anwendungsbereich... 3 1.3 Entwicklung und Fortführung... 3 2 DOKUMENTE... 4 2.1 Formular
ZUM UMGANG MIT Version: 1.0 Datum: 15.10.2012 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 1.1 Ziel und Zweck... 3 1.2 Anwendungsbereich... 3 1.3 Entwicklung und Fortführung... 3 2 DOKUMENTE... 4 2.1 Formular
M e r k b l a t t. Neues Verbrauchervertragsrecht 2014: Beispiele für Widerrufsbelehrungen
 Stand: Januar 2016 M e r k b l a t t Neues Verbrauchervertragsrecht 2014: Beispiele für Widerrufsbelehrungen Sie haben Interesse an aktuellen Meldungen aus dem Arbeits-, Gesellschafts-, Wettbewerbsund
Stand: Januar 2016 M e r k b l a t t Neues Verbrauchervertragsrecht 2014: Beispiele für Widerrufsbelehrungen Sie haben Interesse an aktuellen Meldungen aus dem Arbeits-, Gesellschafts-, Wettbewerbsund
Prozessorientiertes Asset Management und Mobile Workforce (unter Android)
 Prozessorientiertes Asset Management und Mobile Workforce (unter Android) Themen Herausforderungen für einen effizienten Netzbetrieb Zentrales Objektmanagement: Funktionsumfang und Aufbau Mobile Bearbeitung
Prozessorientiertes Asset Management und Mobile Workforce (unter Android) Themen Herausforderungen für einen effizienten Netzbetrieb Zentrales Objektmanagement: Funktionsumfang und Aufbau Mobile Bearbeitung
 4..1 Übersicht und Verwendung Mit der PMW stellt die SAP seit Release 4.6 ein generisches Werkzeug zur Verfügung, welches mittel- und langfristig die über 60 formatspezifischen RFFO*-Reports ablösen wird.
4..1 Übersicht und Verwendung Mit der PMW stellt die SAP seit Release 4.6 ein generisches Werkzeug zur Verfügung, welches mittel- und langfristig die über 60 formatspezifischen RFFO*-Reports ablösen wird.
P H I U S. Strategieentwicklung in Wissenschaft und Forschung
 Strategieentwicklung in Wissenschaft und Forschung Strategieentwicklung Strategische Planung Strategiekonzept in Wissenschaft und Forschung Strategieentwicklung in Wissenschaft und Forschung Drei Auslöser
Strategieentwicklung in Wissenschaft und Forschung Strategieentwicklung Strategische Planung Strategiekonzept in Wissenschaft und Forschung Strategieentwicklung in Wissenschaft und Forschung Drei Auslöser
Business Model Canvas
 Business Model Canvas Business Model Canvas ist ein strategisches Management Tool, mit dem sich neue und bestehende Geschäftsmodelle visualisieren lassen. Demnach setzt sich ein Geschäftsmodell aus neun
Business Model Canvas Business Model Canvas ist ein strategisches Management Tool, mit dem sich neue und bestehende Geschäftsmodelle visualisieren lassen. Demnach setzt sich ein Geschäftsmodell aus neun
Gästeverwaltung. Gästestammdaten. Gäste verwalten. Hotelsoftware für Klein- und Mittelbetriebe
 Gästeverwaltung Hotelsoftware für Klein- und Mittelbetriebe Gästestammdaten Gäste verwalten Gästeverwaltung für Windows ermöglicht Ihnen die komfortable Erfassung Ihrer Gästestammdaten und stellt diese
Gästeverwaltung Hotelsoftware für Klein- und Mittelbetriebe Gästestammdaten Gäste verwalten Gästeverwaltung für Windows ermöglicht Ihnen die komfortable Erfassung Ihrer Gästestammdaten und stellt diese
Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung
 DR. BETTINA DILCHER Management Consultants Network Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung Leonhardtstr. 7, 14057 Berlin, USt.-ID: DE 225920389
DR. BETTINA DILCHER Management Consultants Network Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung Leonhardtstr. 7, 14057 Berlin, USt.-ID: DE 225920389
E-Sourcing einfach, effizient und erfolgreich
 E-Sourcing einfach, effizient und erfolgreich In wenigen Schritten von der Lieferanteninformation zur Auktion Die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen ist für Unternehmen immer mit einem enormen
E-Sourcing einfach, effizient und erfolgreich In wenigen Schritten von der Lieferanteninformation zur Auktion Die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen ist für Unternehmen immer mit einem enormen
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des 87 der Strafprozessordnung Berlin, 21. Februar 2012 Korrespondenzadresse: Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des 87 der Strafprozessordnung Berlin, 21. Februar 2012 Korrespondenzadresse: Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Von der Bedarfsmeldung bis zur Rechnungsprüfung
 Von der Bedarfsmeldung bis zur Rechnungsprüfung Optimieren Sie Ihren Prozess in einer elektronischen Beschaffung und einer workflowgestützten Rechnungseingangsprüfung www.schleupen.de E-Procurement Beschaffung
Von der Bedarfsmeldung bis zur Rechnungsprüfung Optimieren Sie Ihren Prozess in einer elektronischen Beschaffung und einer workflowgestützten Rechnungseingangsprüfung www.schleupen.de E-Procurement Beschaffung
Sonderrundschreiben. Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen
 Sonderrundschreiben Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen Sonnenstraße 11-80331 München Telefon 089 / 5404133-0 - Fax 089 / 5404133-55 info@haus-und-grund-bayern.de
Sonderrundschreiben Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen Sonnenstraße 11-80331 München Telefon 089 / 5404133-0 - Fax 089 / 5404133-55 info@haus-und-grund-bayern.de
Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante
 ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
SwissSupplyChain Musterprüfung
 Prüfungsfach: Prüfungsdauer: 1 Stunde Maximale Punktzahl 60 Anzahl Aufgabenblätter 6 Anzahl Lösungsblätter... Bitte bei den Lösungsblättern nicht auf die Rückseite schreiben! Bitte beachten Sie: Sollten
Prüfungsfach: Prüfungsdauer: 1 Stunde Maximale Punktzahl 60 Anzahl Aufgabenblätter 6 Anzahl Lösungsblätter... Bitte bei den Lösungsblättern nicht auf die Rückseite schreiben! Bitte beachten Sie: Sollten
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Antoine de Saint-Exupery. Das Beratungsteam. Iris Güniker + Silke Schoenheit
 Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung Antoine de Saint-Exupery Das Beratungsteam Iris Güniker + Silke Schoenheit Ihre Spezialisten für ganzheitliches Projektmanagement Was ist GPM?
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung Antoine de Saint-Exupery Das Beratungsteam Iris Güniker + Silke Schoenheit Ihre Spezialisten für ganzheitliches Projektmanagement Was ist GPM?
Informationsbroschüre über die Nutzung des otop Hilfsmittel-Marktplatzes
 Informationsbroschüre über die Nutzung des otop Hilfsmittel-Marktplatzes Was ist otop? otop ist der erste Internet-Marktplatz für die Vermittlung von Aufträgen der Krankenkassen. Bei otop können Leistungserbringer
Informationsbroschüre über die Nutzung des otop Hilfsmittel-Marktplatzes Was ist otop? otop ist der erste Internet-Marktplatz für die Vermittlung von Aufträgen der Krankenkassen. Bei otop können Leistungserbringer
Aufgabenheft. Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Modul 32701 - Business/IT-Alignment. 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr. Univ.-Prof. Dr. U.
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Aufgabenheft : Termin: Prüfer: Modul 32701 - Business/IT-Alignment 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl Aufbau und Bewertung der Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Aufgabenheft : Termin: Prüfer: Modul 32701 - Business/IT-Alignment 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl Aufbau und Bewertung der Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Stadt» Cottbus. Alternativen zur Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung der Stadt Cottbus. Cottbus, 17. Januar 2006
 Stadt» Cottbus Alternativen zur Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung der Cottbus, 17. Januar 2006 Diese Unterlage ist nur im Zusammenhang mit dem mündlichen Vortrag vollständig; die isolierte
Stadt» Cottbus Alternativen zur Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung der Cottbus, 17. Januar 2006 Diese Unterlage ist nur im Zusammenhang mit dem mündlichen Vortrag vollständig; die isolierte
[Customer Service by KCS.net] KEEPING CUSTOMERS SUCCESSFUL
![[Customer Service by KCS.net] KEEPING CUSTOMERS SUCCESSFUL [Customer Service by KCS.net] KEEPING CUSTOMERS SUCCESSFUL](/thumbs/39/18744977.jpg) [Customer Service by KCS.net] KEEPING CUSTOMERS SUCCESSFUL Was bedeutet Customer Service by KCS.net? Mit der Einführung von Microsoft Dynamics AX ist der erste wichtige Schritt für viele Unternehmen abgeschlossen.
[Customer Service by KCS.net] KEEPING CUSTOMERS SUCCESSFUL Was bedeutet Customer Service by KCS.net? Mit der Einführung von Microsoft Dynamics AX ist der erste wichtige Schritt für viele Unternehmen abgeschlossen.
Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz
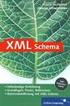 Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Test zur Bereitschaft für die Cloud
 Bericht zum EMC Test zur Bereitschaft für die Cloud Test zur Bereitschaft für die Cloud EMC VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG Testen Sie, ob Sie bereit sind für die Cloud Vielen Dank, dass Sie sich
Bericht zum EMC Test zur Bereitschaft für die Cloud Test zur Bereitschaft für die Cloud EMC VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG Testen Sie, ob Sie bereit sind für die Cloud Vielen Dank, dass Sie sich
Verpasst der Mittelstand den Zug?
 Industrie 4.0: Verpasst der Mittelstand den Zug? SCHÜTTGUT Dortmund 2015 5.11.2015 Ergebnisse einer aktuellen Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen 1 Industrie 4.0 im Mittelstand Ergebnisse einer
Industrie 4.0: Verpasst der Mittelstand den Zug? SCHÜTTGUT Dortmund 2015 5.11.2015 Ergebnisse einer aktuellen Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen 1 Industrie 4.0 im Mittelstand Ergebnisse einer
Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien
 Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Optimierung der operativen Controllingaktivitäten
 Wirtschaft Christoph Rösch Optimierung der operativen Controllingaktivitäten Dargestellt am Beispiel einer nach Kostenstellen gegliederten kurzfristigen Erfolgsrechnung im Service Center Neu-Ulm der EvoBus
Wirtschaft Christoph Rösch Optimierung der operativen Controllingaktivitäten Dargestellt am Beispiel einer nach Kostenstellen gegliederten kurzfristigen Erfolgsrechnung im Service Center Neu-Ulm der EvoBus
Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen
 Zentrale Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 445/2011 umfasst das Instandhaltungssystem der ECM die a) Managementfunktion b) Instandhaltungsentwicklungsfunktion
Zentrale Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 445/2011 umfasst das Instandhaltungssystem der ECM die a) Managementfunktion b) Instandhaltungsentwicklungsfunktion
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1. Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse:
 Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Outsourcing personalwirtschaftlicher Dienstleistungen in Stadtwerken
 Outsourcing personalwirtschaftlicher Dienstleistungen in Stadtwerken Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse der Diplomarbeit von cand. rer. pol. Stefanie Findeis geschrieben an der Professur BWL II
Outsourcing personalwirtschaftlicher Dienstleistungen in Stadtwerken Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse der Diplomarbeit von cand. rer. pol. Stefanie Findeis geschrieben an der Professur BWL II
Workshop-Unterlagen Leitbildentwicklung
 Workshop-Unterlagen Leitbildentwicklung Ein partizipativer Entwicklungsprozess mit Hilfe der Fotolangage Dr. Kurt Aeberhard aeberhard@innopool.ch Dr. Michèle Etienne etienne@innopool.ch Schüpfen, November
Workshop-Unterlagen Leitbildentwicklung Ein partizipativer Entwicklungsprozess mit Hilfe der Fotolangage Dr. Kurt Aeberhard aeberhard@innopool.ch Dr. Michèle Etienne etienne@innopool.ch Schüpfen, November
Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung
 Änderung IFRS 2 Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt. 2 Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller
Änderung IFRS 2 Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt. 2 Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller
1 topologisches Sortieren
 Wolfgang Hönig / Andreas Ecke WS 09/0 topologisches Sortieren. Überblick. Solange noch Knoten vorhanden: a) Suche Knoten v, zu dem keine Kante führt (Falls nicht vorhanden keine topologische Sortierung
Wolfgang Hönig / Andreas Ecke WS 09/0 topologisches Sortieren. Überblick. Solange noch Knoten vorhanden: a) Suche Knoten v, zu dem keine Kante führt (Falls nicht vorhanden keine topologische Sortierung
Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Steve Murphy, Marc Schaeffers
 Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Steve Murphy, Marc Schaeffers Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Einleitung Wenn in einem Unternehmen FMEA eingeführt wird, fangen die meisten sofort damit an,
Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Steve Murphy, Marc Schaeffers Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Einleitung Wenn in einem Unternehmen FMEA eingeführt wird, fangen die meisten sofort damit an,
Richtlinien über das Betriebskonzept für Einrichtungen der Heimpflege für Kinder und Jugendliche
 Richtlinien über das Betriebskonzept für Einrichtungen der Heimpflege für Kinder und Jugendliche vom 1. April 2007 Gestützt auf Art. 2 der Verordnung über Kinder- und Jugendheime vom 21. September 1999
Richtlinien über das Betriebskonzept für Einrichtungen der Heimpflege für Kinder und Jugendliche vom 1. April 2007 Gestützt auf Art. 2 der Verordnung über Kinder- und Jugendheime vom 21. September 1999
Der -Online- Ausbilderkurs
 Der -Online- Ausbilderkurs Machen Sie Ihren Ausbilderschein mit 70% weniger Zeitaufwand Flexibel & mit 70% Zeitersparnis zu Ihrem Ausbilderschein Mit Videos auf Ihre Ausbilderprüfung (IHK) vorbereiten
Der -Online- Ausbilderkurs Machen Sie Ihren Ausbilderschein mit 70% weniger Zeitaufwand Flexibel & mit 70% Zeitersparnis zu Ihrem Ausbilderschein Mit Videos auf Ihre Ausbilderprüfung (IHK) vorbereiten
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland
 OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
Internet- und E-Mail-Überwachung in Unternehmen und Organisationen
 Publiziert in SWITCHjournal 1/2004 Internet- und E-Mail-Überwachung in Unternehmen und Organisationen Dr. Ursula Widmer, Rechtsanwältin, Bern ursula.widmer@widmerpartners-lawyers.ch Die Nutzung von Internet
Publiziert in SWITCHjournal 1/2004 Internet- und E-Mail-Überwachung in Unternehmen und Organisationen Dr. Ursula Widmer, Rechtsanwältin, Bern ursula.widmer@widmerpartners-lawyers.ch Die Nutzung von Internet
OEM Von der Idee zum Serienprodukt
 OEM Von der Idee zum Serienprodukt I n d i v i d u e l l g e f e r t i g t e S i c h e r h e i t s t e c h n i k a u s e i n e r h a n d Effizientes Projektmanagement Von der Idee bis zur Umsetzung Hätten
OEM Von der Idee zum Serienprodukt I n d i v i d u e l l g e f e r t i g t e S i c h e r h e i t s t e c h n i k a u s e i n e r h a n d Effizientes Projektmanagement Von der Idee bis zur Umsetzung Hätten
Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014
 Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014 Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Die Anmeldung... 2 2.1 Die Erstregistrierung... 3 2.2 Die Mitgliedsnummer anfordern... 4 3. Die Funktionen für Nutzer... 5 3.1 Arbeiten
Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014 Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Die Anmeldung... 2 2.1 Die Erstregistrierung... 3 2.2 Die Mitgliedsnummer anfordern... 4 3. Die Funktionen für Nutzer... 5 3.1 Arbeiten
Projektmanagement in der Spieleentwicklung
 Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität.
 Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität. Verantwortung statt Versprechen: Qualität permanent neu erarbeiten. Geyer & Weinig ist der erfahrene Spezialist für Service Level Management.
Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität. Verantwortung statt Versprechen: Qualität permanent neu erarbeiten. Geyer & Weinig ist der erfahrene Spezialist für Service Level Management.
Hilfe Bearbeitung von Rahmenleistungsverzeichnissen
 Hilfe Bearbeitung von Rahmenleistungsverzeichnissen Allgemeine Hinweise Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Hinweise... 3 1.1 Grundlagen...3 1.2 Erstellen und Bearbeiten eines Rahmen-Leistungsverzeichnisses...
Hilfe Bearbeitung von Rahmenleistungsverzeichnissen Allgemeine Hinweise Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Hinweise... 3 1.1 Grundlagen...3 1.2 Erstellen und Bearbeiten eines Rahmen-Leistungsverzeichnisses...
Mobile. it-people it-solutions
 it-people it-solutions Überblick I Komponenten I Nominierungsmanagement I Portfolioberechnung I Kommunikationsmanagement I Controlling und Monitoring I Systemarchitektur Produktbeschreibung Neue Markt-
it-people it-solutions Überblick I Komponenten I Nominierungsmanagement I Portfolioberechnung I Kommunikationsmanagement I Controlling und Monitoring I Systemarchitektur Produktbeschreibung Neue Markt-
WERKZEUG KUNDENGRUPPEN BILDEN
 Integrierter MarketinXervice Dr. Rüdiger Alte Wilhelm-Busch-Straße 27 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 55 45 84 38 WERKZEUG GRUPPEN BILDEN Die folgenden Fragen mögen Ihnen helfen, Kriterien aufzustellen, anhand
Integrierter MarketinXervice Dr. Rüdiger Alte Wilhelm-Busch-Straße 27 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 55 45 84 38 WERKZEUG GRUPPEN BILDEN Die folgenden Fragen mögen Ihnen helfen, Kriterien aufzustellen, anhand
DAS TEAM MANAGEMENT PROFIL IM ÜBERBLICK. Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam.
 Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam. Das Team Management Profil: Was haben Sie davon? In Unternehmen, die mit dem Team Management Profil arbeiten, entsteht ein
Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam. Das Team Management Profil: Was haben Sie davon? In Unternehmen, die mit dem Team Management Profil arbeiten, entsteht ein
Bereich METIS (Texte im Internet) Zählmarkenrecherche
 Bereich METIS (Texte im Internet) Zählmarkenrecherche Über die Zählmarkenrecherche kann man nach der Eingabe des Privaten Identifikationscodes einer bestimmten Zählmarke, 1. Informationen zu dieser Zählmarke
Bereich METIS (Texte im Internet) Zählmarkenrecherche Über die Zählmarkenrecherche kann man nach der Eingabe des Privaten Identifikationscodes einer bestimmten Zählmarke, 1. Informationen zu dieser Zählmarke
Auswahl eines Erhebungsinstruments aus der Rubrik Methoden und Instrumente aus dem Verfahren der externen Evaluation :
 Auswahl eines Erhebungsinstruments aus der Rubrik Methoden und Instrumente aus dem Verfahren der externen Evaluation : Verwenden Sie eine für Ihre Fragestellung relevante Auswahl an Instrumenten aus dem
Auswahl eines Erhebungsinstruments aus der Rubrik Methoden und Instrumente aus dem Verfahren der externen Evaluation : Verwenden Sie eine für Ihre Fragestellung relevante Auswahl an Instrumenten aus dem
1 Einleitung. 1.1 Motivation
 1 Einleitung 1.1 Motivation Eine zunehmende Globalisierung in Verbindung mit der Verbreitung des elektronischen Handels, stets kürzer werdende Produktlebenszyklen und eine hohe Variantenvielfalt konstituieren
1 Einleitung 1.1 Motivation Eine zunehmende Globalisierung in Verbindung mit der Verbreitung des elektronischen Handels, stets kürzer werdende Produktlebenszyklen und eine hohe Variantenvielfalt konstituieren
Benchmark MES Anbietern
 MES Anbietern MES Consult beobachtet den MES Markt seit über 10 Jahren. Kritisch dabei ist immer wieder, dass aufgrund der heutigen Aktualität des Themas viele Anbieter ihren Systemen, die meist aus der
MES Anbietern MES Consult beobachtet den MES Markt seit über 10 Jahren. Kritisch dabei ist immer wieder, dass aufgrund der heutigen Aktualität des Themas viele Anbieter ihren Systemen, die meist aus der
50. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Klasse 11 13. 501322 Lösung 10 Punkte
 50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
Teil 2 Management virtueller Kooperation
 Anwendungsbedingungen und Gestaltungsfelder 45 Teil 2 Management virtueller Kooperation Der strategischen Entscheidung über die Einführung telekooperativer Zusammenarbeit und die rüfung der Anwendungsbedingungen
Anwendungsbedingungen und Gestaltungsfelder 45 Teil 2 Management virtueller Kooperation Der strategischen Entscheidung über die Einführung telekooperativer Zusammenarbeit und die rüfung der Anwendungsbedingungen
Qualitätsmanagement-Handbuch. 1.7 Projektmanagement
 Seite 1 von 5 Erstellt: Geprüft: Freigegeben: Dr. Christine Reimann Datum: Datum: Datum: Inhaltsverzeichnis Nr. Element-Abschnitt Seite 1 Ziel und Zweck 2 2 Geltungsbereich / Verantwortung 2 3 Vorgehen
Seite 1 von 5 Erstellt: Geprüft: Freigegeben: Dr. Christine Reimann Datum: Datum: Datum: Inhaltsverzeichnis Nr. Element-Abschnitt Seite 1 Ziel und Zweck 2 2 Geltungsbereich / Verantwortung 2 3 Vorgehen
Synchronisations- Assistent
 TimePunch Synchronisations- Assistent Benutzerhandbuch Gerhard Stephan Softwareentwicklung -und Vertrieb 25.08.2011 Dokumenten Information: Dokumenten-Name Benutzerhandbuch, Synchronisations-Assistent
TimePunch Synchronisations- Assistent Benutzerhandbuch Gerhard Stephan Softwareentwicklung -und Vertrieb 25.08.2011 Dokumenten Information: Dokumenten-Name Benutzerhandbuch, Synchronisations-Assistent
Online-Befragungen. cogitaris GmbH, Eltville. Online-Befragungen
 Online-Befragungen cogitaris GmbH, Eltville Online-Befragungen cogitaris Die Online-Befragung Vorteile in vielerlei Hinsicht Umfragen smart und preisbewusst umsetzen Onlinebefragungen haben sich neben
Online-Befragungen cogitaris GmbH, Eltville Online-Befragungen cogitaris Die Online-Befragung Vorteile in vielerlei Hinsicht Umfragen smart und preisbewusst umsetzen Onlinebefragungen haben sich neben
Information zur Revision der ISO 9001. Sehr geehrte Damen und Herren,
 Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Dokument möchten wir Sie über die anstehende Revision der ISO 9001 und die sich auf die Zertifizierung ergebenden Auswirkungen informieren. Die folgenden Informationen
Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Dokument möchten wir Sie über die anstehende Revision der ISO 9001 und die sich auf die Zertifizierung ergebenden Auswirkungen informieren. Die folgenden Informationen
INitiative Gesunde Arbeitswelt
 INitiative Gesunde Arbeitswelt Münsterland (INGA-Münsterland) Gemeinsame Arbeitsgrundlage 2 1. Der Netzwerkgedanke Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sind in der Bundesrepublik Deutschland gekennzeichnet
INitiative Gesunde Arbeitswelt Münsterland (INGA-Münsterland) Gemeinsame Arbeitsgrundlage 2 1. Der Netzwerkgedanke Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sind in der Bundesrepublik Deutschland gekennzeichnet
GEMEINSAM MIT IHNEN SETZEN WIR DIE SEGEL, UM IHR LEBENSWERK SACHTE UND SICHER IN EINEN NEUEN HAFEN ZU STEUERN.
 GEMEINSAM MIT IHNEN SETZEN WIR DIE SEGEL, UM IHR LEBENSWERK SACHTE UND SICHER IN EINEN NEUEN HAFEN ZU STEUERN. UNTERNEHMENSNACHFOLGE NUR WER WEISS, WO DAS ZIEL SEINER REISE IST, KANN AUCH DIE SEGEL RICHTIG
GEMEINSAM MIT IHNEN SETZEN WIR DIE SEGEL, UM IHR LEBENSWERK SACHTE UND SICHER IN EINEN NEUEN HAFEN ZU STEUERN. UNTERNEHMENSNACHFOLGE NUR WER WEISS, WO DAS ZIEL SEINER REISE IST, KANN AUCH DIE SEGEL RICHTIG
Logistikmanagement aus Kundensicht, ein unterschätztes Potenzial
 Logistikmanagement aus Kundensicht, ein unterschätztes Potenzial INHALTSVERZEICHNIS INHALT MANAGEMENT DES NETZWERKS LOGISTIKPROZESSE TRANSPARENZ INOS JG CONSULTING Management des Supply-Netzwerks Logistikprozesse
Logistikmanagement aus Kundensicht, ein unterschätztes Potenzial INHALTSVERZEICHNIS INHALT MANAGEMENT DES NETZWERKS LOGISTIKPROZESSE TRANSPARENZ INOS JG CONSULTING Management des Supply-Netzwerks Logistikprozesse
Fachkaufmann für Einkauf & Logistik
 Fachkaufmann für Einkauf & Logistik w w w. D e n n y K o e l l i n g. d e Seite 1 w w w. D e n n y K o e l l i n g. d e Seite 2 w w w. D e n n y K o e l l i n g. d e Seite 3 w w w. D e n n y K o e l l
Fachkaufmann für Einkauf & Logistik w w w. D e n n y K o e l l i n g. d e Seite 1 w w w. D e n n y K o e l l i n g. d e Seite 2 w w w. D e n n y K o e l l i n g. d e Seite 3 w w w. D e n n y K o e l l
etutor Benutzerhandbuch XQuery Benutzerhandbuch Georg Nitsche
 etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
Empathisches CRM. (Empathic CRM) Sven Bruck, die dialogagenten. die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH Katernberger Straße 4 42115 Wuppertal
 Empathisches CRM (Empathic CRM) Sven Bruck, die dialogagenten die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH Katernberger Straße 4 42115 Wuppertal +49 (0)202. 371 47 0 crmpathy@die-da.com www.die-da.com
Empathisches CRM (Empathic CRM) Sven Bruck, die dialogagenten die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH Katernberger Straße 4 42115 Wuppertal +49 (0)202. 371 47 0 crmpathy@die-da.com www.die-da.com
Abschluss Version 1.0
 Beschreibung Der Abschluss wird normalerweise nur einmal jährlich durchgeführt. Dieses Tech-Note soll helfen, diesen doch seltenen aber periodisch notwendigen Vorgang problemlos durchzuführen. Abschlussvarianten
Beschreibung Der Abschluss wird normalerweise nur einmal jährlich durchgeführt. Dieses Tech-Note soll helfen, diesen doch seltenen aber periodisch notwendigen Vorgang problemlos durchzuführen. Abschlussvarianten
Erfolgsfaktoren der Handelslogistik. Ergebnisse der BVL-Studie Logistik im Handel Strukturen, Erfolgsfaktoren, Trends
 Erfolgsfaktoren der Handelslogistik Ergebnisse der BVL-Studie Logistik im Handel Strukturen, Erfolgsfaktoren, Trends Die Studie Logistik im Handel Inhalte der Studie: Landkarte des deutschen Handels Bedeutung
Erfolgsfaktoren der Handelslogistik Ergebnisse der BVL-Studie Logistik im Handel Strukturen, Erfolgsfaktoren, Trends Die Studie Logistik im Handel Inhalte der Studie: Landkarte des deutschen Handels Bedeutung
SWOT-Analyse. Der BABOK V2.0 (Business Analysis Body Of Knowledge) definiert die SWOT-Analyse wie folgt:
 SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und wurde in den 1960er-Jahren von der Harvard Business School zur Anwendung in Unternehmen vorgeschlagen. Die SWOT-Analyse
SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und wurde in den 1960er-Jahren von der Harvard Business School zur Anwendung in Unternehmen vorgeschlagen. Die SWOT-Analyse
Sicherheit und Gesundheit in Kleinbetrieben Die Schlüssel zum Erfolg
 Sicherheit und Gesundheit in Kleinbetrieben Die Schlüssel zum Erfolg Zehn Empfehlungen für eine erfolgreiche Präventionsarbeit im Betrieb Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Beschäftigte Die Verhütung
Sicherheit und Gesundheit in Kleinbetrieben Die Schlüssel zum Erfolg Zehn Empfehlungen für eine erfolgreiche Präventionsarbeit im Betrieb Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Beschäftigte Die Verhütung
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
ST Xenn Ihr Tor zur unkomplizierten
 ST Xenn Ihr Tor zur unkomplizierten und effizienten i Immobilienbewertung b Mitd durchdachten hten und praxiserprobten Lösungen, Bedienerfreundlichkeit und Verzahnung verschiedener Hilfsmittel auf Basis
ST Xenn Ihr Tor zur unkomplizierten und effizienten i Immobilienbewertung b Mitd durchdachten hten und praxiserprobten Lösungen, Bedienerfreundlichkeit und Verzahnung verschiedener Hilfsmittel auf Basis
Lineare Funktionen. 1 Proportionale Funktionen 3 1.1 Definition... 3 1.2 Eigenschaften... 3. 2 Steigungsdreieck 3
 Lineare Funktionen Inhaltsverzeichnis 1 Proportionale Funktionen 3 1.1 Definition............................... 3 1.2 Eigenschaften............................. 3 2 Steigungsdreieck 3 3 Lineare Funktionen
Lineare Funktionen Inhaltsverzeichnis 1 Proportionale Funktionen 3 1.1 Definition............................... 3 1.2 Eigenschaften............................. 3 2 Steigungsdreieck 3 3 Lineare Funktionen
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Technik Wirtschaft Sozialwesen. Projektarbeit
 Hochschule Ravensburg-Weingarten Technik Wirtschaft Sozialwesen Projektarbeit Entwicklung eines Reitmoduls mit Reitstundenverwaltung für eine existierende Homepage eines Reitvereins vorgelegt von: Tobias
Hochschule Ravensburg-Weingarten Technik Wirtschaft Sozialwesen Projektarbeit Entwicklung eines Reitmoduls mit Reitstundenverwaltung für eine existierende Homepage eines Reitvereins vorgelegt von: Tobias
Universal Gleismauer Set von SB4 mit Tauschtextur u. integrierten Gleismauerabschlüssen!
 Stefan Böttner (SB4) März 2013 Universal Gleismauer Set von SB4 mit Tauschtextur u. integrierten Gleismauerabschlüssen! Verwendbar ab EEP7.5(mitPlugin5) + EEP8 + EEP9 Abmessung: (B 12m x H 12m) Die Einsatzhöhe
Stefan Böttner (SB4) März 2013 Universal Gleismauer Set von SB4 mit Tauschtextur u. integrierten Gleismauerabschlüssen! Verwendbar ab EEP7.5(mitPlugin5) + EEP8 + EEP9 Abmessung: (B 12m x H 12m) Die Einsatzhöhe
Bedienung des Web-Portales der Sportbergbetriebe
 Bedienung des Web-Portales der Sportbergbetriebe Allgemein Über dieses Web-Portal, können sich Tourismusbetriebe via Internet präsentieren, wobei jeder Betrieb seine Daten zu 100% selbst warten kann. Anfragen
Bedienung des Web-Portales der Sportbergbetriebe Allgemein Über dieses Web-Portal, können sich Tourismusbetriebe via Internet präsentieren, wobei jeder Betrieb seine Daten zu 100% selbst warten kann. Anfragen
MSXFORUM - Exchange Server 2003 > SMTP Konfiguration von Exchange 2003
 Page 1 of 8 SMTP Konfiguration von Exchange 2003 Kategorie : Exchange Server 2003 Veröffentlicht von webmaster am 25.02.2005 SMTP steht für Simple Mail Transport Protocol, welches ein Protokoll ist, womit
Page 1 of 8 SMTP Konfiguration von Exchange 2003 Kategorie : Exchange Server 2003 Veröffentlicht von webmaster am 25.02.2005 SMTP steht für Simple Mail Transport Protocol, welches ein Protokoll ist, womit
Outlook. sysplus.ch outlook - mail-grundlagen Seite 1/8. Mail-Grundlagen. Posteingang
 sysplus.ch outlook - mail-grundlagen Seite 1/8 Outlook Mail-Grundlagen Posteingang Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zum Posteingang zu gelangen. Man kann links im Outlook-Fenster auf die Schaltfläche
sysplus.ch outlook - mail-grundlagen Seite 1/8 Outlook Mail-Grundlagen Posteingang Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zum Posteingang zu gelangen. Man kann links im Outlook-Fenster auf die Schaltfläche
Prozessanalyse und -optimierung. Die Beratungsleistung der Dr. Peter & Company AG
 Prozessanalyse und -optimierung Die Beratungsleistung der Dr. Peter & Company AG Warum müssen bestehende Prozesse kontinuierlich überprüft werden? Prozess (DIN EN ISO 9000:2000)... ist ein Satz von Wechselbeziehung
Prozessanalyse und -optimierung Die Beratungsleistung der Dr. Peter & Company AG Warum müssen bestehende Prozesse kontinuierlich überprüft werden? Prozess (DIN EN ISO 9000:2000)... ist ein Satz von Wechselbeziehung
Mitteilung zur Kenntnisnahme
 17. Wahlperiode Drucksache 17/1319 14.11.2013 Mitteilung zur Kenntnisnahme Leitlinien für einen standardisierten IT-Arbeitsplatz offen und Zukunftsorientiert Drucksachen 17/1077 Neu und 17/0996 und Zwischenbericht
17. Wahlperiode Drucksache 17/1319 14.11.2013 Mitteilung zur Kenntnisnahme Leitlinien für einen standardisierten IT-Arbeitsplatz offen und Zukunftsorientiert Drucksachen 17/1077 Neu und 17/0996 und Zwischenbericht
Leseauszug DGQ-Band 14-26
 Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Was beinhaltet ein Qualitätsmanagementsystem (QM- System)?
 Was ist DIN EN ISO 9000? Die DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 (kurz ISO 9000) ist eine weltweit gültige Norm. Diese Norm gibt Mindeststandards vor, nach denen die Abläufe in einem Unternehmen zu gestalten sind,
Was ist DIN EN ISO 9000? Die DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 (kurz ISO 9000) ist eine weltweit gültige Norm. Diese Norm gibt Mindeststandards vor, nach denen die Abläufe in einem Unternehmen zu gestalten sind,
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN
 PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
V e r s i o n 3. 0 2 6. 0 2. 2 0 0 9
 LIEFERANTENDOKUMENTATION RFQ DELUXE V e r s i o n 3. 0 2 6. 0 2. 2 0 0 9 Schnelle, medienbruchfreie Prozesse steigern nicht nur die Effizienz sondern auch die Qualität der gesamten Kommunikation zwischen
LIEFERANTENDOKUMENTATION RFQ DELUXE V e r s i o n 3. 0 2 6. 0 2. 2 0 0 9 Schnelle, medienbruchfreie Prozesse steigern nicht nur die Effizienz sondern auch die Qualität der gesamten Kommunikation zwischen
10 IDG (Gesetz über die Information und den Datenschutz, LS 170.4) 24 IDV (Verordnung über die Information und den Datenschutz, LS 170.
 M erkblatt Vorabkontrolle 1 Einleitung Öffentliche Organe des Kantons Zürich müssen Projekte und Vorhaben dem Datenschutzbeauftragten zur Prüfung unterbreiten, wenn diese Datenbearbeitungen beinhalten,
M erkblatt Vorabkontrolle 1 Einleitung Öffentliche Organe des Kantons Zürich müssen Projekte und Vorhaben dem Datenschutzbeauftragten zur Prüfung unterbreiten, wenn diese Datenbearbeitungen beinhalten,
AGB Teil 5 - Support. Supportleistungen, Supportpakete, Supportverträge
 Thema AGB Teil 5 - Support Letzte Anpassung 17. Dezember 2013 Status / Version Final - V 1.0 Supportleistungen, Supportpakete, Supportverträge Summary Erstellung Dieser Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingen
Thema AGB Teil 5 - Support Letzte Anpassung 17. Dezember 2013 Status / Version Final - V 1.0 Supportleistungen, Supportpakete, Supportverträge Summary Erstellung Dieser Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingen
Schnelleinstieg in die (cs) AuftragPro
 Schnelleinstieg in die (cs) AuftragPro Starten der Anwendung Entpacken Sie das herunter geladene Archiv. Der entstandene Ordner (cs) AuftragPro enthält alle benötigten Komponenten der Anwendung. Öffnen
Schnelleinstieg in die (cs) AuftragPro Starten der Anwendung Entpacken Sie das herunter geladene Archiv. Der entstandene Ordner (cs) AuftragPro enthält alle benötigten Komponenten der Anwendung. Öffnen
Transferprojekt zum Projektmanagement Fachmann /-frau GPM/IPMA Level D
 Wirtschaft Gertraud Köppl Transferprojekt zum Projektmanagement Fachmann /-frau GPM/IPMA Level D (BSC) Examensarbeit Transferprojekt zum Projektmanagement Fachmann /-frau GPM/IPMA Level D Entwicklung
Wirtschaft Gertraud Köppl Transferprojekt zum Projektmanagement Fachmann /-frau GPM/IPMA Level D (BSC) Examensarbeit Transferprojekt zum Projektmanagement Fachmann /-frau GPM/IPMA Level D Entwicklung
Kapitel 1: Einrichten der Kostenrechnung. Kanzleientwicklungsdialog, Stand 04 11, DATEV Seite 1 von 8
 Welchen Mandanten können Sie eine Kostenrechnung anbieten und wie gestalten Sie diese? Sie möchten einem Mandanten eine Kostenrechnung anbieten. Vor allem Unternehmen mit mehreren Standorten oder einem
Welchen Mandanten können Sie eine Kostenrechnung anbieten und wie gestalten Sie diese? Sie möchten einem Mandanten eine Kostenrechnung anbieten. Vor allem Unternehmen mit mehreren Standorten oder einem
Umfrage: Ihre Erwartungen, Ihr Bedarf und der aktuelle Einsatz von Informationstechnologie (IT) in Ihrem Unternehmen
 Umfrage: Ihre Erwartungen, Ihr Bedarf und der aktuelle Einsatz von Informationstechnologie (IT) in Ihrem Unternehmen A.1 Welche Funktion bekleiden Sie in Ihrem Unternehmen? A.2 Sind Sie entscheidungsbefugt
Umfrage: Ihre Erwartungen, Ihr Bedarf und der aktuelle Einsatz von Informationstechnologie (IT) in Ihrem Unternehmen A.1 Welche Funktion bekleiden Sie in Ihrem Unternehmen? A.2 Sind Sie entscheidungsbefugt
Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
 Wenn der Kunde Verbraucher ist, steht ihm das nachfolgende Widerrufsrecht zu. Ein Kunde ist Verbraucher, wenn das in Rede stehende Rechtsgeschäft (z.b. Bestellung der Ware(n) aus dem Warenkorb) zu einem
Wenn der Kunde Verbraucher ist, steht ihm das nachfolgende Widerrufsrecht zu. Ein Kunde ist Verbraucher, wenn das in Rede stehende Rechtsgeschäft (z.b. Bestellung der Ware(n) aus dem Warenkorb) zu einem
