2.1.2 Physiologie der Glukosehomöostase während der Schwangerschaft
|
|
|
- Cornelius Bruhn
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 2. Einleitung 2.1 Gestationsdiabetes Definition Als Gestationsdiabetes (GDM) gilt jede erstmals in der Schwangerschaft aufgetretene oder diagnostizierte Glukosetoleranzstörung. Diese Definition schließt die Möglichkeit der Erstmanifestation eines Typ-1 oder Typ-2- Diabetes mellitus während der Schwangerschaft ebenso ein wie präkonzeptionell bestehende, aber bislang nicht diagnostizierte Fälle von Typ- 2- Diabetes mellitus. Abhängig von untersuchter ethnischer Population, methodischem Vorgehen sowie verwendeter diagnostischer Kriterien sind die Angaben zur Häufigkeit des Auftretens des GDM sehr unterschiedlich. Die Angaben schwanken von < 1 % bis zu 20 %. Im Mittel kann von einer Inzidenz des GDM von 1 3 % aller Schwangerschaften ausgegangen werden (Damm 1998). Der Anteil des GDM an allen Schwangerschaften mit Diabetes beläuft sich auf 90 %, die restlichen zehn Prozent betreffen Schwangere, die bereits präkonzeptionell an einem Diabetes mellitus erkrankt waren (Coustan 1995) Physiologie der Glukosehomöostase während der Schwangerschaft GDM ist pathogenetisch zurückzuführen auf eine Insulinresistenz v.a. im zweiten und dritten Trimenon der Schwangerschaft, die zu einem relativen Insulinmangel, also einem Ungleichgewicht zwischen der endogenen Produktion und dem Bedarf an Insulin, führen kann. Der erhöhte Bedarf an Insulin lässt sich erklären durch die physiologischerweise während der Schwangerschaft ansteigenden Konzentrationen von Insulinantagonisten im mütterlichen Organismus. Zu diesen zählt neben Kortison, Progesteron, Prolaktin und dem humanen Plazentalaktogen (hpl) auch das aus dem Fettgewebe und der Plazenta stammende Hormon Leptin. Dem durch die Insulinresistenz hervorgerufenen erhöhten Blutglukosespiegel wird durch eine Mehrausschüttung von Insulin durch die ß- Zellen des Pankreas entgegenzuwirken versucht. Erst wenn die Kapazität der ß- Zellen erschöpft ist und eine Kompensation unmöglich wird, manifestiert sich der GDM. 7
2 2.1.3 Risikofaktoren für die Entstehung eines GDM Mütterliche Faktoren, die die Entstehung eines GDM begünstigen, sind zu einem Teil der Anamnese zu entnehmen. Zu diesen zählen das Übergewicht (BMI präkonzeptionell > 27 kg/ m²) sowie neben der familiären diabetischen Vorbelastung der Schwangeren v.a. durch Verwandte ersten Grades auch vorausgegangene Schwangerschaften mit GDM sowie die Geburt makrosomer Kinder (> 90. Perzentile des dem Gestationsalter entsprechenden Geburtsgewichtes). Auch ein Alter der Patientin von über 35 Jahren, habituelle Abortneigung, Kinder mit schweren kongenitalen Fehlbildungen oder Totgeburten sind als Risikofaktoren zu werten. Des weiteren sind bestimmte ethnische Gruppen überdurchschnittlich häufig betroffen; zu diesen gehören u.a. Amerikaner mexikanischen Ursprungs, Schwarzafrikaner und Süd- sowie Ostasiaten. Faktoren in der laufenden Schwangerschaft, die ein erster Hinweis auf die Entwicklung eines GDM sein können, sind eine Glukosurie, eine übermäßige Gewichtszunahme der Mutter sowie die sonografisch bestimmte fetale Makrosomie. Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Schwangerschaft mit einem GDM in einer weiteren Schwangerschaft erneut einen solchen zu entwickeln, wird in der Literatur zwischen 30 und 69 % angegeben. MacNeill fand an einem kanadischen Kollektiv eine Wiederholungsrate von 35,6 %. Als entscheidende Faktoren wurden hierbei das Geburtsgewicht des Kindes der vorausgegangenen Schwangerschaft mit GDM sowie das Ausgangsgewicht der Schwangeren vor der nachfolgenden Schwangerschaft angegeben (MacNeill 2001). Als prädiktive Faktoren für weitere Schwangerschaften mit GDM gelten auch eine frühe Diagnosestellung des GDM im ersten Trimenon der vorausgegangenen Schwangerschaft sowie die Notwendigkeit einer Insulintherapie in derselben (Major 1998) Diagnose des GDM Die Diagnostik des GDM basiert auf den Ergebnissen des standardisierten oralen Glukosetoleranztestes (ogtt), wobei die diagnostischen Kriterien jedoch international nicht einheitlich und mitunter schwer vergleichbar sind. 8
3 Entscheidend ist das Auftreten von mindestens zwei pathologischen Werten nach einer 75g- Glukosebelastung gemäß den Originaldaten von O Sullivan. Diese galten ursprünglich jedoch für eine Belastung mit 100 g Glukose und die Messung in venösem Vollblut (O Sullivan/ Mahan 1964): Tab. 2.1 GDM- Grenzwerte nach O Sullivan/ Mahan Messzeitpunkt Glukose (mg/dl) (mmol/l) nüchtern 90 5,0 nach 1 h 165 9,2 nach 2 h 145 8,1 nach 3 h 125 7,0 Die von O Sullivan 1964 entwickelten und etablierten Grenzwerte richteten sich allein nach dem maternalen Risiko, später im Leben einen Diabetes - meist vom Typ 2 - zu entwickeln. Für die kindliche perinatale Morbidität, die im Zentrum des Interesses des Geburtshelfers steht, ist die Sensitivität der Grenzwerte jedoch fraglich (Weiss 1998). Die Originalwerte von 1964 werden heute in verschiedenen Umrechnungen und Anpassungen verwendet, abhängig von Messmethode und Material (Somogyi- Nelson- Methode im venösen Vollblut vs. Glukoseoxydase- bzw. Hexokinase- Methode im venösen Plasma/ Serum). Sich stützend auf Beobachtungen außerhalb der Schwangerschaft wurden für die Kriterien der National Diabetes Data Group (NDDG) für Glukosemessungen im Plasma bzw. Serum die Originalwerte O Sullivans, die auf Messungen in venösem Vollblut basierten, um einen Faktor von + 13 % korrigiert. Eine Reduktion dieser Grenzwerte um 5 % ergab sich aus der Berücksichtigung der methodischen Unterschiede der neueren und als glukosespezifisch anzusehenden Glukoseoxydase- bzw. Hexokinase- Methode. Diese Grenzwerte wurden bis 1997 von der American Diabetes Association (ADA) verwendet. Nach 1997 fanden Ergebnisse von Carpenter und Coustan aus dem Jahr 1982 Beachtung, die die Hämodilution während der Schwangerschaft einbezogen und die bisher gültigen Schwellenwerte für Plasmaglukosebestimmungen wie folgt nach unten korrigierten (Carpenter et al. 1982): Tab. 2.2 GDM- Grenzwerte nach Carpenter/ Coustan Messzeitpunkt Glukose (mg/dl) (mmol/l) nüchtern 95 5,3 nach 1 h ,0 nach 2 h 155 8,6 nach 3 h 140 7,8 9
4 Hierbei handelt es sich um die derzeit am Weitesten verbreitete Modifikation der Originalwerte von O Sullivan. Die Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie des GDM der Deutschen Diabetesgesellschaft (DDG) aus dem Jahre 2001 übernahmen diese Grenzwerte: Tab. 2.3 GDM- Grenzwerte DDG Glukose Messzeitpunkt kapilläres Vollblut venöses Plasma (mg/dl) (mmol/l) (mg/ dl) (mmol/l) nüchtern 90 5,0 95 5,3 nach 1 h , ,0 nach 2 h 155 8, , Screeningverfahren In Deutschland ist in der Mutterschaftsvorsorge bislang kein generelles Screening auf GDM vorgesehen, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Fällen unerkannt bleibt. Diese liegt Untersuchungen von Coustan zufolge bei 50%. Sowohl von der Deutschen Diabetesgesellschaft als auch von der American Diabetes Association wird ein generelles Screening bei allen Schwangeren befürwortet. Alternativ zur einzeitigen Untersuchung, bei der bei allen Schwangeren zwischen der vollendeten 24. und 28. Schwangerschaftswoche ein 75g- ogtt durchgeführt wird, bietet sich das zweizeitige Vorgehen an. Bei diesem wird ebenfalls zwischen der vollendeten 24. und 28. Schwangerschaftswoche zunächst ein 50g- Glukose- Screening- Test durchgeführt, der bei pathologischem Ausfall durch einen 75g- ogtt komplettiert wird (Deutsche Diabetesgesellschaft 2001). Im Gegensatz zum 75g- ogtt kann der 50g- Glukose- Belastungstest unabhängig von der vorausgegangenen Nahrungszufuhr, also auch im nicht nüchternen Zustand, durchgeführt werden. Der Verdacht auf das Vorliegen eines GDM wird geäußert bei Blutglukosewerten, die eine Stunde nach dem Ende des Trinkens der Testlösung über 140 mg/ dl (7,8 mmol/ l) liegen, und muss in der Folge durch einen 75g- ogtt bestätigt oder aber entkräftet werden. Bei einem Wert 200 mg/ dl (11,1 mmol/ l) ist ein Nüchternwert von > 90 mg/ dl (5, 0 mmol/ l) im kapillären Vollblut bzw. > 95 mg/ dl (5,3 mmol/l ) im venösen Plasma ausreichend, um die Diagnose GDM ohne Durchführung eines ogtt zu stellen (DDG 2001). 10
5 Bei Schwangeren mit hohem Risiko für einen GDM, z.b. bei Adipositas, familiärer Belastung, vorausgegangenen Schwangerschaften mit GDM oder Z.n. Geburt eines makrosomen Kindes, sollte das Screening bereits in der Frühschwangerschaft durchgeführt und bei negativem Ausfall später wiederholt werden (DDG 2001). Weiss hingegen propagiert die Diagnosestellung basierend auf einem 75g- ogtt aus Kapillarblut mit einem Einstundengrenzwert von 160 mg Glukose/ dl (8,9 mmol/ l) als Methode, um das Risiko für das Auftreten eines fetalen Hyperinsulinismus zu erkennen. Bei diabetischen Schwangerschaften korrelierten der fetale Hyperinsulinismus und das Geburtsgewicht des Kindes seinen Studien zufolge am besten mit den postprandialen 1h- Werten. Bei einem 1h- Wert über 160 mg/ dl konnte er bei 8 % der Feten erhöhte Insulinwerte im Fruchtwasser nachweisen (Weiss 1998) Therapie Ziel der Therapie des GDM ist die Vermeidung v.a. fetaler Komplikationen. Sie baut auf folgenden vier Säulen auf: Ernährungsumstellung, Bewegung, Blutzuckerselbstkontrolle und Insulinapplikation. Normalgewichtige Gestationsdiabetikerinnen erhalten eine Ernährungsberatung und eine Kostverordnung mit einem Energiegehalt von 30 kcal/ kg Körpergewicht. Bei bestehendem Übergewicht (BMI > 27 kg/ m²) erfolgt eine Reduktion auf 25 kcal/ kg Körpergewicht. Anhand von jeweils zwei wöchentlich durchgeführten Blutzuckertagesprofilen wird ermittelt, ob durch Diät allein bei der betroffenen Patientin das Einstellungsziel, die Normoglykämie, erreicht werden kann. Dies ist der Fall bei Einhaltung folgender Zielwerte im kapillären Vollblut (DDG 2001): Tab. 2.4 Zielwerte Normoglykämie Messzeitpunkt Glukose (mg/dl) (mmol/l) nüchtern < 90 < 5,0 1 h pp < 140 < 7,8 2 h pp < 120 < 6,7 Körperliche Aktivität wirkt sowohl durch den Verbrauch von Glukose als Substrat für die Energiegewinnung als auch durch die Verbesserung der Insulinsensitivität unterstützend auf die Senkung der Blutzuckerwerte. Führen die genannten konservativen Maßnahmen nicht zu einem befriedigenden Ergebnis, ist die Indikation für eine medikamentöse Therapie, in erster Linie einer Insulintherapie, zu 11
6 stellen. Inzwischen sprechen umfangreiche Studiendaten auch einer oralen Therapie mit dem Biguanid Metformin, auch in Kombination mit einer Insulintherapie, eine Anwendungsberechtigung zu, die bislang jedoch keine Aufnahme in die aktuellen Leitlinien der DDG gefunden hat. Bei grenzwertig erhöhten Blutzuckerwerten kann eine Insulintherapie in Erwägung gezogen werden, wenn der fetale Abdominalumfang im Ultraschall als Zeichen für das Vorliegen einer Makrosomie die 90. Perzentile nach Hadlock überschreitet (Buchanan/ Kjos 1994). Andererseits kann bei normalem fetalem Wachstum bei moderater Hyperglykämie der Mutter auf eine Insulintherapie verzichtet werden (Kjos 2001, Schaefer- Graf 2004) Folgen für die Mutter Im Vergleich mit einer Normalpopulation ist das Risiko für Harnwegsinfektionen bei Gestationsdiabetikerinnen erhöht. Diese wiederum können zu vorzeitiger Wehentätigkeit und erhöhter Frühgeburtlichkeit führen. Weitere akute Komplikationen durch den GDM sind die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie sowie die Präeklampsie und die Eklampsie. Das erhöhte Risiko kann hierbei zum Teil durch die zugrundeliegenden mütterlichen Risikofaktoren für GDM, wie höheres Alter und Adipositas, erklärt werden. Auch kann eine erhöhte Rate an Sectiones und an vaginal- operativen Entbindungen beobachtet werden. Die Kaiserschnittrate bei Schwangeren mit GDM wurde von Persson et al. als 1,6 mal so hoch wie in dem nichtdiabetischenvergleichskollektiv angegeben (Persson et al. 1998). Als Langzeitfolgen bekannt ist das Risiko, in der folgenden Schwangerschaft erneut einen GDM zu entwickeln; dieses belief sich in verschiedenen Studien auf %, abhängig von verschiedenen prädiktiven Faktoren (siehe auch 2.1.3: Risikofaktoren für die Entstehung eines GDM). Auch das Risiko, frühzeitig an einem Diabetes mellitus - vorwiegend vom Typ 2 - zu erkranken, ist signifikant erhöht und beträgt innerhalb von zehn Jahren 40 bis 50 % (DDG 2001). Besonders gefährdet sind Frauen, die übergewichtig sind, bei denen während oder auch kurz nach der Schwangerschaft eine schwere Hyperglykämie bestand und bei denen die Diagnose GDM bereits vor der 24. SSW gestellt worden war (Kjos 1999). Alle Frauen mit während der Schwangerschaft bestehender IGT oder GDM sollen sich erstmals sechs bis zwölf Wochen nach der Entbindung und in der Folge in maximal 12
7 zweijährlichen Abständen einem erneuten 75g ogtt unterziehen, um eine eventuell postpartal weiterhin bestehende oder wieder aufgetretene Störung der Glukosetoleranz frühzeitig aufdecken zu können und einer Behandlung zugänglich zu machen Folgen für das Kind Die maternale Hyperglykämie führt über die transplazentare Substratzufuhr zu einer fetalen Hyperglykämie, die am fetalen Pankreas eine Hypertrophie und Hyperplasie der β- Zellen und in der Folge eine gesteigerte Insulinproduktion hervorruft ( Pedersen- Hypothese ). Neben der direkten Wachstumsstimulation durch den fetalen Hyperinsulinismus kommt es zudem zu einer gesteigerten Akkumulation von Glykogen in der Leber sowie zu einer erhöhten Synthese von Triglyceriden in den Fettzellen und Umwandlung von Aminosäuren zu Proteinen, in deren Folge es zur Insulinmast mit einem disproportionierten Wachstum der insulinsensitiven Gewebe wie Leber, Milz, Herzmuskel und subkutanem Fettgewebe kommt. Zahlreiche der neonatalen Komplikationen lassen sich direkt oder indirekt mit der maternalen Hyperglykämie und dem konsekutiven fetalen Hyperinsulinismus in Verbindung bringen. Als Folge der mütterlichen Hyperglykämie kommt es zur vermehrten Entstehung von Sauerstoff- Radikalen. Als Konsequenz ist die Fehlbildungsrate erhöht, wobei das Risiko schwerer Fehlbildungen mit den mütterlichen Blutzuckerwerten steigt. Dies betrifft jedoch primär Schwangere mit einem vorbestehenden Typ 1- oder Typ 2- Diabetes mellitus. Bei Gestationsdiabetikerinnen hingegen ist lediglich bei einem bei Diagnosestellung hohen Nüchtern- Blutzuckerwert mit einer erhöhten Fehlbildungsrate zu rechnen. Klassisches Zeichen der diabetischen Fetopathie ist die Makrosomie, deren Inzidenz wie bereits beschrieben bei diabetischen Schwangerschaften deutlich erhöht angegeben wird. Die Makrosomie kann unter der Geburt vermehrt zu Traumata mit Schulterdystokie, Klavikulafraktur und oberer Plexusparese führen. Gleichzeitig kann sie eine Protrahierung des Geburtsverlaufes bewirken, wodurch das Risiko für eine fetale Asphyxie ebenso wie für eine operative Entbindung steigt. Wird bei der Definition der Makrosomie lediglich das Geburtsgewicht berücksichtigt, so wird unabhängig vom jeweiligen Gestationsalter der Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Entbindung ein Gewicht von 4000 g angenommen. Der im englischen Sprachraum gebräuchliche Begriff LGA (= large for gestational age) hingegen beschreibt ein 13
8 Geburtsgewicht, das oberhalb der an das Gestationsalter und das Geschlecht des Neugeborenen angepassten 90. Perzentile liegt, so dass falsch negative Befund bei Frühgeborenen vermieden werden können. Während das fetale Wachstum in der ersten Schwangerschaftshälfte weitgehend genetisch determiniert wird, entwickelt der Fetus in der zweiten Schwangerschaftshälfte ca. 95 % seines endgültigen Gewichtes auf der Grundlage der Substratumsetzung unter Einfluss von Hormonen wie Insulin und Insulin- ähnlichen Wachtstumsfaktoren (IGF), die somit für die Entwicklung eines gesteigerten intrauterinen Wachstums eine zentrale Rolle spielen. Postpartal bedarf die Hypoglykämie des Neugeborenen als direkte Folge des Hyperinsulinismus nach der Trennung der Glukosezufuhr durch die Mutter einer strengen Überwachung. Aufgrund der die Bildung von Surfactant in den Lungen antagonisierenden Wirkung von Insulin kann vermehrt ein Atemnotsyndrom beobachtet werden. Die Neugeborenen neigen weiterhin zu Polyzythämie, definiert als Hämatokritwert 65 % bzw. Hämoglobinwert 20 g/ dl, Hypocalciämie und Hypomagnesiämie sowie zu Hyperbilirubinämie infolge der Reifungsretardierung der enzymatischen Systeme der Leber. Auf lange Sicht erhöht ist das Risiko, bereits im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter eine Glukosetoleranzstörung oder eine Adipositas zu enwickeln (Persson 1998, Schaefer- Graf 2005). 2.2 Leptin Allgemeines Humanes Leptin ist ein 16 kda schweres, nicht glykosyliertes Polypeptid. Es wurde Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts durch Zhang et al. identifiziert, als nach einer Genmutation gesucht wurde, die bei Mäusen zu Übergewicht führte (Zhang 1994). Der Name Leptin entstammt dem Griechischen (leptós dünn) und wurde gewählt aufgrund der Fähigkeit des Gen- Produktes, Fettspeicher zu vermindern. Ein anderer gebräuchlicher Name ist ob- Protein, also das Produkt des ob- Gens (ob = obese = übergewichtig). Bei nichtschwangeren sowohl Menschen als auch Nagern wird Leptin fast ausschließlich in den Adipozyten des weißen Fettgewebes produziert und von diesen in die Zirkulation sezerniert. Das subkutane spielt im Vergleich zum viszeralen Fettgewebe dabei die Hauptrolle, da es 70 bis 14
9 80 % der Gesamtfettmasse des Körpers ausmacht. Die Sekretion erfolgt pulsatil und nach einem zirkadianen Rhythmus; die höchsten Werte können während der Nacht gemessen werden (Licino 1997). Im Blut zirkuliert Leptin sowohl gebunden an Plasma- Proteine, darunter auch die lösliche Form des Leptin- Rezeptors, als auch in freier Form. Als Zeichen der Sättigung der Leptinbindenden Proteine ist die freie Fraktion des Leptins bei Übergewichtigen erhöht (Houseknecht 1996). Frauen weisen höhere Serum- Leptinkonzentrationen auf als Männer mit vergleichbarem BMI. Dies wird darauf zurückgeführt, dass Frauen erstens einen höheren Körperfettanteil aufweisen als Männer und zweitens das Verhältnis von subkutanem zu viszeralem Fettgewebe bei Frauen signifikant höher ist als bei Männern (Rosenbaum 1996) Rolle von Leptin Auf funktioneller Ebene ist Leptin am besten bekannt durch seine Rolle in der Regulierung von Appetit und Energieverbrauch. Es konnte gezeigt werden, dass die Verabreichung hoher Dosen von Leptin an Nagetiere die aufgenommene Nahrungsmenge und die Fettspeicher des Körpers deutlich verminderte (Campfield 1996). Beim Menschen besteht eine starke positive Korrelation zwischen der Serumkonzentration von Leptin und dem vorhandenen Körperfett. Die Konzentration von Leptin im Serum spiegelt bei ausgeglichenem Verhältnis von Energieaufnahme und Energieabgabe die Menge an Triglyzeriden wieder, die im Körper als Fettgewebe gespeichert sind. Auch zwischen dem BMI (Body Mass Index: Körpergewicht / Körpergröße², Einheit: kg/ m² ) als indirektem Maß für den prozentualen Körperfettanteil und der Serumkonzentration von Leptin konnte ein positiver Zusammenhang gezeigt werden (Considine 1996). Ein wichtiger Faktor in der Regulation der Leptinproduktion scheint die Zellwandspannung der Fettzellen zu sein: Kleine Fettzellen exprimieren weniger ob- mrna als große Fettzellen desselben Individuums (Hamilton 1995). Mit steigender Spannung, verursacht durch die intrazelluläre Akkumulation von Lipiden, steigt auch die Transkriptionsrate des ob- Gens an (Caro 1996a). Es wird davon ausgegangen, dass der Reiz für die Ausschüttung von Leptin in der Größenzunahme der Fettzellen infolge übermäßiger Nahrungszufuhr besteht (Considine 1996). Große Fettzellen signalisieren dabei, dass eine weitere Energiezufuhr auf kurze Sicht nicht nötig ist, und zirkulierendes Leptin als Appetitsuppressor (= Adipostat) überwindet die Blut- Hirn- Schranke mit Hilfe eines Transportsystems (Banks 1996) und vermittelt dies an 15
10 die Areale des Hypothalamus, die in die Regulation von Appetit und Energiebalance involviert sind (Elmquist 1997). Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass Leptin die Freisetzung von u.a. Neuropeptid Y herabsetzt und so dessen Konzentration im Hypothalamus vermindert; Neuropeptid Y stimuliert die Nahrungsaufnahme und setzt die Thermogenese herab (Stephens 1995). Die Tatsache, dass die zirkulierenden Leptinspiegel nicht akut postprandial ansteigen, legt jedoch nahe, dass es sich bei Leptin nicht um ein typisches kurzfristiges Sättigungssignal handelt, das eine Beschränkung der weiteren Nahrungsaufnahme bewirkt (Considine 1996). Die Rolle von Leptin ließe sich eher beschreiben als ein langfristiger Sensor der Energiebalance des Körpers, indem es Aufnahme und Abgabe von Energie in ein Gleichgewicht zu bringen versucht (Caro 1996 a). Leptin spielt somit eine wichtige Rolle in der Homöostase des Körpergewichtes, indem es die Energieabgabe vermittelt über die Aktivität des sympathischen Nervensystems stimuliert, den Appetit unterdrückt und somit das Körpergewicht vermindert. Es ist aber nur einer von vielen Faktoren sowohl im Hirn als auch in der Körperperipherie, die in Gewichtshaushalt und Energiemetabolismus involviert sind. Die anfängliche Euphorie, mit der Entdeckung des fettschmelzenden Hormons Leptin der Möglichkeit nahe gekommen zu sein, die menschliche Adipositas zu besiegen, verflog mit der Feststellung, dass die bei der Mehrzahl der Adipösen bestehende Hyperleptinämie nicht zu dem erwarteten Effekt - Unterdrückung des Appetits und Senkung der aufgenommenen Nahrungsmenge - führte. Sie zeigten sich gegenüber dem endogen gebildeten Leptin resistent. Anders als bei Mäusen, bei denen sowohl eine fehlerhafte Produktion von Leptin als auch ein Leptin- Rezeptordefekt als verbreitete Ursachen für Übergewicht bekannt sind (Chen 1996), konnten beim Menschen nur bei einigen wenigen Individuen Mutationen des ob- Gens oder Rezeptorfehlfunktionen nachgewiesen werden (Clement 1996 und 1998, Montague 1997). Durch diese jedoch lässt sich nur ein kleines Segment der menschlichen Adipositas erklären. Ansätze für die Erklärung der Leptin- Resistenz bei Adipositas schreiben u.a. einem veränderten Transportmechanismus von Leptin an der Blut- Hirn- Schranke eine Bedeutung zu (Caro 1996 b). Erhöhte Serumleptinspiegel sind zu erwarten als Antwort auf eine andauernde übermäßige Nahrungs- und Energiezufuhr und in der Folge bei Adipositas sowie nach der Applikation von Glukokortikoiden (Papaspyrou- Rao 1997) oder Insulin, das einen trophischen Effekt auf die 16
11 Adipozyten ausübt (Dagogo- Jack 1996). Die Effekte des Insulins auf das Leptin- System werden dabei über die Fraktion des freien Leptins vermittelt (Lewandowski 2001). Hohe Insulinkonzentrationen interferieren zudem mit der Signaltransduktion des Leptins in den Insulin- sezernierenden Zellen des Pankreas. Die Hyperinsulinämie kann eine Leptinresistenz verursachen oder verstärken, indem sie auf molekularer Ebene die physiologischerweise als Antwort auf eine Hyperleptinämie auftretende Erhöhung der Insulinsekretionsrate aufhebt (Kellerer 2001). Anhand von Untersuchungen an Typ- 2- Diabetikern konnte gezeigt werden, dass eine Therapie mit Insulin höhere Leptinkonzentrationen im Blut mit sich bringt als ein Therapie mit oralen Antidiabetika (Widjaja 1997). Diese Ergebnisse lassen sich vereinbaren mit den Beobachtungen, dass hohe Insulinkonzentrationen die Produktion von Leptin durch die Adipozyten stimulieren können (Kolaczynski 1996a). Widjaja belegte weiterhin, dass Typ- 2- Diabetiker mit erhöhten Leptinkonzentrationen im Blut auch erhöhte Insulinkonzentrationen im Nüchternzustand aufwiesen, und zwar unabhängig von der gewählten Therapieform und dem BMI (Widjaja 1997). Erniedrigte Leptinwerte beobachtete man u.a. in Zeiten des Fastens, z.b. auch bei Anorexia nervosa, sowie bei Insulinmangelzuständen wie Diabetes mellitus Typ 1 (Kolaczynski 1996 b). Eine Reduktion des Körpersgewichtes um 10 % war assoziiert mit einer 50 prozentigen Senkung der Serumkonzentration von Leptin (Considine 1996). Leptin hat auch Funktionen unabhängig von der Regulation der Energiebalance inne. So konnte gezeigt werden, dass die Applikation von rekombinantem Leptin bei Mäusen, die selbst kein Leptin produzieren konnten und die infertil waren, zu einer zentralen Aktivierung der Achse Hypothalamus- Hypophyse- Gonaden führte und die Infertilität behob (Chehab 1996). Auch die Auslösung der Pubertät beim Menschen scheint unter Mitwirkung von Leptin zu geschehen (Mantzoros 1997). Des Weiteren spielt Leptin eine Rolle im Rahmen der Hämatopoese (Sivan 1997) Leptin in der Schwangerschaft Erhöhte zirkulierende Serumleptinkonzentrationen während der Schwangerschaft sind neben der Zunahme von Körpergewicht und Körperfettanteil sowohl bei der Mutter als auch beim 17
12 Fetus zurückzuführen auf eine plazentaeigene Synthese durch die Zellen des Trophoblasten v.a. des Synzytiotrophoblasten sowie des Amnionepithels (Señarís/ Masuzaki 1997). Dabei steigt der Anteil der freien Form des Leptins auf den doppelten Wert an, und es kommt zu Veränderungen der Konzentrationen der Leptin- bindenden Proteine. Die Zunahme des Leptins ist damit wesentlich höher, als es gemäß der durchschnittlichen Zunahme an Fettgewebe während der Schwangerschaft, die nach King auf 25 bis 30 % zu schätzen ist (King 1994), zu erwarten wäre (Lewandowski 1999). Des Weiteren lässt sich beobachten, dass der Anstieg der Leptinkonzentration dem Anstieg des BMI zum Ende des zweiten Trimenons hin vorausgeht, wodurch die These gestützt wird, dass die Plazenta während der Schwangerschaft zum primären Ort der Leptinsynthese wird. 95% des plazentaren Leptins werden in den mütterlichen Organismus sezerniert. Ein Zusammenhang zwischen dem mütterlichen Leptinlevel und der fetalen Fettmasse zum Geburtstermin hin lässt sich nicht beweisen, was impliziert, dass mütterliches Leptin die plazentare Schranke nicht zu einem nennenswerten Anteil passiert (Smith 2003). Im Gegensatz zu dem durch das weiße Fettgewebe produzierten Leptin scheint das in der Plazenta synthetisierte Leptin nicht durch Insulin beeinflußt zu werden (Sivan 1998). Im ersten Schwangerschaftsdrittel zeigten sich im Vergleich mit einer nichtschwangeren Kontrollgruppe signifikant erhöhte Leptinserumkonzentrationen, die ihr Maximum beim Übergang zum zweiten Trimenon erreichten und zur Entbindung hin zwar leicht abfielen, aber dennoch auf hohem Niveau blieben (Kautzky- Willer 2001). Die stark erhöhten zirkulierenden Leptinkonzentrationen legten die Vermutung nahe, dass der Energieumsatz im Laufe der Schwangerschaft zu Gunsten des Feten zunehmen soll (Highman 1997). Es kommt zu einer verstärkten Mobilisation mütterlicher Fettspeicher und somit zu einem erhöhten Substratangebot an den Feten (Okereke 2004). Während der Geburt war die Leptinkonzentration im maternalen Serum signifikant höher als als die im Nabelschnurblut. Eine Korrelation zwischen diesen beiden bestand nicht (Schubring 1997). Bereits 24 Stunden nach der Geburt der Plazenta wurden maternale Leptinserumwerte gemessen, die unterhalb derer des ersten Trimenons lagen (Masuzaki 1997). Leptin agiert während der Schwangerschaft also unabhängig vom Körpergewicht als ein humorales Signal der Plazenta auf Mutter und Fetus. Im Gegensatz zu den Beobachtungen außerhalb der Schwangerschaft konnte ein Zusammenhang zwischen dem maternalen BMI und der Leptinkonzentration im Serum 18
13 während der Schwangerschaft nicht belegt werden (Masuzaki 1997). Untersuchungen von Schubring zufolge sinkt die Korrelation zwischen dem Leptinspiegel und dem BMI der Schwangeren mit der Dauer der Schwangerschaft mit nurmehr geringer Korrelation zum Zeitpunkt der Geburt (Schubring 1998). Zu erklären ist dies dadurch, dass der BMI während der Schwangerschaft ein nur ungenaues Maß für die Fettspeicher des Körpers darstellt, da er neben den Gewichten von Fetus, Plazenta und Fruchtwasser auch die mütterliche Volumenexpansion unbeachtet lässt (Lewandowski 1998). In vitro konnte ein stimulierender Effekt von Östrogen und hcg auf das Fettgewebe gezeigt werden, der zu einer gesteigerten Synthese von Leptin führte. Progesteron und hpl hingegen übten diesen Effekt nicht aus. Im klinischen Versuch jedoch konnte ein signifikante Korrelation nur zwischen Leptin und Kortison, nicht aber zwischen Leptin und den oben genannten Hormonen beobachtet werden (Sivan 1998). Wie bei Typ- 2- Diabetikern konnten auch bei Gestationsdiabetikerinnen höhere Serumleptinspiegel gemessen werden als bei Frauen mit normaler Glukosetoleranz, und zwar sowohl während der Schwangerschaft als auch nach Beendigung derselben (Schubring 1997). Auch die Konzentration des löslichen Leptin- Rezeptors war in diabetischen gegenüber normalen Schwangerschaften erhöht und positiv korreliert mit dem Insulin- Bedarf innerhalb von 24 Stunden (Lewandowski 1999). Bedenkt man, dass der lösliche Leptinrezeptor mit hoher Affinität an Leptin bindet und sein Vorhandensein die Bindung von Leptin an Membranrezeptoren und somit die Entfaltung der Wirkung von Leptin unterbinden kann, könnte dies von Bedeutung sein für die Entwicklung der Leptin- Resistenz bei Diabetikern (Liu 1997). 19
dass eine Korrelation mit der Leptinkonzentration im maternalen Blut jedoch fehlt (Tamura 1998). Dies weist darauf hin, dass der fetale Leptinmetaboli
 5. Diskussion Die fetale Makrosomie, ein übersteigertes intrauterines Wachstum des Feten, ist das klassische Zeichen der Fetopathia diabetica. Ihre Entstehung ist in den letzten Jahren in diversen Studien
5. Diskussion Die fetale Makrosomie, ein übersteigertes intrauterines Wachstum des Feten, ist das klassische Zeichen der Fetopathia diabetica. Ihre Entstehung ist in den letzten Jahren in diversen Studien
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
 5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
Typ-2-Diabetes. Krankheitsbilder. Das metabolische Syndrom. Entstehung des Typ-2-Diabetes A1 5
 In Deutschland gehören etwa 95 % der Diabetiker zum Typ 2, wobei in den letzten Jahren eine Zunahme der Häufigkeit zu beobachten ist. Die Manifestation erfolgt meistens nach dem 40. Lebensjahr. Früher
In Deutschland gehören etwa 95 % der Diabetiker zum Typ 2, wobei in den letzten Jahren eine Zunahme der Häufigkeit zu beobachten ist. Die Manifestation erfolgt meistens nach dem 40. Lebensjahr. Früher
4. Ergebnisse. 4.1 Kollektivbeschreibung
 4. Ergebnisse 4.1 Kollektivbeschreibung Das Studienkollektiv umfasste 128 Probandinnen, die sich zu annähernd gleichen Teilen auf den Standard- (49,6 %) und den Ultraschall- Arm der Studie (50,4 %) verteilten.
4. Ergebnisse 4.1 Kollektivbeschreibung Das Studienkollektiv umfasste 128 Probandinnen, die sich zu annähernd gleichen Teilen auf den Standard- (49,6 %) und den Ultraschall- Arm der Studie (50,4 %) verteilten.
Gestationsdiabetes. Diagnostik
 Gestationsdiabetes Allgemein erhöhte Blutzuckerwerte (Störung des Glucosestoffwechsels) mit erstmaligem Auftreten während der Schwangerschaft 7% der Schwangeren werden mit GDM diagnostiziert 40-60% erkranken
Gestationsdiabetes Allgemein erhöhte Blutzuckerwerte (Störung des Glucosestoffwechsels) mit erstmaligem Auftreten während der Schwangerschaft 7% der Schwangeren werden mit GDM diagnostiziert 40-60% erkranken
81,9% 71,5% Abbildung 1: Inzidenz von neonataler und fetaler Makrosomie
 3 ERGEBNISSE 21 3 Ergebnisse 3.1 Inzidenz von Makrosomie Es wurde die Inzidenz von neonataler Makrosomie (Anteil der Large for Gestational Age Kinder) und die Inzidenz von fetaler Makrosomie (Anteil der
3 ERGEBNISSE 21 3 Ergebnisse 3.1 Inzidenz von Makrosomie Es wurde die Inzidenz von neonataler Makrosomie (Anteil der Large for Gestational Age Kinder) und die Inzidenz von fetaler Makrosomie (Anteil der
5 ZUSAMMENFASSUNG Zusammenfassung
 5 ZUSAMMENFASSUNG 56 5 Zusammenfassung Schwangere mit Gestationdiabetes (GDM) haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer fetalen Makrosomie. Die Geburt eines makrosomen Neugeborenen erhöht nicht
5 ZUSAMMENFASSUNG 56 5 Zusammenfassung Schwangere mit Gestationdiabetes (GDM) haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer fetalen Makrosomie. Die Geburt eines makrosomen Neugeborenen erhöht nicht
Gestationsdiabetes. Gestationsdiabetes. GDM: Definition. GDM unbehandelt vs. behandelt. Gestationsdiabetes: Prävalenz BQS-Outcome
 GDM: Definition Gestationsdiabetes Glukosetoleranzstörung, erstmals in der Schwangerschaft festgestellt M. Sorger, Bonn kein manifester Diabetes ADE-Jahrestagung Mainz - 7.2.2009 3 (%) 2,5 2 1,5 1 0,5
GDM: Definition Gestationsdiabetes Glukosetoleranzstörung, erstmals in der Schwangerschaft festgestellt M. Sorger, Bonn kein manifester Diabetes ADE-Jahrestagung Mainz - 7.2.2009 3 (%) 2,5 2 1,5 1 0,5
Gestationsdiabetes. Gestationsdiabetes. Diagnostische Grenzwerte. Dr. Günther Kreisel - Regensburg
 Gestationsdiabetes Diagnostische Grenzwerte Entwicklung der diagnostischen GDM-Grenzwerte 1964 O Sullivan and Mahan [100 g, 3 Std, Vollblut ] 90 165 145-125 Diabetesrisiko postpartal 1982 Carpenter and
Gestationsdiabetes Diagnostische Grenzwerte Entwicklung der diagnostischen GDM-Grenzwerte 1964 O Sullivan and Mahan [100 g, 3 Std, Vollblut ] 90 165 145-125 Diabetesrisiko postpartal 1982 Carpenter and
Empfehlungen zum generellen Screening auf Gestationsdiabetes
 Erscheinungsjahr 2006 (erste Auflage) Empfehlungen zum generellen Screening auf Gestationsdiabetes Erstellt von der Fachkommission Diabetes in Bayern (FKDB) e.v. -Landesverband der Deutschen Diabetes-Gesellschaft
Erscheinungsjahr 2006 (erste Auflage) Empfehlungen zum generellen Screening auf Gestationsdiabetes Erstellt von der Fachkommission Diabetes in Bayern (FKDB) e.v. -Landesverband der Deutschen Diabetes-Gesellschaft
Von Anfang an gesund ins Leben!? Ernährung bei Gestationsdiabetes und Präeklampsie Aktuelle Empfehlungen für die Praxis
 Von Anfang an gesund ins Leben!? Ernährung bei Gestationsdiabetes und Präeklampsie Aktuelle Empfehlungen für die Praxis PD Dr. Frauke von Versen-Höynck, MSc Mütterlicher Diabetes mellitus während der Schwangerschaft
Von Anfang an gesund ins Leben!? Ernährung bei Gestationsdiabetes und Präeklampsie Aktuelle Empfehlungen für die Praxis PD Dr. Frauke von Versen-Höynck, MSc Mütterlicher Diabetes mellitus während der Schwangerschaft
Gestationsdiabetes. Informationen für einen optimalen Schwangerschaftsverlauf. Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife.
 Gestationsdiabetes. Informationen für einen optimalen Schwangerschaftsverlauf. Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife. Fürs Leben gemacht. Gestationsdiabetes Schwangerschaftsdiabetes Schwangerschaftsdiabetes,
Gestationsdiabetes. Informationen für einen optimalen Schwangerschaftsverlauf. Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife. Fürs Leben gemacht. Gestationsdiabetes Schwangerschaftsdiabetes Schwangerschaftsdiabetes,
Evaluationsbogen Endokrinologie und Schwangerschaft am mit Lösungen
 [Frage 1] Eine Schilddrüsenunterfunktion kann führen zu 1. Haarausfall 2. Zyklusstörungen 3. höherer Abortrate nach IVF 4. Intelligenzdefekten beim Feten C: nur 1 ist richtig [Frage 2] In der Schwangerschaft
[Frage 1] Eine Schilddrüsenunterfunktion kann führen zu 1. Haarausfall 2. Zyklusstörungen 3. höherer Abortrate nach IVF 4. Intelligenzdefekten beim Feten C: nur 1 ist richtig [Frage 2] In der Schwangerschaft
2 METHODEN Methoden
 2 METHODEN 16 2 Methoden 2.1 Management des GDM Bei pathologischem Ergebnis des oralen Glukosetoleranztestes (ogtt) wurde bei den Studienteilnehmerinnen die Diagnose GDM gestellt. Als Grenzwerte fanden
2 METHODEN 16 2 Methoden 2.1 Management des GDM Bei pathologischem Ergebnis des oralen Glukosetoleranztestes (ogtt) wurde bei den Studienteilnehmerinnen die Diagnose GDM gestellt. Als Grenzwerte fanden
Diabetes in der Schwangerschaft und Gestationsdiabetes (GDM): Formen, Vorkommen, Ursachen und Folgen
 Diabetessprechstunde Jens H. Stupin und Christine Klapp Die Diabetessprechstunde der Klinik für Geburtsmedizin ist eine Spezialsprechstunde für Schwangere mit einer Zuckerstoffwechselstörung (Diabetes
Diabetessprechstunde Jens H. Stupin und Christine Klapp Die Diabetessprechstunde der Klinik für Geburtsmedizin ist eine Spezialsprechstunde für Schwangere mit einer Zuckerstoffwechselstörung (Diabetes
Fetale Programmierung
 Fetale Programmierung Fortbildungskurs Klinische Diabetologie der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) mit Schwerpunkt Pädiatrische Diabetologie München, den 19.02.2013 Prof. Dr. med. C. Eberle Prävalenz
Fetale Programmierung Fortbildungskurs Klinische Diabetologie der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) mit Schwerpunkt Pädiatrische Diabetologie München, den 19.02.2013 Prof. Dr. med. C. Eberle Prävalenz
-GESTATIONSDIABETES - GESTATIONSDIABETES. Ernährung in der Schwangerschaft. Diabetes-Schwerpunktpraxis Dr. med. M. Gloge
 Diabetes-Schwerpunktpraxis Dr. med. M. Gloge GESTATIONSDIABETES Ernährung in der Schwangerschaft -GESTATIONSDIABETES - Es gibt verschiedene Arten des Diabetes mellitus. Beim Typ 1 Diabetes mellitus sind
Diabetes-Schwerpunktpraxis Dr. med. M. Gloge GESTATIONSDIABETES Ernährung in der Schwangerschaft -GESTATIONSDIABETES - Es gibt verschiedene Arten des Diabetes mellitus. Beim Typ 1 Diabetes mellitus sind
Schwangerschaftsdiabetes
 Schwangerschaftsdiabetes Bayer Austria Ges.m.b.H Herbststraße 6-10 1160 Wien 0800/220 110 www.bayerdiabetes.at 1 2 Quelle: http://www.springerlink.com/content/3540562266364567/fulltext.pdf, S.52 Quelle:
Schwangerschaftsdiabetes Bayer Austria Ges.m.b.H Herbststraße 6-10 1160 Wien 0800/220 110 www.bayerdiabetes.at 1 2 Quelle: http://www.springerlink.com/content/3540562266364567/fulltext.pdf, S.52 Quelle:
Warum habe ich Diabetes? Sind die Gene schuld?
 Warum habe ich Diabetes? Sind die Gene schuld? Lenka Bosanska medicalxpress.com 17. Welt Diabetes Tag Was sind Gene? Gene bei Diabetes Polygene vs. Monogene Formen Ich und meine Gene - was kann ich tun?
Warum habe ich Diabetes? Sind die Gene schuld? Lenka Bosanska medicalxpress.com 17. Welt Diabetes Tag Was sind Gene? Gene bei Diabetes Polygene vs. Monogene Formen Ich und meine Gene - was kann ich tun?
Querschnittsbereich Epidemiologie, Med. Biometrie und Med. Informatik Diagnose und Prognose WS 06/07 Übung 5
 Informationsblatt zum Gestationsdiabetes (Schwangerschaftsdiabetes) Gruppe B Der Schwangerschafts- oder Gestationsdiabetes () ist eine spezielle Form der Zuckerkrankheit, die sich während einer Schwangerschaft
Informationsblatt zum Gestationsdiabetes (Schwangerschaftsdiabetes) Gruppe B Der Schwangerschafts- oder Gestationsdiabetes () ist eine spezielle Form der Zuckerkrankheit, die sich während einer Schwangerschaft
Schwangerschaft Sicherheit für Sie und Ihr Baby
 Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten: Diabetes in der Schwangerschaft Sicherheit für Sie und Ihr Baby www.diabetesportal.at www.sanofi.at Gerne hilft Ihnen unsere Diabetes-Hotline
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten: Diabetes in der Schwangerschaft Sicherheit für Sie und Ihr Baby www.diabetesportal.at www.sanofi.at Gerne hilft Ihnen unsere Diabetes-Hotline
Empfehlungen und Statements Folienversion
 Gestationsdiabetes mellitus (GDM) Diagnostik, Therapie und Nachsorge S3-Leitlinie Gestationsdiabetes mellitus (GDM), Diagnostik, Therapie und Nachsorge 2. Auflage AWMF-Registernummer: 057 008 Empfehlungen
Gestationsdiabetes mellitus (GDM) Diagnostik, Therapie und Nachsorge S3-Leitlinie Gestationsdiabetes mellitus (GDM), Diagnostik, Therapie und Nachsorge 2. Auflage AWMF-Registernummer: 057 008 Empfehlungen
UNDERSTANDING WEIGHT GAIN AT MENOPAUSE
 Hormone therapy and cognition Victor W. Henderson, 2012 UNDERSTANDING WEIGHT GAIN AT MENOPAUSE Gewichtszunahme in der Menopause Schlüsselfragen Gewichtszunahme ist eines der wichtigsten Gesundheitsprobleme
Hormone therapy and cognition Victor W. Henderson, 2012 UNDERSTANDING WEIGHT GAIN AT MENOPAUSE Gewichtszunahme in der Menopause Schlüsselfragen Gewichtszunahme ist eines der wichtigsten Gesundheitsprobleme
Sind dicke Kinder auch kranke Kinder? Gesundheitsrisiken und Folgeerkrankungen des Uebergewichtes im Kindes- und Jugendalter
 Sind dicke Kinder auch kranke Kinder? Gesundheitsrisiken und Folgeerkrankungen des Uebergewichtes im Kindes- und Jugendalter Dr. Gabor Szinnai Abteilung Endokrinologie und Diabetologie Universitäts-Kinderspital
Sind dicke Kinder auch kranke Kinder? Gesundheitsrisiken und Folgeerkrankungen des Uebergewichtes im Kindes- und Jugendalter Dr. Gabor Szinnai Abteilung Endokrinologie und Diabetologie Universitäts-Kinderspital
Diabetes und Schwangerschaft
 Diabetes und Schwangerschaft Diabetogene Faktoren in der Schwangerschaft Insulinresistenz Gesteigerte t Produktion von Kortisol, HPL, Estriol und Progesteron Vermehrter Insulinabbau durch Niere und Plazenta
Diabetes und Schwangerschaft Diabetogene Faktoren in der Schwangerschaft Insulinresistenz Gesteigerte t Produktion von Kortisol, HPL, Estriol und Progesteron Vermehrter Insulinabbau durch Niere und Plazenta
1.1 Gestationsdiabetes
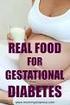 1 EINLEITUNG 1 1 Einleitung Anekdoten über die Geburt von Riesenbabys gehen viele Jahrhunderte zurück. François Rabelais, ein Mönch und Arzt aus dem 16. Jahrhundert, erzählt die Geschichte vom Gigant -Baby
1 EINLEITUNG 1 1 Einleitung Anekdoten über die Geburt von Riesenbabys gehen viele Jahrhunderte zurück. François Rabelais, ein Mönch und Arzt aus dem 16. Jahrhundert, erzählt die Geschichte vom Gigant -Baby
1! im fluate erzei ch n os. Vorwort v
 1! im fluate erzei ch n os Vorwort v 1 Adipositas, PCO und Fertilität 1 1.1 Fetuin-A- Indikator für die Insulinresistenz 6 1.2 Therapeutische Überlegungen bei PCO-Syndrom 6 1.3 Literatur 10 2 Adipositas
1! im fluate erzei ch n os Vorwort v 1 Adipositas, PCO und Fertilität 1 1.1 Fetuin-A- Indikator für die Insulinresistenz 6 1.2 Therapeutische Überlegungen bei PCO-Syndrom 6 1.3 Literatur 10 2 Adipositas
Schwangerschaft Informationen zum Gestationsdiabetes mellitus
 Alles aus einer Hand fur.. Ihre Diabetestherapie. Vielseitige Beratung Haben Sie Fragen zu Diabetes? Wir haben Antworten, die in Ihr Leben passen: Insuline, Insulinpens und intelligente Blut zuckermessgeräte.
Alles aus einer Hand fur.. Ihre Diabetestherapie. Vielseitige Beratung Haben Sie Fragen zu Diabetes? Wir haben Antworten, die in Ihr Leben passen: Insuline, Insulinpens und intelligente Blut zuckermessgeräte.
MODY. Eine wichtige Differentialdiagnose beim Diabetes mellitus und beim Gestationsdiabetes mellitus. Winfried Schmidt. www.molekulargenetik.
 MODY Eine wichtige Differentialdiagnose beim Diabetes mellitus und beim Gestationsdiabetes mellitus Winfried Schmidt Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) Früh manifestierender Diabetes Nicht-Insulin
MODY Eine wichtige Differentialdiagnose beim Diabetes mellitus und beim Gestationsdiabetes mellitus Winfried Schmidt Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) Früh manifestierender Diabetes Nicht-Insulin
Schilddrüse und Schwangerschaft. Wilhelm Krone Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie und Präventivmedizin Universität zu Köln
 Schilddrüse und Schwangerschaft Wilhelm Krone Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie und Präventivmedizin Universität zu Köln Physiologische Veränderungen in der Schwangerschaft und fetale Entwicklung
Schilddrüse und Schwangerschaft Wilhelm Krone Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie und Präventivmedizin Universität zu Köln Physiologische Veränderungen in der Schwangerschaft und fetale Entwicklung
Vertrag. nach 73 c SGB V. zur Förderung der frühzeitigen Diagnostik des Gestationsdiabetes. zwischen
 Vertrag nach 73 c SGB V zur Förderung der frühzeitigen Diagnostik des Gestationsdiabetes zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt Doctor-Eisenbart-Ring 2 39120 Magdeburg (im Folgenden KVSA
Vertrag nach 73 c SGB V zur Förderung der frühzeitigen Diagnostik des Gestationsdiabetes zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt Doctor-Eisenbart-Ring 2 39120 Magdeburg (im Folgenden KVSA
3.3.1 Referenzwerte für Fruchtwasser-Schätzvolumina ( SSW)
 50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
Die Inzidenz und Risikofaktoren für postpartalen Diabetes nach Schwangerschaften mit Gestationsdiabetes
 Aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des St. Joseph-Krankenhaus Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Die Inzidenz und Risikofaktoren
Aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des St. Joseph-Krankenhaus Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Die Inzidenz und Risikofaktoren
Diabetes mellitus während der Schwangerschaft - Gestations Diabetes
 Diabetes mellitus während der Schwangerschaft - Gestations Diabetes Praegestations Diabetes 0,2-0,3% alle Schwangerscaften In Ungarn: 300 Fälle pro Jahr Diabetes Gestationis 3-5% alle Schwangerscaften
Diabetes mellitus während der Schwangerschaft - Gestations Diabetes Praegestations Diabetes 0,2-0,3% alle Schwangerscaften In Ungarn: 300 Fälle pro Jahr Diabetes Gestationis 3-5% alle Schwangerscaften
S c r e e n i n g a u f G D M
 PD Dr. Karl Horvath EBM Review Center Klin. Abt. Endokrinologie und Stoffwechsel Universitätsklinik für Innere Medizin; MUG S c r e e n i n g a u f G D M 1.Jahrestagung des ebm-netzwerk.at 19. April 2012;
PD Dr. Karl Horvath EBM Review Center Klin. Abt. Endokrinologie und Stoffwechsel Universitätsklinik für Innere Medizin; MUG S c r e e n i n g a u f G D M 1.Jahrestagung des ebm-netzwerk.at 19. April 2012;
durch eine Geschmacksprobe des Urins gestellt. Diese Methode war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich. Unbehandelt führt der Diabetes mellitus
 durch eine Geschmacksprobe des Urins gestellt. Diese Methode war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich. Unbehandelt führt der Diabetes mellitus aber nicht nur zu einer Hyperglykämie. Neben dem Kohlenhydrat-Stoffwechsel
durch eine Geschmacksprobe des Urins gestellt. Diese Methode war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich. Unbehandelt führt der Diabetes mellitus aber nicht nur zu einer Hyperglykämie. Neben dem Kohlenhydrat-Stoffwechsel
Die Schilddrüse in der Schwangerschaft und post-partum Periode. Univ. Doz. Dr. Georg Zettinig
 Die Schilddrüse in der Schwangerschaft und post-partum Periode Univ. Doz. Dr. Georg Zettinig Erkrankungen der Schilddrüse Gestörte Funktion Gestörte Morphologie/Struktur DIAGNOSE der zugrundeliegenden
Die Schilddrüse in der Schwangerschaft und post-partum Periode Univ. Doz. Dr. Georg Zettinig Erkrankungen der Schilddrüse Gestörte Funktion Gestörte Morphologie/Struktur DIAGNOSE der zugrundeliegenden
Inhalt. 7 Liebe Leserinnen und Leser
 Inhalt 7 Liebe Leserinnen und Leser 11 Vom honigsüßen Durchfluss 17 Risikofaktor Übergewicht 20 Diabetesgerechte Ernährung 29 Folgekomplikationen vermeiden 38 Wie Sie die Tabellen nutzen können 41 Diabetes-Ampel
Inhalt 7 Liebe Leserinnen und Leser 11 Vom honigsüßen Durchfluss 17 Risikofaktor Übergewicht 20 Diabetesgerechte Ernährung 29 Folgekomplikationen vermeiden 38 Wie Sie die Tabellen nutzen können 41 Diabetes-Ampel
UNSER RATGEBER FÜR DIE SCHWANGER- SCHAFT
 UNSER RATGEBER FÜR DIE SCHWANGER- SCHAFT INHALT SCHWANGERSCHAFTS-VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN DER GESETZLICHEN KRANKENKASSE... 2 ULTRASCHALL-UNTERSUCHUNGEN IN DER SCHWANGERSCHAFT... 4 ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUSÄTZLICHEN
UNSER RATGEBER FÜR DIE SCHWANGER- SCHAFT INHALT SCHWANGERSCHAFTS-VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN DER GESETZLICHEN KRANKENKASSE... 2 ULTRASCHALL-UNTERSUCHUNGEN IN DER SCHWANGERSCHAFT... 4 ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUSÄTZLICHEN
Adipositas. die Rolle des Hausarztes. Netzwerk Adipositas / KÄS / 27.01.2010
 Adipositas die Rolle des Hausarztes 1 Hintergrund: Häufigkeit nimmt zu wirtschaftliche Belastung steigt Leitlinien u.a. in USA, Schottland, England, Frankreich und Deutschland (2007) 2 Definition: eine
Adipositas die Rolle des Hausarztes 1 Hintergrund: Häufigkeit nimmt zu wirtschaftliche Belastung steigt Leitlinien u.a. in USA, Schottland, England, Frankreich und Deutschland (2007) 2 Definition: eine
5 Diskussion. 5.1 Korrelationen zwischen den verschiedenen Phasen der Insulinsekretion
 55 5 Diskussion Für die Charakterisierung des metabolischen Phänotyps genügt nicht alleine die Feststellung der Glukosetoleranz und die Messung der Insulinwirkung (resistent oder empfindlich), es muß auch
55 5 Diskussion Für die Charakterisierung des metabolischen Phänotyps genügt nicht alleine die Feststellung der Glukosetoleranz und die Messung der Insulinwirkung (resistent oder empfindlich), es muß auch
Was ist insulin. Gegenspieler
 Was ist insulin Insulin ist eine Eiweissverbindung Hormon. dass in bestimmten Zellen (Betazellen) der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und im Kohlehydratstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt. Welche
Was ist insulin Insulin ist eine Eiweissverbindung Hormon. dass in bestimmten Zellen (Betazellen) der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und im Kohlehydratstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt. Welche
Gestations- Diabetes. Referentin: Agnes Ruckstuhl
 Gestations- Diabetes Referentin: Agnes Ruckstuhl C1 Die wichtigsten Diabetestypen Typ1 - Diabetes autoimmune Erkrankung => verursacht einen absoluten Insulinmangel, d.h. Zerstörung der körpereigenen Beta-Zellen
Gestations- Diabetes Referentin: Agnes Ruckstuhl C1 Die wichtigsten Diabetestypen Typ1 - Diabetes autoimmune Erkrankung => verursacht einen absoluten Insulinmangel, d.h. Zerstörung der körpereigenen Beta-Zellen
Aus der Klinik für Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin. der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Gestationsdiabetes -
 Aus der Klinik für Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Gestationsdiabetes - Klinische Daten nach Änderung der deutschen Leitlinie INAUGURAL-DISSERTATION
Aus der Klinik für Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Gestationsdiabetes - Klinische Daten nach Änderung der deutschen Leitlinie INAUGURAL-DISSERTATION
1. Nennen Sie 3 kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel. 2. Wieso sind Kohlenhydrate für unseren Körper so wichtig?
 1. Nennen Sie 3 kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel. 2. Wieso sind Kohlenhydrate für unseren Körper so wichtig? 3. Aus welchen Elementen bestehen die Kohlenhydrate? 4. Nennen Sie die Summenformel der Kohlenhydrate.
1. Nennen Sie 3 kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel. 2. Wieso sind Kohlenhydrate für unseren Körper so wichtig? 3. Aus welchen Elementen bestehen die Kohlenhydrate? 4. Nennen Sie die Summenformel der Kohlenhydrate.
Klinikübergreifende Optimierung der Versorgung von Schwangeren mit Diabetes ein Modell in Berlin!
 Klinikübergreifende Optimierung der Versorgung von Schwangeren mit Diabetes ein Modell in Berlin! Christine Klapp, Ute Schäfer-Graf Babett Ramsauer, Norbert Fuhr, Elisabeth Schalinski, Gabriele Gossing
Klinikübergreifende Optimierung der Versorgung von Schwangeren mit Diabetes ein Modell in Berlin! Christine Klapp, Ute Schäfer-Graf Babett Ramsauer, Norbert Fuhr, Elisabeth Schalinski, Gabriele Gossing
3.4.1 Referenzwerte für das fetale Schätzgewicht in der SSW
 60 3.4 Die Bedeutung des fetalen und des mütterlichen Gewichts in der 21.-24.SSW als prädiktiver Parameter für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.4.1 Referenzwerte für das fetale Schätzgewicht
60 3.4 Die Bedeutung des fetalen und des mütterlichen Gewichts in der 21.-24.SSW als prädiktiver Parameter für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.4.1 Referenzwerte für das fetale Schätzgewicht
für Diabetikerinnen Der große Schwangerschafts- TRIAS Gut vorbereitet schwan Sicher durch Schwangerschaft un So vermeiden Sie
 D r. m e d H e m u t K le i n w e c h t e r Dr. med. Ute Schäfer-Graf Ursula Mäder, Hebamme Der große Schwangerschafts- Ratge ber für Diabetikerinnen Gut vorbereitet schwan Sicher durch Schwangerschaft
D r. m e d H e m u t K le i n w e c h t e r Dr. med. Ute Schäfer-Graf Ursula Mäder, Hebamme Der große Schwangerschafts- Ratge ber für Diabetikerinnen Gut vorbereitet schwan Sicher durch Schwangerschaft
Mutter und Kind vor Komplikationen schützen
 FORTBILDUNG SEMINAR Diabetes und Schwangerschaft Mutter und Kind vor Komplikationen schützen M. HUMMEL Wird eine Diabeteserkrankung in der Schwangerschaft nicht erkannt und nicht behandelt, birgt dies
FORTBILDUNG SEMINAR Diabetes und Schwangerschaft Mutter und Kind vor Komplikationen schützen M. HUMMEL Wird eine Diabeteserkrankung in der Schwangerschaft nicht erkannt und nicht behandelt, birgt dies
Kinderwunsch aus nephrologischer Sicht. Dr. Klemens Budde Charité, Berlin
 Kinderwunsch aus nephrologischer Sicht Dr. Klemens Budde Charité, Berlin Das Ziel: Niereninsuffizienz und Schwangerschaft 1. chron. Niereninsuffizienz 2. Dialyse Hämodialyse Peritonealdialyse 2. Nierentransplantation
Kinderwunsch aus nephrologischer Sicht Dr. Klemens Budde Charité, Berlin Das Ziel: Niereninsuffizienz und Schwangerschaft 1. chron. Niereninsuffizienz 2. Dialyse Hämodialyse Peritonealdialyse 2. Nierentransplantation
Auswirkung der Adipositas auf Schwangerschaft u. Geburt Gyn Allround Teneriffa, KTM Scheider, TU München
 Auswirkung der Adipositas auf Schwangerschaft u. Geburt Gyn Allround Teneriffa, 28.2. 11.10-12.00 KTM Scheider, TU München Zunehmendes Problem Falsche Ernährung Bewegungsmangel Verändertes Reproduktionsverh.en
Auswirkung der Adipositas auf Schwangerschaft u. Geburt Gyn Allround Teneriffa, 28.2. 11.10-12.00 KTM Scheider, TU München Zunehmendes Problem Falsche Ernährung Bewegungsmangel Verändertes Reproduktionsverh.en
Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas
 Angelika Schaffrath Rosario, Bärbel-M. Kurth Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Korrespondenzadresse: Robert Koch-Institut Seestr. 10 13353 Berlin rosarioa@rki.de KiGGS-Geschäftsstelle: Seestr.
Angelika Schaffrath Rosario, Bärbel-M. Kurth Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Korrespondenzadresse: Robert Koch-Institut Seestr. 10 13353 Berlin rosarioa@rki.de KiGGS-Geschäftsstelle: Seestr.
Omalizumab. 2. An&asthma&ka Omalizumab Xolair /Novar&s CHO K1
 Omalizumab Omalizumab ist ein humanisierter rekombinanter, monoklonaler IgG1kappa- Antikörper, der selektiv an das menschliche Immunglobulin E (IgE) bindet. Nach Humanisierung des Maus-Moleküls durch Austausch
Omalizumab Omalizumab ist ein humanisierter rekombinanter, monoklonaler IgG1kappa- Antikörper, der selektiv an das menschliche Immunglobulin E (IgE) bindet. Nach Humanisierung des Maus-Moleküls durch Austausch
Gestationsdiabetes. special Gestationsdiabetes
 special Gestationsdiabetes Gestationsdiabetes Glossar: Dystokie = gestörter Geburtsverlauf infolge mechan., org., oder funktionaler Ursachen Eklampsie = lebensgefährliche Schwangerschaftstoxikose Hypokalzämie
special Gestationsdiabetes Gestationsdiabetes Glossar: Dystokie = gestörter Geburtsverlauf infolge mechan., org., oder funktionaler Ursachen Eklampsie = lebensgefährliche Schwangerschaftstoxikose Hypokalzämie
Diabetes mellitus. Mindestens 5 Mill. Bundesbürger. Häufigkeit. sind betroffen!
 Häufigkeit Mindestens 5 Mill. Bundesbürger sind betroffen! Häufigkeit 2 % der über 50 Jährigen 20% der über 70 Jährigen sind betroffen! Häufigkeit Unterschicht 5,6 Prozent, in der Mittelschicht 3,5 Prozent
Häufigkeit Mindestens 5 Mill. Bundesbürger sind betroffen! Häufigkeit 2 % der über 50 Jährigen 20% der über 70 Jährigen sind betroffen! Häufigkeit Unterschicht 5,6 Prozent, in der Mittelschicht 3,5 Prozent
Adipositas im Kindes- und Jugendalter
 Adipositas im Kindes- und Jugendalter Eine retrospektive Studie Gerhard Steinau, Carsten J. Krones, Rafael Rosch, Volker Schumpelick Entsprechend einer repräsentativen Studie des Robert- Koch-Instituts
Adipositas im Kindes- und Jugendalter Eine retrospektive Studie Gerhard Steinau, Carsten J. Krones, Rafael Rosch, Volker Schumpelick Entsprechend einer repräsentativen Studie des Robert- Koch-Instituts
Diabetes mellitus Eine Übersicht
 Diabetes mellitus Eine Übersicht Dr. med. Tobias Armbruster Facharzt für Allgemeinmedizin Diabetologe DDG / Naturheilverfahren Diabetes eine Übersicht Welche Diabetes Typen gibt es? Wie entsteht Diabetes?
Diabetes mellitus Eine Übersicht Dr. med. Tobias Armbruster Facharzt für Allgemeinmedizin Diabetologe DDG / Naturheilverfahren Diabetes eine Übersicht Welche Diabetes Typen gibt es? Wie entsteht Diabetes?
Diabetes und Schwangerschaft
 Diabetes und Schwangerschaft Wetzlar, den 29. April 2009 1 aktuelle Situation international: ADA-Jahrestagung in San Francisco (Juni 08) Großbritannien Jo Modder,London: Confidential Enquiry into Maternal
Diabetes und Schwangerschaft Wetzlar, den 29. April 2009 1 aktuelle Situation international: ADA-Jahrestagung in San Francisco (Juni 08) Großbritannien Jo Modder,London: Confidential Enquiry into Maternal
Zusammenhänge zwischen Übergewicht / Gewichtszunahme und Stoffwechselerkrankungen
 Zusammenhänge zwischen Übergewicht / Gewichtszunahme und Stoffwechselerkrankungen Robert A. Ritzel Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Suchtmedizin Nuklearmedizin Klinikum Schwabing Städtisches
Zusammenhänge zwischen Übergewicht / Gewichtszunahme und Stoffwechselerkrankungen Robert A. Ritzel Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Suchtmedizin Nuklearmedizin Klinikum Schwabing Städtisches
Hypoglykämie. René Schaefer 1
 Hypoglykämie René Schaefer 1 Hypoglykämie Typen Definition Glucoseangebot Glucoseverbrauch Ursachen Pathophysiologie Abgrenzung zur Hyperglykämie Nachweis und Therapie Medikament René Schaefer 2 Typen
Hypoglykämie René Schaefer 1 Hypoglykämie Typen Definition Glucoseangebot Glucoseverbrauch Ursachen Pathophysiologie Abgrenzung zur Hyperglykämie Nachweis und Therapie Medikament René Schaefer 2 Typen
4 Diskussion. 4.1 Einführung und Fragestellung. 4.2 Probandinnendaten
 4 Diskussion 4.1 Einführung und Fragestellung Die Suche nach der Ursache des Gestationsdiabetes und der ansteigenden Insulinresistenz hat über die Schwangerschaftshormone hinaus zu möglichen Mediatoren
4 Diskussion 4.1 Einführung und Fragestellung Die Suche nach der Ursache des Gestationsdiabetes und der ansteigenden Insulinresistenz hat über die Schwangerschaftshormone hinaus zu möglichen Mediatoren
OGTT. Oraler Glukose Toleranz Test.
 OGTT Oraler Glukose Toleranz Test www.medica.ch Liebe Patientin Ihre Ärztin / Ihr Arzt hat Ihnen diese Broschüre mitgegeben, damit Sie sich über den OGTT informieren können. OGTT bedeutet oraler Glukose
OGTT Oraler Glukose Toleranz Test www.medica.ch Liebe Patientin Ihre Ärztin / Ihr Arzt hat Ihnen diese Broschüre mitgegeben, damit Sie sich über den OGTT informieren können. OGTT bedeutet oraler Glukose
3.4 Darm. Hintergrund. Kernaussagen
 ICD-10 C18 C21 Ergebnisse zur 37 3.4 Darm Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Bösartige Neubildungen des Dickdarms und des Mastdarms sind für wie inzwischen die zweithäufigste Krebserkrankung und Krebstodesursache.
ICD-10 C18 C21 Ergebnisse zur 37 3.4 Darm Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Bösartige Neubildungen des Dickdarms und des Mastdarms sind für wie inzwischen die zweithäufigste Krebserkrankung und Krebstodesursache.
4 DISKUSSION 41. 4 Diskussion
 4 DISKUSSION 41 4 Diskussion Die vorliegende Studie untersuchte den zeitlichen Ablauf der Entwicklung von fetaler Makrosomie bei Schwangeren mit Gestationsdiabetes mit dem Ziel, zu evaluieren, inwieweit
4 DISKUSSION 41 4 Diskussion Die vorliegende Studie untersuchte den zeitlichen Ablauf der Entwicklung von fetaler Makrosomie bei Schwangeren mit Gestationsdiabetes mit dem Ziel, zu evaluieren, inwieweit
Gestationsdiabetes Was hat sich durch die Aufnahme in die Mutterschaftsrichtlinien geändert?
 Gestationsdiabetes Was hat sich durch die Aufnahme in die Mutterschaftsrichtlinien geändert? Prof. Ute Schäfer-Graf Perinatologin & Diabetologin Perinatalzentrum Level 1 St. Joseph Krankenhaus Chefarzt
Gestationsdiabetes Was hat sich durch die Aufnahme in die Mutterschaftsrichtlinien geändert? Prof. Ute Schäfer-Graf Perinatologin & Diabetologin Perinatalzentrum Level 1 St. Joseph Krankenhaus Chefarzt
Klare ANTWORTEN auf wichtige Fragen
 Klare ANTWORTEN auf wichtige Fragen Der HARMONY PRÄNATAL-TEST ist ein neuartiger, DNA-basierter Bluttest zur Erkennung von Trisomie 21 (Down-Syndrom). Der Harmony- Test ist zuverlässiger als herkömmliche
Klare ANTWORTEN auf wichtige Fragen Der HARMONY PRÄNATAL-TEST ist ein neuartiger, DNA-basierter Bluttest zur Erkennung von Trisomie 21 (Down-Syndrom). Der Harmony- Test ist zuverlässiger als herkömmliche
4. DEO - Symposium Diabetologie - Endokrinologie - Osteologie Chur 10.06.10. Gestationsdiabetes rubenesque pregnancy
 4. DEO - Symposium Diabetologie - Endokrinologie - Osteologie Chur 10.06.10 Gestationsdiabetes rubenesque pregnancy Neues zu Diagnose und Therapie Rolf Gräni, Wolhusen Gestationsdiabetes 1 Definition Gestationsdiabetes
4. DEO - Symposium Diabetologie - Endokrinologie - Osteologie Chur 10.06.10 Gestationsdiabetes rubenesque pregnancy Neues zu Diagnose und Therapie Rolf Gräni, Wolhusen Gestationsdiabetes 1 Definition Gestationsdiabetes
Gestationsdiabetes. Dr. Hans-Peter Kopp. 1. Medizinische Abteilung, Rudolfstiftung Wien
 Gestationsdiabetes Dr. Hans-Peter Kopp 1. Medizinische Abteilung, Rudolfstiftung Wien Gestationsdiabetes Schwangerschaftsdiabetes, auch als Gestationsdiabetes, GDM bezeichnet, ist eine Form der Stoffwechselstörung,
Gestationsdiabetes Dr. Hans-Peter Kopp 1. Medizinische Abteilung, Rudolfstiftung Wien Gestationsdiabetes Schwangerschaftsdiabetes, auch als Gestationsdiabetes, GDM bezeichnet, ist eine Form der Stoffwechselstörung,
Expektatives Management oder aktives Vorgehen?
 Terminüberschreitung Expektatives Management oder aktives Vorgehen? Keine maternale Erkrankung Keine fetale Erkrankung Einling Terminüberschreitung Absprache mit der Schwangeren Interventionen vermeiden
Terminüberschreitung Expektatives Management oder aktives Vorgehen? Keine maternale Erkrankung Keine fetale Erkrankung Einling Terminüberschreitung Absprache mit der Schwangeren Interventionen vermeiden
Der Median der Körpergröße der Frauen liegt bei 170 cm, die Spannbreite bewegt sich von 150 cm bis 180 cm (SD 6,2 cm).
 3 Ergebnisse 3.1 Probandinnendaten Die Altersverteilung der Frauen weist einen Median von 29,5 Jahren auf (Mittelwert 29,6, SD 4,45). Das Minimum liegt bei 19 und das Maximum bei 39 Jahren. 1 % der Frauen
3 Ergebnisse 3.1 Probandinnendaten Die Altersverteilung der Frauen weist einen Median von 29,5 Jahren auf (Mittelwert 29,6, SD 4,45). Das Minimum liegt bei 19 und das Maximum bei 39 Jahren. 1 % der Frauen
Diabetes und Schwangerschaft
 Diabetes und Schwangerschaft Dr. med. R. Görse Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg am Caritas- Krankenhaus St. Josef Definition I. Typ-1-Diabetes: B-Zell-Störung, die
Diabetes und Schwangerschaft Dr. med. R. Görse Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg am Caritas- Krankenhaus St. Josef Definition I. Typ-1-Diabetes: B-Zell-Störung, die
Diabetes mellitus und Schwangerschaft Regina Rasenack, M.D.
 Diabetes mellitus und Schwangerschaft Regina Rasenack, M.D. Diabetes Mellitus und Schwangerschaft 1. Fall 1.Fall: 28j. I Gr/ 0 P, DM seit 11 Jahren, nach LP jetzt 30.SSW, Insulinpumpenbehandlung, Symptome:
Diabetes mellitus und Schwangerschaft Regina Rasenack, M.D. Diabetes Mellitus und Schwangerschaft 1. Fall 1.Fall: 28j. I Gr/ 0 P, DM seit 11 Jahren, nach LP jetzt 30.SSW, Insulinpumpenbehandlung, Symptome:
Übergewicht, Anorexia nervosa und Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
 Übergewicht, Anorexia nervosa und Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen Begriffsbestimmung Die Begriffe Übergewicht
Übergewicht, Anorexia nervosa und Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen Begriffsbestimmung Die Begriffe Übergewicht
Inhaltsverzeichnis VORWORT
 Inhaltsverzeichnis VORWORT Bis zum Jahr 1922 waren Typ-1-Diabetiker zum Tode verurteilt. Doch schon ein Jahr später konnten Zuckerkranke auf ein langes, erfülltes und produktives Leben hoffen. Gemeinsam
Inhaltsverzeichnis VORWORT Bis zum Jahr 1922 waren Typ-1-Diabetiker zum Tode verurteilt. Doch schon ein Jahr später konnten Zuckerkranke auf ein langes, erfülltes und produktives Leben hoffen. Gemeinsam
5.3 Informationen zur jetzigen Schwangerschaft
 5.3 Informationen zur jetzigen Schwangerschaft 5.3.1 Anamnese Anzahl Zigaretten pro Tag nach Bekanntwerden der Schwangerschaft 0 angegeben 480.453 72,51 74,27 204.946 74,75 275.507 70,93 1 bis 10 49.108
5.3 Informationen zur jetzigen Schwangerschaft 5.3.1 Anamnese Anzahl Zigaretten pro Tag nach Bekanntwerden der Schwangerschaft 0 angegeben 480.453 72,51 74,27 204.946 74,75 275.507 70,93 1 bis 10 49.108
Zyklus außer Rand und Band Hyperandrogenämie, Schilddrüse & Co. Dr. med. E. Neunhoeffer 13. Oktober 2012
 Zyklus außer Rand und Band Hyperandrogenämie, Schilddrüse & Co. Dr. med. E. Neunhoeffer 13. Oktober 2012 Zusammenspiel: Hypothalamus - Hypophyse - Ovar Hypothalamus: GnRH (Gonadotropin- Releasinghormon)
Zyklus außer Rand und Band Hyperandrogenämie, Schilddrüse & Co. Dr. med. E. Neunhoeffer 13. Oktober 2012 Zusammenspiel: Hypothalamus - Hypophyse - Ovar Hypothalamus: GnRH (Gonadotropin- Releasinghormon)
5.3 Informationen zur jetzigen Schwangerschaft
 5.3 Informationen zur jetzigen Schwangerschaft 5.3.1 Anamnese Anzahl Zigaretten pro Tag 0 angegeben 480.899 80,1 82,3 191.353 82,1 289.546 78,8 1 bis 10 49.226 8,2 8,5 17.299 7,4 31.927 8,7 11 bis 20 21.378
5.3 Informationen zur jetzigen Schwangerschaft 5.3.1 Anamnese Anzahl Zigaretten pro Tag 0 angegeben 480.899 80,1 82,3 191.353 82,1 289.546 78,8 1 bis 10 49.226 8,2 8,5 17.299 7,4 31.927 8,7 11 bis 20 21.378
Die Auswirkung von Gestationsdiabetes mellitus in späteren Jahren an einem Typ zwei Diabetes mellitus zu erkranken
 Institut für Pflegewissenschaft Medizinische Universität Graz Bachelorarbeit Die Auswirkung von Gestationsdiabetes mellitus in späteren Jahren an einem Typ zwei Diabetes mellitus zu erkranken vorgelegt
Institut für Pflegewissenschaft Medizinische Universität Graz Bachelorarbeit Die Auswirkung von Gestationsdiabetes mellitus in späteren Jahren an einem Typ zwei Diabetes mellitus zu erkranken vorgelegt
HAPO-Studie liefert lange erwartete Daten zum Gestationsdiabetes
 DIABETES UND SCHWANGERSCHAFT HAPO-Studie liefert lange erwartete Daten zum Gestationsdiabetes Zusammenhang zwischen ansteigenden Blutzuckerwerten im ogtt und geburtshilflichen Komplikationen Ute Schäfer-Graf,
DIABETES UND SCHWANGERSCHAFT HAPO-Studie liefert lange erwartete Daten zum Gestationsdiabetes Zusammenhang zwischen ansteigenden Blutzuckerwerten im ogtt und geburtshilflichen Komplikationen Ute Schäfer-Graf,
DIABETES MELLITUS «ZUCKERKRANKHEIT» Jasmin Hess Interne Weiterbildung
 DIABETES MELLITUS «ZUCKERKRANKHEIT» Jasmin Hess Interne Weiterbildung 1.2.16 350 000 Menschen HÄUFIGKEIT IN DER SCHWEIZ 20-84 Jahre: Männer 4,8%, Frauen 3,7% 75-84 Jahre: Männer 16%, Frauen 12% Anteil
DIABETES MELLITUS «ZUCKERKRANKHEIT» Jasmin Hess Interne Weiterbildung 1.2.16 350 000 Menschen HÄUFIGKEIT IN DER SCHWEIZ 20-84 Jahre: Männer 4,8%, Frauen 3,7% 75-84 Jahre: Männer 16%, Frauen 12% Anteil
4 Ergebnisse. 4.1 Charakterisierung der Probanden
 30 4 Ergebnisse 4.1 Charakterisierung der Probanden Das untersuchte Kollektiv von 16 Probanden bestand aus gesunden, glukosetoleranten, nicht stark übergewichtigen Personen. Die demographischen Charakteristika
30 4 Ergebnisse 4.1 Charakterisierung der Probanden Das untersuchte Kollektiv von 16 Probanden bestand aus gesunden, glukosetoleranten, nicht stark übergewichtigen Personen. Die demographischen Charakteristika
Klassifikation des Diabetes mellitus
 5 Klassifikation des Diabetes mellitus 6 Kapitel Klassifikation des Diabetes mellitus Die Klassifikation des Diabetes mellitus folgt heute einer Einteilung nach der Pathogenese der einzelnen Diabetestypen.
5 Klassifikation des Diabetes mellitus 6 Kapitel Klassifikation des Diabetes mellitus Die Klassifikation des Diabetes mellitus folgt heute einer Einteilung nach der Pathogenese der einzelnen Diabetestypen.
Diabetes zu viel Zucker im Blut, zu wenig Energie im Gehirn?
 Diabetes zu viel Zucker im Blut, zu wenig Energie im Gehirn? PD Dr. med. Bernd Schultes Kantonsspital St. Gallen Achtung! Es geht hier ausschließlich um den Typ 2 Diabetes, d.h. die häufigste Form des
Diabetes zu viel Zucker im Blut, zu wenig Energie im Gehirn? PD Dr. med. Bernd Schultes Kantonsspital St. Gallen Achtung! Es geht hier ausschließlich um den Typ 2 Diabetes, d.h. die häufigste Form des
DISSERTATION. Zur Erlangung des akademischen Grades Doctor medicinae (Dr.med.)
 Aus der Klinik für Geburtsmedizin des Vivantes Klinikum Neukölln Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Untersuchung des Zusammenhangs von
Aus der Klinik für Geburtsmedizin des Vivantes Klinikum Neukölln Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Untersuchung des Zusammenhangs von
GDM aus diabetologischer Sicht
 Gestationsdiabetes eine interdisziplinäre Herauforderung 21.03.2012 Henriettenstiftung Hannover GDM aus diabetologischer Sicht Dr. med. Wilfried von dem Berge FA für Innere Medizin Diabetologie Diabetologe
Gestationsdiabetes eine interdisziplinäre Herauforderung 21.03.2012 Henriettenstiftung Hannover GDM aus diabetologischer Sicht Dr. med. Wilfried von dem Berge FA für Innere Medizin Diabetologie Diabetologe
Diabetes, die stille Gefahr wie erkannt wie gebannt?
 Diabetes, die stille Gefahr wie erkannt wie gebannt? Dr. A. Figge Fachärztin für Innere Medizin Endokrinologie Diabetologie Ernährungsmedizin Seite 1 Diabetes mellitus (DM) 8.9% der Gesamtbevölkerung (rund
Diabetes, die stille Gefahr wie erkannt wie gebannt? Dr. A. Figge Fachärztin für Innere Medizin Endokrinologie Diabetologie Ernährungsmedizin Seite 1 Diabetes mellitus (DM) 8.9% der Gesamtbevölkerung (rund
Metabolisches Syndrom was ist das eigentlich?
 Metabolisches Syndrom, Diabetes und KHK Volkskrankheiten auf dem Vormarsch Dr. med. Axel Preßler Lehrstuhl und Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin Klinikum rechts der Isar TU München
Metabolisches Syndrom, Diabetes und KHK Volkskrankheiten auf dem Vormarsch Dr. med. Axel Preßler Lehrstuhl und Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin Klinikum rechts der Isar TU München
Abb. 1: Krankenhaussterblichkeit unterteilt in Geschlechter und Altersklassen
 Vor dem Herzinfarkt sind nicht alle gleich: Zu Geschlechterdifferenzen in der Sterblichkeit und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit akutem Herzinfarkt im Krankenhaus - Daten des Berliner Herzinfarktregisters
Vor dem Herzinfarkt sind nicht alle gleich: Zu Geschlechterdifferenzen in der Sterblichkeit und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit akutem Herzinfarkt im Krankenhaus - Daten des Berliner Herzinfarktregisters
Mit der Zukunft verbunden. B. Braun Space GlucoseControl
 Mit der Zukunft verbunden B. Braun Space GlucoseControl Herausforderungen von heute Die Notwendigkeit einer intensiven Insulintherapie auf der Intensivstation Intensivpflichtige Patienten entwickeln häufig
Mit der Zukunft verbunden B. Braun Space GlucoseControl Herausforderungen von heute Die Notwendigkeit einer intensiven Insulintherapie auf der Intensivstation Intensivpflichtige Patienten entwickeln häufig
Pränatales Screening auf Chromosomenstörungen
 Unsere Patienten-Information Pränatales Screening auf Chromosomenstörungen Leitfaden für werdende Mütter und Väter Unsere Patienten-Information Liebe Patientin, eine Schwangerschaft ist ein ganz besonderes
Unsere Patienten-Information Pränatales Screening auf Chromosomenstörungen Leitfaden für werdende Mütter und Väter Unsere Patienten-Information Liebe Patientin, eine Schwangerschaft ist ein ganz besonderes
Gestationsdiabetes (GDM) Behandlung und Therapie
 Erstelldatum: 08.12.2004 1931 Geburtshilfe Nr. 193125/12 Seite 1 von 8 Verfasser: Visca Eva Genehmigt am: 08.03.2013 Ersetzt Versionen: Anlaufstelle: FKL Genehmigt durch: M. Todesco 193125/11 vom 18.12.2012
Erstelldatum: 08.12.2004 1931 Geburtshilfe Nr. 193125/12 Seite 1 von 8 Verfasser: Visca Eva Genehmigt am: 08.03.2013 Ersetzt Versionen: Anlaufstelle: FKL Genehmigt durch: M. Todesco 193125/11 vom 18.12.2012
OFT SCHLAPP, MÜDE, DEPRIMIERT? Eisenmangel weit verbreitet und vielfach unterschätzt
 OFT SCHLAPP, MÜDE, DEPRIMIERT? Eisenmangel weit verbreitet und vielfach unterschätzt Liebe Patientin, lieber Patient! Fühlen Sie sich häufig schlapp, müde, erschöpft, deprimiert? Frieren Sie leicht? Neigen
OFT SCHLAPP, MÜDE, DEPRIMIERT? Eisenmangel weit verbreitet und vielfach unterschätzt Liebe Patientin, lieber Patient! Fühlen Sie sich häufig schlapp, müde, erschöpft, deprimiert? Frieren Sie leicht? Neigen
Risikomanagement bei Schwangeren mit Diabetes. Prof. Dr. med. Roland Büttner Klinik für Innere Medizin I, Caritas-Krankenhaus St.
 Risikomanagement bei Schwangeren mit Diabetes Prof. Dr. med. Roland Büttner Klinik für Innere Medizin I, Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg Definitionen und Epidemiologie Schwangerschaft mit Präkonzeptionell
Risikomanagement bei Schwangeren mit Diabetes Prof. Dr. med. Roland Büttner Klinik für Innere Medizin I, Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg Definitionen und Epidemiologie Schwangerschaft mit Präkonzeptionell
Testosteron. und benigne Prostatahyperplasie
 Testosteron und benigne Prostatahyperplasie Behauptung Testosteronsubstitution bewirkt Eine Vergrößerung der Prostata Verstärktes Wachstum eines Prostatakarzinoms In den letzten Jahren wurde nach einem
Testosteron und benigne Prostatahyperplasie Behauptung Testosteronsubstitution bewirkt Eine Vergrößerung der Prostata Verstärktes Wachstum eines Prostatakarzinoms In den letzten Jahren wurde nach einem
Routineuntersuchung auf Schwangerschaftsdiabetes
 IQWiG sieht Hinweis auf positiven Effekt: Routineuntersuchung auf Schwangerschaftsdiabetes Weniger Geburtskomplikationen, wenn Schwangere mit erhöhtem Blutzucker gezielt behandelt werden Berlin (3. September
IQWiG sieht Hinweis auf positiven Effekt: Routineuntersuchung auf Schwangerschaftsdiabetes Weniger Geburtskomplikationen, wenn Schwangere mit erhöhtem Blutzucker gezielt behandelt werden Berlin (3. September
Hämoglobin: Proteinfunktion und Mikrokosmos (Voet Kapitel 9)
 Hämoglobin: Proteinfunktion und Mikrokosmos (Voet Kapitel 9) 1. Funktion des Hämoglobins 2. Struktur und Mechanismus 3. Anormale Hämoglobine 4. Allosterische Regulation 4. Allosterische Regulation Organismen
Hämoglobin: Proteinfunktion und Mikrokosmos (Voet Kapitel 9) 1. Funktion des Hämoglobins 2. Struktur und Mechanismus 3. Anormale Hämoglobine 4. Allosterische Regulation 4. Allosterische Regulation Organismen
