Ibrahim Cindark / Sema Aslan
|
|
|
- Josef Hofer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Deutschlandtürkisch? Ibrahim Cindark / Sema Aslan Migration führt zu Zwei- und Mehrsprachigkeit. Ein Ausdruck dieser Sprachkontaktsituation sind Phänomene wie Codeswitching oder Codemixing, die weltweit, wie auch im kommunikativen Haushalt der türkischen Migranten in Europa, zu beobachten sind. 1 Eine andere Folge dieses Prozesses sind Auffälligkeiten, die sich im Laufe der Zeit auf verschiedenen Ebenen der Diasporasprachen zeigen. Im vorliegenden Beitrag beschäftigen wir uns mit der Frage nach solchen Besonderheiten und ihren Ursachen im Türkischen der Migranten in Deutschland. Hierzu analysieren wir mündliche Alltagskonversationen von zwei Gruppen. Unsere Analyse von gesprochener Sprache wirft in diesem Zusammenhang einige zentrale methodologische Fragen bezüglich der untersuchten Daten und der Analyseperspektive auf, die wir zunächst in Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur erörtern. 1. Deutschlandtürkisch Entsteht ein Deutschlandtürkisch? war die Frage, die bereits vor knapp anderthalb Dekaden von Lars Johanson (1988) aufgeworfen wurde. Die Frage umriss eine Perspektive, mit der in der Turkologie ein Forschungsprogramm etabliert werden sollte, das längst fällig und [...] nicht mehr aufschiebbar (1988: 3) war. So forderte Johanson breit angelegte Untersuchungen auf einer soliden varietätenlinguistischen Grundlage, um zwei Phasen der offensichtlich[en] Sondermerkmale (ebd.) des Türkischen erfassen zu können: a) die Phase der zunächst begrenzten Neuerungen und b) die Phase ihrer geographisch und sozial zu bestimmenden Durchsetzung in Sprachwissen, Sprachgemeinschaft und Sprachraum (1988: 6). Rückblickend muss festgehalten werden, dass in den vergangenen Jahren kein entsprechend umfangreiches Projekt formuliert wurde, das der Forderung Johansons nach systematischer Beschreibung hätte nachkommen können. Daher ist eine Zwischenbilanz der bis dato veröffentlichten Forschungsarbeiten nicht unproblematisch. Ein Überblick deckt aber zwei wesentliche Charakteristika der meisten Arbeiten auf, auf die wir im Folgenden eingehen wollen: 1.) Die Besonderheiten werden in der Regel als Interferenzen aus dem Deutschen erklärt. 2.) Die Arbeiten untersuchen mehrheitlich schriftsprachliche Texte (von Nacherzählungen bis Romanübersetzungen) als empirische Daten. 1 Siehe hierzu u.a. Backus (1996), Treffers-Daller (1998), Türker (2000), Hinnenkamp (2002), Keim (2002a), Keim/Cindark (2003). 1
2 1.1. Interferenz vs. andere Mechanismen des Wandels In Sprachkontaktsituationen ist Interferenz, d.h. die Übernahme von Elementen und Strukturen der einen Sprache in die andere, einer der beobachteten Mechanismen, der zu Sprachwandel führen kann. Methodologisch problematisch ist es jedoch, wenn man für vorgefundene Besonderheiten monokausal lediglich die Interferenz als Erklärungsansatz in Betracht zieht. Wir wollen hier Backus/Boeschoten (1998), Boeschoten/Broeder (1999) und Boeschoten (2000) folgen, die neben dem Einfluss der Zweitsprache (Deutsch, Holländisch, etc.) die beiden Mechanismen Dialektausgleich und Auflockerung der sprachlichen Norm(en) anführen. Für Boeschoten sind insbesondere in den frühen Stadien des Sprachkontakts interne Faktoren, also Prozesse des Dialektausgleichs, bei der möglichen Entstehung einer Diasporavarietät von zentraler Bedeutung: [...] the first stage in the formation of local varieties of migrant Turkish must have been processes of dialect levelling (2000: 146). Die Dominanz der zentralanatolischen Dialekte im Diasporatürkischen, die sich darin ausdrücke, dass ihre Elemente von Sprechern aus Schwarzmeerregionen übernommen würden, ist nach Boeschoten (ebd.: 147) ein Ausdruck dieser Entwicklung. Leider ist jedoch dieser Bereich des Wandels in der linguistischen Turkologie völlig unerforscht geblieben (Boeschoten/Broeder 1999: 19), weshalb auch wir seine Bedeutung lediglich andiskutieren können. 2 Unter dem zweiten Aspekt der Auflockerung der sprachlichen Norm(en) verstehen Backus/ Boeschoten (1998: 225) Phänomene, die aufgrund der besonderen Erwerbssituation des Türkischen in der Diaspora auftreten. Da in den Einwanderungsländern der fokussierende Einfluss des Standardtürkischen weniger vorhanden sei, werde die overall structure of language use [...] more diffused (ebd.). In der Folge finde man im Türkischen der Nachfolgegenerationen increased variation of a more or less erratic nature (ebd.), die nicht unmittelbar ein Resultat von Interferenzen sein müssen. Vielmehr gelte es auch an diesem Punkt, sprachinterne Prozesse, d.h. im Türkischen vorhandene marginale Regeln (Boeschoten 1998: 15) zu berücksichtigen, die in der Diaspora unter den besonderen Erwerbsbedingungen vermehrt auftreten. Als ein Beispiel hierfür diskutiert Boeschoten (2000: 149) die häufig zu beobachtende fehlende Genitivmarkierung in Konstruktionen, wo sie im Standardtürkischen obligatorisch 2 Neben dem Ausgleich zwischen den verschiedenen türkischen Dialekten darf nicht übersehen werden, dass in der Diaspora wie auch in türkischen Ballungsgebieten noch andere sprachliche Augleichsprozesse vonstatten gehen. So ist für viele Einwanderer aus der Türkei das Türkische gar nicht die Erst-, sondern die Zweitsprache. Daher spricht einiges dafür, dass es (noch unerforschte) ethnolektale Varietäten des Türkischen gibt (z.b. eine Varietät, die von der kurdischen Bevölkerungsgruppe gesprochen wird), die in der Diaspora im Prozess des Dialektausgleichs ebenso wirksam sind. Dieser Aspekt ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil z.b. das Kurdische (als eine indogermanische Sprache wie das Deutsche!) auf diesem Wege eventuell Spuren im Türkischen hinterlässt, die ohne die Berücksichtigung dieses Ausgleichaspektes fälschlicherweise als Deutscheinflüsse interpretiert würden; vgl. hierzu unsere Analyse in Abschnitt
3 ist. Da die Genitivmarkierung aber nur im Falle von spezifischen Subjekten gesetzt werden muss und bei unspezifischen Subjekten wegfallen kann, betrachtet Boeschoten ihre häufige Auslassung bei spezifischen Subjekten als eine Übergeneralisierung einer im Türkischen vorhandenen Regel. Gleichzeitig räumt Boeschoten aber ein, dass man diese Besonderheit auch als eine Interferenz aus dem Deutschen betrachten kann: Bei den deutschen Äquivalenten steht nämlich das Nomen an jenen Positionen ebenso nicht im Genitiv, sondern im Nominativ. Auffällig bei anderen Autoren wie z.b. Aytemiz (1990) oder Menz (1991), die das gleiche Phänomen beschreiben, ist, dass sie ausschließlich die Interferenz als Explanans anführen und andere Erklärungen wie Auflockerung der Norm(en) lediglich als Restkategorie in Erwägung ziehen. Dies entspricht auch der generellen analytischen Haltung, auf die wir aufmerksam machen wollen. Denn als Resultat dieser interferenzlastigen Analyse erweckt eine additive Zusammenführung der Forschungsergebnisse (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) den Anschein, dass kaum ein Bereich des Türkischen von Deutscheinflüssen verschont geblieben wäre: - Ausfall der Genitivmarkierung in Modalkonstruktionen (Menz 1991), Komposita (Aytemiz 1990) und bei Subjekten nominalisierter Nebensätze (Sarõ 1995) - Übermäßige Verwendung des Ablativs (Boeschoten 1994, Backus/Boeschoten 1998) - Veränderung in der Verbrektion (Aytemiz 1990, Menz 1991, Rehbein 2001) - Wegfall der Fragepartikel in Entscheidungsfragen (Hess-Gabriel 1979) - Analytische Syntax bei Attributivkonstruktionen (Menz 1991, Sarõ 1995, Çabadağ 2001) - Mehrfache Pluralmarkierung (Aytemiz 1990) - Ausfall des Akkusativs in unmittelbar (als spezifisches Objekt) und nicht unmittelbar präverbaler Position (Menz 1991) - Veränderung im Gebrauch der Konnektoren (Aytemiz 1990, Rehbein 2001) - Übermäßige Verwendung von pronominalen Subjekten und Objekten (Aytemiz 1990, Menz 1991, Pfaff 1991, Rehbein 2001) Wir wollen an dieser Stelle nicht anzweifeln, dass die aufgelisteten Besonderheiten als Interferenzen erklärt werden können. Wie Boeschoten im Falle der oben diskutierten Genitivmarkierung anmerkt, kann es im Einzelfall sehr schwierig bis unmöglich sein, die Ursache für eine Besonderheit eindeutig zu bestimmen. Unsere Argumente lauten lediglich zum einen, dass der Einfluss der anderen Sprache [...] allzuoft als selbstverständliche Ursache für Veränderungen in der Sprachstruktur aufgeführt (wird) (Boeschoten/Broeder 1999: 1), und zum anderen, dass die Ergebnisse nicht die tatsächliche Sprachwirklichkeit des Türkischen in der 3
4 Diaspora reflektieren, sondern vielmehr von der Konstitution der Daten herrühren, was wir im Folgenden ausführen wollen Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit Das Türkische in Deutschland ist vornehmlich eine gesprochene Sprache. Und als solche ist es nach wie vor sehr vital. Die aktive Schriftsprachlichkeit der Migranten und ihrer Nachfolgegenerationen ist im Gegensatz zum mündlichen Sprachgebrauch auf sehr wenige Gebrauchskontexte reduziert. Trotz dieser offenkundigen Dominanz der Mündlichkeit stützen sich jedoch die meisten Arbeiten auf schriftliche Daten, 3 was zu einer Schieflage führt zwischen dem, was analysiert wird, und dem, was analysiert werden soll. Die Untersuchungen beanspruchen, das in der Diaspora verwendete Türkisch zu erfassen. Was sie jedoch faktisch analysieren, sind Auffälligkeiten, die sich lediglich in der Schriftsprachlichkeit der Probanden zeigen. Und da in der Folge nicht immer eine hinreichende methodologische Reflexion über den Geltungsbereich der Ergebnisse stattfindet, werden diese verallgemeinert und auch auf die mündliche Sprachwirklichkeit des Türkischen in der Diaspora übertragen. Eine derart unzulässige Generalisierung übersieht u.e. mindestens zwei Problemkomplexe: a) Kennzeichnend für die überwiegende Mehrheit der Migranten ist die größtenteils fehlende Übung und/oder Kompetenz in der aktiven Schriftsprachlichkeit. So ist es nicht weiter vewunderlich, dass in schriftlichen Texten der Probanden Phänomene zu beobachten sind, die sie aus ihrem mündlichen Sprachgebrauch übernehmen. Viele für die gesprochene Sprache normale Formulierungsverfahren wie z.b. Links- und Rechtsherausstellungen erscheinen dann in schriftsprachlichen Produkten als Fehler oder Besonderheit. So nehmen wir z.b. im Falle der bereits angeführten, häufig fehlenden Genitivmarkierung an, dass dies möglicherweise auf eine Übertragung aus dem mündlichen Sprachgebrauch in die schriftliche Textproduktion zurückzuführen ist. Exemplarisch hierfür sei aus unserem Korpus das folgende Beispiel diskutiert: Bsp.1: Standardtürkisch: parktaki kadõnlar * dedikodularõ ne üzerine Die Frauen im Park, worüber geht ihr Geschwätz parktaki kadõnlar-õn dedikodularõ ne üzerine 3 Das gilt insbesondere für die Arbeiten im deutschsprachigen Raum, so z.b. Schwenk (1988), Hepsöyler/Liebe- Harkort (1988), Aytemiz (1990), Menz (1991), Sarõ (1995), Rehbein (2001), Cabadağ (2001). Und in den wenigen Fällen, wo mündliche Daten analysiert werden, handelt es sich nicht um Alltagsgespräche, sondern um asymmetrische Interviews zwischen erwachsenen Interviewern und befragten Kindern (Pfaff 1991, Herkenrath/ Karakoç 2000), oder für Forschungszwecke aufgenommene, d.h. aufgabenorientierte, mündliche Nacherzählungen von Bildergeschichten (Hepsöyler/Liebe-Harkort 1991) und Stummfilmen (Menz 1991). 4
5 Würde man bei der Analyse dieses Beispiels die Norm der geschriebenen Sprache als Bezugsebene ansetzen, so müsste man das Fehlen des Genitivsuffixes õn an kadõnlar (= die Frauen) als Fehler/Auffälligkeit deklarieren. Die leicht steigende Intonation (angezeigt durch Pfeil nach oben) und eine kurze Redepause (indiziert durch Sternchen) nach kadõnlar verdeutlichen jedoch, dass die Nominalphrase parktaki kadõnlar (= die Frauen im Park) ausgeklammert vorangestellt wird. Aus der Forschung zur gesprochenen Sprache ist bekannt, dass solche Freien Themen eine geläufige Technik zur vorgreifenden Aufmerksamkeitsfokussierung (Selting 1993: 310) auf einen neuen Themenaspekt sind. So betrachtet ist die vorangestellte Nominalphrase mit kadõnlar im Nominativ statt Genitiv als ein gemäß der Syntax der gesprochenen Sprache unauffälliges Freies Thema zu interpretieren. Hinsichtlich dieser methodologischen Problemlage bleibt festzuhalten, dass die Untersuchung der gesprochenen Sprache eine unverzichtbare Forschungsrichtung ist, wenn man Aussagen über Entwicklung und Dynamik von gesprochenen Varietäten (was das Türkische in der Diaspora zweifellos ist) machen will. 4 Denn eine solche Fokusverschiebung brächte mit sich, dass man nicht nur von einer Norm, nämlich die der schriftsprachlichen Standardsprache, sondern von verschiedenen Normen auszugehen hat. Der Turkologe Bernt Brendemoen (1998: 240) weist in diesem Zusammenhang auf einige Besonderheiten der türkischen Dialekte hin, die in Bezug zur kodierten Schriftsprache beanstandet würden. Compared with Standard Turkish, most dialects show a tendency to prefer less complex sentences. Hypotactical constructions are not very common. Direct speech is much more frequently used than indirect speech expressed by means of subordinate nominal clauses. Notably in the northeast, constituent order is freer than in Standard Turkish. Thus, the post-verbal position can be used for focused constituents, particularly adverbial phrases expressing goal or purpose [ ] Another important characteristic of the Trabzon and partly Rize dialects is that anaphoric pronouns are used in cases where Standard Turkish would normally dispense with them. [Unsere Hervorhebungen] Einige der von Brendemoen aufgezählten Merkmale wie redundante anaphorische Pronomen sind auch im Türkischen der Migranten zu beobachten. Aber nicht selten werden diese in der Forschungsliteratur als Deutscheinflüsse diskutiert, ohne zu hinterfragen, dass sie vielleicht ein Charakteristikum des gesprochenen, ggf. dialektalen Türkischen sind. b) Migranten der zweiten und dritten Generation erfahren ihre schulische Sozialisation in deutscher Sprache und haben nur wenig bis gar keinen schriftsprachlichen Input aus dem Türkischen. Mit anderen Worten erwerben sie schriftsprachliche Kompetenzen und damit zusammenhängendes Textsortenwissen (wie man z.b. eine Nacherzählung zu verfassen hat) fast ausschließlich in Deutsch. Wir denken, dass es aus diesem Grund im schriftsprachlichen 4 Johanson (1975) hat bereits vor knapp drei Jahrzehnten auf diesen Punkt aufmerksam gemacht. Aber leider ist er bis auf wenige Ausnahmen (z.b. Schroeder (1999) zum Bereich der Nominalphrasen und Erdal (1999) zum Bereich des Nachfelds) ein Desiderat der linguistischen Turkologie geblieben. 5
6 Türkisch der Probanden zu Übertragungen (Interferenzen) aus dem Deutschen kommt, die so in ihrem mündlichen Sprachgebrauch nicht vorzufinden sind. Als Beispiel hierfür sei an dieser Stelle die Verwendung des türkischen Konnektors ve (= und) diskutiert. Aytemiz (1990) und Rehbein (2001) stellen in ihren Untersuchungen von schriftlichen Nacherzählungen fest, dass ve der am häufigsten verwendete Konnektor ist (im Vergleich zu seiner Verwendung bei Türkeitürken, die den Konnektor nur selten gebrauchen). Sie führen die Frequenz von ve auf den Einfluss des Deutschen zurück, wo der Konnektor und häufig verwendet würde. 5 Wir teilen ihre Interpretation, kritisieren aber ihre Generalisierung, dass dies ein Charakteristikum des Türkischen in Deutschland sei. Denn unsere Analyse von vier mündlichen Erzählungen aus unserem Korpus 6 zeigt folgende Frequenz bei den verwendeten Konnektoren: Tabelle 1: Konnektoren Türkische Konnektoren 15x ondan sonra (= und danach), 11x -de/-da (= und) 11x -de/-da (= auch), 7x sonra (= danach) Deutsche Konnektoren 16x und, 7x danach 6x dann, 2x und dann Aus der Tabelle geht hervor, dass der deutsche Konnektor und auch von Migrantenjugendlichen sehr häufig (16x) gebraucht wird. Aber entgegen der These von Aytemiz und Rehbein wird sein türkisches Äquivalent ve kein einziges Mal verwendet, woraus unserer Meinung nach ersichtlich wird, dass es sich bei diesem Konnektor um ein Charakteristikum der schriftlichen Textproduktion handelt. Aufgrund von Unsicherheiten, fehlender Übung und/oder Kompetenz der Probanden lassen sich in der Schriftlichkeit diese und andere Besonderheiten und Interferenzen finden, während sie in ihrem mündlichen Sprachgebrauch gänzlich fehlen. 7 Zum Schluss unserer methodologischen Anmerkungen wollen wir an den Anfang unseres Forschungsüberblicks zurückkommen. Die von Johanson aufgeworfene Frage, ob sich in der Diaspora eine eigenständige Varietät entwickelt, ist im Wesentlichen darüber zu klären, ob die Besonderheiten, sei es im Repertoire von einzelnen Individuen, von Gruppen oder der großen Sprachgemeinschaft, singulär oder rekurrent vorkommen. Aber neben den beiden dis- 5 Auch Johanson (1992: 182) erwähnt, dass [u]nter Deutschlandtürken manchmal eine übertriebene Verwendung von ve und unter Einfluß des deutschen und festgestellt [wird]. Leider führt der Autor keine Arbeiten oder empirische Daten auf, die diese These bestätigen bzw. nachweisen könnten. 6 Die Erzählungen entstammen aus dem Material der Powergirls. 7 Das stimmt auch mit Schaufelis (1994: 207) Beobachtung überein, die in einer schriftlich verfassten Bildergeschichte eines holländisch-türkischen Kindes die häufige Verwendung von ve festhält. Generell bemerkt Schaufeli zur Mündlichkeit und Schriftlichkeit der von ihr untersuchten türkischen Kinder in den Niederlanden, dass children in the Netherlands who produce a relatively cohesive oral narrative do not necessarily produce a relatively cohesive written narrative (ebd.: 208). 6
7 kutierten Gesichtspunkten der Interferenzlastigkeit und Konzentration auf schriftliche Daten fällt in vielen Arbeiten negativ auf, dass sie den Aspekt der Singularität und Rekurrenz von Phänomenen nicht eindeutig bestimmen. Vielmehr werden Besonderheiten im Türkischen der Probanden herausgestellt und untersucht, ohne umgekehrt anzumerken, wie oft die beschriebene Besonderheit vom gleichen Probanden in anderen Fällen richtig/unauffällig realisiert wird. Wir denken, dass genaue prozentuale Ergebnisse statt vager Angaben wie selten oder häufig über auffällige und unauffällige Sprachbelege wichtig sind, um über die Singularität und Rekurrenz von Phänomenen den Verbreitungsgrad der Besonderheiten zu erfassen. 2. Die Gruppen und die Daten Die von uns untersuchten Gruppen stehen für verschiedene soziale Welten der türkischen Minderheit in Deutschland, die Gegenstand unseres Projekts Deutsch-Türkische Sprachvariation und die Herausbildung kommunikativer Stile in dominant türkischen Migrantengruppen am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim sind. 8 Die Gruppen werden von uns longitudinal beobachtet, ethnografisch beschrieben und die auf Tonband aufgezeichneten Interaktionen der Gruppenmitglieder werden mit soziolinguistischen und gesprächsanalytischen Methoden untersucht. Im vorliegenden Beitrag werden wir uns auf zwei der drei von uns untersuchten Gruppen konzentrieren. 9 Die Gruppe der Powergirls besteht aus Mädchen und jungen Frauen, die zwischen 15 und 22 Jahre alt sind und in einem der Mannheimer Stadteile leben, die sie selbst als Ghetto bezeichnen (über 60% der Einwohner sind nicht-deutscher Herkunft). Sie treffen sich regelmässig in einer städtischen Einrichtung, wo sie zusammen Hausaufgaben machen und ihre Freizeit miteinander verbringen. Unser Korpus der Powergirls besteht aus natürlichen Gruppeninteraktionen, die charakterisiert sind durch schnelle und impulsive situational talks, Alltagserzählungen, Spielsequenzen, etc. Daher sind die einzelnen Redebeiträge tendenziell kurz, beinhalten selten komplexe Einbettungen und längere Wortsucheprozesse. Die gängige Kommunikationspraxis der Powergirls zeichnet sich durch eine dichte deutsch-türkische Sprachmischung aus. Monolingualer Sprachgebrauch über längere Zeit, sei es Deutsch oder Türkisch, kommt in der Ingroup-Kommunikation selten vor. 10 Für den vorliegenden Beitrag haben wir aus dem gemischtsprachlichen Material (aus sechs verschiedenen Aufnahmen) Äuße- 8 Das Projekt ist Bestandteil der bis 2004 von der DFG geförderten Forschergruppe Sprachvariation als kommunikative Praxis [ 9 Die dritte Gruppe der Unmündigen verwendet in der Ingroup-Kommunikation nur peripher Türkisch, bzw. deutsch-türkische Mischungen, was sich für eine quantitative Untersuchung wie diese als nicht ausreichend herausstellte; vgl. Cindark (i.vorb.). 10 Für detaillierte Untersuchungen zur Sprache, Variationspraxis und zur sozialen Welt der Powergirls siehe Keim (2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2003). 7
8 rungen mit Türkisch als Matrixsprache isoliert und analysiert. Die faktische Gesamtlänge des untersuchten Materials beträgt drei Stunden. Die zweite Gruppe der Europatürken ist eine europaweit organisierte Vereinigung von Jungakademikern und -akademikerinnen. Die Kerngruppe bilden Mitglieder, die zwischen 25 und 33 Jahre alt und wie die Powergirls Kinder von sogenannten Gastarbeitern sind. Daneben gibt es die türkeitürkischen Mitglieder, die sich zu Studienzwecken in Europa aufhalten. Die Europatürken definieren sich als moderne und gebildete europäische Türken, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in der Diaspora ein positives Bild der Türken und der Türkei zu vermitteln. Als aufstiegs- und eliteorientierte Akademiker verstehen sie sich als ein integratives Bindeglied zwischen der Türkei und Europa. In ihrer Ingroup-Kommunikation versuchen sie nach dem Vorbild der türkeitürkischen Mitglieder ausschließlich Standardtürkisch zu verwenden. Trotz einiger Lücken und Schwierigkeiten im Türkischen wechseln sie oft dennoch nicht ins Deutsche und arbeiten so konsequent an einem elaborierten Türkisch. Das bedeutet im Ergebnis, dass sie deutsch-türkische Mischungen meiden, auch weil sie sie als Ausdruck von doppelter Halbsprachigkeit betrachten. Für den vorliegenden Beitrag haben wir eine zweistündige Aufnahme analysiert, bei der sich die Mitglieder über biografische Erlebnisse unterhalten und die zu 90 % auf Türkisch verläuft. Die Redebeiträge (nicht nur bei dieser Aufnahme, sondern generell bei den Treffen/Interaktionen der Europatürken ) sind im Vergleich zum Material der Powergirls länger und die Äußerungen komplexer Die Analyse Bei der empirischen Analyse haben wir uns für die drei Bereiche der Fragepartikel, Verbrektion und der anaphorischen Pronomen entschieden. Unser Fokus richtet sich darauf, weil diese im Deutschen und Türkischen stark divergieren, und weil sie verschiedene Ebenen der Sprache abdecken: Die Fragepartikel betrifft einen Teilbereich der Syntax, die Verbrektion den zentralen Bereich der Syntax und die anaphorischen Pronomen gehen über die Syntax hinaus und sind auf der Text- und Diskursebene relevant. Im Folgenden werden wir jeweils kurz die untersuchten Bereiche erläutern. Danach werden wir bisherige Forschungsergebnisse zusammenfassen, sofern sie zu den drei von uns untersuchten Ebenen vorliegen. Abschließend werden wir tabellarisch unsere Ergebnisse aus den beiden Gruppen vorstellen und diskutieren. 11 Eine ausführliche Analyse der Europatürken findet sich in Aslan (i.vorb.). 8
9 3.1. Die anaphorischen Pronomen Die Verwendung von anaphorischen Pronomen ist im Deutschen obligatorisch. Im Standardtürkischen können sie weggelassen werden, weil Person und Numerus in den Flexionsendungen des Prädikats angezeigt werden. Ihre Verwendung ist adäquat, wenn damit bestimmte pragmatische Funktionen erfüllt werden, wie z.b. (Wieder-)Einführung von Themen, Emphase, Kontrastierung, Vermeidung von Mehrdeutigkeiten, etc. Liegt keine dieser Funktionen vor, handelt es sich um einen redundanten Pronomengebrauch, der nicht grammatikalisch, aber pragmatisch auffällig ist. 12 Aarssen (1996: 120) beobachtet bezüglich der Themenfortführung und wechsel in Erzählungen von vier- bis fünfjährigen türkischen Kindern in den Niederlanden keine Unterschiede zu gleichaltrigen türkeitürkischen Kindern. Beide Gruppen verwenden in diesem Alter noch häufig redundante Pronomen. 13 Eine partielle Auffälligkeit hält dagegen Pfaff (1991: 121f.) in ihren mündlichen Daten von drei acht- bis neunjährigen türkischen Kindern in Deutschland fest. Die beiden türkischdominanten Kinder weisen beim Personalpronomen der 3. Person in 2% bzw. 5% der Fälle redundante Verwendung auf. Die Quote des dritten deutschdominanten Kindes liegt mit 8% nur unwesentlich höher. Auf ein ähnliches Ergebnis kommt Schaufeli (1994: 216). In ihrer Untersuchung mündlicher und schriftlicher (Nach-)Erzählungen von jeweils 18 zwölfjährigen türkeitürkischen und niederländisch-türkischen Kindern beobachtet sie marginale Auffälligkeiten bei den Bilingualen. Sie zeigen lediglich Auffälligkeiten bei Themenwechseln, indem sie in einigen Fällen inadäquate anaphorische Pronomen verwenden und in anderen Fällen Nullanaphern zeigen, wo eine Nominalphrase zu erwarten wäre. 14 Neben diesen Arbeiten, die den Bereich der anaphorischen Pronomen systematisch analysieren und im Ergebnis nur auf partielle oder marginale Auffälligkeiten kommen, gibt es Untersuchungen, die lediglich die auffälligen Beispiele fokussieren, ohne sie in Relation zu den unauffälligen Sprachbelegen zu setzen. In Menz (1991: 45ff.) und Rehbein (2001: 325) finden sich vier bzw. ein Beleg für redundante pronominale Subjekte und Objekte. Während Menz diese beispielhaft als mögliche Deutscheinflüsse analysiert, ohne darüber hinaus zu generalisieren, sieht Rehbein in diesem Bereich die Tendenz, dass deictic procedures are moved into (subject-/ object-) positions occupied in European languages by pronouns (ebd.). Cabadağ geht sogar einen Schritt weiter und meint, dass das im Standardtürkischen fakultative anaphorische Personalpronomen bereits ein obligatorischer Bestandteil der Prädikation (2001: 12 Vgl. Ediskun (1992 : 333), Csató/Johanson (1998: 223f.), Lewis (2000: 65f.). 13 Siehe dazu auch Aksu-Koç/Slobin (1985: 871). 14 Siehe auch Verhoeven (1988), der einen ähnlichen Trend im Sprachgebrauch 8-jähriger Bilingualer (holländisch-türkisch) beobachtet. 9
10 243) der Diasporavarietät geworden sei. Leider lassen sich aber in seiner Arbeit keine empirischen Belege finden, die seine These stützen. Auch Aytemiz (1990) sieht den Bereich der anaphorischen Pronomen als deutschbeeinflusst. In 40 Aufsätzen von deutsch- und türkischdominanten Jugendlichen zählt er insgesamt 16 Fälle von redundanten Personalpronomen. 15 Der Autor lässt aber unerwähnt, dass die 16 Pronomen von 16 verschiedenen Schülern formuliert wurden, was im Ergebnis nur eine Auffälligkeit pro Aufsatz ausmacht und somit unserer Meinung nach von marginaler Bedeutung ist. Das Ergebnis unserer Untersuchung ist bei den Powergirls eine 3%ige Verwendung von redundanten anaphorischen Pronomen, wie man aus Tabelle 2 entnehmen kann. In 63% der Fälle beobachtet man bei ihnen richtige Nullanaphern und zu 34% sind die anaphorischen Pronomen adäquat verwendet, d.h. ihre Äußerungen sind - was den Gebrauch bzw. Nichtgebrauch von anaphorischen Pronomen betrifft - zu 97 % unauffällig. Tabelle 2: Anaphorische Pronomen Nullanapher adäquate Verwendung redundante Verwendung Powergirls 306 (63%) 162 (34%) 14 (3%) Europatürken 1872 (76%) 363 (15%) 213 (9%) Im Material der Europatürken werden die anaphorischen Pronomen in 76% der Fälle korrekterweise weggelassen und 15% der Pronomen werden adäquat verwendet. Somit sind 91% ihrer Sprachbelege unauffällig. In 9% der Fälle werden anaphorische Pronomen redundant gebraucht, wie im folgenden Beispiel 2 das hervorgehobene Personalpronomen ben (=ich), das bei gleichbleibendem Erstaktanten und ohne pragmatische Funktion überflüssig ist (kursiv ist die Hypotaxe markiert, worauf wir unten eingehen). Bsp.2: inşaat mühendisliği bölümünde üç tane türktük onun eksikliğini hissettim bide würzburg tipik katolik ve memur şehri biraz kasvetli havasõ tabi gidip gelmenin de dezavantajlarõ vardõ fakat kalsaydõm- * pek memnun kalmõyacağamõ düşünerek ben bi sene sonra yatay geçiş yaptõm frankfurta geçtim Im Fachbereich für Bauingenieurwesen waren wir drei Türken diesen Mangel [an anderen Türken] habe ich gespürt außerdem ist Würzburg eine typisch katholische Beamtenstadt ihre Atmosphäre ist etwas verstaubt natürlich hatte dieses Hin- und Herfahren auch seine Nachteile aber wenn ich geblieben wäre- * daran denkend, dass 15 Aytemiz (1990: 131, 135, 177 und 179) 10
11 ich [dort] nicht sehr zufrieden sein würde, habe ich ein Jahr später einen gleitenden Studienplatzwechsel vollzogen nach Frankfurt Der Bereich der anaphorischen Pronomen ist bei den Powergirls im Wesentlichen intakt. Die wenigen Fälle von redundanten Pronomen (3%) halten wir gerade in der gesprochenen Sprache für erwartbar. Demgegenüber überrascht es ein wenig, dass die Europatürken als die Gruppe, die mehr und elaborierter Türkisch spricht, in diesem Bereich eine größere Auffälligkeit zeigt. Ein genauer Blick auf die einzelnen Belege zeigt aber, wie diese 9% zustande kommen. Die Europatürken zeigen die Auffälligkeiten vornehmlich in langen Turns und Redebeiträgen, die nicht in wenigen Fällen zusätzlich sprachstrukturell äußerst komplex sind. Wie in Beispiel 2 scheint im Umfeld von komplexen hypotaktischen Strukturen ( kalmõyacağamõ düşünerek ) bezüglich der nötigen Kohärenz eine momentane Unsicherheit zu herrschen, die mit der Verwendung des Pronomens aufgehoben wird. Deshalb interpretieren wir diese Vorkommen als Vermeidung von Mehrdeutigkeiten und Missverständnissen. Wenn man nur kurze Redebeiträge mit einfachen Sentenzen, d.h. ohne hypotaktische Einbettungen, in Betracht zieht (die charakteristisch für das Material der Powergirls sind), findet man bei den Europatürken nahezu keine Auffälligkeiten. So gesehen kann man auch bei den Europatürken schlussfolgern, dass die 9%ige Verwendung von redundanten Pronomen der Kohärenz und Eindeutigkeit dienen und generell der Bereich der anaphorischen Pronomen intakt ist. Letztendlich ist die Frage, wie auffällig oder unauffällig unsere Ergebnisse sind, nur über einen Vergleich mit türkeitürkischen Daten (aus vergleichbaren Gruppen und Kontexten) entscheidbar. Wie aus Brendemoens Zitat hervorging, scheint es nämlich in verschiedenen türkischen Dialekten so zu sein, that anaphoric pronouns are used in cases where Standard Turkish would normally dispense with them (1998: 240). Auf jeden Fall denken wir, dass die Quote der redundanten anaphorischen Pronomen mit 3% bzw. 9% zu gering ist, um hier von Deutscheinfluss zu reden. Denn, wenn das Türkische neben der Nullanapher auch den adäquaten Gebrauch von Pronomen vorsieht, ist es nur allzu erwartbar, dass eine geringe Menge von Fällen inadäquate Verwendung aufweist. So gesehen ist die Erklärung - wenn man denn eine bemühen muss - dieser geringen Auffälligkeit als ein Ausdruck von Sprachnorm(en)- auflockerung viel plausibler. In diesem Bereich von Interferenzen zu reden, ist unserer Meinung nach dann gerechtfertigt, wenn die Kategorie der redundanten Fälle die beiden anderen Kategorien zahlenmäßig übertrifft. 11
12 3.2. Die Fragepartikel Im Deutschen werden Entscheidungsfragen mit Inversion gebildet, in der gesprochenen Sprache auch ohne syntaktische Umstellung durch eine steigende Intonation am Satzende. Im Standardtürkischen dagegen werden Entscheidungsfragen mit der Fragepartikel -mi realisiert. Diese steht immer nach dem erfragten Satzteil. Wird die gesamte Satzaussage hinterfragt, steht die Fragepartikel bei unmarkierter Wortstellung d.h. Verbendstellung am Satzende. 16 Dieser Teilbereich der Syntax ist von der Forschung bislang nicht untersucht worden. Nur in der valenztheoretisch-vergleichenden Untersuchung des Türkischen und Deutschen von Hess- Gabriel (1979: 59) lässt sich die Notiz finden, dass man bei türkischen Gastarbeiterkindern häufig türkische Fragesätze mit deutscher Intonationskurve fände. Diese seien für einen Türken ohne Deutschkenntnisse nicht als Frage zu identifizieren, da die Fragepartikel (-mi, -mü, -mõ, -mu), die als einziges Merkmal Entscheidungsfragen des Türkischen kennzeichnen, eben durch die Betonung ersetzt worden sind. Da die Autorin diesen Bereich nicht weiter untersucht, lassen sich in ihrer Arbeit leider keine empirischen Belege für ihre These finden. Aus Tabelle 3 geht hervor, dass insbesondere bei den Europatürken der Bereich der Entscheidungsfragen mit Partikel völlig intakt ist. Über das einmalige Vorkommen eines Fragesatzes ohne Partikel kann hinweggesehen werden, da ihm gegenüber 140 Fälle mit Fragepartikel stehen. Tabelle 3: Fragepartikel vorhanden nicht vorhanden Powergirls 85 (96%) 4 (4%) Europatürken 140 (99%) 1 (1%) Auch die Powergirls haben von insgesamt 89 Entscheidungsfragen 96% mit Partikel versehen. Lediglich in 4% der Fälle verwenden sie keine Partikel wie in Beispiel 3, wo nach duydun eine steigende Intonation (angezeigt durch Pfeil nach oben) die Fragepartikel -mu ersetzt. Bsp. 3 Standardtürkisch: duydun cemile Hast du gehört, Cemile? duydun mu cemile 16 Vgl. Ediskun (1992: 190ff. ), Csató/ Johanson (1998: 226f. ), Hengirmen (1998: 283f.), Lewis (2000: 103f.). 12
13 Eine Interpretation dieser Fälle von fehlenden Fragepartikeln als Interferenzen kann zwar nicht ausgeschlossen werden, halten wir aber aufgrund ihres geringen und sporadischen Vorkommens für nicht überzeugend. Vielmehr glauben wir, dass hier möglicherweise ein sprachinterner Ausgleichsprozess wirksam ist. Nach unseren Beobachtungen ist es nämlich ein Charakteristikum des Türkischen der kurdischen MigrantInnen, dass sie die Fragepartikel in der Regel weglassen. 17 Da im Wohnviertel der Powergirls viele kurdische MigrantInnen leben und einige der Powergirls selbst kurdischer Abstammung sind, halten wir dieses Ergebnis für den Ausdruck eines Ausgleichsprozesses, der zwischen den türkischen Dialekten und Ethnolekten in der Diaspora vonstatten geht. Eine andere von uns vorgenommene Untersuchung unterstützt diese These. Im Rahmen unseres Projekts haben wir Aufnahmen in einem Kindergarten gemacht, der sich in dem Stadtteil befindet, in dem auch die Powergirls leben. Aus diesem Korpus haben wir zwei Spielaufnahmen (jeweils von halbstündiger Länge) von vier 4- bis 6-jährigen türkischdominanten Mädchen untersucht. Das Türkische der Kinder weist in keinem Bereich erwähnenswerte Auffälligkeiten auf, bis auf die Bildung der Entscheidungsfragen. Von insgesamt 111 Entscheidungsfragen wurden 57% mit und 43% (!) ohne Fragepartikel gebildet. Die Interpretation dieser Fälle als Interferenzen aus dem Deutschen ist nicht möglich, da die Kinder kaum Deutsch können und keine der anderen Ebenen in ihrem Türkisch derartige Auffälligkeiten zeigt. Aus diesen Gründen ist die Erklärung dieser Auffälligkeit als sprachinternen Ausgleichsprozess viel plausibler Die Verbrektion Dieser Bereich ist von großem Interesse, da viele Verben im Deutschen und Türkischen unterschiedliche Rektionen besitzen. Hier kann man im Falle von Auffälligkeiten (die nicht dialektal bedingt sind) genauestens klären, ob sie auf Deutschinterferenzen oder auf eine Auflockerung der Sprachnorm(en) zurückzuführen sind. Bisher ist die Verbrektion nur selten systematisch untersucht worden. In der Regel werden Rektionsbeispiele unter allgemeineren Überschriften wie z.b. Wechsel in der Suffixstruktur 18 diskutiert. In Menz (1991: 32f.), Boeschoten (1994: 261), Backus/ Boeschoten (1998: 224) und Rehbein (2001: 327) werden ohne statistische Angaben über Häufigkeiten einzelne 17 Im Kurdischen gibt es wie im Deutschen, die beide eine indogermanische Sprache sind, keine Partikel in Entscheidungsfragen: In den Sätzen ohne Interrogativpronomen oder adverb wird [im Kurdischen] eine Frage nur mittels der Betonung zum Ausdruck gebracht (Zaradachet 1982: 129). 18 Rehbein (2001: 327). 13
14 Beispiele besprochen, bei denen die Verbrektion nicht der türkeitürkischen Standardnorm, sondern den deutschen Regeln folgen. Pfaff (1991: 114) stellt zwar Auffälligkeiten in diesem Bereich fest, aber bei den von ihr untersuchten vier- bis fünfjährigen Migrantenkindern befinden sich vom Standard abweichende Kasusmarkierungen im Bereich dessen, was auch bei monolingualen Kindern in der Türkei zu beobachten ist. 19 Bei Acht- bis Neunjährigen liegt die Quote von Kasusauffälligkeiten gar bei 0% bis 2%. Eine Ausnahme in ihren Daten ist ein deutschdominantes Kind, das in 15% der Fälle auffällige Verbrektion zeigt. 20 Dem widersprechen die Ergebnisse von Aytemiz (1990). In seiner Analyse der von der Verbrektion abhängigen Kasusmarkierungen stellt er fest, dass in diesem Bereich 26 von 40 Jugendlichen (gleichermaßen verteilt auf deutsch- und türkischdominante Probanden) in ihren Aufsätzen insgesamt 51 Auffälligkeiten 21 zeigen. Somit sei die Verbrektion einer der Bereiche, der am meisten von Interferenzen betroffen ist. Die Zahlen zur Verbrektion bei den Europatürken, wie sie in Tabelle 4 aufgeführt sind, weisen auf eine ungeheuere Stabilität in diesem zentralen Bereich der Grammatik hin. Nur 11 von 1030, also 1% der Kasusfälle entsprechen nicht der Verbrektion, die nach dem Standardtürkischen erforderlich ist. Tabelle 4: Verbrektion entspricht dem Standardtürkischen auffällig nach dem Standardtürkischen Powergirls 184 (94%) 11 (6%) Europatürken 1019 (99%) 11 (1%) Auch bei den Powergirls entspricht die überwiegende Mehrheit der Verbrektionen den standardtürkischen Fällen (94%). Nur zu 6% weichen die Fälle vom Standardtürkischen ab. Auch wenn 6% eine erklärungsbedürftige Quote ist, halten wir zunächst fest, dass wie bei den anaphorischen Pronomen und der Fragepartikel auch hier keine grundlegende, sondern eine partielle Abweichung vom Türkeitürkischen vorzuliegen scheint. Zur Erklärung der insgesamt 22 abweichenden Fälle aus den beiden Gruppen wollen wir die Beispiele im Folgenden genauer anschauen. 19 Aksu-Koç/ Slobin (1985: 854) halten generell zum Erwerb des Türkischen fest, dass die regelmäßige und transparente agglutinierende Morphologie von den Kindern sehr früh erworben wird. Die Kinder würden bereits in der Zweiwortphase, vor dem Alter von zwei Jahren, vom morphologischen System nominal wie verbal Gebrauch machen. 20 Wobei auch bei diesem Kind keine Auffälligkeiten in einfachen Nominalphrasen zu beobachten sind. Rektionsabweichungen seien begrenzt auf environments which are structurally and semantically complex (Pfaff 1991: 115). 21 Nach den von Aytemiz vorgelegten Tabellen (1990: 131, 135, 177 und 179) haben wir die Abweichungen im Bereich der Nomen und Verbalnomen zusammengenommen und sind so auf diese Zahl gekommen. 14
15 In den Tabellen 5 und 6 sind die elf abweichenden Beispiele der Powergirls und Europatürken aufgeführt. In der mittleren Spalte befinden sich die realisierten Verbrektionen der SprecherInnen. In den beiden äußeren Spalten sind die Verbrektionen notiert, die nach dem Standardtürkischen bzw. deutschen erforderlich sind. Eine weitere Anmerkung zu den Tabellen betrifft die drei Kategorien, in die wir die Beispiele eingeteilt haben. In der 1. Kategorie sind die Fälle zusammengefasst, bei denen die Verbrektionen im Deutschen und Türkischen übereinstimmen, aber die Powergirls bzw. die Europatürken eine ganz andere Rektion zeigen. Die 2. Kategorie stellt die Fälle dar, bei denen die beiden Sprachen jeweils eine andere Rektion verlangen, und die SprecherInnen weder der einen noch der anderen folgen. Schließlich befinden sich in der 3. Kategorie die Beispiele, die der deutschen Rektion entsprechend realisiert wurden, also als Interferenzen interpretiert werden könnten. Tabelle 5: Auffällige Beispiele bei der Verbrektion der Powergirls Standardtürkisch Bsp. Powergirls Standarddeutsch 1. a) Dativ Nominativ Dativ b) Akkusativ Nominativ Akkusativ c) Akkusativ Nominativ Akkusativ d) Akkusativ Dativ Akkusativ e) Akkusativ Dativ Akkusativ f) Akkusativ Dativ Akkusativ 2. a) Dativ Lokativ Akkusativ b) Nominativ Ablativ Akkusativ c) Genitiv Nominativ Dativ d) Dativ Lokativ Akkusativ 3. Lokativ Dativ Dativ Tabelle 6: Auffällige Beispiele bei der Verbrektion der Europatürken Standardtürkisch Bsp. Europatürken Standarddeutsch 1. a) Akkusativ Dativ Akkusativ b) Akkusativ Nominativ Akkusativ 2. a) Lokativ Akkusativ Dativ b) Lokativ Ablativ Dativ c) Lokativ Komitativ Dativ d) Lokativ Nominativ Dativ e) Dativ Nominativ Akkusativ f) Ablativ Nominativ Dativ/ Akkusativ g) Dativ Akkusativ (idiomat. Füg. ohne dt. Entspr.) 3. a) Lokativ Akkusativ Akkusativ b) Dativ Akkusativ Akkusativ Aus den Tabellen geht eindeutig hervor, dass die Mehrheit der Auffälligkeiten (Kategorien 1 und 2) nicht der deutschen Rektion folgen, also keine Interferenzen sind. In absoluten Zahlen 15
16 handelt sich hierbei bei den Powergirls um 10 von 11 und bei den Europatürken um 9 von 11 Fälle. In beiden Tabellen zusammen lassen sich in der 3. Kategorie nur 3 Belege (von insgesamt 22) finden, die als Interferenzen betrachtet werden könnten. Aber ein genauer Blick auf diese Fälle zeigt, um welche Interferenzen es sich dabei handelt. Beispiel 4 zeigt einen der beiden Fälle der Europatürken, bei dem die Verbrektion vom Standardtürkischen abweicht und ihrem deutschen Äquivalent folgt, d.h. die Sprecherin statt dem erforderlichen Dativsuffix ( -a ) ein Akkusativsuffix ( -õ ) setzt. Allerdings ist das Verb bakmak (= schauen/anschauen) ein sehr geläufiges, das die Sprecherin in allen anderen Fällen mit der richtigen Rektion verwendet, wie in Beispiel 5, das sie kurze Zeit nach der Äußerung in Beispiel 4 formuliert: Bsp. 4 Standardtürkisch: Bsp. 5 hayatõn-õ bi (...) bakõp so auf sein/ihr Leben schauend hayatõn-a bi bakõp yani onlar-a bakõyoruz also wir schauen uns sie an Da die Sprecherin bis auf Beispiel 4 bei der Rektion des Verbs bakmak keine Abweichungen zeigt, ist die Interpretation der Auffälligkeit als Interferenz möglich aber nicht überzeugend. Vielmehr scheint hier ein momentaner Versprecher oder eine partielle Unsicherheit vorzuliegen, die die Sprecherin unkorrigiert stehen lässt. Abschließend kann man also im Bereich der Verbrektion festhalten, dass sie weitgehend intakt ist. Im Material der Europatürken sind 1% und bei den Powergirls 6% der Fälle abweichend. Wie wir zeigen konnten, sind diese partiellen Abweichungen nicht auf Interferenzen, sondern zweifellos auf die Auflockerung der Sprachnorm(en) in der Diaspora zurückzuführen. Darüber hinaus kann man bei keiner der Auffälligkeiten rekurrentes Vorkommen verzeichnen. 4. Zusammenfassung und Ausblick Die von uns untersuchten Gruppen der Europatürken und Powergirls sind für die türkische Community in Deutschland in höchstem Maße repräsentativ. In nahezu jeder westdeutschen Stadt gibt es Stadtviertel mit hohem Migrantenanteil ( Ghettos ), in denen man auf soziale Welten von jugendlichen Migrantinnen wie die der Powergirls treffen kann. Charakteristisch für diese Deutsch-Türkinnen (Selbstbezeichnung der Powergirls ) ist in der Ingroup-Kommunikation eine tief einsozialisierte und routinisierte deutsch-türkische Varia- 16
17 tionspraxis. Unsere Ergebnisse bezüglich der Powergirls zeigen, dass häufige Mischungen in der Sprachpraxis nicht aus Sprachdefiziten resultieren. Ihr Türkisch hat sich als weitestgehend stabil mit einigen Auffälligkeiten erwiesen. 22 Auch die Europatürken stehen für eine sehr große und relevante soziale Welt. An fast allen (west-)deutschen Hochschulen kann man auf Vereinigungen von Studenten treffen, die wie die Europatürken an einem Selbstbild als gebildete europäische Türken arbeiten und sich für eine positive Darstellung der Türkei in Europa einsetzen. In diesen Gruppen ist es von wesentlicher Bedeutung, Türkisch zu reden bzw. an einem elaborierten Türkisch zu arbeiten. Aufgrund dieser sprachlichen Orientierung und der Präsenz von türkeitürkischen Studenten als sprachliche Vorbilder erfährt das Türkische der Europatürken, das anfänglich u.u. solche partiellen Auffälligkeiten wie die der Powergirls aufweist, innerhalb kurzer Zeit viel Input und einen großen Entwicklungsschub. Im Ergebnis sieht man dann in ihrem Türkisch kaum Auffälligkeiten. Für die Beantwortung der Frage, ob in Europa eine Diasporavarietät des Türkischen entsteht, sind unsere Analysen zu den Powergirls und Europatürken natürlich nicht ausreichend. Da gibt es noch viele andere, große soziale Welten, wie die der herkunftsorientierten politischen Gruppierungen, religiöse Milieus, etc., die dazu erforscht werden müssten. Dennoch glauben wir aber, ausgehend von (1.) unseren Ergebnissen und (2.) von einigen bedeutsamen Aspekten der türkischen Migration in Europa, zumindest eine tendenzielle Aussage diesbezüglich machen zu können. Zu (1.): Unsere Ergebnisse zu drei Bereichen des Türkischen der Powergirls und Europatürken verdeutlichen, dass das Türkische in der Diaspora nicht wesentlich vom Standardtürkischen abweicht. Gerade der zentrale Bereich der Grammatik, die Verbrektion, weist nur peripheres und singuläres Vorkommen von Auffälligkeiten auf. Aber auch die Bereiche der anaphorischen Pronomen und der Fragepartikel erwiesen sich größtenteils als intakt. Dennoch bleibt aber in den verschiedenen Bereichen eine Quote zwischen 1% und 9% an Auffälligkeiten festzuhalten. Gleichwohl diese Auffälligkeiten nicht rekurrent sind und eine partielle Abweichung vom Türkeitürkischen darstellen, reichen sie in der Begegnung zwischen Türkeitürken und Diasporatürken oft aus, dass die Ersteren die Sprache der Migranten als ab- 22 Unsere Befunde zu den Powergirls werden auch von Sirim (2003) bestätigt, die für ihre Magisterarbeit zwölf Aufnahmen der Gruppe untersucht hat. In ihrer Analyse der verschiedenen Bereiche wie Definitheit- Indefinitheit, Numerus, Kausativ-Passiv, Lexik und Gebrauch von Adjektiven, Adverbien und Partizipien, etc. kommt sie zu dem Ergebnis, dass bei den Migrantenkindern keineswegs von einer mangelnden Türkischkompetenz oder sogar von Halbsprachigkeit die Rede sein kann. Die grammatischen Teilbereiche des von den Probandinnen gesprochenen Türkisch und der Bereich der Lexik sind größtenteils intakt. Beispiele für eine partielle Norm(en)auflockerung sind nicht sehr frequent und auch der Einfluss des Deutschen auf die Migrantenvarietät ist gering (2003: 88f.). 17
18 weichend ansehen. Die fokussierte Aufnahme dieser wenigen Besonderheiten und ihre Generalisierung als charakteristische Eigenschaften des Diasporatürkischen führen zusammen mit den lexikalischen Lücken oft zu dem Trugschluss, dass es sich beim Türkischen in der Diaspora um eine eigene Varietät handelt. Zu (2.): Verschiedene Aspekte unterscheiden die türkische Migration in Europa in wesentlichen Punkten von der anderer Einwanderergruppen (z.b. die Überseemigration), wie (a) der anhaltende Nachzug von Migranten aus der Türkei insbesondere über Eheschließungen, (b) der enorme Anstieg von türkischen Medienangeboten seit Anfang der 90er Jahre (Satellitenfernsehen, private türkische Radiostationen, etc.) und (c) die geografische Nähe der Türkei, die häufige Besuche und Urlaubsaufenthalte ermöglicht. Alle diese Faktoren verdeutlichen zunächst, dass man in keiner Weise von einer isolierten Entwicklung der türkischen Sprachgemeinschaft in der Diaspora reden kann. Im Gegenteil fördern sie ungemein die anhaltende Wirksamkeit und Vitalität des Standardtürkischen in der Diaspora, sei es als Verkehrs- oder Prestigesprache. Daher ist es allein von diesen makrostrukturellen Gesichtspunkten ausgehend kaum zu erwarten, dass sich in Deutschland oder Europa eine eigenständige, relativ stabile Diasporavarietät des Türkischen entwickeln wird. Letztendlich kann die Frage, inwiefern die festgestellten Auffälligkeiten Besonderheiten des Türkischen in der Diaspora sind, nur geklärt werden, wenn sich die linguistische Turkologie verstärkt der Gesprochenen Sprache als Forschungsobjekt zuwendet. Mit Forschungen zu Charakteristiken des gesprochenen Türkeitürkischen im Allgemeinen und seinen aktuellen Entwicklungen im Besonderen bestünde eine Grundlage, das in der Diaspora verwendete Türkisch kontrastiv zu untersuchen. Unsere Ergebnisse des mündlichen Sprachgebrauchs zeigen, dass die in schriftsprachlichen Daten beobachteten Interferenzen, die die Entstehung einer deutschlandtürkischen Varietät nahe legen, im mündlichen Sprachgebrauch peripher bis verschwindend gering sind. 5. Bibliographie Aarssen, J. (1996): Relating events in two languages: acquisition of cohesive devices by Turkish-Dutch bilingual children at school age. Tilburg: Tilburg University Press. Aksu-Koç, A./ Slobin, D. (1985): The acquisition of Turkish. In: Slobin, D. (Hg.): The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. Vol.1. Hillsdale, NJ/ London: Erlbaum. S Aslan, S. (i.vorb.): Sozialstilistische Merkmale in Gesprächen der Europatürken. Aytemiz, A. (1990): Zur Sprachkompetenz türkischer Schüler in Türkischer und Deutsch. Frankfurt am Main: Lang Backus, A. (1996): Two in One. Bilingual Speech of Turkish Immigrants in the Netherlands. Tilburg: Tilburg University Press. 18
19 Backus, A./ Boeschoten, H. (1998): Language change in immigrant Turkish. In: Extra, G./ Maartens, J. (Hg.): Multilingualism in a multicultural context. Case studies on South Africa and Western Europe. Tilburg: Tilburg University Press. S Boeschoten, H. (1994): Second language influence on first language acquisition: Turkish children in Germany. In: Extra, G./ Verhoeven, L. (Hg.): The cross-linguistic study of bilingual development. Amsterdam: North-Holland. S Boeschoten, H. (1998): Codeswitching, codemixing, and code alternation: What a difference. In: Jacobson, R. (Hg.): Codeswitching worldwide. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter. S Boeschoten, H. (2000): Convergence an Divergence in Migrant Turkish. In: Mattheier, K. (Hg.): Dialect and migration in a changing Europe. Frankfurt am Main, u.a.: Lang. S Boeschoten, H./ Broeder, P. (1999): Zum Interferenzbegriff in seiner Anwendung auf die Zweisprachigkeit türkischer Immigranten. In: Johanson, L./ Rehbein, J. (Hg.): Türkisch und Deutsch im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz. S Brendemoen, B. (1998): Turkish Dialects. In: Johanson, L./ Csató, E.A. (Hg.): The Turkic Languages. London/ New York: Routledge. S Cindark, I. (i.vorb.): Die Unmündigen Der kommunikative soziale Stil einer Migrantengruppe. Cabadağ, T. (2001): Zur Genese einer Diasporavarietät des Türkeitürkischen. Universität Bielefeld. Dissertationsschrift. Online Erdal, M. (1999): Das Nachfeld im Türkischen und im Deutschen. In: Johanson, L./ Rehbein, J. (Hg.): Türkisch und Deutsch im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz. S Johanson, L. (1975): Gesprochenes Türkisch als Forschungsobjekt. In: Materialia Turcica 1. S Johanson, L. (1992): Strukturelle Faktoren in Türkischen Sprachkontakten. Stuttgart: Steiner. Johanson, L. (1988): Zur Entwicklung türkeitürkischer Varietäten in Nordwesteuropa. In: Turkish in North-West Europe Newsletter 1. S Hepsöyler, E./ Liebe-Harkort, K. (1988): Wörter und Begriffe Lücken im Kindesalter = Verlust der Gleichberechtigung in Beruf und Gesellschaft. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang. Hepsöyler, E./ Liebe-Harkort, K. (1991): Muttersprache und Zweitsprache. Türkische Schulanfängerinnen und Schulanfänger in der Migration Ein Vergleich. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang. Herkenrath, A./ Karakoç, B. (2002): Zum Erwerb von Verfahren der Subordination bei türkisch-deutsch bilingualen Kindern Transkripte und quantitative Aspekte. In: Universität Hamburg, SFB 538 Mehrsprachigkeit: AzM (Arbeiten zur Mehrsprachigkeit), Nr. 37. Hess-Gabriel, B. (1979): Zur Didaktik des Deutschunterrichts für Kinder türkischer Muttersprache. Tübingen: Narr. Hinnenkamp, V. (2002): Deutsch-türkisches Code-Mixing und Fragen der Hybridität. In: Hartung, W./ Shethar, A. (Hg.): Kulturen und ihre Sprachen. Die Wahrnehmung anders Sprechender und ihr Selbstverständnis. Berlin: trafo verlag. S Keim, I. (2001a): Die Powergirls. Aspekte des kommunikativen Stils einer Migrantinnengruppe aus Mannheim. In: Jakobs, Eva/ Rothkegel, Annely (Hg.): 19
20 Perspektiven auf Stil. Akten des Kolloquiums zum 60. Geburtstag von Barbara Sandig. S Keim, I. (2001b): Sprachvariation und kommunikativer Stil in einer jugendlichen Migrantinnengruppe in Mannheim. In: List, Gudula/ List, Günther (Hg.): Quersprachigkeit- Zum transkulturellen Registergebrauch in Laut- und Gebärdensprachen. Tübingen. S Keim, I. (2002a): Social style of communication and bilingual speech practices: Case study of three migrant youth groups of Turkish origin in Mannheim/ Germany. In: Turkic Languages 6/2. S Keim, I. (2002b): Die Verwendung von Formen der Mannheimer Stadtsprache in einer jugendlichen Migrantinnengruppe. In: Bateman, John/ Wildgen, Wolfgang (Hg.): Sprachbewusstheit im schulischen und sozialen Kontext. Frankfurt am Main/ Berlin/ New York. S Keim, I. (2002c): Sprachvariation und Bedeutungskonstitution. Die Verwendung von Gastarbeiterdeutsch in Gesprächen junger Türkinnen. In: Deppermann, Arnulf/ Spranz- Fogasy, Thomas (Hg.): be-deuten. Wie Bedeutung im Gespräch entsteht. Tübingen. S Keim, I. (2003): Sprach- und Kommunikationsverhalten von jugendlichen MirgantInnen türkischer Herkunft in Deutschland. In: Deutsche Sprache 2, (2002). S Keim, I./ Cindark, I. (2003): Deutsch-türkischer Mischcode in einer Migrantinnengruppe: Form von Jugendsprache oder soziolektales Charakteristikum? In: Neuland, Eva (Hg.): Jugendsprache Spiegel der Zeit. Tagungsband der internationalen Fachkonferenz in Wuppertal Frankfurt am Main: Lang. S Menz, A. (1991): Studien zum Türkisch der zweiten deutschland-türkischen Generation. Universität Mainz. Magisterarbeit. Pfaff, C. (1991): Turkish in contact with German: Language maintenance and loss among immigrant children in Berlin (West). In: International Journal of the Sociology of Language 90. S Rehbein, J. (2001): Turkish in European Societies. In: Lingua e Stile XXXVI-2. S Sarõ, M. (1995): Der Einfluß der Zweitsprache (Deutsch) auf die Sprachentwicklung türkischer Gastarbeiterkinder in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main u.a.: Lang. Selting, M. (1993): Voranstellungen vor den Satz. Zur grammatischen Form und interaktiven Funktion von Linksversetzung und Freiem Thema im Deutschen. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 21. S Schroeder, C. (1999): The Turkish nominal phrase in spoken discourse. Wiesbaden: Harrassowitz. Schaufeli, A. (1994): First language text cohesion in a Turkish-Dutch bilingual setting. In: Extra, G./ Verhoeven, L. (Hg.): The cross-linguistic study of bilingual development. Amsterdam: North-Holland. S Schwenk, H. (1988): Das Sprachvermögen zweisprachiger türkischer Kinder. Tübingen: Narr. Sirim, E. (2003): Bilinguales Sprachverhalten bei jungen Deutschtürken. (MS). Treffers-Daller, J. (1998): Variability in code-switching styles: Turkish-German codeswitching patterns. In: Jacobson, R. (Hg.): Codeswitching worldwide. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter. S
Referat: Typische Phänomene der Mehrsprachigkeit: Mischungen & Codeswitching
 Goethe Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen Dozentin: Dr. ders. Doris Stolberg Referentin: Anuschka Somogyi
Goethe Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen Dozentin: Dr. ders. Doris Stolberg Referentin: Anuschka Somogyi
Sprachanalysen bei Russlanddeutschen
 Sprachanalysen bei Russlanddeutschen Untersuchungsbeispiele aus dem Essener Projekt zum Spracherwerb von Aussiedlern (ESA) Gliederung Das ESA-Projekt: Möglichkeiten und Ziele Analysebereiche Syntaktische
Sprachanalysen bei Russlanddeutschen Untersuchungsbeispiele aus dem Essener Projekt zum Spracherwerb von Aussiedlern (ESA) Gliederung Das ESA-Projekt: Möglichkeiten und Ziele Analysebereiche Syntaktische
Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Referat. Typische Phänomene der Mehrsprachigkeit: Mischungen und Code-Switching. in Deutsch als Zweitsprache. Dienstag Uhr HZ13
 Referat Typische Phänomene der Mehrsprachigkeit: Mischungen und Code-Switching in Deutsch als Zweitsprache Dienstag 10-12 Uhr HZ13 Dozent : Magdalena Wojtecka Wichtiger Aspekt der Kommunikation: Konzept
Referat Typische Phänomene der Mehrsprachigkeit: Mischungen und Code-Switching in Deutsch als Zweitsprache Dienstag 10-12 Uhr HZ13 Dozent : Magdalena Wojtecka Wichtiger Aspekt der Kommunikation: Konzept
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung)
 Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
GER_C2.0606S. Bilinguale Erziehung. Education and children Speaking & Discussion Level C2 GER_C2.0606S.
 Bilinguale Erziehung Education and children Speaking & Discussion Level C2 www.lingoda.com 1 Bilinguale Erziehung Leitfaden Inhalt Viele Kinder, deren Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen sprechen,
Bilinguale Erziehung Education and children Speaking & Discussion Level C2 www.lingoda.com 1 Bilinguale Erziehung Leitfaden Inhalt Viele Kinder, deren Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen sprechen,
Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0
 Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0 Glossar zum BESK 2.0 bzw. BESK-DaZ 2.0 erstellt in Zusammenarbeit von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Schule
Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0 Glossar zum BESK 2.0 bzw. BESK-DaZ 2.0 erstellt in Zusammenarbeit von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Schule
AVS - M 01. Nr. Veranstaltungen SWS LP A Pflichtbereich 1 Einführung in die Phonetik & Phonologie Einführung in die Morphologie und Syntax 2 5
 AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden
AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden
GERMAN LANGUAGE Tania Hinderberger-Burton, Ph.D American University
 GERMAN LANGUAGE Tania Hinderberger-Burton, Ph.D American University www.companyname.com 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved. 10. Word Order www.companyname.com 2016 Jetfabrik Multipurpose
GERMAN LANGUAGE Tania Hinderberger-Burton, Ph.D American University www.companyname.com 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved. 10. Word Order www.companyname.com 2016 Jetfabrik Multipurpose
Transkript-Merkmal-Analysen. Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen
 Transkript-Merkmal-Analysen Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen 1. Transkript-/Text-Merkmal-Analyse Am Anfang Ihrer Arbeit sollten Sie eine Transkript-Merkmal-Analyse bzw.
Transkript-Merkmal-Analysen Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen 1. Transkript-/Text-Merkmal-Analyse Am Anfang Ihrer Arbeit sollten Sie eine Transkript-Merkmal-Analyse bzw.
Produktion von Relativsätzen III Elizitierte Produktion
 Produktion von Relativsätzen III Elizitierte Produktion Referat von Isa-Marie Trussina Seminar: Relativsätze im Spracherwerb Dozentin: Prof. Dr. Petra Schulz Wintersemester 2011/2012 Gliederung 1. Allgemeines
Produktion von Relativsätzen III Elizitierte Produktion Referat von Isa-Marie Trussina Seminar: Relativsätze im Spracherwerb Dozentin: Prof. Dr. Petra Schulz Wintersemester 2011/2012 Gliederung 1. Allgemeines
Profilanalyse - Verbstellung in Kindertexten analysieren
 Profilanalyse - Verbstellung in Kindertexten analysieren Dr. Hanna Sauerborn PH Freiburg und Adolf-Reichwein Schule Freiburg, 017 Worum geht es? Verschiedene Verbstellungen im Deutschen Im Deutschen gibt
Profilanalyse - Verbstellung in Kindertexten analysieren Dr. Hanna Sauerborn PH Freiburg und Adolf-Reichwein Schule Freiburg, 017 Worum geht es? Verschiedene Verbstellungen im Deutschen Im Deutschen gibt
AVS - M 01. Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ Verantwortlich:
 AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden in diesem Basismodul vertraut
AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden in diesem Basismodul vertraut
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik. Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz. Robert Zangenfeind
 Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Grammatik des Standarddeutschen III. Michael Schecker
 Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Seminar: Relativsätze im Spracherwerb Dozentin: Prof. Dr. Petra Schulz WS 2011/2012. Referent: Pljevaljcic Sascha Datum:
 Seminar: Relativsätze im Spracherwerb Dozentin: Prof. Dr. Petra Schulz WS 2011/2012 Referent: Pljevaljcic Sascha Datum: 15.11.2011 Gliederung Bisherige RS-Forschung RS-Fehler im Spracherwerb Faktoren,
Seminar: Relativsätze im Spracherwerb Dozentin: Prof. Dr. Petra Schulz WS 2011/2012 Referent: Pljevaljcic Sascha Datum: 15.11.2011 Gliederung Bisherige RS-Forschung RS-Fehler im Spracherwerb Faktoren,
Sprachkontaktforschung
 Claudia Maria Riehl Sprachkontaktforschung Eine Einführung Vorwort 9 1 Einleitung 11 1.1 Was ist Sprachkontakt? 11 1.2 Aspekte des Sprachkontakts: Aufbau des Buchs 13 2 Wirkungen des Sprachkontakts 15
Claudia Maria Riehl Sprachkontaktforschung Eine Einführung Vorwort 9 1 Einleitung 11 1.1 Was ist Sprachkontakt? 11 1.2 Aspekte des Sprachkontakts: Aufbau des Buchs 13 2 Wirkungen des Sprachkontakts 15
HPSG. Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer
 HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
Hast du Fragen? Begleitmaterial Station 5. Ziel: Idee und Hintergrund. Kompetenzen. Fragen rund um das Thema Sprachen
 Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen
 Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen
 Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Schulpraktische Studien. Vorbereitung SoSe 14
 Schulpraktische Studien Vorbereitung SoSe 14 SS 2010 Deutsch als Zweitsprache 2 Veränderung der Anteile von Schülern auf verschiedenen Schularten (Sek. I) zw. 2000/01 und 2006/07 SS 2010 Deutsch als Zweitsprache
Schulpraktische Studien Vorbereitung SoSe 14 SS 2010 Deutsch als Zweitsprache 2 Veränderung der Anteile von Schülern auf verschiedenen Schularten (Sek. I) zw. 2000/01 und 2006/07 SS 2010 Deutsch als Zweitsprache
URIEL WEINREICH. Sprachen in Kontakt. Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung. Mit einem Vorwort von Andre Martinet
 URIEL WEINREICH Sprachen in Kontakt Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung Mit einem Vorwort von Andre Martinet Herausgegeben und mit einem Nachwort zur deutschen Ausgabe versehen von A.
URIEL WEINREICH Sprachen in Kontakt Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung Mit einem Vorwort von Andre Martinet Herausgegeben und mit einem Nachwort zur deutschen Ausgabe versehen von A.
Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch
 Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
T 93/ '03? 3. Claudia Maria Riehl. Sprachkoritaktforschung. Eine Einführung. 3., überarbeitete Auflage narr VERLAG
 T 93/ '03? 3 Claudia Maria Riehl Sprachkoritaktforschung Eine Einführung 3., überarbeitete Auflage 2014 narr VERLAG Inhaltsverzeichnis Vorworte 1 Einleitung 1.1 Was ist Sprachkontakt? 1.2 Aspekte des Sprachkontakts:
T 93/ '03? 3 Claudia Maria Riehl Sprachkoritaktforschung Eine Einführung 3., überarbeitete Auflage 2014 narr VERLAG Inhaltsverzeichnis Vorworte 1 Einleitung 1.1 Was ist Sprachkontakt? 1.2 Aspekte des Sprachkontakts:
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Ich treffe Neuer. Verben mit unterschiedlicher Valenz Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch von Schülerinnen und Schülern generierte Sätze zu ein-, zweiund dreiwertigen Verben (z. B. auf
Ich treffe Neuer. Verben mit unterschiedlicher Valenz Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch von Schülerinnen und Schülern generierte Sätze zu ein-, zweiund dreiwertigen Verben (z. B. auf
Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen
 Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 28.6.2007
Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 28.6.2007
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
AVS-M 01. b) verpflichtende Nachweise: Keine
 AVS-M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ Prof. Dr. Johannes Helmbrecht 3. Inhalte des
AVS-M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ Prof. Dr. Johannes Helmbrecht 3. Inhalte des
Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung. thomas fritz lernraum.
 Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung thomas fritz lernraum.wien oktober 2012 was bedeutet Mehrsprachigkeit? Individuum Gesellschaft
Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung thomas fritz lernraum.wien oktober 2012 was bedeutet Mehrsprachigkeit? Individuum Gesellschaft
DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS
 DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS ROBERT HELMDACH LUKAS WIEDERHOLD 1. Schlüsselworte Digital Natives, Digital Immigrants, E-Learning, Generation, Millennials, Net Generation, Netzgeneration 2. Kontext
DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS ROBERT HELMDACH LUKAS WIEDERHOLD 1. Schlüsselworte Digital Natives, Digital Immigrants, E-Learning, Generation, Millennials, Net Generation, Netzgeneration 2. Kontext
Materialien zu unseren Lehrwerken
 Word order Word order is important in English. The word order for subjects, verbs and objects is normally fixed. The word order for adverbial and prepositional phrases is more flexible, but their position
Word order Word order is important in English. The word order for subjects, verbs and objects is normally fixed. The word order for adverbial and prepositional phrases is more flexible, but their position
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
ABSCHNITT I EINLEITUNG
 1 ABSCHNITT I EINLEITUNG A. Hintergrund des Problems Sprache wird von allen genutzt, um ihre Wünsche, Ideen und Überlegungen zu äußern. Außerdem benutzen Menschen auch Sprache, damit sie miteinander in
1 ABSCHNITT I EINLEITUNG A. Hintergrund des Problems Sprache wird von allen genutzt, um ihre Wünsche, Ideen und Überlegungen zu äußern. Außerdem benutzen Menschen auch Sprache, damit sie miteinander in
Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen
 @ 8005-21, Seite 1 Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen Abschnitt 1 (allgemeine Lernvoraussetzungen) Die Lerner kennen die Eigennamen, können die Personen auf Abbildungen
@ 8005-21, Seite 1 Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen Abschnitt 1 (allgemeine Lernvoraussetzungen) Die Lerner kennen die Eigennamen, können die Personen auf Abbildungen
2. Theoretischer Teil
 2. Theoretischer Teil 2.1 Forschungsstand Überblick über Studien zum Zweitspracherwerb Der Zweitspracherwerb ist ein altes, aber nach wie vor hochaktuelles Thema, das seit den 1970er Jahren in Deutschland
2. Theoretischer Teil 2.1 Forschungsstand Überblick über Studien zum Zweitspracherwerb Der Zweitspracherwerb ist ein altes, aber nach wie vor hochaktuelles Thema, das seit den 1970er Jahren in Deutschland
Wissenschaftliches Schreiben. Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß
 Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:
Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:
Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert
 VitDovalil Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften 0. Vorwort.
VitDovalil Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften 0. Vorwort.
Sprachprüfung (24 Punkte)
 Berufsmittelschulen des Kantons Zürich Aufnahmeprüfung 00 DEUTSCH Sprachprüfung (4 Punkte) () Jedenfalls ist sie zur Verabredung gekommen, Mischa fiel ein Stein vom Herzen, er hat in die Tasche gegriffen
Berufsmittelschulen des Kantons Zürich Aufnahmeprüfung 00 DEUTSCH Sprachprüfung (4 Punkte) () Jedenfalls ist sie zur Verabredung gekommen, Mischa fiel ein Stein vom Herzen, er hat in die Tasche gegriffen
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M.
 Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Contents / Inhalt. Lilijana Stepic, ERLERNEN WIR DIE ENGLISCHEN ZEITEN 205. Vorwort... und noch einige Tipps zum erfolgreichen Lernen
 Contents / Inhalt Vorwort... und noch einige Tipps zum erfolgreichen Lernen Simple Present and Present Progressive / Präsens (Gegenwart und Verlaufsform der Gegenwart) 7_ Simple Present / Präsens 7 Use
Contents / Inhalt Vorwort... und noch einige Tipps zum erfolgreichen Lernen Simple Present and Present Progressive / Präsens (Gegenwart und Verlaufsform der Gegenwart) 7_ Simple Present / Präsens 7 Use
2. Klausur im Fach Deutsch
 2. Klausur im Fach Deutsch Q2 LK, Bod Aufgabentyp IIB Aufgabe 1 Analysieren Sie Muhammet Merteks Kolumne Türkische Kinder im Labyrinth der Gesellschaft im Hinblick auf den Problemkontext, den Inhalt, die
2. Klausur im Fach Deutsch Q2 LK, Bod Aufgabentyp IIB Aufgabe 1 Analysieren Sie Muhammet Merteks Kolumne Türkische Kinder im Labyrinth der Gesellschaft im Hinblick auf den Problemkontext, den Inhalt, die
Nomen Akkusativ. Inhaltsverzeichnis. Allgemeines. Der Akkusativ im Deutschen
 Nomen Akkusativ Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Der Akkusativ im Deutschen 3 Der Akkusativ im Englischen 4 Der Akkusativ im Ungarischen ( akkusatívus oder tárgyeset ) 4.1 Die Bildung 5 Quelle Allgemeines
Nomen Akkusativ Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Der Akkusativ im Deutschen 3 Der Akkusativ im Englischen 4 Der Akkusativ im Ungarischen ( akkusatívus oder tárgyeset ) 4.1 Die Bildung 5 Quelle Allgemeines
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Fragen im Südslavischen
 Universität des Saarlandes Slavische Sprachen Univ. Prof. Marti, Prof. Avgustinova, Dr. Andreeva Julia Bellmann 11.07.2016 Studien über die phonetische Typologie slavischer Sprachen: Intonation von Ja/nein
Universität des Saarlandes Slavische Sprachen Univ. Prof. Marti, Prof. Avgustinova, Dr. Andreeva Julia Bellmann 11.07.2016 Studien über die phonetische Typologie slavischer Sprachen: Intonation von Ja/nein
Satzglieder: Subjekt, Prädikat und Objekt. Satzglieder: Prädikat, Subjekt und Objekt
 https://www.woxikon.de/referate/deutsch/satzglieder-subjekt-praedikat-und-objekt Satzglieder: Subjekt, Prädikat und Objekt Fach Deutsch Klasse 9 Autor Anja333 Veröffentlicht am 02.09.2018 Zusammenfassung
https://www.woxikon.de/referate/deutsch/satzglieder-subjekt-praedikat-und-objekt Satzglieder: Subjekt, Prädikat und Objekt Fach Deutsch Klasse 9 Autor Anja333 Veröffentlicht am 02.09.2018 Zusammenfassung
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur
 Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Relativische Prädikationen im Baschkirischen
 Michael Heß Relativische Prädikationen im Baschkirischen 2008 Harrassowitz Verlag Wiesbaden ISSN 0177-4743 ISBN 978-3-447-05621-2 Inhalt Verzeichnis der Tabellen... 9 Danksagung... 11 0. Vorbemerkungen...
Michael Heß Relativische Prädikationen im Baschkirischen 2008 Harrassowitz Verlag Wiesbaden ISSN 0177-4743 ISBN 978-3-447-05621-2 Inhalt Verzeichnis der Tabellen... 9 Danksagung... 11 0. Vorbemerkungen...
Einführung in die Computerlinguistik. Morphologie II
 Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet _ Italienisch als Herkunftssprache
 Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet _ Italienisch als Herkunftssprache Fachtagung Universität Duisburg-Essen HerkunftssprecherInnen im Fremdsprachenunterricht: Integrative Konzepte und Spracherhalt 08.05.2015
Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet _ Italienisch als Herkunftssprache Fachtagung Universität Duisburg-Essen HerkunftssprecherInnen im Fremdsprachenunterricht: Integrative Konzepte und Spracherhalt 08.05.2015
Laura Thiele Claudia Scochi
 Laura Thiele Claudia Scochi Bei Unterrichtshospitationen, die an italienischen Grund, Mittel- und Oberschulen von externen Personen oder Kollegen* durchgeführt wurden, erfolgte eine Unterrichtsbeobachtung
Laura Thiele Claudia Scochi Bei Unterrichtshospitationen, die an italienischen Grund, Mittel- und Oberschulen von externen Personen oder Kollegen* durchgeführt wurden, erfolgte eine Unterrichtsbeobachtung
Re exivpronomen. Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com
 Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com Re exivpronomen 2 Gib an, ob es sich um Re exivpronomen oder Personalpronomen handelt. 3 Bestimme das Re exivpronomen und das Subjekt. 4 Bestimme den Kasus.
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com Re exivpronomen 2 Gib an, ob es sich um Re exivpronomen oder Personalpronomen handelt. 3 Bestimme das Re exivpronomen und das Subjekt. 4 Bestimme den Kasus.
Mehrsprachigkeit und andere Mythen
 Mehrsprachigkeit und andere Mythen Text: Mehrsprachigkeit und Migration OPTIMALE LERNBEDINGUNGEN STEHEN NOCH AUS Inken Keim / Rosemarie Tracy Einleitung unzureichende Bildungschancen von Migrantenkindern
Mehrsprachigkeit und andere Mythen Text: Mehrsprachigkeit und Migration OPTIMALE LERNBEDINGUNGEN STEHEN NOCH AUS Inken Keim / Rosemarie Tracy Einleitung unzureichende Bildungschancen von Migrantenkindern
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch
 Germanistik Nuran Aksoy Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch Studienarbeit Freie Universität Berlin Wintersemester 2003/2004 Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften: Fächergruppe deutsche
Germanistik Nuran Aksoy Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch Studienarbeit Freie Universität Berlin Wintersemester 2003/2004 Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften: Fächergruppe deutsche
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 28 Kasus Grammatik und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 28 Kasus Grammatik und
Zweisprachigkeit und Aspekt-Tempus: Erzählstrukturen russisch-deutscher Kinder
 . Deutscher Slavistentag, München,.-..00 Tanja Anstatt, Tübingen tanja.anstatt@uni-tuebingen.de Zweisprachigkeit und Aspekt-Tempus: Erzählstrukturen russisch-deutscher Kinder. Einführung Rahmen: Projekt
. Deutscher Slavistentag, München,.-..00 Tanja Anstatt, Tübingen tanja.anstatt@uni-tuebingen.de Zweisprachigkeit und Aspekt-Tempus: Erzählstrukturen russisch-deutscher Kinder. Einführung Rahmen: Projekt
Die Grammatik. sowie ausführlichem Register. Auflage
 Die Grammatik Unentbehrlich für richtiges Deutsch Umfassende Darstellung des Aufbaus der deutschen Sprache vom Laut über das Wort und den Satz bis hin zum Text und zu den Merkmalen der gesprochenen Sprache
Die Grammatik Unentbehrlich für richtiges Deutsch Umfassende Darstellung des Aufbaus der deutschen Sprache vom Laut über das Wort und den Satz bis hin zum Text und zu den Merkmalen der gesprochenen Sprache
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lateinische Kasusendungen richtig erkennen und übersetzen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lateinische Kasusendungen richtig erkennen und übersetzen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Thema: TMD: 5272
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lateinische Kasusendungen richtig erkennen und übersetzen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Thema: TMD: 5272
Deutsch als Zweitsprache Grundlagen Prof. Dr. Schulz SS Sitzung Kurzreferat von Tobias Lensch
 Deutsch als Zweitsprache Grundlagen Prof. Dr. Schulz SS 2011 7. Sitzung von Tobias Lensch 2 Thema: Typische Phänomene der Mehrsprachigkeit: Mischungen, Codeswitching 3 Literatur für das Referat Dirim,
Deutsch als Zweitsprache Grundlagen Prof. Dr. Schulz SS 2011 7. Sitzung von Tobias Lensch 2 Thema: Typische Phänomene der Mehrsprachigkeit: Mischungen, Codeswitching 3 Literatur für das Referat Dirim,
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung Gegenstand und Relevanz der Arbeit Aufbau der Arbeit 3
 Inhaltsverzeichnis Dank X 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand und Relevanz der Arbeit 1 1.2 Aufbau der Arbeit 3 2 Migration nach Deutschland und Argentinien ein Überblick 5 2.1 Zum Begriff Migration 5 2.2 Migration
Inhaltsverzeichnis Dank X 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand und Relevanz der Arbeit 1 1.2 Aufbau der Arbeit 3 2 Migration nach Deutschland und Argentinien ein Überblick 5 2.1 Zum Begriff Migration 5 2.2 Migration
Angestrebte Zweisprachigkeit am Beispiel ungarndeutscher Kindergärten
 Kinder werden nicht von allein zweisprachig. Egger Angestrebte Zweisprachigkeit am Beispiel ungarndeutscher Kindergärten Dr. Monika Jäger-Manz Baja/Ungarn Internationaler Kongress Frühkindliche Mehrsprachigkeit
Kinder werden nicht von allein zweisprachig. Egger Angestrebte Zweisprachigkeit am Beispiel ungarndeutscher Kindergärten Dr. Monika Jäger-Manz Baja/Ungarn Internationaler Kongress Frühkindliche Mehrsprachigkeit
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 5 INHALTSVERZEICHNIS... 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS... 15
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 5 INHALTSVERZEICHNIS... 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 13 TABELLENVERZEICHNIS... 15 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 17 Fachspezifische Abkürzungen...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 5 INHALTSVERZEICHNIS... 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 13 TABELLENVERZEICHNIS... 15 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 17 Fachspezifische Abkürzungen...
Kern- und Schulcurriculum Englisch Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum Englisch Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Englisch Curriculum Klasse 5/6 Das eingeführte Englischlehrwerk English G 21 ist auf den Bildungsplan für allgemeinbildende Gymnasien
Kern- und Schulcurriculum Englisch Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Englisch Curriculum Klasse 5/6 Das eingeführte Englischlehrwerk English G 21 ist auf den Bildungsplan für allgemeinbildende Gymnasien
Die Bildergeschichte im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Die Bildergeschichte im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Bildergeschichte im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit ist die
Germanistik Mohamed Chaabani Die Bildergeschichte im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Bildergeschichte im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit ist die
Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen
 Claudio Di Meola 0 Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen STAÜFFENBURG VERLAG Inhalt Vorwort xi Einleitung 1 1. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand 5 1.1. Grundannahmen der Grammatikalisierungsforschung
Claudio Di Meola 0 Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen STAÜFFENBURG VERLAG Inhalt Vorwort xi Einleitung 1 1. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand 5 1.1. Grundannahmen der Grammatikalisierungsforschung
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Der Erwerb des Türkischen im monolingualen und bilingualen Kontext
 Der Erwerb des Türkischen im monolingualen und bilingualen Kontext Magdalena Jezek Sprachskizze Türkisch weltweit 74 Millionen SprecherInnen ural-altaische Sprachgruppe 8 Vokale, 20 Konsonanten (+ /ğ/)
Der Erwerb des Türkischen im monolingualen und bilingualen Kontext Magdalena Jezek Sprachskizze Türkisch weltweit 74 Millionen SprecherInnen ural-altaische Sprachgruppe 8 Vokale, 20 Konsonanten (+ /ğ/)
Unterrichtseinheit Lektion 8
 Unterrichtseinheit Lektion 8 Kompetenzbereich(e) / Bildungsstandards: Sprachkompetenz (Verben und Nomina bestimmen und ihren Flexionsklassen Fachterminologie benutzen) Textkompetenz (lateinische Texte
Unterrichtseinheit Lektion 8 Kompetenzbereich(e) / Bildungsstandards: Sprachkompetenz (Verben und Nomina bestimmen und ihren Flexionsklassen Fachterminologie benutzen) Textkompetenz (lateinische Texte
Meilensteine des Spracherwerbs. Spontansprachkorpora. Referentinnen: Jasmin Jakob, Yuliya Khutko
 Meilensteine des Spracherwerbs Spontansprachkorpora Referentinnen: Jasmin Jakob, Yuliya Khutko Gliederung 1. Einleitung 2. Methode 3. Inter- und Intraindividuelle Variation im Morpho-Syntaxerwerb 4. Aufgabe
Meilensteine des Spracherwerbs Spontansprachkorpora Referentinnen: Jasmin Jakob, Yuliya Khutko Gliederung 1. Einleitung 2. Methode 3. Inter- und Intraindividuelle Variation im Morpho-Syntaxerwerb 4. Aufgabe
Beurteilungskriterien und wesentliche Bereiche Englisch / 5. Klasse
 Beurteilungskriterien und wesentliche Bereiche Englisch / 5. Klasse sfeststellung Folgende en während des Schuljahres bilden die Grundlage der Benotung: Mündliche sfeststellungen Zwei im 1 Semester Eine
Beurteilungskriterien und wesentliche Bereiche Englisch / 5. Klasse sfeststellung Folgende en während des Schuljahres bilden die Grundlage der Benotung: Mündliche sfeststellungen Zwei im 1 Semester Eine
STEOP Modulprüfung Mehrsprachigkeit. Sprachkompetenz B-/C-Sprache Deutsch Modelltest - Lösung
 STEOP Modulprüfung Mehrsprachigkeit Sprachkompetenz B-/C-Sprache Deutsch Modelltest - Lösung Zentrum für Translationswissenschaft STEOP-Modulprüfung Mehrsprachigkeit B-/C-Sprache Deutsch Modelltest B-/C-Sprache
STEOP Modulprüfung Mehrsprachigkeit Sprachkompetenz B-/C-Sprache Deutsch Modelltest - Lösung Zentrum für Translationswissenschaft STEOP-Modulprüfung Mehrsprachigkeit B-/C-Sprache Deutsch Modelltest B-/C-Sprache
Stoffplan Deutsch E-Profil 240 Lektionen B-Profil 360 Lektionen
 In Worten Grad diskutieren, produzieren 36 L. 1. Semester Bemerkungen / Hinweise Eintritt ins Berufsleben Einführung in die Mediothek Kurzreferate (Präsentationstechniken) Textproduktion: Zusammenfassung,
In Worten Grad diskutieren, produzieren 36 L. 1. Semester Bemerkungen / Hinweise Eintritt ins Berufsleben Einführung in die Mediothek Kurzreferate (Präsentationstechniken) Textproduktion: Zusammenfassung,
Re exivpronomen. Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com
 Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com Re exivpronomen 2 Gib an, ob es sich um Re exivpronomen oder Personalpronomen handelt. 3 Bestimme das Re exivpronomen und das Subjekt. 4 Bestimme den Kasus.
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com Re exivpronomen 2 Gib an, ob es sich um Re exivpronomen oder Personalpronomen handelt. 3 Bestimme das Re exivpronomen und das Subjekt. 4 Bestimme den Kasus.
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung
 Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
zu überprüfen und zu präzisieren. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
 1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
Zweisprachigkeit in der Familie - Eine Sammlung von Fallstudien
 Pädagogik Andrea Albrecht Zweisprachigkeit in der Familie - Eine Sammlung von Fallstudien Examensarbeit 1. EINLEITUNG... 5 2. ZWEISPRACHIGKEIT EIN ÜBERBLICK... 7 2.1 Definitionen von Zweisprachigkeit...
Pädagogik Andrea Albrecht Zweisprachigkeit in der Familie - Eine Sammlung von Fallstudien Examensarbeit 1. EINLEITUNG... 5 2. ZWEISPRACHIGKEIT EIN ÜBERBLICK... 7 2.1 Definitionen von Zweisprachigkeit...
Wie Kinder Sprachen lernen. Spracherwerb bei Kindern mit DaM und DaZ Tracy, R.(2007). Wie Kinder Sprachen lernen. Thoma, D & Tracy, R (2006) Deutsch
 Wie Kinder Sprachen lernen. Spracherwerb bei Kindern mit DaM und DaZ Tracy, R.(2007). Wie Kinder Sprachen lernen. Thoma, D & Tracy, R (2006) Deutsch als frühe Zweitsprache: zweite Erstsprache? Seminar:
Wie Kinder Sprachen lernen. Spracherwerb bei Kindern mit DaM und DaZ Tracy, R.(2007). Wie Kinder Sprachen lernen. Thoma, D & Tracy, R (2006) Deutsch als frühe Zweitsprache: zweite Erstsprache? Seminar:
Jahresschlusstest 2019
 Jahresschlusstest 2019 Datum Klasse 17. und 18. Juni 1. Real Lernziele MA / DE / EN (E, M, G) Prüfungsinhalt Mathematik Mathematik 1, ohne Taschenrechner LU 8 Brüche-Dezimalbrüche-Prozente Zahlen in unterschiedlichen
Jahresschlusstest 2019 Datum Klasse 17. und 18. Juni 1. Real Lernziele MA / DE / EN (E, M, G) Prüfungsinhalt Mathematik Mathematik 1, ohne Taschenrechner LU 8 Brüche-Dezimalbrüche-Prozente Zahlen in unterschiedlichen
Satzglieder und Gliedteile. Duden
 Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lerntheke: Sportlich, sportlich - Wortarten und Satzglieder trainieren
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lerntheke: Sportlich, sportlich - Wortarten und Satzglieder trainieren Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de VI
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lerntheke: Sportlich, sportlich - Wortarten und Satzglieder trainieren Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de VI
Bildungstag zum Umgang mit Sprachkompetenz und Sprachdefiziten im Zweiten Bildungsweg
 Bildungstag 2016 Sprache als Bildungschance und Bildungshemmnis Workshop zum Umgang mit Sprachkompetenz und Sprachdefiziten im Zweiten Bildungsweg Tages- und Abendschule Köln Stefanie Göllner und Eva Janssen
Bildungstag 2016 Sprache als Bildungschance und Bildungshemmnis Workshop zum Umgang mit Sprachkompetenz und Sprachdefiziten im Zweiten Bildungsweg Tages- und Abendschule Köln Stefanie Göllner und Eva Janssen
Das Passiv im Deutschen und Italienischen
 Das Passiv im Deutschen und Italienischen Inhaltsverzeichnis 1. Das Passiv im Deutschen 1.1 Unterschied zwischen dem Passivsatz und Aktivsatz 1.2 kurze Einleitung zum Passiv 1.3 Verwendung des Passivs
Das Passiv im Deutschen und Italienischen Inhaltsverzeichnis 1. Das Passiv im Deutschen 1.1 Unterschied zwischen dem Passivsatz und Aktivsatz 1.2 kurze Einleitung zum Passiv 1.3 Verwendung des Passivs
Forschungsbericht Sprachkontakt
 Michael Clyne Forschungsbericht Sprachkontakt Untersuchungsergebnisse und praktische Probleme Scriptor Verlag Kronberg/Ts. 1975 INHALT I. SPRACHKONTAKT AUS VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVEN 1 1.1 Wissenschaftliches
Michael Clyne Forschungsbericht Sprachkontakt Untersuchungsergebnisse und praktische Probleme Scriptor Verlag Kronberg/Ts. 1975 INHALT I. SPRACHKONTAKT AUS VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVEN 1 1.1 Wissenschaftliches
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Man nehme den Konjunktiv. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Man nehme den Konjunktiv Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Man nehme
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Man nehme den Konjunktiv Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Man nehme
Personalpronomen Personal pronouns. Deutsch Anfänger - Grammatik -
 Personalpronomen Personal pronouns Deutsch Anfänger - Grammatik - Willkommen welcome Wer nimmt an der Stunde teil? Who is attending the class? Erzähle etwas von dir! Tell something about yourself! Beispiel
Personalpronomen Personal pronouns Deutsch Anfänger - Grammatik - Willkommen welcome Wer nimmt an der Stunde teil? Who is attending the class? Erzähle etwas von dir! Tell something about yourself! Beispiel
Wortschatz 200+ Nomen
 Wortschatz 200+ Nomen Diese Liste enthält 200+ themenunabhängige Nomen/Substantive, die wichtig sind für o die Beschreibung von Statistiken o die Interpretation von Texten o Diskussionen über kontroverse
Wortschatz 200+ Nomen Diese Liste enthält 200+ themenunabhängige Nomen/Substantive, die wichtig sind für o die Beschreibung von Statistiken o die Interpretation von Texten o Diskussionen über kontroverse
Rolle der Input und Korrektur beim Spracherwerb. Liudmyla Liakhova
 Rolle der Input und Korrektur beim Spracherwerb Liudmyla Liakhova Gliederung Einleitung Das Problem von Ursache und Wirkung im Spracherwerb. Die Instruktionshypohese. Form und Funktion korrektiver Rückmeldung.
Rolle der Input und Korrektur beim Spracherwerb Liudmyla Liakhova Gliederung Einleitung Das Problem von Ursache und Wirkung im Spracherwerb. Die Instruktionshypohese. Form und Funktion korrektiver Rückmeldung.
Inhaltsverzeichnis. Prokosch, Erich ZusÃ?tze zum Supplement zu den Osmanischen Grammatiken (GLM 18) digitalisiert durch: IDS Basel Bern
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Zur äußeren Form der Arbeit 15 zu Seiten 7-14: Schrift 15 Besondere Zeichen zur Verdeutlichung der Aussprache ausländischer Wörter: 15 Historische Schreibung 16 Zusammenschreibung
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Zur äußeren Form der Arbeit 15 zu Seiten 7-14: Schrift 15 Besondere Zeichen zur Verdeutlichung der Aussprache ausländischer Wörter: 15 Historische Schreibung 16 Zusammenschreibung
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN
 FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
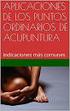 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Für die Produktion dieser Äußerung müssen unter anderen folgende syntaktische Schemata bzw. Schemastrukturen instanziert werden:
 8.2 Operationen zur Produktion eines einfachen Satzes Im Folgenden soll die Instanzierung einiger wichtiger syntaktischer Schemata beschrieben werden, die häufig an der Produktion eines einfachen spanischen
8.2 Operationen zur Produktion eines einfachen Satzes Im Folgenden soll die Instanzierung einiger wichtiger syntaktischer Schemata beschrieben werden, die häufig an der Produktion eines einfachen spanischen
Einführung in die Computerlinguistik
 Einführung in die Computerlinguistik Merkmalstrukturen und Unifikation Dozentin: Wiebke Petersen WS 2004/2005 Wiebke Petersen Formale Komplexität natürlicher Sprachen WS 03/04 Universität Potsdam Institut
Einführung in die Computerlinguistik Merkmalstrukturen und Unifikation Dozentin: Wiebke Petersen WS 2004/2005 Wiebke Petersen Formale Komplexität natürlicher Sprachen WS 03/04 Universität Potsdam Institut
