UŽSIENIO KALBŲ STUDIJOS/ STUDIES OF FOREIGN LANGUAGES
|
|
|
- Adolf Dieter
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ISSN KALBŲ STUDIJOS NR. * STUDIES ABOUT LANGUAGES NO. 21 UŽSIENIO KALBŲ STUDIJOS/ STUDIES OF FOREIGN LANGUAGES Language Awareness in der Fremdsprachenvermittlung am Beispiel eines DaF- Lehrwerks Rade Sazdovski Zusammenfassung. Die Lehrwerke für die Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache (im Folgenden: DaF) unterliegen ständigen Aktualisierungen und Erweiterungen aufgrund der Anstöße zur Neugestaltung von Lehrplänen, Richtlinien und Curricula für den Fremdsprachenunterricht, die im Zuge der neu entwickelten didaktischen Ansätze und Konzepte gegeben werden. Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, Überlegungen zum jungen Konzept Language Awareness in der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache bei genauer Untersuchung des DaF-Lehrwerks em neu Hauptkurs 2008 näher zu beleuchten und zu analysieren. In erster Linie wird überprüft, welche Inhalte aus der DaF-Didaktik den Ansätzen von Language Awareness nahe stehen und ob sie das Konzeptziel verfolgen. Bei präziserer Befolgung der Kernpunkte des Konzepts werden zwar linguistische Fragestellungen spezifisch unter den Gesichtspunkten des Sprachvergleichs und der Einsichten in die Sprachstrukturen des Deutschen behandelt, aber der Hauptaugenmerk wird insbesondere auf die sprachdidaktischen Aspekte und pädagogischen Neuerungen des Konzepts für den DaF-Unterricht gelegt. Trotz mangelnder Untersuchungen des Konzepts im Feld der DaF-Didaktik wird im vorliegenden Beitrag der Versuch unternommen, aus den durch Reflexion über die Sprache ergänzten Ansätzen von Language Awareness, die ursprünglich auf das Sprachlernen im Erstsprachbereich des Englischen Bezug nahmen und später auch in den mutter- und fremdsprachlichen Deutschunterricht übernommenen wurden, einen Nutzen für die Fremdsprachenvermittlung des Deutschen im Rahmen eines DaF-Unterrichts zu ziehen. Zur Veranschaulichung werden Beispiele aus dem Arbeits- und Kursbuch des untersuchten Lehrwerks herangezogen. Schlüsselwörter: Language Awareness, Sprachreflexion, Deutsch als Fremdsprache, DaF-Lehrwerk, Sprachmanipulation, Sprachsensibilisierung. Einleitende Bemerkungen Einen wichtigen Aspekt des vorliegenden Beitrags betreffen die Fragen, ob bzw. welche Zusammenhänge es zwischen den Ansätzen von Language Awareness und der DaF-Didaktik gibt, und welche Einsatzmöglichkeiten im DaF-Unterricht sich aus der Nutzung ergeben könnten. Bevor auf diese Fragen eine Antwort gegeben werden kann, soll zunächst ein Überblick in das Konzept Language Awareness mit Schwerpunkt auf seinen Zielen und Inhalten erfolgen. Der Fokus wird sich bei der Analyse besonders auf die Fremdsprachenvermittlung des Deutschen als Fremdsprache richten, da sich nur eine spärliche Anzahl empirischer Untersuchungen über Language Awareness in Verbindung mit der DaF-Didaktik findet, die überwiegend im Zusammenhang mit der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) ermittelt wird (Luchtenberg, 1994). Die Letztere wird im Rahmen dieses Beitrags nicht berücksichtigt. Als Forschungsgrundlage des o.g. Aspekts dient das DaF- Lehrwerk em neu Hauptkurs 2008, das ausschließlich für den DaF-Unterricht konzipiert ist. Im Folgenden wird der englische Begriff Language Awareness beibehalten, um seiner möglichst unterschiedlich vagen und mehrdeutigen Begriffswahl im deutschsprachigen Raum, wie Sprachsensibilisierung, Sprachreflexion oder Sprachbewußtheit auszuweichen (Budde, 2001; Luchtenberg, 1995, 1997; Hug, 2007, S.10ff). Außerdem ist die definitorische Vagheit im Deutschen nicht auf einen Mangel an Reflexion zurückzuführen, sondern liegt in den unterschiedlichen Deutungen von Language Awareness bereits in der englischsprachigen Fachliteratur, die auch nicht ohne Kritik bleiben darf. Language Awareness wird nämlich in der englischen Fachliteratur überdimensioniert definiert. Autoren teilen dem Begriff Dimensionen von einer Bewegung, einer Haltung, einer Methode, einem Konzept oder auch einem Zustand zu. In der Erstausgabe der Zeitschrift Language Awareness definieren die Herausgeber den Begriff als einen Sammelbegriff (cover term), der jegliches mit Sprachen zu tun hat (The Editors, 1992, S.2). Diese Uneinheitlichkeit dient auch nicht der Klarheit des Begriffs für die deutsche Didaktik, so dass unterschiedliche Übersetzungen des Begriffs wie Sprachreflexion, Sprachsensibilisierung oder Sprachbewusstheit sich nicht etablieren und für Verwirrung sorgen können. Im vorliegenden Beitrag wird deshalb Language Awareness als ein Gesamtkonzept betrachtet, um all seine Ziele und Strategien innerhalb der Sprachvermittlung einzurahmen. Zum Konzept Language Awareness Seit den 90er Jahren wurden die Ansätze von Language Awareness auch in der Bundesrepublik Deutschland erheblich diskussionsbedürftig. Um sie nachvollziehen zu können, ist es vorher jedoch notwendig, sie aus ihren An- 108
2 fängen heraus zu betrachten. Das britische Ausbildungssystem erwies sich zu Beginn der 70er Jahre als unfähig, Lerner mit unterschiedlichen verbalen Vorkenntnissen auf denselben Sprachstand sowohl im Mutter- als auch im Fremdsprachenunterricht zu bringen. Angesichts der nicht so hohen Qualität des Unterrichts in der Grundschule entstand eine Kluft in der Ausbildung zwischen zwei Lernergruppen. In der ersten Gruppe konnten Lerner mit bereits erworbenen Vorkenntnissen von der Strukturierung des Lehr-Lern-Prozesses im Unterricht besonders profitieren, während Lerner mit mangelhaften Vorkenntnissen der zweiten Gruppe benachteiligt waren. Keine Lehrmethoden und Ansätze wurden im derzeitigen britischen Curriculum vorgesehen, die den Lernern ermöglicht hätten, die Sprache selbst zu verstehen (vgl. Hawkins, 1984, S.1; Morkötter, 2005, S.28f). In den Überlegungen für die Rolle der Sprache im Rahmen des Curriculums stellt Hawkins fest: It is becoming clear that there is something missing from the language education offered to all children (Hawkins, 1984, S.1). Der Leitansatz eine explizite Reflexion über die Sprache soll ein Bestandteil des Curriculums sein wird unter dem Begriff Language Awareness erfasst. Die in der britischen Diskussion ent-wickelten Ansätze von Language Awareness sind später in die Didaktik des Deutschen (sowohl im Erstsprachbereich als auch im Fremdsprachenunterricht) übernommen worden. Folgende Ziele runden das Konzept Language Awareness ab: Wecken von Interesse und Neugier auf die Sprache und sprachliche Phänomene im Unterricht. Herstellung aktiver Akzeptanz sprachlicher Vielfalt durch den Einbezug des Sprachvergleichs im Unterricht, was die Sprachreflexion und den Sprachvergleich fördert. Anregung der Sprachanalyse im Unterricht. Entwicklung der metasprachlichen Kommunikation, die den Spracherwerb und das Sprachenlernen begünstigen kann. Kritische Betrachtung des Verhältnisses zwischen Sprache und Sprachmanipulation. Lerner sollen herausgefordert werden, Fragen über die Sprache zu stellen, welche im Regelfall als selbstverständlich angesehen werden. Die Ansatzvorteile von Language Awareness resultieren aus fünf Ebenen, die zu einem ganzheitlichen Lernen gehören. James und Garett zeichnen die besonderen Anhaltspunkte jeder Ebene pointiert nach (1992, S.12 20): a) Die affektive Ebene (the affective domain) Auf dieser Ebene geht es um die Anregung der Lernfreude im Umgang mit Mehrsprachigkeit und die Herstellung der emotionalen Einstellung zu Sprachen. Das Besitzen innerlicher Kriterien (wie z.b. die Lernmotivation) kann den Lernerfolg stark beeinflussen. b) Die soziale Ebene (the social domain) Bezogen auf mehrsprachige Gesellschaften betrifft diese Ebene die Förderung der Beziehungen zwischen allen ethnischen Gruppen. Die Lerner werden sich über die Herkunft und Merkmale anderer in der Klasse vertretenen Sprachen und Dialekte bewusst, was die linguistische Toleranz gegenüber verschiedenen Sprachvarietäten fördern und unterstützen kann. c) Die Machtebene 1 (the power domain) Die Sprachmanipulation bzw. der Sprachmissbrauch in den Medien, in der Politik oder in der Werbung ist in dieser Ebene betroffen. Die Impulse von Language Awareness im Unterricht können die Lerner auf die verschleiernde Wirkung der Sprache aufmerksam machen. d) Die kognitive Ebene (the cognitive domain) Durch eine stärkere Hervorhebung von Sprachmustern, -einheiten und -regeln soll das metasprachliche Wissen einer Sprache verbessert und die Sprachsensibilisierung gestärkt werden. Language Awareness soll dennoch in keiner Weise als eine Rückkehr zum trockenen Grammatikunterricht verstanden werden, in dessen Rahmen die Bestimmung von Satzgliedern geübt wird. e) Die Ebene der Performanz (the performance domain) Diese Ebene belangt einen entscheidenden Aspekt in den Ansätzen von Language Awareness an. Hier geht es darum, ob das Sprachwissen zur verbesserten Beherrschung einer bestimmten Sprache beiträgt. We learn by becoming aware of what we do not know (James, Garett, 1992, S.19). Eine ehrliche und objektive Selbsteinschätzung ist der Schlüssel zur Selbstverbesserung. Diese Ebene wird auch als die problematischste angesehen, die auf Mutmaßungen beruht, da die Forschung keine eindeutigen Ergebnisse zur Sachlage bringen kann. Die Komplexität der Sprache darf in den Ansätzen von Language Awareness nicht nur auf die Grammatik oder nur auf den Wortschatz beschränkt werden. Die Grammatik macht das Konzept nicht aus. Sie kann nur ein Teil davon sein, aber niemals der dominante, denn Language Awareness gehört zum ganzheitlichen Lernen einer Sprache. Vordergründig geht es um den kontrastiven Umgang sprachlicher Einheiten der Mutter- und Fremdsprache, die Erkennung des linguistischen Parochialismus 2, Sensibilisierung der fremden Perspektiven, Einbezug von sprachund interkulturellen Aspekten in den Unterricht, Sprachmanipulation und diskriminierenden Sprachgebrauch. 1 Fehling übersetzt diese Ebene als die politische Ebene ins Deutsche (Fehling, 2008, S.48f). Dabei rückt in den Mittelpunkt, dass die verschleierten und doppelsinnigen Bedeutungen einer Sprache (oft als Euphemismen vorkommend) speziell auf das politische Vokabular beschränkt sind. Dies schließt andere Bereiche wie beispielsweise die Medien aus, in denen die Sprache auch als ein Manipulationsinstrument verwendet werden kann. Um die Betonung auf das gesamte Manipulationspotential der Sprache in allen Bereichen zu legen, wird deshalb diese Ebene als die Machtebene ins Deutsche übersetzt. 2 Linguistischer Parochialismus bzw. linguistische Engstirnigkeit oder Beschränktheit bezeichnet das Unvermögen, andere Fremdsprachen zu verstehen und sich dadurch irritieren zu lassen. Anhand der Ansätze von Language Awareness soll Grundlegung von Toleranz gegenüber komischen oder lustig klingenden Sprachen stattfinden (vgl. Hawkins, 1984, S.17). 109
3 Zusammenhänge zwischen Language Awareness und der DaF-Didaktik Die zuerst auf die Muttersprache bezogene Bedeutung des Konzepts Language Awareness wurde im Laufe der Zeit ausgeweitet und auf die Sprache generell bezogen. In jüngeren Publikationen zur Diskussion über Language Awareness wird auch das fremdsprachliche Lernen miteinbezogen (Rampillon, 1997, S.173). Die Relevanz von Language Awareness in der DaF-Didaktik wurde von Luchtenberg ausgearbeitet (Luchtenberg, 1994; 1995; 1997). Sie postuliert folgende Zusammenhänge zwischen Language Awareness und der DaF-Didaktik: a) Der Methode des Sprachvergleichs in den Ansätzen von Language Awareness lassen sich Formen konfrontativer Semantik im DaF-Bereich zuordnen, indem zwei oder mehr Sprachen in Bezug auf sprachkulturelle Inhalte kontrastiert bzw. verglichen werden. b) Einsichten in Sprachstrukturen gehören sowohl zu den Methoden der Ansätze von Language Awareness als auch zu den anerkannten Methoden des Deutschen als Fremdsprache. Die Lerner gewinnen Einsichten in Sprachstrukturen und erkennen Zusammenhänge des sprachlichen Handelns im Deutschen. c) Zusammenhänge von Sprache und Kultur, die als Cultural Awareness ein Teil der Ansätze von Language Awareness sind, ergeben sich in Konzepten des Deutschen als Fremdsprache beispielsweise in der kulturkontrastiven Grammatik von Ehnert (1988). In Bezug auf Cultural Awareness betreffen folgende kulturelle Fragestellungen als Unterrichtsinhalte, vor allem Semantik und Pragmatik sowie den Textunterricht (Luchtenberg, 1994, S.7): Semantisch-kulturelle Aspekte von Language Awareness beziehen sich auf Wortinhalte und Verwendungssituationen, die in ihren kulturellen Bindungen verdeutlicht werden, wobei auch innerhalb einer Sprache ein Wortfeld oder Synonym im Mittelpunkt stehen kann (z.b. Gasthaus). Sprachliches Alltagswissen spielt hier eine große Rolle, da es durch die Ansätze von Language Awareness bewusster gemacht wird. Pragmatisch-kulturelle Aspekte von Language Awareness beziehen sich überwiegend auf das Sprachverhalten (z.b. bei Einladungen, Begrüßungen) oder die nonverbale Kommunikation. Kulturelle Aspekte des Textunterrichts für Language Awareness können sowohl die Vergleichbarkeit von Textsorten und ihre Rolle in einer Gesellschaft betreffen (wie Zeitschriften, Fernsehnachrichten o.ä.) als auch die Rezeption von Literatur oder auch Fragen zur Übersetzung. d) Sprachreflexion, d.h. das Nachdenken und Sprechen über sprachliche Phänomene ist ein grundlegender Bestandteil der Ansätze von Language Awareness. Anhand der Sprachreflexion wird die Mehrsprachigkeit gefördert. Außerdem werden die Lerner beim Nachdenken über Sprachen angeregt, sprachkontrastive Elemente zu erkennen, diese mit eigenen Beispielen zu ergänzen, Übersetzungsvarianten einzelner Begriffe zu überdenken und in eigenen Schreibversuchen zu bearbeiten, das zur Motivationsförderung beitragen kann. e) Kritische Sprachbetrachtung ist eine neuere Entwicklung, jedoch in den Ansätzen von Language Awareness sowie auch in der Fremdsprachenvermittlung selten vorkommend. Mögliche Inhalte sind etwa die Thematiken Vorurteile und Stereotypen in der Erst- und Zweitsprache, ihre Vorkommen in den Medien und die Entwicklung von Sprechhandlungsstrategien, um ihnen gegenübertreten zu können. Analyse und Diskussion der Forschungsergebnisse Angesichts der großen Auswahl an Lehrwerken, die im DaF-Bereich verwendet werden, beschränkte sich die Untersuchung zum Konzept auf nur ein Lehrwerk, das im deutschen Sprachraum erstellt worden und erschienen ist. der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache schlechthin dienen will. aktuell ist bzw. nach dem Jahr 2000 herausgegeben wurde, so dass mögliche Zusammenhänge mit dem jungen Konzept Language Awareness in Betracht gezogen werden können. Die Entscheidung fiel auf das im Jahr 2008 erschienene Lehrwerk em neu Hauptkurs (Perlmann-Balme, 2008). Im Rahmen der Analyse zu den Einsatzmöglichkeiten von Language Awareness wird auf die von Luchtenberg postulierten Zusammenhänge zwischen den Ansätzen von Language Awareness und der DaF-Didaktik rekurriert. Anhand zweier ausgewählter Lektionen Sprache und Orte des Lehrwerks wurde untersucht, ob und inwiefern Ansätze von Language Awareness zu erkennen sind und welche Auswirkung sie auf den Sprachlernprozess und die Fremdsprachenvermittlung des Deutschen haben: In einer Aufgabe der zweiten Lektion des Kursbuchs wird das Thema der Fremdsprachen zur Diskussion gestellt, während in einer anderen Aufgabe die Lerner aufgefordert werden, die Mutter- und Fremdsprachen zu nennen, der sie mächtig sind: (1) Unterhalten Sie sich zu viert und diskutieren Sie anschließend in der Klasse. a) Wie viele Fremdsprachen sollte man beherrschen? b) Welches ist für Sie die beste Methode, eine Sprache zu lernen? Zum Beispiel, durch Lesen, durch Auswendiglernen, durch Kontakt mit Muttersprachlern etc. (2) Machen Sie eine Umfrage in der Klasse. Stellen Sie fest, welche Mutter- und Fremdsprachen gesprochen werden. Stellen Sie fest, wie viele eine Fremdsprache, zwei oder mehr sprechen. 110
4 Anhand dieser Aufgaben erhalten die Lerner und der Lehrende einen Einblick in die in der Klasse gesprochenen Sprachen: der Lerner X spricht z.b. Mazedonisch, und der Lerner Y spricht z.b. Schwedisch. Dies wirft die Frage auf, ob die Lerner X und Y von den unterschiedlichen Strukturen beider Sprachen profitieren können, indem diese in einer trockenen Diskussion angebracht werden. Es ist festzustellen, dass der Sprachvergleich, vor allem im Rahmen der Lektion Sprache, bei dem die Lerner vielfältige Erfahrungen aus der Muttersprache mitbringen, nur am Rande behandelt wird. Eine reine Erwähnung der in der Klasse gesprochenen Sprachen ist nicht ausreichend, um den Sprachvergleich zu behandeln. Es wird weder auf unterschiedliche Sprachstrukturen noch auf sprachliche Phänomene der in der Klasse vertretenen Sprachen aufmerksam gemacht. Die Auseinandersetzung mit dem Sprachvergleich bleibt an der Oberfläche bestehen und es kommt zu keinem tiefgründigen Austausch über sprachliche Aspekte zwischen den Lernern in der Klasse, und die Lerner bleiben weiterhin sprachunbewusst. Der Lerner X berichtet lediglich über die von ihm gesprochenen Sprachen und der Lerner Y tut es ihm gleich. Es folgt daraus, dass die Methode des Sprachvergleichs in diesem Lehrwerk nicht als lernfördernd erkannt wird und im Hintergrund des Unterrichts bleibt. Der Sprachvergleich im Sinne von Language Awareness steht im Zusammenhang mit Übersetzungsübungen in die Ausgangssprache, bei denen weniger die grammatische Korrektheit noch die Überprüfung von Textverständnis im Vordergrund steht (vgl. hierzu auch Luchtenberg, 1994). Es geht vielmehr um die Reflexion über die Situationsangemessenheit der Äußerungen und um das sprachkulturelle Handeln. Durch die Methode des Sprachvergleichs im Rahmen der Ansätze von Language Awareness kann nicht nur die Wertschätzung der Muttersprache der Lerner gesteigert werden, sondern auch auf kulturell verknüpfte und vielfältige Phänomene eingegangen werden. Dabei können Lerner anderer Muttersprache über ein im Deutschen nicht (mehr) existierendes Phänomen erfahren, dass es beispielsweise in mehreren slawischen Sprachen (wie Mazedonisch, Polnisch, Serbisch u.a.), aber auch im Türkischen und im Schwedischen, unterschiedliche Bezeichnungen jedes Familienmitglieds sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits gibt: Tabelle 1. Familienbegriffe (Deutsch-Schwedisch-Mazedonisch). Deutsch Schwedisch Mazedonisch Onkel (väterlicherseits) Farbror Striko Onkel (mütterlicherseits) Morbror Vujko Tante (väterlicherseits) Faster Strina Tante (mütterlicherseits) Moster Vujna Der Bezug und die Arbeit mit dem Konzept Language Awareness sollen ansatzweise Verständigungsbereitschaft ermöglichen und neue sprachliche Aspekte zweier oder mehrerer Fremdsprachen mittels der Methode des Sprachvergleichs erfolgreich ins Bewusstsein zu heben. In einer offenen Kommunikation über sprachkundliche Fragen können Lerner Interesse an anderen Sprachen entwickeln, das zur Vermeidung von Kommunikationsschwierigkeiten und Konfliktsituationen beitragen kann. Außerdem schafft die Methode des Sprachvergleichs die Voraussetzung dafür, gezielte Korrekturen von Sprachfehlern vorzunehmen, die beispielsweise auf interlinguale Interferenz oder muttersprachlich bedingte Fehler semantischer, grammatischer, idiomatischer oder phonologischer Art zurückgehen. Die grammatischen Regeln im Lehrwerk werden womöglich mit dem Wortschatz in Bezug gebracht. Die Erläuterungen zur Grammatik jeder Lektion werden als Vorentlastung für die Aufgaben im Arbeitsbuch zusammengefasst. In der zweiten Lektion ist ein Akronym als Beispiel assoziativen Lernens gegeben, um sich die Reihenfolge der Satzglieder besser zu merken. Wenn z.b. mehrere freie Angaben im Satz vorkommen, gilt als Faustregel temporal vor kausal vor modal vor lokal (te-ka-mo-lo). Beispiele zur Wortbildung und Wortstellung im Hauptsatz geben einen Überblick über die genaue Behandlung und Einübung der Grammatikthemen: (3) Wortbildung Wortschatz Ergänzen Sie die passenden Verben oder Nomen zum Wortfeld Sprache aus dem Lernwortschatz: Verben Nomen äußern die Äußerung (4) Fehleranalyse Wortstellung Warum sind die folgenden Sätze falsch: Falsch: Um halb acht er steht normalerweise auf. Richtig: Um halb acht steht er normalerweise auf. Korrektur: Verb an Position 2 Das Grammatikregister in jeder Lektion fördert die schnelle Orientierung und erleichtert das Wiederauffinden der durchgenommenen Grammatikthemen. Der Grammatikstoff wird mit sinnvollen Beispielen übersichtlich und verständlich dargestellt. Zusammenhänge zwischen altem und neuem Wissen werden hergestellt. Die Grammatikregeln werden allgemeinverständlich behandelt, so dass die Lerner keine weiteren ausführlichen Grammatikbücher benötigen. Die Kultur Deutschlands und die der deutschsprachigen Länder, wie der Schweiz und der Österreichs, wird im Lehrwerk anhand authentischer bzw. semiauthentischer Texte dargestellt. Semantisch-kulturelle Aspekte, die sich auf Wortinhalte und Verwendungssituationen beziehen, werden in der zweiten Lektion im Bereich Wortschatz bearbeitet. Dadurch wird der Umgang mit anderen Kulturen sensibilisiert, indem die Lerner mit interkulturell verknüpften Erfahrungen vertraut gemacht werden. In einer interkulturellen Diskussion werden beispielsweise unterschiedliche Konnotationen zum Stichwort Kaffeehaus deutlich (dritte Aufgabe der dritten Lektion): (5) Was versteht man in Ihrem Heimatland unter einem Café/ Kaffeehaus? Finden Sie heraus, welche Bedeutung ein Café/ Kaffeehaus in Deutschland bzw. Österreich hat. Ansätze von Language Awareness fließen dabei auf jeden Fall mit in die Unterrichtseinheit ein, da die Lerner etwas 111
5 mehr über die kulturelle Besonderheiten der vertretenen Länder in der Klasse lernen können. Im Hinblick auf den Kulturvergleich und die Auswirkung des Fremdsprachenunterrichts betont Rall, dass man nicht nur das Fremde, sondern auch das Eigene besser kennen und einschätzen lernt (Rall, 1990, S.16). Das Landeskundeprojekt Kaffeehaus gehört im Wesentlichen zum handlungsorientierten Unterricht und trägt zum kreativen Umgang mit der deutschen Sprache in der Klasse bei. Obwohl in den beiden untersuchten Lektionen nonverbale Kommunikation nicht thematisiert wird, kommen andere pragmatisch-kulturelle Aspekte von Language Awareness vor, die sich z.b. auf das Sprachverhalten beziehen. An dieser Stelle ist auf das Register eines formellen Briefs hinzuweisen, anhand dessen geübt wird, welche Ausdrucksmittel für die Textsorte formeller Brief sprachlich und inhaltlich passend oder unpassend sind: (6) Notieren Sie in der Übersicht, aus welchem Grund die Sätze für Ihren Brief nicht passen. Passt sprachlich nicht: Hallo! Begründung: Bei einem offiziellen Brief wählt man eine höfliche, distanzierte Anrede. Bei der Begründung der Ausdrucksmittel werden der Wortschatz und die allgemein sprachlichen Kompetenzen explizit gefördert. Es gäbe eine Nähe zu interkulturellen Ansätzen, wenn die Diskussion über die deutsche Sprache hinaus zu einer Auseinandersetzung mit anderen fremdkulturellen Sprachen geführt hätte. Aus dieser Aufgabe ist dies nicht zu erschließen. Die Merkmale der deutschen Sprache werden im Lehrwerk vordergründig an seinen Grammatikregeln aufgezeigt und die Lerner werden in den Bereichen der Grammatik und der Semantik zur Sprachreflexion angeregt. Im Teil Schreiben der zweiten Lektion werden die Lerner dazu aufgefordert, ihre eigenen Texte zu prüfen: (7) Prüfen Sie Ihren Text selbst. Habe ich den Text klar und übersichtlich gegliedert? Habe ich mich präzise ausgedrückt? Habe ich ihn richtig geschrieben? Anhand der vom Lehrwerk angegebenen Hilfestellung zur Textproduktion übernehmen die Lerner die Rolle eines Bewerters. Das Nachdenken über Sprache wird angeregt, denn die Sprachfunktion und der Sprachgebrauch des Deutschen werden in den Vordergrund gestellt. Wichtiger für die Ansätze von Language Awareness ist, dass die Lerner angstlos Fragen im Unterricht stellen, die sie ursprünglich als selbstverständlich ansahen. Diese Hilfestellung zur Textproduktion lässt die Sprachreflexion zu. Sprachkritische Auseinandersetzungen mit sprachlichen Diskriminierungen und Vorurteilen sind im Lehrwerk nicht vorhanden. Die Sprache wird nur als ein Kommunikationsmittel betrachtet und ist kein Gegenstand der Kritik. Sensibilität im Umgang mit der Sprache im sozialen Miteinander hat das Lehrwerk nicht zum Thema. Bezogen auf die fünf Ebenen von Language Awareness ergibt sich für das Lehrwerk em neu Hauptkurs 2008 folgendes Bild: Die affektive Ebene von Language Awareness wird sehr selten behandelt und es fehlt an kulturrelativierenden Perspektiven. Das hängt damit zusammen, dass der Umgang mit der Mehrsprachigkeit nur am Rande behandelt wird. Übertragen auf den Lerneffekt bedeutet dies, dass die Lerner mit ihren Spracherfahrungen aus der Muttersprache nur sehr begrenzt zum Unterricht beitragen können. Es führte möglicherweise zu einem Perspektivenwechsel, wenn das Lehrwerk sprachlich kontrastiver angelegt würde (z.b. kurze Texte oder Berichte von Touristen oder Ausländern über die deutsche Kultur könnten in einige der Texte miteinbezogen werden). Dies würde die Einseitigkeit landeskundlicher Aspekte im Lehrwerk relativieren und einen Anstoß zur Mehrsprachigkeit geben. Die soziale Ebene, welche auch mit der Mehrsprachigkeit in Berührung kommt, wird nicht gründlich, sondern nur beiläufig angesprochen. Von einer Förderung besserer Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen ist im Lehrwerk nicht die Rede. Es ist eine Tatsache, dass alle Herkunftssprachen im Lehrwerk nicht behandelt werden können, was im Prinzip nicht das Ziel von Language Awareness ist. Das eigentliche Ziel aber ist es, die linguistische Toleranz gegenüber unterschiedlichen Sprachvarietäten zu fördern und zu unterstützen. Um dies zu erreichen, könnten z.b. Übungen oder Aufgaben zum Thema Mehrsprachigkeit in einigen Lektionen aufgebaut werden. Ein Verbesserungsvorschlag könnte eine Übung zum Zungenbrecher im Deutschen, aber auch in der Muttersprache einiger der Lerner sein, um die Akzeptanz der Ethnizität in der Klasse zu fördern. Dadurch wird der Klang anderer Sprachen auch kennengelernt. Alle vertretenen Sprachen in der Klasse sollen einbezogen und nicht ständig das Englische oder das Französische als Mittel zur Hilfestellung sprachlicher Schwierigkeiten vorgezogen werden, denn solche und andere Prestigesprachen können weniger Befremdung in sich tragen, da ihnen bereits in den Medien oder in der Schule begegnet wird. Aspekte der Machtebene von Language Awareness werden durchgehend ausgeklammert, denn der Entwicklung eines kritischen Bewusstseins gegenüber dem Manipulationspotential der Sprache wird kein Vorrang eingeräumt. Die Sprachmanipulation und die sprachlichen Vorurteile in den verschleierten und doppelsinnigen Bedeutungen der deutschen Sprache sollten im Lehrwerk nicht gezwungenermaßen behandelt werden. Es könnte aber auf diskriminierende Wörter oder Ausdrücke im Lehrwerk hingewiesen werden. Zum Beispiel haben Wörter wie Zigeuner, zwergwüchsig, Neger, Schwabe (als Ethnophaulismus für die Deutschen) und viele andere eine negative und sogar pejorative Konnotation. Auf ihre unbewusste Anwendung im Alltag sollen die Lerner in ihrem DaF-Unterricht sensibilisiert werden, um nicht unbewusst andere Menschen bezogen auf Geschlecht, Rasse, Aussehen usw. außerhalb der Klasse zu beleidigen (vgl. hierzu auch Matouschek, 2000). Im Bereich der kognitiven Ebene lässt sich feststellen, dass die Lerner ihre metasprachliche Kommunikation anhand der Sprachmuster, -einheiten und -regeln im Lehrwerk entwickeln. Dies schafft eine Grundlage für einen sprachreflektierenden und sprachbetrachtenden Unterricht 112
6 im Bereich der Grammatik. Der Schwerpunkt liegt vordergründig auf der Einübung der Grammatik und des Wortschatzes in den Bereichen Lesen und Schreiben, das dazu führe, den Unterrichtsfokus stark auf die Grammatik und den Wortschatz in den Teilfertigkeiten Lesen und Schreiben hinzulenken, während das Hören und Sprechen benachteiligt bleiben. Die letzte Ebene der Performanz ist unmöglich empirisch zu untersuchen, da sie auf Annahmen beruht, die nicht beobachtet werden können. Es werden aber Daten von Lernern über ihr explizites Wissen der Sprache benötigt, um zu zeigen, welche Bereiche und Aspekte unbewussten Wissens über die Sprache bewusst gemacht worden sind. Weitere Auswertungen zu dieser Ebene können nicht ohne weitere empirische Studien erfolgen. Schlussfolgerungen Obwohl Language Awareness ursprünglich für den Erstsprachbereich gedacht war und seine Ansätze in der Fremdsprachendidaktik einen geringen Anteil hatten, wurde der Fokus dieses Beitrags hauptsächlich auf das Lernen des Deutschen als Fremdsprache gerichtet. Aus dieser Perspektive konnte gezeigt werden, dass zum Konzept Language Awareness in Verbindung mit der DaF- Didaktik nur eine spärliche Anzahl empirischer Untersuchungen existiert. Ziele und Inhalte der Ansätze von Language Awareness liegen dem DaF-Unterricht zwar sehr nahe, aber das angestrebte Konzeptziel wird damit nicht verfolgt. Manche Ansätze von Language Awareness können sich mit bestimmten Aspekten des DaF-Unterrichts teilweise überlappen. Es wird aber darauf nicht eindeutig hingewiesen, dass das Ziel des Konzepts verfolgt wird. Rückblickend auf die Sprachreflexion lässt sich resümieren, dass das Hauptaugenmerk der Sprachreflexion auf die Grammatik und die Einsichten in die sprachlichen Strukturen gelegt wurde, die im untersuchten DaF-Lehrwerk gut und strukturiert dargestellt sind. Die Dominanz der Grammatik im DaF-Unterricht macht aber das Konzept Language Awareness nicht aus. Sie kann nur ein Teil davon sein, aber niemals prädominieren, denn Language Awareness gehört zum ganzheitlichen Lernen. Bezüglich der Zusammenhänge von Language Awareness und dem DaF-Unterricht wäre es günstigstenfalls ratsam, mehrere davon in den Unterricht einzubringen, so dass die Entwicklung sprachlicher, kommunikativer, interaktiver, sowie kultureller Kompetenzen im Unterricht begünstigt und vorwärts gebracht werden könnte. Das bedeutet, dass der Sprachvergleich und die Zusammenhänge zwischen der Sprache und der Kultur beispielsweise auch in die Sprachreflexion mit einflössen. Je mehr Zusammenhänge und Aspekte miteinander verbunden wären, umso stärker würde das Nachdenken über die Sprache in den Mittelpunkt gerückt. Des Weiteren ist zu nennen, dass die Kriterien zur Begutachtung eines DaF-Lehrwerks im Zuge der neu entwickelten didaktischen Ansätze und Konzepte aktualisiert werden sollten, die vor allem lernfördernd wirken. Language Awareness ist ein sehr junges Konzept, das in älteren Kriterienlisten zur Begutachtung der Lehrwerke nicht eingeplant werden konnte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass die DaF-Lehrwerke und somit die Lehrpläne, Curricula und Lehrmethoden einer laufenden Aktualisierung unterliegen sollten, um aus lernfördernden Konzepten einen Nutzen zu ziehen, denn die Inhalte der Lehrwerke können auf die Umsetzung neuer didaktischer Erkenntnisse einen großen Einfluss ausüben. Durch das Konzept Language Awareness wird vordergründig ein Anstoß auf Mehrsprachigkeit im Unterricht gegeben, die (inter) kulturelle Vielfalt gefördert und der kritischen Sprachbetrachtung Vorrang eingeräumt. Literaturverzeichnis 1. Budde, M., Sprachsensibilisierung. Unterricht auf sprachreflektierender und sprachbetrachtender Grundlage. Eine Einführung. Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Fach Deutsch als Zweitsprache. Kassel: Univ. Press. 2. Ehnert, R., Komm doch mal vorbei. Überlegungen zu einer 'kulturkontrastiven Grammatik'. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 14, München: iudicium, S Fehling, S., Language Awareness und bilingualer Unterricht. Eine komparative Studie. Frankfurt am Main: Peter Lang. 4. Hawkins, E., Awareness of Language: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 5. Hug, M., Sprachbewusstheit/ Sprachbewusstsein the state of art. In: Hug, M., Siebert-Ott, G., Hg. Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S James, C., Garett, P., Language Awareness in the Classroom. London: Longman. 7. Luchtenberg, S., Zur Bedeutung von Language Awareness Konzeptionen für Didaktik des Deutschen als Fremd- und als Zweitsprache. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 5/1, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S Luchtenberg, S., Language Awareness-Konzeptionen. Ein Weg zur Aktualisierung des Lernbereichs 'Relfexion über Sprache'. In: Der Deutschunterricht 4/95, Seelze: Friedrich Verlag, S Luchtenberg, S., Language Awareness: Anforderung an Lehrkräfte und ihre Ausblidung. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen 26, Tübingen: Gunter Narr, S Matouschek, B., Böse Wörte? Sprache und Diskriminierung. Eine praktische Anleitung zur Erhöhung der "sprachlichen Sensibilität" im Umgang mit den Anderen. 2. Aufl. Klagenfurt: Drava. 11. Morkötter, S., Language Awareness und Mehrsprachigkeit. Eine Studie zu Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit aus der Sicht von Fremdsprachenlernern und Fremdsprachenlehrern. Frankfurt am Main: Peter Lang. 12. Rall, M., Sprachbrücke. Deutsch als Fremdsprache. Handbuch für den Unterricht. 1. Aufl. Stuttgart: Klett. 13. Rampillon, U., Be Aware of Awareness oder: Beware of Awareness? Gedanken zur Metakognition im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I. In: Rampillon, U. (Hg.) Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, S The Editors., Language Awareness: Wat is dat? Language Awareness 1/1, S Hartman, E., Familienbegriffe Deutsch-Schwedisch. [online], [Stand: ] Quelle 1. Perlmann-Balme, M., Schwalb, S., EM neu. Hauptkurs: Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B2. 1. Aufl. Ismaning: Hueber. 113
7 Rade Sazdovski Praktiniai kalbos gebėjimai (Language Awareness) vokiečių kaip užsienio kalbos dėstymo procese Santrauka Straipsnyje pateikiami skirtingi požiūriai į kalbos praktinių gebėjimų (Language Awareness) sąvoką vokiečių, kaip svetimos kalbos, mokymo procese. Išryškinama sąvokos Language Awareness svarba ir teigiama, kad ji gali būti naudinga vokiečių kalbos besimokantiems studentams. Remiantis vokiečių, kaip svetimos kalbos, vadovėlio tyrimo rezultatais, straipsnyje parodoma, kad minėtasis vadovėlis ne visiškai pasiekia tikslą, atitinkantį sąvoką Language Awareness. Tiesa, kai kurie požiūriai į šią sąvoką sutampa su kai kuriais vadovėlio aspektais, tačiau tai nereiškia, kad pasiekiamas sąvoką atitinkantis tikslas. Pavyzdžiui, gerai pateikta gramatikos struktūra, bet vien tik gramatika dar neapima visos sąvokos. Ji tegali būti jos dalis, bet niekada nedominuojanti (kaip ir minimame vadovėlyje), nes Language Awareness yra tik dalis holistinio mokymosi, į kurį įeina gimtosios ir svetimos kalbos kontrastiniai lingvistiniai vienetai, lingvistinis parochializmas, jautrus svetimiems požiūriams, kalbos ir tarpkultūrinės temos auditorijoje, manipuliavimas kalba ir diskriminacinės kalbos naudojimas. Be to, būtina vokiečių kalbos didaktikoje vartoti anglų kalbos terminą Language Awareness, kadangi šio termino vertimas į vokiečių kalbą yra nelogiškas ir gali būti nesuprantamas. Straipsnis įteiktas Parengtas spaudai Über den Autor Rade Sazdovski, MA, Deutsche Sprache und Kultur (Schwerpunkt: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache), wissenschaftliche Hilfskraft in der Sektion Internationale Beziehungen, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Duisburg-Essen, Deutschland. Forschungsinteressen: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Fremdsprachenforschung, Fremdsprachendidaktik. Adresse: Sektion Internationale Beziehungen, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Duisburg-Essen, Universitätsstraße 12, Essen, Deutschland
Workshops im März 2018:
 Workshops im März 2018: Workshop Nr. 1: Wortschatzarbeit im DaF/DaZ-Unterricht Zeit und Ort: 20. März 2018, 16-20 Uhr an der EUF (Raum: OSL 231) In dem Workshop wird zunächst der Begriff Wortschatz definiert.
Workshops im März 2018: Workshop Nr. 1: Wortschatzarbeit im DaF/DaZ-Unterricht Zeit und Ort: 20. März 2018, 16-20 Uhr an der EUF (Raum: OSL 231) In dem Workshop wird zunächst der Begriff Wortschatz definiert.
DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten
 Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK. Herausgegeben von Detlef Kremer, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera
 GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Detlef Kremer, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 34 Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung von Hans-Werner Huneke und Wolfgang
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Detlef Kremer, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 34 Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung von Hans-Werner Huneke und Wolfgang
Sprachsensibler Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Eltern. Buchert/Enzinger FEZ
 Sprachsensibler Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Eltern Buchert/Enzinger FEZ 2013-11 Die nachhaltige Förderung sprachlicher Fähigkeiten im Sinne einer funktionalen Grundbildung ist Aufgabe der gesamten
Sprachsensibler Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Eltern Buchert/Enzinger FEZ 2013-11 Die nachhaltige Förderung sprachlicher Fähigkeiten im Sinne einer funktionalen Grundbildung ist Aufgabe der gesamten
Fragebogen Deutsch als Fremdsprache
 Fragebogen Deutsch als Fremdsprache Liebe Studentin, lieber Student! Am Institut für Germanistik der Universität Wien machen wir im Seminar Fremdsprachenerwerb, Identität und Bildungspolitik eine große
Fragebogen Deutsch als Fremdsprache Liebe Studentin, lieber Student! Am Institut für Germanistik der Universität Wien machen wir im Seminar Fremdsprachenerwerb, Identität und Bildungspolitik eine große
Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern
 Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Theoretische und praktische Ansätze mit konkreten Beispielen Haupt Verlag
Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Theoretische und praktische Ansätze mit konkreten Beispielen Haupt Verlag
Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen
 Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht
 Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Sprachspiele, Spracherwerb und Sprachvermittlung 2., korrigierte Auflage Von Gerlind Belke Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung zur zweiten
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Sprachspiele, Spracherwerb und Sprachvermittlung 2., korrigierte Auflage Von Gerlind Belke Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung zur zweiten
Handout: Kommunikative Grammatik Nadine Custer
 Unter dem Begriff kommunikative Grammatik versteht man eine Orientierung im Fremdsprachenunterricht, bei dem die Vermittlung der Grammatik in erster Linie auf kommunikativem Wege erfolgen soll. 1) Traditionelle
Unter dem Begriff kommunikative Grammatik versteht man eine Orientierung im Fremdsprachenunterricht, bei dem die Vermittlung der Grammatik in erster Linie auf kommunikativem Wege erfolgen soll. 1) Traditionelle
Verpflich tungsgrad. Voraussetzung für die Teilnahme. Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1. Niveaustufe. für die Vergabe von LP
 Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1 Grundwissen Deutsch als Fremdsprache Fundamentals of German as a Foreign Language LP Verpflich tungsgrad Niveaustufe 9 Pflicht Basismodul
Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1 Grundwissen Deutsch als Fremdsprache Fundamentals of German as a Foreign Language LP Verpflich tungsgrad Niveaustufe 9 Pflicht Basismodul
Language Awareness und bilingualer Unterricht
 Sylvia Fehling Language Awareness und bilingualer Unterricht Eine komparative Studie 2., überarbeitete Auflage PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 17 TEIL
Sylvia Fehling Language Awareness und bilingualer Unterricht Eine komparative Studie 2., überarbeitete Auflage PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 17 TEIL
Grammatik in Schulbüchern
 Pädagogik Thorsten Witting Grammatik in Schulbüchern Studienarbeit Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Stellung der Grammatik im Kerncurriculum Niedersachsen... 1 3 Optionen der Grammatikvermittlung... 2 4 Grammatik
Pädagogik Thorsten Witting Grammatik in Schulbüchern Studienarbeit Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Stellung der Grammatik im Kerncurriculum Niedersachsen... 1 3 Optionen der Grammatikvermittlung... 2 4 Grammatik
Deutsch als Fremdsprache
 Dietmar Rösler Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Mit 46 Abbildungen Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar Dank XI Einleitung 1 1. Lernende und Lehrende 5 1.1 Die Lernenden 5 1.1.1 Die Vielfalt der
Dietmar Rösler Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Mit 46 Abbildungen Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar Dank XI Einleitung 1 1. Lernende und Lehrende 5 1.1 Die Lernenden 5 1.1.1 Die Vielfalt der
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Der fachspezifische Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zur Sprachbildung
 Prof. Dr. Daniela Caspari Freie Universität Berlin Der fachspezifische Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zur Sprachbildung 10.5.2017 LISUM Berlin-Brandenburg Gliederung 1. Ansätze zur SB in der Fremdsprachendidaktik
Prof. Dr. Daniela Caspari Freie Universität Berlin Der fachspezifische Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zur Sprachbildung 10.5.2017 LISUM Berlin-Brandenburg Gliederung 1. Ansätze zur SB in der Fremdsprachendidaktik
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn. PP Medienanlass
 Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN!
 ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Wir vergleichen Sprachen
 Wir vergleichen Sprachen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Sprache untersuchen und reflektieren Film (youtube) und Arbeitsblätter in unterschiedlichen Sprachen Kompetenzerwartungen D
Wir vergleichen Sprachen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Sprache untersuchen und reflektieren Film (youtube) und Arbeitsblätter in unterschiedlichen Sprachen Kompetenzerwartungen D
Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis Bildungsplanbezug Englisch
 7. Bildungsplanbezug Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis 10. 9.2010 Bildungsplanbezug Englisch Grundlage für die Konzeption und Vermittlung der
7. Bildungsplanbezug Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis 10. 9.2010 Bildungsplanbezug Englisch Grundlage für die Konzeption und Vermittlung der
Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde
 Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde Lernbereich im LP: Relevanz: Klassenstufe 3/ 4 Charakter, Stellung und Prinzipien von Fremdsprachenunterricht
Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde Lernbereich im LP: Relevanz: Klassenstufe 3/ 4 Charakter, Stellung und Prinzipien von Fremdsprachenunterricht
Dank... XI Einleitung... 1
 Inhaltsverzeichnis Dank... XI Einleitung... 1 1. Lernende und Lehrende... 5 1.1 Die Lernenden... 5 1.1.1 Die Vielfalt der Einflussfaktoren... 6 1.1.2 Biologische Grundausstattung... 7 1.1.3 Sprachlerneignung...
Inhaltsverzeichnis Dank... XI Einleitung... 1 1. Lernende und Lehrende... 5 1.1 Die Lernenden... 5 1.1.1 Die Vielfalt der Einflussfaktoren... 6 1.1.2 Biologische Grundausstattung... 7 1.1.3 Sprachlerneignung...
Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums
 Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 84 Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums Ein Unterrichtsmodell für interkulturelle Lernziele Bearbeitet von Jingzhu Lü 1.
Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 84 Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums Ein Unterrichtsmodell für interkulturelle Lernziele Bearbeitet von Jingzhu Lü 1.
Deutsch als Fremdsprache
 Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Bearbeitet von Dietmar Rösler 1. Auflage 2012. Buch. XI, 301 S. Softcover ISBN 978 3 476 02300 1 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 481 g Weitere Fachgebiete
Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Bearbeitet von Dietmar Rösler 1. Auflage 2012. Buch. XI, 301 S. Softcover ISBN 978 3 476 02300 1 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 481 g Weitere Fachgebiete
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Vorblick Einfuhrung und Problemstellung Bedeutung des untersuchten Themas Ziele der Arbeit Struktur der Arbeit 18
 Inhaltsverzeichnis Vorblick 13 1. Einfuhrung und Problemstellung 15 1.1 Bedeutung des untersuchten Themas 15 1.2 Ziele der Arbeit 16 1.3 Struktur der Arbeit 18 2. Die interkulturelle Fremdsprachendidäktik
Inhaltsverzeichnis Vorblick 13 1. Einfuhrung und Problemstellung 15 1.1 Bedeutung des untersuchten Themas 15 1.2 Ziele der Arbeit 16 1.3 Struktur der Arbeit 18 2. Die interkulturelle Fremdsprachendidäktik
Laura Thiele Claudia Scochi
 Laura Thiele Claudia Scochi Bei Unterrichtshospitationen, die an italienischen Grund, Mittel- und Oberschulen von externen Personen oder Kollegen* durchgeführt wurden, erfolgte eine Unterrichtsbeobachtung
Laura Thiele Claudia Scochi Bei Unterrichtshospitationen, die an italienischen Grund, Mittel- und Oberschulen von externen Personen oder Kollegen* durchgeführt wurden, erfolgte eine Unterrichtsbeobachtung
Methoden der empirischen Kommunikationsforschung
 Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Eine Einführung Bearbeitet von Hans-Bernd Brosius, Alexander Haas, Friederike Koschel 7., überareitete
Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Eine Einführung Bearbeitet von Hans-Bernd Brosius, Alexander Haas, Friederike Koschel 7., überareitete
Vorwort. Einleitung. Aufbau der Arbeit
 LESEPROBE Vorwort Einleitung Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses entstand auch die Notwendigkeit vergleichende Leistungen und Qualifikationen innerhalb der jeweiligen nationalen Bildungssysteme
LESEPROBE Vorwort Einleitung Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses entstand auch die Notwendigkeit vergleichende Leistungen und Qualifikationen innerhalb der jeweiligen nationalen Bildungssysteme
Kommunikative Methode
 Kommunikative Methode 10112038 Sayaka Kaneko 1. Einleitung Ich habe schon im letzten Semester über die Kommunikative Methode meine Seminar Arbeit geschrieben. Das vorige Mal habe ich die Kommunikative
Kommunikative Methode 10112038 Sayaka Kaneko 1. Einleitung Ich habe schon im letzten Semester über die Kommunikative Methode meine Seminar Arbeit geschrieben. Das vorige Mal habe ich die Kommunikative
Begriffe von Mehrsprachigkeit Sprachliche Bildung der PädagogInnen vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung. Dr. Judith Purkarthofer, MultiLing 1
 Begriffe von Mehrsprachigkeit Sprachliche Bildung der PädagogInnen vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung Dr. Judith Purkarthofer, MultiLing 1 Welche Begriffe werden zur Beschreibung von Mehrsprachigkeit
Begriffe von Mehrsprachigkeit Sprachliche Bildung der PädagogInnen vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung Dr. Judith Purkarthofer, MultiLing 1 Welche Begriffe werden zur Beschreibung von Mehrsprachigkeit
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen. Beate Lütke. Blitzlicht
 DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
2. Grammatikprogression
 2. Grammatikprogression Die Grammatikprogression betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen. 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt
2. Grammatikprogression Die Grammatikprogression betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen. 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt
GER_C2.0606S. Bilinguale Erziehung. Education and children Speaking & Discussion Level C2 GER_C2.0606S.
 Bilinguale Erziehung Education and children Speaking & Discussion Level C2 www.lingoda.com 1 Bilinguale Erziehung Leitfaden Inhalt Viele Kinder, deren Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen sprechen,
Bilinguale Erziehung Education and children Speaking & Discussion Level C2 www.lingoda.com 1 Bilinguale Erziehung Leitfaden Inhalt Viele Kinder, deren Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen sprechen,
Dauer Art ECTS- Punkte. 1./ 2. Semester Jährlich 2 Semester Pflicht Stunden, davon Präsenzstudium: 180 Selbststudium: 360
 Türkisch Universität Modul Linguistik I 1./ 2. Jährlich 2 Pflicht 18 540 Stunden, davon Präsenzstudium: 180 Selbststudium: 360 Sprachkenntnisse im Türkischen auf dem Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens
Türkisch Universität Modul Linguistik I 1./ 2. Jährlich 2 Pflicht 18 540 Stunden, davon Präsenzstudium: 180 Selbststudium: 360 Sprachkenntnisse im Türkischen auf dem Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens
Sprachwandel und Sprachgeschichte in Lehrerfachzeitschriften. mit besonderem Schwerpunkt auf Praxis Deutsch und Der Deutschunterricht
 Seminar: Sprachgeschichte und Schule Prof. Dr. Agnes Jäger WS 2014/ 15 Sprachwandel und Sprachgeschichte in Lehrerfachzeitschriften mit besonderem Schwerpunkt auf Praxis Deutsch und Der Deutschunterricht
Seminar: Sprachgeschichte und Schule Prof. Dr. Agnes Jäger WS 2014/ 15 Sprachwandel und Sprachgeschichte in Lehrerfachzeitschriften mit besonderem Schwerpunkt auf Praxis Deutsch und Der Deutschunterricht
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse
 Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN
 RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN EINE UNTERRICHTSEINHEIT ZUR BILDBESCHREIBUNG FOKUSSIERT AUF DIE VERWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN IN EINER SIEBTEN KLASSE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN, DIE DEUTSCH
RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN EINE UNTERRICHTSEINHEIT ZUR BILDBESCHREIBUNG FOKUSSIERT AUF DIE VERWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN IN EINER SIEBTEN KLASSE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN, DIE DEUTSCH
Die Didaktik des Französischen, Spanischen und Italienischen in Deutschland einst und heute
 Andreas Michel Die Didaktik des Französischen, Spanischen und Italienischen in Deutschland einst und heute Verlag Dr. Kovac Hamburg 2006 Inhaltsverzeichnis Abkürzungen, Sonderzeichen und Symbole Vorwort
Andreas Michel Die Didaktik des Französischen, Spanischen und Italienischen in Deutschland einst und heute Verlag Dr. Kovac Hamburg 2006 Inhaltsverzeichnis Abkürzungen, Sonderzeichen und Symbole Vorwort
«Система работы учителя немецкого языка в условиях реализации ФГОС»
 Мастер-класс для учителей немецкого языка «Система работы учителя немецкого языка в условиях реализации ФГОС» Grammatikvermittlung im Daf-Unterricht Светлана Борисова, методист ГМЦ ДОгМ Sind Sie mit diesen
Мастер-класс для учителей немецкого языка «Система работы учителя немецкого языка в условиях реализации ФГОС» Grammatikvermittlung im Daf-Unterricht Светлана Борисова, методист ГМЦ ДОгМ Sind Sie mit diesen
Mehrsprachigkeit mit dem Ziel einer funktionalen Fremdsprachenkompetenz. Interkulturelle Kompetenz
 Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt auf der Basis des europäischen Aktionsplans 2004 2006 (http:/www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_de.pdf) Mehrsprachigkeit
Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt auf der Basis des europäischen Aktionsplans 2004 2006 (http:/www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_de.pdf) Mehrsprachigkeit
Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit
 Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit Referentin: Lisa Aul 28. Juni 2011 Vgl. Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit von Gerlind Belke Fakten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland der Regelfall Im Grundschulalter
Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit Referentin: Lisa Aul 28. Juni 2011 Vgl. Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit von Gerlind Belke Fakten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland der Regelfall Im Grundschulalter
Modul 7: Forschungspraxis. Autorenkollektiv
 Modul 7: Forschungspraxis Autorenkollektiv 1 Modul 7: Forschungspraxis Zu Modul 7: Forschungspraxis gehören folgende Online-Lernmodule: 1. Einführung in die Sprachlehr- und Mehrsprachigkeitsforschung 2.
Modul 7: Forschungspraxis Autorenkollektiv 1 Modul 7: Forschungspraxis Zu Modul 7: Forschungspraxis gehören folgende Online-Lernmodule: 1. Einführung in die Sprachlehr- und Mehrsprachigkeitsforschung 2.
Deutsch und andere Sprachen Deutsch als Zweitsprache
 Deutsch und andere Sprachen Deutsch als Zweitsprache Karin Kleppin Zur Situation im Deutschunterricht Für den Unterricht DaM gilt Folgendes: unterschiedliche Erstsprachen mit diesen Erstsprachen verbundene
Deutsch und andere Sprachen Deutsch als Zweitsprache Karin Kleppin Zur Situation im Deutschunterricht Für den Unterricht DaM gilt Folgendes: unterschiedliche Erstsprachen mit diesen Erstsprachen verbundene
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit
 Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit 1 Deutsch als Zweitsprache 2 Übersicht/Verlauf der Vorlesung Deutsche Sprache was ist
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit 1 Deutsch als Zweitsprache 2 Übersicht/Verlauf der Vorlesung Deutsche Sprache was ist
Green Line Band 3 (G9) Synopse mit dem neuen Kerncurriculum am Gymnasium des Landes Hessen 2011 für die Klasse 7
 Green Line Band 3 (G9) Synopse mit dem neuen Kerncurriculum am Gymnasium des Landes Hessen 2011 für die Klasse 7 Vorbemerkung Green Line 3 (G9) der 3. Band einer neu konzipierten Lehrwerksgeneration für
Green Line Band 3 (G9) Synopse mit dem neuen Kerncurriculum am Gymnasium des Landes Hessen 2011 für die Klasse 7 Vorbemerkung Green Line 3 (G9) der 3. Band einer neu konzipierten Lehrwerksgeneration für
Inhaltsverzeichnis. Vorwort. I. Grundlegendes 1
 Inhaltsverzeichnis Vorwort XI I. Grundlegendes 1 1. Fachgeschichtliche Entwicklungen der Sprachdidaktik (nach 1945) 2 1.1 Methodik und Didaktik der Deutschlehrerausbildung 2 1.2 Konstitution der Disziplin
Inhaltsverzeichnis Vorwort XI I. Grundlegendes 1 1. Fachgeschichtliche Entwicklungen der Sprachdidaktik (nach 1945) 2 1.1 Methodik und Didaktik der Deutschlehrerausbildung 2 1.2 Konstitution der Disziplin
1 Einführung: Ausdrucksfähigkeit bei Jugendlichen 11
 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung: Ausdrucksfähigkeit bei Jugendlichen 11 2 Jugendsprache in der linguistischen Forschung 19 2.1 Verständnisweisen... 19 2.2 Funktionen... 26 2.2.1 Jugendsprache als Mittel
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung: Ausdrucksfähigkeit bei Jugendlichen 11 2 Jugendsprache in der linguistischen Forschung 19 2.1 Verständnisweisen... 19 2.2 Funktionen... 26 2.2.1 Jugendsprache als Mittel
Hast du Fragen? Begleitmaterial Station 5. Ziel: Idee und Hintergrund. Kompetenzen. Fragen rund um das Thema Sprachen
 Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Die im Französischunterricht vermittelten Grundlagen sollen als Fundament für die Verständigung mit der frankophonen Bevölkerung der Schweiz dienen.
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Modulnummer Modulname Modulverantwortlicher. Vorlesung (V) (2 SWS) Einführungskurs (S) (2 SWS) Tutorium (T) (1 SWS) Selbststudium
 DAZ-B1 Basismodul 1: Grundlagen der germanistischen Sprachwissenschaft Das Modul umfasst ausgewählte Inhalte der germanistischen Sprachwissenschaft wie u. a. Phonetik, Grammatik, Lexikologie, (Fach-) Textlinguistik
DAZ-B1 Basismodul 1: Grundlagen der germanistischen Sprachwissenschaft Das Modul umfasst ausgewählte Inhalte der germanistischen Sprachwissenschaft wie u. a. Phonetik, Grammatik, Lexikologie, (Fach-) Textlinguistik
Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz
 Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Mehrsprachigkeitsdidaktik
 Mehrsprachigkeitsdidaktik Einleitende Bemerkungen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nyböle Hochschule Östfold, Norwegen www.hiof.no Sprache oder Dialekt? manchmal ist es schwierig, zwischen Einzelsprache und
Mehrsprachigkeitsdidaktik Einleitende Bemerkungen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nyböle Hochschule Östfold, Norwegen www.hiof.no Sprache oder Dialekt? manchmal ist es schwierig, zwischen Einzelsprache und
Konzeption der Seminarfolge: Curriculum: Voraussetzungen: Über Sprachkönnen und Fachwissen verfügen
 Konzeption der Seminarfolge: - Modulare Anlage - Semesterübergreifende Teilnahme - Einführungssitzungen: o Hinweis auf Rahmenrichtlinien und Curricula, die EPAS, den europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen
Konzeption der Seminarfolge: - Modulare Anlage - Semesterübergreifende Teilnahme - Einführungssitzungen: o Hinweis auf Rahmenrichtlinien und Curricula, die EPAS, den europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen
SCHULE FÜR ERWACHSENE 10
 SCHULE FÜR ERWACHSENE 10 ÜBERSICHT Die Schule für Erwachsene der Allgemeinen Gewerbeschule Basel bietet Kurse in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik an. Die Sprachkurse sind nach den Niveaus
SCHULE FÜR ERWACHSENE 10 ÜBERSICHT Die Schule für Erwachsene der Allgemeinen Gewerbeschule Basel bietet Kurse in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik an. Die Sprachkurse sind nach den Niveaus
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Einführung in die Sprachwissenschaft 3 2 VL P WS u. SoSe 1.-2.
 Fachwissenschaftliche Grundlagen Dr. Nicole Bachor-Pfeff BAS-1Deu-FW1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. sind in der Lage, die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in ihren wesentlichen Zusammenhängen
Fachwissenschaftliche Grundlagen Dr. Nicole Bachor-Pfeff BAS-1Deu-FW1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. sind in der Lage, die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in ihren wesentlichen Zusammenhängen
Mehrsprachigkeit. Problem? Recht? Potential? Chance?
 Mehrsprachigkeit Problem? Recht? Potential? Chance? Inhalt meines Vortrages Ist-Analyse: Zahlen und Fakten Begrifflichkeiten Situation mehrsprachiger Familien Mehrsprachigkeit als Potential und Chance
Mehrsprachigkeit Problem? Recht? Potential? Chance? Inhalt meines Vortrages Ist-Analyse: Zahlen und Fakten Begrifflichkeiten Situation mehrsprachiger Familien Mehrsprachigkeit als Potential und Chance
Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit)
 Janina Cyrener und Linn Haselei (September 2016) Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit) 1. Vorbemerkungen Für die Konzeption der
Janina Cyrener und Linn Haselei (September 2016) Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit) 1. Vorbemerkungen Für die Konzeption der
Inhaltsverzeichnis. Danksagung. Abbildungs Verzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
F) Germanistik. Folgende Module sind bei Germanistik als 1. Fach zu absolvieren:
 Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft Seite 32 von 112 F) Germanistik Folgende Module sind bei Germanistik als 1. Fach zu absolvieren: Studienprofil Gymnasium/
Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft Seite 32 von 112 F) Germanistik Folgende Module sind bei Germanistik als 1. Fach zu absolvieren: Studienprofil Gymnasium/
Lernstrategien in der Grundschule Wo sind die Defizite im Unterricht der Grundschule?
 Hans Merkens Lernstrategien in der Grundschule Wo sind die Defizite im Unterricht der Grundschule? Arbeitsbereich Empirische Erziehungswissenschaft Vortrag 22.11.2006 in Wünsdorf Spracherwerb in der Grundschule
Hans Merkens Lernstrategien in der Grundschule Wo sind die Defizite im Unterricht der Grundschule? Arbeitsbereich Empirische Erziehungswissenschaft Vortrag 22.11.2006 in Wünsdorf Spracherwerb in der Grundschule
Agenda. Kolloquium Spracherwerb - WS 2013/
 Agenda 1. Grammatikunterricht in der (Grund-)Schule - Was ist das überhaupt? 2. Einblick in die Bildungsstandards: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen und reflektieren 3. Methoden des Grammatikunterrichts
Agenda 1. Grammatikunterricht in der (Grund-)Schule - Was ist das überhaupt? 2. Einblick in die Bildungsstandards: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen und reflektieren 3. Methoden des Grammatikunterrichts
Rassismus in der Gesellschaft
 Geisteswissenschaft Anonym Rassismus in der Gesellschaft Examensarbeit Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaften Institut für Humanwissenschaften Fach: Soziologie Rassismus in der Gesellschaft
Geisteswissenschaft Anonym Rassismus in der Gesellschaft Examensarbeit Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaften Institut für Humanwissenschaften Fach: Soziologie Rassismus in der Gesellschaft
1. Körpersprache ist in der interkulturellen Kommunikation wichtig. Das habe ich erwartet.
 1. Grammatik: Körpersprache interkulturell. Bilden Sie Vergleichssätze mit als, wie oder je desto /umso. Verbinden Sie die Sätze und verändern Sie dabei, wo nötig, die Adjektive. 1. Körpersprache ist in
1. Grammatik: Körpersprache interkulturell. Bilden Sie Vergleichssätze mit als, wie oder je desto /umso. Verbinden Sie die Sätze und verändern Sie dabei, wo nötig, die Adjektive. 1. Körpersprache ist in
Modernes Hocharabisch: Lehrbuch mit einer Einführung in Hauptdialekte. Click here if your download doesn"t start automatically
 Modernes Hocharabisch: Lehrbuch mit einer Einführung in Hauptdialekte Click here if your download doesn"t start automatically Modernes Hocharabisch: Lehrbuch mit einer Einführung in Hauptdialekte Eckehard
Modernes Hocharabisch: Lehrbuch mit einer Einführung in Hauptdialekte Click here if your download doesn"t start automatically Modernes Hocharabisch: Lehrbuch mit einer Einführung in Hauptdialekte Eckehard
Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache
 Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache Modulhandbuch, Stand: 09.05.2016 Vorbemerkung Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet ab Juni 2016 einen Zertifikatskurs Deutsch
Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache Modulhandbuch, Stand: 09.05.2016 Vorbemerkung Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet ab Juni 2016 einen Zertifikatskurs Deutsch
SCHULE FÜR ERWACHSENE 10
 SCHULE FÜR ERWACHSENE 10 ÜBERSICHT Die Schule für Erwachsene der Allgemeinen Gewerbeschule Basel bietet Kurse in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik an. Die Sprachkurse sind nach den Niveaus
SCHULE FÜR ERWACHSENE 10 ÜBERSICHT Die Schule für Erwachsene der Allgemeinen Gewerbeschule Basel bietet Kurse in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik an. Die Sprachkurse sind nach den Niveaus
Allgemeine Ratschläge für die Sprachförderung
 Allgemeine Ratschläge für die Sprachförderung Maren Krempin, Kerstin Mehler, Sibel Ocak, Stephanie Rupp, Doris Stolberg Sprache geht alle an, deshalb ist es sinnvoll und bereichernd, zur Stärkung sprachlicher
Allgemeine Ratschläge für die Sprachförderung Maren Krempin, Kerstin Mehler, Sibel Ocak, Stephanie Rupp, Doris Stolberg Sprache geht alle an, deshalb ist es sinnvoll und bereichernd, zur Stärkung sprachlicher
Anlage 2: Modulliste. 8. Anlage 2 erhält folgende Fassung: Niveaustufe. Modulbezeichnung. Voraussetzung für die Teilnahme. für die Vergabe von LP
 8. Anlage 2 erhält folgende Fassung: Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung (Modulkürzel sind kein Namensbestandteil) LP Verpflichtungsgrad Niveaustufe Qualifikationsziele Voraussetzung für die Teilnahme
8. Anlage 2 erhält folgende Fassung: Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung (Modulkürzel sind kein Namensbestandteil) LP Verpflichtungsgrad Niveaustufe Qualifikationsziele Voraussetzung für die Teilnahme
Inhaltsverzeichnis. Vorwort Vorbetrachtungen... 15
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 13 Vorbetrachtungen... 15 Situation des fachsprachlichen und berufsbezogenen Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache... 15 Situation des Lehrers... 16 Gründe und Ziele der
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 13 Vorbetrachtungen... 15 Situation des fachsprachlichen und berufsbezogenen Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache... 15 Situation des Lehrers... 16 Gründe und Ziele der
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Jahrgangsstufen 3/4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet E 3/4 4.4 Einkaufen Kompetenzerwartungen Language Awareness: Der lange i-laut: [i:] Englisch Stand: 25.02.2016 1-2 Unterrichtseinheiten
Jahrgangsstufen 3/4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet E 3/4 4.4 Einkaufen Kompetenzerwartungen Language Awareness: Der lange i-laut: [i:] Englisch Stand: 25.02.2016 1-2 Unterrichtseinheiten
Synopse für Let s go Band 3 und 4
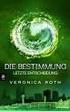 Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Daf/DaZ für Fortgeschrittene: Das gesamte Tempussystem
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Daf/DaZ für Fortgeschrittene: Das gesamte Tempussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Einfuehr.hin Einführung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Daf/DaZ für Fortgeschrittene: Das gesamte Tempussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Einfuehr.hin Einführung
IT Fragebogen für Sprachlehrer-Trainer - Datenanalyse
 IT Fragebogen für Sprachlehrer-Trainer - Datenanalyse Über die Teilnehmer 1. Sieben Sprachlehrer-Trainer haben den Fragebogen ausgefüllt. 2. Sechs Lehrer-Trainer sprechen Englisch, sechs Französisch, drei
IT Fragebogen für Sprachlehrer-Trainer - Datenanalyse Über die Teilnehmer 1. Sieben Sprachlehrer-Trainer haben den Fragebogen ausgefüllt. 2. Sechs Lehrer-Trainer sprechen Englisch, sechs Französisch, drei
Einführung in die Didaktik und Methodik des DaZ-Unterrichts
 Einführung in die Didaktik und Methodik des DaZ-Unterrichts Ziele und Aufgaben des Unterrichts Fachdidaktische und methodische Prinzipien Kompetenzbereiche des Spracherwerbs DaZ-Lehrer ist man nicht nur
Einführung in die Didaktik und Methodik des DaZ-Unterrichts Ziele und Aufgaben des Unterrichts Fachdidaktische und methodische Prinzipien Kompetenzbereiche des Spracherwerbs DaZ-Lehrer ist man nicht nur
10,5. Europäische Schulen. Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen
 10,5 Europäische Schulen Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen 7 13 Europäische Schulen in sechs Ländern Die Europäischen Schulen wurden gegründet, um die Kinder der Beschäftigten in den europäischen
10,5 Europäische Schulen Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen 7 13 Europäische Schulen in sechs Ländern Die Europäischen Schulen wurden gegründet, um die Kinder der Beschäftigten in den europäischen
VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21
 VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21 Übersicht zur Einpassung der Französisch und Englisch) in den Stand 16. September 2014 1 Projektvorgaben (Aussprachepapier zum Fachbereich Sprachen, von der
VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21 Übersicht zur Einpassung der Französisch und Englisch) in den Stand 16. September 2014 1 Projektvorgaben (Aussprachepapier zum Fachbereich Sprachen, von der
Englischlernen als Kontinuum in Grundschule und Sekundarstufe I: Diskussion über Gelingensbedingungen
 Englischlernen als Kontinuum in Grundschule und Sekundarstufe I: Diskussion über Gelingensbedingungen Frühbeginn im Fokus der Fremdsprachendidaktik Dieter Wolff Alter der Lernenden These: Der Englischunterricht
Englischlernen als Kontinuum in Grundschule und Sekundarstufe I: Diskussion über Gelingensbedingungen Frühbeginn im Fokus der Fremdsprachendidaktik Dieter Wolff Alter der Lernenden These: Der Englischunterricht
MITTEILUNGSBLATT. Studienjahr 2016/2017 Ausgegeben am Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
 MITTEILUNGSBLATT Studienjahr 201/2017 Ausgegeben am 2.0.2017 1. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. V E R O R D N U N G E N, R I C H T L I N I E N 11. Verordnung
MITTEILUNGSBLATT Studienjahr 201/2017 Ausgegeben am 2.0.2017 1. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. V E R O R D N U N G E N, R I C H T L I N I E N 11. Verordnung
Coaching-Portfolio 1. Warum bin ich hier? (Kärtchen mit verschiedenen sprachlichen Bereichen) 2. Wie lerne ich?/meine Ressourcen
 Coaching Portfolio Coaching-Portfolio Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Arbeitsblättern, die Teilnehmenden bei er Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, insbesondere seinem Sprachenlernen unterstützen
Coaching Portfolio Coaching-Portfolio Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Arbeitsblättern, die Teilnehmenden bei er Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, insbesondere seinem Sprachenlernen unterstützen
EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR
 Name: Matrikel-Nr. SS 2013 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 15.Juli 2013 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 72 BE Die folgenden Fragen sollten Sie in der Regel stichpunktartig
Name: Matrikel-Nr. SS 2013 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 15.Juli 2013 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 72 BE Die folgenden Fragen sollten Sie in der Regel stichpunktartig
Sylvette Penning. Leitfaden. Mit vielen praktischen Tipps für Ihren Unterricht.
 Sylvette Penning Leitfaden Mit vielen praktischen Tipps für Ihren Unterricht. Inhalt 1 2 3 Das Lehrwerk Schritte: Die Komponenten 3 Die Zielgruppe 4 Rahmenbedingungen 3.1. Schritte und der Gemeinsame Europäische
Sylvette Penning Leitfaden Mit vielen praktischen Tipps für Ihren Unterricht. Inhalt 1 2 3 Das Lehrwerk Schritte: Die Komponenten 3 Die Zielgruppe 4 Rahmenbedingungen 3.1. Schritte und der Gemeinsame Europäische
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie
 Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Der Status der Einheit Wort im Französischen
 Sprachen Rainer Kohlhaupt Der Status der Einheit Wort im Französischen Studienarbeit Der Status der Einheit Wort im Französischen von Rainer Kohlhaupt Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Verschiedene
Sprachen Rainer Kohlhaupt Der Status der Einheit Wort im Französischen Studienarbeit Der Status der Einheit Wort im Französischen von Rainer Kohlhaupt Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Verschiedene
1. Umrisse einer Didaktik der Mehrsprachigkeit 1
 V Vorwort XIII 1. Umrisse einer Didaktik der Mehrsprachigkeit 1 1.1 Mehrsprachigkeit als Regelfall 2 1.2 Welche Didaktik ist zuständig? DaM - DaZ - DaF oder die Interkulturelle Pädagogik? 4 1.2.1 Der ungeklärte
V Vorwort XIII 1. Umrisse einer Didaktik der Mehrsprachigkeit 1 1.1 Mehrsprachigkeit als Regelfall 2 1.2 Welche Didaktik ist zuständig? DaM - DaZ - DaF oder die Interkulturelle Pädagogik? 4 1.2.1 Der ungeklärte
- Theoretischer Bezugsrahmen -
 Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Deutsch als Fremdsprache
 Vorlesungsverzeichnis Universität Trier Winter 2012/13, gedruckt am: 05. März 2015 Deutsch als Fremdsprache Bachelor Vorlesungen 21533 Grundlagenvorlesung/Ringvorlesung Vorlesung, 2 Std., Mi 12:00-14:00,
Vorlesungsverzeichnis Universität Trier Winter 2012/13, gedruckt am: 05. März 2015 Deutsch als Fremdsprache Bachelor Vorlesungen 21533 Grundlagenvorlesung/Ringvorlesung Vorlesung, 2 Std., Mi 12:00-14:00,
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
Eintragung von Leistungen gemäß Anerkennungsverordnung
 Universität Wien An die StudienServiceStelle Deutsche Philologie Universitätsring 1 1010 Wien Eintragung von Leistungen gemäß Anerkennungsverordnung Angaben zur Studierenden/zum Studierenden Matrikelnummer:
Universität Wien An die StudienServiceStelle Deutsche Philologie Universitätsring 1 1010 Wien Eintragung von Leistungen gemäß Anerkennungsverordnung Angaben zur Studierenden/zum Studierenden Matrikelnummer:
Lehramt BA Prim / BA Sek 1. Bachelorarbeit
 11.10.2017 1 Ziel Nachweis der Fähigkeit, eine wissenschaftliche Fragestellung in einem begrenzten Umfang bearbeiten zu können Thema fachwissenschaftlich (literatur- bzw. sprachwissenschaftlich) fachdidaktisch
11.10.2017 1 Ziel Nachweis der Fähigkeit, eine wissenschaftliche Fragestellung in einem begrenzten Umfang bearbeiten zu können Thema fachwissenschaftlich (literatur- bzw. sprachwissenschaftlich) fachdidaktisch
Weiterbildung Volksschule. Vortragswerkstatt. Sprache als Chance. Herbstsemester weiterbilden.
 Weiterbildung Volksschule Vortragswerkstatt Sprache als Chance Herbstsemester 2017 weiterbilden. Sprache als Chance 3 Moderation und Diskussionsführung: Titus Bürgisser, PH Luzern, Zentrum Gesundheitsförderung
Weiterbildung Volksschule Vortragswerkstatt Sprache als Chance Herbstsemester 2017 weiterbilden. Sprache als Chance 3 Moderation und Diskussionsführung: Titus Bürgisser, PH Luzern, Zentrum Gesundheitsförderung
Erwartete Kompetenzen am Ende des 4. Schuljahrganges. Die Schüler erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen :
 Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
