2 Kostenverantwortung der Produktentwickler
|
|
|
- Carsten Linden
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 2 Kostenverantwortung der Produktentwickler In diesem Kapitel sollen zunächst einige für die Produktentwicklung relevante Kostenbegriffe erläutert werden. Im Anschluss daran wird untersucht, welchen Einfluss die an der Produktentwicklung beteiligten Unternehmensbereiche auf die Kostenentstehung eines Unternehmens haben. Dabei wird deutlich, dass der Produktentwicklung im Rahmen des Kostenmanagements in Unternehmen herausragende Bedeutung zukommt. Über Kostenfragen sollten allerdings Innovationen als Träger eines langfristigen Unternehmenserfolgs nicht vernachlässigt werden. 2.1 Was sind Kosten? In unserer Gesellschaft ist bereits die bloße Existenz eines Menschen mit ständigem Geldausgeben verbunden. Nahrung, Kleidung, Unterkunft, all das sind elementare Bedürfnisse, die durch die Aufwendung finanzieller Mittel stets von neuem befriedigt werden wollen. Aus diesem Grund dürfte jedem von uns das Problem der Kostenentstehung aus eigener Erfahrung vertraut sein. In der Betriebswirtschaftslehre werden Kosten (vgl. Kap. 8.1) allgemein als in Geld bewerteter Güterverbrauch für die betriebliche Leistungserstellung definiert. Als Güter im Sinne dieser Definition gelten Material, Energie und Betriebseinrichtungen ebenso wie die menschliche Arbeitskraft, Information oder die Nutzung von Kapital und der Rechte anderer. Ziel des Gütereinsatzes im Rahmen einer betrieblichen Leistungserstellung ist die Schaffung von Produkten oder das Erbringen von Dienstleistungen. Dabei wird immer eine sog. Wertschöpfung angestrebt, was bedeutet, dass dem Ergebnis des Gütereinsatzes mehr Wert beigemessen wird als der Summe der entstandenen Kosten. Die Kosten eines Unternehmens und Möglichkeiten zu ihrer Senkung können aus einer Vielzahl von Perspektiven heraus betrachtet werden. Unter dem Aspekt einer kosteneffizienten Produktentwicklung interessieren vor allem die durch Produkte verursachten Kosten. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Einteilung der Kosten nach Bild als sinnvoll erwiesen. Den Kern der produktbezogenen Kostenentstehung bilden die Herstellkosten (HK, vgl. Kap. 7), also diejenigen Kosten, die direkt dem Herstellprozess eines Produkts zugeordnet werden. Dazu zählen im Wesentlichen die Materialkosten und die Fertigungskosten für das Produkt. Darüber hinaus gibt es Kosten, die nicht direkt mit der Produktherstellung in Zusammenhang gebracht werden (z. B. Verwaltungskosten). Sie werden mit den Herstellkosten zu den Selbstkosten (SK, vgl. Kap. 6) eines Unternehmens zusam- K. Ehrlenspiel et al., Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren, DOI / _2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
2 8 2 Kostenverantwortung der Produktentwicklung 6147 Bild Einteilung der Kosten mengefasst. Die Selbstkosten gehen als Teil des Verkaufspreises wiederum in die Lebenslaufkosten (LLK, vgl. Kap. 5) eines Produkts ein. Die Lebenslaufkosten sind die Kosten, die beim Produktnutzer als Summe aller Kosten aufgrund des Kaufs und während der Nutzungszeit eines Produkts anfallen (vgl. Bild 5.1-5). Sie lassen sich grob in die folgenden Kostenarten untergliedern: Einstandskosten, die im Wesentlichen aus dem Einstandspreis des Produkts bestehen. Von den Einstandskosten kann eventuell der Wiederverkaufswert des Produkts am Ende der Nutzungsdauer abgezogen werden. Einmalige Kosten, wie z. B. Kosten für Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme, Personalschulung und Entsorgung 1 ; Betriebskosten, wie z. B. laufende Kosten für Energie, Betriebsstoffe und deren Entsorgung sowie die Löhne des Bedienpersonals; Instandhaltungskosten für Wartung, Inspektion und Instandsetzung; Sonstige Kosten, zu denen z. B. die Kapitalverzinsung, steuerliche Belastungen, Versicherungen und Ausfallkosten gehören. Für den Nutzer sind die Lebenslaufkosten das Kriterium, an dem er die Wirtschaftlichkeit eines Produkts messen kann. Diese streng ökonomische Sicht auf das Verhältnis von Nutzen und Kosten bei Produkten ist im Investitionsgüterbereich zunehmend wichtig. Die Lebenslaufkosten sind ein zentrales Verkaufsargument, das sich der Kunde auch vertraglich zusichern lassen kann. Auf dem Konsumgütersektor spielen bei Kaufentscheidungen dagegen oft auch andere Einflüsse eine wichtige Rolle. Die strikte Beurteilung dieser Produkte nach den zu erwartenden Lebenslaufkosten ist weniger üblich, obwohl dieser Aspekt dort auch an Bedeutung gewinnt (Bild 5.3-1). Grundsätzlich besteht dabei ein Spannungsverhältnis zwischen den Interessen des Produktnutzers und denen des Herstellers. Das primäre Interesse des Herstellers gilt der Maximierung und Absicherung seiner Unternehmenserträge, d. h. 1 Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz fallen diese Kosten u. U. auf den Hersteller zurück (siehe Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten ElektroG 2005 [ElG05] in [Cro12]).
3 2.1 Was sind Kosten? 9 des Gewinns. Vereinfacht gesagt, entsteht der Gewinn aus der Differenz zwischen Verkaufspreis des Produkts und den Selbstkosten des Unternehmens für die Produkterstellung. Darum strebt der Hersteller mit der Entwicklung kostengünstiger Produkte und innerbetrieblicher Rationalisierung vor allem danach, die Selbstkosten des Unternehmens so weit wie möglich zu reduzieren. Über die Selbstkosten hinaus ist der Hersteller aber an den Lebenslaufkosten seines Produkts insofern interessiert, als dadurch seine Konkurrenzfähigkeit am Markt, d. h. das Kundeninteresse, entscheidend verbessert wird, soweit er nicht ohnehin durch gesetzliche Bestimmungen z. B. bezüglich der Entsorgung dazu gezwungen wird. Für die Selbstkosten auf Unternehmensebene existieren noch eine Reihe weiterer Einteilungen, die im Rahmen des Kostenmanagements von Bedeutung sind. Dazu zählt die grundsätzliche Unterscheidung nach Kostenarten (vgl. Kap ), wie z. B. Materialkosten, Personalkosten oder Kapitalkosten. Aus der Kostenrechnung kommt zum einen noch die Einteilung in Einzelkosten und Gemeinkosten (vgl. Kap ), zum anderen in fixe Kosten und variable Kosten (vgl. Kap. 8.5) hinzu. Wie in Bild angedeutet, handelt es sich dabei nicht um andere Kosten, sondern lediglich um eine andere Sichtweise auf die Selbstkosten des Unternehmens. Einzelkosten sind Kosten, die sich sog. Kostenträgern (vgl. Kap ) direkt zuordnen lassen. Unter Kostenträgern werden dabei einzelne Produkte oder Dienstleitungen des Unternehmens verstanden. Typische Einzelkosten sind die Kosten für Fertigungsmaterial oder Fertigungslohn. Im Gegensatz dazu werden unter dem Begriff Gemeinkosten all jene Kosten zusammengefasst, die sich nicht direkt ei- Bild Verschiedene Sichten auf die Selbstkosten eines Unternehmens 6145
4 10 2 Kostenverantwortung der Produktentwicklung nem bestimmten Kostenträger zuordnen lassen. Dazu zählen z. B. die Kosten der Verwaltung, die Gehälter der Angestellten, aber auch Kosten von CAD oder der Raumheizung, die keinem bestimmten Kostenträger zugeordnet werden können. Des Weiteren werden Kosten, je nachdem ob sie vom Beschäftigungsgrad oder der produzierten Stückzahl abhängig sind, entweder als fixe oder als variable Kosten bezeichnet. Variable Kosten sind somit beispielsweise Materialeinzel- oder Fertigungslohnkosten, die nur anfallen, wenn tatsächlich produziert wird. Fixe Kosten, wie Mieten, Abschreibungen oder Gehälter, fallen dagegen i. d. R. unabhängig von der Auslastung eines Unternehmens an. 2.2 Wer nimmt Einfluss auf die Kostenentstehung im Unternehmen? Ziel der Unternehmenspolitik ist es, den Ertrag, also die Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu steigern und langfristig abzusichern. Da der Gewinn sich aus dem Erlös abzüglich der Kosten ergibt, sind dazu grundsätzlich die drei in Bild aufgeführten Vorgehensweisen denkbar, die meist parallel angewandt werden. Bild Alternativen zur Steigerung des Unternehmensertrags 6206
5 2.2 Wer nimmt Einfluss auf die Kostenentstehung im Unternehmen? 11 Die erste Möglichkeit besteht darin, den Erlös des Unternehmens zu erhöhen. Das Angebot marktgerechterer, besserer Produkte kann dazu ebenso beitragen, wie die Verkürzung von Lieferzeiten und die Verbesserung von Vertrieb und Kundenservice. Insbesondere Unternehmen in Ländern mit starkem Wettbewerb leben von innovativen Produkten [Gau00]. Dies sei zu Beginn eines Buchs zum Kostensenken besonders betont. Die zweite Möglichkeit, den Gewinn zu erhöhen, ist die Verringerung der Selbstkosten: Dies kann unter anderem durch die Rationalisierung des Produkterstellungsprozesses erfolgen. Unter dem Begriff Rationalisierung werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die dazu dienen, die betrieblichen Abläufe effizienter zu gestalten, und dadurch die Kosten bei der Herstellung eines vorgegebenen Produkts oder beim Erbringen einer Dienstleistung reduzieren. Dazu können u. a. verstärkter Rechnereinsatz, Automatisierung in der Fertigung, das Senken der Personalkosten, die Beschleunigung des Auftragsdurchlaufs oder die Verringerung des Lagerbestands beitragen. Parallel dazu muss die Strategie der Entwicklung kostengünstiger Produkte verfolgt werden. Hierbei geht es um das Erarbeiten grundsätzlich kostengünstiger Produktkonzepte, die Verringerung der Teilevielfalt, die fertigungs-, montage- und materialkostengünstige Gestaltung von Produkten und die innerbetriebliche Normung. Im Gegensatz zu Rationalisierungsmaßnahmen stellt die Entwicklung kostengünstiger Produkte eine Maßnahme zum Senken der Kosten dar, die eher mittel- und langfristig zum Tragen kommt. Wie fügen sich diese drei Strategien zur Ertragssteigerung in die betrieblichen Abläufe ein? Um diese Frage beantworten zu können, muss zunächst ein Blick auf die fünf wichtigsten Abschnitte im Produktlebenslauf (Bild 2.2-2) geworfen werden: Die Entscheidung über das Produkt wird bei der Projektierung oder der Produktplanung vorbereitet und anschließend entweder beim Kunden auf Grundlage eines abgegebenen Angebots oder bei einem Verantwortlichen innerhalb des Unternehmens getroffen. Die Vorbereitung beider Entscheidungen weist grundsätzliche Unterschiede auf. Bei der Projektierung wird ausgehend vom Kundenwunsch ein meist spezielles Produkt- oder Anlagenkonzept erstellt. Wichtig dabei ist die möglichst scharfe Interpretation der Kundenanforderungen sowie das Aufzeigen möglicher Lösungsalternativen zu einzelnen Forderungen und Wünschen und der damit verbundenen Kostenwirkungen. Es werden die für den Kunden wichtigsten technischen Eigenschaften durch einen überschlägigen Berechnungs- und Konstruktionsprozess festgestellt (z. B. Gewicht, Leistungsfähigkeit, Baugröße) und die Kosten abgeschätzt. Das Ergebnis der Projektierung ist ein Angebot. Trotz der meist nur sehr geringen Zeit für die Projektierung sollte der Nachweis über die Erreichbarkeit der Zielkosten Voraussetzung für die Freigabe eines Angebots sein. Bei der Projektierung wird daher soweit wie möglich mit bekannten Elementen (Funktionen, Bauteilen und deren Kosten) gearbeitet, so dass das Angebot bei Auftrag oft als Varianten- oder Anpassungskonstruktion realisiert wird.
6 12 2 Kostenverantwortung der Produktentwicklung Im Gegensatz zur Projektierung ist die Produktplanung der Prozess für eine innerbetriebliche Entscheidung, ob ein neues Produkt oder eine neue Anlage für eine Vielzahl von Kunden entwickelt werden soll. Es werden die Kundenanfragen vorausgedacht, aus denen in Zukunft profitable Aufträge entstehen können. Fragen hierbei sind: Welche Problemstellungen werden in Zukunft zu Kundenanfragen führen? Mit welchen Problemlösungen kann man weitere profitable Aufträge erhalten? Die Produktplanung ist eher langfristig, strategisch ausgerichtet, mit dem Ergebnis einer internen Entscheidungsvorlage häufig für eine Neu- oder Anpassungskonstruktion. Der mit der Entscheidung verbundene Neuheitsgrad in Bezug auf Markt sowie auch Produkt und Technologie erhöht dabei das unternehmerische Risiko. Bei der Produktplanung werden zunächst ausgehend von Informationen über das Unternehmen und sein Umfeld Suchfelder für Produktideen festgelegt und das Unternehmenspotenzial analysiert. Anschließend gilt es, Produktideen zu finden und einem meist mehrstufigen Bewertungssystem zuzuführen. Strategische Produktentscheidungen können dabei meist nicht auf Anhieb bzw. in einem streng planbaren Ablauf getroffen werden. Sie bedürfen einer längeren, kontinuierlichen Vorbereitung, während der es darauf ankommt, in einem Lernprozess interne Fähigkeiten der Organisation sowie externe Chancen und Gefahren zu erkennen und Handlungsoptionen zu sammeln [Ger02]. Wichtig bei der Produktplanung ist es, die verschiedenen zusammenhängenden Systeme Märkte, Kundengruppen, Vertriebswege, Bedürfnisstrukturen, rechtliche Rahmenbedingungen, Herstellprozesse etc. bei der Entscheidungsfindung im Blick zu behalten und mit den Unternehmenszielen zu einem schlüssigen Ganzen zu verknüpfen [Mai01]. Das Wissen über die Merkmale der verschiedenen Systeme und ihre Zusammenhänge ist Voraussetzung für die Produktplanung und auch dafür, dass Entscheidungen umsetzbar und mögliche Ziele erreichbar sind. Zur Entwicklung eines Produkts zählen alle Vorgänge, die nach dem Anstoß des Entwicklungsvorhabens die Aufnahme einer regulären Produktion vorbereiten. Im Zuge des Entwicklungsprozesses müssen die Eigenschaften des Produkts so festgelegt werden, dass die Nutzung durch den Kunden und die Fertigung entsprechend den Vorgaben der Projektierung möglich ist. Ziel der Entwicklung ist das Erarbeiten von Fertigungs- und Nutzungsunterlagen. In der Fertigung (auch Produktion) entsteht das reale Produkt durch Teilefertigung und Montage weitgehend nach den Vorgaben der Entwicklung. Das Produkt wird im Hinblick auf seine Nutzung gekauft. Projektierung, Entwicklung und Fertigung orientieren sich darum am Nutzen eines Produkts für potenzielle Käufer [VDM97]. Orientierung am Nutzergewinn! Die Entsorgung des Produkts nach dem Ende der Nutzung schließt den Produktlebenslauf ab. Während der einzelnen Lebensabschnitte entstehen Kosten, die sich über den ganzen Produktlebenslauf hinweg zu den Lebenslaufkosten summieren (vgl. Bild 5.1-3). Diese werden je nach Art und Nutzung des Produkts in ihrer Zusam-
7 2.2 Wer nimmt Einfluss auf die Kostenentstehung im Unternehmen? 13 mensetzung stark variieren. Die damit verbundene Problematik wird in Kap. 5 noch Gegenstand einer ausführlichen Diskussion sein. An dieser Stelle ist jedoch die Frage sehr viel wichtiger, wann genau während des Produktlebenslaufs die Weichen gestellt werden für das Besondere, den Pfiff eines Produkts ebenso wie für die weitere Kostenentstehung. Bild zeigt schematisch die Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung und die zunehmende Kostenentstehung über der Abfolge der Lebensabschnitte eines Produkts. Die Kurven sind gegenläufig! In den Anfangsphasen, in denen man am meisten beeinflussen kann, weiß man am wenigsten über die späteren Kosten. Es ist einleuchtend, dass bei der Produktplanung und Projektierung die Kosten eines vage definierten Produkts zunächst nur sehr vage festliegen aber die Einflussmöglichkeiten am größten sind. Mit Beginn des Entwicklungsprozesses sind die entscheidenden Weichenstellungen erfolgt, bei seinem Abschluss liegen die Lebenslaufkosten des Produkts weitgehend fest, auch wenn sie noch nicht bekannt sind. Im Rahmen von Produktion, Nutzung und Entsorgung kann nur noch eine Kostenoptimierung einzelner Prozesse auf der Grundlage des Entwicklungsergebnisses erfolgen. Ist ein Pkw-Motor entwickelt, dann ist an den Herstellkosten und den Betriebskosten kaum mehr zu rütteln. Durch geschickte Auswahl der Fertigungsprozesse oder durch besonders behutsame Fahrweise können noch Kosten eingespart werden. Am größten Teil der Lebenslaufkosten wird das im Vergleich zu der Einflussnahme, die zu Beginn bestand, jedoch nur wenig ändern können. Das gilt in gleichem Maß für den Innovationsvorsprung bzw. die Orientierung am Kunden- Bild Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung und Kostenfestlegung während des Produktlebenslaufs: das Dilemma der Produktentwicklung! (Beispiel Neukonstruktion) 6134
8 14 2 Kostenverantwortung der Produktentwicklung nutzen eines Produkts. Diese Aussagen gelten für die Neukonstruktion. Bei Anpassungs- und Variantenkonstruktion sind die Einflussmöglichkeiten geringer (vgl. Kap ). Die Bedeutung der frühen Lebensabschnitte für einen Produkterfolg kann nicht genug betont werden. Was hier falsch gemacht wird, kann in der Folge, wenn überhaupt, nur mit sehr hohem Aufwand korrigiert werden. Daraus ergibt sich auch die Bedeutung von Maßnahmen zur Kostenfrüherkennung (vgl. Kap. 9). Den traditionell eher technisch denkenden Entwicklern muss daher nahe gebracht werden, dass jede technische Festlegung auch eine Festlegung von Kosten darstellt; diese Kostenfestlegung simultan im Entwicklungsprozess kontrolliert werden muss (Die Kosten müssten bei der technischen Entscheidung vorliegen!); andernfalls das Produkt zu teuer werden kann, was zeit- und kostenintensive Änderungen erforderlich macht (vgl. Bild 4.2-3). Aus den Erfahrungen der Praxis heraus wurde daraus die Rule of Ten formuliert, die das exponentielle Wachstum der Kosten über dem Lebenslauf vermitteln soll. Änderungen sind umso teurer, je später sie erfolgen: Eine Änderung während der Aufgabenklärung kostet z. B. 1, während der Konstruktion 10, während der Fertigungsvorbereitung 100, während der Fertigung und nach der Auslieferung ! Produktplanung, Projektierung und Entwicklung sind von überragender Bedeutung für den weiteren Lebenslauf eines Produkts. Doch wer fällt die grundlegenden Entscheidungen innerhalb dieser Prozesse, wer legt tatsächlich die zukünftigen Kosten eines Produkts fest? Dazu sei kurz die Rolle dargestellt, die Geschäftsführung, Vertrieb, Entwicklung und Fertigung beim Planen, Projektieren und Entwickeln eines neuen Produkts spielen. Die Geschäftsführung legt die Firmenpolitik fest. Damit ist sie selbstverständlich auch für die grundsätzliche Ausrichtung der Produktpalette des Unternehmens verantwortlich. Mit der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt oder Produktprogramm wird auch über dessen wesentliche Kosten entschieden, selbst wenn sie im Einzelnen noch nicht bekannt sind. Ein technisch kompetenter Vertrieb und ein entsprechendes Marketing stellen den Mittler zwischen dem Markt, den Kunden und dem Unternehmen dar. Ihre Aufgabe ist es daher, die Wünsche potenzieller Kunden zu analysieren und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse die Projektierung neuer Produkte anzustoßen. Die konsequente Einbeziehung von Vertrieb und Marketing und damit des Kundenbedarfs beim Planen, Projektieren und Entwickeln stellt einen Schlüssel zum Produkterfolg dar. Teil der Mittlerfunktion ist es auch, Kostenziele für ein neu zu entwickelndes Produkt vom Markt abzuleiten und damit in dieser Hinsicht konkrete Vorgaben für den Entwicklungsprozess zu schaffen. Die Entwicklung ist der Träger sowohl des Projektierungs- als auch des Entwicklungsprozesses. Hier sollten sich die Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen in einem marktfähigen Produktkonzept bzw. Produkt niederschlagen. Zu den wichtigsten Aufgaben der Entwicklung gehört es, den Spagat zwischen dem Wunschprodukt des Kunden, den geplanten Technologieveränderungen und dem technisch wie wirtschaftlich Realisierbaren zu vollziehen. Mit dem Abschluss der
9 2.2 Wer nimmt Einfluss auf die Kostenentstehung im Unternehmen? 15 Produktkosten in [%] 100 Festlegung (verantwortlich sein) ~18 % ~7 % ~5 % ~22 % ~38 % 50 0 Entwicklung Konstruktion ~70 % ~9 % Realisierung ~3 % Fertigung ~28 % festgelegte Kosten z. T. beeinflussbar realisierte (verrechnete) Kosten Fertigungsvorbereitung Materialwirtschaft Zulieferer Vertrieb Verwaltung Bild Kostenfestlegung und Kostenentstehung in unterschiedlichen Unternehmensbereichen [VDI87; VDM06] 6 Konstruktion sind sowohl die Herstell-, als auch die Betriebs- und Entsorgungskosten weitgehend fixiert. Von daher kann gesagt werden, dass die Entwicklung den größten, zumindest aber einen unmittelbar quantitativen Einfluss auf die Herstell- und Lebenslaufkosten eines Produkts hat (vgl. Bild 2.2-3). In der Fertigung entstehen zusammen mit der Beschaffung (Einkauf) meist die größten Kosten im Unternehmen, weshalb bei der Durchsetzung von Rationalisierungsmaßnahmen der Schwerpunkt eigentlich immer auf diesen Bereichen lastet. Da die Optimierung der Teilefertigungs- und Montageprozesse jedoch schon bei der Festlegung der Produktgestalt selbst am wirkungsvollsten und aufwandsärmsten ist, muss die Einbindung der Fertigung und der Beschaffung in Planung, Projektierung und Entwicklung neuer Produkte von Beginn an organisiert werden. Dabei fließen das Know-how und die unternehmensspezifischen technologischen Randbedingungen in den Entwicklungsprozess ein, genauso wie sich die Fertigung ihrerseits rechtzeitig auf die neuen Produkte einstellen kann (Teamarbeit, Kap ; und ). In der Vergangenheit wurde vielfach versucht, den Einfluss der unterschiedlichen Unternehmensbereiche auf die Kostenfestlegung bei der Produktentwicklung zu quantifizieren. So bestätigen Untersuchungen (vgl. Bild 2.2-3, [Bro68a; Ehr80a]), dass die technischen Planungsabteilungen (Entwicklung und Ferti-
10 16 2 Kostenverantwortung der Produktentwicklung gungsplanungsplanung) gemeinsam rund 90 % der Produktkosten festlegen. 2 Zu beachten ist der enorme Unterschied zwischen der hohen Kostenverantwortung der Entwicklung und ihren eigenen Kosten, die bei rund einem Achtel liegen. Es ist folglich sinnlos, die Entwicklung personell auszudünnen, um Selbstkosten zu verringern. Vielmehr sollte es das Ziel sein, einen qualifizierten Personalstamm aufzubauen, der mit Hilfe der Methoden des Kostenmanagements ein Vielfaches seiner eigenen Kosten hereinholt. Das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen wird in dieser Darstellung jedoch nicht aufgezeigt. Die Projektierung und Entwicklung eines neuen Produkts sollte immer im engen Zusammenspiel von Entwicklung, Vertrieb, Produktion, Beschaffung, Controlling und Geschäftsführung erfolgen. Der Entwicklungsabteilung kommt dabei auch die Rolle des zentralen Vermittlers zwischen den verschiedenen Beteiligten zu [Cla91; Mon89; Sak89a; Sak89b; Wom91; Wom98]. Das Wissen und die Erfahrung des ganzen Unternehmens für die Produktentwicklung nutzbar zu machen, ist die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe für die Produktentwickler. 2 Die Festlegungen der Entwicklung betreffen zunächst die variablen Herstellkosten (vgl. Bild und Kap ). Wenn die Selbstkosten über feste Zuschlagsätze aus den Herstellkosten errechnet werden, gilt die Aussage auch für die Selbstkosten.
11
KALKULATIONSVERFAHREN
 KALKULATIONSVERFAHREN EINSTUFIGE DIVISIONSKALKULATION 1. Die Firma Plastic GmbH stellt eine Produktart her, für die Gesamtkosten für 2018 in Höhe von 450.000 angefallen sind. Die Ausbringungsmenge in dieser
KALKULATIONSVERFAHREN EINSTUFIGE DIVISIONSKALKULATION 1. Die Firma Plastic GmbH stellt eine Produktart her, für die Gesamtkosten für 2018 in Höhe von 450.000 angefallen sind. Die Ausbringungsmenge in dieser
Kosten- und Leistungsrechnung
 - und Leistungsrechnung Einführung zur Abgrenzungstabelle und zum betrieblichen Abrechnungsbogen (BAB) Zweikreissystem im Industriekontenrahmen Während die Finanzbuchhaltung den steuerlichen Gewinn des
- und Leistungsrechnung Einführung zur Abgrenzungstabelle und zum betrieblichen Abrechnungsbogen (BAB) Zweikreissystem im Industriekontenrahmen Während die Finanzbuchhaltung den steuerlichen Gewinn des
Ingenieur- und Beratungsbüro B. Villing, Target Costing
 Target Costing Zielkosten und Kundenwünsche als Vorgabe der Produktentwicklung Was nützt die beste Entwicklung, wenn das Produkt durch zu hohe Herstellkosten nicht verkauft werden kann? Um dies zu vermeiden
Target Costing Zielkosten und Kundenwünsche als Vorgabe der Produktentwicklung Was nützt die beste Entwicklung, wenn das Produkt durch zu hohe Herstellkosten nicht verkauft werden kann? Um dies zu vermeiden
Die 150 besten Checklisten zur effizienten Produktion
 Edgar Weier Die 150 besten Checklisten zur effizienten Produktion Produktionssystem und Auslastung optimieren Durchlaufzeit und Kosten senken Qualität und Zuverlässigkeit steigern 3 1 Unternehmensstrategie
Edgar Weier Die 150 besten Checklisten zur effizienten Produktion Produktionssystem und Auslastung optimieren Durchlaufzeit und Kosten senken Qualität und Zuverlässigkeit steigern 3 1 Unternehmensstrategie
Rechnungswesen. Kostenrechnung
 Rechnungswesen Kostenrechnung Was sind Kosten? Ja Betriebsbedingt und periodenbezogen Einsatz on Gütern und Dienstleistungen Nein Nicht betriebsbedingt, außerordentlich, einer anderen Periode zurechenbar
Rechnungswesen Kostenrechnung Was sind Kosten? Ja Betriebsbedingt und periodenbezogen Einsatz on Gütern und Dienstleistungen Nein Nicht betriebsbedingt, außerordentlich, einer anderen Periode zurechenbar
Fallbeispiel. Fallbeispiel zur Vorlesung Richard Kuttenreich. Fallbeispiel BICYCLECOMPANY AG - Lösung SS Seite 1 von 14
 Fallbeispiel Fallbeispiel zur Vorlesung Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Fallbeispiel BICYCLECOMPANY AG - Lösung SS 2012 Prof. Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und
Fallbeispiel Fallbeispiel zur Vorlesung Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Fallbeispiel BICYCLECOMPANY AG - Lösung SS 2012 Prof. Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und
Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure Kostenkalkulation. Richard Kuttenreich
 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure Kostenkalkulation Richard Kuttenreich Beziehungen zwischen Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgern Kostenarten Kostenträger Fertigungsmaterial (Rohstoffe) Fertigungslöhne
Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure Kostenkalkulation Richard Kuttenreich Beziehungen zwischen Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgern Kostenarten Kostenträger Fertigungsmaterial (Rohstoffe) Fertigungslöhne
Teilkostenrechnung. ( Finanzbuchhaltung; bestimmt durch steuerliche Vorschriften; externes Rechnungswesen)
 1 Teilkostenrechnung 1 Kostenrechnung als Instrument des betrieblichen Controllings Controlling (Internes Rechnungswesen) Das interne Rechnungswesen als Führungssubsystem befasst sich mit Beschaffung,
1 Teilkostenrechnung 1 Kostenrechnung als Instrument des betrieblichen Controllings Controlling (Internes Rechnungswesen) Das interne Rechnungswesen als Führungssubsystem befasst sich mit Beschaffung,
Deckungsbeitragsrechnung
 136 Berücksichtigung von Fixkosten in der Kostenrechnung keine besondere Berücksichtigung in Vollkostenrechnungen Trennung der Kosten in Einzel- und Gemeinkosten z.b. bei Zuschlagskalkulation aber: keine
136 Berücksichtigung von Fixkosten in der Kostenrechnung keine besondere Berücksichtigung in Vollkostenrechnungen Trennung der Kosten in Einzel- und Gemeinkosten z.b. bei Zuschlagskalkulation aber: keine
Prof. Dr. H. Dirrigl Wintersemester 2009/2010 Modul Operatives Controlling Kosten- und Erlös-Controlling
 Pro. Dr. H. Dirrigl Wintersemester 2009/2010 Modul Operaties Controlling Kosten- und Erlös-Controlling 1. Controlling au Basis der Kosten- und Erlösrechnung 2. Systeme der Kosten- und Erlösrechnung 2.1.
Pro. Dr. H. Dirrigl Wintersemester 2009/2010 Modul Operaties Controlling Kosten- und Erlös-Controlling 1. Controlling au Basis der Kosten- und Erlösrechnung 2. Systeme der Kosten- und Erlösrechnung 2.1.
3 Gliederungsmöglichkeiten von Kostenarten
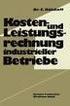 1 von 5 04.10.2010 14:21 Hinweis: Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle
1 von 5 04.10.2010 14:21 Hinweis: Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle
Kostengünstig entwickeln und konstruieren
 TAE Technische Akademie Esslingen Ihr Partner für Weiterbildung seit 60 Jahren! Maschinenbau, Produktion und Fahrzeugtechnik Tribologie Reibung, Verschleiß und Schmierung Elektrotechnik, Elektronik und
TAE Technische Akademie Esslingen Ihr Partner für Weiterbildung seit 60 Jahren! Maschinenbau, Produktion und Fahrzeugtechnik Tribologie Reibung, Verschleiß und Schmierung Elektrotechnik, Elektronik und
Die verschiedenen Investitionsalternativen werden durch Gegenüberstellung ihrer wesentlichen Kosten beurteilt. Dazu gehören:
 Statische Verfahren 2 2.1 Kostenvergleichsrechnung Die verschiedenen Investitionsalternativen werden durch Gegenüberstellung ihrer wesentlichen Kosten beurteilt. Dazu gehören: Anschaffungswert Kapitalkosten
Statische Verfahren 2 2.1 Kostenvergleichsrechnung Die verschiedenen Investitionsalternativen werden durch Gegenüberstellung ihrer wesentlichen Kosten beurteilt. Dazu gehören: Anschaffungswert Kapitalkosten
5.3 Dokumentation von Kostenprognosen
 5.3 Dokumentation von Kostenprognosen Prognose von Gemeinkosten Gemeinkosten der Betriebsarbeit Hilfs-, Betriebsstoff- und Werkzeugkosten Instandhaltungskosten Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische
5.3 Dokumentation von Kostenprognosen Prognose von Gemeinkosten Gemeinkosten der Betriebsarbeit Hilfs-, Betriebsstoff- und Werkzeugkosten Instandhaltungskosten Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische
Kostenrechnung Kostenartenrechnung
 Methoden zur Entscheidungsfindung Grundlagen neue Systeme Funktionen Plankostenrechnung Produktionsprogrammplanung Kostenrechnung Kostenartenrechnung Gliederung von Kostenarten Erfassung von Kostenarten
Methoden zur Entscheidungsfindung Grundlagen neue Systeme Funktionen Plankostenrechnung Produktionsprogrammplanung Kostenrechnung Kostenartenrechnung Gliederung von Kostenarten Erfassung von Kostenarten
1. Nicht zu den Aufgaben des Rechnungswesens zählt. 2. Eine Bilanz kann durch folgenden Satz beschrieben werden
 Rechnungswesen 1. Nicht zu den Aufgaben des Rechnungswesens zählt a) Dispositionsaufgabe b) Legitimationsaufgabe* c) Dokumentationsaufgabe d) Kontrollaufgabe 2. Eine Bilanz kann durch folgenden Satz beschrieben
Rechnungswesen 1. Nicht zu den Aufgaben des Rechnungswesens zählt a) Dispositionsaufgabe b) Legitimationsaufgabe* c) Dokumentationsaufgabe d) Kontrollaufgabe 2. Eine Bilanz kann durch folgenden Satz beschrieben
Kostenträgerrechnung. Grundlagen Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung. Kostenträgerrechnung. Deckungsbeitragsrechnung
 118 Kostenträgerrechnung Kostenträgerrechnung dritte Stufe der Kostenrechnung: wofür sind die Kosten angefallen? Übernahme der Einzelkosten aus der Übernahme der Gemeinkosten aus der vielfältige Aufgaben
118 Kostenträgerrechnung Kostenträgerrechnung dritte Stufe der Kostenrechnung: wofür sind die Kosten angefallen? Übernahme der Einzelkosten aus der Übernahme der Gemeinkosten aus der vielfältige Aufgaben
B. Verfahren der Investitionsrechnung
 Auf einen Blick: Statische Investitionsrechnungsverfahren die klassischen Verfahren zur Berechnung der Vorteilhaftigkeit einer Investition. Dynamische Investitionsrechnungsverfahren der moderne Weg zur
Auf einen Blick: Statische Investitionsrechnungsverfahren die klassischen Verfahren zur Berechnung der Vorteilhaftigkeit einer Investition. Dynamische Investitionsrechnungsverfahren der moderne Weg zur
Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerstückrechnung
 G Kosten- und Leistungsrechnung Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerstückrechnung Aufgabe 74 Welche der Definition(en) passt (passen) auf den Begriff Kostenträger? a) Anlagen
G Kosten- und Leistungsrechnung Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerstückrechnung Aufgabe 74 Welche der Definition(en) passt (passen) auf den Begriff Kostenträger? a) Anlagen
Die Gewinnermittlung eines Industriebetriebes
 Ausgangspunkt ist die Gewinnermittlung eines Handelsbetriebes. Hierfür gilt: (1) Gewinn = Umsatz Wareneinsatz übrige Kosten Dabei ist der Wareneinsatz der mit den Anschaffungskosten pro Stück bewertete
Ausgangspunkt ist die Gewinnermittlung eines Handelsbetriebes. Hierfür gilt: (1) Gewinn = Umsatz Wareneinsatz übrige Kosten Dabei ist der Wareneinsatz der mit den Anschaffungskosten pro Stück bewertete
Klausur zur Vorlesung Betriebliches Rechnungswesen II - Industrielle Kosten- und Leistungsrechnung im Sommersemester 2017
 Leibniz Universität Hannover Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Produktionswirtschaft Prof. Dr. Stefan Helber Klausur zur Vorlesung Betriebliches Rechnungswesen II - Industrielle Kosten-
Leibniz Universität Hannover Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Produktionswirtschaft Prof. Dr. Stefan Helber Klausur zur Vorlesung Betriebliches Rechnungswesen II - Industrielle Kosten-
Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
 Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Kalkulation von Kontaktlinsen ein Workbook
 Kalkulation von Kontaktlinsen ein Workbook Betreuer: Prof. Dr. Anna Nagl Dipl.-Ing. (FH) Gunther Oesker 1 Gliederung Einleitung: Weshalb ist eine eigene Kalkulation notwendig? Problemstellung Ziele dieser
Kalkulation von Kontaktlinsen ein Workbook Betreuer: Prof. Dr. Anna Nagl Dipl.-Ing. (FH) Gunther Oesker 1 Gliederung Einleitung: Weshalb ist eine eigene Kalkulation notwendig? Problemstellung Ziele dieser
für Management und Training -Betriebswirt- Ambossweg 1a Breckerfeld Rechtsstand: 2011 / 2012 Gesetzliche Mehrwertsteuer 19,00% 119,00%
 Seite 1 Copyright Autor MTF Unternehmensberatung Georg Freund für Management und Training -Betriebswirt- Ambossweg 1a 58339 Breckerfeld Deckungsbeitragsrechnung Fach: Kostenrechnung Rechtsstand: 2011 /
Seite 1 Copyright Autor MTF Unternehmensberatung Georg Freund für Management und Training -Betriebswirt- Ambossweg 1a 58339 Breckerfeld Deckungsbeitragsrechnung Fach: Kostenrechnung Rechtsstand: 2011 /
Klausur Internes Rechnungswesen
 Institut für Verbundstudien der Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens IfV NRW Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft Master of Business Administration Prof. Dr. W. Hufnagel / Dipl. Betriebsw.
Institut für Verbundstudien der Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens IfV NRW Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft Master of Business Administration Prof. Dr. W. Hufnagel / Dipl. Betriebsw.
Musterlösung Übungsklausur Kostenrechnung WS 2001/02 Prof. Dr. Ursula Kück Seite 1
 Prof. Dr. Ursula Kück Seite 1 Aufgabe 1 (ca. 30 min.) Kostenstellen (KST) Technik Studio Material Produktion Verwaltung Vertrieb a) Leistungen von KST Technik 33.750 67.500 a) Leistungen von KST Studio
Prof. Dr. Ursula Kück Seite 1 Aufgabe 1 (ca. 30 min.) Kostenstellen (KST) Technik Studio Material Produktion Verwaltung Vertrieb a) Leistungen von KST Technik 33.750 67.500 a) Leistungen von KST Studio
Betriebsabrechnungsbogen (BAB I)
 Ausgefüllter BAB I mit verteilten Gemeinkosten Betriebsabrechnungsbogen (BAB I) Gemeinkosten (in Tsd. ) Materialbereich I II Verwalt.- bereich Vertriebsbereich Summe Hilfs-/Betriebsstoffe 0 220.000 170.000
Ausgefüllter BAB I mit verteilten Gemeinkosten Betriebsabrechnungsbogen (BAB I) Gemeinkosten (in Tsd. ) Materialbereich I II Verwalt.- bereich Vertriebsbereich Summe Hilfs-/Betriebsstoffe 0 220.000 170.000
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012
 Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Mitschrift der Vorlesung vom 06.06.2012 4.3
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Mitschrift der Vorlesung vom 06.06.2012 4.3
Musterlösung. Wintersemester 2007/2008 Klausur Kosten- und Leistungsrechnung (Grundstudium) am Name: Vorname: Matrikel-Nr.
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre - Controlling Prof. Dr. Gunther Friedl Musterlösung Wintersemester 2007/2008 Klausur Kosten-
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre - Controlling Prof. Dr. Gunther Friedl Musterlösung Wintersemester 2007/2008 Klausur Kosten-
Reverse-Engineering (RE) (Produkt-Benchmarking)
 Schlichting Consulting Reverse-Engineering (RE) (Produkt-Benchmarking) Hermann Schlichting 01.05.2013 Reverse-Engineering wozu? Ohne exzellentes Wissen über den Feind und sich selbst ist kein Krieg zu
Schlichting Consulting Reverse-Engineering (RE) (Produkt-Benchmarking) Hermann Schlichting 01.05.2013 Reverse-Engineering wozu? Ohne exzellentes Wissen über den Feind und sich selbst ist kein Krieg zu
Einkauf als Bindeglied zwischen Lieferant, Logistik und Produktion
 Einkauf als Bindeglied zwischen Lieferant, Logistik und Produktion Wolfram Bernhardt Leiter Einkauf Produktionsmaterialien Europa, 3M Deutschland, Neuss 85 Der Referent Name Bernhardt Vorname Wolfram Jahrgang
Einkauf als Bindeglied zwischen Lieferant, Logistik und Produktion Wolfram Bernhardt Leiter Einkauf Produktionsmaterialien Europa, 3M Deutschland, Neuss 85 Der Referent Name Bernhardt Vorname Wolfram Jahrgang
Probeklausur Accounting 1 (BACC) Sommersemester 2015
 Probeklausur Accounting 1 (BACC) Sommersemester 2015 Wichtiger Hinweis: Diese Probeklausur entspricht zwar in Umfang und Schwierigkeitsgrad dem Niveau der Abschlussklausur für dieses Fach. Allerdings deckt
Probeklausur Accounting 1 (BACC) Sommersemester 2015 Wichtiger Hinweis: Diese Probeklausur entspricht zwar in Umfang und Schwierigkeitsgrad dem Niveau der Abschlussklausur für dieses Fach. Allerdings deckt
Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
 Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Wie finde ich ein neues Produkt?
 Kategorie Produktentwicklung Bild: Von mir entwickeltes Produkt Wie finde ich ein neues Produkt? Sie finden es nicht, wenn Sie im Tagesgeschäft versinken und dem keine Aufmerksamkeit schenken. Sie finden
Kategorie Produktentwicklung Bild: Von mir entwickeltes Produkt Wie finde ich ein neues Produkt? Sie finden es nicht, wenn Sie im Tagesgeschäft versinken und dem keine Aufmerksamkeit schenken. Sie finden
Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren
 K. Ehrlenspiel A. Kiewert U. Lindemann 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Kostengünstig Entwickeln und
K. Ehrlenspiel A. Kiewert U. Lindemann 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Kostengünstig Entwickeln und
Fallbeispiel. Fallbeispiel zur Vorlesung Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Fallbeispiel BICYCLECOMPANY AG - Aufgabe -
 Fallbeispiel Fallbeispiel zur Vorlesung Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Fallbeispiel BICYCLECOMPANY AG - Aufgabe - SS 2013 Prof. Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau
Fallbeispiel Fallbeispiel zur Vorlesung Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Fallbeispiel BICYCLECOMPANY AG - Aufgabe - SS 2013 Prof. Richard Kuttenreich Fakultät Maschinenbau
Wie man kostengünstig konstruiert und entwickelt und dabei Nutzen und Leistung steigert. Seminar in Ostfildern-Nellingen, An der Akademie 5
 TAE Technische Akademie Esslingen Ihr Partner für Weiterbildung seit 60 Jahren! Unterstützt durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
TAE Technische Akademie Esslingen Ihr Partner für Weiterbildung seit 60 Jahren! Unterstützt durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
Unternehmens-Audit (TS 005)
 Toolname Unternehmens-Audit (TS 005) Synonyme Unternehmens-Prüfung Toolart Frageliste; (20 S., doc-datei, 281 KB) Beschreibung Auf 20 Seiten werden Fragen zum Status und zur Entwicklung bereitgestellt,
Toolname Unternehmens-Audit (TS 005) Synonyme Unternehmens-Prüfung Toolart Frageliste; (20 S., doc-datei, 281 KB) Beschreibung Auf 20 Seiten werden Fragen zum Status und zur Entwicklung bereitgestellt,
Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
 Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren
 Klaus Ehrlenspiel Alfons Kiewert Udo Lindemann Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung 6., überarbeitete und korrigierte Auflage Mit 313 Abbildungen
Klaus Ehrlenspiel Alfons Kiewert Udo Lindemann Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung 6., überarbeitete und korrigierte Auflage Mit 313 Abbildungen
Gliederung zu Kapitel Erfolgsrechnung
 Gliederung zu Kapitel 6 6. Erfolgsrechnung 6.1 Aufgaben der Erfolgsrechnung 6.2 Verfahren der Periodenerfolgsrechnung 6.3 Voll- und Teilkosten in der Periodenerfolgsrechnung 6.4 Deckungsbeitragsrechnung
Gliederung zu Kapitel 6 6. Erfolgsrechnung 6.1 Aufgaben der Erfolgsrechnung 6.2 Verfahren der Periodenerfolgsrechnung 6.3 Voll- und Teilkosten in der Periodenerfolgsrechnung 6.4 Deckungsbeitragsrechnung
BWL I für Nebenfachstudenten Wintersemester 2009/2010 Übungsaufgaben internes und externes Rechnungswesen
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre - Controlling Prof. Dr. Gunther Friedl BWL I für Nebenfachstudenten Wintersemester 2009/2010
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre - Controlling Prof. Dr. Gunther Friedl BWL I für Nebenfachstudenten Wintersemester 2009/2010
Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren
 K. Ehrlenspiel A. Kiewert U. Lindemann Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung Vierte, bearbeitete Auflage Mit 314 Abbildungen Springer Kurzzeichen
K. Ehrlenspiel A. Kiewert U. Lindemann Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung Vierte, bearbeitete Auflage Mit 314 Abbildungen Springer Kurzzeichen
Betriebliches Rechnungswesen. Datenermittlung
 Betriebliches Rechnungswesen Datenermittlung Rechnungswesen der Unternehmung Rechnungswesen der Unternehmung Verkauf nach aussen Buchhaltung Finanzielles Rechnungswesen FIBU Finanzbuchhaltung Betriebliches
Betriebliches Rechnungswesen Datenermittlung Rechnungswesen der Unternehmung Rechnungswesen der Unternehmung Verkauf nach aussen Buchhaltung Finanzielles Rechnungswesen FIBU Finanzbuchhaltung Betriebliches
[ Unternehmen ] Dachthema Produkt. WAS uns wichtig ist. Lebe unsere Werte. Mach sie zu deiner inneren Stimme.
![[ Unternehmen ] Dachthema Produkt. WAS uns wichtig ist. Lebe unsere Werte. Mach sie zu deiner inneren Stimme. [ Unternehmen ] Dachthema Produkt. WAS uns wichtig ist. Lebe unsere Werte. Mach sie zu deiner inneren Stimme.](/thumbs/79/78905153.jpg) [ Unternehmen ] Dachthema Produkt WAS uns wichtig ist Lebe unsere Werte. Mach sie zu deiner inneren Stimme. UnserE UnternehmensWERTE Mit unseren Werten benennen wir die wesentlichen Rahmen für unsere Verhaltensregeln.
[ Unternehmen ] Dachthema Produkt WAS uns wichtig ist Lebe unsere Werte. Mach sie zu deiner inneren Stimme. UnserE UnternehmensWERTE Mit unseren Werten benennen wir die wesentlichen Rahmen für unsere Verhaltensregeln.
Das betriebliche Rechnungswesen und seine Teilgebiete 1. Die Betriebsabrechnung. Kostenartenrechnung
 VII INHALTSVERZEICHNIS Seite Das betriebliche Rechnungswesen und seine Teilgebiete 1 Die Betriebsabrechnung Kostenartenrechnung Wesen der Kosten Die Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten ' ' ' ' Die einzelnen
VII INHALTSVERZEICHNIS Seite Das betriebliche Rechnungswesen und seine Teilgebiete 1 Die Betriebsabrechnung Kostenartenrechnung Wesen der Kosten Die Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten ' ' ' ' Die einzelnen
12. Projektkosten und Projektcontrolling
 In diesem Kapitel lernen Sie......die wichtigsten Kosten in einem Projekt zu erfassen, einmalige und wiederkehrende Kosten zu unterscheiden, finanzielles Controlling durchzuführen sowie eine Nutzwertanalyse
In diesem Kapitel lernen Sie......die wichtigsten Kosten in einem Projekt zu erfassen, einmalige und wiederkehrende Kosten zu unterscheiden, finanzielles Controlling durchzuführen sowie eine Nutzwertanalyse
Wie führt eine Führungskraft?
 Wie führt eine Führungskraft? Überlegungen zur Rolle und zur Qualifikation von Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung Vortrag in der Reihe Wissenschaft trifft Wirtschaft Prof. Dr. rer. nat. Achim
Wie führt eine Führungskraft? Überlegungen zur Rolle und zur Qualifikation von Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung Vortrag in der Reihe Wissenschaft trifft Wirtschaft Prof. Dr. rer. nat. Achim
INVESTITIONS- RECHNUNG. Thomas Kutschera
 INVESTITIONS- RECHNUNG Thomas Kutschera 24.10.2016 10.10.2014 Kutschera - Investitionsrechnung 2 Mittel woher - wohin Finanzierung Mittelherkunft Von wo bekomme ich die Mittel Partner Bank Eigene Gewinne
INVESTITIONS- RECHNUNG Thomas Kutschera 24.10.2016 10.10.2014 Kutschera - Investitionsrechnung 2 Mittel woher - wohin Finanzierung Mittelherkunft Von wo bekomme ich die Mittel Partner Bank Eigene Gewinne
Anliegen und Normung des Qualitätsmanagements
 Anliegen und Normung des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie 2. Qualitätsmanagementsystem 3. Normenfamilie ISO 9000 4. Grundprinzipien des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie
Anliegen und Normung des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie 2. Qualitätsmanagementsystem 3. Normenfamilie ISO 9000 4. Grundprinzipien des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie
Kosten- und Leistungsrechnung
 Fachbeitrag Kosten- und Leistungsrechnung Quelle: ProFirma Das Magazin für den innovativen Mittelstand Jahresabonnement 64,00 /11 Ausgaben Inklusiv-Leistungen: Zugang zum stets aktuellen Artikelarchiv
Fachbeitrag Kosten- und Leistungsrechnung Quelle: ProFirma Das Magazin für den innovativen Mittelstand Jahresabonnement 64,00 /11 Ausgaben Inklusiv-Leistungen: Zugang zum stets aktuellen Artikelarchiv
Inhaltsverzeichnis. Vorwort Der Autor Abkürzungsverzeichnis. Einleitung 1
 Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Der Autor Abkürzungsverzeichnis V VII XV Einleitung 1 1 Die Kostenrechnung und ihre Steifung im betrieblichen Rechnungswesen 5 1.1 Aufgaben und Systeme
Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Der Autor Abkürzungsverzeichnis V VII XV Einleitung 1 1 Die Kostenrechnung und ihre Steifung im betrieblichen Rechnungswesen 5 1.1 Aufgaben und Systeme
Energieoptimierte Produktion
 Prof. Dr.-Ing. Bettina Keil Energieoptimierte Produktion Möglichkeiten der Produktionslogistik zur effizienten Nutzung der Ressourcen Die Produktionslogistik umfasst die komplexe - Planung - Steuerung
Prof. Dr.-Ing. Bettina Keil Energieoptimierte Produktion Möglichkeiten der Produktionslogistik zur effizienten Nutzung der Ressourcen Die Produktionslogistik umfasst die komplexe - Planung - Steuerung
Industrielle Betriebswirtschaftslehre. Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256
 Industrielle Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256 Seite 2 Vorlesung IBL I. Kontakt. Dr. Stefan Zanner Email: stefan.zanner@lrz.fh-muenchen.de
Industrielle Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256 Seite 2 Vorlesung IBL I. Kontakt. Dr. Stefan Zanner Email: stefan.zanner@lrz.fh-muenchen.de
FACHHOCHSCHULE PFORZHEIM
 FACHHOCHSCHULE PFORZHEIM Fachbereich: Betriebswirtschaftslehre (FB 6) Datum: 05.07.2005 Studiengang: Fach: Kosten- und Leistungsrechnung Studiensemester: 3 Prüfer: siehe unten Sommersemester 2005 Max.
FACHHOCHSCHULE PFORZHEIM Fachbereich: Betriebswirtschaftslehre (FB 6) Datum: 05.07.2005 Studiengang: Fach: Kosten- und Leistungsrechnung Studiensemester: 3 Prüfer: siehe unten Sommersemester 2005 Max.
DIN EN ISO Die acht Grundsätze.
 DIN EN ISO 9001 Die acht Grundsätze Kundenorientierung Führung Einbeziehung der Personen Prozessorientierter Ansatz Systemorientierter Managementansatz Ständige Verbesserung Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung
DIN EN ISO 9001 Die acht Grundsätze Kundenorientierung Führung Einbeziehung der Personen Prozessorientierter Ansatz Systemorientierter Managementansatz Ständige Verbesserung Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung
Vollständiger Produktionsprozess (Herstellung und Steuerung)
 - A6.1 - Vollständiger Produktionsprozess (Herstellung und Steuerung) A6 Personalbezogener Prozess Ein wesentlicher Anteil der Produktionsprozesse Verwaltungsprozesse einbezogen werden nach wie vor maßgeblich
- A6.1 - Vollständiger Produktionsprozess (Herstellung und Steuerung) A6 Personalbezogener Prozess Ein wesentlicher Anteil der Produktionsprozesse Verwaltungsprozesse einbezogen werden nach wie vor maßgeblich
Unternehmens Handbuch
 FlowVision GmbH Im Erlet 6 90518 Altdorf Tel. +49 (0 91 87) 92293-0 Fax +49 (0 91 87) 92293-29 E-Mail: norbert.gliedstein@flowvision-gmbh.de Einleitung Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind
FlowVision GmbH Im Erlet 6 90518 Altdorf Tel. +49 (0 91 87) 92293-0 Fax +49 (0 91 87) 92293-29 E-Mail: norbert.gliedstein@flowvision-gmbh.de Einleitung Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind
INNOVATIVE PRODUKTE UND MASCHINEN FÜR DAS ARBEITEN VON MORGEN
 INNOVATIVE PRODUKTE UND MASCHINEN FÜR DAS ARBEITEN VON MORGEN PRÄZISION AM WERK. LOHNFERTIGUNG. Auch für die Herstellung von Dreh- und Frästeilen aus Metall ist WKT MA TEC kompetenter Ansprechpartner flexibel
INNOVATIVE PRODUKTE UND MASCHINEN FÜR DAS ARBEITEN VON MORGEN PRÄZISION AM WERK. LOHNFERTIGUNG. Auch für die Herstellung von Dreh- und Frästeilen aus Metall ist WKT MA TEC kompetenter Ansprechpartner flexibel
5.8 Maschinenstundensatz in der Vollkostenrechnung
 5.8 Maschinenstundensatz in der Vollkostenrechnung 5.8.1 Gründe für das Einführen einer Maschinenstundensatzrechnung Durch die zunehmende Mechanisierung ergibt sich eine Zunahme der Kostenarten, die durch
5.8 Maschinenstundensatz in der Vollkostenrechnung 5.8.1 Gründe für das Einführen einer Maschinenstundensatzrechnung Durch die zunehmende Mechanisierung ergibt sich eine Zunahme der Kostenarten, die durch
Produktrahmen zur internen Steuerung
 Produktrahmen zur internen Steuerung Arbeitshilfe bzw. Empfehlungen für Produktbeschreibungen zur weiteren Untergliederung der verbindlichen statistischen Anforderungen als Basis für die Einrichtung der
Produktrahmen zur internen Steuerung Arbeitshilfe bzw. Empfehlungen für Produktbeschreibungen zur weiteren Untergliederung der verbindlichen statistischen Anforderungen als Basis für die Einrichtung der
F E R N U N I V E R S I T Ä T IN HAGEN
 1. Korrektur 2. Korrektur F E R N U N I V E R S I T Ä T IN HAGEN FAKULTÄT für WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT Matrikelnummer Name: Vorname: MODULKLAUSUR: MODUL 31102: Unternehmensführung Unternehmensführung TERMIN:
1. Korrektur 2. Korrektur F E R N U N I V E R S I T Ä T IN HAGEN FAKULTÄT für WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT Matrikelnummer Name: Vorname: MODULKLAUSUR: MODUL 31102: Unternehmensführung Unternehmensführung TERMIN:
Internes Rechnungswesen Tutorium
 Internes Rechnungswesen Tutorium Kontakt Annabelle Ritter annabelle.ritter@study.hs-duesseldorf.de Dienstag Mittwoch 14:30-16:00 08:30-10:00 R 4.E.001 R 3.3.036 Die Veranstaltungen in der KW 44 werden
Internes Rechnungswesen Tutorium Kontakt Annabelle Ritter annabelle.ritter@study.hs-duesseldorf.de Dienstag Mittwoch 14:30-16:00 08:30-10:00 R 4.E.001 R 3.3.036 Die Veranstaltungen in der KW 44 werden
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling 2007
 Lösungsansatz im Prüfungsfach Finanzen, Rechnungswesen, Controlling 2007 Aufgabe 1 Theoriefragen Finanzbuchhaltung Aufgabe 1a Erklären Sie den Unterschied zwischen transitorischen Aktiven und transitorischen
Lösungsansatz im Prüfungsfach Finanzen, Rechnungswesen, Controlling 2007 Aufgabe 1 Theoriefragen Finanzbuchhaltung Aufgabe 1a Erklären Sie den Unterschied zwischen transitorischen Aktiven und transitorischen
Lösung der Aufgaben aus dem Kurs Grundbegriffe und Systeme der KLR in der Modulabschlussklausur: Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung
 Lösung der Aufgaben aus dem Kurs Grundbegriffe und Systeme der KLR in der Modulabschlussklausur: Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung Klausurkolloquium zur Modulabschlussklausur WS 2014/2015
Lösung der Aufgaben aus dem Kurs Grundbegriffe und Systeme der KLR in der Modulabschlussklausur: Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung Klausurkolloquium zur Modulabschlussklausur WS 2014/2015
Prüfungsaufgabe Kostenrechnung. a) Tische Stühle Summe Umsatzerlöse
 Prüfungsaufgabe Kostenrechnung a) Tische Stühle Summe Umsatzerlöse 1.375.000 940.000 2.315.000 MEK 390.000 220.000 MGK 10,00% 39.000 22.000 FEK 260.000 240.000 FGK 150,00% 390.000 360.000 HKE/HKU 1.079.000
Prüfungsaufgabe Kostenrechnung a) Tische Stühle Summe Umsatzerlöse 1.375.000 940.000 2.315.000 MEK 390.000 220.000 MGK 10,00% 39.000 22.000 FEK 260.000 240.000 FGK 150,00% 390.000 360.000 HKE/HKU 1.079.000
BAB zu Aufgabe (in Fr ) Kostenstellenrechnung. Verwaltung. Fertigung. Einkauf/ Lager. Vertrieb Standkollektoren.
 46.01 BAB zu Aufgabe 46.01 (in Fr. 1000. ) Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung Kosten Einkauf/ Lager Fertigung Verwaltung und Vertrieb Standkollektoren Mobilkollektoren Einzelmaterial
46.01 BAB zu Aufgabe 46.01 (in Fr. 1000. ) Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung Kosten Einkauf/ Lager Fertigung Verwaltung und Vertrieb Standkollektoren Mobilkollektoren Einzelmaterial
Lösungen. Aufgabe Durchschnittskosten bei Outputeinheiten: Durchschnittskosten bei Outputeinheiten:
 Lösungen Aufgabe 1 1. Unter Fixkosten versteht man Kosten, die unabhängig von der Ausbringungsmenge sind. Beispiele: Gehalt des Geschäftsführers, Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen, Kosten für Wartungsverträge,
Lösungen Aufgabe 1 1. Unter Fixkosten versteht man Kosten, die unabhängig von der Ausbringungsmenge sind. Beispiele: Gehalt des Geschäftsführers, Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen, Kosten für Wartungsverträge,
Klausur ABWL 5 Internes Rechnungswesen WS 2004, 120 Minuten, 120 Punkte
 Klausur ABWL 5 Internes Rechnungswesen WS 2004, 120 Minuten, 120 Punkte Block A: Textaufgabe Bitte beantworten Sie sie Fragen auf dem jeweils freigelassen Platz in der Klausur und benutzen Sie kein eigenes
Klausur ABWL 5 Internes Rechnungswesen WS 2004, 120 Minuten, 120 Punkte Block A: Textaufgabe Bitte beantworten Sie sie Fragen auf dem jeweils freigelassen Platz in der Klausur und benutzen Sie kein eigenes
Die strategische Steuerung von Kleinunternehmen mit Profit Centern
 Die strategische Steuerung von Kleinunternehmen mit Profit Centern von Sabine Sinz Erstauflage Diplomica Verlag 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 95485 257 4 schnell und portofrei
Die strategische Steuerung von Kleinunternehmen mit Profit Centern von Sabine Sinz Erstauflage Diplomica Verlag 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 95485 257 4 schnell und portofrei
Informationsblatt Kooperation mit anderen Dienstleistern
 Informationsblatt Kooperation mit anderen Dienstleistern Stand: 07.02.2017 Jahrgangsstufen 11/12 Fach/Fächer SWR Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Kompetenzerwartungen
Informationsblatt Kooperation mit anderen Dienstleistern Stand: 07.02.2017 Jahrgangsstufen 11/12 Fach/Fächer SWR Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Kompetenzerwartungen
1. Aufgabenblatt: Einführung in die Kosten- und Erlösrechnung und Kalkulation
 1. Aufgabenblatt: Einführung in die Kosten- und Erlösrechnung und Kalkulation Aufgabe 1.1: Begriffsabgrenzung zwischen internem- und externem Rechnungswesen Nach weihnachtlicher Besinnung und fröhlicher
1. Aufgabenblatt: Einführung in die Kosten- und Erlösrechnung und Kalkulation Aufgabe 1.1: Begriffsabgrenzung zwischen internem- und externem Rechnungswesen Nach weihnachtlicher Besinnung und fröhlicher
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2013
 Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2013 Mitschrift der Vorlesung vom 24.04.2013 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München 1.2.
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2013 Mitschrift der Vorlesung vom 24.04.2013 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München 1.2.
Was versteht man unter Investitionen?
 Was versteht man unter Investitionen? Überführung von Zahlungsmitteln in Sach- oder Finanzvermögen Unter Investition versteht man den wirtschaftlichen Sachverhalt, dass Zahlungsmittel ausgegeben und damit
Was versteht man unter Investitionen? Überführung von Zahlungsmitteln in Sach- oder Finanzvermögen Unter Investition versteht man den wirtschaftlichen Sachverhalt, dass Zahlungsmittel ausgegeben und damit
Materialien zur Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Materialien zur Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Teil III: Rechnungs- und Finanzwesen Kostenrechnung Technische Studiengänge Dr. Horst Kunhenn Fachhochschule Münster, ITB Steinfurt Allgemeine
Materialien zur Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Teil III: Rechnungs- und Finanzwesen Kostenrechnung Technische Studiengänge Dr. Horst Kunhenn Fachhochschule Münster, ITB Steinfurt Allgemeine
Mehr Effizienz dank Online Marketing Audit. Whitepaper inkl. Best Practice Beispiel
 Mehr Effizienz dank Online Marketing Audit Whitepaper inkl. Best Practice Beispiel Das Online Marketing Audit Die geplanten Investitionen in das digitale Marketing sind weiterhin steigend, allerdings wird
Mehr Effizienz dank Online Marketing Audit Whitepaper inkl. Best Practice Beispiel Das Online Marketing Audit Die geplanten Investitionen in das digitale Marketing sind weiterhin steigend, allerdings wird
Vorlesungsskript Kosten- und Leistungsrechnung SS Frank Tekülve. Kosten- und Leistungsrechnung SS2017 Frank Tekülve
 Vorlesungsskript Kosten- und Leistungsrechnung SS 2017 Frank Tekülve 1 Inhalte Vorlesung 1 Aufgaben und Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens Definition / Aufgaben der KuL Eingliederung ins betriebliche
Vorlesungsskript Kosten- und Leistungsrechnung SS 2017 Frank Tekülve 1 Inhalte Vorlesung 1 Aufgaben und Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens Definition / Aufgaben der KuL Eingliederung ins betriebliche
Beispiel für ein Simulationsverfahren: Analyse eines Investitionsprojekts (2)
 3.1.4 Konzepte zur Berücksichtigung unsicherer Erwartungen Investitionsprojekts (2) 2. Festlegung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen w() für die einzelnen Einflussfaktoren A0 im Bereich w (A0) Von 200.000
3.1.4 Konzepte zur Berücksichtigung unsicherer Erwartungen Investitionsprojekts (2) 2. Festlegung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen w() für die einzelnen Einflussfaktoren A0 im Bereich w (A0) Von 200.000
Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren
 Klaus Ehrlenspiel Alfons Kiewert Udo Lindemann Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung 6., überarbeitete und korrigierte Auflage Mit 313 Abbildungen
Klaus Ehrlenspiel Alfons Kiewert Udo Lindemann Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung 6., überarbeitete und korrigierte Auflage Mit 313 Abbildungen
Kostenrechnung Kostenartenrechnung
 Methoden zur Entscheidungsfindung Grundlagen neue Systeme Funktionen Plankostenrechnung Produktionsprogrammplanung Kostenrechnung Kostenartenrechnung Gliederung von Kostenarten Erfassung von Kostenarten
Methoden zur Entscheidungsfindung Grundlagen neue Systeme Funktionen Plankostenrechnung Produktionsprogrammplanung Kostenrechnung Kostenartenrechnung Gliederung von Kostenarten Erfassung von Kostenarten
Erreichte Punkte
 Leibniz Universität Hannover Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Produktionswirtschaft Prof. Dr. Stefan Helber Klausur zur Vorlesung Betriebliches Rechnungswesen II Industrielle Kosten-
Leibniz Universität Hannover Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Produktionswirtschaft Prof. Dr. Stefan Helber Klausur zur Vorlesung Betriebliches Rechnungswesen II Industrielle Kosten-
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
 1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns mit Dank und guten Wünschen von Ihnen verabschieden, möchte ich an dieser Stelle ein Resümee zur heutigen Veranstaltung geben und die wesentlichen
1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns mit Dank und guten Wünschen von Ihnen verabschieden, möchte ich an dieser Stelle ein Resümee zur heutigen Veranstaltung geben und die wesentlichen
KoRe Kostenrechnung für KMU
 KoRe Kostenrechnung für KMU umfassend ganzheitliche, integrierte Sichtweise kompetent individuell ideales Führungs- und Controllinginstrument an Ihre Bedürfnisse angepasst Ziele der KoRe für KMU Das wirtschaftliche
KoRe Kostenrechnung für KMU umfassend ganzheitliche, integrierte Sichtweise kompetent individuell ideales Führungs- und Controllinginstrument an Ihre Bedürfnisse angepasst Ziele der KoRe für KMU Das wirtschaftliche
K L A U S U R. zur Bachelor-Prüfung SS Teilgebiet: Interne Unternehmensrechnung
 Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R zur Bachelor-Prüfung SS 2011 Teilgebiet: Interne Unternehmensrechnung Prof. Dr. Hansrudi Lenz
Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R zur Bachelor-Prüfung SS 2011 Teilgebiet: Interne Unternehmensrechnung Prof. Dr. Hansrudi Lenz
Übung Kostenrechnung SS 2015
 SS 2015 Übung 4 Kostenträgerrechnung Kalkulation und Kostenverrechnung bei Einzel- und Serienfertigung Ausgangspunkt der Zuschlagskalkulation Einzelkosten - direkt dem einzelnen Auftrag/ Kostenträger zurechenbar
SS 2015 Übung 4 Kostenträgerrechnung Kalkulation und Kostenverrechnung bei Einzel- und Serienfertigung Ausgangspunkt der Zuschlagskalkulation Einzelkosten - direkt dem einzelnen Auftrag/ Kostenträger zurechenbar
- Kontrolle der Wirtschaftlichkeit (Kostenkontrolle): Vergleich der gesamten Plankosten mit den Istkosten der Kostenstelle
 III.Kostenstellenrechnung 1. Grundlagen 1.1. Ziele und Aufgaben der Kostenstellenrechnung - Kontrolle der Wirtschaftlichkeit (Kostenkontrolle): Vergleich der gesamten Plankosten mit den Istkosten der Kostenstelle
III.Kostenstellenrechnung 1. Grundlagen 1.1. Ziele und Aufgaben der Kostenstellenrechnung - Kontrolle der Wirtschaftlichkeit (Kostenkontrolle): Vergleich der gesamten Plankosten mit den Istkosten der Kostenstelle
Dr. Jörg Tautrim Engineering
 Zuverlässigkeit und (Z&I) Programm Seite Zuverlässigkeit und (Z&I) Grundlagen 1. SB Zuverlässigkeit und (Z&I) Grundlagen 2. Vertraulichkeitsklausel 3. Inhaltsübersicht 4. Strukturierung der Schulung Z&I-Grundlagen
Zuverlässigkeit und (Z&I) Programm Seite Zuverlässigkeit und (Z&I) Grundlagen 1. SB Zuverlässigkeit und (Z&I) Grundlagen 2. Vertraulichkeitsklausel 3. Inhaltsübersicht 4. Strukturierung der Schulung Z&I-Grundlagen
DAA Wirtschafts-Lexikon
 DAA Wirtschafts-Lexikon 1. Inhalt, Aufgaben! Begriffsbestimmung Kostenträgerzeitrechnung Die Kostenträgerzeitrechnung ist ein Instrument zur Ermittlung und Verrechnung der in einer Abrechnungsperiode (z.
DAA Wirtschafts-Lexikon 1. Inhalt, Aufgaben! Begriffsbestimmung Kostenträgerzeitrechnung Die Kostenträgerzeitrechnung ist ein Instrument zur Ermittlung und Verrechnung der in einer Abrechnungsperiode (z.
Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum. Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010
 Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010 Strukturwandel in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten enormer Wandel: Auf
Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010 Strukturwandel in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten enormer Wandel: Auf
(Werte in Euro) Reparatur Material Fertigung Verwaltung Vertrieb Abschreibungen. sonstige primäre Kosten
 Aufgabe 1 (ca. 30 min.): Ein Produktions-Unternehmen hat seine Organisation in fünf Kostenstellen unterteilt: Reparaturstelle, Materialstelle, Fertigungsstelle, Verwaltungsstelle und Vertriebsstelle. Die
Aufgabe 1 (ca. 30 min.): Ein Produktions-Unternehmen hat seine Organisation in fünf Kostenstellen unterteilt: Reparaturstelle, Materialstelle, Fertigungsstelle, Verwaltungsstelle und Vertriebsstelle. Die
Kostenträgerrechnung
 Kapitel 4: 4.1 Teilgebiete der KLR Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung 4.2 Grundschema der Vollkostenrechnung Gesamtkosten in der Kostenartenrechnung Einzelkosten Gemeinkosten Kostenstellenrechnung
Kapitel 4: 4.1 Teilgebiete der KLR Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung 4.2 Grundschema der Vollkostenrechnung Gesamtkosten in der Kostenartenrechnung Einzelkosten Gemeinkosten Kostenstellenrechnung
Management Accounting Einführung die Kostenrechnung
 Management Accounting Einführung die Kostenrechnung Hochschule Weserbergland Hochschullehrer für Gesundheitsmanagement und Controlling Inhaltsüberblick 1. Einführung in die Kostenrechnung 2. Bausteine
Management Accounting Einführung die Kostenrechnung Hochschule Weserbergland Hochschullehrer für Gesundheitsmanagement und Controlling Inhaltsüberblick 1. Einführung in die Kostenrechnung 2. Bausteine
Industrie. iprovis.com
 Industrie das Konzept Visual Creations & Industrie 4.0 Produktentwicklung Vermarktung Nachhaltigkeit Visual Creations ist ein digitales Konzept zur simulierenden Darstellung und Optimierung interaktiver
Industrie das Konzept Visual Creations & Industrie 4.0 Produktentwicklung Vermarktung Nachhaltigkeit Visual Creations ist ein digitales Konzept zur simulierenden Darstellung und Optimierung interaktiver
Komplexe strategische Entscheidungen motivierend vermitteln
 Komplexe strategische Entscheidungen motivierend vermitteln Eine Firma erfolgreich zu führen ist eine sehr komplexe, herausfordernde und befriedigende Aufgabe, bei der Sie als Verantwortlicher permanent
Komplexe strategische Entscheidungen motivierend vermitteln Eine Firma erfolgreich zu führen ist eine sehr komplexe, herausfordernde und befriedigende Aufgabe, bei der Sie als Verantwortlicher permanent
Die 5-Schritte-Methode des Service Engineering im Überblick
 Die 5-Schritte-Methode des Service Engineering im Überblick 2 Moderne Dienstleistungs-Systeme systematisch zu entwickeln das ist die zentrale Forderung und Aufgabe des Service Engineering (Meyer und Böttcher
Die 5-Schritte-Methode des Service Engineering im Überblick 2 Moderne Dienstleistungs-Systeme systematisch zu entwickeln das ist die zentrale Forderung und Aufgabe des Service Engineering (Meyer und Böttcher
avamechbase für Teamcenter PLM für Unternehmen mit Herstellprozessen
 avamechbase für Teamcenter PLM für Unternehmen mit Herstellprozessen Verkürzt den Erstellungsprozess Sichert die Qualitätsanforderungen Senkt Kosten und führt zu mehr Umsatz Ihre Vorteile mit avamechbase
avamechbase für Teamcenter PLM für Unternehmen mit Herstellprozessen Verkürzt den Erstellungsprozess Sichert die Qualitätsanforderungen Senkt Kosten und führt zu mehr Umsatz Ihre Vorteile mit avamechbase
Fragen aus dem OnlineTED
 Fragen aus dem OnlineTED Wann führt die lineare Abschreibung dazu, dass im Zeitverlauf steigende Anteile des Restbuchwerts abgeschrieben werden? A Immer B Nie C Nur in der ersten Hälfte des Abschreibungszeitraums
Fragen aus dem OnlineTED Wann führt die lineare Abschreibung dazu, dass im Zeitverlauf steigende Anteile des Restbuchwerts abgeschrieben werden? A Immer B Nie C Nur in der ersten Hälfte des Abschreibungszeitraums
Information, Kommunikation & Planung. EFQM Modell
 1 EFQM Modell Das EFQM-Modell ist ein Qualitätsmanagement-System des Total-Quality-Management. Es wurde 1988 von der European Foundation for Quality Management (EFQM) entwickelt. EFQM ISO 9001 Prüfung
1 EFQM Modell Das EFQM-Modell ist ein Qualitätsmanagement-System des Total-Quality-Management. Es wurde 1988 von der European Foundation for Quality Management (EFQM) entwickelt. EFQM ISO 9001 Prüfung
