wurf' Keynes gegenüber, der sich durch das ganze Werk Krügers zieht, lautet, daß Keynes nicht die produktionstheoretischen
|
|
|
- Rüdiger Schäfer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 KEYNES, MARX UND DIE ZUKUNFT DES KAPITALISMUS Rezension von: Stephan Krüger u. a.; Keynes contra Marx? Darstellung und Kritik der "General Theory", VSA Verlag, Hamburg 1984,340 Seiten, DM 48,- und Karl Georg Zinn; Arbeit, Konsum, Akkumulation, Versuch einer integralen Kapitalismusanalyse von Keynes und Marx, 244 Seiten, DM 29,80,-. Wer sich schon öfter Gedanken über etwaige Parallelen im Werk von Keynes und von Marx gemacht hat und diesen Ahnungen auf den Grund gehen möchte, dem seien diese beiden Studien empfohlen. Der Unterschied zwischen den beiden Büchern liegt in der Schwerpunktsetzung und im Analysegegenstand, in der Ableitung wirtschaftspolitischer Konsequenzen oder in der Darstellung der längerfristigen Perspektive unseres Wirtschaftssystems kommen die Autoren zu beinahe denselben Ergebnissen. Das Buch von Krüger u. a. ist im Rahmen eines Forschungsprojektes über die "General Theory" (GT) von Keynes entstanden. Es erscheint gerade richtig zum 50jährigen Jubiläum dieses revolutionären Werkes. Die große Gemeinsamkeit zwischen Keynes und Marx sieht Krüger darin, daß beide die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht auf die Ergebnisse der Handlungen der Individuen reduzieren. Das Ergebnis ist abhängig vom Zusammenwirken dieser Handlungen und hat eine andere Dimension. Die Wirtschaftenden erzeugen durch ihr Verhalten die Krise, ohne es zu wollen, Marx spricht von den Gesetzmäßigkeiten des Systems. Der zentrale "Vor- wurf' Keynes gegenüber, der sich durch das ganze Werk Krügers zieht, lautet, daß Keynes nicht die produktionstheoretischen Ursachen und Widersprüche als Krisenursachen erkennt, sondern an der Oberfläche des schon entwickelten Kapitalismus bleibt. Dabei wird nicht ganz klar, in welchem Sinn dieses Versäumnis von Keynes gemeint ist. Krüger spricht an mehreren Stellen davon, daß Keynes die Produktion und ihre Widersprüche als Krisenursache "nicht gesehen hat". Da man aber weiß, daß er das Marxsche Werk sehr wohl gekannt hat, teilweise radikal abgelehnt hat und selbst einen nicht marxistischen Sozialismus bevorzugt hat, stellt sich die Frage, inwieweit das "Nichts ehen" nicht einfach darauf zurückzuführen ist, daß er mit seinen Rezepten gar nicht dort ansetzen wollte. Krüger stellt die Keynessche Theorie umfassend und sehr genau dar. Er beginnt mit der Betonung der Geldwirtschaft, die Keynes beschreiben wollte. Die zentralen Aussagen dazu finden sich in den Kapiteln 17 und 18 der "General Theory", die sich mit den "wesentlichen Eigenschaften von Zins und Geld" beschäftigt. Daran knüpfen auch Postkeynesianer wie Minsky und Davidson an. Daß das auch wirklich der Zugang zum Verständnis des Keynesschen Werkes sein könnte, wird aus der von Keynes selbst öfters geäußerten Intention deutlich, es gehe ihm darum, "a monetary theory of production" aufzustellen. Keynes sieht Geld als knappen Vermögensbestand an, dessen Aufgabe (in Form von Kredit bzw. Verzicht auf Liquidität) mit der Zahlung einer Rente, nämlich des Zinses, belohnt wird. Geld ist somit ein Rentenfaktor, ebenso wie knapper Boden. Es kann nämlich nicht beliebig erzeugt werden und behält obendrein immer seinen Wert als allgemeines Tauschmittel. Die "Produktion" von Geld ist für die Unternehmer nur möglich über den Umweg der Produktion von Waren. Die marxi- 148
2 stische Kritik, die Krüger daran anbringt, lautet, daß hier wiederum die Produktion übersehen wird: Die Zahlung eines Geldzinses ist nur möglich, weil in der Produktion Mehrwert und Profit entstehen. Da aber entwickelte Geldwirtschaft und kapitalistische Produktionsweise einander bedingen und das eine ohne das andere nicht denkbar ist, ist es müßig, diesen Disput fortzusetzen. Für Krüger bleibt das aber ein zentrales Anliegen seines Buches. Dennoch ist er bemüht, die Konsequenzen der Keynesschen Geldwirtschaftstheorie für die Produktion von Profit herauszuarbeiten und betont damit die gleichen Aspekte wie die Postkeynesianer Davidson und Minsky. Das Knapphalten des Geldes führt demnach zum Knapphalten von physischem Kapital, sodaß ein Profit produziert werden kann. Es stehen einander somit eine knappheitstheoretische Erklärung der Profitproduktion bei Keynes und die Mehrwerttheorie von Marx gegenüber. Die knappheitstheoretische Erklärung beruht aber auf der Geldvermögenstheorie und ließe sich auf die Frage nach der Vermögensverteilung zurückführen. Ob der Unterschied daher so bedeutend ist, wie Krüger ihn darstellt, wäre eine weitere Frage. Höchst aufschlußreich ist es weiters, die Aussagen von Keynes zur Produktionssphäre und zur Werttheorie zu analysieren, was Krüger ausführlich tut. Dieser Bereich wird in der Keynes-Exegese meist übergangen, weil es als nicht so bedeutend eingestuft wird. Tatsächlich findet sich in der GT folgende Aussage (Krüger, S. 58): "Ich neige daher zu der vorklassischen Lehre, daß alles durch Arbeit erzeugt wird; unterstützt durch das, was man früher Kunst zu nennen pflegte, und jetzt Technik genannt wird; sowie durch natürliche Hilfsmittel, die frei sind oder je nach ihrer Knappheit oder ihrem Überfluß eine Rente kosten, und durch die Ergebnisse vergangener, in den Vermögenswerten verkörperter Arbeit, die ebenfalls gemäß ihrer Knappheit oder ihrem Überfluß einen Preis bedingen." Keynes Darstellung der Messung der Produktion in Arbeitseinheiten zeigt deutliche Parallelen zur Arbeitswerttheorie, während andere Passagen seines Werkes eher knappheitstheoretische oder maginalistische Aussagen über die Wertbestimmung enthalten. Er wird von Krüger somit einmal mehr als der "Übergangsökonom" präsentiert, der zwar wesentliche Neuerungen bringt, aber dennoch selbst noch im marginalistischen Denken der von ihm als Klassiker bezeichneten Marshall-Schule befangen ist. Nach einer ausführlichen Analyse von Keynesscher und Marxscher Produktionstheorie und ihren Aggregationsproblemen geht es in Krügers Buch um die bei den großen Nachfragegrößen bei Keynes, nämlich Konsum und Investition und deren Erklärung. Es geht um die psychologische begründete Konsumfunktion und die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, die nach Krüger genau den Standpunkt der Interessenlage des Investors darstellt. Krüger stimmt in der Analyse der Investitionstheorie im wesentlichen wieder mit den Postkeynesianern Davidson und Minsky überein. Er betont ebenso die Rolle der Erwartungen bei unsicheren Entscheidungen und die Erklärung des Aufschlages auf den Zinssatz durch Schuldner- und Gläubigerrisiko. Aus alldem resultiert auch Keynes Skepsis der Funktionsfähigkeit von Börsen gegenüber. Die großen Parallelen zwischen Keynes und Marx sieht Krüger in der Analyse der langfristigen Entwicklung des Kapitalismus. Die Keynessche Darstellung des reichen Gemeinwesens, in dem Kapital nicht mehr knapp ist und daher weniger rentabel, während gleichzeitig eine hohe Ersparnis anfällt, stimmt im Ergebnis mit der Marxschen These der strukturellen Überakkumulation überein, so Krüger. Die 149
3 Darstellung in diesen Punkten ist sehr überzeugend und wird in der Keynes- Diskussion im allgemeinen kaum diskutiert. Es ist jedoch von daher eine plausible Annahme, daß die Keynesschen Rezepte für reiche Volkswirtschaften anders aussehen als das traditionelle Instrumentarium des Keynesianismus. Folgende Zitate, das erste von Keynes, das zweite von Marx, unterstreichen obendrein die Verachtung bei der für die im Krisenzusammenhang entscheidende Klasse der Geldvermögensbesitzer und ihre "Erwerbstätigkeit" in Form von Spekulation (Krüger S. 271): "Wenn die Kapitalentwicklung eines Landes das Nebenerzeugnis der Tätigkeiten eines Spielsaales wird, wird die Arbeit voraussichtlich schlecht getan werden." "Die Finanzaristokratie, in ihrer Erwerbsweise wie in ihren Genüssen, ist nichts als die Wiedergeburt des Lumpenproletariats auf den Höhen der bürgerlichen Gesellschaft." Man kann sich somit ausmalen, wie die Krisentheoretiker Keynes und Marx auf die in den letzten Jahren gestiegene Geldvermögensbildung und das Neuerwachen der Wiener Börse reagieren würden. In einem letzten Abschnitt werden aus der umfangreichen und anschaulichen Analyse auch wirtschaftspolitische Konsequenzen gezogen, die helfen sollen, mit der zweiten Weltwirtschaftskrise der reichen Volkswirtschaften fertig zu werden. Daß die vorgeschlagenen Maßnahmen an der Situation der BRD orientiert sind, tut einer prinzipiellen Anwendbarkeit auch in anderen Industriestaaten keinen Abbruch. Im einzelnen werden gefordert: Arbeitszeitverkürzung, Mindestsicherung in Tarif- und Sozialpolitik (Sokkelbeträge), Vergesellschaftung der Investitionsgüterindustrien und Zinsertragsteuer. Wünschenswert erscheint den Autoren eine internationale Koordination in der Wirtschaftspoli- tik. Eine denkwürdige Passage über die Zukunft der Gewerkschaften beschließt das Buch (Krüger, S. 320): "Die Gewerkschaften sind daher gezwungen, wollen sie ihre Funktion als Organisation der Arbeiterklasse nicht verlieren, einen neuen Konsens unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen herzustellen." Das Buch von Zinn ist von vornherein eher wirtschaftspolitisch orientiert. Es geht um das Beschäftigungsproblem und die Frage der Bewältigung der derzeitigen Krise. Ausgangspunkte sind die Keynessche Konsumfunktion und die mikroökonomische Haushaltstheorie. Die Hauptpostulate der Theorie der Markträumung, nämlich das Saysche Theorien und der klassischen Zinsmeehanismus, werden untersucht und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen herausgefiltert. Sodann erfolgt eine Analyse dieses Bereiches in einer keynesianisch-marxistischen Perspektive, wobei das Problem der sich öffnenden Schere zwischen steigender Ersparnis und eben deswegen sinkender induzierter Investition herausgearbeitet wird. Das ist für Zinn jedoch zunächst erst der Rahmen der weiteren Untersuchung. Er begibt sich danach auf eine Forschungsreise ins Gebiet der Mikroökonomie, bei der man manchmal den Eindruck hat, daß einige Umwege in Kauf genommen werden. Es entsteht der Eindruck, daß Zinn durch Einbau dieses Teiles auch Neoklassiker von seiner These überzeugen will und sich daher in ihren Denkkategorien bewegt. Eine zentrale These von Zinn ist die Parallele zwischen dem 1. Gossensehern Gesetz des sinkenden Grenznutzens und der Keynesschen Konsumfunktion. Mit steigendem Einkommen wird somit mehr gespart und weniger konsumiert. Ein steigender Teil des Arbeitseinkommens wird daher der Geldvermögensbildung zugeführt, erst auf einem höheren Einkom- 150
4 mensniveau wird das Arbeitsangebot wieder reduziert. Zinn faßt diese Mechanismen in der Gossen-Keynesschen Regel zusammen (Zinn S. 81): "Der historische Prozeß, der ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen bewirkt, führt nicht nur zu einer relativen Konsumsättigung gemäß dem Gossenschen Sättigungs gesetz, sondern steigert die Geldvermögensbildung; hierin kommt Keynes psychologisches Grundgesetz zum Ausdruck." Diese Regel besagt, daß es in einem Prozeß permanenten Einkommenswachstums bei gegebenen Verteilungsverhältnissen zu einer Konsumsättigung kommt. Diese Stagnationstendenz sieht Zinn sowohl bei Gossen als auch vor allem bei Keynes angelegt. Er verweist auf einen Aufsatz von Keynes aus dem Jahr 1943 mit dem Titel: "The long-term problem of full employment". Darin stellt Keynes die wahrscheinliche Entwicklung nach dem Krieg in einem Drei-Phasen- Schema dar: Nachdem die Investition zunächst die Ersparnis übersteigen wird, wird es zunehmend zur Investitionssättigung kommen. In der dritten Phase schließlich übersteigt die Ersparnis die Investition:... "die Investitionsnachfrage ist soweit gesättigt, daß sie nicht auf das durch die (Vollbeschäftigungs- )Ersparnis angezeigte Niveau gebracht werden kann, außer durch verlustreiche und überflüssige Unternehmungen". (Zinn, S.84) Soweit Keynes Beitrag aus dem Jahre 1943 zur heutigen internationalen Stahlkrise. Die Empfehlungen von Keynes für diese dritte Phase lauten: Entmutigung von Ersparnisbildung, mehr Muße, längere Ferien und kürzere Arbeitszeit. Zinn beschäftigt sich aber noch weiter mit der Sättigungsthese auf mikroökonomischer Ebene, wobei er versucht, die Gegenargumente aufzulisten (Präferenzen für höheres Einkommen, Produktinnovation). Im Endergebnis dieses mikroökonomischen Blocks, der beinahe ein Drittel des ganzen Buches ausmacht, geht es ihm um die Darstellung einer historisch-dynamisierten Haushaltstheorie. Damit wird auch das Problem der Innovation behandelbar, die der Sättigung entgegenwirken könnte: Prozeßinnovationen (Automatisierung) erhöhen das reale Einkommensniveau, ohne daß der Konsum steigen muß und verschärfen daher wahrscheinlich das Problem. Lediglich neue Produkte, neue Konsumgüter könnten der Sättigung entgegenwirken. Jedoch nur, wenn nicht zugleich eine Prozeßinnovation den Reallohn erhöht und alte Produkte substituiert werden, sonst ergibt sich wieder das Problem von steigendem Realeinkommen bei gleich bleibendem Konsum. Das Ankämpfen gegen die Sättigung werde jedoch immer schwieriger und unternehmerisch riskanter, so Zinn. Der Hauptteil des Buches ist den Investitionen und dem Akkumulationsprozeß gewidmet. Dabei unterscheidet Zinn zunächst verschiedene Investitionstypen. Die Frage, ob autonome Investitionen die aufgrund relativ sinkenden Konsums zurückgehenden induzierten Investitionen ersetzen werden, wird von Zinn abermals verneint. Gewissen administrativ erzwungenen Investitionen (Umweltschutz) räumt er größere Bedeutung ein, vor allem auch am Ende des Buches. Die Akkumulation ist aber vor allem deswegen für Zinn die entscheidende Nachfragegröße, weil nur sie die Krise überhaupt potentiell verhindern könnte. Denn wenn bei der Produktion positiver Mehrwert, also Gewinn anfallen soll, dann können die Konsumausgaben, selbst wenn alles verdiente Geld ausgegeben wird, gar nie ausreichen, um das Produkt zu kaufen und Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Das bedeutet umgekehrt, daß die Kapitalisten selbst ihr Schicksal meistern. Bei Kalecki führt das zu dem Ausspruch: "Die Kapitalisten verdienen was sie ausgeben, die Arbeiter 151
5 geben aus, was sie verdienen", bei Keynes zum Gleichnis vom "Krug der Witwe": ausgegebene Unternehmerprofite führen zu steigenden Unternehmerprofiten, die Klasse der Unternehmer gewinnt immer, wenn sie mehr ausgibt. Wenn aber die Arbeiter gar nicht alles ausgeben, sondern bei steigenden Reallohn immer mehr sparen, führt das zu einer Zuspitzung der Krisentendenzen. Im Produktionsbereich wirkt obendrein die Smith-Srajja-Young-RegeL Es wird bei steigenden Skalenerträgen produziert, die Produktivitätssteigerung und Erschließung neuer Märkte erhöhen somit das in der Produktion entstehende Einkommen überproportional. Das führt weiters zu Kapitalkonzentration und - ein empirischer Teil in Zinns Buch zeigt das ebenfalls - zu zunehmender Rationalisierung. Die Krise scheint somit durch das Zusammenwirken der Gossen-Keynesschen-Rege~ und der Smith-Srajja- Young-Rege~ vorprogrammiert. Die langfristige Tendenz führt eben dazu, daß Kapital wenig knapp wird und die Profitrate fällt, was aber nicht heißen muß - und das gelingt Zinn sehr schön zu zeigen -, daß die Rentabilität (in Geldeinheiten gemessen) sinken muß. All diese Tendenzen führen aber nicht dazu, wie Keynes 1930 optimistisch in "The Economic Pos sibilities for our Grandchildren" meinte, daß die Menschheit das ökonomische Problem gelöst hat, sondern zur Krise. Die Wirtschaftspolitik hätte daher gegenzusteuern durch: Investitionslenkung, sozialstaatliche Absicherung und Ausbau des Sozialsystems statt Abbau sowie administrative Verordnung von Umweltinvestitionen mit strengen.standards. Dringend notwendig wären aber auch internationale Absprachen zur Koordination der Wirtschaftspolitik und zur Erleichterung des Schuldendienstes der Entwicklungsländer. Implizit ist das Buch von Zinn natürlich ein starkes Plädoyer für eine rasche Arbeitszeitverkürzung. Kurt Kratena 152
Theoriegeschichte 2. Neoklassik und Keynesianische Ökonomie
 Theoriegeschichte 2 Neoklassik und Keynesianische Ökonomie Neoklassik Marginalistische Revolution Subjektive Wertlehre Gleichgewichtstheorie Say sches Gesetz Unterschiede zur Klassik Konsequenzen für Wirtschaftspolitik
Theoriegeschichte 2 Neoklassik und Keynesianische Ökonomie Neoklassik Marginalistische Revolution Subjektive Wertlehre Gleichgewichtstheorie Say sches Gesetz Unterschiede zur Klassik Konsequenzen für Wirtschaftspolitik
Theoriegeschichte 2. Neoklassik, Keynes und neuere Entwicklungen
 Theoriegeschichte 2 Neoklassik, Keynes und neuere Entwicklungen Übersicht Neoklassik Keynesianische Ökonomie Neue Entwicklungen: Neoliberalismus und Monetarismus Globalisierungsdebatte Feministische Ökonomie
Theoriegeschichte 2 Neoklassik, Keynes und neuere Entwicklungen Übersicht Neoklassik Keynesianische Ökonomie Neue Entwicklungen: Neoliberalismus und Monetarismus Globalisierungsdebatte Feministische Ökonomie
Geschichte der Makroökonomie. (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest
 Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Dogmen 8 - Keynesianismus: Krisen, Geld und Staat
 Dogmen 8 - Keynesianismus: Krisen, Geld und Staat John Maynard Keynes (1883-1946) General Theory of Employment, Interest and Money (1936) Keynes zweifelt an der Selbstregulierungsfähigkeit der Wirtschaft
Dogmen 8 - Keynesianismus: Krisen, Geld und Staat John Maynard Keynes (1883-1946) General Theory of Employment, Interest and Money (1936) Keynes zweifelt an der Selbstregulierungsfähigkeit der Wirtschaft
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen
 Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
MASCH Stuttgart Kritik der Politischen Ökonomie
 MASCH Stuttgart Kritik der Politischen Ökonomie Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital (MEW 6, S. 397 423) Karl Marx, Lohn, Preis und Profit (MEW 16, S. 101-152) Entstehung: 1847/49 Lohnarbeit und Kapital:
MASCH Stuttgart Kritik der Politischen Ökonomie Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital (MEW 6, S. 397 423) Karl Marx, Lohn, Preis und Profit (MEW 16, S. 101-152) Entstehung: 1847/49 Lohnarbeit und Kapital:
MakroÖkonomik und neue MakroÖkonomik
 Bernhard Felderer Stefan Homburg MakroÖkonomik und neue MakroÖkonomik Siebte, verbesserte Auflage 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated
Bernhard Felderer Stefan Homburg MakroÖkonomik und neue MakroÖkonomik Siebte, verbesserte Auflage 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated
Übung zur Einführung in die VWL, Makroökonomie (zweiter Teil)
 Makroökonomie Übung Teil 2, WS 2007/2008, Thomas Domeratzki Seite 1 Übung zur Einführung in die VWL, Makroökonomie (zweiter Teil) Thomas Domeratzki 17. Dezember 2007 Makroökonomie Übung Teil 2, WS 2007/2008,
Makroökonomie Übung Teil 2, WS 2007/2008, Thomas Domeratzki Seite 1 Übung zur Einführung in die VWL, Makroökonomie (zweiter Teil) Thomas Domeratzki 17. Dezember 2007 Makroökonomie Übung Teil 2, WS 2007/2008,
Makroökonomie 1 Skript: Teil 7
 Makroökonomie 1 Skript: Teil 7 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Skript 7 / 1 Übersicht IV. Mikrofundierung der Makroökonomie 1. Konsum, Entscheidungsverhalten der Haushalte und
Makroökonomie 1 Skript: Teil 7 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Skript 7 / 1 Übersicht IV. Mikrofundierung der Makroökonomie 1. Konsum, Entscheidungsverhalten der Haushalte und
Karl Marx ( )
 Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Fragenkatalog Makroökonomie für Fortgeschrittene / Konjunktur und Wachstum
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre II (Mikroökonomie) Univ.-Prof. Dr. Fritz Helmedag Wintersemester 2014/2015 Fragenkatalog Makroökonomie für Fortgeschrittene / Konjunktur
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre II (Mikroökonomie) Univ.-Prof. Dr. Fritz Helmedag Wintersemester 2014/2015 Fragenkatalog Makroökonomie für Fortgeschrittene / Konjunktur
AS-Kurve - Spezialfälle
 Die Angebotskurve Spezialfälle 1 - Bisher: -Kurve mit positiver Steigung. Spezialfälle: Langfristige -Kurve Kurzfristige -Kurve 2 1 Langfristige -Kurve Annahmen Löhne und reise sind flexibel. Vollbeschäftigungsoutput
Die Angebotskurve Spezialfälle 1 - Bisher: -Kurve mit positiver Steigung. Spezialfälle: Langfristige -Kurve Kurzfristige -Kurve 2 1 Langfristige -Kurve Annahmen Löhne und reise sind flexibel. Vollbeschäftigungsoutput
Wichtige ökonomische Zusammenhänge und Grundgedanken
 7 Wichtige ökonomische Zusammenhänge und Grundgedanken In diesem ersten Kapitel geht es um grundsätzliche Ziele, Arbeitsweisen und Einsichten der Ökonomik. Wen meinen Ökonomen, wenn sie von Haushalten
7 Wichtige ökonomische Zusammenhänge und Grundgedanken In diesem ersten Kapitel geht es um grundsätzliche Ziele, Arbeitsweisen und Einsichten der Ökonomik. Wen meinen Ökonomen, wenn sie von Haushalten
4. Auflage. Kapitel V: Konjunktur
 Eine Einführung in die Theorie der Güter-, Arbeits- und Finanzmärkte Mohr Siebeck c Kapitel V: Konjunktur Inhaltsverzeichnis Das BIP wächst seit vielen Jahrzehnten mit einer durchschnittlichen jährlichen
Eine Einführung in die Theorie der Güter-, Arbeits- und Finanzmärkte Mohr Siebeck c Kapitel V: Konjunktur Inhaltsverzeichnis Das BIP wächst seit vielen Jahrzehnten mit einer durchschnittlichen jährlichen
Übungsaufgaben Makroökonomik
 Abteilung für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik Übungsaufgaben Makroökonomik Besprechung: 14.08.2008 bzw. 02.09.2008 Bitte bringen Sie einen Taschenrechner und das Vorlesungsskript mit!
Abteilung für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik Übungsaufgaben Makroökonomik Besprechung: 14.08.2008 bzw. 02.09.2008 Bitte bringen Sie einen Taschenrechner und das Vorlesungsskript mit!
11. Übung Makroökonomischen Theorie
 11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
VWL A Grundlagen. Kapitel 1. Grundlagen
 Kapitel 1 Einleitung Dieses Kapitel führt in die der VWL ein. Dabei wir die Ökonomik als die Wissenschaft vom Umgang mit knappen Ressourcen (Knappheitsproblematik) vorgestellt. Des Weiteren werden die
Kapitel 1 Einleitung Dieses Kapitel führt in die der VWL ein. Dabei wir die Ökonomik als die Wissenschaft vom Umgang mit knappen Ressourcen (Knappheitsproblematik) vorgestellt. Des Weiteren werden die
Teilprüfung Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Teilprüfung Einführung in die VWL im WS 2012/13 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Teilprüfung Einführung in die VWL im WS 2012/13 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu
Wirtschaft. Stephanie Schoenwetter. Das IS-LM-Modell. Annahmen, Funktionsweise und Kritik. Studienarbeit
 Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2016 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2016 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2016/17 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2016/17 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Instabilität und Kapitalismus
 Instabilität und Kapitalismus minima oeconomica herausgegeben von Joseph Vogl Hyman P. Minsky Instabilität und Kapitalismus Herausgegeben und mit einer Vorbemerkung von Joseph Vogl Aus dem Englischen von
Instabilität und Kapitalismus minima oeconomica herausgegeben von Joseph Vogl Hyman P. Minsky Instabilität und Kapitalismus Herausgegeben und mit einer Vorbemerkung von Joseph Vogl Aus dem Englischen von
Überblick über die Vorlesung
 Überblick über die Vorlesung Prof. Dr. Kai Carstensen LMU und Ifo Institut Inhalt der Vorlesung Empirie es gibt Konjunkturzyklen Produktionskapazitäten sind nicht immer gleich ausgelastet Beschäftigung
Überblick über die Vorlesung Prof. Dr. Kai Carstensen LMU und Ifo Institut Inhalt der Vorlesung Empirie es gibt Konjunkturzyklen Produktionskapazitäten sind nicht immer gleich ausgelastet Beschäftigung
Prof. Dr. Frank Beckenbach EINFÜHRUNG IN DIE ÖKONOMIK Konzepte
 Buchgliederung Erstes Buch: Der Produktionsprozess des Kapitals Vorwort zur ersten Auflage Erster Abschnitt: Ware und Geld 1. Kapitel: Die Ware 2. Kapitel: Der Austauschprozeß 3. Kapitel: Das Geld oder
Buchgliederung Erstes Buch: Der Produktionsprozess des Kapitals Vorwort zur ersten Auflage Erster Abschnitt: Ware und Geld 1. Kapitel: Die Ware 2. Kapitel: Der Austauschprozeß 3. Kapitel: Das Geld oder
S. 1 Thema: Kurzüberblick über Konjunkturtheorien
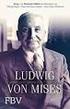 S. 1 Thema: Kurzüberblick über Konjunkturtheorien 5 10 15 Es gibt eine Vielfalt von Theorien in den Wirtschaftswissenschaften, welche die Ursachen und Auswirkungen von Konjunkturschwankungen zu bestimmen
S. 1 Thema: Kurzüberblick über Konjunkturtheorien 5 10 15 Es gibt eine Vielfalt von Theorien in den Wirtschaftswissenschaften, welche die Ursachen und Auswirkungen von Konjunkturschwankungen zu bestimmen
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2014/15 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2014/15 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie
 Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Volkswirtschaftslehre
 Volkswirtschaftslehre Zusammenfassung Mehrwerttheorie - er will die Ausbeutung nachweisen, indem er den Wert einer Ware durch das Quantum der gesellschaftlich notwendigen Gesamtarbeitszeit zu definieren
Volkswirtschaftslehre Zusammenfassung Mehrwerttheorie - er will die Ausbeutung nachweisen, indem er den Wert einer Ware durch das Quantum der gesellschaftlich notwendigen Gesamtarbeitszeit zu definieren
LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 4
 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 4 Aufgabe 1: IS-Kurve Leiten Sie graphisch mit Hilfe
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 4 Aufgabe 1: IS-Kurve Leiten Sie graphisch mit Hilfe
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2015 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2015 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Investitionen. Investitionen. Ausrüstungsinvestitionen. Bauinvestitionen. Sonstige Anlagen. Vorratsinvestitionen
 Investitionen 1 Investitionen Ausrüstungsinvestitionen Maschinen etc. zur Erstellung von Produktionsleistungen. Bauinvestitionen Neubauten Sonstige Anlagen Nutzvieh, Nutzpflanzen, Software Vorratsinvestitionen
Investitionen 1 Investitionen Ausrüstungsinvestitionen Maschinen etc. zur Erstellung von Produktionsleistungen. Bauinvestitionen Neubauten Sonstige Anlagen Nutzvieh, Nutzpflanzen, Software Vorratsinvestitionen
Kreditfinanzierung und Akkumulation. Teil 3: Nachfragekomponenten und ihre Probleme in Europa
 Kreditfinanzierung und Akkumulation Teil 3: Nachfragekomponenten und ihre Probleme in Europa Das BIP und seine Verwendung Das BIP Y zzgl. der Importe kann durch vier Nachfragekomponenten verwendet werden
Kreditfinanzierung und Akkumulation Teil 3: Nachfragekomponenten und ihre Probleme in Europa Das BIP und seine Verwendung Das BIP Y zzgl. der Importe kann durch vier Nachfragekomponenten verwendet werden
Mikroökonomie 1. Einführung
 Mikroökonomie 1 Einführung 17.09.08 1 Plan der heutigen Vorlesung Was ist die Mikroökonomie Ablauf und Organisation der Lehrveranstaltung Was ist ein ökonomisches Modell? Das Marktmodell als zentrales
Mikroökonomie 1 Einführung 17.09.08 1 Plan der heutigen Vorlesung Was ist die Mikroökonomie Ablauf und Organisation der Lehrveranstaltung Was ist ein ökonomisches Modell? Das Marktmodell als zentrales
Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R
 Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R Bachelor-Modulprüfung 2010/I Einführung in die Volkswirtschaftslehre Prof. Dr. Peter Bofinger
Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R Bachelor-Modulprüfung 2010/I Einführung in die Volkswirtschaftslehre Prof. Dr. Peter Bofinger
Rezepte gegen Arbeitslosigkeit
 Rezepte gegen Arbeitslosigkeit Offizielle Arbeitslosenquote (1980-2005) % 5 4 3 2 1 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Quelle: seco 2 Arbeitslosenquoten Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK und USA
Rezepte gegen Arbeitslosigkeit Offizielle Arbeitslosenquote (1980-2005) % 5 4 3 2 1 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Quelle: seco 2 Arbeitslosenquoten Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK und USA
Gliederung der ersten Vorlesungen und Übungen
 Seite 1 Gliederung der ersten Vorlesungen und Übungen Vorlesung 2 (heute): Vorlesung 3 (06. Mai.): Grundlagen Grundlagen / Kartelle und Kartellverbot Übung 1 (07.Mai) Mikroökonomische Grundlagen Vorlesung
Seite 1 Gliederung der ersten Vorlesungen und Übungen Vorlesung 2 (heute): Vorlesung 3 (06. Mai.): Grundlagen Grundlagen / Kartelle und Kartellverbot Übung 1 (07.Mai) Mikroökonomische Grundlagen Vorlesung
VWL Teilfachprüfung II (Neue DPO) März Lösungshinweise. Teil 1 Multiple Choice (2 Punkte pro Frage = 46 Punkte)
 Prof. Dr. B. Erke / Prof. Dr. Th. Siebe VWL Teilfachprüfung II (Neue DPO) März 2006 Lösungshinweise Teil 1 Multiple Choice (2 Punkte pro Frage = 46 Punkte) Bitte beantworten Sie ALLE Teilaufgaben. Tragen
Prof. Dr. B. Erke / Prof. Dr. Th. Siebe VWL Teilfachprüfung II (Neue DPO) März 2006 Lösungshinweise Teil 1 Multiple Choice (2 Punkte pro Frage = 46 Punkte) Bitte beantworten Sie ALLE Teilaufgaben. Tragen
Mikroökonomie: Faktormärkte. Lösung zu Aufgabensammlung. Erklären die Besonderheit, dass Arbeitsverträge unvollständige Verträge sind.
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: Faktormärkte Lösung zu Aufgabensammlung Lösung Faktormärkte: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Nennen sie die Besonderheiten des Faktors Arbeit. 1.2 - Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit
Thema Dokumentart Mikroökonomie: Faktormärkte Lösung zu Aufgabensammlung Lösung Faktormärkte: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Nennen sie die Besonderheiten des Faktors Arbeit. 1.2 - Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit
Mikroökonomie 1. Einführung Plan der heutigen Vorlesung
 Mikroökonomie 1 Einführung 26.10.06 1 Plan der heutigen Vorlesung Was ist die Mikroökonomie Ablauf und Organisation der Lehrveranstaltung Was ist ein ökonomisches Modell? Das Marktmodell als zentrales
Mikroökonomie 1 Einführung 26.10.06 1 Plan der heutigen Vorlesung Was ist die Mikroökonomie Ablauf und Organisation der Lehrveranstaltung Was ist ein ökonomisches Modell? Das Marktmodell als zentrales
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Die Entwicklung deutscher Führungsgrundsätze im 20. Jahrhundert
 Geisteswissenschaft Stefan Erminger Die Entwicklung deutscher Führungsgrundsätze im 20. Jahrhundert Eine vergleichende Betrachtung zwischen Beständigkeit und Wandel Wissenschaftlicher Aufsatz GRUNDSÄTZE
Geisteswissenschaft Stefan Erminger Die Entwicklung deutscher Führungsgrundsätze im 20. Jahrhundert Eine vergleichende Betrachtung zwischen Beständigkeit und Wandel Wissenschaftlicher Aufsatz GRUNDSÄTZE
Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität. Y n = C + I (1)
 2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet:
 1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Fachrichtung:... Semesterzahl:...
 Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuß der Georg-August-Universität Göttingen Diplomprüfung Klausuren für Volkswirte, Betriebswirte, Handelslehrer und Wirtschaftsinformatiker, BA, MA, Nebenfach
Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuß der Georg-August-Universität Göttingen Diplomprüfung Klausuren für Volkswirte, Betriebswirte, Handelslehrer und Wirtschaftsinformatiker, BA, MA, Nebenfach
Thema 4: Das IS-LM-Modell. Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM)
 Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Pierre Bourdieu Die Regeln der Kunst Genese und Struktur des literarischen Feldes
 Pierre Bourdieu Die Regeln der Kunst Genese und Struktur des literarischen Feldes [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999, S. 227-279.] 3. Der Markt der symbolischen Güter [ ] Die Geschichte, deren entscheidende
Pierre Bourdieu Die Regeln der Kunst Genese und Struktur des literarischen Feldes [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999, S. 227-279.] 3. Der Markt der symbolischen Güter [ ] Die Geschichte, deren entscheidende
Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte
 Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte Band 3 Geld, Konjunktur, Außenwirtschaft, Wirtschaftswachstum von Prof. Dr. Manfred O.E. Hennies BERLIN VERLAG Arno Spitz ALLGEMEINE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte Band 3 Geld, Konjunktur, Außenwirtschaft, Wirtschaftswachstum von Prof. Dr. Manfred O.E. Hennies BERLIN VERLAG Arno Spitz ALLGEMEINE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
 Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung bis zur Gegenwart
 Jürgen Kromphardt Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung bis zur Gegenwart 2., überarbeitete Auflage Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhaltsverzeichnis Einleitung 13 Kapitel
Jürgen Kromphardt Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung bis zur Gegenwart 2., überarbeitete Auflage Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhaltsverzeichnis Einleitung 13 Kapitel
Übung zur Vorlesung Grundlagen der Wirtschaftspolitik
 Übung zur Vorlesung Grundlagen der Wirtschaftspolitik Mi, 12:15-13:45 Uhr, HS 4 Do, 12:15-13:45 Uhr, HS 4 Wöchentlich werden insgesamt zwei Übungstermine angeboten. Sprechstunde Julian Schmied Nach Vereinbarung
Übung zur Vorlesung Grundlagen der Wirtschaftspolitik Mi, 12:15-13:45 Uhr, HS 4 Do, 12:15-13:45 Uhr, HS 4 Wöchentlich werden insgesamt zwei Übungstermine angeboten. Sprechstunde Julian Schmied Nach Vereinbarung
7.2 Kostenfunktionen und Skalenerträge
 7. Kostenfunktionen und Skalenerträge In diesem Abschnitt werden wir uns auf die langfristige Kostenminimierung konzentrieren. Mit anderen Worten, die beiden hier betrachteten Inputs sind frei variierbar.
7. Kostenfunktionen und Skalenerträge In diesem Abschnitt werden wir uns auf die langfristige Kostenminimierung konzentrieren. Mit anderen Worten, die beiden hier betrachteten Inputs sind frei variierbar.
Eigentum, Zins und Geld
 Gunnar Heinsohn / Otto Steiger Eigentum, Zins und Geld Ungeloste Ratsel der Wirtschaftswissenschaft Dritte, nochmals durchgesehene Auflage Metropolis-Verlag Marburg 2004 INHALT Vorwort zur 3., nochmals
Gunnar Heinsohn / Otto Steiger Eigentum, Zins und Geld Ungeloste Ratsel der Wirtschaftswissenschaft Dritte, nochmals durchgesehene Auflage Metropolis-Verlag Marburg 2004 INHALT Vorwort zur 3., nochmals
Zur ökologischen Vergesellschaftung bei Marx
 Zur ökologischen Vergesellschaftung bei Marx Als Dissertation am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften an der Freien Universität Berlin vorgelegt von Jeong-Im Kwon 1. Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang
Zur ökologischen Vergesellschaftung bei Marx Als Dissertation am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften an der Freien Universität Berlin vorgelegt von Jeong-Im Kwon 1. Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang
Einkommen, Inflation und Arbeitslosigkeit - Thema 6: IS - LM Ein (mächtiges) Werkzeug.
 Einkommen, Inflation und Arbeitslosigkeit - Thema 6: IS - LM Ein (mächtiges) Werkzeug. Mario Lackner JKU Linz, Abteilung für Finazwissenschaften. 28. Mai 2009 Was ist das IS-LM-Modell? Im IS LM Modell
Einkommen, Inflation und Arbeitslosigkeit - Thema 6: IS - LM Ein (mächtiges) Werkzeug. Mario Lackner JKU Linz, Abteilung für Finazwissenschaften. 28. Mai 2009 Was ist das IS-LM-Modell? Im IS LM Modell
GRUNDZÜGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I + II
 Prof. Dr. Wolfgang Filc WS 2005/06 GRUNDZÜGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I + II Adressaten: Studierende im 1. Semester der BWL, VWL, Soziologie und Mathematik Zeit: Mittwoch, 14-16 Uhr und Donnerstag, 16-18
Prof. Dr. Wolfgang Filc WS 2005/06 GRUNDZÜGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I + II Adressaten: Studierende im 1. Semester der BWL, VWL, Soziologie und Mathematik Zeit: Mittwoch, 14-16 Uhr und Donnerstag, 16-18
Betrachten wir die folgende Klausuraufgabe aus dem Wintersemester 2010/2011:
 Eine makroökonomische Theorie der offenen Volkswirtschaft Betrachten wir die folgende Klausuraufgabe aus dem Wintersemester 2010/2011: Die Euro-Schuldenkrise hat dazu geführt, dass Anleihen in Euro für
Eine makroökonomische Theorie der offenen Volkswirtschaft Betrachten wir die folgende Klausuraufgabe aus dem Wintersemester 2010/2011: Die Euro-Schuldenkrise hat dazu geführt, dass Anleihen in Euro für
Makroökonomie I Vorlesung 10. Wachstum stilisierte Fakten (Kapitel 10)
 Leopold von Thadden Makroökonomie I Vorlesung 10 Wintersemester 2013/2014 Wachstum stilisierte Fakten (Kapitel 10) Diese Präsentation verwendet Lehrmaterialien von Pearson Studium 2009 1 Olivier Blanchard/Gerhard
Leopold von Thadden Makroökonomie I Vorlesung 10 Wintersemester 2013/2014 Wachstum stilisierte Fakten (Kapitel 10) Diese Präsentation verwendet Lehrmaterialien von Pearson Studium 2009 1 Olivier Blanchard/Gerhard
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Der negative natürliche Zins. Carl Christian von Weizsäcker MPI zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern Vortrag Universität Leipzig 21.
 Der negative natürliche Zins Carl Christian von Weizsäcker MPI zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern Vortrag Universität Leipzig 21. Mai 2014 1 1 Die Produktionsperiode 2 Die Sparperiode 3 Das Allgemeine
Der negative natürliche Zins Carl Christian von Weizsäcker MPI zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern Vortrag Universität Leipzig 21. Mai 2014 1 1 Die Produktionsperiode 2 Die Sparperiode 3 Das Allgemeine
Transformation als historischer Prozess
 Politik Mara Rebmann / Juliane Marmuth Transformation als historischer Prozess Karl Polanyi Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...1 2. Das internationale System...2 2.1 Der hundertjährige Friede...2
Politik Mara Rebmann / Juliane Marmuth Transformation als historischer Prozess Karl Polanyi Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...1 2. Das internationale System...2 2.1 Der hundertjährige Friede...2
Ökonomische Regulierungsdoktrin: Keynesianismus vs. Neoklassik/ Neoliberalismus
 Ökonomische Regulierungsdoktrin: Keynesianismus vs. Neoklassik/ Neoliberalismus Wiederholung: - Liberaler Kapitalismus bis zum Ersten Weltkrieg - Koordinierter ("fordistischer") Kapitalismus bis zum Zusammenbruch
Ökonomische Regulierungsdoktrin: Keynesianismus vs. Neoklassik/ Neoliberalismus Wiederholung: - Liberaler Kapitalismus bis zum Ersten Weltkrieg - Koordinierter ("fordistischer") Kapitalismus bis zum Zusammenbruch
Einführung in die VWL Teil 1
 Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 1 Grundlagen der VWL und Mikroökonomie Version vom 21.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017
Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 1 Grundlagen der VWL und Mikroökonomie Version vom 21.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017
Bachelor Business Administration and Economics / Bachelor Governance and Public Policy / Lehramt
 Bachelor Business Administration and Economics / Bachelor Governance and Public Policy / Lehramt Prüfungsfach/Modul: Makroökonomik Klausur: Makroökonomik (80 Minuten) (211751) Prüfer: Prof. Dr. Johann
Bachelor Business Administration and Economics / Bachelor Governance and Public Policy / Lehramt Prüfungsfach/Modul: Makroökonomik Klausur: Makroökonomik (80 Minuten) (211751) Prüfer: Prof. Dr. Johann
Klausur Makroökonomie II Sommersemester 2000
 Klausur Makroökonomie II Sommersemester 2000 Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen. Die Klausur gliedert sich in zwei Teile (Gewichtung A:B = 1:1). Teil A besteht
Klausur Makroökonomie II Sommersemester 2000 Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen. Die Klausur gliedert sich in zwei Teile (Gewichtung A:B = 1:1). Teil A besteht
Konjunkturzyklus und Überakkumulation
 Stephan Krüger Konjunkturzyklus und Überakkumulation Wert, Wertgesetz und Wertrechnung für die Bundesrepublik Deutschland V VS Stephan Krüger Konjunkturzyklus und Überakkumulation Stephan Krüger, Dr.,
Stephan Krüger Konjunkturzyklus und Überakkumulation Wert, Wertgesetz und Wertrechnung für die Bundesrepublik Deutschland V VS Stephan Krüger Konjunkturzyklus und Überakkumulation Stephan Krüger, Dr.,
Inflation. Was ist eigentlich../inflation u. Deflation
 Inflation Unsere Serie Was ist eigentlich... behandelt aktuelle und viel diskutierte Themen, die beim Nicht-Spezialisten eine gewisse Unsicherheit hinterlassen. Wir wollen das Thema jeweils einfach und
Inflation Unsere Serie Was ist eigentlich... behandelt aktuelle und viel diskutierte Themen, die beim Nicht-Spezialisten eine gewisse Unsicherheit hinterlassen. Wir wollen das Thema jeweils einfach und
Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung bis zur Gegenwart
 Jürgen Kromphardt Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung bis zur Gegenwart Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhaltsverzeichnis Einleitung : 13 Kapitel I: Charakteristische
Jürgen Kromphardt Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung bis zur Gegenwart Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhaltsverzeichnis Einleitung : 13 Kapitel I: Charakteristische
Prüfung Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Prüfung Einführung in die VWL im SS 2013 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Prüfung Einführung in die VWL im SS 2013 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Makroökonomie 1. Skript: Teil 1
 Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Richtig oder falsch?(mit Begründungen) Teil macro
 oder falsch?(mit Begründungen) Teil macro Quellen: O'Leary James, Make That Grade Economics, 4th ed., Gill & Macmillan, Dublin 202 (III,x) Salvatore Dominick und Diulio Eugene, Principles of Economics,
oder falsch?(mit Begründungen) Teil macro Quellen: O'Leary James, Make That Grade Economics, 4th ed., Gill & Macmillan, Dublin 202 (III,x) Salvatore Dominick und Diulio Eugene, Principles of Economics,
Der Transmissionsmechanismus nach Keynes
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Prof. Dr. Sell: Klausur VWL I und II, 11. Juni 2003 Musterlösung ohne Punkte Seite 1 von 7
 Prof. Dr. Sell: Klausur VWL I und II, 11. Juni 2003 Musterlösung ohne Punkte Seite 1 von 7 1. Knappheit und Wirtschaften a) Definieren Sie die vier folgenden Begriffe (4 Punkte) Bedürfnis: Gefühl einer
Prof. Dr. Sell: Klausur VWL I und II, 11. Juni 2003 Musterlösung ohne Punkte Seite 1 von 7 1. Knappheit und Wirtschaften a) Definieren Sie die vier folgenden Begriffe (4 Punkte) Bedürfnis: Gefühl einer
VWL - Examen - Makroökonomik
 Geschichte der Makroökonomik a) Weltwirtschaftskrise (Oktober 1929 Börsencrash) Arbeitslosigkeit verblieb in vielen Ländern mehr als zehn Jahre auf hohem Niveau b) Klassischer Ansatz bis zur Weltwirtschaftskrise
Geschichte der Makroökonomik a) Weltwirtschaftskrise (Oktober 1929 Börsencrash) Arbeitslosigkeit verblieb in vielen Ländern mehr als zehn Jahre auf hohem Niveau b) Klassischer Ansatz bis zur Weltwirtschaftskrise
Aufgabensammlung. Präsenzveranstaltung des Lehrgebietes Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik. Termin:
 Präsenzveranstaltung des Lehrgebietes Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik Aufgabensammlung Termin: 20.02.2010 Thema: Freiwilliges Kolloquium zur Klausurvorbereitung Leitung: Dipl.-Volkswirtin Hilke
Präsenzveranstaltung des Lehrgebietes Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik Aufgabensammlung Termin: 20.02.2010 Thema: Freiwilliges Kolloquium zur Klausurvorbereitung Leitung: Dipl.-Volkswirtin Hilke
Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE. Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Maximale Punktzahl:
 Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Aufgaben-Nr.: 1 2 3 4 Gesamt Maximale Punktzahl: 15 15 15 15 60 Erreichte Punkte: WICHTIGE HINWEISE: Bitte beantworten
Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Aufgaben-Nr.: 1 2 3 4 Gesamt Maximale Punktzahl: 15 15 15 15 60 Erreichte Punkte: WICHTIGE HINWEISE: Bitte beantworten
Konjunktur und Wachstum
 Konjunktur und Wachstum Multiplikator und Konsum 8. Sitzung, Sommersemester 2015 2.6.2015 Inhaltsverzeichnis 1 Multiplikator... 2 1.2 Sparen im E-A-Modell... 2 1.3 Konsum und verfügbares Einkommen der
Konjunktur und Wachstum Multiplikator und Konsum 8. Sitzung, Sommersemester 2015 2.6.2015 Inhaltsverzeichnis 1 Multiplikator... 2 1.2 Sparen im E-A-Modell... 2 1.3 Konsum und verfügbares Einkommen der
Konjunktur. Wirtschaftsschwankungen. Lange Wellen Konjunkturschwankungen Saisonschwankungen
 Konjunktur Je nach Dauer der wirtschaftlichen Schwankungen, die in der Regel an der Entwicklung des Bruttoinlandproduktes gemessen werden, unterscheidet man langfristige (strukturelle), mittelfristige
Konjunktur Je nach Dauer der wirtschaftlichen Schwankungen, die in der Regel an der Entwicklung des Bruttoinlandproduktes gemessen werden, unterscheidet man langfristige (strukturelle), mittelfristige
Beispiele für Prüfungsfragen
 Beispiele für Prüfungsfragen Nach welchem Prinzip funktionieren und wachsen kapitalistische Märkte? Welche Rolle spielt dabei Vertrauen und wie können mit Hilfe des Vertrauenskonzepts Finanzkrisen erklärt
Beispiele für Prüfungsfragen Nach welchem Prinzip funktionieren und wachsen kapitalistische Märkte? Welche Rolle spielt dabei Vertrauen und wie können mit Hilfe des Vertrauenskonzepts Finanzkrisen erklärt
DAS VERHALTEN DER VERBRAUCHER UND UNTERNEHMER
 DAS VERHALTEN DER VERBRAUCHER UND UNTERNEHMER Über die Beziehungen zwischen Nationalökonomie, Psychologie und Sozialpsychologie DR. GEORGE KATONA ^Professor für Nationalökonomie und Psychologie an der
DAS VERHALTEN DER VERBRAUCHER UND UNTERNEHMER Über die Beziehungen zwischen Nationalökonomie, Psychologie und Sozialpsychologie DR. GEORGE KATONA ^Professor für Nationalökonomie und Psychologie an der
Volkswirtschaftliche Grundlagen
 Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
VWL für Ingenieure. Programm Termin 9. Kernpunkte. Programm Termin 9. Programm Termin 9. Kernpunkte. Karl Betz. Klassik
 Karl Betz VWL für Ingenieure Termin 9: Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht + komparative Statik Angebotsorientierte Theorie Programm Termin 9 Klassik Neoklassik Exkurs: Simultanes GG der Faktormärkte
Karl Betz VWL für Ingenieure Termin 9: Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht + komparative Statik Angebotsorientierte Theorie Programm Termin 9 Klassik Neoklassik Exkurs: Simultanes GG der Faktormärkte
Wintersemester 2016/2017
 1 Friedrich-Schiller-Universität Jena Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Makroökonomik PD Dr. Markus Pasche Klausur BM Einführung in die Volkswirtschaftslehre Wintersemester
1 Friedrich-Schiller-Universität Jena Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Makroökonomik PD Dr. Markus Pasche Klausur BM Einführung in die Volkswirtschaftslehre Wintersemester
Aufgabenblatt 1: Güter- und Geldmarkt
 Aufgabenblatt : Güter- und Geldmarkt Lösungsskizze Bitten beachten Sie, dass diese Lösungsskizze lediglich als Hilfestellung zur eigenständigen Lösung der Aufgaben gedacht ist. Sie erhebt weder Anspruch
Aufgabenblatt : Güter- und Geldmarkt Lösungsskizze Bitten beachten Sie, dass diese Lösungsskizze lediglich als Hilfestellung zur eigenständigen Lösung der Aufgaben gedacht ist. Sie erhebt weder Anspruch
Die Produktion. 16 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Beispiele: Güter und Dienstleistungen
 16 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Beispiele: Güter und Dienstleistungen Ü Sachgüter: Für den privaten Haushalt sind Waschmaschine und Waschmittel Konsumgüter, die Waschmaschine ein Gebrauchsgut
16 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Beispiele: Güter und Dienstleistungen Ü Sachgüter: Für den privaten Haushalt sind Waschmaschine und Waschmittel Konsumgüter, die Waschmaschine ein Gebrauchsgut
Allgemeine BWL 3 Mikroökonomie. Kai Kleinwächter, M.A.
 Allgemeine BWL 3 Mikroökonomie, M.A. Fachbegriffe - Arbeitswerttheorie / Humankapitaltheorie - Bedürfnis / Nutzen / Güter - Ökonomisches Prinzip (Minimal- / Maximal-Strategie) - Pareto-Optimum, Kaldor-Hicks-Kriterium
Allgemeine BWL 3 Mikroökonomie, M.A. Fachbegriffe - Arbeitswerttheorie / Humankapitaltheorie - Bedürfnis / Nutzen / Güter - Ökonomisches Prinzip (Minimal- / Maximal-Strategie) - Pareto-Optimum, Kaldor-Hicks-Kriterium
Das (einfache) Solow-Modell
 Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Das Unternehmen // Produktion Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Problem Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gegeben durch F (K, L) = K β L 1 β Für welche Werte von β zeigt sie steigende, konstante
Das Unternehmen // Produktion Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Problem Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gegeben durch F (K, L) = K β L 1 β Für welche Werte von β zeigt sie steigende, konstante
Demokratietheorien im Vergleich
 Politik Simone Prühl Demokratietheorien im Vergleich Rezension / Literaturbericht Theoretical Debates in the Literature Demokratietheorie(n) im Vergleich Lehrstuhl für Politische Systeme Universität Bamberg
Politik Simone Prühl Demokratietheorien im Vergleich Rezension / Literaturbericht Theoretical Debates in the Literature Demokratietheorie(n) im Vergleich Lehrstuhl für Politische Systeme Universität Bamberg
UE4: Aufgaben Wachstumspolitik durch Investitionsförderung
 UE4: Aufgaben Wachstumspolitik durch Investitionsförderung 1) Welche Rolle spielen private Investitionen für die Wirtschaftspolitik (WiPol) und warum? 2) An welchen Determinanten des Investitionsverhaltens
UE4: Aufgaben Wachstumspolitik durch Investitionsförderung 1) Welche Rolle spielen private Investitionen für die Wirtschaftspolitik (WiPol) und warum? 2) An welchen Determinanten des Investitionsverhaltens
Konvergenz und Bedingte Konvergenz. = h 0 ( ) ( ) i 2 0 Zudem sinkt die Wachstumsrate der pro-kopf-produktion mit dem Niveau.
 TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
Wir sagen also, dass der Faschismus nicht einfach abstrakt mit dem Kapitalismus
 Unterdrückung) der Faschismus eigentlich antritt, auf die Spitze getrieben werden: der im Kapitalismus allgegenwärtige antagonistische Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der Widerspruch
Unterdrückung) der Faschismus eigentlich antritt, auf die Spitze getrieben werden: der im Kapitalismus allgegenwärtige antagonistische Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der Widerspruch
Dogmen 6 - Neoklassik: Wirtschaft als System von Märkten
 Dogmen 6 - Neoklassik: Wirtschaft als System von Märkten Léon Walras (134-1910) Eléments d économie politique pure (2 Teile 1874 und 1877) William Stanley Jevons (1835-1882) The Theory of Political Economy
Dogmen 6 - Neoklassik: Wirtschaft als System von Märkten Léon Walras (134-1910) Eléments d économie politique pure (2 Teile 1874 und 1877) William Stanley Jevons (1835-1882) The Theory of Political Economy
Volkswirtschaftslehre für WI ler, Bachelor 60 Pkt. SS08 -Makroökonomik- Dr. Jörg Lingens
 Volkswirtschaftslehre für WI ler, Bachelor 60 Pkt. SS08 -Makroökonomik- Dr. Jörg Lingens Frage 1: Grundlagen (10 Pkt) Welche Größen sind nicht Bestandteil des Bruttonationaleinkommens (BNE)? o Faktoreinkommen
Volkswirtschaftslehre für WI ler, Bachelor 60 Pkt. SS08 -Makroökonomik- Dr. Jörg Lingens Frage 1: Grundlagen (10 Pkt) Welche Größen sind nicht Bestandteil des Bruttonationaleinkommens (BNE)? o Faktoreinkommen
K L A U S U R. Bearbeitungshinweise: Bitte tragen Sie hier Ihre Kennziffer ein: Bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein: 60 Minuten.
 Bitte tragen Sie hier Ihre Kennziffer ein: Bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein: K L A U S U R Bachelor 2008/I Einführung in die VWL Prof. Dr. Peter Bofinger Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Geld
Bitte tragen Sie hier Ihre Kennziffer ein: Bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein: K L A U S U R Bachelor 2008/I Einführung in die VWL Prof. Dr. Peter Bofinger Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Geld
Einführung in die VWL Teil 2
 Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 2 Makroökonomie Version vom 24.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017 1 Einführung in die
Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 2 Makroökonomie Version vom 24.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017 1 Einführung in die
Die möglichen Kombinationen X1 und X2 lassen sich durch die Verbindung der beiden Achsenpunkte veranschaulichen (Budgetgerade).
 Folie 3.. - Die Budgetgerade Die Budgetgerade kennzeichnet die Wahlmöglichkeiten des Haushaltes bei gegebenem Einkommen () und gegebenen Preisen P und für die beiden Güter (-bündel) X und. Das kann für
Folie 3.. - Die Budgetgerade Die Budgetgerade kennzeichnet die Wahlmöglichkeiten des Haushaltes bei gegebenem Einkommen () und gegebenen Preisen P und für die beiden Güter (-bündel) X und. Das kann für
Das Preisniveau und Inflation
 Das Preisniveau und Inflation MB Preisindex für die Lebenshaltung Preisindex für die Lebenshaltung (Consumer Price Index, CPI) Bezeichnet für eine bestimmte Periode die Kosten eines typischen Warenkorbs
Das Preisniveau und Inflation MB Preisindex für die Lebenshaltung Preisindex für die Lebenshaltung (Consumer Price Index, CPI) Bezeichnet für eine bestimmte Periode die Kosten eines typischen Warenkorbs
Abschlussklausur Makroökonomie
 Prof. Dr. Peter Grösche Abschlussklausur Makroökonomie Gruppe A 1.August 2012 Name, Vorname: Matrikelnummer: Studiengang Semester Hinweise 1. Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben, von denen alle zu beantworten
Prof. Dr. Peter Grösche Abschlussklausur Makroökonomie Gruppe A 1.August 2012 Name, Vorname: Matrikelnummer: Studiengang Semester Hinweise 1. Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben, von denen alle zu beantworten
