Gert Vonhoff. Erzählgeschichte. Studien zur erzählenden Prosa
|
|
|
- Meta Beckenbauer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gert Vonhoff Erzählgeschichte Studien zur erzählenden Prosa
2 Gert Vonhoff,»Erzählgeschichte. Studien zur erzählenden Prosa«2007 der vorliegenden Ausgabe: Edition Octopus Die Edition Octopus erscheint im Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG Münster Gert Vonhoff Alle Rechte vorbehalten Satz: Gert Vonhoff Umschlag: MV-Verlag Druck und Bindung: MV-Verlag ISBN
3 Alles Göttliche und alles Schöne ist schnell und leicht. Zum Gedenken an meinen Vater
4
5 Inhalt Vorbemerkungen 7 Bürgerliche Projektionen 20 Moralische Charaktere (Gellert) 22 Der Triumph der tugendhaften Liebe (Pfeil) 27 Das wahre Glück ist in der Seele der Rechtschaffenen (La Roche) 32 Natur und Kunst 37 Der Topf 39 Menschenelend und Menschenduldsamkeit (Seybold) 42 Grenzgang 45 Die Leiden des jungen Werthers (Goethe) 45 Freuden des jungen Werthers / Leiden und Freuden Werthers des Mannes (Nicolai) 56 Ausdifferenzierungen 63 Moralische Bekehrung eines Poeten (Lenz) 63 Zerbin oder die neuere Philosophie (Lenz) 67 Der Waldbruder (Lenz) 77 Der Landprediger (Lenz) 83 Geschichten oder Geschichte 90 Eine grossmütige Handlung (Schiller) 95 Verbrecher aus Infamie (Schiller) 100 Spiel des Schicksals (Schiller) 106 Erzählen im Zeitalter der Revolution 113 Briefe aus Paris (Campe) 115 Notiz zu Parisische Umrisse (Forster) 124 Kosmopolitische Wanderungen durch einen Teil Deutschlands (Rebmann) 125 Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (Goethe) 131 Nachtwachen. Von Bonaventura (Klingemann) 145 Projektive Abstraktionen 157 Lucinde (F. Schlegel) 157 Notiz zu Hyperion (Hölderlin) 173 Notiz zu Die Wahlverwandtschaften (Goethe) 175 Wilhelm Meisters Wanderjahre (Goethe) 176
6 Zersetzungsformen 194 Briefe eines Narren an eine Närrin (Gutzkow) 194 Maha Guru (Gutzkow) 202 Andere Werke von Gutzkow 206 Florentinische Nächte (Heine) 208 Der Blick von unten 216 Die Sterbecassirer (Gutzkow) 216 Armut und Verbrechen (Dronke) 220 Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten (Weerth) / Englische Fragmente (Heine) 225 Die Ritter vom Geiste (Gutzkow) 245 Nachbemerkungen 259 Literaturverzeichnis 265 Dank 283
7 Vorbemerkungen Erzählen findet immer dann statt, wenn jemand jemandem anderen etwas erzählt das ist die vielleicht abstrakteste Formel, auf die man den Erzählvorgang reduzieren kann. In dem Maße, wie die Formulierung die Valenzen des Verbs sichtbar macht, ist sie keineswegs tautologisch, deckt vielmehr auf, wie komplex das Gefüge von Komponenten ist, wenn erzählt wird. Erzählen ist demnach eine Relation von vier Faktoren: dem Erzähler als demjenigen, der erzählt; dem Zuhörer (oder Leser) als demjenigen, dem erzählt wird; dem Erzählgegenstand als demjenigen, über das erzählt wird; und der erzählerischen Vermittlung als Modus, wie erzählt wird. Wer wem was wie erzählt, das charakterisiert die Relation erzählen. Von jedem einzelnen dieser vier Faktoren sowie von deren Zusammenspiel hängt es ab, ob ein Erzählakt banal oder erkenntnisstiftend ist. Begründet ist das darin, daß alle Faktoren immer schon in Kontexte und damit in Wertungszusammenhänge eingebunden sind. Beim alltäglichen Erzählen, gar wo die Zuhörer mit dem Erzähler vertraut sind, macht man sich die Komplexität der Relation erzählen in der Regel nicht bewußt. Die Kontextualisierungen erfolgen hier zum größten Teil automatisiert, mit Ausnahme indes von dem, was erzählt wird, dem Neuen, dem Andersartigen. Und erst, wenn etwas nicht funktioniert, eine Irritation des Erwarteten eintritt, werden die stillschweigend zugrundegelegten Kontextualisierungen bewußt. Beim literarischen Erzählen hingegen verhält es sich anders: alles ist neu, darum andersartig und darum fremd. Und hierin liegt das Erkenntnispotential der erzäh-
8 lenden Literatur begründet. Alle vier Komponenten der Relation sind aufgrund der uneigentlichen Rezeptionssituation stets zu konstituieren, in der Werkstruktur finden sie sich zu jeweils unterschiedlichen Maßen angelegt, bedürfen aber in jedem einzelnen Fall der historischen Kontextualisierung und damit der geschichtlichen Konkretion. Diese erfolgt immer dann, wenn das literarisch Erzählte in einen eigentlichen Rezeptionsvorgang überführt wird, also jemand etwas verstehen will. Was hier als Erzählgeschichte vorgelegt wird, versucht der komplexen Relation erzählen gerecht zu werden. Untersucht wird das (in seiner historischen Abbildung) konkrete und damit geschichtliches Verstehen eröffnende Zusammenspiel der vier Komponenten in der Relation. Für die erzählende Literatur sind dies: der Erzähler, der fingierte (aber auch der reale) Leser, der Erzählgegenstand und der Erzählmodus. Literarisches Erzählen, so lautet eine der zugrunde gelegten Prämissen der Erzählgeschichte, verstehe man erst dann in seiner vollen Potentialität, wenn man die geschichtliche Evolution, in der jeder einzelne Erzählakt steht, ansichtig macht und begreift. Geschichte, und sei es auch nur die der Literatur, begreift man wiederum nur von dem Standort, an dem sich derjenige, der sie verstehen will, befindet. Dies wiederum eröffnet den Rückverweis auf den ersten Teil des Kompositums Erzählgeschichte : denn Geschichte wird ihrerseits erzählt, steht selbst wiederum in dieser komplexen Relation. Die postmodernen Debatten haben dies immer aufs Neue klarzumachen versucht. Doch bedeutet, der Geschichte gerecht zu werden, sie je konkret in ihren Ausformungen wie in ihrer Bedingtheit auch zu verstehen. Hermeneutik bleibt somit die 8
9 Grundlage der Arbeit in, mit und an der Geschichte. Und weil Hermeneutik dazu tendiert, blind zu sein, bedarf sie des kritischen Korrektivs, wie es etwa in der Kritischen Theorie sich ausgebildet hat. Aus dem bisher Gesagten ergeben sich Konsequenzen für die Kategorien, mit denen die Erzählgeschichte arbeitet. Es ist einsichtig, warum diese keinen typologischen und damit potentiell ontologischen Charakter haben sollten, denn der kann Geschichte nicht erfassen. Es wird deutlich, warum sie nicht zu systematisch, auf keinen Fall zu klassifikatorisch sein sollten, denn das würde die Sicht auf die Besonderheit der jeweils historisch ausgeprägten Relation eher verstellen, damit nur ablenken von dem, was gerade wegen seiner Nicht-Automatisierung, wegen seiner Besonderung die Neugierde hervorruft und so potentiell das Verstehen öffnet. Die Kategorien, mit denen die Erzählgeschichte arbeitet, sollen also eine Hilfe sein, um die Besonderheit des je einzelnen Erzählwerks beschreibend und interpretierend zu erfassen. Sie müssen deshalb derart beschaffen sein, daß sie die in der Besonderung der Kunst angelegte Widerständigkeit nicht nivellieren, die Unruhe der erzählerischen Werke nicht ruhigstellen. In ihrer allgemeinen Beschaffenheit sollen sie das Besondere nicht unter das Allgemeine subsumieren, sondern im Moment ihrer Setzung zu weitergehenden Differenzierungen einladen. Sie müssen darum selbst eher relationalen Charakter haben als definitorisch festschreibenden. Ihr Schwerpunkt darf nicht auf der Aussage liegen, wie es bei Begriffen wie auktorial oder personal zu beobachten ist. Bei den Kategorien projektiv, kritisch und analytisch, welche die Erzählgeschichte benutzt, ist man über die Aussagequalität hinaus neugierig 9
10 zu fragen, etwa: projektiv im Hinblick auf was? kritisch wofür oder wogegen? analytisch in welcher Beziehung? Solche Begrifflichkeit lädt ein zur Differenzierung und erfaßt darum eher die komplexe Relation erzählen. Zugleich sind die Kategorien projektives Erzählen, kritisches Erzählen oder analytisches Erzählen in ihrer unbestimmten, aber zur Bestimmung einladenden Allgemeinheit dazu geeignet, historische Prozesse in ihren Wiederholungen zu begreifen und dabei das Augenmerk gerade darauf zu lenken, was im Ähnlichen als Unterschiedliches sich festhalten läßt. In einer ersten Annäherung läßt sich zur Charakterisierung der Kategorien folgendes sagen: Projektives Erzählen hat eine Position entwerfende Qualität; es beschreibt einen neuen Standort, ist darum bemüht, ihn gewissermaßen zu definieren. Zu finden ist es etwa im Prozeß der bürgerlichen Selbstfindung in Deutschland Mitte des 18. Jahrhunderts. Kritisches Erzählen hat eine Position hinterfragende Qualität; es befragt einen bereits ausgebildeten Standort, im Bemühen darum, ihn in Differenzierungen fortzuentwickeln, und im Bewußtsein davon, dies auch im Rahmen des Bestehenden tun zu können. Zu finden ist es etwa in der deutschen Literatur des Sturm und Drang und der Spätaufklärung. Analytisches Erzählen hat eine Position suchende Qualität; es weist über den eingenommenen Standort hinaus, ohne allerdings schon in eine andere, neue Projektion zu münden; in der Art, wie es darum weiß, daß die Kritik über das Kritisierte hinausweist, dies aber noch nicht benennen kann, ist es die offenste Weise des Erzählens. Zu finden ist es etwa im Gefolge der Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution in den deutschen Staaten. Doch hat ein die Grundbedingungen der sozialen Organisation so fundamental hinterfragendes Ereignis wie 10
11 die Französische Revolution nicht nur dazu geführt, daß die Literatur mit analytisch erzählten Werken reagierte; zur gleichen Zeit entstanden auch projektive Erzählmodelle, die das Neue, was hier geschichtlich vorscheint, auch im literarischen Modell anschaulich zu machen suchen. Wo die Begrifflichkeit in der Lage ist, das Gleichzeitige von Ungleichzeitigem zu erfassen, genügt sie der Vielfalt der zu jedem Zeitpunkt anzutreffenden Positionen, führt also gerade nicht zur Reduzierung von Komplexität, sondern hilft im Gegenteil beim differenzierten Erfassen derselben. Die bisherigen Ausführungen veranschaulichen noch ein weiteres Charakteristikum: die Erzählgeschichte arbeitet in ihrer über diese grundlegende Kategorienbildung hinausgehenden Begriffsbildung eklektisch und greift auf bereits vorhandene Kategorien zurück, wo immer dies hilft, das Besondere der Erzählwerke in ihrer geschichtlichen Genese zu verstehen. Eine zweite erklärende Annäherung an die Kategorien wird möglich, wenn man die vier Momente der Relation erzählen auf die drei Kategorien bezieht. Wer? Wo projektiv erzählt wird, findet sich häufig eine übergeordnete, normsetzende Erzählinstanz, die sich im bürgerlichen Erzählen als auktorialer Erzähler manifestiert hat, also gleichsam eine Individualgestalt angenommen hat. Wo kritisch erzählt wird, gerät gerade diese normsetzende Instanz zunehmend selbst in die Kritik, ihr Anspruch wird destruiert, etwa dadurch, daß sich einzelne Figuren oder Motive nicht mehr in den Entwurf integrieren. Wo analytisch erzählt wird, ist der normsetzende Anspruch der Erzählinstanz, so sie denn noch auftaucht, derart weit hinterfragt, daß andere Momente oder deren Konstellation geradezu an dessen Stelle treten, ohne schon selbst Neues setzen zu können oder zu wollen. Wem? Das projektiv 11
12 Erzählte sucht den fiktiven Leser als Allianzpartner der normsetzenden Erzählinstanz zu gewinnen, um so die Projektion verbindlich zu erklären. Das kritisch Erzählte gewährt dem fiktiven Leser Freiräume, um ihn aus dieser Bindung zur normsetzenden Erzählinstanz zu lösen. Das analytische Erzählen drängt den Leser aus der Identifikation mit allen Strukturmomenten des Erzählwerks, um ihn frei zu setzen. Was? Im projektiv Erzählten enthält der gewählte Stoff schon die Momente des Neuen. Im kritisch Erzählten durchziehen den Stoff Momente, die über diesen hinausweisen. Im analytisch Erzählten ist der gewählte Stoff nur mehr veraltetes Material, aus dem die Widersprüche herausgetrieben werden, die diese Materialbasis zu sprengen versprechen. Wie? Alles im projektiven Erzählmodell ordnet sich dem Entwurf unter; das Erzählen ist absolut. Manches im kritischen Erzählmodell erweckt Zweifel, weist auf Lücken im Entwurf hin; das Erzählen wird demokratisch. Nichts im analytischen Erzählmodell läßt sich mehr der noch genannten Norm unterordnen; das Erzählen grenzt an Anarchie. Wie der Untertitel Studien zur erzählenden Prosa es bereits andeutet, ist die vorliegende Arbeit an vielen Stellen beschränkt. So konzentriert sie sich auf die Prosa, gleichwohl wissend, daß es natürlich auch versgebundenes Erzählen gibt. Eine nicht im Untertitel genannte, aber aus dem Inhaltsverzeichnis leicht abzulesende Beschränkung hat die Konzentration auf die erzählende Prosa bedingt. Im Zeitraum von etwa 1750 bis 1850 hat die Prosa die Versform im Erzählen verdrängt, und daher scheint es legitim, diese Eingrenzung des Gegenstandes vorzunehmen. Der Zeitraum selbst ist ein Ausschnitt von Geschichte, der von der Ausformung über die Konsolidierung und Etablierung 12
13 hin zur Infragestellung der bürgerlichen Erzählprosa reicht und damit in vielerlei Weise die historische Entwicklung des Bürgertums in Deutschland über diese hundert Jahre begleitet. Die Art, in der das Inhaltsverzeichnis einzelne Werke in Gruppen zusammenstellt, verdeutlicht auch, wie bausteinhaft und damit baustellenartig die vorliegende Einteilung ist. Mehr Bausteine würden ein größeres und zugleich ein anderes Gebäude ergeben, aber auch mit einer begrenzten Anzahl von Steinen läßt sich schon bauen. Allerdings sollte man so bauen, daß man auch nach Fertigstellung noch umbauen kann. Eine weitgehend isolierte Betrachtung der einzelnen Erzählwerke soll dies ermöglichen, denn wo die Interpretation Bausteine sichtbar läßt, können diese eher wieder aus dem schon Gemauerten gelöst und für den Umbau verwendet werden. Die Gliederung ist also ein gleichsam fotografisches Stillstellen, bietet eine Momentaufnahme. Der Status der einzelnen Interpretationen ist unterschiedlich, je nach Erkenntnisstand und Erfahrung des Verfassers. Damit einhergehende Unausgewogenheiten waren nicht zu umgehen. Wenn die Studien Fragen hervorbringen, zur Kritik herausfordern und zum Wiederlesen der Erzählwerke anregen, haben sie ihr Ziel erreicht. Kein Forschungsbericht zur Erzähltheorie soll an dieser Stelle die Vorbemerkungen beschließen, denn die Literatur ist in den vergangenen Jahrzehnten exponentiell angewachsen. Ein Bericht kann da schnell selbst Buchumfang erreichen. Im folgenden werden daher nur die Grundlagen des Vorgelegten etwas deutlicher gemacht und also das, was als Erzählgeschichte hier entwickelt worden ist, wenigstens knapp kontextualisiert. Die wichtigsten Quel- 13
14 len werden so sichtbar, aus denen die Erzählgeschichte schöpft. Die vielleicht bedeutendsten Anregungen verdankt die Erzählgeschichte zwei kurzen, aber gehaltvollen Beiträgen: Theodor W. Adornos Essay Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman 1 und Herbert Krafts Exkurs: Über auktoriales und personales Erzählen. 2 Beide öffnen ein Verständnis dafür, wie erzählende Literatur und (gesellschafts)geschichtlicher Wandel zusammenhängen. Und wie so oft entsteht die Position erst aus der Abgrenzung. Adorno schränkt die Kategorie des Standorts unnötig ein, wenn er sie nur auf den Erzähler bezieht und seine Sicht damit auf eine Hauptlinie der Entwicklung des bürgerlichen Erzählens seit dem 18. Jahrhundert verkürzt. Die Erzählgeschichte versucht, dies zu umgehen, kennt darum die zusätzlichen Kategorien Standort des Erzählten auf der Ebene des Was und Standort des Erzählens auf übergeordneter Ebene der Werkbedeutung. Kraft beschreibt die Entwicklung von auktorialem zu personalem Erzählen als eine einlinige und verkürzt damit den historischen Wandel, wie es auch ähnlich angelegte Darstellungen, etwa von Georg Lukács 3 und Michail M. Bachtin 4 gemacht haben. Diese geschichtlich argumentierenden Arbeiten seien darum etwas genauer angesehen. Die insgesamt noch idealistisch argumentierende geschichtsphilosophische Darstellung von Lukács beschreibt 1 Zuerst 1954 als Radiovortrag und in den Akzenten veröffentlicht, später dann in: Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur I, S Herbert Kraft, Um Schiller betrogen, S Georg Lukács, Die Theorie des Romans, zuerst Michail M. Bachtin, Epos und Roman, zuerst 1941; Formen der Zeit im Roman, 1937/38 und 1973; Das Wort im Roman, zuerst 1934/35. 14
15 die Ablösung des Epos durch den Roman und setzt dies in Korrelation zum Übergang von der feudalen Ordnung zur bürgerlichen Gesellschaft. 5 Das Bild von der Welt als gegebener Totalität, wie es das Epos kannte, werde abgelöst durch ein Verständnis der Welt in ihrer Pluralität, das dann das vereinheitlichende Zentrum im Roman als Ausdrucksform der aufgegebenen Totalität finde. 6 Bachtin verfolgt ebenfalls den Übergang vom Epos zum Roman, aber in einer differenzierteren Weise. Er kann den Roman so als eine sich fortwährend wandelnde offene Form erkennen, die nicht nur in der Moderne, sondern auch in der Antike schon zu finden gewesen sei. Das Dialogische, die Mehrzahl der Stimmen, charakterisiere den Roman. Damit erkennt er dem Roman selbst eine Genese zu: Die Entwicklung des Romans liegt in der Vertiefung der Dialogizität, in ihrer Entwicklung und Verfeinerung beschlossen. Immer weniger neutrale, feste ( eherne Wahrheit ), nicht in den Dialog eingewobene Elemente bleiben übrig. 7 Doch bleibt die Genese auch hier wie das Zitat zeigt vom Grundverständnis her einlinig, stellt so zwar die Binnendifferenzierung innerhalb der Gattung Roman dar, aber begreift Geschichte letztlich nur eindimensional, als eine Entwicklung hin zu mehr Dialogizität und Diversifikation. Kraft nun baut seine Überlegungen auf Adornos berühmtem Verdikt etwas erzählen heißt ja: etwas Besonderes zu sagen haben 8 auf und gelangt ähnlich wie Adorno zu einer Differenzierung innerhalb des bürgerlichen Erzäh- 5 Siehe dazu besonders Georg Lukács, Die Theorie des Romans. 6 Georg Lukács, Die Theorie des Romans, besonders S. 21f., 25f., 30, Bachtin, Das Wort im Roman, S Theodor W. Adorno, Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman, S
16 lens. So sieht er im auktorialen und im personalen Erzählen die Pole, zwischen denen er die Besonderheit des je einzelnen Werks geschichtlich zu verstehen bemüht ist: Am Besonderen, das im Erzählen zu sagen ist, wird indessen ein Unterschied erkannt, welcher der von auktorialem zu personalem Erzählen ist. Es sind dies die Extrempositionen, welche den Raum für die Möglichkeiten des Erzählens ausmessen, oder auch: die Gegensätze, welche im Werk zur je spezifischen Vermittlung kommen. Solche Dialektik ist Ausdruck des geschichtlichen Prozesses [ ]. 9 Folgerichtig bestimmt Kraft dann seine Kategorien des Auktorialen und Personalen in geschichtlicher Dimension: Ist das Besondere das, was das Individuum erlebt und erdacht hat, aber in der Sicht der (historisch definierten) Allgemeinheit, so ist die Perspektive auktorial ; ist das Besondere das, was alle betrifft, aber in vereinzelter Sicht (weil keine verbindliche und verbindende Wertordnung eine Zusammenschau ermöglicht, weil die Gemeinschaft der Individuen unter der Betroffenheit der Einzelnen zerbricht), so ist die Perspektive personal. Die Bezeichnungen können abgeleitet werden von lat. auctor (Urheber, Schöpfer, Verfasser) oder auctorare (verbürgen, bestätigen): hier wird die Individuation benannt, welche die Selbständigkeit des Schaffens und Gestaltens ist, die aus der allgemein verbindlichen Wertordnung sich herleitet, und von lat. persona (Maske, Rolle, Figur, Individuum): hier wird die andere Individuation benannt, welche gerade die Selbständigkeit des Schaffens und Gestaltens verloren hat in der Betroffenheit [ ]. Auktorial ist die Offensichtlichkeit des Erzählens personal die des Erzählten. 10 Die Gegenüberstellung ist mit diesem Zitat keineswegs erschöpft, ein Nachlesen im Exkurs darum sinnvoll. Doch am Ende erblickt Kraft in der Geschichte der erzählenden Literatur auch wieder die eine Entwicklung vom Aukto- 9 Herbert Kraft, Um Schiller betrogen, S Herbert Kraft, Um Schiller betrogen, S. 50f. 16
17 rialen zum Personalen. 11 Die Erzählgeschichte nun versucht, mit ihren Kategorien des projektiven, kritischen und analytischen Erzählens sich wiederholende Variationen sichtbar zu machen und so Geschichte mehr in ihren Ausdifferenzierungen wahrzunehmen; wenn man so will, die geschichtliche Vorstellung in Form einer Linie durch eine solche in Spiralform zu ersetzen. In ihrer eklektischen Benutzung der umfangreichen Literatur zur Erzähltheorie basiert die Erzählgeschichte auf einer ganzen Reihe von Anregungen aus Arbeiten, die sich zum Teil von ihren Ansätzen her auszuschließen scheinen. Jürgen H. Petersens Buch über Erzählsysteme etwa ist anregend gewesen, wo es stabile von variablen Systemen unterscheidet und von Mehrfachsystemen und Systemwechsel handelt. 12 Die Möglichkeiten des Übergangs und der Mischformen von projektivem, kritischem und analytischem Erzählen schöpfen aus dieser Quelle, aber auch die Vorstellung von verschiedenen Erzählebenen innerhalb eines bestimmten Werks. Die Auseinandersetzung mit Gérard Genette 13 sowie mit Matias Martinez und Michael Scheffel 14 ist wertvoll für die Differenzierung des Wie, die Darstellung, und des Was, die Handlung und erzählte Welt im Erzählen. 15 Wolfgang Isers Darstellung zum Impliziten Leser öffnet in gleicher Weise ein komplexes 11 Herbert Kraft, Um Schiller betrogen, S Jürgen H. Petersen, Erzählsysteme, S Gérard Genette, Die Erzählung. 14 Matias Martinez / Michael Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie. Siehe dort besonders S , wo sie aus der Kritik an Genettes Theorie ihren zweiten, Genette ergänzenden Aspekt mit der Betonung auf das Was herleiten. Später dann entfalten sie ihr Verständnis der Handlung und der erzählten Welt (S ). 15 Die Begriffe so bei Matias Martinez / Michael Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie, S. 27,
18 Verständnis für den strukturellen Ort des Wem im Erzähltext: Wenn die sozialen und historischen Normen das Repertoire des Romans bilden, so erscheint dieses im fiktionalen Kontext in einer oft differenziert abgestuften Negation. Diese Negation aber hat einen imperativischen Charakter; sie fordert dazu auf, das Positive anderswo als im Umkreis des unmittelbar Vertrauten zu suchen. Diese implizite Aufforderung der Negation ergeht natürlich zunächst an den, für den die negierten Normen das Vertraute sind. Das aber ist der Leser des Romans, dessen Aktivität insoweit beansprucht wird, als er die vom bekannten Horizont sich abkehrende Zielrichtung des Romans als dessen Sinn konstituieren muß. 16 Jochen Vogts Anhang zur Geschichte des Romans ist, neben so mancher Einsicht in literargeschichtliche Zusammenhänge, die vorsichtige Gewißheit geschuldet, daß es trotz all der Vielheit noch möglich sein müsse, so etwas wie einen Leitfaden zu schreiben. 17 Und Franz K. Stanzels Theorie des Erzählens schließlich ist immer dann eine Inspiration gewesen, wenn in seinem Schreiben die typologische Systematik hinter der Konkretion der Beispiele und ihrer Fülle verschwindet. 18 In der Konkretion des jeweiligen Beispiels geht Iser in seiner Zusammenstellung von Aufsätzen und Essays dann allerdings oft noch einen Schritt weiter vielleicht nicht überraschend, denn er sieht seine Abhandlung ja auch als Vorstudien. 19 Im Bereich der Ästhetik basiert die Erzählgeschichte auf Adornos Ästhetischer Theorie, besonders dort, wo sie 16 Wolfgang Iser, Der implizite Leser, S Jochen Vogt, Anhang: Ein (viel zu) kurzer Leitfaden zur Geschichte des Romans, S Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens, besonders etwa S. 221 bis Wolfgang Iser, Der implizite Leser, S
19 mit Kategorien wie Kunstwerk, literarische Form(ung), Material der Kunst, utopisch und ideologisch arbeitet. Dazu kommt der Modellbegriff, wie ihn Jurij M. Lotman entwickelt hat, 20 und ein Verständnis von literarischer Evolution, wie es bei Jurij Tynjanov zu finden ist. 21 Für die Geschichte im nicht-literarischen Sinne greift die Darstellung an vielen, im Einzelnen nicht nachgewiesenen Stellen auf das Konzept wie die Ausführungen von Hans- Ulrich Wehlers Gesellschaftsgeschichte zurück. 22 Ich bin sicher, diese Liste ließe sich noch erweitern. 20 Jurij M. Lotman, Vorlesungen zu einer strukturalen Poetik, besonders S Ergänzend siehe dazu auch schon die zeitlich früheren Arbeiten von Jan Mukařovsky, Kapitel aus der Ästhetik; Studien zur strukturalistischen Ästhetik und Poetik. 21 Jurij Tynjanov, Über die literarische Evolution. 22 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1 und 2. 19
20 Bürgerliche Projektionen Die Botschaft der Tugend hat Wolfgang Martens 1971 sein Buch über die deutschen Moralischen Wochenschriften betitelt und umreißt damit eine nicht nur in ihnen an den Tag gelegte Weltanschauung, die für die Formung bürgerlichen Bewußtseins von entscheidender Bedeutung gewesen ist. Frühformen bürgerlichen Erzählens entwickelten sich denn auch aus dem Kontext der Moralischen Wochenschriften, wie Jürgen Jacobs in seiner Übersichtsdarstellung erläutert hat: Die Moralischen Wochenschriften, die seit etwa 1720 nach englischem Vorbild in Deutschland erscheinen, sind für die Vorbereitung und Ausbreitung der aufklärerischen Literatur von großer Bedeutung. Sie bieten nämlich einem wachsenden bürgerlichen Publikum den Lesestoff, der auf die Lektüre belletristischer Texte überhaupt erst hinleitet. Das geschieht vor allem durch zahlreiche literarische Einlagen, vorzugsweise durch erzählende Partien, die sich bald auf wenige Zeilen beschränken, bald auch über mehrere Stücke des Blatts sich ausbreiten. Die erzählenden Passagen der erbaulichen Periodika bleiben stets auf ein bestimmtes moralisches Thema ausgerichtet. Die Überleitung vom diskursiven Teil der Wochenschrift zum erzählenden wird häufig ohne große Umstände vollzogen. So kann etwa nach Überlegungen zum Thema der sozialen Pflichten oder der Notwendigkeit, sie im wohlverstandenen Eigeninteresse anzuerkennen, mit folgender Wendung ein Beispiel herbeizitiert werden: Ich kenne in einer berühmten Stadt in Preussen zween Kauff-Leute, der eine nennet sich Potrimp, der andere Perkum, welcher Exempel obiger Sätze einiger massen erläutern und bestättigen kann. Die in diesem Satz deutlich spürbare Einbindung der erzählenden Passagen in den didaktischen und demonstrierenden Zusammenhang der Wochenschrift führt dazu, daß die Erzäh-
21 lung meist knapp und ohne atmosphärische oder schmückende Details bleibt. 1 Die Moralischen Zeitschriften der ersten Aufklärungsjahrzehnte konnten so neben französischen Einflüssen zur Grundlage eines Genres werden, das etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts als Moralische Erzählung auch zunehmend in eigenständiger Form in Erscheinung getreten ist. 2 Wie die Moralischen Wochenschriften halfen auch die Moralischen Erzählungen im Prozeß bürgerlicher Selbstfindung: The importance of the moral weeklies in accustoming an everwidening middle-class reading public, and a female reading public in particular, to fiction has been established. They also gave a sense of purpose and identity to a class that was barred from political influence, and turned to journalism and attacking the decadent morality of the aristocracy instead. 3 1 Jürgen Jacobs, Die deutsche Erzählung im Zeitalter der Aufklärung, S. 57. Siehe zum Einfluß der Wochenschriften auch schon Jacobs Monographie Prosa der Aufklärung von 1976, S Siehe zur gattungsgeschichtlichen Grundlegung und zur Entwicklung der moralischen Erzählung besonders Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany. Astburys Monographie aus dem Jahr 2002 ist die erste grundlegende Arbeit in diesem Bereich; sie beschreibt die Besonderheit der Entwicklung der Moralischen Erzählung in Deutschland in stetem Vergleich mit der Entwicklung, die Contes Moraux in Frankreich durchlaufen. Jürgen Jacobs hatte 1981 versucht, einen Überblick über das außerordentlich breite und vielgestaltige Material der Erzählungsliteratur der Aufklärung zu geben und dabei einen großen Komplex Moralischer Erzählungen (mit einer ganzen Reihe von Varianten) unterschieden von dem Typus der Philosophischen Erzählung (die sich vor allem an Voltaire anschließt) und vom Märchen, d.h. vor allem der Feenerzählung. (Jürgen Jacobs, Die deutsche Erzählung im Zeitalter der Aufklärung, S. 57) 3 Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S
22 Was Katherine Astbury als genrespezifische Merkmale der Moralischen Erzählung in Deutschland zusammengetragen hat, wird hier in der Folge an Texten von Christian Fürchtegott Gellert und Johann Gottlob Benjamin Pfeil zu illustrieren versucht. Mit einigen Beispielen soll dann damit begonnen werden, die Grenzen dieses Genres genauer zu bestimmen, denn diese Grenzgänge ermöglichen es, die Spezifik der Moralischen Erzählung als Ausdruck projektiven bürgerlichen Erzählens im 18. Jahrhundert zu veranschaulichen. Gellerts Moralische Charaktere sind ausgeführte kleine Charakterbilder, die Teil seiner ständig wiederkehrenden Moralischen Vorlesungen in Leipzig waren und dann in der postumen Gesamtausgabe von 1774, seinem Wunsch entsprechend, als Sammlung moralischer Charaktere an den Schluß der gesamten Vorlesungen gestellt wurden 4. Sie beanspruchen so einen gewissen erzählerischen Eigenwert. In ihrer Loslösung aus der Eingebundenheit in ein größeres Ganzes entsprechen sie einer Tendenz der Moralischen Erzählungen, die sich seit der Jahrhundertmitte aus dem Rahmen der Moralischen Wochenschriften zu befreien suchen 5 und dann in späteren Werkausgaben von Autoren zusammengefaßt werden. Dieses Für-sich-selber- Stehen der kleinen Erzählung wird zu einem der Kennzeichen der Gattung: The moral tale is usually of limited length and restricted plot, dazu zunächst zunehmend und schließlich ganz in Prosa geschrieben. 6 Gellerts Beispiel- 4 Fritz Behrend, Einleitung des Herausgebers, in: Gellerts Werke, 2. Teil, S. 141, Siehe dazu auch Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S
23 geschichte Regelmäßige Sinnlichkeit, in dem Charakter des Kriton vorgestellet 7 entspricht nicht nur hierin dem sich entwickelnden Genre; auch der Titel der Erzählung gibt den Aspekt an, der im weiteren entwickelt wird. 8 Von Beginn des Erzähltextes an besteht Klarheit über die Position des Erzählers, der die Geschichte oft mit moralisierenden Reflexionen oder allgemeinen Hinweisen auf die menschliche Natur beginnt und auf diese Weise den (Wertungs-)Rahmen für das Erzählte bereitstellt, so auch in Gellerts Skizze, wo die Einleitung zu einer Bestandsaufnahme bürgerlicher Werte gerät: Im gemeinen Leben heißen meistens diejenigen vernünftige, gesittete und ehrbare Menschen, die klug oder arbeitsam genug sind, ihre Handlungen so einzurichten, daß sie Ansehen, Ehre, Bequemlichkeiten und Vergnügungen der Sinne, Reichtümer und die Freiheit erlangen, nach ihrem Geschmacke leben zu können. (RS 174) Was dann in der Form des Erzählerberichts in der dritten Person folgt, scheint der allgemeinen Beschreibung zu entsprechen: Kriton lebt seit zwanzig Jahren auf seinem väterlichen ererbten Rittersitze ohne Familie. Er hat den Ruf eines vernünftigen, arbeitsamen und gastfreien Mannes für sich, und die ganze Gegend preist ihn glücklich. / Er ist stets beschäftiget und hat keine Zeit zu den Ausschweifungen, die der Müßiggang gebiert. (RS 174) Beinahe listenartig werden Stationen aus dem täglichen Leben des Helden zusammengestellt, ein Hinweis darauf, wie sich Erzählen erst entwickeln muß, wie sehr es zu- 7 Gellerts Werke, 2. Teil, S Im folgenden zitiert mit der Sigle RS. 8 Siehe zu diesen und den im folgenden behandelten Merkmalen der Moralischen Erzählung die gute Zusammenstellung in: Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S
24 nächst noch eingeschrieben bleibt in die Formen der Disputation und des Exempels. Am Ende einer durchweg positiven Beschreibung wendet sich der Erzähler dann an den Leser, wiederum ein üblicher Zug für die Moralischen Erzählungen: 9 Und was hat man auch an diesem Leben des Kriton auszusetzen? Nicht viel, wie es scheint. Alles stimmt ja unter sich und mit einer gewissen Hauptabsicht überein. Aber was ist seine Hauptabsicht? Warum lebt er? Warum sorgt und denkt und arbeitet er so übereinstimmend? (RS 175) Im fingierten Zwiegespräch mit dem Leser kommt der Erzähler in der Folge zu einem Ergebnis, das seine Zweifel bestätigt und zugleich eine weitergehende Forderung gelingender Bürgerlichkeit entwirft, indem er darlegt, wie diese auf mehr als nur Eigennutz aufbauen sollte: [Kriton] lebte bei allen seinen Anstalten eigentlich für sich und nie mit Absicht für das Beste der Welt; er lebte für seinen Eigennutz und nicht für die Tugend. (RS 175) Im abschließenden Absatz entwirft der Erzähler dann die Grundzüge dieser anderen, alternativen Lebensform. Dies geschieht in Form rhetorischer Fragen, damit der Leser mit seiner Urteilskraft wiederum am didaktischen Prozeß beteiligt wird (RS 175). 10 Doch damit nicht genug. In einem 9 Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S. 12: Although first-person narratives or letterforms are sometimes used to ensure that the reader is involved in the action, the majority of moral tales up to the 1790s adopt a third-person narrative form and the emphasis is more on the relationship between the narrator and the reader than on the creation of a plausible relationship between the narrator and story. 10 Hätte Kriton, wenn er vernünftig sein wollen, wohl die Hauptabsicht seines Lebens vergessen können? Konnte er nicht wissen, daß seine Seele edler wäre als sein Körper, daß die guten Eigenschaften des Herzens etwas Wichtigers wären als Rittersitze, als 24
25 zweiten Teil wird nun all dies in einem positiven Gegenbild konkretisiert, dessen Unterüberschrift die Polarität der beiden Erzählhälften bewußt hält: Euphemon, das Gegenteil des Kriton (RS 176). Mit vielen Aspekten entwirft nun der Erzähler wiederum listenartig Euphemons Lebensführung und seine Errungenschaften, stellt immer wieder auch Vergleiche mit Kriton an, bevor er alles in einer moralisierenden Sentenz und dem Appell an den Leser zusammenfaßt: Er hat nicht bloß seine Haushaltung nützlich geführt; er hat auch sein Vermögen und sein Ansehen nach seinem Gewissen, zu seinem und andrer Glücke verwandt. Wie ehrwürdig, aber wie selten ist ein Euphemon! Wiewohl Plot- und Figurenentwicklung hinter der Botschaft des Textes zurückstehen, ist schon den frühen Moralischen Erzählungen der Einbezug der Leser eine zentrale Angelegenheit. 11 Im Verlauf der Geschichte des Genres wird solches Ansprechen des Lesers von den recht kruden, ihn diskursiv einbindenden Formen weiterentwickelt zu einem psychologischen Einbezogensein der Lesenden, die wie auch die Figuren dann zunehmend zum Fokus des Erzählens werden. 12 eine gute Tafel und die Bewunderung der Nachbarn? Daß es weiser wäre, Güter zu erwerben, die uns im Tode bleiben, als solche, die wir in wenig Jahren verlassen müssen? Daß es mehr Würde sei, ein weiser, guttätiger, gemeinnütziger und gottseliger Mann zu sein, als der Reichste im Lande? Daß die Übungen der Pflichten gegen die Menschen und den Schöpfer unendlich mehr Wert haben als die strengste Ausübung der Regeln der Wirtschaft? (RS 175) 11 Jörg Schönert, Fragen ohne Antwort, S. 228: Der totale Konsensus mit dem Leser ist dem bürgerlichen Schriftsteller das Wichtigste. 12 Siehe dazu auch Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S
26 Am Ende von Gellerts Charakterbild ist die moralische Lehre so klar, daß es keiner weiterführenden moralisierenden Reflexion mehr bedarf. Die Entwicklung und überzeugende Darbietung einer Position aus der Kritik ist ein wesentlicher Bestandteil dieses projektiven Erzählens. Konkretion des Entwurfs hilft dabei. Und so entstehen Erzählungen, die im Beispiel das Allgemeine veranschaulichen. Die Moralische Erzählung in ihrer frühen Entwicklungsstufe versteht diesen Anspruch auf Allgemeingültigkeit ganz programmatisch. Das moralisch richtige Verhalten des Einzelnen, zur Maxime des Handelns aller erklärt, gewährleiste den Fortschritt für alle. Jochen Schulte-Sasse hat dies im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen zum Drama Lessings als Moralisierungsprogramm bezeichnet, mit dessen Hilfe die literarische Intelligenz nach 1745/50 den Charakter absolutistischer Machtausübung qualitativ verändern will. 13 Die Privatmoral wird für das Bürgertum zum Hebel, mit dem man die feudalen Verhältnisse mit ihren starren Setzungen glaubt unterlaufen zu können. Die Erzähler in den Moralischen Geschichten wie die projektierten Leser sind optimistisch, den Umbau der feudalen in die bürgerliche Ordnung erreichen zu können. Am Projekt der Aufklärung wird in diesen frühen Moralischen Erzählungen utopisch und mit steigendem bürgerlichen Selbstwertgefühl weitergeschrieben. Das Selbstbewußtsein der Aufklärer ist stark, der Fortschrittsoptimismus ungebrochen: man wird die Welt schon bürgerlich einrichten können, allen Hindernissen und Umwegen zum Trotze. 13 Jochen Schulte-Sasse, Drama, S Siehe dort auch S und die Ausführungen zu Miß Sara Sampson (1755), S. 456 bis
27 Johann Gottlob Benjamin Pfeils Versuch in moralischen Erzählungen ist die erste Sammlung, die den Genretitel in Deutschland trägt sie ist 1757, also nur zwei Jahre nachdem Marmontel seine Contes Moraux im Mercure de France zu veröffentlichen begann, erschienen und damit früher als die erste Sammlung dieses in Deutschland oft als Muster angesehenen französischen Autors 14 und auch früher als die erste Übersetzung Marmontels ins Deutsche (1762). Pfeils Moralische Erzählungen ließen mithin auch kaum den Einfluß Marmontels, dafür aber unverkennbar den von Voltaires Contes philosophiques und Richardsons Romanen erkennen, hat Jacobs festgehalten. 15 Der Triumph der tugendhaften Liebe ist eine Erzählung aus Pfeils Sammlung, an der die Weiterentwicklung der Moralischen Erzählung veranschaulicht werden kann. 16 Die den Aspekt vorgebende Überschrift, eine allgemein den Werthorizont aufbauende Erzählerreflexion am Eingang der Erzählung, den Einbezug des Lesers (TtL 36) all dies hat diese Erzählung mit den Charakterskizzen von Gellert gemein. Deutlich ausgewiesener sind in Pfeils projektivem Erzähltext aber die erzählerischen Momente: es gibt eine Handlung, die sich über mehrere Stationen entwickelt. Geschildert wird die Konfliktsituation, die Elisabeth Harris, die einzige Tochter eines Mannes von Vermögen und vielen lobenswürdigen Eigenschaften (TtL 36), in ihrer wechselhaften Beziehung zu dem jungen Baronet Thomas Hill und zu Lord Danby durchlebt. Hill 14 Alexander Košenina, Nachwort, S. 89. Siehe dazu auch Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S Jürgen Jacobs, Die deutsche Erzählung im Zeitalter der Aufklärung, S Johann Gottlob Benjamin Pfeil, Versuch in moralischen Erzählungen, S Im folgenden zitiert mit der Sigle TtL. 27
28 wird dabei als ein moralischer Leichtfuß dargestellt, der nur ohne weiteres wiederholt zum Opfer der selbst ehebrüchigen Lady Digby werden kann, einer traditionell höfischen Figur, deren Ränkespiel sie problemlos zum Bösewicht der Erzählung abstempelt. Von Danby sagt der Erzähler, als er ihn einführend charakterisiert: Der Lord besaß weniger Witz aber mehr Verstand als sein Freund. Er vermehrte seine Tugenden noch durch eine gewisse Beständigkeit, welche dem Baronet mangelte. Allein seine Miene war ernsthafter, seine Bildung weniger einnehmend, und er verband jederzeit den Liebhaber mit dem Philosophen. (TtL 37f.) Schon aus dieser Anlage wird deutlich, wie viel komplexer die erzählte Geschichte in Pfeils Text ist. Es geht nicht um die bloße Kontrastierung von Gut und Böse, sondern nun bereits um Charakterentwicklung und auch um Zwischentöne. Der Erzähler bleibt demgegenüber allerdings klar in seiner ordnenden und Übersicht gewährleistenden Funktion, wird somit zum Garanten eines bürgerlichen Werthorizontes, der hinter dem erzählten Geschehen sich aufbaut. Erzählerkommentare wie Der verständige Mann liest in dem Herzen der Verstellung, und also mit noch weniger Müh in den Herzen der Liebenden, die niemals von einer gewissen Offenherzigkeit leer seyn können (TtL 38) bestätigen dies. 17 Auch Warnungen, die der Erzähler gegenüber dem Figurenverhalten ausspricht, weisen in die- 17 Andere Beispiele für solche verallgemeinernden und urteilenden Erzählerkommentare sind: Einer gebrandmarkten Tugend ist der Anblick einer reinen unschuldigen Tugend, der sie ehedessen gleich war, unerträglich. (TtL 40) Oder: Der Baronet empfieng von derjenigen seine Bestrafung, um derenwillen er sie verdienet hatte. (TtL 44) 28
29 selbe Richtung (TtL 39). Es scheint darum auf den ersten Blick richtig, wenn ein Kritiker urteilt: Die Geschichte zeigt exemplarisch die Spannung zwischen Kabale und Liebe, Rache und Tugend, wie sie dem Leser Mitte des 18. Jahrhunderts häufiger begegnet. Die didaktische Botschaft des Textes tritt deutlich zu Tage und verhindert nachhaltig jede Illusion. Zu beweisen ist die These, daß das größte gegenwärtige Glück bloß der Vorbothe eines desto größern zukünftigen Unglücks zu seyn pflegt. 18 Wichtiger ist demgegenüber allerdings, daß der Erzähler seine Lehre in Beziehung setzt zum Erfahrungsstand der weiblichen Hauptfigur, ja daß er uns überzeugen will, daß wir uns in einer ähnlichen Lage wie Elisabeth befinden: Die junge Lady zählte mit zuversichtlichem Blick sehr weit in die Zukunft hinaus, lauter heitre Tage der Zufriedenheit, und der Freude. Ohngeachtet ihrer Unglücksfälle hatte sie doch noch nicht gelernt (und welcher Mensch lernt dieß jemals!) daß das größte gegenwärtige Glück bloß der Vorbothe eines desto größern zukünftigen Unglücks zu seyn pflegt. (TtL 45f.) Und auch ganz am Ende der Erzählung wird der Erzählerkommentar, der den gleichen Akkord anschlägt wie seine einleitende allgemeine Erörterung, 19 in die Perspektive der Figur hineinverlegt, wenn es heißt: [Der Baronet] erkannte in den Armen seiner Gemahlin den Unterschied der wahren und falschen Liebe. Diese liebenswürdige Gemahlin empfand jetzund, daß endlich die Tugend über das Laster triumphirt, und niemals leidet, ohne zuletzt belohnt zu werden. (TtL 50) Die teleologische Ausrichtung der Schlußposition, die davon weiß, daß am Ende des tugendhaften Weges der 18 Alexander Košenina, Nachwort, S Nichts rührt das menschliche Herz mit einer größern Bewunderung als die leidende Tugend, welche mit ihrem Unglück ringt, sich über dasselbe empor zu heben. (TtL 36) 29
30 Lohn und das Glück für den Leidenden stehen, widerspricht auffällig dem vorhergehenden Lehrsatz, der von der Wechselhaftigkeit allen Glücks ausging und damit ein markant negatives Weltverständnis im Vergleich zur optimistischen Tugendlehre der Aufklärung darbot. Charakterentwicklung paßt nicht zum fatalistischen Weltbild, das der Erzähler an der früheren Stelle vertrat. Dieser Widerspruch entgeht Košenina, der allerdings berechtigterweise andere Schwachpunkte der Erzählung herausstellt: Die Versöhnungsszenen [ ] sind so unwahrscheinlich wie die kühnen Konstruktionen einer doppelten Eheschließung, der grenzenlosen Freundschaft des tugendhaften Mitbewerbers um die Liebe des Fräuleins oder der großherzigen Einwilligung ihres Vaters in das ganze Unglück. Daß der verdorbene Gemahl am Ende wirklich und dauerhaft den Unterschied der wahren und falschen Liebe erkennt, ist mehr als zweifelhaft. 20 Doch versteht Košenina zu Recht den Titel Der Triumph der tugendhaften Liebe nicht als Ironie, denn so sagt er diese finde man bei Pfeil sonst eigentlich nicht. 21 Die 20 Alexander Košenina, Nachwort, S Alexander Košenina, Nachwort, S. 97. Diese Skepsis gegenüber einer ironisch-satirischen Leseweise kann auch durch das Vorwort, das Pfeil seinem Versuch voranstellt, weiter untermauert werden. Dort heißt es im Unterschied zu den Romanen über die Erzählungen: Sie sind von dem Vorwurf wegen der Verderbung der Sitten völlig frey. Dieß ist der vornehmste Ruhm, den ich bey der Ausarbeitung derselben zu erhalten gewünscht habe [ ]. Jedes einzelne Stück hat die Ausführung eines gewissen moralischen Satzes zum Gegenstande. Ich habe jederzeit geglaubt, daß alle Arbeiten von dieser Art strafbar sind, wenn sie bloß den Leser vergnügen, ohne den Nutzen desselben mit diesem Vergnügen zu verbinden. (An den Leser, in: Johann Gottlob Benjamin Pfeil, Versuch in moralischen Erzählungen, S. 7f.) Astburys Ausführungen zu Pfeil sind in diesem Fall nicht hilfreich, denn sie bleiben zu allgemein und können damit zur Beurteilung der Spezifik 30
31 widerstreitenden und unwahrscheinlichen Momente der Erzählung machen nicht die Erzählstruktur dieser frühen Moralischen Erzählung aus. Es handelt sich eher um Unfälle, wie sie sich allgemein leicht in projektives Erzählen einschleichen, weil der Entwurf als Positionssetzung selten ganz frei von Ideologie ist. Was für die Moralische Erzählung als Positionsbestimmung wichtig bleibt zu erinnern, hat Astbury in allgemeiner Form zusammengefaßt: The follies, foibles and injustices of society receive as much attention as social comment or the conflict between vice and virtue because the moral tale aims to show the interaction between morality and mores at a time when people believed virtue was une aptitude sociale. As a result happy endings are often achieved only once the characters have gained a sense of social responsibility. The misguided are shown a middle course away from extremes and one which is firmly situated within society, rather than outside its norms and constraints. 22 Zugleich scheint im Widersprüchlichen von Pfeils Erzählung auch ein Unterschied von Bedeutung zu sein, der die deutsche Moralische Erzählung von ihrem französischen Pendant trennt. In Deutschland folgt die Moralische Erzählung dem, was sich als Konzentration auf das Individuum herausbildet: die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse hängt demnach ab von der Genese des bürgerlichen Individuums. Die Contes Moraux sind demgegenüber eher Sittenschilderungen, die zugleich weniger strikt auf einen enggefaßten Begriff von Moral rekurrieren. 23 dieser Erzählung nichts beitragen (siehe Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S ). 22 Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S. 13f. 23 Siehe dazu Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S. 14, 71f., und
32 Waren die Verwicklungen und überraschenden Wendungen in Pfeils Erzählung in Form des Erzählerberichts dargestellt, so geht die Moralische Erzählung Das wahre Glück ist in der Seele der Rechtschaffenen von Sophie von La Roche 24 noch einmal einen Schritt weiter in der Ausdifferenzierung des Genres. Wie schon der programmatische Titel der Erzählung zeigt, wird Glück nicht mehr im gesellschaftlichen Sein des Individuums, etwa in seiner Rechtschaffenheit gesucht, sondern ist zur verinnerlichten Kategorie geworden, zu finden nun in der Seele des Rechtschaffenen. Sophie von La Roches Erzählungen stehen zwar unter dem Eindruck Marmontels, aber sie modifiziert dessen Muster: Sie verstärkt die empfindsamen Motive, simplifiziert meist Psychologie und Handlungsführung und akzentuiert ihre pädagogischen Absichten deutlicher. 25 Diese Wende zur Innerlichkeit, mit ihrer Basis im Pietismus, ist eine generelle Entwicklung der Empfindsamkeit der siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts. 26 Sophie von La Roche schrieb seit 1772 Erzählungen, die meisten wurden allerdings erst in ihren Sammlungen Pomona für Teutschlands Töchter (1783 und 1784) Moralische Erzählungen der Frau Verfasserin der Pomona, [d.i. Sophie von La Roche], Zweyte Sammlung, S Im folgenden zitiert mit der Sigle WG. 25 Jürgen Jacobs, Die deutsche Erzählung im Zeitalter der Aufklärung, S. 58f. 26 Siehe dazu schon Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S. 82, die in ihrer Charakterisierung der Bewegung allerdings zu weit geht, wenn sie sagt: Pietism led to a psychological examination of people s motivation and gave the middle classes a new sense of confidence. 27 Siehe Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S
33 und dann in den Moralischen Erzählungen veröffentlicht, aus deren zweitem Band von 1784 der hier näher angesehene Text ist. Die Tendenz zur Verinnerlichung spiegelt sich im Erzählverfahren, wo der Erzählerbericht an vielen Stellen durch Dialoge oder Reflexionen der Figuren ersetzt wird, so Raum schaffend für eine Introspektion, wie sie in den frühen Jahren der Moralischen Erzählungen nicht zu finden ist. Dies bedeutet aber nun keineswegs, daß der Erzähler hinter den Figuren zurücktritt wie wir es zum Teil wenigstens in Goethes Werther finden. La Roches Erzählen kennt den allwissenden Erzähler noch, die Erzählung Das wahre Glück ist in der Seele des Rechtschaffenen wird geradezu von einem Erzählerbericht über die Kindheit, Jugend und Erziehung eines reichen Englischen Erben mit dem sprechenden Namen Weldone eingeleitet (WG 1f.), bevor der Held der Erzählung das erste Mal selbst zu Wort kommt (WG 3). Weldone hat nach den Kriterien der Aufklärung die bestmögliche Erziehung erfahren: auf einem Landgut, weit von der Hauptstadt und der Menge ihrer gekünstelten und verdorbenen Menschen. Eltern und Lehrer geben ihm alles, von den Grundsätzen der Ehre, den moralischen Idealen bis hin zu den edlen feinen Gefühlen für das Schöne der Natur, für Wahrheit und Wohlthätigkeit. Dies ideale Umfeld setzt sich bis auf die Ebene der Hausbedienten fort, die alle [ ] lauter gute und in ihrem Gefach vortrefliche Leute waren (WG 1). Und trotz all dieser Vorkehrungen scheitert das Erziehungsprojekt, findet darin seine Grenze, daß die Welt außerhalb dieses Schutzraumes eben so wenig diesen Idealen entspricht, was dazu führt, daß Weldone alles von einer düstern Seite ansah (WG 6), Mißtrauen und Abscheu 33
34 fühlt (WG 3). Auch seine Reise durch Europa ist von dieser negativen Grunderwartung bestimmt (WG 4f.), droht damit zum Gegenteil einer produktiven Bildungsreise zu werden, wenn er auch hoffnungsvollere Momente gerade bei Bauren und Handwerkern findet, bey denen er einen vorzüglichen Fleiß oder Geschicklichkeit wahrnahm (WG 5). Doch trotz dieser Aufwertung des ländlichen Bereichs einem für Sophie von La Roches Erzählen charakteristischen Merkmal 28 ist das Urteil des Erzählers über Weldones Misanthropie eindeutig: Auf diese Art kann auch das edelste Herz eine schiefe Wendung nehmen, eigensinnig und ungerecht werden, wobey dann auch immer das eigene Glück des Lebens verlohren geht, wie es bey Sir Weldone geschah. (WG 7) Auf seiner Reise zeigt Weldone allerdings bereits seine Wohltätigkeit gegenüber den Armen, und wo ihm in einem Dorf Mangel, Arbeitsamkeit und Reinlichkeit begegnen und ein empfangenes Dankesschreiben sein Herz wieder den verbrüderten Mitmenschen öffnet (WG 13f.), ist der Grund bereitet, Weldone aus seiner Verirrung zu befreien. Der ganze Rest der Geschichte (WG 14-39) schildert dann wenige Tage, die Weldone bei der Familie Felsen verbringt und in deren Nähe er seine angebohrne Menschenfreundlichkeit wieder aufwachen fühlt (WG 24). Das Verhältnis von erzählter Zeit und Erzählzeit verschiebt sich deutlich in Richtung auf eine Erzähldehnung. Felsen, der selbst einen Sturm (WG 19) durchlebt hat, veranschaulicht Weldone, wie Freundschaft und das Zeugnis des Herzens einem auf dem Lande Glück verschaffen können (WG 20f.). Nur gelegentlich finden sich noch knappe Erzählerkommentare (WG 24, 36); der Erzählerbe- 28 Siehe Katherine Astbury, The Moral Tale in France and Germany, S
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther. Reclam Lektüreschlüssel
 Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLER Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther Von Mario Leis Philipp Reclam jun. Stuttgart
Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLER Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther Von Mario Leis Philipp Reclam jun. Stuttgart
Naturverständnis und Naturdarstellung in Goethes "Die Leiden des jungen Werther"
 Germanistik Thorsten Kade Naturverständnis und Naturdarstellung in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Das Naturverständnis innerhalb der Epochen
Germanistik Thorsten Kade Naturverständnis und Naturdarstellung in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Das Naturverständnis innerhalb der Epochen
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN
 09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
Elemente der Narratologie
 Wolf Schmid Elemente der Narratologie 2., verbesserte Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis I. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität ung Ereignishaftigkeit
Wolf Schmid Elemente der Narratologie 2., verbesserte Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis I. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität ung Ereignishaftigkeit
Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität
 Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
kultur- und sozialwissenschaften
 Univ.-Prof. Dr. Martin Huber Methoden der Textanalyse Überarbeitete Fassung vom März 2011 kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Univ.-Prof. Dr. Martin Huber Methoden der Textanalyse Überarbeitete Fassung vom März 2011 kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Inhalt. II. Hegels Phänomenologie des Geistes" Interpretation der Einleitung" und der Teile Bewußtsein", Selbstbewußtsein" und Vernunft"
 Inhalt I. Erläuternde Vorbemerkungen zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Hegels Phänomenologie des Geistes" und zum Zugang über eine phänomenologisdie Interpretation /. Die phänomenologische Methode
Inhalt I. Erläuternde Vorbemerkungen zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Hegels Phänomenologie des Geistes" und zum Zugang über eine phänomenologisdie Interpretation /. Die phänomenologische Methode
Inklusion - nur ein Märchen?
 Pädagogik Regina Weber Inklusion - nur ein Märchen? Examensarbeit Inklusion nur ein Märchen? Schriftliche Hausarbeit mit Video-Anhang im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik,
Pädagogik Regina Weber Inklusion - nur ein Märchen? Examensarbeit Inklusion nur ein Märchen? Schriftliche Hausarbeit mit Video-Anhang im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik,
1 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnittäus ders.: Kritik
 In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
Geisteswissenschaft. Robin Materne. Utilitarismus. Essay
 Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Wolf Schmid. Ele01ente der. N arratologie. 3., erweiterte und überarbeitete Auflage. De Gruyter
 Wolf Schmid Ele01ente der N arratologie 3., erweiterte und überarbeitete Auflage De Gruyter Vorwort... - 1. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität............ 1 a) Der klassische und
Wolf Schmid Ele01ente der N arratologie 3., erweiterte und überarbeitete Auflage De Gruyter Vorwort... - 1. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität............ 1 a) Der klassische und
Kabale und Liebe - Lady Milford und ihre Rolle im Stück
 Germanistik Johanna Brockelt Kabale und Liebe - Lady Milford und ihre Rolle im Stück Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das bürgerliche Trauerspiel... 3 2.1. Zur Entstehung des bürgerlichen
Germanistik Johanna Brockelt Kabale und Liebe - Lady Milford und ihre Rolle im Stück Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das bürgerliche Trauerspiel... 3 2.1. Zur Entstehung des bürgerlichen
Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen.
 Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Erlaube dir Erlaube dir
 Lebst du dein eigenes Leben oder das Leben deiner Glaubenssätze? Erlaubst du dir deine Freiheit und bringst den Mut auf, dein eigenes Leben zu führen? Nimmst du dir die innere Freiheit, ganz du selbst
Lebst du dein eigenes Leben oder das Leben deiner Glaubenssätze? Erlaubst du dir deine Freiheit und bringst den Mut auf, dein eigenes Leben zu führen? Nimmst du dir die innere Freiheit, ganz du selbst
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht!
 Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Friedrich Schiller (1759 1805) 1 Schillers Rezeption von Kants Pflichtbegriff, satirisch
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Friedrich Schiller (1759 1805) 1 Schillers Rezeption von Kants Pflichtbegriff, satirisch
Beschreibe die Hauptfigur. Inwiefern empfindest du diese Figur als wirklich?
 Wie würdest du die Figur im Buch beschreiben? Wo zeigt die Figur eine bestimmte Eigenschaft? Wie verändert sich eine Figur im Laufe der In welcher Weise trägt die Persönlichkeit einer Figur zu deren Erfolg
Wie würdest du die Figur im Buch beschreiben? Wo zeigt die Figur eine bestimmte Eigenschaft? Wie verändert sich eine Figur im Laufe der In welcher Weise trägt die Persönlichkeit einer Figur zu deren Erfolg
Aristoteles über die Arten der Freundschaft.
 1 Andre Schuchardt präsentiert Aristoteles über die Arten der Freundschaft. Inhaltsverzeichnis Aristoteles über die Freundschaft...1 1. Einleitung...1 2. Allgemeines...2 3. Nutzenfreundschaft...3 4. Lustfreundschaft...4
1 Andre Schuchardt präsentiert Aristoteles über die Arten der Freundschaft. Inhaltsverzeichnis Aristoteles über die Freundschaft...1 1. Einleitung...1 2. Allgemeines...2 3. Nutzenfreundschaft...3 4. Lustfreundschaft...4
Jürgen Eiben Von Luther zu Kant- Der deutsche Sonderweg in die Moderne
 Jürgen Eiben Von Luther zu Kant- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Jürgen Eiben von Luther zu Kant-- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Eine soziologische Bebachtung ~ Springer Fachmedien Wiesbaden
Jürgen Eiben Von Luther zu Kant- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Jürgen Eiben von Luther zu Kant-- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Eine soziologische Bebachtung ~ Springer Fachmedien Wiesbaden
Vorlesung. Willensfreiheit. Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472:
 Vorlesung Willensfreiheit Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember 2005 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der
Vorlesung Willensfreiheit Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember 2005 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der
Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
 Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?
Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Das Gute, das Böse und die Wissenschaft
 Evandro Agazzi Das Gute, das Böse und die Wissenschaft Die ethische Dimension der wissenschaftlich-technologischen Unternehmung Akademie Verlag Inhalt Vorwort 11 Einleitung 15 Die Autonomie der Wissenschaft
Evandro Agazzi Das Gute, das Böse und die Wissenschaft Die ethische Dimension der wissenschaftlich-technologischen Unternehmung Akademie Verlag Inhalt Vorwort 11 Einleitung 15 Die Autonomie der Wissenschaft
Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen"
 Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Herrschaft und Knechtschaft
 Geisteswissenschaft Maximilian Reisch Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Herrschaft und Knechtschaft Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Vorbereitung zur Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft
Geisteswissenschaft Maximilian Reisch Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Herrschaft und Knechtschaft Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Vorbereitung zur Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS
 DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
WOZU DIENT PROJEKTIVE GEOMETRÍE? WELCHE DENKKRÄFTE WERDEN DURCH SIE ENTWICKELT? Ana Ayllón Cesteros Escuela Libre Micael Las Rozas, España
 WOZU DIENT PROJEKTIVE GEOMETRÍE? WELCHE DENKKRÄFTE WERDEN DURCH SIE ENTWICKELT? Ana Ayllón Cesteros Escuela Libre Micael Las Rozas, España Es ist sonderbar, dass ich, obwohl ich mich nicht genau an den
WOZU DIENT PROJEKTIVE GEOMETRÍE? WELCHE DENKKRÄFTE WERDEN DURCH SIE ENTWICKELT? Ana Ayllón Cesteros Escuela Libre Micael Las Rozas, España Es ist sonderbar, dass ich, obwohl ich mich nicht genau an den
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN
 Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Inhalt. Das Drama Grundlagenkapitel Dramenanalyse Übungskapitel Vorwort
 Inhalt Vorwort Das Drama... 1 Grundlagenkapitel Dramenanalyse... 5 Georg Büchner: Leonce und Lena... 5 Dramenauszug 1... 6 Aufgabenstellung... 8 1 Reflexion des Szeneninhalts, Klärung der Situation...
Inhalt Vorwort Das Drama... 1 Grundlagenkapitel Dramenanalyse... 5 Georg Büchner: Leonce und Lena... 5 Dramenauszug 1... 6 Aufgabenstellung... 8 1 Reflexion des Szeneninhalts, Klärung der Situation...
Neville Goddard - Grundlagen
 NevilleGoddard Neville Goddard - Grundlagen BEI so einem riesigen Thema ist es in der Tat schwierig, in ein paar hundert Worten zusammenzufassen, was ich als die grundlegenden Ideen betrachte, auf die
NevilleGoddard Neville Goddard - Grundlagen BEI so einem riesigen Thema ist es in der Tat schwierig, in ein paar hundert Worten zusammenzufassen, was ich als die grundlegenden Ideen betrachte, auf die
Karl Marx ( )
 Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Frauenfiguren im Leben und Werk Heinrich von Kleists
 Germanistik Lena Kaiser Frauenfiguren im Leben und Werk Heinrich von Kleists Studienarbeit 1. Einleitung... 2 2. Das Frauenbild um 1800... 3 3. Heinrich von Kleist und die Frauen... 4 3.1 Kindheit, Jugend
Germanistik Lena Kaiser Frauenfiguren im Leben und Werk Heinrich von Kleists Studienarbeit 1. Einleitung... 2 2. Das Frauenbild um 1800... 3 3. Heinrich von Kleist und die Frauen... 4 3.1 Kindheit, Jugend
"Die Wissenschaft des Reichwerdens"
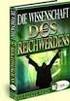 "Die Wissenschaft des Reichwerdens" von Wallace D. Wattles Interpretation und Zusammenfassung von Wolfram Andes [1] "Die Wissenschaft des Reichwerdens" Interpretation und Zusammenfassung von Wolfram Andes
"Die Wissenschaft des Reichwerdens" von Wallace D. Wattles Interpretation und Zusammenfassung von Wolfram Andes [1] "Die Wissenschaft des Reichwerdens" Interpretation und Zusammenfassung von Wolfram Andes
Inhalt. Erzählen Kompetenzcheck: Erzählen Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern
 Inhalt Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern Erzählen... 1 1 Die Teile einer Erzählung gestalten... 1 1.1 Grundlagen des Erzählens... 2 1.2 Wie ist eine gute Erzählung aufgebaut?... 3 1.3 Die Einleitung...
Inhalt Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern Erzählen... 1 1 Die Teile einer Erzählung gestalten... 1 1.1 Grundlagen des Erzählens... 2 1.2 Wie ist eine gute Erzählung aufgebaut?... 3 1.3 Die Einleitung...
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien
 Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien von Remigius Bunia ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien von Remigius Bunia ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Einführung in die Erzähltextanalyse
 Einführung in die Erzähltextanalyse Bearbeitet von Matthias Aumüller, Benjamin Biebuyck, Anja Burghardt, Jens Eder, Per Krogh Hansen, Peter Hühn, Felix Sprang, Silke Lahn, Jan Christoph Meister 1. Auflage
Einführung in die Erzähltextanalyse Bearbeitet von Matthias Aumüller, Benjamin Biebuyck, Anja Burghardt, Jens Eder, Per Krogh Hansen, Peter Hühn, Felix Sprang, Silke Lahn, Jan Christoph Meister 1. Auflage
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Interpretation zu Kleist, Heinrich von - Michael Kohlhaas
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Kleist, Heinrich von - Michael Kohlhaas Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de königs erlä uterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Kleist, Heinrich von - Michael Kohlhaas Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de königs erlä uterungen
Sprachwissenschaft und Literatur
 Sprachwissenschaft und Literatur Berliner Lehrbücher Sprachwissenschaft Band 3 Jesús Zapata González Sprachwissenschaft und Literatur Ein Einstieg in die Literaturtheorie Bibliografische Information Der
Sprachwissenschaft und Literatur Berliner Lehrbücher Sprachwissenschaft Band 3 Jesús Zapata González Sprachwissenschaft und Literatur Ein Einstieg in die Literaturtheorie Bibliografische Information Der
Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik"
 Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Metafiktionalität und Metalepsen in Daniel Kehlmanns "Ruhm"
 Germanistik Andreas Schlattmann Metafiktionalität und Metalepsen in Daniel Kehlmanns "Ruhm" Eine vergleichende Analyse der Erzählungen "In Gefahr" [I] und [II] Studienarbeit Metafiktionalität und Metalepsen
Germanistik Andreas Schlattmann Metafiktionalität und Metalepsen in Daniel Kehlmanns "Ruhm" Eine vergleichende Analyse der Erzählungen "In Gefahr" [I] und [II] Studienarbeit Metafiktionalität und Metalepsen
Der deutsche Bildungsroman
 Der deutsche Bildungsroman Gattungsgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert Von Jürgen Jacobs und Markus Krause Verlag C.H.Beck München Inhalt Vorwort 11 ARBEITSBEREICH I Grundlegendes zum Gattungsbegriff
Der deutsche Bildungsroman Gattungsgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert Von Jürgen Jacobs und Markus Krause Verlag C.H.Beck München Inhalt Vorwort 11 ARBEITSBEREICH I Grundlegendes zum Gattungsbegriff
-&-/3S. Johann Friedrich Herbart SYSTEMATISCHE PÄDAGOGIK. eingeleitet, ausgewählt und interpretiert von Dietrich Benner. iig.
 Johann Friedrich Herbart -&-/3S SYSTEMATISCHE PÄDAGOGIK eingeleitet, ausgewählt und interpretiert von Dietrich Benner iig Klett-Cotta Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 13 1.1 Zur Biographie Herbarts als
Johann Friedrich Herbart -&-/3S SYSTEMATISCHE PÄDAGOGIK eingeleitet, ausgewählt und interpretiert von Dietrich Benner iig Klett-Cotta Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 13 1.1 Zur Biographie Herbarts als
Bernd Prien. Kants Logik der Begrie
 Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Poetische Vernunft. Moral und Ästhetik im Deutschen Idealismus. Bearbeitet von Hans Feger
 Poetische Vernunft Moral und Ästhetik im Deutschen Idealismus Bearbeitet von Hans Feger 1. Auflage 2007. Buch. x, 622 S. Hardcover ISBN 978 3 476 02065 9 Format (B x L): 17 x 24,4 cm Gewicht: 1251 g Weitere
Poetische Vernunft Moral und Ästhetik im Deutschen Idealismus Bearbeitet von Hans Feger 1. Auflage 2007. Buch. x, 622 S. Hardcover ISBN 978 3 476 02065 9 Format (B x L): 17 x 24,4 cm Gewicht: 1251 g Weitere
Hans Ineichen. Philosophische Hermeneutik. Verlag Karl Alber Freiburg/München
 Hans Ineichen Philosophische Hermeneutik Verlag Karl Alber Freiburg/München Inhalt Einleitung 17 A. Systematische Darstellung einer philosophischen Hermeneutik 21 /. Was ist philosophische Hermeneutik?
Hans Ineichen Philosophische Hermeneutik Verlag Karl Alber Freiburg/München Inhalt Einleitung 17 A. Systematische Darstellung einer philosophischen Hermeneutik 21 /. Was ist philosophische Hermeneutik?
Martin Huber Nicolas Pethes Ulf-Michael Schneider. Grundlagen der Literaturwissenschaft. kultur- und sozialwissenschaften
 Martin Huber Nicolas Pethes Ulf-Michael Schneider Grundlagen der Literaturwissenschaft kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Martin Huber Nicolas Pethes Ulf-Michael Schneider Grundlagen der Literaturwissenschaft kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Vernunft und Temperament Eine Philosophie der Philosophie
 1 Unfertiges Manuskript (Stand November 2017) Bitte nicht zitieren oder weiterleiten Vernunft und Temperament Eine Philosophie der Philosophie LOGI GUNNARSSON 2 Das Philosophieren ist die Erkundung des
1 Unfertiges Manuskript (Stand November 2017) Bitte nicht zitieren oder weiterleiten Vernunft und Temperament Eine Philosophie der Philosophie LOGI GUNNARSSON 2 Das Philosophieren ist die Erkundung des
Vernunft und Temperament Eine Philosophie der Philosophie
 Unfertiges Manuskript (Stand Oktober 2016) bitte nicht zitieren oder darauf verweisen Vernunft und Temperament Eine Philosophie der Philosophie LOGI GUNNARSSON Die Geschichte der Philosophie ist weitgehend
Unfertiges Manuskript (Stand Oktober 2016) bitte nicht zitieren oder darauf verweisen Vernunft und Temperament Eine Philosophie der Philosophie LOGI GUNNARSSON Die Geschichte der Philosophie ist weitgehend
Heines Reise von München nach Genua
 Germanistik Silvia Schmitz-Görtler Heines Reise von München nach Genua Eine Reise von der Tradition zur Utopie Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung 1 II. Heines Darstellung Italiens 2 1. Das
Germanistik Silvia Schmitz-Görtler Heines Reise von München nach Genua Eine Reise von der Tradition zur Utopie Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung 1 II. Heines Darstellung Italiens 2 1. Das
Beziehungserfahrung und Bildungstheorie
 Peter Weisz Beziehungserfahrung und Bildungstheorie Die klassische Bildungstheorie im Lichte der Briefe Caroline und Wilhelm von Humboldts PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhalt 1. ZUM
Peter Weisz Beziehungserfahrung und Bildungstheorie Die klassische Bildungstheorie im Lichte der Briefe Caroline und Wilhelm von Humboldts PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhalt 1. ZUM
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Das Vater-Sohn-Problem in Franz Kafkas 'Die Verwandlung'
 Germanistik Christoph Höbel Das Vater-Sohn-Problem in Franz Kafkas 'Die Verwandlung' Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Gregor Samsa... 3 2.1. Erster Teil der Erzählung... 3 2.2. Zweiter
Germanistik Christoph Höbel Das Vater-Sohn-Problem in Franz Kafkas 'Die Verwandlung' Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Gregor Samsa... 3 2.1. Erster Teil der Erzählung... 3 2.2. Zweiter
Glaube der berührt. Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen!
 Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! Liebe, Annahme echtes Interesse an der Person Anteilnahme geben erzählen, wie Gott mich selbst berührt einladen Unser Gegenüber,
Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! Liebe, Annahme echtes Interesse an der Person Anteilnahme geben erzählen, wie Gott mich selbst berührt einladen Unser Gegenüber,
DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS LESEPROBE DIE NEUE WISSENSCHAFT. des REICHWERDENS
 DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS LESEPROBE DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS 248 Vorwort AKTUALISIERTE VERSION 9 1. DAS RECHT REICH ZU SEIN was auch immer zum Lobpreis der Armut gesagt werden
DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS LESEPROBE DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS 248 Vorwort AKTUALISIERTE VERSION 9 1. DAS RECHT REICH ZU SEIN was auch immer zum Lobpreis der Armut gesagt werden
ROMANTIK. Sie war in allen Künsten und in der Philosophie präsent. Die Romantik war eine Gegenwelt zur Vernunft, also zur Aufklärung und Klassik
 ROMANTIK Eine gesamteuropäische Geistes- und Kunstepoche, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts andauerte Sie war in allen Künsten und in der Philosophie
ROMANTIK Eine gesamteuropäische Geistes- und Kunstepoche, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts andauerte Sie war in allen Künsten und in der Philosophie
1. Grundzüge der Diskursethik
 Die Diskursethik 1. Grundzüge der Diskursethik Interpretiere das oben gezeigte Bild: Moralische Kontroversen können letztlich nicht mit Gründen entschieden werden, weil die Wertprämissen, aus denen wir
Die Diskursethik 1. Grundzüge der Diskursethik Interpretiere das oben gezeigte Bild: Moralische Kontroversen können letztlich nicht mit Gründen entschieden werden, weil die Wertprämissen, aus denen wir
kultur- und sozialwissenschaften
 Helga Grebing Überarbeitung und Aktualisierung: Heike Dieckwisch Debatte um den Deutschen Sonderweg Kurseinheit 2: Preußen-Deutschland die verspätete Nation? kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist
Helga Grebing Überarbeitung und Aktualisierung: Heike Dieckwisch Debatte um den Deutschen Sonderweg Kurseinheit 2: Preußen-Deutschland die verspätete Nation? kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart
 Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Der psychologische Aspekt, in der homöopathischen Behandlung
 Der psychologische Aspekt, in der homöopathischen Behandlung Dr. Sanjay Sehgal Dr. Yogesh Sehgal Band XVI Homöopathie-Seminar Bad Boll 2007 Eva Lang Verlag Homöopathische Literatur INHALT Seite Dr. Yogesh
Der psychologische Aspekt, in der homöopathischen Behandlung Dr. Sanjay Sehgal Dr. Yogesh Sehgal Band XVI Homöopathie-Seminar Bad Boll 2007 Eva Lang Verlag Homöopathische Literatur INHALT Seite Dr. Yogesh
KAPITEL 1 WARUM LIEBE?
 KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich
KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich
Das Dilemma der Luise Millerin
 Germanistik Anke Leins Das Dilemma der Luise Millerin Studienarbeit Eberhard-Karls-Universität Tübingen Seminar im Hauptstudium: Schiller und das europäische Theater des 18 Jahrhunderts Sommersemester
Germanistik Anke Leins Das Dilemma der Luise Millerin Studienarbeit Eberhard-Karls-Universität Tübingen Seminar im Hauptstudium: Schiller und das europäische Theater des 18 Jahrhunderts Sommersemester
Wilhelm von Humboldt Weimarer Klassik Bürgerliches Bewusstsein
 AObT* Jürgen Kost Wilhelm von Humboldt Weimarer Klassik Bürgerliches Bewusstsein Kulturelle Entwürfe in Deutschland um 1800 Königshausen & Neumann Inhalt 1. i.l. 1.2. 1.3. Einleitung 13 Humboldt und Weimar
AObT* Jürgen Kost Wilhelm von Humboldt Weimarer Klassik Bürgerliches Bewusstsein Kulturelle Entwürfe in Deutschland um 1800 Königshausen & Neumann Inhalt 1. i.l. 1.2. 1.3. Einleitung 13 Humboldt und Weimar
kultur- und sozialwissenschaften
 Volker Gerhardt Nietzsches Philisophie der Macht Kurseinheit 1: Nietzsche und die Philosophie kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Volker Gerhardt Nietzsches Philisophie der Macht Kurseinheit 1: Nietzsche und die Philosophie kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Frühromantik Epoche - Werke - Wirkung
 Frühromantik Epoche - Werke - Wirkung Von Lothar Pikulik Verlag C.H.Beck München Inhaltsverzeichnis Einführung 9 Abkürzungen der zitierten Quellen 13 Erster Teil: Entstehung I. Kapitel: Die Geburt der
Frühromantik Epoche - Werke - Wirkung Von Lothar Pikulik Verlag C.H.Beck München Inhaltsverzeichnis Einführung 9 Abkürzungen der zitierten Quellen 13 Erster Teil: Entstehung I. Kapitel: Die Geburt der
Der pragmatische Blick
 Der pragmatische Blick Was bedeutet das bisher gesagte für die Methoden in der Bildnerischen Erziehung Der Blick geht von der Kunstpädagogik aus. Blick der Kunst(pädagogik) K. erschließt die Welt wahr
Der pragmatische Blick Was bedeutet das bisher gesagte für die Methoden in der Bildnerischen Erziehung Der Blick geht von der Kunstpädagogik aus. Blick der Kunst(pädagogik) K. erschließt die Welt wahr
Es reicht, einfach mit dem zu sein, was wir erfahren, um fundamentales Gut- Sein oder Vollkommenheit zu erkennen.
 Heilige Vollkommenheit Teil 2 Die Vollkommenheit aller Dinge zu erkennen, braucht Genauigkeit. Mit Vollkommenheit ist gemeint, dass die Dinge in einem tieferen Sinn in Ordnung sind und zwar jenseits unserer
Heilige Vollkommenheit Teil 2 Die Vollkommenheit aller Dinge zu erkennen, braucht Genauigkeit. Mit Vollkommenheit ist gemeint, dass die Dinge in einem tieferen Sinn in Ordnung sind und zwar jenseits unserer
Literaturwissenschaft
 Literaturwissenschaft Theorie & Beispiele Herausgegeben von Herbert Kraft ASCHENDORFF Historisch-kritische Literaturwissenschaft. Von Herbert Kraft 1999, 120 Seiten, Paperback 9,10 d. ISBN 978-3-402-04170-3
Literaturwissenschaft Theorie & Beispiele Herausgegeben von Herbert Kraft ASCHENDORFF Historisch-kritische Literaturwissenschaft. Von Herbert Kraft 1999, 120 Seiten, Paperback 9,10 d. ISBN 978-3-402-04170-3
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch Name: Klasse: Aufsatz / Beschreibung / Personen: Charakterisierung
 Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch Name: Klasse: Aufsatz / Beschreibung / Personen: Charakterisierung Personenbeschreibung II) Die Charakterisierung einer Person 1) Anfertigung einer Personencharakterisierung
Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch Name: Klasse: Aufsatz / Beschreibung / Personen: Charakterisierung Personenbeschreibung II) Die Charakterisierung einer Person 1) Anfertigung einer Personencharakterisierung
Joachim Heinrich Campe: Robinson der Jüngere
 Germanistik Katja Krenicky-Albert Joachim Heinrich Campe: Robinson der Jüngere Studienarbeit Pädagogische Hochschule Freiburg SS 2002 Fach: Deutsch Seminar: Einführung in die Theorie und Didaktik der
Germanistik Katja Krenicky-Albert Joachim Heinrich Campe: Robinson der Jüngere Studienarbeit Pädagogische Hochschule Freiburg SS 2002 Fach: Deutsch Seminar: Einführung in die Theorie und Didaktik der
Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück"
 Germanistik Miriam Degenhardt Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück" Eine Analyse der Sprache bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Leben der Mutter und Handkes Umgang mit der
Germanistik Miriam Degenhardt Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück" Eine Analyse der Sprache bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Leben der Mutter und Handkes Umgang mit der
SCHILLER. Epoche - Werk - Wirkung. Von Michael Hofmann. Verlag C.H.Beck München
 SCHILLER Epoche - Werk - Wirkung Von Michael Hofmann Verlag C.H.Beck München Inhalt Vorwort 9 I. Schiller in seiner Epoche Forschungsliteratur 14 A. Aspekte von Schillers Biographie 15 1. Jugend und Karlsschulzeit
SCHILLER Epoche - Werk - Wirkung Von Michael Hofmann Verlag C.H.Beck München Inhalt Vorwort 9 I. Schiller in seiner Epoche Forschungsliteratur 14 A. Aspekte von Schillers Biographie 15 1. Jugend und Karlsschulzeit
ISBN (Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN im Tectum Verlag erschienen.
 Thanh Ho Trauerrituale im vietnamesischen Buddhismus in Deutschland. Kontinuität und Wandel im Ausland Religionen aktuell; Band 9 Zugl. Univ.Diss.,Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 2011 Umschlagabbildung:
Thanh Ho Trauerrituale im vietnamesischen Buddhismus in Deutschland. Kontinuität und Wandel im Ausland Religionen aktuell; Band 9 Zugl. Univ.Diss.,Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 2011 Umschlagabbildung:
"Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert
 Medien Deborah Heinen "Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert Studienarbeit Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Geschichtswissenschaft Veranstaltung:
Medien Deborah Heinen "Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert Studienarbeit Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Geschichtswissenschaft Veranstaltung:
Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln
 Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Trauerfeier von Markus Heiniger Samstag, 10. Juli 2004
 Der Mann starb durch einen tragischen Unfall. Er wurde von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen. Nach dem Unfall folgte noch ein wochenlanger Überlebenskampf. Er konnte aber nicht mehr wirklich
Der Mann starb durch einen tragischen Unfall. Er wurde von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen. Nach dem Unfall folgte noch ein wochenlanger Überlebenskampf. Er konnte aber nicht mehr wirklich
Inhalt. 1 Literaturwissenschaft.
 Inhalt Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft: das letzte intellektuelle Abenteuer - Literatur und Wissenschaft Vermittlung der Grundkenntnisse Motivationen des Studiums Fach-Begriffe Literaturgeschichte
Inhalt Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft: das letzte intellektuelle Abenteuer - Literatur und Wissenschaft Vermittlung der Grundkenntnisse Motivationen des Studiums Fach-Begriffe Literaturgeschichte
Brechts Theatertheorie
 Germanistik Napawan Masaeng Brechts Theatertheorie Studienarbeit Das epische Theater Bertolt Brechts Inhalt: Zum Begriff:...1 Grundgedanke :...1 Das Wesentliche vom epischen Theater in Kürze :...4 Das
Germanistik Napawan Masaeng Brechts Theatertheorie Studienarbeit Das epische Theater Bertolt Brechts Inhalt: Zum Begriff:...1 Grundgedanke :...1 Das Wesentliche vom epischen Theater in Kürze :...4 Das
Nietzsches Philosophie des Scheins
 Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1
Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1
EIN HANDBUCH FU R DAS LEBEN!
 EIN HANDBUCH FU R DAS LEBEN! Teil 1 EIN REISEBEGLEITER FÜR DEINE LEBENSREISE! Dieser Reisebegleiter soll Dich durch Dein Leben führen und Dir ein Wegweiser und Mutmacher sein. Denn auch wenn es mal schwierig
EIN HANDBUCH FU R DAS LEBEN! Teil 1 EIN REISEBEGLEITER FÜR DEINE LEBENSREISE! Dieser Reisebegleiter soll Dich durch Dein Leben führen und Dir ein Wegweiser und Mutmacher sein. Denn auch wenn es mal schwierig
Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. ARTIBUS INi
 Hans-Georg Gadamer Hermeneutik I Wahrheit und Methode Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik ARTIBUS INi J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1986 Inhalt Einleitung 1 Erster Teil Freilegung der Wahrheitsfrage
Hans-Georg Gadamer Hermeneutik I Wahrheit und Methode Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik ARTIBUS INi J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1986 Inhalt Einleitung 1 Erster Teil Freilegung der Wahrheitsfrage
UNI-WISSEN. Klett Lemtraining
 UNI-WISSEN Klett Lemtraining Inhalt 1 Literaturwissenschaft 9 1 Literaturwissenschaft: das letzte intellektuelle Abenteuer 9 2 Literatur und Wissenschaft 10 3 Vermittlung der Grundkenntnisse 13 4 Motivationen
UNI-WISSEN Klett Lemtraining Inhalt 1 Literaturwissenschaft 9 1 Literaturwissenschaft: das letzte intellektuelle Abenteuer 9 2 Literatur und Wissenschaft 10 3 Vermittlung der Grundkenntnisse 13 4 Motivationen
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Frank Lassner Meditieren ist ganz einfach IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 Meditieren die nächste Dimension 17 Erster Schritt: Meditieren mit geschlossenen
Frank Lassner Meditieren ist ganz einfach IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 Meditieren die nächste Dimension 17 Erster Schritt: Meditieren mit geschlossenen
Thesen des Kriminalromans nach Bertolt Brecht
 Germanistik Una Müller Thesen des Kriminalromans nach Bertolt Brecht Studienarbeit Gliederung Einleitung... 2 Hauptteil... 3 Erste These... 3 Zweite These... 4 Dritte These... 5 Vierte These... 7 Die
Germanistik Una Müller Thesen des Kriminalromans nach Bertolt Brecht Studienarbeit Gliederung Einleitung... 2 Hauptteil... 3 Erste These... 3 Zweite These... 4 Dritte These... 5 Vierte These... 7 Die
4.4 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung Verknüpfung und zusammenfassende Ergebnisdarstellung Schlussfolgerungen für eine
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 7 1 Einleitung...9 2 Das soziale Phänomen der Stigmatisierung in Theorie und Empirie...10 2.1 Stigmatisierung in theoretischen Konzepten...10 2.1.1 Ausgangspunkte...11 2.1.2
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 7 1 Einleitung...9 2 Das soziale Phänomen der Stigmatisierung in Theorie und Empirie...10 2.1 Stigmatisierung in theoretischen Konzepten...10 2.1.1 Ausgangspunkte...11 2.1.2
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
 Immanuel Kant Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Anaconda Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten erschien erstmals 1785 bei Johann Friedrich Hartknoch, Riga. Textgrundlage der vorliegenden Ausgabe
Immanuel Kant Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Anaconda Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten erschien erstmals 1785 bei Johann Friedrich Hartknoch, Riga. Textgrundlage der vorliegenden Ausgabe
Ein Inspektor kommt. Königs Erläuterungen und Materialien Band 336. Erläuterungen zu. John Boynton Priestley. von Reiner Poppe
 Königs Erläuterungen und Materialien Band 336 Erläuterungen zu John Boynton Priestley Ein Inspektor kommt von Reiner Poppe C. Bange Verlag Hollfeld 1 Herausgegeben von Klaus Bahners, Gerd Eversberg und
Königs Erläuterungen und Materialien Band 336 Erläuterungen zu John Boynton Priestley Ein Inspektor kommt von Reiner Poppe C. Bange Verlag Hollfeld 1 Herausgegeben von Klaus Bahners, Gerd Eversberg und
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
