COOH. 2. Materialien und Methoden Prüfsubstanzen Synthetisierte Huminsäuren
|
|
|
- Nicolas Acker
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 2. Materialien und Methoden 2.1. Prüfsubstanzen Synthetisierte Huminsäuren Zur Herstellung der verschiedenen Salze des Kaffeesäure-xidationsproduktes (KP), des DPA-xidationsproduktes (DPA-P) und des Hydrokaffeesäure-xidationsproduktes (HYKP) werden die monomeren Ausgangssubstanzen mit Natriummetaperiodat oder Periodsäure in einem alkalischen Milieu polymerisiert. Dabei entstehen braun gefärbte, hochmolekulare, wasserlösliche HS, die nach ihren Ausgangsstoffen, ihren Synthesebedingungen und ihrem Molekulargewicht charakterisiert werden können. Die Synthesevorschrift wurde von Helbig und Klöcking (1983) entwickelt. Werden die Ausgangsverbindungen in ein alkalisches Milieu gegeben, entstehen zunächst fluoreszierende Verbindungen. Die Lösungen verfärben sich über gelb, nach grün-braun bis dunkelbraun (Hänninen et al., 1987). Die Phenolkörperpolymerisate stellen Modellsubstanzen für die natürlichen HS dar. Sie werden unter definierten Bedingungen hergestellt. Klöcking et al. (1983) charakterisierten die Phenolkörperpolymerisate hinsichtlich ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften. Man kann die Substanzen mittels Elementaranalyse, über ihr mittleres Molekulargewicht, die Anzahl ihrer sauren Gruppen, mit Hilfe des reduktiven Abbaus, anhand der IR-Spektren und der 13 C-NMR-Spektren beschreiben. Synthese von Na-KP: 1,8 g (0,01 Mol) Kaffeesäure werden mit 0,6 g Natriummetaperiodat in 500 ml Aqua gelöst, mit 15 ml 1 M Natriumhydroxid-Lösung versetzt und der ph-wert auf 8-9 eingestellt. Anschließend erwärmt man für 1 h auf 50 C im Wasserbad unter Luftabschluss und lässt die Lösung über Nacht stehen. Die Lösung wird auf ein Volumen von ca. 5 ml eingeengt und mit 96 %igem Ethanol ausgefällt. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit Ethanol gewaschen und getrocknet. Kaffeesäure + Natriummetaperiodat Kaffeesäureoxidationsprodukt, Natrium-Salz H H CH Abb. 5: Kaffeesäure (3,4-Dihydroxyzimtsäure) als monomere Ausgangsverbindung für die Synthese der verschiedenen Salze von KP 15
2 In der Abbildung 6 sind die möglichen bei der Synthese von KP vorkommenden Übergangsverbindungen dargestellt. Kaffeesäure ist unter alkalischen Bedingungen deprotoniert. H H H H Kaffeesäure H H Übergangsverbindungen der Kaffeesäure Abb. 6: Kaffeesäure und ihre Übergangsverbindungen bei der Synthese von KP Fernekorn (1988) untersuchte die spektralen Eigenschaften des KP und fand eine Abnahme der Extinktion mit zunehmender Wellenlänge. Das UV-VIS-Spektrum der Kaffeesäure weist bei 300 nm und 345 nm Maxima auf. Synthese von K-KP: Die Herstellung des Kalium-Salzes des KP erfolgt mit Periodsäure anstelle des Natriummetaperiodates und mit 1 M Kaliumhydroxid-Lösung anstelle der Natriumhydroxid-Lösung. Die anderen Herstellungsschritte verlaufen analog der Synthese des Natriumsalzes. Kaffeesäure + Periodsäure Kaffeesäureoxidationsprodukt, Kalium-Salz Synthese des NH 4 -KP: Die Herstellung erfolgt wiederum analog zur Herstellung des Na- KP aber mit Periodsäure anstelle des Natriummetaperiodates und Ammoniak statt der Natriumhydroxid-Lösung zur Alkalisierung. Kaffeesäure + Periodsäure Kaffeesäureoxidationsprodukt, Ammonium-Salz Synthese von Ca-KP: Bei der Herstellung wird Periodsäure und Calciumhydroxid-Lösung verwendet. Die restlichen Schritte werden wie beim Na-KP durchgeführt. Das Calcium-Salz ist schwer wasserlöslich, weswegen die Zytotoxizitätsuntersuchungen und die Bestimmung der UV-B-protektiven Wirkung nicht erfolgen konnte. Kaffeesäure + Periodsäure Kaffeesäureoxidationsprodukt, Calcium-Salz 16
3 In der Abbildung 7 sind Reaktionsschritte dargestellt, wie sie möglicherweise bei der Bildung von KP ablaufen. H H C H H H Kaffeesäure Polymerisation zum KP Abb. 7: Mögliche Reaktionsschritte bei der xidation der Kaffeesäure Synthese von DPA-P: Bei der Synthese des DPA-P wird als Ausgangssubstanz DPA (Dihydroxyphenylalanin) verwendet. Es werden 2,0 g DPA unter Verwendung von 0,6 g Natriummetaperiodat und 1 M Natriumhydroxid-Lösung nach der gleichen Synthesevorschrift wie die Kaffeesäure polymerisiert. Man erhält also das Natriumsalz von DPA-P. DPA + Natriummetaperiodat DPA-xidationsprodukt, Natrium-Salz H CH H NH 2 Abb. 8: DPA (Dihydroxyphenylalanin) als monomere Ausgangsverbindung für die Synthese des DPA-P Synthese von HYKP: Man oxidiert 1,8 g Hydrokaffeesäure mit 0,6 g Natriummetaperiodat und einem mit 1 M Natriumhydroxid-Lösung eingestelltem ph-wert von 9 wiederum nach der gleichen Vorschrift wie die Kaffeesäure und erhält das Natrium-Salz von HYKP. Hydrokaffeesäure + Natriummetaperiodat Hydrokaffeesäureoxidationsprodukt, Natrium- Salz 17
4 H H CH Abb. 9: Hydrokaffeesäure (3,4-Dihydroxyhydrozimtsäure) als monomere Ausgangsverbindung für die Synthese des HYKP Die drei verwendeten Ausgangsverbindungen haben gleiche chemische Grundgerüste und unterscheiden sich nur in der Seitenkette voneinander. Hydrokaffeesäure ist die reduzierte Form der Kaffeesäure, und DPA ist die entsprechende Aminosäure zu den beiden Verbindungen. Als gleiche Strukturen sind der aromatische Ring mit den beiden orthoständigen Hydroxylgruppen und die Seitenkette bestehend aus drei C-Atomen anzusehen. Zur Überprüfung, ob die synthetisierten HS noch monomere Ausgangssubstanzen enthalten, wird eine Dünnschichtchromatographie durchgeführt. Als Fließmittel wird ein Gemisch bestehend aus Toluol 6 Teile, Ethylacetat 1 Teil, Ethanol 3 Teile und für DPA Butanol 7 Teile, Essigsäure 1,5 Teile, Wasser 1,5 Teile verwendet. Kaffeesäure, Hydrokaffeesäure und DPA wandern auf der DC-Platte nach oben und können mit einem DC-Sprühreagenz bestehend aus diazotierter Sulfanilsäure und p-nitranilin sichtbar gemacht werden. Man erkennt die Substanzen auf der DC-Platte aber auch unter einer UV-Lampe, weil die verwendeten DC-Platten einen Fluoreszenzindikator enthalten. Die DC muss unter Lichtausschluss erfolgen, da die Substanzen bereits unter DC-Bedingungen polymerisieren. Zur Kontrolle werden die Vergleichssubstanzen aufgetragen. Es sind keine monomeren Verbindungen mehr nachweisbar. Die meisten natürlich vorkommenden HS haben einen mehr oder weniger großen Anteil an fluoreszierenden Verbindungen. Auch bei der Synthese unserer HS kann bei der Polymerisation bei der Betrachtung unter UV-Licht und z.t. bereits bei Tageslicht eine grüne Fluoreszenz nachgewiesen werden. Setzt man einer schwach alkalischen Lösung von Kaffeesäure einige Tropfen 30 %ige Wasserstoffperoxid-Lösung zu, färbt sich die Lösung innerhalb weniger Sekunden gelb bis bräunlich an. Diese Lösung fluoresziert unter UV-Licht. Die fluoreszierenden Verbindungen bei der Synthese der HS sind wahrscheinlich auf die chinoiden Übergangsverbindungen zurückzuführen. Die aromatischen phenolischen Ausgangsverbindungen besitzen je zwei ortho-ständige Hydroxylgruppen, die leicht eine chinoide Struktur unter oxidativem Einfluss ausbilden können. 18
5 In der Natur kommen auch sogenannte grüne HS vor, die durch ihre Absorptionskurve klassifiziert werden können. In podsoligen Böden, auf den Britischen Inseln und in alpinen Böden sind diese P-Typen vorhanden, die sich durch ein grünes Pigment auszeichnen. Dieses Pigment kann chromatographisch getrennt werden und wird als ein Chinon angesehen (Kumada u. Hurst, 1967). Herstellung von DPA-P Luft : 2,0 g DPA werden abgewogen und mit 1 M Natriumhydroxid-Lösung auf einen ph-wert von 9 eingestellt. Man erwärmt die Lösung 1 h lang im Wasserbad auf 50 C und lässt die Lösung für weitere 48 h an der Luft stehen. Die Lösung wird dann auf ein Volumen von ca. 5 ml eingeengt und die HS mit Ethanol ausgefällt. Der Rückstand wird noch einmal mit Ethanol gewaschen und getrocknet Natürliche Huminsäuren Huminsäuren aus dem Altteicher Moor Das Altteicher Moor ist ein bei Bad Muskau/Weißwasser in Niederschlesien gelegenes Naturmoor. Das Naturmoor ist ein Endprodukt eines natürlichen, über viele hunderte bis tausende Jahre ablaufenden Umwandlungsprozesses von Pflanzen unter Luftabschluss. Bei den Mooren unterscheidet man zwei Haupttypen, das Hochmoor und das Niedermoor. Beim Hochmoor wird das zur Bildung notwendige Wasser nur durch den Regen oder Tau eingespeist, während das Niedermoor aus Boden-, berflächen- oder Grundwasser gebildet wird. Die Wasserqualitäten und dynamik bestimmen maßgeblich die Vegetation im Moor und die Torfbildung. In vielen volkstümlichen Überlieferungen wird die heilsame Wirkung des Moores beschrieben. Naturmoor wird seit über 150 Jahren in Form von Bädern in Kureinrichtungen angewandt. Das Altteicher Moor wird zur Linderung von rheumatischen und Hautbeschwerden, zur Schmerzlinderung, zur Durchblutungsförderung und aufgrund der desodorierenden Wirkung in Kurbädern eingesetzt. Hierzu gehören die Kurbäder in Bad Düben, in Bad Liebenwerda, in Bad Muskau, in Bad Schandau und Bad Schmiedeberg. Die beschriebenen Wirkungen lassen sich auf die enthaltenen Huminstoffe zurückführen. Der Torf enthält als feste Bestandteile neben HS, die in einer Konzentration von ca. 5 % enthalten sind, noch Mineralstoffe und organische Substanzen. Zu den Mineralien gehören z.b. Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan, Aluminium, Silikat, Sulfat, Chlorid und Phosphat. Zu den organischen Stoffen gehören Pektine, Cellulosen und Lignine. 19
6 HS Altteicher Moor I ist eine schwarz gefärbte HS, die durch Alkalisierung und Ansäuerung des Moores mit Natriumhydroxid-Lösung und Salzsäure ausgefällt und danach bei 60 C getrocknet wurde. Nach der Fällung fanden keine weiteren Aufbereitungsschritte statt. HS Altteicher Moor II ist eine braune HS, die zunächst in der gleichen Weise wie die HS Altteicher Moor I durch Base-Säure-Behandlung ausgefällt, aber anschließend weiter aufbereitet wurde. Die Isolierung und Aufbereitung der HS Altteicher Moor I und II fand im Jahre 2002 im Rahmen einer Diplomarbeit (Kirsch, 2002) statt. HS Altteicher Moor III ist eine sehr dunkel, fast schwarz gefärbte HS, die ebenfalls durch eine Base-Säure-Behandlung isoliert und dann weiter aufbereitet wurde (Liers, 2002). Huminsäuren aus einem Naturmoor bei Dierhagen Die HS Natriumhumat (Na-humat) und Ammoniumhumat (NH 4 -humat) entstammen dem Küstenhochmoor bei Dierhagen-Neuhaus im Kreis Ribnitz-Damgarten auf der Halbinsel Darß in Mecklenburg-Vorpommern. Beide HS wurden nach einer von Klöcking et al. (1977) beschriebenen Methode am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Akademie Erfurt isoliert. Na-humat: Charge: Moorwasser-HS I IV/1980 Dr. He., MG Dalton Na-humat ist eine hellbraune, wasserlösliche HS. NH 4 -humat: Charge: Moorwasser-HS I X/1979 Dr. He., MG 7500 Dalton NH 4 -humat ist eine braune, wasserlösliche HS. Bei der reduktiven Aufspaltung mit Amalgam konnten Helbig et al. (1985) nachweisen, dass NH 4 -humat und Na-humat die Verbindungen Phloroglucin, α-resorcylsäure, Resorcin und ß- Resorcylsäure liefern. Die reduktiv aufgespaltenen HS wurden bereits im Jahr 1976 nach der gleichen Vorschrift wie die von uns verwendeten isoliert. Fernekorn (1988) zeigte, dass die Extinktion von Na-humat mit zunehmender Wellenlänge abnimmt. Huminsäure aus Braunkohle Zusätzlich wurde eine natürlich gewonnene HS untersucht, die käuflich von der Sigma Aldrich Chemie GmbH, D Steinheim, erworben wurde. HS Aldrich: Catalog. No: HI,675-2, Lot: Die HS Aldrich ist eine dunkelbraun gefärbte, wasserlösliche HS, die aus Braunkohle isoliert wurde. In Wasser gelöst, ergibt sie keine klare durchsichtige, sondern eine trübe, aufgeschlemmte Lösung. 20
7 Herstellung der Untersuchungslösungen der natürlichen und synthetischen Huminsäuren In den Versuchen wurde eine Lösung der HS verwendet, die wie im folgenden beschrieben hergestellt wurde. 10 mg des jeweiligen HS-Präparates wurden im Mörser fein zerrieben, mit 2,0 ml 0,05 M NaH versetzt und stehen gelassen, bis sich die HS nahezu vollständig gelöst hatte. Anschließend versetzt man die Lösung mit weiteren 0,5 ml 0,05 M NaH und füllt mit RPMI-Medium auf 10 ml auf. Beim unvollständigen Lösen der HS wird die Lösung zum Abtrennen von unlöslichen Partikeln 5 min lang bei 1500 U/min zentrifugiert und der klare Überstand zur Herstellung der Verdünnungsreihe genutzt. Diese wird im Sinne einer geometrischen Reihe mit 6 verschiedenen Untersuchungskonzentrationen pipettiert. Werden die HS in farblosem RPMI in einer Konzentration von 1 mg/ml gelöst und der ph- Wert mittels Indikatorpapier überprüft, ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle charakterisierten Lösungen (Tab. 1). Der saure ph-wert der HS wird durch das RPMI- Medium abgepuffert. Ein ph-wert im physiologischen Bereich ist notwendig, um eine säureoder alkalibedingte Schädigung der U937-Zellen während der Exposition zu vermeiden. Tabelle 1: Charakterisierung der aus den natürlichen und synthetischen Huminsäuren hergestellten Testlösungen bei einer Konzentration von 1 mg/ml in RPMI Huminsäure HS Aldrich NH 4 -humat Na-humat HYKP K-KP NH 4 -KP Na-KP Charakterisierung der Testlösungen trübe Lösung, milchig oder kreidig, braun, undurchsichtig bei einer Konzentration von 1 mg/ml dunkelbraun gefärbt ph-wert von 7-8 klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml dunkelbraun gefärbt, schimmert rotbraun ph-wert von 7-8 klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml braun gefärbt, aber heller als die von NH 4 -humat, rötlich braun ph-wert von 7-8 klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml braun gefärbt ph-wert von 7-8 klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml braun gefärbt ph-wert von 7-8 klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml leicht braun bis gelbbraun gefärbt ph-wert von 7-8 klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1mg/ml dunkelbraun, intensiv gefärbt ph-wert von
8 HS Altteicher Moor I HS Altteicher Moor II HS Altteicher Moor III DPA-P klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml dunkelbraun gefärbt nur unvollständig gelöst, es bleiben einige ungelöste Partikel zurück, die einen Anteil von 1 bis 2 % ausmachen ph-wert 7-8 es sind keine Lösungsunterschiede zwischen den 3 verschiedenen Aufbereitungsformen festzustellen klare, durchsichtige Lösung bei einer Konzentration von 1 mg/ml dunkelbraun gefärbt ph-wert von Paraaminobenzoesäure (PABA) ein UV-B-Lichtschutzfilter Paraaminobenzoesäure (4-Aminobenzoesäure, PABA) ist eine UV-B-protektive Substanz, die laut Kosmetikverordnung als UV-Filter mit einer zulässigen Höchstkonzentration von 5 % in kosmetischen Mitteln eingesetzt werden darf. Sie wurde als Referenzsubstanz für die UV- B-protektive Wirkung ausgewählt, weil sie eine gute Löslichkeit im Versuchsmedium besitzt, selbst keine störende Eigenfärbung aufweist und strukturelle Gemeinsamkeiten mit den monomeren Ausgangsverbindungen unserer synthetischen HS aufweist. Physiologisch greift PABA in den Zellstoffwechsel und dort speziell in den Folsäurestoffwechsel ein. In Bakterien wirkt PABA als Coenzym bei der Folsäuresynthese. Säugetiere nehmen die Folsäure mit der Nahrung auf, da sie nicht befähigt sind, Folsäure selbst zu synthetisieren. Bei einem Mangel an PABA treten Ekzeme auf. PABA ist in verschiedenen Nahrungsmitteln, wie z.b. in Leber, Bierhefe, Nieren, Vollkorn, Reis, Kleie, Weizenkeimen, schwarzer Melasse und Milch enthalten. PABA [4-Aminobenzoesäure] C 7 H 7 N 2 MG 137,1 g/mol Merck Darmstadt H 2 N CH Abb.10: Paraaminobenzoesäure (4-Aminobenzoesäure, PABA) als Referenzsubstanz für die UV-B-protektive Wirkung Kaffeesäure, Hydrokaffeesäure, Dihydroxyphenylalanin (DPA) Zur Herstellung der synthetisierten HS wurden die Substanzen Kaffeesäure (Abb. 5), Hydrokaffeesäure (Abb. 9) und DPA (Abb. 8) verwendet. Diese beginnen in Lösung z.t. von selbst zu polymerisieren, was sich an einer gelblichen, rötlichen oder bräunlichen Verfärbung der Lösungen erkennen lässt. Kaffeesäure und Hydrokaffeesäure kommen als 22
9 sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe vor. So ist z.b. im gerösteten Kaffee Coffein an Chlorogensäure gebunden, die sich wiederum aus je einem Molekül Chinasäure und Kaffeesäure zusammensetzt. Pharmakologisch wird die Chlorogensäure beim Kaffeegenuss für das Aufstoßen, eventuelle Durchfälle, Spasmen und eine gesteigerte Säurebildung im Magen verantwortlich gemacht. Kaffeesäure ist eine Dihydroxyzimtsäure, eine Bezeichnung, die auf ihr Vorkommen in der Zimtrinde hinweist. Hier tritt sie zusammen mit strukturell ähnlichen Verbindungen, wie z.b. Zimtaldehyd, Zimtalkohol, Hydrokaffeesäure u.a. Hydroxyzimtsäuren auf. Kaffeesäure und auch die methoxylierte Kaffeesäure (Ferulasäure) wirken antikarzinogen, indem sie die Karzinogenbildung aus Vorläuferzellen und Karzinogenreaktionen mit zellulären Molekülen verhindern. DPA ist die Ausgangsverbindung für die in der menschlichen Haut ablaufende Melaninbildung. DPA entsteht aus der Aminosäure Tyrosin durch das Anhängen einer Hydoxylgruppe durch die Tyrosinase (Karlson et al., 1994). Kaffeesäure [3,4-Dihydroxyzimtsäure] C 9 H 6 4 MG 180,2 g/mol Serva (Feinbiochemica Heidelberg) Hydrokaffeesäure [3,4-Dihydroxyhydrozimtsäure; 3-(3,4-Dihydroxyphenyl-)propionsäure] C 9 H 10 4 MG 182,2 g/mol Serva (Feinbiochemica Heidelberg) DPA [3-(3,4-Dihydroxyphenyl-)alanin] C 9 H 11 4 N MG 197,2 g/mol Merck (Darmstadt) 2.2. Zellen Zellkultur Zur Bestimmung der Zytotoxizität und der UV-B-protektiven Wirkung werden die humanen U937-Zellen (ATCC, CRL 1593) verwendet. U937-Zellen sind eine Suspensionszellkultur mit monozytären Eigenschaften, die einem malignen Pleuraerguss eines 37-jährigen Mannes mit einem diffusen histiozytären Lymphom entstammen und seitdem kontinuierlich weitervermehrt werden. Diese humane Zelllinie wurde 1974 von Sundström und Nilsson eingeführt. Zur Aufbewahrung über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten können sie tiefgefroren werden. Die Zellen wurden vom Institut für Physiologische Chemie der Universität Mainz, Abteilung für Angewandte Molekularbiologie (Prof. Dr. W.E.G. Müller) vor einigen Jahren übernommen. 23
10 Zellzüchtung Die U937-Zellen werden in rotem RPMI 1640, das mit 10 % fetalem, hitzeinaktivierten Kälberserum (FCS) versetzt wird, in Schräghalszellkulturflaschen (250 ml Volumen, 75 cm² Wachstumsfläche) kultiviert. Die Züchtung findet in einer humiden, 5 % C 2 -enthaltenden Atmosphäre bei einer Temperatur von 37 C statt. Die U937-Zellen können in Abhängigkeit von den Ansatzbedingungen nach 2*, 3** oder 5*** Tagen geerntet werden. Dabei wird unter dem Mikroskop der Proliferationsgrad und die Zelldichte beurteilt und nach dem folgenden Pipettierschema unter aseptischen Bedingungen umgesetzt. * 1: ml U937-Zellen + 17 ml farbloses RPMI ml FCS ** 1:5...6 ml U937-Zellen + 21 ml farbloses RPMI ml FCS *** 1: ml U937-Zellen + 24 ml farbloses RPMI ml FCS 2.3. Chemikalien und weitere Geräte Materialien zur Herstellung der synthetischen Huminsäuren Periodsäure (H 5 I 6 ) (Merck, Darmstadt) Natriummetaperiodat (NaI 4 ) (Merck, Darmstadt) 1 M Natriumhydroxid-Lösung (NaH) (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) 1 M Kaliumhydroxid-Lösung (KH) (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Ammoniak 25 % (NH 3 ) (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Calciumhydroxid-Lösung, gesättigt [Ca(H) 2 ] (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland- Klinikum Plauen) 10 %ige und 30 %ige Wasserstoffperoxid-Lösung (H 2 2 ) (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Ethanol, rein (Merck, Darmstadt) 500 ml Glasflaschen, hydrolytische Klasse 1 (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland- Klinikum Plauen) Thermometer (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Laborwaagen (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Kammer für die Dünnschichtchromatographie (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland- Klinikum Plauen) Dünnschichtchromatographie-Alufolie 20 x 20 cm Kieselgel 60 F 254 (Merck, Darmstadt) UV-Lampe 254 nm für die Dünnschichtchromatographie (Merck, Darmstadt) 24
11 Fließmittel: Toluol, Ethylacetat, Ethanol, Butanol, Essigsäure (Krankenhaus- Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Sprühreagenz für die Dünnschichtchromatographie: diazotierte Sulfanilsäure, p- Nitranilin (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) ph-meter CG 840 (Schott-Geräte GmbH, Hofheim am Ts.) Indikatorpapier (Merck, Darmstadt) Materialien für die Zellzucht und zur Versuchsdurchführung RPMI-Medium 1640, farblos, ohne Indikator, ohne L-Glutamin (Invitrogen GmbH, Karlsruhe) RPMI-Medium 1640, rot, mit Indikator, mit L-Glutamin (Invitrogen GmbH, Karlsruhe) Fetales Bovines Serum (FCS) (Biochrom AG seromed, Berlin) XTT-Tetrazoliumreduktionstest EZ4U (Biomedica Medizinprodukte GmbH & Co KG, Wien) Auslaufpipetten, wattiert, steril, 5 und 10 ml (Greiner Labortechnik GmbH, Frickenhausen) Rundbodenröhrchen aus Polystyren, 17x100 mm, 14 ml (Becton-Dickinson, Meylan Cedex, F) Cytomorph -b-mikrotiterplatten (nerbe plus GmbH, Winsen/ Luhe) Schräghalszellkulturflaschen, 50 ml, 250 ml (Becton-Dickinson, England) Zentrifugenröhrchen aus Polystyrol, 17x120 mm, 15 ml (Becton-Dickinson, Meylan Cedex, F) Pipettenspitzen 10 µl, 100 µl, 1 ml (Eppendorf GmbH, Hamburg) UV-B-Quelle: dermalight 80 (Dr. Hönle Medizintechnik GmbH, Kaufering) Stoppuhr (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Schutzbrille (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Silberpapier (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) Zellkulturflaschen mit Schräghals und blauer selbstabdichtender Schraubkappe, 50 ml Volumen, 25 cm² Wachstumsfläche (Becton Dickinson Labware, England) Megafuge 1.0R (Heraeus Holding GmbH, Hanau) Begasungsbrutschrank BB 6060 (Heraeus GmbH, Hanau) Reinraumwerkbank (Elektromat Dresden, Dresden) Inverses Durchlicht-Mikroskop TELEVAL 31 (Carl Zeiss Jena GmbH, Jena) Fotoapparat Nikon AF (Japan) Mikroskop Nikon TMS (Japan) 25
12 Bürker-Zählkammer (Feinoptik GmbH, Bad Blankenburg) Varipette (Eppendorf GmbH, Hamburg) Mikrotiter-Platten-Reader Easy Reader EAR 340 AT (SLT Labinstruments Deutschland GmbH, Crailheim) Mikrotiter-Platten-Schüttler Shaker Inkubator AM 89 A (Dynatech Deutschland GmbH, Denkendorf) Analysenwaage MC 210 P (Satorius AG, Göttingen) Matrixdrucker KX-P1081 (Panasonic, saka, Japan) Pipettierhilfe Pipetboy (Integra Biosciences, Fernwald) Pipettierhilfe Sarpette (Sarstedt AG & Co, Nürmbrecht) Untersuchungshandschuhe aus Latex, puderfrei, unsteril (Ansell GmbH, Stahlgruberring 3, München) Buraton 10F Flächendesinfektions- und Reinigungsmittel (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt, Wien) Peressigsäure 40 % (Kesla Pharma Wolfen GmbH, Wolfen) Ethanol 80 %, zur Desinfektion (Krankenhaus-Apotheke, Vogtland-Klinikum Plauen) 2.4. Testmethoden Bestimmung der Zytotoxizität mit dem XTT-Tetrazoliumreduktionstest EZ4U Die U937-Zellen werden zunächst serumfrei gewaschen. Dazu werden sie bei 1200 U/min (200 x g) und einer Temperatur von 4 C 5 min lang zentrifugiert, der Überstand abgegossen, in 5 ml RPMI-Medium resuspendiert und erneut zentrifugiert. Danach füllt man mit ca. 10 ml farblosem RPMI-Medium auf und bestimmt die Zellzahl mittels Bürker-Zählkammer unter dem Mikroskop. Es wird eine Zellzahl von 0,75 bis 1,25 x 10 6 Zellen pro ml Medium eingestellt. Die Zellzahl richtet sich nach der Empfindlichkeit des verwendeten Zytotoxizitätstests und sollte nicht zu hoch sein, da sonst die Linearität des Zusammenhanges zwischen Vitalität und Farbentwicklung nicht gewährleistet ist (Biomedica EZ4U). Es werden pro Kavität 100 µl Zellsuspension und 100 µl der in absteigenden Konzentrationen vorliegenden HS-Lösung pipettiert. Anschließend erfolgt die 1-, 24-, 48- und 72-stündige Exposition und die Ermittlung der Zytotoxizität. Bei der mitgeführten Zellkontrolle wird anstelle der HS-Lösung farbloses RPMI-Medium zugegeben. Bevor die photometrische Bestimmung der Zellvitalität erfolgen kann, müssen die Cytomorph -b-platten zentrifugiert (1200 U/min, 4 C, 5 min) und der Überstand abgegossen werden. Die Zentrifugation ist aufgrund der Eigenfärbung der HS-Lösung, die die photometrische Vermessung stört, notwendig. Die Zellen werden mit 200 µl farblosem RPMI-Medium aufpipettiert. 26
13 Unmittelbar vor der Zugabe des Testkits zur Probe wird das lyophilisierte XTT-Salz in 2,5 ml der etwas angewärmten Aktivatorlösung gelöst und jeweils 20 µl in die Kavitäten pipettiert. Anschließend werden die Platten für 3 h im Brutschrank erneut inkubiert, dann in einem Shaker geschüttelt und im Easy Reader bei einer Wellenlänge von 450 nm und einer Vergleichswellenlänge von 620 nm photometrisch vermessen. Durch Verwendung einer Referenzwellenlänge erzielt man eine höhere Genauigkeit. Der Test ist schnell, zuverlässig und einfach in der Anwendung (Biomedica EZ4U). Es wurden jeweils 3 Zellkontrollwerte und 6 in Folge einer geometrischen Reihe pipettierten HS-Lösungen getestet. Der EZ4U-Test ist ein nichtradioaktiver Tetrazoliumreduktionstest, in dem die reduktive Umwandlung von gelb gefärbten Tetrazoliumsalzen in intensiv orange bis rot gefärbte Formazan-Derivate durch Dehydrogenasen ausgenutzt wird (Mosmann, 1983). Die U937- Zellen können die Derivate nur reduzieren, wenn intakte Mitochondrien vorhanden sind. Beim Zelltod sterben innerhalb weniger Minuten die Mitochondrien ab, so dass man sehr gut zwischen lebenden und toten Zellen unterscheiden kann. Bei den ersten bereits in den 50er Jahren eingeführten Tetrazoliumreduktionstesten waren die gebildeten Formazan-Derivate unlöslich, und man musste mehrere zusätzliche Arbeitsschritte einfügen, um diese wieder in Lösung zu bringen. Außerdem waren die ursprünglichen Tetrazoliumsalze selbst zytotoxisch. Die neueren gebräuchlichen Teste sind selbst nur noch wenig toxisch auf die Zellen und besitzen lösliche Reduktionsprodukte. In der folgenden Abbildung 11 ist die mit einem Farbwechsel einhergehende Reduktion des Tetrazoliumsalzes zum Formazan dargestellt (Klöcking et al., 1995). N 2 N 2 CH 3 S 3 - CH 3 S 3 - NH C N N N N + NH C N N NH N CH 3 S 3 - CH 3 S 3 - N 2 N 2 Tetrazolium Formazan Abb.11: Reduktion des Tetrazoliumsalzes zum intensiv gefärbten Formazan als Indikatorreaktion des EZ4U-Testes 27
14 Berechnung und Darstellung der halbmaximalen zytotoxischen Konzentration (CC 50 ) Die Zytotoxizität wird wie folgt berechnet: x o -x i CT = 100 % x o x o Messwert der Zellkontrolle x i Messwert der mit HS inkubierten Zellen Die ermittelte Zytotoxizität wird in einem Diagramm mit halblogarithmischen Maßstab über der Konzentration aufgetragen. Es ergibt sich eine sigmoide Kurve. Die halbmaximale Zytotoxizität (CC 50 ) wird mit Hilfe einer Regressionsgeraden ermittelt. Die Regressionsfunktion beschreibt den mathematischen Zusammenhang zwischen der Konzentration und der ermittelten CT. Da die x-achse im Diagramm logarithmisch dargestellt ist, erhält man in der Geradengleichung statt der Konzentration x die logarithmische Konzentration ln x. Man berechnet y = 50 % in der Geradengleichung der Form y = m (ln x) + b. Von den erhaltenen ln x-werten wird der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet und anschließend entlogarithmiert. Dabei erhält man den CC 50 -Wert und das zugehörige Konfidenzintervall. Die Versuche wurden mindestens 3 mal durchgeführt Bestimmung der UV-B-protektiven Wirkung mit dem XTT-Tetrazoliumreduktionstest EZ4U Zur Bestimmung der Photoprotektivität werden 100 µl Zellsuspension und 100 µl HS-Lösung in die Kavitäten des Bodens der Cytomorph -b-platten pipettiert und mit einer UV-B-Lampe bestrahlt. Es wird eine mit RPMI-Medium aufpipettierte Zellkontrolle und eine ohne HS- Lösung bestrahlte Positivkontrolle mitgeführt. Die Versuchsanordnung wurde in verschiedenen Variationen durchgeführt (Abb.12). Die Bestrahlung der U937-Zellen erfolgte stets mit aufgesetztem Deckel der Cytomorph -b- Platten und einer UV-B-Dosis von 36 mj/cm². In der Anordnung 1 erfolgt die UV-B-Bestrahlung der Zellen in direktem Kontakt mit den HS. 100 µl Zellsuspension und 100 µl HS-Lösung werden gemeinsam im Boden der Cytomorph -b-platten mit UV-B bestrahlt. 28
15 In der Anordnung 2 werden 100 µl Zellen in die Kavitäten des Bodens der Cytomorph -b- Platten gegeben und 100 µl HS in die Kavitäten des Deckels. Bei der anschließenden Bestrahlung befinden sich die HS getrennt von den Zellen. In der Anordnung 3 werden 100 µl Zellen in den Kavitäten des Bodens der Cytomorph -b- Platten pipettiert und mit UV-B-Licht bestrahlt. Erst im Anschluss an die UV-B-Bestrahlung werden 100 µl der HS-Lösungen hinzugegeben, um eine mögliche pharmakologische oder membranstabilisierende Wirkung zu untersuchen. In der Anordnung 4 wird die Zytotoxizität der HS gegenüber U937-Zellen getestet. Dabei werden 100 µl Zellen zusammen mit den HS-Lösungen in die Kavitäten des Bodens der Cytomorph -b-platten gegeben und deren Zytotoxizität bestimmt. In der Anordnung 5 werden 100 µl Zellen und 100 µl HS zusammen in die Kavitäten des Bodens der Cytomorph -b-platten gegeben und zunächst 1 h lang im Brutschrank exponiert. Anschließend werden die in direktem Kontakt stehenden Zellen und HS mit UV-B bestrahlt. In dieser Versuchsanordnung wird der Frage nach möglichen Wechselwirkungen der HS mit den Membranoberflächen bzw. einer möglichen Partikelbildung und einer damit verbundenen physikalischen UV-B-Schutzwirkung nachgegangen. In der Anordnung 6 wird untersucht, ob die HS bei der UV-B-Bestrahlung zytotoxische Abbauprodukte bilden (Photostabilität). Dabei werden 100 µl HS in den Kavitäten des Bodens der Cytomorph -b-platten mit UV-B bestrahlt. Im Anschluss werden 100 µl Zellen hinzupipettiert und die Zytotoxizität bestimmt. Die Exposition der bestrahlten Zellen erfolgte im Brutschrank für 24 h, 48 h und 72 h. Expositionsdauern von 24 h, 48 h und 72 h wurden schon von Nagy (1970) verwendet, um menschliche Haut nach UV-Bestrahlung elektronenmikroskopisch zu untersuchen. Es werden jeweils 2 Zellkontrollwerte, 1 Positivkontrollwert und 6 verschiedene HS- Lösungen getestet. In den folgenden Abbildungen sind die unterschiedlichen Versuchsanordnungen dargestellt. 29
16 Versuchsanordnung 1 U937-Zellen werden in Gegenwart von Huminsäuren bestrahlt. UV-B-Lampe Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (enthalten je 100 µl farbloses RPMI) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten Huminsäure-Lösung und U937-Zellen) Versuchsanordnung 2 U937-Zellen und Huminsäuren sind voneinander getrennt; die UV-B-Strahlen erreichen die Zellen erst nach Passieren der Filterschicht (Huminsäuren, PABA). UV-B-Lampe Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (enthalten je 100 µl Huminsäure-Lösung) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten U937-Zellen) 30
17 Versuchsanordnung 3 U937-Zellen werden bestrahlt, 1 h danach werden Huminsäuren zugesetzt. UV-B-Lampe Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (enthalten je 100 µl farbloses RPMI) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten U937-Zellen) nach der UV-B-Bestrahlung wird Huminsäure-Lösung hinzugegeben Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten U937-Zellen und Huminsäure-Lösung) Versuchsanordnung 4 U937-Zellen in Gegenwart von Huminsäuren ohne Bestrahlung (Zytotoxizitätsprüfung). Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (leer) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten U937-Zellen und Huminsäure-Lösung) 31
18 Versuchsanordnung 5 U937-Zellen werden 1 h mit Huminsäuren vorinkubiert und danach bestrahlt. Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (enthalten je 100 µl farbloses RPMI) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten Huminsäure-Lösung und U937-Zellen) 1-stündige Exposition bei 37 C und 5% C 2 UV-B-Lampe Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (enthalten je 100 µl farbloses RPMI) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten Huminsäure-Lösung und U937-Zellen) 32
19 Versuchsanordnung 6 Huminsäuren werden bestrahlt und danach U937- Zellen zugesetzt. UV-B-Lampe Kavitäten des berteils der Cytomorph -b-platten (enthalten je 100 µl farbloses RPMI) Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten Huminsäure-Lösung) Zugabe von U937-Zellen erst nach UV-B-Bestrahlung der Huminsäuren Kavitäten des Unterteils der Cytomorph -b-platten (enthalten Huminsäure-Lösung und U937-Zellen) Abb.12: Variation der Versuchsanordnungen zur Ermittlung der UV-B-protektiven Wirkung unter Verwendung von Cytomorph -b-platten Berechnung und Darstellung der halbmaximalen UV-B-protektiven Konzentration (UV-B-PC 50 ) Die UV-B-protektive Wirkung wird wie folgt berechnet: x i -x o UV-B-PW = 100 % x o - x o x o Messwert der unbestrahlten Zellkontrolle x o Messwert der bestrahlten Zellkontrolle x i Messwert der mit HS inkubierten und bestrahlten Zellen Die Darstellung erfolgt in einem halblogarithmischen Diagramm. Die halbmaximale UV-Bprotektive Konzentration UV-B-PC 50 wird analog der CC 50 ermittelt. Zur statistischen 33
20 Auswertung wurde der Student-Test (t-test) zweiseitig mit gepaarten Stichproben verwendet Bestimmung der Zytotoxizität der Huminsäuren bei 96-stündiger Exposition Die Zellen werden zweimal gewaschen und eine Zellzahl von 0,5 x 10 5 Zellen pro ml Medium eingestellt. Anschließend werden die Zellen mit HS-Lösung versetzt und für 96 h im Brutschrank inkubiert. Die Ermittlung der Zellvitalität erfolgt mittels EZ4U und die Zellzahlbestimmung mittels Bürkerkammer. Es wurden jeweils 3 Zellkontrollen und 6 verschiedene Konzentrationen der HS-Lösungen untersucht Bestrahlungsdosis Um die Strahlendosis, die in den weiteren Versuchen verwendet werden soll, zu ermitteln, werden zunächst die Zellen mit verschiedenen UV-B-Dosen bestrahlt und die Zytotoxizität bestimmt. Dazu werden die Zellen in der gleichen Weise vorbereitet, wie zur Bestimmung der Zytotoxizität der Substanzen, in die Cytomorph -b-platten pipettiert und mit der UV-B- Lampe in einem Abstand von 3 cm bestrahlt. Die Dosis wird durch Variation der Bestrahlungsdauer verändert und die Zellvitalität mit dem EZ4U-Test bestimmt. Für die nachfolgenden Versuche wird eine Strahlendosis von 360 J/m² bzw. 36 mj/cm² ± 10 % ausgewählt. Praktisch entspricht das einer Bestrahlungsdauer von 60 s in einem Abstand von 3 cm. In der Literatur findet man einen Bereich von 10 bis 100 mj/cm² als UV-B- Erythemschwelle (Kindl u. Raab, 1998). Es ist durchaus üblich bei der Nutzung von UV-B- Strahlung in der Therapie zunächst die MED (minimale Erythemdosis) zu bestimmen und anschließend eine Behandlungsdosis festzulegen (Neumann et al., 2000). So wird auch bei der UV-Provokationstestung beim systemischen Lupus erythematodes zunächst die MED bestimmt und dann mit der 1,5-fachen Dosis bestrahlt. Eine pathologische Erythemschwelle liegt bei < 0,025 J/cm² UV-B bzw. < 15 J/cm² für UV-A (Kowalzick et al., 1998). Filipe et al. (1995) untersuchten an humanen Hautfibroblasten die UV-induzierte Zellsterblichkeit, die Lipidperoxidation und die Produktion des Entzündungsparameters PGE 2. Dabei wurden die Zellen mit Dosen von 50, 100 und 150 mj/cm 2 bestrahlt. Auch Danno et al. (1984) bestrahlten humane epidermale Zellen, um die Rolle der Sauerstoffintermediate in Sonnenbrandzellen zu untersuchen. Sie bestrahlten mit 300 mj/cm 2 bei 280 bis 320 nm Morphologische Beurteilung der Zellen Die morphologische Beurteilung der U937-Zellen erfolgte nach 24-, 48- und 72-stündiger Expositionsdauer mit den Testsubstanzen vor der Durchführung des Zytotoxizitätstestes. Die beobachteten Veränderungen der Zellen hinsichtlich ihrer Struktur und ihrem Erscheinungsbild unter dem Lichtmikroskop werden im Ergebnisteil kurz zusammengefasst. 34
21 Die Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse der Versuche kann nur in Kombination mit dem Erscheinungsbild der geschädigten Zellen und der Zellkontrolle erfolgen Statistische Auswertung der Ergebnisse Die einzelnen Versuche wurden mindestens drei mal durchgeführt und aus den berechneten Zytotoxizitäten die Mittelwerte gebildet. Σ x i Mittelwert der Zytotoxizität = x i Einzelwerte der Zytotoxizität n n Anzahl der Versuche Die Standardabweichung errechnet sich: Σ ( x i - ) 2 SD Standardabweichung der Zytotoxizität SD = x i Einzelwerte der Zytotoxizität n 1 Mittelwert der Zytotoxizität Daraus berechnet man den Standardfehler des Mittelwertes: SD SE = n SE Standardfehler des Mittelwertes Der Begriff t-test umschreibt mehrere Verfahren zur Überprüfung von Mittelwertunterschieden. In unserem Fall haben wir zwei miteinander zu vergleichende Stichproben, die nicht voneinander abhängig sind. Mit Hilfe des F-Testes wird zunächst überprüft, ob die beiden Varianzen homogen d.h. gleich oder ähnlich sind. Man berechnet den Quotienten der Varianzen, wobei die größere oben steht. F Ergebnis des F-Testes F = σ 1 Varianz der Stichprobe 1 2 σ 2 σ 2 Varianz der Stichprobe 2 σ 1 2 Anschließend wurde auf Signifikanz mit Hilfe des t-test nach Student zweiseitig mit ungepaarten Stichproben geprüft. Es wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,05 bzw. 0,01 gewählt. Daraus ergab sich die Entscheidung, ob ein Ergebnis signifikant bzw. hochsignifikant ist. Die Prüfung erfolgte mit dem Programm Excel. 1-2 n 1 n 2 (n 1 + n 2 2) T = (n 1-1)SD x1 ² + (n 2-1)SD x2 ² n 1 + n Mittelwert 1 n 2 - Anzahl der Messwerte Mittelwert 2 SD x1 - Standardabweichung von 1 n 1 - Anzahl der Messwerte 1 SD x2 - Standardabweichung von 2 35
2. Materialien Zellen U937-Zellen. 2. Materialien
 2. Materialien 2.1. Zellen 2.1.1. U937-Zellen Für den AART und die Zytotoxizitätsbestimmungen wurden U937-Zellen verwendet, die vom Institut für Physiologische Chemie der Universität Mainz, Abteilung angewandte
2. Materialien 2.1. Zellen 2.1.1. U937-Zellen Für den AART und die Zytotoxizitätsbestimmungen wurden U937-Zellen verwendet, die vom Institut für Physiologische Chemie der Universität Mainz, Abteilung angewandte
Coffein-Natriumbenzoat Coffeinum-natrii benzoas Synonym: Coffeinum-Natrium benzoicum
 !!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende revidierte Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (Österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmenf sind bis zum 15.September 2008 an folgende Adresse
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende revidierte Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (Österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmenf sind bis zum 15.September 2008 an folgende Adresse
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 22. September 2017, 13 bis 16 Uhr. Dr. Stephanie Möller & Prof. Dr. Thomas Jüstel.
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 22. September 2017, 13 bis 16 Uhr Dr. Stephanie Möller & Prof. Dr. Thomas Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 22. September 2017, 13 bis 16 Uhr Dr. Stephanie Möller & Prof. Dr. Thomas Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Chloro(triphenylphosphin)gold(I)
 raktikum Org. und Anorg. Chemie II D-CHAB Wintersemester 04/05 Zürich, den 1. März 2005 [(h 3 )] 1 1. SYNTHESE 1.1 Methode [1] Elementares Gold wird mit Königswasser aufgeschlossen und durch Zugabe von
raktikum Org. und Anorg. Chemie II D-CHAB Wintersemester 04/05 Zürich, den 1. März 2005 [(h 3 )] 1 1. SYNTHESE 1.1 Methode [1] Elementares Gold wird mit Königswasser aufgeschlossen und durch Zugabe von
Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius
 Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius Definition Das durch Abkratzen von Stämmen von Picea abies gewonnene vom Baum selbst abgesonderte Produkt. Sammelvorschrift Picea abies kann sehr unterschiedliche
Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius Definition Das durch Abkratzen von Stämmen von Picea abies gewonnene vom Baum selbst abgesonderte Produkt. Sammelvorschrift Picea abies kann sehr unterschiedliche
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 14. März Prof. Dr. T. Jüstel. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 14. März 2007 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 14. März 2007 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Qualitative anorganische Analyse
 Qualitative anorganische Analyse Grundprinzip: nicht Stoffe (chemische Verbindungen) werden nachgewiesen, sondern die Ionen, aus denen sie aufgebaut sind Ergebnisform: (auf einem A4 oder A5 Blatt mit Namen,
Qualitative anorganische Analyse Grundprinzip: nicht Stoffe (chemische Verbindungen) werden nachgewiesen, sondern die Ionen, aus denen sie aufgebaut sind Ergebnisform: (auf einem A4 oder A5 Blatt mit Namen,
Chemie-Labothek zur Photochemie
 Fluoreszenz und Phosphoreszenz, Echtfarbenemissionsspektren (EFES) V1: Fluoreszenz und Phosphoreszenz Arbeitsmaterialien: Waage Mörser mit Pistill Porzellanschale Bunsenbrenner UV-Handlampe 7 Reagenzgläser
Fluoreszenz und Phosphoreszenz, Echtfarbenemissionsspektren (EFES) V1: Fluoreszenz und Phosphoreszenz Arbeitsmaterialien: Waage Mörser mit Pistill Porzellanschale Bunsenbrenner UV-Handlampe 7 Reagenzgläser
1. Einleitung Materialien...6
 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...1 2. Materialien...6 2.1. Zellen... 6 2.1.1. U937-Zellen... 6 2.1.2. HaCaT-Zellen... 7 2.2. Geräte und Hilfsmittel... 8 2.3. Chemikalien und Testkits... 9 2.4. Testsubstanzen...
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...1 2. Materialien...6 2.1. Zellen... 6 2.1.1. U937-Zellen... 6 2.1.2. HaCaT-Zellen... 7 2.2. Geräte und Hilfsmittel... 8 2.3. Chemikalien und Testkits... 9 2.4. Testsubstanzen...
Coffeincitrat Coffeini citras Synonym: Coffeinum citricum
 !!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende revidierte Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (Österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmenf sind bis zum 15.September 2008 an folgende Adresse
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende revidierte Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (Österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmenf sind bis zum 15.September 2008 an folgende Adresse
Experiment: Synthese von Gold-Nanopartikeln (Klasse 9)
 Experiment: Synthese von Gold-Nanopartikeln (Klasse 9) Chemikalien Gold(III)-chlorid-Lösung c = 0,000 44 mol/l Natriumcitrat-Lösung c = 1 % Geräte siedendes Wasserbad, Reagenzgläser, Messpipette 10 ml,
Experiment: Synthese von Gold-Nanopartikeln (Klasse 9) Chemikalien Gold(III)-chlorid-Lösung c = 0,000 44 mol/l Natriumcitrat-Lösung c = 1 % Geräte siedendes Wasserbad, Reagenzgläser, Messpipette 10 ml,
lg k ph Profil Versuchsprotokoll Versuch Flüssig D2 1. Stichworte
 Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb, Carina Mönig, Iris Korte Versuchsprotokoll Versuch Flüssig D2 lg k ph Profil 1. Stichworte Reaktionskinetik, Reaktionsordnung, Reaktionsmolekularität Stabilität von wässrigen
Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb, Carina Mönig, Iris Korte Versuchsprotokoll Versuch Flüssig D2 lg k ph Profil 1. Stichworte Reaktionskinetik, Reaktionsordnung, Reaktionsmolekularität Stabilität von wässrigen
Präparat 6: Darstellung von Methylorange (4 Dimethylaminoazobenzol-4 -sulfonsäure, Natriumsalz) - Azofarbstoff -
 Christina Sauermann 1 C- A- Praktikum Präparat 6: Darstellung von Methylorange (4 Dimethylaminoazobenzol-4 -sulfonsäure, atriumsalz) - Azofarbstoff - Die Darstellung von Methylorange erfolgt in zwei Teilschritten:
Christina Sauermann 1 C- A- Praktikum Präparat 6: Darstellung von Methylorange (4 Dimethylaminoazobenzol-4 -sulfonsäure, atriumsalz) - Azofarbstoff - Die Darstellung von Methylorange erfolgt in zwei Teilschritten:
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 13. September 2016, Uhr. Prof. Dr. Thomas Jüstel, Stephanie Möller M.Sc.
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 13. September 2016, 8.00 11.00 Uhr Prof. Dr. Thomas Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 13. September 2016, 8.00 11.00 Uhr Prof. Dr. Thomas Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe
p53-menge bei 4197 nach Bestrahlung mit 4Gy Röntgenstrahlung 3,51 PAb421 PAb1801 PAb240 Do-1 Antikörper
 1.1 STRAHLENINDUZIERTE P53-MENGE 1.1.1 FRAGESTELLUNG Die Kenntnis, daß ionisierende Strahlen DNA Schäden verursachen und daß das Protein p53 an den zellulären Mechanismen beteiligt ist, die der Manifestation
1.1 STRAHLENINDUZIERTE P53-MENGE 1.1.1 FRAGESTELLUNG Die Kenntnis, daß ionisierende Strahlen DNA Schäden verursachen und daß das Protein p53 an den zellulären Mechanismen beteiligt ist, die der Manifestation
V 2 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration und der Temperatur bei der Reaktion von Kaliumpermanganat mit Oxalsäure in Lösung
 V 2 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration und der Temperatur bei der Reaktion von Kaliumpermanganat mit Oxalsäure in Lösung Bei diesem Versuch geht es darum, die Geschwindigkeit
V 2 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration und der Temperatur bei der Reaktion von Kaliumpermanganat mit Oxalsäure in Lösung Bei diesem Versuch geht es darum, die Geschwindigkeit
Darstellung von Malachitgrün Präparat 5
 Janine Schneider 22.05.00 Darstellung von Malachitgrün Präparat 5 1. Reaktionstyp: säurekatalysierte Kondensation (elektrophile Substitution) 2. Reaktionsgleichung: O + 2 ( + ) Benzaldehyd N,N- Dimethylanilin
Janine Schneider 22.05.00 Darstellung von Malachitgrün Präparat 5 1. Reaktionstyp: säurekatalysierte Kondensation (elektrophile Substitution) 2. Reaktionsgleichung: O + 2 ( + ) Benzaldehyd N,N- Dimethylanilin
Darstellung von Phenolphthalein und Fluorescein
 Philipps-Universität Marburg 04. Juli 2007 Fachbereich 15: Chemie rganisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten Praktikumsleiter: Dr. Philipp Reiß SS 2007 Mario Gerwig Versuch: Darstellung
Philipps-Universität Marburg 04. Juli 2007 Fachbereich 15: Chemie rganisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten Praktikumsleiter: Dr. Philipp Reiß SS 2007 Mario Gerwig Versuch: Darstellung
SOP_018_Glucosebestimmung
 SOP_018_Glucosebestimmung Inhalt Version erstellt am erstellt durch freigegeben durch D Glucosebestimmung in Fermentationsproben 001 11.08.11 Laborpraxis Frank Eiden mittels UV - Test Einsatzgebiet: UV
SOP_018_Glucosebestimmung Inhalt Version erstellt am erstellt durch freigegeben durch D Glucosebestimmung in Fermentationsproben 001 11.08.11 Laborpraxis Frank Eiden mittels UV - Test Einsatzgebiet: UV
3011 Synthese von erythro-9,10-dihydroxystearinsäure aus Ölsäure
 311 Synthese von erythro-9,1-dihydroxystearinsäure aus Ölsäure COOH KMnO 4 /NaOH HO HO COOH C 18 H 34 O 2 (282.5) KMnO 4 (158.) NaOH (4.) C 18 H 36 O 4 (316.5) Literatur A. Lapworth und E. N. Mottram,
311 Synthese von erythro-9,1-dihydroxystearinsäure aus Ölsäure COOH KMnO 4 /NaOH HO HO COOH C 18 H 34 O 2 (282.5) KMnO 4 (158.) NaOH (4.) C 18 H 36 O 4 (316.5) Literatur A. Lapworth und E. N. Mottram,
Synthese von eritreo- und reo-8,9,epoxy-p-menth-2-enl-on
 Praktikum Anorganische und rganische Chemie I Assistent: Matthias berli Synthese von eritreo- und reo-8,9,epoxy-p-menth-2-enl-on Dietikon, 24. April 2008 Jorge Ferreiro fjorge@student.ethz.ch 1 Zusammenfassung
Praktikum Anorganische und rganische Chemie I Assistent: Matthias berli Synthese von eritreo- und reo-8,9,epoxy-p-menth-2-enl-on Dietikon, 24. April 2008 Jorge Ferreiro fjorge@student.ethz.ch 1 Zusammenfassung
C Säure-Base-Reaktionen
 -V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
-V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
Praktikum Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe. Abschlussklausur. am 25.
 D E P A R T M E N T P H A R M A Z I E - Z E N T R U M F Ü R P H A R M A F O R S C H U N G Praktikum Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe Abschlussklausur
D E P A R T M E N T P H A R M A Z I E - Z E N T R U M F Ü R P H A R M A F O R S C H U N G Praktikum Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe Abschlussklausur
Säure-Base Titrationen
 Chemie Praktikum Säure-Base Titrationen WS 2006/2007 Verfasser: Lorenz Germann, Lukas Bischoff Versuchsteilnehmer: Lorenz Germann, Lukas Bischoff Datum: 29.11.2006 Assistent: Lera Tomasic E-mail: lukas-bischoff@student.ethz.ch
Chemie Praktikum Säure-Base Titrationen WS 2006/2007 Verfasser: Lorenz Germann, Lukas Bischoff Versuchsteilnehmer: Lorenz Germann, Lukas Bischoff Datum: 29.11.2006 Assistent: Lera Tomasic E-mail: lukas-bischoff@student.ethz.ch
SALICYLAMID. Salicylamidum Salicylsäureamid. 2-Hydroxybenzamid Gehalt: 99,0 bis 101,0% Salicylamid (getrocknete Substanz)
 SALICYLAMID Salicylamidum Salicylsäureamid C7H7NO2 Mr = 137,1 CAS Nr. 65-45-2 Definition 2-Hydroxybenzamid Gehalt: 99,0 bis 101,0% Salicylamid (getrocknete Substanz) Eigenschaften: Aussehen: weißes bis
SALICYLAMID Salicylamidum Salicylsäureamid C7H7NO2 Mr = 137,1 CAS Nr. 65-45-2 Definition 2-Hydroxybenzamid Gehalt: 99,0 bis 101,0% Salicylamid (getrocknete Substanz) Eigenschaften: Aussehen: weißes bis
VL Limnochemie
 VL Limnochemie Redoxreaktionen und -gleichgewichte WIEDERHOLUNG: SAUERSTOFF 1 Henry-Gesetz Massenwirkungsgesetz für den Fall: gasförmiger Stoff löst sich in Wasser A gas A fl K H = c(a fl ) c(a gas ) Henry-
VL Limnochemie Redoxreaktionen und -gleichgewichte WIEDERHOLUNG: SAUERSTOFF 1 Henry-Gesetz Massenwirkungsgesetz für den Fall: gasförmiger Stoff löst sich in Wasser A gas A fl K H = c(a fl ) c(a gas ) Henry-
Eingestellter Ginkgotrockenextrakt
 Eingestellter Ginkgotrockenextrakt Ginkgo extractum siccum normatum Definition Eingestellter Ginkgotrockenextrakt wird hergestellt aus den getrockneten Blättern von Ginkgo biloba L. Er enthält mindestens
Eingestellter Ginkgotrockenextrakt Ginkgo extractum siccum normatum Definition Eingestellter Ginkgotrockenextrakt wird hergestellt aus den getrockneten Blättern von Ginkgo biloba L. Er enthält mindestens
Laborprotokoll Qualitative Analyse Ralph Koitz, Einzelsalz
 1. Einzelsalz Aufgabenstellung: Nasschemische qualitative Analyse eines anorganischen Einzelsalzes. o Farblose, grobkörnige Kristalle o Flammenfärbung: leicht orange, nicht charakteristisch da vermutlich
1. Einzelsalz Aufgabenstellung: Nasschemische qualitative Analyse eines anorganischen Einzelsalzes. o Farblose, grobkörnige Kristalle o Flammenfärbung: leicht orange, nicht charakteristisch da vermutlich
D-(+)-Biotin (Vitamin H)
 D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
Synthese von cis- und trans-stilben
 28. April 2008 eifer Manuel raktikum in Organischer Chemie (OC 1) Frühjahrssemester 2008 529-0230-00L eifer Manuel Synthese von cis- und trans-stilben Janosch Ehrenmann BSc Biotechnologie D CHAB, ETH Zürich
28. April 2008 eifer Manuel raktikum in Organischer Chemie (OC 1) Frühjahrssemester 2008 529-0230-00L eifer Manuel Synthese von cis- und trans-stilben Janosch Ehrenmann BSc Biotechnologie D CHAB, ETH Zürich
Carbonat, Hydrogencarbonat
 Chlorid a) Die Lösung die einer Menge Substanz, die etwa 2 mg Chlorid entspricht, in 2 ml Wasser R oder 2 ml der vorgeschrieben Lösung werden verwendet. Diese Lösung wird mit verdünnter Salpetersäure R
Chlorid a) Die Lösung die einer Menge Substanz, die etwa 2 mg Chlorid entspricht, in 2 ml Wasser R oder 2 ml der vorgeschrieben Lösung werden verwendet. Diese Lösung wird mit verdünnter Salpetersäure R
+ MnO MnO 3. Oxidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole. Chemikalien. Materialien
 DaChS xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole 1 Versuch Nr. 005 xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole C 3 Mn - 4 (violett) 3 C Mn 2 (braun) 3 C C 3 Mn - 4 (violett)
DaChS xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole 1 Versuch Nr. 005 xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole C 3 Mn - 4 (violett) 3 C Mn 2 (braun) 3 C C 3 Mn - 4 (violett)
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
8. Löslichkeit verschiedener Salze bestimmen
 Praktikum Chemie N 8 Classe : Date de la remise : Note sur 10 : Nom(s) : 8. Löslichkeit verschiedener Salze bestimmen Video Löslichkeit Die Löslichkeit eines Stoffes gibt an, in welchem Umfang ein Reinstoff
Praktikum Chemie N 8 Classe : Date de la remise : Note sur 10 : Nom(s) : 8. Löslichkeit verschiedener Salze bestimmen Video Löslichkeit Die Löslichkeit eines Stoffes gibt an, in welchem Umfang ein Reinstoff
3,58 g 0,136 g. ad 100 ml
 9 Anhang 9.1 Rezepturen der Puffer und Lösungen 9.1.1 Vorbereitung der Proben zur Extraktion Coon s-puffer (0,1 M, ph 7,2-7,6) Na 2 HPO 4 x 12 H 2 O KH 2 PO 4 Aqua dest. 3,58 g 0,136 g 8,77 g 9.1.2 Aufbereitung
9 Anhang 9.1 Rezepturen der Puffer und Lösungen 9.1.1 Vorbereitung der Proben zur Extraktion Coon s-puffer (0,1 M, ph 7,2-7,6) Na 2 HPO 4 x 12 H 2 O KH 2 PO 4 Aqua dest. 3,58 g 0,136 g 8,77 g 9.1.2 Aufbereitung
LEE2: 2. Messung der Molrefraktion der Flüssigkeiten für die Bestimmung der Qualität des Rohmaterials
 ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
Untersuchungen zum Mechanismus der UV-B-protektiven Wirkung von Huminsäuren in vitro
 Untersuchungen zum Mechanismus der UV-B-protektiven Wirkung von Huminsäuren in vitro Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr.rer.nat.) vorgelegt der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen
Untersuchungen zum Mechanismus der UV-B-protektiven Wirkung von Huminsäuren in vitro Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr.rer.nat.) vorgelegt der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen
Tris(acetylacetonato)cobalt(III)
 Tris(acetylacetonato)cobalt(III) [Co(C5H7)3] Cobalt(III)acetylacetonat Zürich, 7. November 004 Raphael Aardoom, ACP 1 Synthese 1.1 Methode [1] Cobalt(II)carbonat reagiert mit Acetylaceton in Gegenwart
Tris(acetylacetonato)cobalt(III) [Co(C5H7)3] Cobalt(III)acetylacetonat Zürich, 7. November 004 Raphael Aardoom, ACP 1 Synthese 1.1 Methode [1] Cobalt(II)carbonat reagiert mit Acetylaceton in Gegenwart
Anorganische-Chemie. Michael Beetz Arbeitskreis Prof. Bein. Grundpraktikum für Biologen 2017
 Michael Beetz Arbeitskreis Prof. Bein Butenandstr. 11, Haus E, E 3.027 michael.beetz@cup.uni-muenchen.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2017 Trennungsgänge und Nachweise # 2 Trennungsgänge
Michael Beetz Arbeitskreis Prof. Bein Butenandstr. 11, Haus E, E 3.027 michael.beetz@cup.uni-muenchen.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2017 Trennungsgänge und Nachweise # 2 Trennungsgänge
Meisterwurz. Imperatoriae Radix. Radix Imperatoriae
 ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
Wirkstoffhaltige Suppositorien
 Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb Versuchsprotokoll Versuch Halbfest 9 Wirkstoffhaltige Suppositorien 1. Stichworte Suppositorien (Anwendung, Grundlagen, Hilfstoffe) Herstellung (Münzel-Verfahren, Eichwert-Verfahren,
Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb Versuchsprotokoll Versuch Halbfest 9 Wirkstoffhaltige Suppositorien 1. Stichworte Suppositorien (Anwendung, Grundlagen, Hilfstoffe) Herstellung (Münzel-Verfahren, Eichwert-Verfahren,
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!!
 !!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende neue Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf sind bis zum 31.05.2014 an folgende
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende neue Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf sind bis zum 31.05.2014 an folgende
Aspirin und Paracetamol im chemischen Vergleich
 Aspirin und Paracetamol im chemischen Vergleich Achtung Aspirin und Paracetamol sind geschützte Namen und dürfen nicht ohne weiteres verwendet werden. Strukturformeln Aus den Strukturformeln leiten wir
Aspirin und Paracetamol im chemischen Vergleich Achtung Aspirin und Paracetamol sind geschützte Namen und dürfen nicht ohne weiteres verwendet werden. Strukturformeln Aus den Strukturformeln leiten wir
Protokoll Kurstag 7. Blatt & Blattpigmente. 1) Einleitung
 Datum: 10.12.09 Protokoll Kurstag 7 Blatt & Blattpigmente 1) Einleitung Einige Pflanzenzellen enthalten spezielle Farbstoffe (Pigmente), um Fotosynthese betreiben zu können, zum Schutz vor UV-Strahlung
Datum: 10.12.09 Protokoll Kurstag 7 Blatt & Blattpigmente 1) Einleitung Einige Pflanzenzellen enthalten spezielle Farbstoffe (Pigmente), um Fotosynthese betreiben zu können, zum Schutz vor UV-Strahlung
Trisacetylacetonatoferrat(III) Fe(acac) 3
 Trisacetylacetonatoferrat(III) Fe(acac) 3 Mols, 21. 11. 2004 Marco Lendi, AC II 1. Synthese 1.1 Methode Wasserfreies Eisen(III)chlorid wird in wässriger, basischer Lösung durch Erhitzen in Eisen(III)hydroxid
Trisacetylacetonatoferrat(III) Fe(acac) 3 Mols, 21. 11. 2004 Marco Lendi, AC II 1. Synthese 1.1 Methode Wasserfreies Eisen(III)chlorid wird in wässriger, basischer Lösung durch Erhitzen in Eisen(III)hydroxid
4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen
 Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
GEBRAUCHSANLEITUNG. Lowry Assay Kit. Kit für die Proteinkonzentrationsbestimmung. (Kat.-Nr )
 GEBRAUCHSANLEITUNG Lowry Assay Kit Kit für die Proteinkonzentrationsbestimmung (Kat.-Nr. 39236) SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010
GEBRAUCHSANLEITUNG Lowry Assay Kit Kit für die Proteinkonzentrationsbestimmung (Kat.-Nr. 39236) SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A3 - Atomspektren - BALMER-Serie» Martin Wolf Betreuer: DP Emmrich Mitarbeiter: Martin Helfrich
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A3 - Atomspektren - BALMER-Serie» Martin Wolf Betreuer: DP Emmrich Mitarbeiter: Martin Helfrich
Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie
 Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Seminar: Photometrie
 Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE. T. Golubkova, M. Murkovic
 5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE T. Golubkova, M. Murkovic Institut für Biochemie Technische Universität, Graz, Österreich Einleitung Während
5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE T. Golubkova, M. Murkovic Institut für Biochemie Technische Universität, Graz, Österreich Einleitung Während
QUALITATIVE UNTERSUCHUNGEN
 QUALITATIVE UNTERSUCHUNGEN Allgemeiner Alkaloid-Nachweis Cinchonae cortex 0.5 g gepulverte Droge werden mit 10 ml 0.2 M Schwefelsäure geschüttelt und abfiltriert. 2 ml aus den Extrakten werden in Reagenzgläser
QUALITATIVE UNTERSUCHUNGEN Allgemeiner Alkaloid-Nachweis Cinchonae cortex 0.5 g gepulverte Droge werden mit 10 ml 0.2 M Schwefelsäure geschüttelt und abfiltriert. 2 ml aus den Extrakten werden in Reagenzgläser
Allgemeine Chemie I (AC) HS 2011 Übungen Serie 6
 Prof. A. Togni, D-CHAB, HCI H 239 Allgemeine Chemie I (AC) HS 2011 Übungen Serie 6 Säure-Base-Gleichgewichte E 1. Sie möchten 200 ml einer Pufferlösung mit ph = 5.00 mit dem Säure-Base-Paar Essigsäure
Prof. A. Togni, D-CHAB, HCI H 239 Allgemeine Chemie I (AC) HS 2011 Übungen Serie 6 Säure-Base-Gleichgewichte E 1. Sie möchten 200 ml einer Pufferlösung mit ph = 5.00 mit dem Säure-Base-Paar Essigsäure
Endersch, Jonas Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Platz 53
 Endersch, Jonas 30.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 2.5a: Herstellung von Cholesterylbenzoat Reaktionsgleichung: Einleitung und Theorie: In diesem Versuch
Endersch, Jonas 30.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 2.5a: Herstellung von Cholesterylbenzoat Reaktionsgleichung: Einleitung und Theorie: In diesem Versuch
SERVA Streptavidin Agarose Resin Agarosematrix zur Affinitätsreinigung von biotinylierten Biomolekülen
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA Streptavidin Agarose Resin Agarosematrix zur Affinitätsreinigung von biotinylierten Biomolekülen (Kat.-Nr. 42177) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA Streptavidin Agarose Resin Agarosematrix zur Affinitätsreinigung von biotinylierten Biomolekülen (Kat.-Nr. 42177) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 19. März Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 19. März 2014 Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 19. März 2014 Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der
Schulversuchspraktikum. Jans Manjali. Sommersemester Klassenstufen 9 & 10. Titration. Kurzprotokoll
 Schulversuchspraktikum Jans Manjali Sommersemester 2015 Klassenstufen 9 & 10 Titration Kurzprotokoll Auf einen Blick: Die hier vorgestellte Argentometrie ist eine Fällungstitration, bei der Silberionen
Schulversuchspraktikum Jans Manjali Sommersemester 2015 Klassenstufen 9 & 10 Titration Kurzprotokoll Auf einen Blick: Die hier vorgestellte Argentometrie ist eine Fällungstitration, bei der Silberionen
Organische Hilfsstoffe/Ascorbinsäure
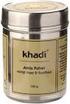 ZUCKER Organische Hilfsstoffe/Ascorbinsäure Teil I Gestermann L., Lehmann S., Pick A. Stein G., Fleischer R., Wiese M. Pharmazeutische Chemie Endenich Universität Bonn, FRG Bearbeitet wurden folgende Substanzen:
ZUCKER Organische Hilfsstoffe/Ascorbinsäure Teil I Gestermann L., Lehmann S., Pick A. Stein G., Fleischer R., Wiese M. Pharmazeutische Chemie Endenich Universität Bonn, FRG Bearbeitet wurden folgende Substanzen:
Echt ätzend! - Was ist und wie wirkt Abflussreiniger?
 Echt ätzend! - Was ist und wie wirkt Abflussreiniger? Versuch 1: Zusammensetzung von festem Abflussreiniger (Analyse nach Prof. Pick ): fester Abflussreiniger (z.b. Drano Rohrfrei) Petrischale, Holzstab
Echt ätzend! - Was ist und wie wirkt Abflussreiniger? Versuch 1: Zusammensetzung von festem Abflussreiniger (Analyse nach Prof. Pick ): fester Abflussreiniger (z.b. Drano Rohrfrei) Petrischale, Holzstab
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 17. März Prof. Dr. T. Jüstel. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 17. März 2010 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 17. März 2010 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Nährstoffe und Nahrungsmittel
 1 Weitere Lehrerversuche Schulversuchspraktikum Annika Nüsse Sommersemester 2016 Klassenstufen 5 & 6 Nährstoffe und Nahrungsmittel Kurzprotokoll 1 Weitere Lehrerversuche Auf einen Blick: Der Lehrerversuch
1 Weitere Lehrerversuche Schulversuchspraktikum Annika Nüsse Sommersemester 2016 Klassenstufen 5 & 6 Nährstoffe und Nahrungsmittel Kurzprotokoll 1 Weitere Lehrerversuche Auf einen Blick: Der Lehrerversuch
Klausur Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen)
 Klausur Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) WS2014/15 6. Fachsemester 1. Wiederholungsklausur: 10.04.2015 Name (in
Klausur Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) WS2014/15 6. Fachsemester 1. Wiederholungsklausur: 10.04.2015 Name (in
Schülerlabor. Modul: Funktionale Polymere. Betreuung durch das MPI für Polymerforschung, Mainz (Gunnar Kircher und Wolfgang H.
 1 Schülerlabor Modul: Funktionale Polymere Betreuung durch das MPI für Polymerforschung, Mainz (Gunnar Kircher und Wolfgang H.Meyer) Lerninhalte: Projektschritte: Bedeutung von funktionalen Polymeren Struktur
1 Schülerlabor Modul: Funktionale Polymere Betreuung durch das MPI für Polymerforschung, Mainz (Gunnar Kircher und Wolfgang H.Meyer) Lerninhalte: Projektschritte: Bedeutung von funktionalen Polymeren Struktur
1) Redoxverhältnisse an einer Sediment-Wasser-Grenzfläche in einem Fluss
 1 Uebungen zur Prüfungsvorbereitung 4.12.14 1) Redoxverhältnisse an einer Sediment-Wasser-Grenzfläche in einem Fluss Die folgenden Tiefenprofile von gelöstem Mangan, Eisen und Sulfid (S 2- ) sowie die
1 Uebungen zur Prüfungsvorbereitung 4.12.14 1) Redoxverhältnisse an einer Sediment-Wasser-Grenzfläche in einem Fluss Die folgenden Tiefenprofile von gelöstem Mangan, Eisen und Sulfid (S 2- ) sowie die
Synthese von 1,4-Di-t-butyl-2,5-dimethoxybenzol
 Praktikum in Organischer Chemie (OCP 1) Frühjahrssemester 2008 529-0230-00L Peifer Manuel Synthese von 1,4-Di-t-butyl-2,5-dimethoxybenzol Janosch Ehrenmann BSc Biotechnologie D CHAB, ETH Zürich Zürich,
Praktikum in Organischer Chemie (OCP 1) Frühjahrssemester 2008 529-0230-00L Peifer Manuel Synthese von 1,4-Di-t-butyl-2,5-dimethoxybenzol Janosch Ehrenmann BSc Biotechnologie D CHAB, ETH Zürich Zürich,
- 2 - Das folgende retrosynthetische Schema erwies sich als geeignet, die gewünschte Zielverbindung darzustellen. TEG. Abbildung 1
 - 1 - Protokoll ynthese von 4(3)-[4-(triethylenglykolmethylether)-3,5-dimetylphenyl]- cyclohepta-2,4,6-trienyl-[n-(triethylenglykolmethylether)-n- (methyl)-anilin] N rganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum
- 1 - Protokoll ynthese von 4(3)-[4-(triethylenglykolmethylether)-3,5-dimetylphenyl]- cyclohepta-2,4,6-trienyl-[n-(triethylenglykolmethylether)-n- (methyl)-anilin] N rganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum
Standardabweichung und Variationskoeffizient. Themen. Prinzip. Material TEAS Qualitätskontrolle, Standardabweichung, Variationskoeffizient.
 Standardabweichung und TEAS Themen Qualitätskontrolle, Standardabweichung,. Prinzip Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Streuung der Messwerte um den eigenen Mittelwert ist. Sie ist eine statistische
Standardabweichung und TEAS Themen Qualitätskontrolle, Standardabweichung,. Prinzip Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Streuung der Messwerte um den eigenen Mittelwert ist. Sie ist eine statistische
Universität der Pharmazie
 Universität der Pharmazie Institut für Pharmazie Pharmazie-Straße 1 12345 Pharmastadt Identitäts-, Gehalts- und Reinheitsbestimmung von Substanzen in Anlehnung an Methoden des Europäischen Arzneibuchs
Universität der Pharmazie Institut für Pharmazie Pharmazie-Straße 1 12345 Pharmastadt Identitäts-, Gehalts- und Reinheitsbestimmung von Substanzen in Anlehnung an Methoden des Europäischen Arzneibuchs
Klausur in Anorganischer Chemie
 1 Klausur in Anorganischer Chemie zum Praktikum Chemie für Biologen, SS2000 Kurse SS Sa 20.05.2000 Name:... Vorname:... Wenn Nachschreiber aus einem der Vorkurse, bitte eintragen: Geb. am in Semester des
1 Klausur in Anorganischer Chemie zum Praktikum Chemie für Biologen, SS2000 Kurse SS Sa 20.05.2000 Name:... Vorname:... Wenn Nachschreiber aus einem der Vorkurse, bitte eintragen: Geb. am in Semester des
Pflanzenphysiologie. Versuch Stickstoffmetabolismus - Induktion der Nitratreduktase
 Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Biologie und Psychologie Pflanzenphysiologie Versuch Stickstoffmetabolismus - Induktion der Nitratreduktase Mitarbeiter: Brill, Martin Mai, Oliver Schoof,
Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Biologie und Psychologie Pflanzenphysiologie Versuch Stickstoffmetabolismus - Induktion der Nitratreduktase Mitarbeiter: Brill, Martin Mai, Oliver Schoof,
Rf-Werte für einige Saccharide: Arabinose 0,54 Fructose 0,51 Galactose 0,44
 Chromatographie 1996/IV/1 1 Bei der chromatographischen Analyse spielt der Verteilungskoeffizient K eine große Rolle für die Qualität der Auftrennung von Substanzgemischen. Er ist definiert als Quotient
Chromatographie 1996/IV/1 1 Bei der chromatographischen Analyse spielt der Verteilungskoeffizient K eine große Rolle für die Qualität der Auftrennung von Substanzgemischen. Er ist definiert als Quotient
4 Ergebnisse. 4.1 Evaluierung der Methode. 4.2 Allgemeine Beobachtungen. 4.3 CD68-positive Zellen 4 ERGEBNISSE 17
 4 ERGEBNISSE 17 4 Ergebnisse 4.1 Evaluierung der Methode Variationskoeffizient Zur Ermittlung der Messgenauigkeit wurde der mittlere Variationskoeffizient bestimmt [5]. Zur Bestimmung wurden 18 Präparate
4 ERGEBNISSE 17 4 Ergebnisse 4.1 Evaluierung der Methode Variationskoeffizient Zur Ermittlung der Messgenauigkeit wurde der mittlere Variationskoeffizient bestimmt [5]. Zur Bestimmung wurden 18 Präparate
Kohlenhydrat-Analytik
 Kohlenhydrat-Analytik Kohlenhydrate sind in ihrem strukturellen Aufbau sehr ähnlich. Eine spezifische Bestimmung wird dadurch erschwert. Ein gruppenweises Unterscheiden mit verschiedenen einfachen Nachweisreaktionen
Kohlenhydrat-Analytik Kohlenhydrate sind in ihrem strukturellen Aufbau sehr ähnlich. Eine spezifische Bestimmung wird dadurch erschwert. Ein gruppenweises Unterscheiden mit verschiedenen einfachen Nachweisreaktionen
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Beugung. Durchgeführt am Gruppe X. Name 1 und Name 2
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
2. Materialien Prüfsubstanzen
 6 2. Materialien 2.1. Prüfsubstanzen Bei allen Prüfsubstanzen handelt es sich um polyanionische Verbindungen, welchen keine totale Molekularstruktur zugeordnet werden kann. Die untersuchten Makromoleküle
6 2. Materialien 2.1. Prüfsubstanzen Bei allen Prüfsubstanzen handelt es sich um polyanionische Verbindungen, welchen keine totale Molekularstruktur zugeordnet werden kann. Die untersuchten Makromoleküle
Endersch, Jonas Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Gruppe 3, Platz 53
 Endersch, Jonas 13.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Gruppe 3, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 1.5: Dünnschicht und Säulenchromatographie Einleitung und Theorie In diesem Versuch wurden
Endersch, Jonas 13.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Gruppe 3, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 1.5: Dünnschicht und Säulenchromatographie Einleitung und Theorie In diesem Versuch wurden
Konzentrationsbestimmung mit Lösungen
 Kapitel 5 Konzentrationsbestimmung mit Lösungen Abb. 5.1: Die Farben von Universalindikatoren sind nützlich für Konzentrationsbestimmungen. Sie lernen auf den folgenden Seiten eine sehr nützliche Methode
Kapitel 5 Konzentrationsbestimmung mit Lösungen Abb. 5.1: Die Farben von Universalindikatoren sind nützlich für Konzentrationsbestimmungen. Sie lernen auf den folgenden Seiten eine sehr nützliche Methode
Wie Heavy Metal ist der Boden?
 Wie Heavy Metal ist der Boden? Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Ausbreitung von Schwermetallen im Boden 2. Analytische Aufschlussverfahren 3. Grundlagen der UV-VIS- und AAS-Spektroskopie 2 Schwermetalle
Wie Heavy Metal ist der Boden? Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Ausbreitung von Schwermetallen im Boden 2. Analytische Aufschlussverfahren 3. Grundlagen der UV-VIS- und AAS-Spektroskopie 2 Schwermetalle
ATTO 565 und ATTO 590
 ATTO 565 und ATTO 590 Allgemeine Informationen ATTO 565 und ATTO 590 sind Fluoreszenzmarker aus der Familie der Rhodamin-Farbstoffe. Diese Farbstoffe besitzen als gemeinsames Strukturelement einen Carboxyphenyl-
ATTO 565 und ATTO 590 Allgemeine Informationen ATTO 565 und ATTO 590 sind Fluoreszenzmarker aus der Familie der Rhodamin-Farbstoffe. Diese Farbstoffe besitzen als gemeinsames Strukturelement einen Carboxyphenyl-
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 11. September Prof. Dr. T. Jüstel. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 11. September 2013 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 11. September 2013 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Auswertung der Versuche mit Aminosäuren und Proteinen (Eiweiß)
 Auswertung der Versuche mit Aminosäuren und Proteinen (Eiweiß) Vorbereitung: Für die folgenden Versuche wird eine Eiweißlösung aus dem Eiklar eines ühnereis hergestellt, indem man dieses in 60 ml dest.
Auswertung der Versuche mit Aminosäuren und Proteinen (Eiweiß) Vorbereitung: Für die folgenden Versuche wird eine Eiweißlösung aus dem Eiklar eines ühnereis hergestellt, indem man dieses in 60 ml dest.
Untersuche die Wirkung verschiedener Säuren und Laugen auf natürliche und industriell hergestellte Indikatoren.
 Naturwissenschaften - Chemie - Säuren, Basen, Salze - 1 Säuren (P7157400) 1.5 Wirkung von Säuren und Laugen auf natürliche und technische Indikatoren Experiment von: Phywe Gedruckt: 15.10.2013 11:37:56
Naturwissenschaften - Chemie - Säuren, Basen, Salze - 1 Säuren (P7157400) 1.5 Wirkung von Säuren und Laugen auf natürliche und technische Indikatoren Experiment von: Phywe Gedruckt: 15.10.2013 11:37:56
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 11. Februar Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 11. Februar 2014 Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 11. Februar 2014 Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M.Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der
Photochemische Reaktion
 TU Ilmenau Chemisches Praktikum Versuch Fachgebiet Chemie 1. Aufgabe Photochemische Reaktion V5 Es soll die Reduktion des Eisen(III)-trisoxalats nach Gleichung (1) unter der Einwirkung von Licht untersucht
TU Ilmenau Chemisches Praktikum Versuch Fachgebiet Chemie 1. Aufgabe Photochemische Reaktion V5 Es soll die Reduktion des Eisen(III)-trisoxalats nach Gleichung (1) unter der Einwirkung von Licht untersucht
3021 Oxidation von Anthracen zu Anthrachinon
 xidation von Anthracen zu Anthrachinon Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Literatur Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Klassifizierung Reaktionstypen und Stoffklassen xidation Aromat,
xidation von Anthracen zu Anthrachinon Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Literatur Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Klassifizierung Reaktionstypen und Stoffklassen xidation Aromat,
4. Anorganisch-chemische Versuche
 4. Anorganisch-chemische Versuche o 4.4 Redoxreaktionen 4.4.1 Reduktion von Mangan(VII) in schwefelsaurer Lsg. 4.4.2 Oxidation von Mangan(II) in salpetersaurer Lsg. 4.4.3 Oxidation von Chrom(III) in alkalischer
4. Anorganisch-chemische Versuche o 4.4 Redoxreaktionen 4.4.1 Reduktion von Mangan(VII) in schwefelsaurer Lsg. 4.4.2 Oxidation von Mangan(II) in salpetersaurer Lsg. 4.4.3 Oxidation von Chrom(III) in alkalischer
Lösungen zu den Übungen zur Einführung in die Spektroskopie für Studenten der Biologie (SS 2011)
 Universität Konstanz Fachbereich Biologie Priv.-Doz. Dr. Jörg H. Kleinschmidt http://www.biologie.uni-konstanz.de/folding/home.html Datum: 26.5.211 Lösungen zu den Übungen zur Einführung in die Spektroskopie
Universität Konstanz Fachbereich Biologie Priv.-Doz. Dr. Jörg H. Kleinschmidt http://www.biologie.uni-konstanz.de/folding/home.html Datum: 26.5.211 Lösungen zu den Übungen zur Einführung in die Spektroskopie
4.1. Campylobacter-Keimzahlen auf Hähnchenschenkeln innerhalb einer Handels- Packung
 4. Ergebnisse 4.1. Campylobacter-Keimzahlen auf Hähnchenschenkeln innerhalb einer Handels- Packung Die Untersuchung der Verteilung der Campylobacter-Keimzahlen innerhalb einer Handels- Packung zeigte,
4. Ergebnisse 4.1. Campylobacter-Keimzahlen auf Hähnchenschenkeln innerhalb einer Handels- Packung Die Untersuchung der Verteilung der Campylobacter-Keimzahlen innerhalb einer Handels- Packung zeigte,
Lösungen, Stoffmengen und Konzentrationen
 12 Lösungen, Stoffmengen und Konzentrationen Lösungen sind homogene Mischungen reiner Stoffe, aber umgekehrt sind nicht alle homogenen Mischungen echte Lösungen. Echte Lösungen weisen nur zum Teil die
12 Lösungen, Stoffmengen und Konzentrationen Lösungen sind homogene Mischungen reiner Stoffe, aber umgekehrt sind nicht alle homogenen Mischungen echte Lösungen. Echte Lösungen weisen nur zum Teil die
Aufnahme einer Extinktionskurve. Themen. Prinzip. Material TEAS Photometrie, Extinktion, Verdünnung, Extinktionskurve
 Aufnahme einer TEAS Themen Photometrie, Extinktion, Verdünnung, Prinzip Eine Farbstofflösung wird zunächst hergestellt und anschließend die Extinktion bei verschiedenen Wellenlängen gemessen. Anschließend
Aufnahme einer TEAS Themen Photometrie, Extinktion, Verdünnung, Prinzip Eine Farbstofflösung wird zunächst hergestellt und anschließend die Extinktion bei verschiedenen Wellenlängen gemessen. Anschließend
Synthese von Acetylsalicylsäure (Aspirin)
 1 Grundlagen 1.1 Einleitung Synthese von Acetylsalicylsäure (Aspirin) von HRISTPH KÖLBL Acetylsalicylsäure, ist eines der weit verbreiteten Schmerz- und Entzündungshemmenden Mittel. Bekannt wurde Acetylsalicylsäure
1 Grundlagen 1.1 Einleitung Synthese von Acetylsalicylsäure (Aspirin) von HRISTPH KÖLBL Acetylsalicylsäure, ist eines der weit verbreiteten Schmerz- und Entzündungshemmenden Mittel. Bekannt wurde Acetylsalicylsäure
Fette, Öle und Tenside
 Schulversuchspraktikum Thomas Polle Sommersemester 2015 Klassenstufen 11 & 12 Fette, Öle und Tenside Kurzprotokoll Inhalt Inhaltsverzeichnis 1Weitere Lehrerversuche... 3 V1 Verseifungszahl... 3 2Weitere
Schulversuchspraktikum Thomas Polle Sommersemester 2015 Klassenstufen 11 & 12 Fette, Öle und Tenside Kurzprotokoll Inhalt Inhaltsverzeichnis 1Weitere Lehrerversuche... 3 V1 Verseifungszahl... 3 2Weitere
Qualitative Analyse. - Identifikation von Ionen (häufig in einem Gemisch) - Charakterisierung der Analyse nach Farbe, Morphologie, Geruch,
 - Identifikation von Ionen (häufig in einem Gemisch) - Charakterisierung der Analyse nach Farbe, Morphologie, Geruch, Löslichkeit - charakteristische Nachweisreaktionen für Einzelionen: - Fällungsreaktionen
- Identifikation von Ionen (häufig in einem Gemisch) - Charakterisierung der Analyse nach Farbe, Morphologie, Geruch, Löslichkeit - charakteristische Nachweisreaktionen für Einzelionen: - Fällungsreaktionen
1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug
 Anionennachweis 1 1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug Die moderne Analytische Chemie unterscheidet zwischen den Bereichen der qualitativen und quantitativen Analyse sowie der Strukturanalyse.
Anionennachweis 1 1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug Die moderne Analytische Chemie unterscheidet zwischen den Bereichen der qualitativen und quantitativen Analyse sowie der Strukturanalyse.
Einzelionennachweise des H2S-Trennungsgangs. Natrium Na + Kalium K + Ammonium NH4 + Blei Pb 2+ (für die Laborprüfung , LBT) Stand: 23.9.
 Einzelionennachweise des H2S-Trennungsgangs (für die Laborprüfung 771105, LBT) Stand: 23.9.2011 Natrium Na + gelbe Flammfärbung Kalium K + 1. mit Perchlorsäure im sauren Auszug der Urprobe: K + + ClO -
Einzelionennachweise des H2S-Trennungsgangs (für die Laborprüfung 771105, LBT) Stand: 23.9.2011 Natrium Na + gelbe Flammfärbung Kalium K + 1. mit Perchlorsäure im sauren Auszug der Urprobe: K + + ClO -
Praktische Übungen Chemie. Versuch 6
 Bauhaus-Universität Weimar Professur Bauchemie Prof. Dr. rer. nat. habil. Christian Kaps Praktische Übungen Chemie Versuch 6 Bestimmung der Wasserhärte Stand: April 2008 1. Grundlagen und Zielstellung
Bauhaus-Universität Weimar Professur Bauchemie Prof. Dr. rer. nat. habil. Christian Kaps Praktische Übungen Chemie Versuch 6 Bestimmung der Wasserhärte Stand: April 2008 1. Grundlagen und Zielstellung
Übung Vor-Ort Parameter / Elektroden (1)
 Übung Vor-Ort Parameter / Elektroden (1) 14.04.2009 Filtration / Probenstabilisierung Gegeben ist eine Oberflächenwasser-Probe versetzt mit einer definierten Menge Multi- Element-Standard. Für Gruppe 1,
Übung Vor-Ort Parameter / Elektroden (1) 14.04.2009 Filtration / Probenstabilisierung Gegeben ist eine Oberflächenwasser-Probe versetzt mit einer definierten Menge Multi- Element-Standard. Für Gruppe 1,
HybriScan D Abwasser Gesamtkeimzahlbestimmung
 HybriScan D Abwasser Gesamtkeimzahlbestimmung Modul I Molekularbiologisches Schnelltestsystem zum Nachweis von Bakterien im Abwasser Produkt-Nr.: 78436 Kontaktinformationen: HybriScan - Schnelltestsystem
HybriScan D Abwasser Gesamtkeimzahlbestimmung Modul I Molekularbiologisches Schnelltestsystem zum Nachweis von Bakterien im Abwasser Produkt-Nr.: 78436 Kontaktinformationen: HybriScan - Schnelltestsystem
Ein Gemisch aus 13,2 g (0,1mol) 2,5-Dimethoxyterahydrofuran und 80ml 0,6 N Salzsäure werden erhitzt bis vollständige Lösung eintritt.
 1.Acetondicarbonsäureanhydrid 40g (0,27mol)Acetondicarbonsäure werden in einer Lösung aus 100ml Eisessig und 43ml (0,45mol) Essigsäureanhydrid gelöst. Die Temperatur sollte 20 C nicht überschreiten und
1.Acetondicarbonsäureanhydrid 40g (0,27mol)Acetondicarbonsäure werden in einer Lösung aus 100ml Eisessig und 43ml (0,45mol) Essigsäureanhydrid gelöst. Die Temperatur sollte 20 C nicht überschreiten und
