Vermessungskunde II für Bauingenieure und Geodäten
|
|
|
- Gertrud Fiedler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Vermessungskunde II für Bauingenieure und Geodäten Teil 1: Übungen Lichtwiese Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 13
2
3 Inhaltsverzeichnis A. Übungsplan Vermessungskunde II Teil 1 3 B. Übungsplan Vermessungskunde II Teil 2 (Hauptvermessungsübung) 5 C. Allgemeines 7 1. Übung: Gebäudeabsteckung Aufgabe Wiederholung Instrumentarium Schnurlot Fluchtstab Rollbandmaß Winkelprisma (Doppelpentagonprisma) Nivellierinstrument Messverfahren Absteckung von Punkten Aufnahme von Punkten Versicherung von vermarkten Punkten auf ein Schnurgerüst Dokumentation Kartierung Vermessungsriss Übung Übungsvorgaben Übungsvorbereitung Übungsdurchführung Übungsauswertung Anleitung zur Absteckung des Gebäudes für den Fall A (siehe Abb. 1.15) Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement Aufgabe Wiederholung Instrumentarium Nivellier Nivellierlatten Lattenuntersatz Messverfahren Geometrische Höhenbestimmung Geometrisches Nivellement Prüfung des Nivellierinstrumentes: Die NÄBAUER-Probe Praktische Messanordnung Übung Übungsvorgaben Übungsdurchführung Übungsauswertung i
4 3. Übung: Rasteraufnahme und Berechnung des Baugrubenaushubes Aufgabe Wiederholung Instrumentarium Tachymeter Messverfahren Tachymetrische Aufnahme Polare Absteckung Berechnungsverfahren Interpolation Erdmengenberechnung Übung Übungsvorgaben Übungsvorbereitung Übungsdurchführung Übungsauswertung Übung: Gauß-Krüger-Koordinaten für Grenz- und Gebäudepunkte Aufgabe Wiederholung Instrumente Mess- und Berechnungsverfahren Polares Anhängen von einem bekannten und vermarkten Standpunkt Polares Anhängen von einem unbekannten, aber vermarkten Standpunkt Polares Anhängen von einem unbekannten Standpunkt (Freie Stationierung) Übung Übungsvorbereitung Übungsdurchführung Übungsauswertung Übung: Trassenberechnung Aufgabe Wiederholung Übungsvorgaben Definition Verbundkurve Trassierungselement Kreisbogen Definition über die Kreisbogenhauptpunkte Berechnung der Kreisbogenpunkte im lokalen Koordinatensystem Trassierungselement Klotoide Definition Klotoide Berechnung der Absteckelemente im lokalen Koordinatensystem Kontrollmaße Beispiel für die Berechnung einer Verbundkurve Berechnung der Stationslängen auf der Verbundkurve Stationierungen auf der Verbundkurve Berechnung der Stationskoordinaten in den lokalen Koordinatensystemen Transformation der lokalen Stationskoordinaten in das Zielkoordinatensystem A Kontrollmaße ii Inhaltsverzeichnis
5 6. Anhang Koordinaten- und Höhenangaben Pläne Übersichtsplan der Nivellementslinien Übersichtsplan der Grundstücke Absteckmaße der Grundstücke Formulare für Übung Formulare für Übung Formulare für Übung Formulare für Übung SS
6
7 A Übungsplan Vermessungskunde II Teil 1 1. Umlauf (Dienstag bzw. Mittwoch 14 Uhr) Gruppe Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 2 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Vorbesprechung Rechenübung Trasse 3 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 4 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 5 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 6 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 7 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 8 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 9 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 10 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 22 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 HVÜ-Vorbesprechung 2. Umlauf (Dienstag bzw. Mittwoch 14 Uhr) Gruppe Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 12 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Vorbesprechung Rechenübung Trasse 13 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 14 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 15 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 16 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 17 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 18 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 19 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 20 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 21 Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 HVÜ-Vorbesprechung Die Übungen finden grundsätzlich bei jeder Wetterlage statt! Datum Uhrzeit und Ort (13:30 Uhr, L ) Vorbesprechung der Übungen Teil (13:30 Uhr, S ) Hörsaalübung Trassenberechnung Abgabetermin Übung 5: Trassenberechnung (Briefkasten östliches Treppenhaus 1.OG L5 01) (13:30 Uhr, L ) Vorbesprechung Hauptvermessungsübung (HVÜ) 3
8 Zuordnung Grundstücke, Polygonpunkte und Nivellementslinien (siehe auch Seite 99 und 100): 1. Umlauf Dienstag Gruppe Grundstück Standpunkt Zielpunkt Nivellementslinie 1 4 PP2 PP PP3 PP PP5 PP PP22 PP PP23 PP PP25 PP Umlauf Mittwoch Gruppe Grundstück Standpunkt Zielpunkt Nivellementslinie 7 16 PP21 PP PP23 PP PP24 PP PP7 PP PP9 PP Umlauf Dienstag Gruppe Grundstück Standpunkt Zielpunkt Nivellementslinie 11 4 PP2 PP PP3 PP PP5 PP PP22 PP PP23 PP PP25 PP Umlauf Mittwoch Gruppe Grundstück Standpunkt Zielpunkt Nivellementslinie PP21 PP PP23 PP PP24 PP PP7 PP PP9 PP8 3 4 Übungsplan Vermessungskunde II Teil 1 SS 2017
9 B Übungsplan Vermessungskunde II Teil 2 (Hauptvermessungsübung) Die Hauptvermessungsübung (HVÜ) findet in drei Umläufen jeweils vom ,vom und vom auf dem Campus Lichtwiese statt. Jeder Umlauf beginnt mit der Einführungsveranstaltung am ersten Tag (17.07., bzw ) um 08:00 Uhr vor der Geräteausgabe. Der zweite Umlauf umfasst 5 Tage, da am Samstag und Sonntag ( und ), nicht gearbeitet wird. HVÜ-Gruppeneinteilung: Die HVÜ-Gruppen entsprechen grundsätzlich den Gruppen der Übungen in Vermessungskunde II Teil 1. Änderungen aus organisatorischen Gründen sind möglich. Umlauf 1 ( ): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Umlauf 2 ( ): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Umlauf 3 ( ): 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 5
10
11 C Allgemeines Atteste Atteste werden nur unter folgenden Bedingungen akzeptiert: Der Studierende hat bis spätestens eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung die Übungsleitung per informiert. Das Attest wurde spätestens am Tag der Veranstaltung ausgestellt. Das Attest wurde in der nächsten Sprechstunde (Donnerstag Uhr) nach der versäumten Veranstaltung der Übungsleitung im Original ausgehändigt. Übungsanerkennung Voraussetzungen für die Anerkennung der Übungen Teil 1 sind: Die persönliche Teilnahme an allen Übungen. Bei krankheitsbedingter Verhinderung (Attest, siehe Seite 7) ist die betreffende Übung bei einer anderen Gruppe nachzuholen. Die erfolgreiche Durchführung aller Übungen. Die termingerechte (siehe Abschnitt Übungsausarbeitung) und vollständige Abgabe aller Ausarbeitungen. Die Anerkennung der Übungen Teil 1 ist wiederum die Vorraussetzung für die Teilnahme an den Übungen Teil 2 (HVÜ) und muss spätestens bis zur HVÜ-Vorbesprechung erfolgt sein. Übungsvorbereitung Es ist für jede Übung erforderlich, dass sich die Studierenden im Selbststudium intensiv vorbereiten. Vor jeder Übung findet ein kurzes Kolloquium statt, um diese Vorbereitung zu überprüfen. Ist die Vorbereitung nicht ausreichend führt dies zum Übungsabbruch. Für einige der Übungen sind spezielle Vorbereitungen nötig (z.b. Lageplan erstellen), konkrete Angaben finden sie jeweils im entsprechenden Abschnitt Übungsvorbereitung. Übungsdurchführung Die Organisation der Übung ist Angelegenheit der Gruppe. Damit verbunden ist auch der Empfang und die vollständige Rückgabe der Geräte sowie die Verantwortung für den sachgemäßen Umgang mit diesen (Hinweise, siehe Abschnitt C). Die Aufgaben innerhalb der Übung sollten gleichmäßig auf alle Gruppenmitglieder verteilt werden, sodass jeder Studierende jeden Arbeitsgang mindestens einmal selbst durchgeführt hat. Das Instrumentarium wird zu Beginn der Übung in der Geräteausgabe bereitgestellt. Die Geräteausleihe erfolgt selbständig durch die Gruppen gegen eine Empfangsbescheinigung. Die ausgeliehenen Geräte sind schonend zu behandeln! Eventuelle Mängel der Messausrüstung, Beschädigungen oder Verlust sind dem Übungsleiter 7
12 unverzüglich zu melden. Anmerkung: Durch die TUD besteht kein Versicherungsschutz für die Vermessungsgeräte. Bei Verlusten und Beschädigungen durch Fahrlässigkeit haften die Mitglieder der betreffenden Gruppe gemeinsam. Bei Vorsatz haftet der Verursacher persönlich. Reparaturen dürfen nur durch das Institut für Geodäsie durchgeführt werden. Die Messergebnisse werden während der Übungen in Feldbüchern protokolliert. Feldbücher (Messprotokolle, Feldzeichnungen) sind während den Messungen in doppelter Ausfertigung mit Bleistift übersichtlich und gut leserlich zu führen, um nachträgliche Reinschriften wegen der Gefahr von Übertragungsfehlern zu vermeiden. Sämtliche Originale sind sorgfältig aufzubewahren und bleiben Bestandteil der Übungsergebnisse. Im Feldbuch sind anzugeben: Ort, Datum, benutztes Instrument (Hersteller, Typ, Inventarnummer), Beobachter, Feldbuchführer und Gruppennummer. Die notwendigen Kontrollen müssen bereits im Feld so weit durchgeführt werden, dass Mess- und Rechenfehler erkannt werden und gegebenenfalls sofortige Nachmessungen durchgeführt werden können. Die Übung ist beendet, wenn alle geforderten Übungsinhalte abgearbeitet wurden (einschließlich Kontrollen!), und der Übungsbetreuer die Übung abgenommen hat. Abschließend erfolgt eine Überprüfung des Messinstrumentariums (quantitativ und qualitativ) sowie die selbständige Abgabe der Messgeräte in der Geräteausgabe. Erachtet der Betreuer oder der Übungsleiter das Übungsziel als nicht erreicht (fehlerhafte Messungen, Überschreitung der Toleranzgrenzen, etc.) erfolgt eine Wiederholung der Übung. Es wird prinzipiell nur eine Wiederholung einer Übung zugelassen. Falls von einer Gruppe mehrfach Übungen wiederholt werden müssten, führt dies zum Ausschluss von der Lehrveranstaltung. Übungsausarbeitung Jede Gruppe fertigt eine Auswertung pro Übung an. Im Hinblick auf die spätere Klausurvorbereitung wird jedoch empfohlen, dass jedes Gruppenmitglied die Berechnungen im eigenen Skript durchführt. Spätestens ein Tag vor dem nächsten Übungstermin muss die Ausarbeitung dem Übungsbetreuer zum Testat vorgelegt werden. Falls die Ausarbeitung Fehler beinhaltet ist maximal 1 Wiedervorlage möglich, andernfalls gilt die Übung als nicht anerkannt. Die Ausarbeitung beinhaltet in der Regel: Originalfeldbuch bzw. eine Fotokopie des Originals, Ausgefüllte Formulare im Skript und/oder eigene Berechnungen, Ggf. zusätzliche Zeichnungen, Erläuterungen etc. Hinweise zum Umgang mit dem Instrumentarium Schonend mit dem Instrumentarium umgehen. Messinstrumente, Transportbehälter und Zubehör nie unbeaufsichtigt lassen. Instrumente beim Aufbau festhalten, bis sie mit dem feststehenden Stativ verschraubt sind. Zum Bewegen des Fernrohrs eines Instrumentes niemals Gewalt anwenden! 8 Allgemeines SS 2017
13 Bei Messbändern keine Schlaufenbildung zulassen und nicht auf das Band treten. Über das ausgerollte Messband darf außerdem kein Fahrzeug rollen, auch kein Fahrrad. Deshalb nach jeder Messung das Band sofort wieder einrollen. Den Feldschirm nie frei stehen lassen, da das Gestänge besonders bruchempfindlich ist. Das Instrumentarium nicht zweckentfremden (Kein Speerwurf mit Fluchtstäben!). Prismen, Lote, Messbänder und andere Kleinteile sollten nach der Benutzung wieder in den Beutel gelegt werden, um Verlust vorzubeugen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise gilt als grob fahrlässig! SS 2017 Allgemeines 9
14
15 1 Übung: Gebäudeabsteckung 1 Aufgabe Jede Gruppe steckt ein Gebäude nach den Vorgaben des Bebauungsplans auf ihrem Grundstück ab. Die Absteckmaße aus dem genehmigten Bauantrag sind rechtsverbindlich, d.h. Baulinien und Baugrenzen sind exakt einzuhalten. Nach der Absteckung erfolgt die Kontrolle durch eine Aufnahme im Orthogonal- und Einbindeverfahren sowie durch die Messung von Kontrollmaßen. Anschließend werden die vermarkten Gebäudeeckpunkte auf ein Schnurgerüst versichert. Im Vorfeld erfolgt die Berechnung der Grundstücksfläche aus orthogonalen Absteckmaßen. 2 Wiederholung Übung 6 WS: Statistische Auswertung ungleichgenauer Messungen 3 Instrumentarium Abb. 1.1.: Fluchtstab Abb. 1.2.: Schnurlot Abb. 1.3.: Rollbandmaß Abb. 1.4.: Maßanfänge 3.1 Schnurlot Das Schnurlot ist ein symmetrisches Metallstück, das an einer Schnur befestigt ist, siehe Abb Es realisiert somit direkt die Lotrichtung und dient zum Lotrechtstellen oder Zentrieren anderer geodätischer Instrumente. 3.2 Fluchtstab Fluchtstäbe dienen während der Messung zur Markierung von Vermessungspunkten, siehe Abb Für eine zentrische Aufstellung auf Pflöcken, Grenzsteinen oder bei festem Boden dient ein eiserner, dreibeiniger Fluchtstabhalter (=Spinne). Die Fluchtstäbe werden durch Vergleich eines geringen parallelen Abstandes zwischen der Lotschnur eines Schnurlotes und einer Stabseite lotrecht gestellt. Dabei muss dieser Vorgang in zwei zueinander orthogonalen Richtungen erfolgen. 11
16 3.3 Rollbandmaß Ist ein aufrollbares Bandmaß, meist aus Metall, siehe Abb Die Teilung des Bandes beginnt entweder am Beschlag (Stoßstelle von Haltering und Band) oder erst auf dem Band (etwa 10 Zentimeter vom Ring entfernt), siehe Abb Winkelprisma (Doppelpentagonprisma) Ein Prisma ist ein lichtdurchlässiger Glaskörper dessen Grenzflächen geschliffen und/oder verspiegelt sind. Ein Prisma dient zur Umlenkung von Lichtstrahlen durch Lichtreflexion oder -brechung. Das Doppelpentagonprisma (siehe Abb. 1.5 und 1.6) besteht aus zwei Prismenspiegeln, diese können gleichzeitig beobachtet werden. Befindet man sich in etwa auf der Geraden zwischen zwei Fluchtstäben, so kann man den linken Fluchtstab in einem Prismenspiegel, den rechten Fluchtstab in dem anderen Prismenspiegel beobachten. Wenn beide Bilder zur Deckung kommen, befindet sich das Winkelprisma exakt in der Verbindungsgeraden. Wird nun ein dritter Stab so gesehen (über Winkelprisma gepeilt), dass er sich ebenfalls mit den beiden anderen Stäben überdeckt, so befindet er sich genau auf der Senkrechten zur Fluchtlinie, deren Fußpunkt im Prisma liegt. D Bild von Stab B D A Auge B A Bild von Stab A B Abb. 1.5.: Strahlengang Doppelpentagonprisma (Grundriss) Abb. 1.6.: Strahlengang Doppelpentagonprisma (perspektivisch) 3.5 Nivellierinstrument Das Nivellier dient zur Schaffung einer horizontalen Ziellinie, mit deren Hilfe vertikale Abstände zur Horizontalen bestimmt werden können. Zur Realisierung der horizontalen Ziellinie dient die Wirkung der Schwerkraft mittels einer Libelle oder pendelnd aufgehängter Bauteile (Kompensator). Detailliertere Ausführungen finden sich in Übung Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
17 4 Messverfahren 4.1 Absteckung von Punkten Die Absteckung von Bauwerkspunkten erfolgt mit Fluchtstäben, Bandmaß und Winkelprisma. Für die Hausabsteckung benutzt man eine Grundstücksgrenze als Ausgangslinie und steckt von ihr aus, die sich aus den einzuhaltenden Mindestabständen ergebenden Zwangspunkte ab. Anschließend bildet man weitere rechte Winkel bzw. Schnittlinien, um alle Punkte des Hauses abzustecken. Geradenabsteckung mit Fluchtstäben (Einfluchten) Um eine Gerade im Gelände zu signalisieren, werden zunächst die beiden Endpunkte mit Fluchtstäben markiert. Zwischen den beiden Endpunkten werden je nach Bedarf weitere Zwischenpunkte eingefluchtet. Vom Beobachtungsstandpunkt aus gesehen wird zunächst der entfernteste Zwischenpunkt eingefluchtet. Der Fluchtstab in einem Punkt ist eingefluchtet, wenn dieser bei Visur vom Anfangs- zum Endpunkt mit diesen beiden Fluchtstäben zur Deckung gebracht wurde. Wenn der Fluchtstab aufgestellt und eingelotet ist, wird die exakte Flucht erneut kontrolliert und gegebenenfalls verbessert. Absteckungsrichtung A E A E Abb. 1.7.: Geradenabsteckung durch Fluchten (Aufriss) Abb. 1.8.: Geradenabsteckung durch Fluchten (Grundriss) Mechanische Streckenmessung mit dem Rollbandmaß Zur Messung wird die Nullmarke am Anfangspunkt der Strecke angelegt, das Bandmaß in Messrichtung eingefluchtet, in die Horizontale gebracht und mit ca. 50 N (ca. 5 kg) gespannt. Somit werden immer horizontale Strecken gemessen. Prinzipiell müssen hierbei 2 Situationen unterschieden werden: 1. die Strecke ist kürzer als das verwendete Bandmaß: Die Strecke kann direkt am Bandmaß abgelesen werden. 2. die Strecke ist länger als das verwendete Bandmaß: Der Endpunkt des Bandmaßes, der eventuell abgelotet werden muss, wird mit einer Zählnadel gekennzeichnet. Zur Messung der zweiten Bandlage wird der Nullpunkt des Bandmaßes an die SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 13
18 Zählnadel angelegt und die nächste Bandlage gemessen. Die Anzahl der benötigten Zählnadeln ergibt die Anzahl der ganzen Bandlagen, das überschüssige Reststück wird direkt am Band abgelesen. Absteckung mit dem Winkelprisma 1. Absteckung eines rechten Winkels a) Aufsuchen des Lotfußpunktes auf der Messungslinie AB. b) Das Winkelprisma so halten, dass die beiden Fluchtstäbe, mit denen die Messungslinie markiert ist, in den Prismenspiegeln zu sehen sind. c) Das Winkelprisma vor und zurück bewegen, bis die Bilder der Fluchtstäbe senkrecht übereinander erscheinen. d) Einweisung eines weiteren Fluchtstabes. e) Bis die zwei Bilder der Fluchtstäbe und der einzuweisende Fluchtstab senkrecht übereinander stehen. Hinweise: Sind die Bilder im Winkelprisma seitlich versetzt, so befindet sich der Beobachter nicht exakt in der Geradenflucht. Erscheinen sie geneigt gegeneinander, hält der Beobachter das Prisma nicht senkrecht. 2. Absteckung des Lotfußpunktes a) Einfluchten in Messungslinie AB, siehe vorhergehender Abschnitt Schritte a) - c). b) Beobachter bewegt sich auf Messungslinie AB hin und her. c) Bis die zwei Bilder der Fluchtstäbe A und B und der Fluchtstab auf dem seitlich gelegenem Punkt D senkrecht übereinander stehen. Abb. 1.9.: Absteckung eines rechten Winkels Abb : Absteckung des Lotfußpunktes 14 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
19 4.2 Aufnahme von Punkten Die Aufnahme kann durch reine Streckenmessung oder in Kombination mit Anwendung rechter Winkel erfolgen. Man unterscheidet zwei Aufnahmeverfahren, die in der Praxis meist kombiniert angewendet werden. C D Whs. Whs. A B A B Abb : Einbindeverfahren Abb : Orthogonalverfahren Einbindeverfahren Das Einbindeverfahren kommt praktisch ohne optische Vermessungsinstrumente (nur Fluchtstäbe und Bandmaß) aus, siehe Abb Hierbei werden zuerst die Anfangs- und Endpunkte der Messungslinien durch Fluchtstäbe markiert. Dann werden die Grenzen oder Gebäudeseiten in vorhandene Messungslinien eingebunden, d.h. es werden durch diese aufzumessenden Punkte neue Messungslinien gelegt und der Schnitt dieser Linien mit den vorhandenen Linien gebildet. Mit einem Bandmaß wird dann in jeder Messungslinie der Abstand der einzelnen Punkte zum Anfangspunkt der Linie gemessen. Das Verfahren ist grundsätzlich sehr einfach, doch ist es in der Örtlichkeit sehr zeit- und personalaufwendig. Orthogonalverfahren Beim Orthogonalverfahren (siehe Abb. 1.12) werden die aufzumessenden Punkte mit einem Winkelprisma auf eine Messungslinie aufgewinkelt. Dies bedeutet, dass der Lotfußpunkt jedes Punktes auf der Messungslinie bestimmt wird (siehe Abb. 1.10). Dann wird der Abstand dieses Lotfußpunktes zum Anfangspunkt der Linie (Abszisse) und zusätzlich der Abstand des aufgewinkelten Punktes von der Linie (Ordinate) gemessen. Die Abszisse und Ordinate können als lokale rechtwinklige Koordinaten aufgefasst werden. SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 15
20 4.3 Versicherung von vermarkten Punkten auf ein Schnurgerüst Abb : Aufbau eines Schnurgerüstes Bei Gebäudeabsteckungen müssen die Gebäudeeckpunkte auf ein Schnurgerüst übertragen werden, da die Vermarkungen der Eckpunkte beim Aushub der Baugrube verloren gehen. Ein Schurgerüst besteht aus Holzlatten die parallel zu den Gebäudeachsen waagerecht an im Boden verankerten Pfosten befestigt werden. Anschließend werden die Gebäudeseiten auf die Holzlatten des Schnurgerüsts verlängert und mit Nägeln markiert. So können durch Einhängen von Schnüren, die Gebäudeecken während des Baus jederzeit wieder hergestellt werden. Damit die Schnüre in den Gebäudeecken genau übereinander liegen und so einen definierten Schnittpunkt bilden, muss sichergestellt sein, dass sich alle Oberkanten der Holzlatten auf der gleichen Höhe befinden. Der Abstand des Schnurgerüstes vom Bauwerk ist so zu wählen, dass der erforderliche Arbeitsraum verfügbar ist. 16 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
21 Ablauf 1. Aufstellen des Schnurgerüstes in einem sinnvollen Abstand (hier ca. 1 m) parallel zum Gebäude, um den erforderlichen Arbeitsraum zu gewährleisten. 2. Oberkanten aller Holzlatten des Schnurgerüstes auf gleiche Höhe bringen a) Nivellierinstrument mittig im abgesteckten Gebäude aufstellen und mit Fußschrauben über die Libelle horizontieren. Durch Drehen des Fernrohrs realisiert man eine Horizontalebene, die als Vergleichshorizont für die Oberkanten der Holzlatten dient. b) Durch senkrechtes Aufsetzen der Nivellierlatte auf die Oberkante und Ablesen am Horizontalstrich im Fernrohr bestimmt man die vertikalen Abstände der Oberkante zu diesem Vergleichshorizont. c) Höhenmäßiges Einrichten aller Oberkanten auf freigewählten Abstand. 3. Übertragung der Gebäudebegrenzungen auf das Schnurgerüst. a) Fluchtstäbe auf Gebäudeeckpunkten lotrecht aufstellen. b) Übertragung der Gebäudebegrenzungen auf die Holzlatten, durch Verlängerung mittels einfluchten. c) Anpeilung der jeweils rechten und linken Kante der Fluchtstäbe mit dem Schnurlot. d) Übertragung der Verlängerung auf die Holzlatten mit einem Bleistift. e) Das Mittel beider Fluchtungen ist die gesuchte Verlängerung der Gebäudebegrenzung. f) Markierung der Gebäudebegrenzungen auf dem Schnurgerüst mit Nägeln. 4. Kontrolle der Versicherungen a) durch Spannen von Schnüren, siehe Abb b) Schnittpunkte der Schnüre auf die abgesteckten Gebäudeeckpunkte abloten. SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 17
22 30,00 5 Dokumentation 5.1 Kartierung Die Kartierung ist die maßstäbliche Darstellung des Vermessungsrisses. Sie enthält im Allgemeinen ein Gitternetz, die Angabe des Maßstabs, einen Nordpfeil, sowie weitere Gestaltungsmerkmale. Die Art der Darstellung von Objekten (Grenzpunkte, Gebäude, Messungslinien) richtet sich in Deutschland nach einer DIN, die für Hessen in einer Zeichenvorschrift nochmals zusammengefasst ist. Im Rahmen dieser Übung wird eine der beiden angefertigten Kartierungen als Vermessungsriss verwendet. 5.2 Vermessungsriss Die Niederschrift der Vermessungsergebnisse nennt man Vermessungsriss. Er ist eine einigermaßen maßstäbliche Darstellung der Situation und enthält alle Informationen, die zur lagemäßigen Festlegung der örtlichen Situation erforderlich sind, siehe Abb Vermessungsrisse werden während der Messung im Feld erstellt und beinhalten sämtliche Kontrollwerte. Die Art der Darstellung richtet sich ebenfalls nach einer DIN bzw. Zeichenvorschrift ,35 0,00 12,92 3,70 46 (13,44) 13,45 15,93 3,00 (4,55) 4,54 9,99 12,00 (15,62) 15,60 (15,62) 15,63 12, ,31 3,93 3,00 4,94 (4,94) (13,58) 13,60 10,01 2,75 30, , ,00 13,30 Abb : Beispiel eines Vermessungsrisses 18 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
23 6 Übung 6.1 Übungsvorgaben 10,00 m 10,00 m 12,00 m Z A 12,00 m Z B # 3,00 m # 3,00 m A B geplante Straße A B # 3,00 m # 3,00 m Z B Z A 12,00 m 12,00 m 10,00 m 10,00 m Baulinie Baugrenze Abb : Ausschnitt des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 1. Die Baulinie verläuft in einem Abstand von 3,00 m parallel zur Grundstücks- bzw. Straßengrenze, siehe Abb (Die Baulinie ist eine planerische Festsetzung im Bebauungsplan, auf der gebaut werden muss. Ein Über- oder Unterschreiten ist nach dem BauGB unzulässig.) 2. Eine weitere Zwangsbedingung ist, dass der Grenzabstand zu einer Nachbargrenze 2,75 m beträgt. Und zwar zu der Nachbargrenze, deren Winkel zur Straßengrenze die größte Abweichung von 100 gon aufweist. Daraus resultieren zwei mögliche Fälle (A und B) und eine unterschiedliche Lage des Zwangspunktes (Z A bzw. Z B ). Der entsprechende Fall und der dazugehörige Winkel ist in Abb dargestellt. Der zu verwendende Winkel ist jeweils durch einen Doppelpfeil markiert. 3. Das Gebäude hat die Maße 10,00 m x 12,00 m, wobei die längere Gebäudeseite parallel zur Straße verläuft. SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 19
24 Übungsvorbereitung 1. Als Vorbereitung der Übung sind zwei Lagepläne (Kartierungen) im Maßstab 1:200 zu zeichnen. Die Kartierung erfolgt auf Zeichenkarton (DIN A3) mit einem harten Bleistift (3H - 5H). Die einzuhaltende Kartiergenauigkeit beträgt 0,5 mm. Das zu kartierende Grundstück ist den Listen auf Seite 4 zu entnehmen. In den Lageplan sollen das Grundstück, das abzusteckende Gebäude, sowie die benötigten Vermessungspunkte kartiert werden. Dazu sind die Maße der Vermessungsrisse (Seite 101 bis 104) zu verwenden. Die Kartierung enthält weiterhin ein Gitternetz, einen Nordpfeil, die Flurstücksnummer, sowie die Angabe des Maßstabs. Vermessungs- und Grundstückspunkte werden mit Kreisen unterschiedlicher Radien signaturiert. Die Messungslinie, Messzahlen und Gebäudemaße werden nicht in die Kartierung eingetragen. 2. Des Weiteren müssen die Fläche des Grundstückes und die Grenzlängen aus den Orthogonalmaßen der Vermessungsrisse (Seite 101 bis 104) berechnet werden (=Sollmaße). Benutzen sie dafür die Formulare auf Seite 105 (Beispiel zur Auswertung siehe Seite 22). Hinweise zur Zeichnung des Lageplans 1. Konstruktion des Gitternetzes Die Grundlage des Lageplans bildet ein Bezugssystem. Zur Kartierung der koordinierten Punkte wird ein Koordinatengitter in Form eines Quadratnetzes mit Maschenweiten von 10 m in der Natur (= 50 mm im Maßstab 1:200) konstruiert. Von dieser Kartierungsgrundlage werden strenge Parallelität bzw. Rechtwinkligkeit der Linien und die exakte Gleichheit aller Quadratseiten verlangt, siehe Abb B C e e S e e A D Abb : Konstruktion des Gitternetzes Auf der Zeichenfläche (DIN A3) werden zunächst die beiden Diagonalen durch die Blattecken gezeichnet. Vom Schnittpunkt S der beiden Diagonalen werden dann in alle vier Diagonalrichtungen exakt gleiche Strecken e abgetragen und die Endpunkte ABCD mit einem spitzen Bleistift markiert. Diese Punkte ergeben ein Rechteck. Ausgehend von den vier Eckpunkten werden nun entlang der Rechteckseiten Längen von 50 mm abgetragen und wiederum mit einem spitzen Bleistift markiert. Verbindet man nun gegenüberliegende Punkte, so entsteht ein Gitternetz, dessen Schnittpunkte ebenfalls markiert werden. Zur Kontrolle werden die Diagonalen in den einzelnen Quadranten auf ihre Solllänge (50 mm 20 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
25 2) geprüft und die Koordinatenwerte der Gitterlinie (jeweils volle 10 m) in der Randleiste eingetragen. Das Gitternetz wird nur durch die Schnittpunkte realisiert, diese werden mit Kreuzen (10 x 10 mm) markiert. Meistens ist zur Ausnutzung des Blattformates eine optimale Lage des Gitternetzes zu den Blatträndern erforderlich. Hierfür sind die Gitterlinien in Bezug zum Kartenformat so anzuordnen, dass das Grundstück sowie die benötigten Polygonpunkte voll hineinpassen, siehe Abb Kartieren der Polygonpunkte Die Polygonpunkte werden nach ihren Gauß-Krüger Koordinaten (siehe Seite 97) mithilfe der Gitterkreuze kartiert. Zur Kontrolle muss die aus Gauß-Krüger-Koordinaten berechnete Strecke zwischen den Punkten mit der aus dem Plan abgegriffenen verglichen werden. 3. Kartieren der Grenzpunkte Mit den kartierten Polygonpunkten (Seite 97) lässt sich zunächst die Messungslinie (siehe Seite 101 bis 104) wiederherstellen. Auf Grundlage der Messungslinie werden anschließend die Grenzpunkte mit den Orthogonalmaßen kartiert. Als Kontrolle müssen die aus den Orthogonalmaßen berechneten Grenzlängen mit den aus der Kartierung abgegriffenen Werten verglichen werden. Die Grenzen werden durch verbinden der Grenzpunkte eingezeichnet. Abb : Beispiel einer Kartierung 4. Kartierung der Gebäudepunkte Die Gebäudepunkte werden anhand der Vorgaben des Bebauungsplans bzw. der Baugenehmigung konstruiert (Vorgabe beachten!, siehe Seite 19). Als Kontrolle müssen die Sollmaße für die Gebäudeseiten und Diagonalen mit den aus der Kartierung abgegriffenen Werten übereinstimmen. 5. Gestaltungsmerkmale Im letzten Schritt wird die Kartierung um Gestaltungsmerkmale wie Nordpfeil, Text und Koordinatenangaben ergänzt. SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 21
26 Beispiele zur Flächen- und Grenzlängenberechnung Gauß sche Flächenformel(n): 2F = X i (Y i+1 Y i 1 ) bzw. 2F = Y i (X i+1 X i 1 ) Flächenberechnung Grundstück (aus den Orthogonalmaßen Seite ) Punkt Orthogonalmaße Y [m] = X [m] = 2 F [m 2 ] 2 F [m 2 ] Nr. Y [m] X [m] Y i+1 Y i 1 X i+1 X i 1 = X i Y = Y i X ,70 4, ,98 12,56-29,78 +24,81-374,04 +98, ,92 29,77 +29,78 +17, ,55 +67, ,76 29,73 +29,78-24, ,36-837, ,70 4,96-29,78-17,17-147,71-578, ,98 12,56 Summe: 0,000 0, , ,16 Kontrollen: 2F = 1250, 16 m 2 F = 625, 08 m 2 Berechnung der Grenzlängen (aus den Orthogonalmaßen Seite ) Punkt Orthogonalmaße Y [m] = X [m] = Grenzlänge Grenzlänge Nr. Y [m] X [m] Y i+1 Y i X i+1 X i s B [m] berechnet s B [m] gemessen 301 3,98 12,56-0,06 17,21 17,21 17, ,92 29,77 29,84-0,04 29,84 29, ,76 29,73-0,06-24,77 24,77 24, ,70 4,96-29,72 7,60 30,68 30, ,98 12,56 Summe: 0,000 0,000 Kontrollen: 22 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
27 6.3 Übungsdurchführung 1. Kontrolle der Grenzlängen: Messung der Grenzlängen und Vergleich mit den vorbereiteten Sollwerten (siehe unteres Formular auf Seite 105). 2. Absteckung des Gebäudes: Markierung der Grenzpunkte des Grundstücks mit Fluchtstäben und Absteckung des Gebäudes mittels Orthogonalverfahren (siehe Seite 15), anhand der Vorgaben des Bebauungsplans (siehe Abb. 1.15) und der detailierten Anleitung zur Absteckung des Gebäudes (siehe Abschnitt 6.5). Die Gebäudepunkte werden durch Kunststoffkegel vermarkt. 3. Einmessung des Gebäudes: Nach der Absteckung wird das Gebäude mittels Orthogonalverfahren (siehe Seite 15) eingemessen. Wobei die Kontrollmaße in einer der beiden Kartierungen (Vermessungsriss, siehe Abb. 1.14) protokolliert und mit den gerechneten Werten verglichen werden. Kontrollmaße sind Gebäudeseiten, Gebäudediagonalen, die vorgegebenen Grenzabstände und die Grenzlängen. Die berechneten Kontrollwerte (Pythagorasprobe) werden neben den gemessenen Werten in Klammern gesetzt (maximal erlaubte Abweichung: 3 cm). Dabei sind insbesondere die folgenden Maße zu kontrollieren: Gebäudediagonalen (2x) Gebäudeseiten (4x) vordere Gebäudeeckpunkte (2x, Pythagorasprobe auf Straßengrenze) hintere Gebäudeeckpunkte (2x, Pythagorasprobe auf entsprechende seitliche Grenze) Halten Sie sich bei der Dokumentation der Kontrollmaße streng an den beispielhaften Vermessungsriss siehe Abb auf der Seite Versicherung der Gebäudeeckpunkte mit einem Schnurgerüst (siehe Seite 16). 6.4 Übungsauswertung 1. Zusammenstellung der gerechneten und gemessenen Strecken (Soll-Ist Differenz) 2. Berechnung von Standardabweichungen für die Absteckung aus den gewichteten Differenzen mit: Gewicht p = l b s = Bandlänge [m] Strecke [m] a) Bandlänge 20 m b) Bandlänge 30 m SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 23
28 6.5 Anleitung zur Absteckung des Gebäudes für den Fall A (siehe Abb. 1.15) Straße > 13,00 m Straße 13,00 m Abb : Absteckung zweier rechter Winkel und Einweisung von Fluchtstäben in einer Entfernung >13 m zur Straßenseite Abb : Einfluchten zweier Fluchtstäbe in jeweils 13,00 m Entfernung zu den Lotfußpunkten Straße > 2,75 m Straße 2,75 m B4 Abb : Absteckung zweier rechter Winkel und Einweisung von Fluchtstäben in einer Entfernung >2,75 m zur entsprechenden Grundstücksgrenze Abb : Einfluchten zweier Fluchtstäbe in jeweils 2,75 m Entfernung zu den Lotfußpunkten; Einfluchten des Zwangspunktes Z A = B4 über die zuvor definierten Geraden 24 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
29 B3 B2 10 m B3 Straße 12 m Straße B4 B1 B4 Abb : Einfluchten eines Fluchstabes (B3) in 12,00 m Entfernung zum Zwangspunkt auf der hinteren Gebäudeflucht Abb : Absteckung der Lotfußpunkte von B3 und B4; Einfluchten weiterer Fluchtstäbe (B1 und B2) in 10,00 m Abstand zu B3 und B4 Analog dazu ist das Vorgehen zur Absteckung des Gebäudes für den Fall B. Da der Zwangspunkt Z B (entsprechend dem Abschnitt 6.1) sich auf der der Straße zugewandten Hausseite befindet, wird mit dieser Hausseite begonnen. SS 2017 Übung: Gebäudeabsteckung 25
30 Beispiel zur Berechung der Standardabweichung Streckenmessung Gewichtsfestsetzung p = Bandlänge Gesamtstrecke = l b s SOLL gerechnet IST gemessen Differenz Gewicht i s soll [m] s ist [m] d i = s soll s ist p i = 20 m s soll p i d 2 i [m 2 ] 1 17,21 17,23-0,02 1,16 0, ,84 29,81 0,03 0,67 0, ,77 24,80-0,03 0,81 0, ,68 30,72-0,04 0,65 0, ,00 9,99 0,01 2,00 0, ,00 10,01-0,01 2,00 0, ,00 12,00 0,00 1,67 0, ,00 11,97 0,03 1,67 0, ,62 15,65-0,03 1,28 0, ,62 15,64-0,02 1,28 0,0005 0,0067 Standardabweichung für eine 20 m Strecke: s 20 m = i max i=1 p i d 2 i i max = 0, = 0, 026 m 26 Übung: Gebäudeabsteckung SS 2017
31 2 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement 1 Aufgabe Die Höhen von zwei Grenzpunkten (siehe Tabelle Höhenanschlusspunkte der Grundstücke auf Seite 98) des Grundstückes sind mit dem Verfahren des geometrischen Nivellements zu bestimmen. Vor der Messung ist zunächst die korrekte Funktionsweise des Nivellierinstruments mit der NÄBAUER-Probe zu überprüfen. 2 Wiederholung Übung 6 WS: Statistische Auswertung ungleichgenauer Messungen 3 Instrumentarium 3.1 Nivellier Ein Nivellier besitzt ein Zielfernrohr und eine Einrichtung zur Horizontierung der Ziellinie des Instruments (Libelle, Kompensator). Beim horizontalen Drehen des Fernrohrs überstreicht die Ziellinie eine Horizontalebene, die als Vergleichshorizont für die Ablesung an vertikalen Maßstäben (Nivellierlatten), herangezogen werden kann. Heutzutage sind meist folgende zwei Arten von Nivellieren im Einsatz: Kompensatornivelliere: Das Fernrohr ist mit dem Fernrohrträger fest verbunden. Die Grobhorizontierung erfolgt über die Dosenlibelle mittels der Fußschrauben. Im Inneren befindet sich ein mechanischoptischer Kompensator, meist ein aufgehängtes Prisma, das sich somit nach der Lotrichtung ausrichtet und die Ziellinie automatisch feinhorizontiert. Digitalnivelliere: Digitalnivelliere bauen optisch auf den Kompensatornivellieren auf, d.h. sie stellen im Prinzip eine Kombination einer digitalen Kamera mit einem Kompensatornivellier dar. Trotzdem lässt sich auch weiterhin eine optische Ablesung durchführen. Die Genauigkeit der Höhenbestimmung hängt von der Güte des Nivellierinstrumentes, seiner Einrichtung für die Horizontierung der Ziellinie und den verwendeten Messmethoden ab. Somit lassen sich Nivelliere neben der Unterscheidung nach ihrem Aufbau, auch nach ihrer Genauigkeit klassifizieren: Bezeichnung Genauigkeit Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement Baunivellier niedere 20 mm Ingenieurnivellier mittlere 6 mm Präzisionsnivellier hohe höchste 2 mm 0,5 mm 27
32 3.2 Nivellierlatten An Nivellierlatten wird der lotrechte Abstand zwischen der horizontalen Ziellinie und dem Aufsetzpunkt der Latte abgelesen. Die Vorderseite der Latten ist in Zentimeter eingeteilt aber mit Dezimetern beschriftet. Die Ablesung findet trotz dieser Bauart in Metern statt. Der Nullpunkt der Teilung fällt mit der Aufsatzfläche des Fußbeschlags zusammen. Je nach Bauart und Bezifferung der Latten unterscheidet man verschiedene Lattentypen: Die Latte mit E-Teilung (siehe Abb. 2.1) gibt eine deutliche Unterscheidung der Dezimeter, Halbdezimeter und der Zentimeter. Häufig ist die Teilung für die ungeraden Meter schwarz und für die geraden Meter rot. Die Zahlen sind in dem zugehörigen Dezimeter-Abschnitt aufgetragen. Die Latte mit Strichcode (siehe Abb. 2.2) wird bei Digitalnivellieren eingesetzt und besitzt neben der herkömmlichen Teilung auf der einen Seite, einen Strichcode auf der anderen Seite. Das im Fernrohr sichtbare Codebild der Latte wird auf eine Photodiodenzeile abgebildet und zu einem digitalen Messsignal verarbeitet. Anschließend wird das Messsignal nach dem Prinzip der Korrelation mit dem abgespeicherten Referenzsignal verglichen, bis es übereinstimmt. Auf diese Weise lässt sich die Lattenablesung für die Höhe und die Strecke bestimmen Abb. 2.1.: Ausschnitt, Latte mit E-Teilung Abb. 2.2.: Ausschnitt, Strichcodelatte Beim Aufstellen einer Nivellierlatte ist darauf zu achten, dass sie immer auf einer runden oder spitzen, festen Unterlage aufgesetzt wird. Der Aufsatzpunkt muss immer der eindeutig höchste Punkt der Unterlage sein, damit die Latte beim Drehen um ihre Achse zwischen Vor- und Rückblick in unveränderter Höhe bleibt. Durch Einspielen einer, an der Latte angebrachten, Dosenlibelle wird die Latte lotrecht gehalten und muss in dieser Stellung durch Fluchtstäbe zusätzlich seitlich abgestützt werden. 3.3 Lattenuntersatz Um bei Wechselpunkten einen eindeutig höchsten Punkt zu garantieren, wird die Latte auf einen Lattenuntersatz (=Frosch) oder einen eingeschlagenen Pflock aufgesetzt. 28 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement SS 2017
33 4 Messverfahren 4.1 Geometrische Höhenbestimmung Bei der geometrischen Höhenbestimmung werden Höhenunterschiede mittels einer horizintalen Ziellinie direkt bestimmt. Dazu wird die Differenz der Ablesung r an der lotrecht aufgestellten Nivellierlatte in A (=Rückblick) und der Ablesung v an der lotrecht aufgestellten Nivellierlatte in B (=Vorblick) gebildet, siehe Abb lotrechte Nivellierlatte horizontale Ziellinie r Nivellierinstrument B v r-v A Δh = r-v Abb. 2.3.: Prinzip der geometrischen Höhenbestimmung Das Ergebnis ist ein metrischer Höhenunterschied zwischen zwei Punkten mit korrektem Vorzeichen. Das Vorzeichen "+" bedeutet bergauf und das Vorzeichen "-" bedeutet bergab. 4.2 Geometrisches Nivellement Lässt sich der Höhenunterschied zwischen zwei Punkten nicht mit einem einzigen Instrumentenstandpunkt bestimmen, so werden Teilhöhenunterschiede nach dem Prinzip der geometrischen Höhenbestimmung, durch Unterteilung des Weges in mehrere Abschnitte, ermittelt und aufsummiert, siehe Abb Zur Festlegung der erforderlichen Wechselpunkte dienen Lattenuntersätze (=Frösche) aus Gusseisen, Pflöcke und Nägel. A B Abb. 2.4.: Prinzip des geometrischen Nivellements SS 2017 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement 29
34 Um die Höhe eines unbekannten Neupunktes N zu bestimmen, muss der Höhenunterschied zwischen dem Neupunkt N und einem Höhenfestpunkt mit bekannter Höhe bestimmt werden. Anschließend kann durch Addition des Höhenunterschieds zur bekannten Höhe des Höhenfestpunktes die Höhe von N bestimmt werden. Um gesicherte Höhen zu erhalten, wird der Neupunkt N mindestens an zwei Höhenfestpunkte, Höhenanschluss- und Höhenabschlusspunkt, angeschlossen. Zur Kontrolle und zur Genauigkeitssteigerung (durch Mehrfachmessung) wird der Höhenunterschied in Hin- und Rückmessung bestimmt. 4.3 Prüfung des Nivellierinstrumentes: Die NÄBAUER-Probe Die Hauptanforderung an Nivellierinstrumente ist die horizontale Ausrichtung der Ziellinie bei eingespielter Libelle. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass die Ziellinie senkrecht zur Stehachse verläuft und der Kompensator frei schwingen kann. Dies bedeutet, dass bei Kompensatornivellieren der Kompensator, bei eingespielter Dosenlibelle, eine horizontale Ziellinie erzeugt. Die Überprüfung der Hauptanforderung geschieht im Feld mit der NÄBAUER-Probe, siehe Seite 30 Abb Die Grundlage der Probe ist, dass ein eventueller Neigungsfehler α der Ziellinie in allen Messrichtungen konstant bleibt. Der daraus entstehende Fehler ɛ der Lattenablesung verhält sich somit proportional zur Zielweite. L 1 L 2 J 1 α a 4' a 4 a 1' a 1 2ε ε ε 2ε a 3' a 3 a 2' a 2 α J 2 s s s Abb. 2.5.: Prinzip der NÄBAUER-Probe Unter Berücksichtigung dieses Zusammenhanges wird mit dem zu prüfenden, horizontierten Instrument ein Höhenunterschied zwischen zwei aufgestellten Nivellierlatten von zwei Instrumentenstandpunkten gemessen. Die Messkonfiguration wird dabei so gewählt, dass der Einfluss einer eventuell vorhandenen geneigten Ziellinie rechnerisch ermittelt werden kann. 30 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement SS 2017
35 Beispiel für die Durchführung einer NÄBAUER-Probe Vor Beginn des Nivellements ist grundsätzlich eine NÄBAUER-Probe durchzuführen. Zur Durchführung werden bei festen Nivellierlattenstandpunkten (L 1 und L 2 ) vom Instrumentenstandpunkt J 1 die Ablesungen a 1 und a 2 durchgeführt, sowie vom Instrumentenstandpunkt J 2 die Ablesung a 3 und a 4. Dabei muss beachtet werden, dass die Nivellierlattenstandpunkte (L 1 und L 2 ) während den Messungen nicht verändert werden dürfen. L 1, L 2 : Lattenstandpunkte J 1, J 2 : Instrumentenstandpunkte Ablesung des Nivelliers in J 1 : Ablesung des Nivelliers in J 2 : a 1 an Latte L 1 a 3 an Latte L 2 a 2 an Latte L 2 a 4 an Latte L 1 Die horizontale Visur (fehlerfreies Nivellierinstrument) ergibt: a 1 a 2 = h = a 4 a 3 es folgt: a 4 = a 1 a 2 + a 3 Mit gleichlangen Strecken s, lassen sich die neigungsfehlerfreien Sollablesungen a 1 bis a 4 definieren: Ablesung Erstprüfung Kontrolle a 1 = (a 1 ɛ) a 2 = (a 2 2ɛ) a 3 = (a 3 ɛ) a 4 = (a 4 2ɛ) Eingesetzt in obige Gleichung: a 4 = (a 1 ɛ) (a 2 2ɛ) + (a 3 ɛ) Aufgelöst und vereinfacht ergibt sich daraus: a 4 = a 1 a 2 + a 3 (=Sollwert) Berechnung Werte a 1 1,613 1,572 a 2 1,515 1,463 a 3 2,453 2,371 a 4 2,532 2,480 a 4 = a 1 - a 2 + a 3 2,551 2,478 Differenz -0,019 +0,002 Justierung notwendig! Tab. 2.1.: NÄBAUER-Probe Restjustierfehler Aus der obigen Gleichung ist ersichtlich, dass man aus den Ablesungen den "richtigen" Wert (horizontale Ziellinie) a 4 ableiten kann. Dieser gerechnete Wert wird mit der tatsächlichen Ablesung a 4 verglichen und ergibt so eine Information über die Neigung der Ziellinie. Ist die Ziellinie nicht horizontal, muss das Instrument justiert werden. Diese erfolgt, wenn die Ablesung a 4 um mehr als ± 3 mm vom Sollwert abweicht und wird nur von Fachleuten durchgeführt. SS 2017 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement 31
36 4.4 Praktische Messanordnung Da aber die Justierung nur mit endlicher Genauigkeit durchführbar ist, bleibt auch bei einem justierten Nivellierinstrument ein so genannter "Restjustierfehler", siehe Tab. 2.1 erhalten, d.h. die Ziellinie ist nicht absolut horizontal, siehe Abb ε α α ε v r r-v s s Abb. 2.6.: Nivellieren aus der Mitte Man kann den Einfluss dieses Restjustierfehlers, der bei einem längeren Nivellementsweg durchaus beträchtliche Größenordnungen annehmen kann, durch eine konsequente Aufstellung des Instruments in der Mitte (gleiche Zielweiten, nicht zwingend in der Flucht) zwischen den beiden Nivellierlatten (zumeist genügt das Abschreiten von s) aus dem Ergebnis eliminieren. Der Restjustierfehler α ergibt an der Nivellierlatte die "Fehlablesung" ɛ. Sind die Zielweiten zu den beiden Latten gleich groß (Nivellieren aus der Mitte), so ergibt die Auswertung der Grundgleichung des Nivellements: h = (r + ɛ) (v + ɛ) = r v Somit ist das Ergebnis - der Höhenunterschied h - fehlerfrei! 32 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement SS 2017
37 Ablauf 1. Der erste Lattenträger stellt die Nivellierlatte mithilfe der Dosenlibelle streng lotrecht auf den Anfangspunkt (Höhenanschlusspunkt) auf. Dabei wird sie mit zwei Fluchtstäben stabilisiert. 2. Das Nivellierinstrument wird im abgeschrittenen Zielweitenabstand s von der Nivellierlatte aufgestellt und horizontiert. Die Zielweite sollte wegen der Millimeter-Schätzgenauigkeit bei der Ablesung an der Nivellierlatte nicht länger als 30 m sein. Bei der Aufstellung des Stativs sollte der Stativteller möglichst horizontal sein. 3. Der zweite Lattenträger geht zum ersten Wechselpunkt, der in der gleichen Zielweite s vom Nivellier entfernt ist. Die abgeschrittenen Entfernungen werden im Feldbuch notiert. Der Wechselpunkt muss auf stabilem Untergrund sein. Der Lattenuntersatz (Frosch) ist fest einzutreten. Bei Wechselpunkten auf weichem Untergrund (Wiesen, Acker, etc.) werden Pflöcke mit Nägeln verwendet. Der Punkt bzw. Pflock darf sich beim Drehen der Nivellierlatte nicht bewegen. 4. An der im Anfangspunkt aufgehaltenen Nivellierlatte wird die Ablesung r (=Rückblick) durchgeführt und im Feldbuch notiert. Dabei wird die Ablesung in Metern angegeben, wobei die Zentimeter noch abgelesen, die Millimeter aber geschätzt werden müssen. 5. An der Nivellierlatte im ersten Wechselpunkt wird die Ablesung v (=Vorblick) durchgeführt und ebenfalls im Feldbuch notiert. Im Moment der Ablesung muss die Nivellierlatte exakt lotrecht aufgestellt sein. 6. Der Feldbuchführer berechnet den Höhenunterschied zwischen beiden Lattenaufstellungen als Differenz zwischen Rück- und Vorblick (r - v) und notiert das Ergebnis im Feldbuch. 7. Das Instrument wird nun zum zweiten Standpunkt getragen. Beim Transport kann das Instrument auf dem Stativ verbleiben. Kompensatornivelliere werden mit dem Stativ über der Schulter getragen, damit der Kompensator beim Transport anliegt und nicht frei schwingt. 8. Die auf dem letzten Wechselpunkt aufgehaltene Nivellierlatte wird vorsichtig zum neuen Instrumentenstandpunkt gedreht, ohne die Latte vom Frosch oder Pflock zu nehmen. Diese Nivellierlatte dient nun als Rückblick und wird vom neuen Instrumentenstandpunkt erneut abgelesen. 9. Die Latte des letzten Rückblicks wird nun zum nächsten Wechselpunkt getragen und mit der Dosenlibelle lotrecht aufgestellt, da sie zum nächsten Vorblick wird. Hierbei muss wiederum auf gleiche Zielweiten geachtet werden. 10. Anschließend wiederholen sich die Ablesungen von Rück- und Vorblick wie zuvor beschrieben sowie die Standpunktwechsel bis zum Zielpunkt. Hinweise: Die Wechselpunkte dienen nur zur Höhenübertragung und werden daher nicht gesondert vermarkt. Das Instrument muss nicht in der Verbindungslinie zwischen zwei Lattenstandpunkten aufgestellt werden, sondern dort, wo gute Standsicherheit und Sicht zu den Latten bestehen. Instrumentenund Lattenstandpunkte wechseln einander so lange ab, bis der Höhenabschlusspunkt erreicht und als Vorblick abgelesen ist. Während des Nivellements dürfen Nivellierinstrument und -Latten niemals gleichzeitig ihre Plätze wechseln! Bei der Ablesung am Nivellierinstrument bewegt sich keiner, beim Standpunktwechsel bewegen sich das Instrument und die Latte des letzten Rückblicks! SS 2017 Übung: Höhenanschluss des Grundstückes durch geometrisches Nivellement 33
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten
 Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 6: statistische Auswertung ungleichgenauer Messungen Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 13 Inhaltsverzeichnis
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 6: statistische Auswertung ungleichgenauer Messungen Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 13 Inhaltsverzeichnis
Klausur Vermessungskunde
 Klausur Vermessungskunde Vermessungskunde für Bauingenieure (Vordiplom) und Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten (Modulprüfung B.Sc) Herbst 2013 27.09.2013 Name: Vorname: Matr.-Nr.: Aufgabe
Klausur Vermessungskunde Vermessungskunde für Bauingenieure (Vordiplom) und Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten (Modulprüfung B.Sc) Herbst 2013 27.09.2013 Name: Vorname: Matr.-Nr.: Aufgabe
Aufbau und Organisation der Lehrveranstaltung Gruppenweises Einschreiben
 Vermessungskunde II Einführungsveranstaltung Aufbau und Organisation der Lehrveranstaltung Gruppenweises Einschreiben 18.04.2017 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen Institut für Geodäsie Fachgebiet
Vermessungskunde II Einführungsveranstaltung Aufbau und Organisation der Lehrveranstaltung Gruppenweises Einschreiben 18.04.2017 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen Institut für Geodäsie Fachgebiet
Geometrische Höhenbestimmung (Nivellement)
 Vermessungsgeräte und ihre Anwendung 13.3 Höhenmessung Die,,Höhe eines Punktes" ist sein lotrechter Abstand von einer Bezugsebene (NN; vgl. Kap. 1 2.2.3). Gemessen werden stets Höhenunterschiede zwischen
Vermessungsgeräte und ihre Anwendung 13.3 Höhenmessung Die,,Höhe eines Punktes" ist sein lotrechter Abstand von einer Bezugsebene (NN; vgl. Kap. 1 2.2.3). Gemessen werden stets Höhenunterschiede zwischen
Volker Matthews. Vermessungskunde 1. Lage-, Höhenund Winkelmessungen. 29., vollständig überarbeitete Auflage Teubner
 Volker Matthews Vermessungskunde 1 Lage-, Höhenund Winkelmessungen 29., vollständig überarbeitete Auflage 2003 Teubner B.G.Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden Inhalt 1 Grundlage der Vermessungen 1.1 Bezugsflächen
Volker Matthews Vermessungskunde 1 Lage-, Höhenund Winkelmessungen 29., vollständig überarbeitete Auflage 2003 Teubner B.G.Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden Inhalt 1 Grundlage der Vermessungen 1.1 Bezugsflächen
14. Polarpunktberechnung und Polygonzug
 14. Polarpunktberechnung und Polygonzug An dieser Stelle sei noch einmal auf das Vorwort zu Kapitel 13 hinsichtlich der gekürzten Koordinatenwerte hingewiesen. 14.1. Berechnungen bei der Polaraufnahme
14. Polarpunktberechnung und Polygonzug An dieser Stelle sei noch einmal auf das Vorwort zu Kapitel 13 hinsichtlich der gekürzten Koordinatenwerte hingewiesen. 14.1. Berechnungen bei der Polaraufnahme
Lehrbuch. Vermessung - Grundwissen
 Bettina Schütze / Andreas Engler / Harald Weber Lehrbuch Vermessung - Grundwissen Schütze Engler Weber Verlags GbR - Dresden Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Orientierung 6 1. Einführung 13 1.1. Aufgabengebiete
Bettina Schütze / Andreas Engler / Harald Weber Lehrbuch Vermessung - Grundwissen Schütze Engler Weber Verlags GbR - Dresden Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Orientierung 6 1. Einführung 13 1.1. Aufgabengebiete
Lehrbuch. Vermessung - Grundwissen
 Bettina Schütze / Andreas Engler / Harald Weber Lehrbuch Vermessung - Grundwissen 2., vollständig überarbeitete Auflage Schütze Engler Weber Verlags GbR - Dresden Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Orientierung
Bettina Schütze / Andreas Engler / Harald Weber Lehrbuch Vermessung - Grundwissen 2., vollständig überarbeitete Auflage Schütze Engler Weber Verlags GbR - Dresden Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Orientierung
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten
 Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 2: Zweite Geodätische Hauptaufgabe und Vorwärtseinschneiden Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 13 1 Aufgabenbeschreibung
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 2: Zweite Geodätische Hauptaufgabe und Vorwärtseinschneiden Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 13 1 Aufgabenbeschreibung
Abschlussklausur Vermessungskunde für Studiengang Bauingenieurwesen
 Fakultät Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften Fachrichtung Geowissenschaften Geodätisches Institut, Professur Ingenieurgeodäsie Beispiel einer Klausur Vermessungskunde Konsulent: Dipl.-Ing. Jan Schmidt
Fakultät Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften Fachrichtung Geowissenschaften Geodätisches Institut, Professur Ingenieurgeodäsie Beispiel einer Klausur Vermessungskunde Konsulent: Dipl.-Ing. Jan Schmidt
Vermessungskunde für Architekten und Bauingenieure
 Vermessungskunde für Architekten und Bauingenieure mit baupraktischen Anwendungen Prof. Dr.-Ing. Rolf Gelhaus Prof. Dr.-Ing. Dieter Kolouch t 2. Auflage 1997 Werner Verlag 1 Grundlagen 1 1.0 Allgemeines
Vermessungskunde für Architekten und Bauingenieure mit baupraktischen Anwendungen Prof. Dr.-Ing. Rolf Gelhaus Prof. Dr.-Ing. Dieter Kolouch t 2. Auflage 1997 Werner Verlag 1 Grundlagen 1 1.0 Allgemeines
Technikpädagogische Arbeitsmappe für Schulen
 Bezirksregierung Köln, Abteilung Geobasis NRW Technikpädagogische Arbeitsmappe für Schulen 1 Indirekte Streckenmessung 2 Messtechnisches Verlängern einer Hauswand 3 Gebäudeseiten messtechnisch verlängern
Bezirksregierung Köln, Abteilung Geobasis NRW Technikpädagogische Arbeitsmappe für Schulen 1 Indirekte Streckenmessung 2 Messtechnisches Verlängern einer Hauswand 3 Gebäudeseiten messtechnisch verlängern
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten
 Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 5: statistische Auswertung gleichgenauer Messungen Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 3 Inhaltsverzeichnis
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 5: statistische Auswertung gleichgenauer Messungen Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich 3 Inhaltsverzeichnis
Unregelmäßig geformte Scheibe Best.- Nr. MD02256
 Unregelmäßig geformte Scheibe Best.- Nr. MD02256 Momentenlehre Ziel Die unregelmäßig geformte Scheibe wurde gewählt, um den Statik-Kurs zu vervollständigen und um einige praktische Versuche durchzuführen.
Unregelmäßig geformte Scheibe Best.- Nr. MD02256 Momentenlehre Ziel Die unregelmäßig geformte Scheibe wurde gewählt, um den Statik-Kurs zu vervollständigen und um einige praktische Versuche durchzuführen.
Vermessen leicht gemacht von Dipl. Ing. Karl Zeiske
 Bauvermessung Druck neuest 13.06.2000 11:30 Uhr Seite 1 30 40 50 Vermessen leicht gemacht von Dipl. Ing. Karl Zeiske Bauvermessung Druck neuest 13.06.2000 11:30 Uhr Seite 2 Vorwort Die vorliegende Broschüre
Bauvermessung Druck neuest 13.06.2000 11:30 Uhr Seite 1 30 40 50 Vermessen leicht gemacht von Dipl. Ing. Karl Zeiske Bauvermessung Druck neuest 13.06.2000 11:30 Uhr Seite 2 Vorwort Die vorliegende Broschüre
Abschlussprüfung. im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in Sommertermin Praktische Übungen, Aufgabe 3
 Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in Sommertermin 2004 Praktische Übungen, Aufgabe 3 Zeit: Hilfsmittel: Anlagen: Hinweise: 3,5 Stunden Maßstab und Zeichengeräte, Formelsammlung,
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in Sommertermin 2004 Praktische Übungen, Aufgabe 3 Zeit: Hilfsmittel: Anlagen: Hinweise: 3,5 Stunden Maßstab und Zeichengeräte, Formelsammlung,
Januar / Februar 2005
 Nr.: Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin nach 34 BBiG Januar / Februar 2005 Schriftliche Prüfung Prüfungsfach: Zeit: Hilfsmittel: Anlagen: Technische Mathematik
Nr.: Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin nach 34 BBiG Januar / Februar 2005 Schriftliche Prüfung Prüfungsfach: Zeit: Hilfsmittel: Anlagen: Technische Mathematik
7.6. Prüfungsaufgaben zu Normalenformen
 7.6. Prüfungsaufgaben zu Normalenformen Aufgabe () Gegeben sind die Gerade g: x a + r u mit r R und die Ebene E: ( x p ) n. a) Welche geometrische Bedeutung haben die Vektoren a und u bzw. p und n? Veranschaulichen
7.6. Prüfungsaufgaben zu Normalenformen Aufgabe () Gegeben sind die Gerade g: x a + r u mit r R und die Ebene E: ( x p ) n. a) Welche geometrische Bedeutung haben die Vektoren a und u bzw. p und n? Veranschaulichen
HINWEISE ZUR BEARBEITUNG DER HAUSARBEIT LINIENFÜHRUNG
 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen HINWEISE HINWEISE ZUR BEARBEITUNG DER HAUSARBEIT LINIENFÜHRUNG EISENBAHNWESEN I Ausgabe: 2016 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1 Onlinekontrolle... 1 2 Anwendung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen HINWEISE HINWEISE ZUR BEARBEITUNG DER HAUSARBEIT LINIENFÜHRUNG EISENBAHNWESEN I Ausgabe: 2016 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1 Onlinekontrolle... 1 2 Anwendung
12 Der Abstand eines Punktes von einer Geraden Seite 1 von Der Abstand eines Punktes von einer Geraden
 12 Der Abstand eines Punktes von einer Geraden Seite 1 von 5 12 Der Abstand eines Punktes von einer Geraden Die Bestimmung des Abstands eines Punktes von einer Geraden gehört zu den zentralen Problemen
12 Der Abstand eines Punktes von einer Geraden Seite 1 von 5 12 Der Abstand eines Punktes von einer Geraden Die Bestimmung des Abstands eines Punktes von einer Geraden gehört zu den zentralen Problemen
Lösungen zum Thema Geometrie. Lösungen zur Aufg. 0: a) Gib an, um welche besondere Linie im Dreieck es sich jeweils handelt.
 Lösungen zum Thema Geometrie Lösungen zur Aufg. 0: a) Gib an, um welche besondere Linie im Dreieck es sich jeweils handelt. Höhe h c Winkelhalbierende w α Mittelsenkrechte ms c Seitenhalbierende s c b)
Lösungen zum Thema Geometrie Lösungen zur Aufg. 0: a) Gib an, um welche besondere Linie im Dreieck es sich jeweils handelt. Höhe h c Winkelhalbierende w α Mittelsenkrechte ms c Seitenhalbierende s c b)
Kalibrierung von elektrooptischen Entfernungsmessern
 Stand: August 2016 Kalibrierung von elektrooptischen Entfernungsmessern In Kooperation zwischen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) und dem Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP)
Stand: August 2016 Kalibrierung von elektrooptischen Entfernungsmessern In Kooperation zwischen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) und dem Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP)
Bauvermessung. Grundvorlesung im BA-Studiengang Bauingenieurwesen Prof. Dr.-Ing. H.-J. Przybilla. Hochschule Bochum Fachbereich Geodäsie 1
 Bauvermessung Grundvorlesung im BA-Studiengang Bauingenieurwesen Prof. Dr.-Ing. H.-J. Przybilla Quellen: Resnik/Bill: Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich Witte/Schmidt: Vermessungskunde
Bauvermessung Grundvorlesung im BA-Studiengang Bauingenieurwesen Prof. Dr.-Ing. H.-J. Przybilla Quellen: Resnik/Bill: Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich Witte/Schmidt: Vermessungskunde
Legt man die vom Betrachter aus gesehen vor den, wird die spätere Konstruktion kleiner als die Risse. Legt man die hinter das Objekt, wird die perspek
 Gegeben ist ein und ein. Der wird auf eine gezeichnet, der unterhalb von dieser in einiger Entfernung und mittig. Parallel zur wird der eingezeichnet. Dieser befindet sich in Augenhöhe. Üblicherweise wird
Gegeben ist ein und ein. Der wird auf eine gezeichnet, der unterhalb von dieser in einiger Entfernung und mittig. Parallel zur wird der eingezeichnet. Dieser befindet sich in Augenhöhe. Üblicherweise wird
Kreis - Tangente. 2. Vorbemerkung: Satz des Thales Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Tangente benutzt den Satz des Thales.
 Kreis - Tangente 1. Allgemeines 2. Satz des Thales 3. Tangente an einem Punkt auf dem Kreis 4. Tangente über Analysis (an einem Punkt eines Ursprungkreises) 5. Tangente von einem Punkt (Pol) an den Kreis
Kreis - Tangente 1. Allgemeines 2. Satz des Thales 3. Tangente an einem Punkt auf dem Kreis 4. Tangente über Analysis (an einem Punkt eines Ursprungkreises) 5. Tangente von einem Punkt (Pol) an den Kreis
UTM- Strecke , ,634
 Aufgabe 1 16 Punkte Für den Bau eines Kletterparks (siehe Anlage 1 Kartenausschnitt Lageplan 1:200 Kletterwald-Kinder-Parcour ) soll Ihr Vermessungsbüro die Durchführung der Bestandsmessung, die Absteckung
Aufgabe 1 16 Punkte Für den Bau eines Kletterparks (siehe Anlage 1 Kartenausschnitt Lageplan 1:200 Kletterwald-Kinder-Parcour ) soll Ihr Vermessungsbüro die Durchführung der Bestandsmessung, die Absteckung
Matthews Vermessungskunde
 Matthews Vermessungskunde Inhalt des Gesamtwerkes Teil 1 27., neubearbeitete Auflage 1993 Grundlage der Vermessungen: Bezugsflächen, Koordinatensysteme, Maße, Fehler, Standardabweichung, Vertrauensbereich
Matthews Vermessungskunde Inhalt des Gesamtwerkes Teil 1 27., neubearbeitete Auflage 1993 Grundlage der Vermessungen: Bezugsflächen, Koordinatensysteme, Maße, Fehler, Standardabweichung, Vertrauensbereich
Fragen zu Vermessungsinstrumenten
 Fragen zu Vermessungsinstrumenten 1. Was versteht man in der Vermessung unter einer Libelle? 2. Was ist eine Dosenlibelle? 3. Was ist eine Röhrenlibelle? 4. Was ist eine Koinzidenzlibelle? 5. Was ist eine
Fragen zu Vermessungsinstrumenten 1. Was versteht man in der Vermessung unter einer Libelle? 2. Was ist eine Dosenlibelle? 3. Was ist eine Röhrenlibelle? 4. Was ist eine Koinzidenzlibelle? 5. Was ist eine
7 Beziehungen im Raum
 Lange Zeit glaubten die Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Heute zeigen dir Bilder aus dem Weltall sehr deutlich, dass die Erde die Gestalt einer Kugel hat. 7 Beziehungen im Raum Gradnetz der Erde Längengrade
Lange Zeit glaubten die Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Heute zeigen dir Bilder aus dem Weltall sehr deutlich, dass die Erde die Gestalt einer Kugel hat. 7 Beziehungen im Raum Gradnetz der Erde Längengrade
Fortführungsvermessung im ETRS89/UTM
 Fortführungsvermessung im ETRS89/UTM Fallbeispiel Punktnachweis nicht in KKQ GPS AP (Kontrollpkt.) GPS 190 2 GPS 1 GPS 245 4,58 0,20 Whs 104 192 105 Thomas Gräfrath, Bezirksregierung Arnsberg GPS Arnsberg,
Fortführungsvermessung im ETRS89/UTM Fallbeispiel Punktnachweis nicht in KKQ GPS AP (Kontrollpkt.) GPS 190 2 GPS 1 GPS 245 4,58 0,20 Whs 104 192 105 Thomas Gräfrath, Bezirksregierung Arnsberg GPS Arnsberg,
Auktion optisch-mechanischer historischer Messinstrumente
 Wann? Auktion optisch-mechanischer historischer Messinstrumente 18. Mai 2017, 15.00 Uhr Besichtigung der Instrumente ab 14.00 Uhr Wo? Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie, Raum A0-20 Das Geschenk für
Wann? Auktion optisch-mechanischer historischer Messinstrumente 18. Mai 2017, 15.00 Uhr Besichtigung der Instrumente ab 14.00 Uhr Wo? Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie, Raum A0-20 Das Geschenk für
Bauvermessung. Grundvorlesung im BA-Studiengang Bauingenieurwesen Prof. Dr.-Ing. H.-J. Przybilla. Hochschule Bochum Fachbereich Geodäsie 1
 Bauvermessung Grundvorlesung im BA-Studiengang Bauingenieurwesen Prof. Dr.-Ing. H.-J. Przybilla Quellen: Resnik/Bill: Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich Witte/Schmidt: Vermessungskunde
Bauvermessung Grundvorlesung im BA-Studiengang Bauingenieurwesen Prof. Dr.-Ing. H.-J. Przybilla Quellen: Resnik/Bill: Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich Witte/Schmidt: Vermessungskunde
Das Wichtigste auf einen Blick
 Das Wichtigste auf einen Blick Zusammenfassung Geometrie.Parameterform einer Geraden Eine Gerade ist wie auch in der Analysis durch zwei Punkte A, B im Raum eindeutig bestimmt einer der beiden Punkte,
Das Wichtigste auf einen Blick Zusammenfassung Geometrie.Parameterform einer Geraden Eine Gerade ist wie auch in der Analysis durch zwei Punkte A, B im Raum eindeutig bestimmt einer der beiden Punkte,
} Symmetrieachse von A und B.
 5 Symmetrieachsen Seite 1 von 6 5 Symmetrieachsen Gleicher Abstand von zwei Punkten Betrachtet man zwei fest vorgegebene Punkte A und B, drängt sich im Zusammenhang mit dem Abstandsbegriff eine Frage auf,
5 Symmetrieachsen Seite 1 von 6 5 Symmetrieachsen Gleicher Abstand von zwei Punkten Betrachtet man zwei fest vorgegebene Punkte A und B, drängt sich im Zusammenhang mit dem Abstandsbegriff eine Frage auf,
Abstände und Zwischenwinkel
 Abstände und Zwischenwinkel Die folgenden Grundaufgaben wurden von Oliver Riesen, KS Zug, erstellt und von Stefan Gubser, KS Zug, überarbeitet. Aufgabe 1: Bestimme den Abstand der beiden Punkte P( 3 /
Abstände und Zwischenwinkel Die folgenden Grundaufgaben wurden von Oliver Riesen, KS Zug, erstellt und von Stefan Gubser, KS Zug, überarbeitet. Aufgabe 1: Bestimme den Abstand der beiden Punkte P( 3 /
Gebrauchsanweisung zur Freien Stationierung und Polaraufnahme mit dem Tachymeter Elta R 55
 Gebrauchsanweisung zur Freien Stationierung und Polaraufnahme mit dem Tachymeter Elta R 55 Allgemeines: Punkt aufsuchen, von dem mindestens 2 Anschlusspunkte und das aufzunehmende Gelände gut sichtbar
Gebrauchsanweisung zur Freien Stationierung und Polaraufnahme mit dem Tachymeter Elta R 55 Allgemeines: Punkt aufsuchen, von dem mindestens 2 Anschlusspunkte und das aufzunehmende Gelände gut sichtbar
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 1 Zahlen 7 1.1 Zahlen und Zahlenmengen....................................... 7 1.2 Rechnen mit Zahlen und Termen....................................
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 1 Zahlen 7 1.1 Zahlen und Zahlenmengen....................................... 7 1.2 Rechnen mit Zahlen und Termen....................................
Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres
 Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres Historisches und Grundlagen: Generell wird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Fernrohren unterschieden. Auf der einen Seite gibt es das
Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres Historisches und Grundlagen: Generell wird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Fernrohren unterschieden. Auf der einen Seite gibt es das
Mitschriebe, Skripten, Bücher, einfacher Taschenrechner
 Prüfungsfach: Darstellende Geometrie Termin: 20. März 2014 Prüfungsbeginn: Prüfungsende: zugel. Hilfsmittel: Hinweis: 13.00 Uhr 14.00 Uhr Mitschriebe, Skripten, Bücher, einfacher Taschenrechner Wir bitten
Prüfungsfach: Darstellende Geometrie Termin: 20. März 2014 Prüfungsbeginn: Prüfungsende: zugel. Hilfsmittel: Hinweis: 13.00 Uhr 14.00 Uhr Mitschriebe, Skripten, Bücher, einfacher Taschenrechner Wir bitten
TheoDist FTD 05 REFLEKTORLOSER BAUTACHYMETER
 TheoDist FTD 05 REFLEKTORLOSER BAUTACHYMETER geo-fennel TheoDist Reflektorloser Tachymeter Der neue, einfach zu bedienende geo-fennel TheoDist ist eine Kombination aus elektronischem Theodoliten und Laserentfernungsmesser.
TheoDist FTD 05 REFLEKTORLOSER BAUTACHYMETER geo-fennel TheoDist Reflektorloser Tachymeter Der neue, einfach zu bedienende geo-fennel TheoDist ist eine Kombination aus elektronischem Theodoliten und Laserentfernungsmesser.
1.Weiterentwicklung der Zahlvorstellung 1.1Die natürlichen Zahlen Mengenschreibweise: N = {1,2,3,...} N 0 = {0,1,2,3,...}
 1 Grundwissen Mathematik 5.Klasse Gymnasium SOB 1.Weiterentwicklung der Zahlvorstellung 1.1Die natürlichen Zahlen Mengenschreibweise: N = {1,2,3,...} N 0 = {0,1,2,3,...} Darstellung am Zahlenstrahl: Darstellung
1 Grundwissen Mathematik 5.Klasse Gymnasium SOB 1.Weiterentwicklung der Zahlvorstellung 1.1Die natürlichen Zahlen Mengenschreibweise: N = {1,2,3,...} N 0 = {0,1,2,3,...} Darstellung am Zahlenstrahl: Darstellung
STUDIENANLEITUNG FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN. 1. Modul / Stoffgebiet. Modul BBF1-09 / BIW1-09: Technische Grundlagen Stoffgebiet: Vermessungskunde
 Bearbeitungsstand: Februar 2016 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN 1. Modul / Stoffgebiet Modul BBF1-09 / BIW1-09: Technische Grundlagen
Bearbeitungsstand: Februar 2016 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN 1. Modul / Stoffgebiet Modul BBF1-09 / BIW1-09: Technische Grundlagen
Termin: Sommer 2011 Fertigkeitsprüfung. Name des Prüflings: Ausbildungsstätte:
 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) Podbielskistr. 331, 30659 Hannover Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen als Zuständige Stelle nach BBiG Prüfungsaufgaben
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) Podbielskistr. 331, 30659 Hannover Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen als Zuständige Stelle nach BBiG Prüfungsaufgaben
STUDIENANLEITUNG FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN. 1. Modul / Stoffgebiet. Modul BBF1-09 / BIW1-09: Technische Grundlagen Stoffgebiet: Vermessungskunde
 Bearbeitungsstand: Februar 2015 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN 1. Modul / Stoffgebiet Modul BBF1-09 / BIW1-09: Technische Grundlagen
Bearbeitungsstand: Februar 2015 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN 1. Modul / Stoffgebiet Modul BBF1-09 / BIW1-09: Technische Grundlagen
Bildkonstruktion an Konvexlinsen (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konvexlinsen (Artikelnr.: P065400) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konvexlinsen (Artikelnr.: P065400) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Gundlagen Klasse 5/6 Geometrie. nach oben. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Grundbegriffe der Geometrie Geometrische Abbildungen Das Koordinatensystem Schnittpunkt von Geraden Symmetrien Orthogonale Geraden Abstände Parallele Geraden Vierecke Diagonalen in Vielecken
Inhaltsverzeichnis Grundbegriffe der Geometrie Geometrische Abbildungen Das Koordinatensystem Schnittpunkt von Geraden Symmetrien Orthogonale Geraden Abstände Parallele Geraden Vierecke Diagonalen in Vielecken
II. Zeitlicher Ablauf und Fernbleiben an einem Praktikumstermin
 Hinweise für die Praktika Physik I, Physik II I. Voraussetzungen zur Teilnahme Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Prüfungsordnungen vom 08.06.2011 (bei Studienbeginn ab WS 2011/2012) und 15.09.2015
Hinweise für die Praktika Physik I, Physik II I. Voraussetzungen zur Teilnahme Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Prüfungsordnungen vom 08.06.2011 (bei Studienbeginn ab WS 2011/2012) und 15.09.2015
Versuch P2-71,74: Kreisel. Auswertung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 25. Mai Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achse 2
 Versuch P2-71,74: Kreisel Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 25. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 2 2 Freie Achse 2 3 Kräftefreie Kreisel 2 4 Dämpfung des Kreisels 3 5 Kreisel
Versuch P2-71,74: Kreisel Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 25. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 2 2 Freie Achse 2 3 Kräftefreie Kreisel 2 4 Dämpfung des Kreisels 3 5 Kreisel
Schule. Station Jakobsstab & Co. Teil 1. Klasse. Arbeitsheft. Tischnummer. Teilnehmercode
 Schule Station Jakobsstab & Co. Teil 1 Arbeitsheft Klasse Tischnummer Teilnehmercode Mathematik-Labor Station Jakobsstab & Co. Teil 1 Liebe Schülerinnen und Schüler! Schon immer haben sich die Menschen
Schule Station Jakobsstab & Co. Teil 1 Arbeitsheft Klasse Tischnummer Teilnehmercode Mathematik-Labor Station Jakobsstab & Co. Teil 1 Liebe Schülerinnen und Schüler! Schon immer haben sich die Menschen
Der Höhenplan. Höhenpläne Der Höhenplan 1. Was sind Höhenlinien? Was ist ein Plan?
 Höhenpläne Der Höhenplan 1 Der Höhenplan Was ist ein Plan? Ein Plan ist eine maßstäbliche Zeichnung mit der Darstellung der bestehenden Situation (z.b. Flurstücksgrenzen, Gebäude, Topographie, u.s.w.)
Höhenpläne Der Höhenplan 1 Der Höhenplan Was ist ein Plan? Ein Plan ist eine maßstäbliche Zeichnung mit der Darstellung der bestehenden Situation (z.b. Flurstücksgrenzen, Gebäude, Topographie, u.s.w.)
Die Strahlensätze machen eine Aussage über Streckenverhältnisse, nämlich:
 Elementargeometrie Der. Strahlensatz Geschichte: In den Elementen des Euklid wird im 5.Buch die Proportionenlehre behandelt, d.h. die geometrische Theorie aller algebraischen Umformungen der Proportion.
Elementargeometrie Der. Strahlensatz Geschichte: In den Elementen des Euklid wird im 5.Buch die Proportionenlehre behandelt, d.h. die geometrische Theorie aller algebraischen Umformungen der Proportion.
Mathematik - 1. Semester. folgenden Zahlenpaare die gegebene Gleichung erfüllen:
 Mathematik -. Semester Wi. Ein Beispiel Lineare Funktionen Gegeben sei die Gleichung y x + 3. Anhand einer Wertetabelle sehen wir; daß die folgenden Zahlenpaare die gegebene Gleichung erfüllen: x 0 6 8
Mathematik -. Semester Wi. Ein Beispiel Lineare Funktionen Gegeben sei die Gleichung y x + 3. Anhand einer Wertetabelle sehen wir; daß die folgenden Zahlenpaare die gegebene Gleichung erfüllen: x 0 6 8
Abschlussprüfung. im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in Wintertermin 2004/2005. Vermessungskunde
 Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in Wintertermin 2004/2005 Vermessungskunde Zeit: Hilfsmittel: Hinweise: 2 Stunden Rechner (nicht programmierbar), Maßstab, Dreieck, Lineal, Zirkel
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in Wintertermin 2004/2005 Vermessungskunde Zeit: Hilfsmittel: Hinweise: 2 Stunden Rechner (nicht programmierbar), Maßstab, Dreieck, Lineal, Zirkel
Didaktik der Analysis und der Analytischen Geometrie/ Linearen Algebra
 A. Filler[-3mm] Didaktik der Analysis und der Analytischen Geometrie/ Linearen Algebra, Teil 8 Folie 1 /27 Didaktik der Analysis und der Analytischen Geometrie/ Linearen Algebra 8. Das Skalarprodukt, metrische
A. Filler[-3mm] Didaktik der Analysis und der Analytischen Geometrie/ Linearen Algebra, Teil 8 Folie 1 /27 Didaktik der Analysis und der Analytischen Geometrie/ Linearen Algebra 8. Das Skalarprodukt, metrische
D C. Man unterscheidet in der Geometrie zwischen Körpern, Flächen, Linien und Punkten.
 V. Körper, Flächen und Punkte ================================================================= 5.1 Körper H G E F D C A B Man unterscheidet in der Geometrie zwischen Körpern, Flächen, Linien und Punkten.
V. Körper, Flächen und Punkte ================================================================= 5.1 Körper H G E F D C A B Man unterscheidet in der Geometrie zwischen Körpern, Flächen, Linien und Punkten.
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin nach 37 BBiG. Juni/Juli/August 2009
 Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin nach 37 BBiG Juni/Juli/August 2009 Schriftliche Prüfung Prüfungsfach: Zeit: Hilfsmittel: Vermessungskunde 120 min Schreibgeräte,
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin nach 37 BBiG Juni/Juli/August 2009 Schriftliche Prüfung Prüfungsfach: Zeit: Hilfsmittel: Vermessungskunde 120 min Schreibgeräte,
InfoBrief Juni Vektordiagramme
 InfoBrief Überblick stellen für Messstellen mit zeitlich veränderlichen dreidimensionalen Koordinaten die Bewegung in einer festgelegten Projektionsebene grafisch dar. Die Darstellung kann jeweils erfolgen
InfoBrief Überblick stellen für Messstellen mit zeitlich veränderlichen dreidimensionalen Koordinaten die Bewegung in einer festgelegten Projektionsebene grafisch dar. Die Darstellung kann jeweils erfolgen
Kreis - Übungen. 1) Die y-achse ist am Punkt A eine Tangente an den Kreis. Mit dem noch nicht bekannten "Zwischenwert"
 Kreis - Übungen Wenn die "Kreisgleichung" gesucht ist, sind der Mittelpunkt und der Radius anzugeben. Es ist möglich, dass mehrere Kreise eine Aufgabenstellung erfüllen. 1) Ein Kreis berührt die y-achse
Kreis - Übungen Wenn die "Kreisgleichung" gesucht ist, sind der Mittelpunkt und der Radius anzugeben. Es ist möglich, dass mehrere Kreise eine Aufgabenstellung erfüllen. 1) Ein Kreis berührt die y-achse
Klausur zur Einführung in die Geometrie im SS 2002
 Klausur zur Einführung in die Geometrie im SS 2002 Name, Vorname... Matr.Nr.... Semester-Anzahl im SS 2002:... Studiengang GH/R/S Tutor/in:... Aufg.1 Aufg,2 Aufg.3 Aufg.4 Aufg.5 Aufg.6 Aufg.7 Aufg.8 Gesamt
Klausur zur Einführung in die Geometrie im SS 2002 Name, Vorname... Matr.Nr.... Semester-Anzahl im SS 2002:... Studiengang GH/R/S Tutor/in:... Aufg.1 Aufg,2 Aufg.3 Aufg.4 Aufg.5 Aufg.6 Aufg.7 Aufg.8 Gesamt
Dynamische Geometrie
 Dynamische Geometrie 1) Die Mittelsenkrechten, die Seitenhalbierenden, die Höhen und die Winkelhalbierenden eines beliebigen Dreiecks schneiden sich jeweils in einem Punkt. a) Untersuchen Sie die Lage
Dynamische Geometrie 1) Die Mittelsenkrechten, die Seitenhalbierenden, die Höhen und die Winkelhalbierenden eines beliebigen Dreiecks schneiden sich jeweils in einem Punkt. a) Untersuchen Sie die Lage
O10 Linsensysteme. Physikalische Grundlagen. Grundbegriffe Hauptebenen Abbildungsgleichung Abbildungsmaßstab Bildkonstruktion
 Physikalische Grundlagen Grundbegriffe Hauptebenen Abbildungsgleichung Abbildungsmaßstab Bildkonstruktion 1. Definition der Hauptebenen Bei dünnen Linsen kann die zweifache Brechung (Vorder- und Rückseite
Physikalische Grundlagen Grundbegriffe Hauptebenen Abbildungsgleichung Abbildungsmaßstab Bildkonstruktion 1. Definition der Hauptebenen Bei dünnen Linsen kann die zweifache Brechung (Vorder- und Rückseite
Lineare Funktion Eigenschaften von linearen Funktionen Übungen Bearbeite zu jeder der gegebenen Funktionen die Fragen:
 Lineare Funktion Eigenschaften von linearen Funktionen Übungen - 3 2.0 Bearbeite zu jeder der gegebenen Funktionen die Fragen: steigt oder fällt der Graph der Funktion? schneidet der Graph die y-achse
Lineare Funktion Eigenschaften von linearen Funktionen Übungen - 3 2.0 Bearbeite zu jeder der gegebenen Funktionen die Fragen: steigt oder fällt der Graph der Funktion? schneidet der Graph die y-achse
Mit eckigen Rädern fahren
 Mit eckigen Rädern fahren Für Spielfreudige und mathematisch Interessierte Mit eckigen Rädern fahren: Das klingt reichlich unwahrscheinlich, aber möglich ist es. Zugegeben: Die Idee ist etwas wunderlich
Mit eckigen Rädern fahren Für Spielfreudige und mathematisch Interessierte Mit eckigen Rädern fahren: Das klingt reichlich unwahrscheinlich, aber möglich ist es. Zugegeben: Die Idee ist etwas wunderlich
Mecklenburg - Vorpommern
 Arbeit A Seite 1 Mecklenburg - Vorpommern Realschulprüfung 1996 im Fach Mathematik Arbeit A Seite 2 Pflichtteil 1. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle innerhalb einer Ortschaft durchfuhren die Meßstelle
Arbeit A Seite 1 Mecklenburg - Vorpommern Realschulprüfung 1996 im Fach Mathematik Arbeit A Seite 2 Pflichtteil 1. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle innerhalb einer Ortschaft durchfuhren die Meßstelle
Physikalisches Praktikum 3
 Datum: 0.10.04 Physikalisches Praktikum 3 Versuch: Betreuer: Goniometer und Prisma Dr. Enenkel Aufgaben: 1. Ein Goniometer ist zu justieren.. Der Brechungsindex n eines gegebenen Prismas ist für 4 markante
Datum: 0.10.04 Physikalisches Praktikum 3 Versuch: Betreuer: Goniometer und Prisma Dr. Enenkel Aufgaben: 1. Ein Goniometer ist zu justieren.. Der Brechungsindex n eines gegebenen Prismas ist für 4 markante
Vektoren - Basiswechsel
 Vektoren - Basiswechsel Grundprinzip Für rein geometrische Anwendungen verwendet man üblicherweise die Standardbasis. Damit ergibt sich in den Zahlenangaben der Koordinaten kein Unterschied zu einem Bezug
Vektoren - Basiswechsel Grundprinzip Für rein geometrische Anwendungen verwendet man üblicherweise die Standardbasis. Damit ergibt sich in den Zahlenangaben der Koordinaten kein Unterschied zu einem Bezug
Prüfungsaufgaben für die Abschluss-/Umschulungsprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungstechnikerin und Vermessungstechniker. Termin: Sommer 2004
 Bezirksregierung Hannover als Zuständige Stelle nach 84 BBiG für die Ausbildungsberufe Kartograph/in im öffentlichen Dienst und Vermessungstechniker/in in Niedersachsen Lfd. Nr. Prüfungsaufgaben für die
Bezirksregierung Hannover als Zuständige Stelle nach 84 BBiG für die Ausbildungsberufe Kartograph/in im öffentlichen Dienst und Vermessungstechniker/in in Niedersachsen Lfd. Nr. Prüfungsaufgaben für die
Seite 1 von 10. Staatsprüfung für den mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst. Juli / August 2012
 Seite 1 von 10 Staatsprüfung für den mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst Juli / August 01 LosNr. / Prüfungsfach: Vermessungstechnik und Kartenwesen Aufgabe 1 Zeit: 3 Stunden Hilfsmittel:
Seite 1 von 10 Staatsprüfung für den mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst Juli / August 01 LosNr. / Prüfungsfach: Vermessungstechnik und Kartenwesen Aufgabe 1 Zeit: 3 Stunden Hilfsmittel:
Erdellipsoid (Rotationsellipsoid) als mathematisch/geometrisch
 Höhenmessung Die Ergebnisse der Höhenmessung (Nivellement) werden nicht nur für die Geländedarstellung und die Höhenangaben in topographischen Karten, sondern für nahezu alle Bauvorhaben und Ingenieurvermessungen
Höhenmessung Die Ergebnisse der Höhenmessung (Nivellement) werden nicht nur für die Geländedarstellung und die Höhenangaben in topographischen Karten, sondern für nahezu alle Bauvorhaben und Ingenieurvermessungen
Bild 1: Gegeben ist der in der Zentralperspektive zentrale Fluchtpunkt, der Distanzpunkt und der Grundriss des zu zeichnenden Vierecks.
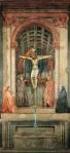 Bild 1: Gegeben ist der in der Zentralperspektive zentrale, der und der Grundriss des zu zeichnenden Vierecks. Die Breite des Vierecks trägt man auf der ab und verbindet die Schnittpunkte mit dem zentralen
Bild 1: Gegeben ist der in der Zentralperspektive zentrale, der und der Grundriss des zu zeichnenden Vierecks. Die Breite des Vierecks trägt man auf der ab und verbindet die Schnittpunkte mit dem zentralen
Stationstraining. Trage hier ein, wenn du eine Station abgeschlossen hast. Wenn du mit einem Partner gearbeitet hast, trage seinen Vornamen ein.
 Name: Starte an einer Station deiner Wahl. Achtung: es sollten nicht mehr als 4 Schüler gleichzeitig an einer Station arbeiten. Löse die Aufgaben einer Station entsprechend der Anweisung. Bearbeite zuerst
Name: Starte an einer Station deiner Wahl. Achtung: es sollten nicht mehr als 4 Schüler gleichzeitig an einer Station arbeiten. Löse die Aufgaben einer Station entsprechend der Anweisung. Bearbeite zuerst
Ausbildungsjahr 2014/2015. Lehrgangsangebot der überbetrieblichen Ausbildung für die Berufe in der Geoinformationstechnologie
 Lehrgangsangebot der überbetrieblichen Ausbildung für die Berufe in der Geoinformationstechnologie Ausbildungsjahr 2014/2015 Zentrale Aus- und Fortbildung Frankfurt (Oder) Basis - Lehrgangsprogramm Lehrgangsbezeichnung
Lehrgangsangebot der überbetrieblichen Ausbildung für die Berufe in der Geoinformationstechnologie Ausbildungsjahr 2014/2015 Zentrale Aus- und Fortbildung Frankfurt (Oder) Basis - Lehrgangsprogramm Lehrgangsbezeichnung
Bildkonstruktion an Konkavlinsen (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konkavlinsen (Artikelnr.: P065600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konkavlinsen (Artikelnr.: P065600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
55. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Olympiadeklasse 8 Lösungen
 55. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Olympiadeklasse 8 Lösungen c 2015 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 550821 Lösung
55. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Olympiadeklasse 8 Lösungen c 2015 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 550821 Lösung
Übung: Abhängigkeiten
 Übung: Abhängigkeiten Befehle: Linie, Abhängigkeiten, Kreis, Drehung Vorgehen Erstellen Sie ein neues Bauteil. Projizieren Sie die X-Achse und die Y-Achse als Bezug zum Koordinatensystem. Klicken Sie auf
Übung: Abhängigkeiten Befehle: Linie, Abhängigkeiten, Kreis, Drehung Vorgehen Erstellen Sie ein neues Bauteil. Projizieren Sie die X-Achse und die Y-Achse als Bezug zum Koordinatensystem. Klicken Sie auf
Wie lautet die Gleichung der Geraden, durch die beiden Punkte A(4/1) und B(-5/8)?
 Übungsbeispiel / 2 Gerade durch 2 Punkte Wie lautet die Gleichung der Geraden, durch die beiden Punkte A(4/) und B(-5/8)? Maturavorbereitung 8. Klasse ACDCA 999 Vektorrechnung Übungsbeispiel 2 / 2 Gerade
Übungsbeispiel / 2 Gerade durch 2 Punkte Wie lautet die Gleichung der Geraden, durch die beiden Punkte A(4/) und B(-5/8)? Maturavorbereitung 8. Klasse ACDCA 999 Vektorrechnung Übungsbeispiel 2 / 2 Gerade
SCHRIFTLICHE MATURA 2010
 SCHRIFTLICHE MATURA 2010 Fach: Mathematik Klassen: 7SA Prüfer: Dr. Martin Holzer Name: Diese Arbeit umfasst 4 Aufgaben. Jede der 4 Aufgaben wird mit gleich vielen Punkten bewertet. Für die Darstellung
SCHRIFTLICHE MATURA 2010 Fach: Mathematik Klassen: 7SA Prüfer: Dr. Martin Holzer Name: Diese Arbeit umfasst 4 Aufgaben. Jede der 4 Aufgaben wird mit gleich vielen Punkten bewertet. Für die Darstellung
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten
 Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 1: Geodätische Koordinatensysteme und Erste Geodätische Hauptaufgabe Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich
Vermessungskunde für Bauingenieure und Geodäten Übung 1: Geodätische Koordinatensysteme und Erste Geodätische Hauptaufgabe Milo Hirsch Hendrik Hellmers Florian Schill Institut für Geodäsie Fachbereich
Kapitel im Fokus. Ich kann / kenne. 5. Klasse Stand Juni **Anzahl der KA: 6 pro Schuljahr** Daten und Zufall. Größen messen
 Daten und Zufall Sammeln und Auswerten von Daten Strichliste Absolute Häufigkeit Säulendiagramm Daten erfassen (Strichlisten, Tabellen). gesammelte Daten auswerten. Daten mithilfe von Diagrammen darstellen.
Daten und Zufall Sammeln und Auswerten von Daten Strichliste Absolute Häufigkeit Säulendiagramm Daten erfassen (Strichlisten, Tabellen). gesammelte Daten auswerten. Daten mithilfe von Diagrammen darstellen.
Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil
 Übungen mit dem Applet Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil 1. Statistischer Hintergrund und Darstellung.... Wie entsteht der Vertrauensbereich?...
Übungen mit dem Applet Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil 1. Statistischer Hintergrund und Darstellung.... Wie entsteht der Vertrauensbereich?...
Computational Geometry, MU Leoben
 Computational Geometry, MU Leoben www.unileoben.ac.at Computational Geometry Lehrveranstaltung: Darstellende Geometrie I, Übungen SS 2011 http://institute.unileoben.ac.at/anggeom/dg1 Übungsleiterin: S.
Computational Geometry, MU Leoben www.unileoben.ac.at Computational Geometry Lehrveranstaltung: Darstellende Geometrie I, Übungen SS 2011 http://institute.unileoben.ac.at/anggeom/dg1 Übungsleiterin: S.
1 Vektorrechnung als Teil der Linearen Algebra - Einleitung
 Vektorrechnung als Teil der Linearen Algebra - Einleitung www.mathebaustelle.de. Einführungsbeispiel Archäologen untersuchen eine neu entdeckte Grabanlage aus der ägyptischen Frühgeschichte. Damit jeder
Vektorrechnung als Teil der Linearen Algebra - Einleitung www.mathebaustelle.de. Einführungsbeispiel Archäologen untersuchen eine neu entdeckte Grabanlage aus der ägyptischen Frühgeschichte. Damit jeder
Mitschriebe, Skripten, Bücher, einfacher Taschenrechner
 Prüfungsfach: Darstellende Geometrie Termin: 2. September 2015 Prüfungsbeginn: Prüfungsende: zugel. Hilfsmittel: Hinweis: 9.00 Uhr 10.00 Uhr Mitschriebe, Skripten, Bücher, einfacher Taschenrechner Wir
Prüfungsfach: Darstellende Geometrie Termin: 2. September 2015 Prüfungsbeginn: Prüfungsende: zugel. Hilfsmittel: Hinweis: 9.00 Uhr 10.00 Uhr Mitschriebe, Skripten, Bücher, einfacher Taschenrechner Wir
5A. Von der Perspektive zu den projektiven Ebenen.
 5A. Von der Perspektive zu den projektiven Ebenen. Neben der Euklidischen Geometrie, wie sie im Buch von Euklid niedergelegt und wie wir sie im vorigen Abschnitt behandelt haben, gibt es noch weitere Geometrien.
5A. Von der Perspektive zu den projektiven Ebenen. Neben der Euklidischen Geometrie, wie sie im Buch von Euklid niedergelegt und wie wir sie im vorigen Abschnitt behandelt haben, gibt es noch weitere Geometrien.
M 3.1. Seite 1. Modul 3.1 Geometrie: Umgang mit dem Geodreieck. Thema. 1. Umgang mit dem Geodreieck. Datum
 Seite. Wie zeichnet man zueinander senkrechte Geraden?. Zeichne zunächst mit deinem Geodreieck eine Gerade von 2 cm. 2. Nun drehst du dein Geodreieck wie rechts abgebildet. Achte darauf, dass die Gerade
Seite. Wie zeichnet man zueinander senkrechte Geraden?. Zeichne zunächst mit deinem Geodreieck eine Gerade von 2 cm. 2. Nun drehst du dein Geodreieck wie rechts abgebildet. Achte darauf, dass die Gerade
Grundsätzliche Konstruktionshilfen:
 Grundsätzliche Konstruktionshilfen: Konstruktion des Netzes Seite 1 Wahre Größe von Flächen und Geraden Seite 1 Drehen in Hauptlage Seite 2 Wahre Größe durch weiteren Riss Seite 4 Sichtbarkeit Seite 5
Grundsätzliche Konstruktionshilfen: Konstruktion des Netzes Seite 1 Wahre Größe von Flächen und Geraden Seite 1 Drehen in Hauptlage Seite 2 Wahre Größe durch weiteren Riss Seite 4 Sichtbarkeit Seite 5
Abiturprüfung Mathematik 2015 Baden-Württemberg Allgemeinbildende Gymnasien Wahlteil Analytische Geometrie / Stochastik Aufgabe B 1.1 und B 1.
 1 Abiturprüfung Mathematik 215 Baden-Württemberg Allgemeinbildende Gymnasien Wahlteil Analytische Geometrie / Stochastik Aufgabe B 1.1 und B 1.2 - Lösungen klaus_messner@web.de www.elearning-freiburg.de
1 Abiturprüfung Mathematik 215 Baden-Württemberg Allgemeinbildende Gymnasien Wahlteil Analytische Geometrie / Stochastik Aufgabe B 1.1 und B 1.2 - Lösungen klaus_messner@web.de www.elearning-freiburg.de
Praktikum Optische Technologien Anleitung zum Versuch Dicke Linsen
 Fachbereich Energietechnik Lehrgebiet für Lasertechnik und Optische Technologien Prof. Dr. F.-M. Rateike Praktikum Optische Technologien Anleitung zum Versuch Dicke Linsen August 204 Praktikum Optische
Fachbereich Energietechnik Lehrgebiet für Lasertechnik und Optische Technologien Prof. Dr. F.-M. Rateike Praktikum Optische Technologien Anleitung zum Versuch Dicke Linsen August 204 Praktikum Optische
3.6 Einführung in die Vektorrechnung
 3.6 Einführung in die Vektorrechnung Inhaltsverzeichnis Definition des Vektors 2 2 Skalare Multiplikation und Kehrvektor 4 3 Addition und Subtraktion von Vektoren 5 3. Addition von zwei Vektoren..................................
3.6 Einführung in die Vektorrechnung Inhaltsverzeichnis Definition des Vektors 2 2 Skalare Multiplikation und Kehrvektor 4 3 Addition und Subtraktion von Vektoren 5 3. Addition von zwei Vektoren..................................
SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2013 MATHEMATIK (GRUNDLEGENDES ANFORDERUNGSNIVEAU) Prüfungsaufgaben
 () Prüfungsaufgaben Auswahlzeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 210 Minuten Es sind die drei Pflichtaufgaben und eine Wahlpflichtaufgabe zu lösen. Entscheiden Sie sich für eine Wahlpflichtaufgabe und kreuzen
() Prüfungsaufgaben Auswahlzeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 210 Minuten Es sind die drei Pflichtaufgaben und eine Wahlpflichtaufgabe zu lösen. Entscheiden Sie sich für eine Wahlpflichtaufgabe und kreuzen
SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2013 MATHEMATIK (ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU) Prüfungsaufgaben
 () Prüfungsaufgaben Auswahlzeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 300 Minuten Es sind die drei Pflichtaufgaben und eine Wahlpflichtaufgabe zu lösen. Entscheiden Sie sich für eine Wahlpflichtaufgabe und kreuzen
() Prüfungsaufgaben Auswahlzeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 300 Minuten Es sind die drei Pflichtaufgaben und eine Wahlpflichtaufgabe zu lösen. Entscheiden Sie sich für eine Wahlpflichtaufgabe und kreuzen
absteckplanung
 absteckplanung http://technikseiten.hsr.ch Einleitung 1 Definition des Begriffes 1 Abstecksysteme 1 Einfache Absteckung 1 Koordinatenabsteckung mit Schweizer Landeskoordinaten 1 Bemassungsarten 2 Bemassungshierarchie
absteckplanung http://technikseiten.hsr.ch Einleitung 1 Definition des Begriffes 1 Abstecksysteme 1 Einfache Absteckung 1 Koordinatenabsteckung mit Schweizer Landeskoordinaten 1 Bemassungsarten 2 Bemassungshierarchie
Station Strahlensätze Teil 1. Arbeitsheft. Teilnehmercode
 Station Strahlensätze Teil 1 Arbeitsheft Teilnehmercode Mathematik-Labor Station Strahlensätze Teil 1 Liebe Schülerinnen und Schüler! Schon immer haben sich die Menschen Gedanken gemacht, wie man Strecken
Station Strahlensätze Teil 1 Arbeitsheft Teilnehmercode Mathematik-Labor Station Strahlensätze Teil 1 Liebe Schülerinnen und Schüler! Schon immer haben sich die Menschen Gedanken gemacht, wie man Strecken
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lineare Funktionen an der Berufsschule: Übungsaufgaben
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lineare Funktionen an der Berufsschule: Übungsaufgaben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Übungsaufgaben:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lineare Funktionen an der Berufsschule: Übungsaufgaben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Übungsaufgaben:
Die Praktika findet im Physiklabor in C224 und C225 statt.
 Hinweise für die Praktika Physik I, Physik II Die Praktika findet im Physiklabor in C224 und C225 statt. I. Voraussetzungen zur Teilnahme Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Prüfungsordnungen vom 08.06.2011
Hinweise für die Praktika Physik I, Physik II Die Praktika findet im Physiklabor in C224 und C225 statt. I. Voraussetzungen zur Teilnahme Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Prüfungsordnungen vom 08.06.2011
2. Ermitteln Sie die Höhe des Zauns. Die Bodenplatte kann teilweise im Boden eingegraben werden.
 Montage Anleitung 1. Finden Sie die Grundstücksgrenze und spannen Sie eine Maurerschnur. LIND BETON APS www.havehegn.dk 2. Ermitteln Sie die Höhe des Zauns. Die Bodenplatte kann teilweise im Boden eingegraben
Montage Anleitung 1. Finden Sie die Grundstücksgrenze und spannen Sie eine Maurerschnur. LIND BETON APS www.havehegn.dk 2. Ermitteln Sie die Höhe des Zauns. Die Bodenplatte kann teilweise im Boden eingegraben
Messung der Geradheit einer optischen Bank
 D.-I. Kurt Salmann HTBLuVA Mödling / Abt. Mechatronik Übungsanleitung Betriebslabor Optik Klassen: AFFW 1. Übung Gruppe geteilt (Brennweitenmessung / Geradheit einer optischen Bank) Messung der Geradheit
D.-I. Kurt Salmann HTBLuVA Mödling / Abt. Mechatronik Übungsanleitung Betriebslabor Optik Klassen: AFFW 1. Übung Gruppe geteilt (Brennweitenmessung / Geradheit einer optischen Bank) Messung der Geradheit
Klausur Nr. 2. Skalarprodukt, Ebenen und Geraden (Darstellungen und Lage zueinander)
 Klausur Nr. 2 2013-06-06 Pflichtteil Skalarprodukt, Ebenen und Geraden (Darstellungen und Lage zueinander) keine Hilfsmittel gestattet, bitte alle Lösungen auf dieses Blatt. Name: 0. Für Pflicht- und Wahlteil
Klausur Nr. 2 2013-06-06 Pflichtteil Skalarprodukt, Ebenen und Geraden (Darstellungen und Lage zueinander) keine Hilfsmittel gestattet, bitte alle Lösungen auf dieses Blatt. Name: 0. Für Pflicht- und Wahlteil
K2 - Klausur Nr. 3. Generalprobe mit allen Themen. keine Hilfsmittel gestattet, bitte alle Lösungen auf dieses Blatt.
 K2 - Klausur Nr. 3 Generalprobe mit allen Themen Pflichtteil keine Hilfsmittel gestattet, bitte alle Lösungen auf dieses Blatt. Name: 0. Für Pflicht- und Wahlteil gilt: saubere und übersichtliche Darstellung,
K2 - Klausur Nr. 3 Generalprobe mit allen Themen Pflichtteil keine Hilfsmittel gestattet, bitte alle Lösungen auf dieses Blatt. Name: 0. Für Pflicht- und Wahlteil gilt: saubere und übersichtliche Darstellung,
2.5. Aufgaben zu Dreieckskonstruktionen
 2.5. Aufgaben zu Dreieckskonstruktionen Aufgabe 1 Zeichne das Dreieck AC mit A( 1 2), (5 0) und C(3 6) und konstruiere seinen Umkreis. Gib den Radius und den Mittelpunkt des Umkreises an. Aufgabe 2 Konstruiere
2.5. Aufgaben zu Dreieckskonstruktionen Aufgabe 1 Zeichne das Dreieck AC mit A( 1 2), (5 0) und C(3 6) und konstruiere seinen Umkreis. Gib den Radius und den Mittelpunkt des Umkreises an. Aufgabe 2 Konstruiere
