Aufgrund der Differenzen zwischen Ist- und Soll-Zeiten gilt es, die Ursachen zu klären und ggf. abzustellen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren zur
|
|
|
- Lorenz Winkler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2
3
4 Aufgrund der Differenzen zwischen Ist- und Soll-Zeiten gilt es, die Ursachen zu klären und ggf. abzustellen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren zur Zeitdatenermittlung. Experimentelle Verfahren dienen zur Ermittlung von Ist-Zeiten. Rechnerische Verfahren sind die Grundlage zur Ermittlung von Soll-Zeiten.
5 Die Begriffsbestimmung von Systemen vorbestimmter Zeiten macht deutlich, dass die Anwendung von Systemen vorbestimmter Zeiten auf vorwiegend manuelle Tätigkeiten beschränkt ist. Geistige Tätigkeiten, die über einfache Ja-Nein-Entscheidungen hinausgehen, können nicht mit Systemen vorbestimmter Zeiten modelliert werden. Darüber hinaus ist eine SvZ-Anwendung nur möglich, wenn der Arbeitende diese Arbeitsabläufe voll beeinflussen kann. Sogenannte Prozesszeiten sind durch Zeitmessungen zu bestimmen. Mittels Systemen vorbestimmter Zeiten lassen sich nur die Tätigkeitszeiten ermitteln. In den Normzeitwerten sind keine Verteil- oder Erholzeiten enthalten.
6
7 Taylor forderte, dass bei der Zeitstudie die Arbeit des Ausführenden in einfache Elementarbewegungen zu zerlegen sei; jede Elementarbewegung sei unter Angabe der Zeitdauer genau zu beschreiben und so zu klassifizieren, dass sie bei Bedarf jederzeit schnell wieder aufzufinden ist. In gleicher Reihenfolge wiederkehrende Kombinationen von Elementarbewegungen sollten zur schnellen Wiederverwendung klassifiziert werden. Wenn schließlich genügend Zeiten von Elementarbewegungen und deren Kombinationen klassifiziert seien, könne die zur Verrichtung fast jeder Arbeit erforderliche Zeit durch Hinzufügen der entsprechenden Zuschläge synthetisch ermittelt werden. Sein Schüler Gilbreth analysierte Bewegungsabläufe u.a. mit Hilfe von Filmaufnahmen und ging davon aus, dass es Bewegungselemente gibt, die sich nicht weiter unterteilen lassen. Er definierte 17 solcher Elemente und nannte sie, seinen Namen rückwärts schreibend, Therbligs. Mit diesen Bewegungselementen verband er die Idee, den Zeitbedarf jeder beliebigen bi Ab Arbeit synthetisch ti h ermitteln zu können. Das erste System vorbestimmter Zeiten wurde dann auch von A.B. Segur, einem Mitarbeiter Gilbreths, im Jahre 1924 vorgestellt. Die Urheberrechte für das MTM-Verfahren wurden von den Entwicklern der 1951 gegründeten U.S.MTM-Association for Standards and Research übertragen. Diese arbeitet auf gemeinnütziger Basis. Aufgrund der schnellen Verbreitung des MTM-Verfahrens gründeten sich in der Folgezeit eine Reihe weiterer nationaler MTM-Vereinigungen. Die Dachorganisation dieser nationalen MTM-Vereinigungen bildet das Internationale MTM-Direktorat. Die U.S.MTM- Association hat den nationalen, im internationalen MTM-Direktorat vertretenden Vereinigungen die Urheberrechte des MTM-1-Verfahrens für den Geltungsbereich ihrer Satzung übertragen. Die Deutsche MTM-Vereinigung g e. V. wurde 1962 von bekannten deutschen Industrieunternehmen gegründet und ist weltweit eine der größten nationalen MTM- Vereinigungen. Weitere Informationen befinden sich unter: veröffentlichte Kjell Zandin in Schweden MOST (Maynard Operation Sequence Technique), bei dem vorwiegend die Bewegung von Objekten betrachtet wird. Es wird dabei unterschieden zwischen drei Bewegungsabfolgen: General Move, Controlled Move und Tool Use.
8 Um die Grundbewegungen gegeneinander abzugrenzen und den Zeitbedarf für die Grundbewegungen zu ermitteln, wurden eine Vielzahl industrieller Arbeitsabläufe gefilmt. Durch Auszählen der je Bewegung anfallenden Bilder wurden die Ist-Zeiten ermittelt. Die aus der interpersonellen Leistungsstreuung resultierenden Zeitstreuungen wurden mit dem LMS-Verfahren ausgeglichen. Die MTM-Normleistungszeiten wurden mit Hilfe statistischer Verfahren wie der Regressionsrechnung verarbeitet, um die Messwertstreuungen auszugleichen und funktionale Zusammenhänge zwischen den Einflussgrößen und der Zeit herzustellen. Das Ergebnis dieser Entwicklungen bildet die MTM- Normzeitwertkarte.
9
10 Die zur Zeit gültige Ausgabe der Zeitwertkarte des MTM-Grundsystems ist die MTM- Data-Card 101 A, Ausgabe 1955, der U.S.- und Canada MTM-Association. Auf dieser Karte basieren die vom internationalen Direktorat anerkannten nationalen Karten. Dadurch ist auf internationaler Ebene eine Übereinstimmung der Daten gegeben. Lediglich die Zollmaße sind für verschiedene nationale Vereinigungen in das metrische System übertragen worden. (Deutsche MTM-Vereinigung e.v., Lehrgangsunterlagen zu MTM-1). Die Analyse von manuellen Arbeitsprozessen mit MTM erfolgt heute in der Regel rechnergestützt, z. B. mit Hilfe von TiCon-Base (
11 Untersuchungen haben gezeigt, dass die aufgeführten fünf Grundbewegungen in der Praxis mit Abstand am häufigsten vorkommen. Sie werden auch als Grundbewegungszyklus bezeichnet, da sie in der Regel in der dargestellten Reihenfolge auftreten.
12 Die Grundbewegungen können nach der Schwierigkeit ihres Erlernens unterteilt werden: So werden einfache Bewegungen wie Hinlangen und Bringen nahezu sofort beherrscht; ihre Ausführung kann durch Übung kaum verbessert werden. Dagegen sind Bewegungen wie Greifen und Fügen als schwierig i einzustufen; ihre Ausführung kann durch Übung verbessert werden, so dass ihre Ausführungsdauer mit der Anzahl der Wiederholungen sinkt. Belegt wird dies durch Studien von Rohmert & Schlaich (1967) und von Rohmert & Kirchner (1969).
13 Charakteristisch für das Drücken und Trennen ist die ansteigende kontrollierte muskuläre Kraft, die auf einen Gegenstand wirkt, ohne dass dabei eine nennenswerte Bewegung auftritt. Drehen ist die Grundbewegung, die ausgeführt wird, wenn die leere oder belastete t Hand um die Längsachse des Unterarms bewegt wird. id
14 Blickverschieben ist die Bewegung der Augen, die ausgeführt wird, um den Blick von einer Stelle auf eine andere Stelle zu lenken. Beeinflusst wird das Blickverschieben vom Abstand zwischen den Blickpunkten und dem Abstand der Augen von der Verbindungslinie der Blickpunkte. Ein Blickverschieben wird nur dann analysiert, wenn es als selbstständige Grundbewegung auftritt, d. h. die Augen müssen ihre Aufgabe erfüllt haben, bevor die nächste Grundbewegung ausgeführt werden kann. Prüfen ist die Augentätigkeit, um an einem Gegenstand innerhalb des normalen Blickfeldes (kreisförmige Fläche mit einem Durchmesser von 10 cm, die sich in 40 cm Entfernung von den Augen befindet) leicht zu unterscheidende Merkmale festzustellen. Beim Prüfen kann zwischen Kontroll- und Prüfmerkmalen unterschieden werden. Kontrollmerkmale sind solche Merkmale, die lediglich auf ihr Vorhandensein zu prüfen sind (z. B. Bohrung vorhanden?). Prüfmerkmale sind qualitativ zu beurteilen (z. B. Gießharz sauber vergossen?).
15
16 Die Zeit für das Hinlangen wird von der Ausprägung der drei Einflussgrößen (Bewegungslänge, Bewegungsfall, Typ des Bewegungsverlauf) bestimmt. Die Bewegungslänge ist der tatsächlich zurückgelegte Weg im Raum. Der Bewegungsfall ist abhängig vom erforderlichen Kontrollgrad einer Bewegung. In den Fällen A und E ist der Kontrollgrad gering, im Fall B mäßig, und in den Fällen C und D hoch. Beim Hinlangen können drei Typen des Bewegungsverlaufs auftreten. In den meisten Fällen beginnt und endet die Hand in der Ruhelage. Die normale Hinlang-Bewegung weist daher eine Beschleunigung- und Verzögerungsphase auf (Typ I). Typ II liegt vor, wenn die Beschleunigungs- oder Ver- zögerungsphase fehlt (z. B. Hinlangen zu einem Maschinenhebel, der ohne Bewegungsverzögerung nach dem Hinlangen bewegt wird). Typ III-Bewegungen (fehlende Beschleunigungs- und Verzögerungskomponente) kommen in der Praxis äußerst selten vor.
17
18
19 Die MTM-Normzeitwertkarte macht keine Angaben über die Streuungen des Zeitverbrauchs sowie die Wahrscheinlichkeit eines menschlichen Fehlers bei der Bewegungsplanung, -ausführung und -kontrolle.
20 Modelliert wurde hier das Aufnehmen und Fügen von Bolzen durch einen Mitarbeiter. Die Bolzen (Abmessungen 8x12 mm, vollsymmetrisch) liegen vermischt in einer Box in 40 cm Entfernung vom Mitarbeiter. Der Mitarbeiter nimmt jeweils einen Bolzen auf und steckt ihn in die vor ihm liegende Öffnung. Die passgenaue Öffnung besitzt eine enge Fügetoleranz, die Handhabung wird als einfach eingestuft. Das Loslassen des Bolzens geschieht durch Öffnen der Finger.
21 Im Beispiel sind nacheinander folgende Bewegungen dargestellt. Ziel der Arbeitsgestaltung sind allerdings Bewegungsabläufe, bei denen z. B. beide Hände gleichzeitig Bewegungen ausführen.
22 Eine kombinierte Bewegung wird ausgeführt, wenn eine Bewegung bzw. mehrere Bewegungen während einer Hauptbewegung ausgeführt werden und der Bewegungsablauf nicht gehemmt wird.
23 Bewegungen lassen sich dann gleichzeitig ausführen, wenn der Kontrollaufwand gering bis mäßig ist. Hoher Kontrollaufwand stellt dagegen so hohe Anforderungen an das Konzentrationsvermögen des Menschen, dass diese Bewegungen in der Regel nicht gleichzeitig ausgeführt werden können.
24 Auf der Vorderseite der MTM-Normzeitwertkarte ist eine Tabelle abgebildet, mit deren Hilfe entschieden werden kann, ob Grundbewegungen gleichzeitig oder nacheinander ausgeführt werden können. Dabei werden drei Schwierigkeitsgrade zur Ausführung gleichzeitiger Bewegungen unterschieden: (1) leicht, (2) mit Übung, (3) schwierig. Man kann bei simultanen Hinlangbewegungen bspw. ablesen, dass die Möglichkeit der gleichzeitigen Ausführung zwar gegeben ist, hierzu jedoch Übung notwendig ist.
25 Die beiden Abbildungen stellen die Montage zweier Bolzen dar. In der oberen Abbildung ist zu sehen, wie die Bolzen nacheinander mit einer Hand in die Vorrichtung gesteckt werden. Die untere Abbildung hingegen zeigt, wie beide Bolzen gleichzeitig - also mit zwei Händen - ebenfalls in die Vorrichtung gesteckt werden. Das Montagebeispiel zeigt, dass die Beidhandarbeit in diesem Fall eine erhebliche Zeitersparnis zur Folge hat.
26
27 Dem MTM-Grundverfahren, auch als MTM-1 und MTM-Grundsystem bezeichnet, liegt das Methodenniveau der Massenfertigung zugrunde. Da die Massenfertigung aufgrund veränderter Kundenanforderungen heute nur noch in wenigen Branchen zur Anwendung kommt, wurden in der Vergangenheit verdichtete MTM-Analysiersysteme entwickelt. Diese weisen eine deutlich höhere Analysiergeschwindigkeit auf und sind für die Serienund Einzelteilfertigung geeignet.
28 Im deutschsprachigen Raum wurden unter Federführung der Deutschen MTM- Vereinigung e. V. die folgenden MTM-Analysiersysteme entwickelt: - MTM-Standard-Daten-Basiswerte - MTM-UAS (Universelles Analysiersystem) - MTM-MEK (MTM für die Einzel- und Kleinserienfertigung). Das Analysiersystem MTM-UAS ist das Analysiersystem, welches in Deutschland den höchsten Verbreitungsgrad aufweist. Es wird unter anderem in manuellen Montagen der Automobil- und Automobilzulieferindustrie angewendet. Typische Anwendungsfelder von MTM-MEK sind die Montage in der Luftfahrtindustrie oder die Erstellung von Stanz- und Umformwerkzeugen in der Automobilindustrie. Das MTM-Grundverfahren kommt in Deutschland nur noch in sehr wenigen Unternehmen zur Anwendung.
29 Die Entwicklung verdichteter Analysiersysteme erfolgt ausgehend vom MTM- Grundsystem über eine Höher- oder Querverdichtung der Daten. Bei der Höherverdichtung werden Daten nach dem Prinzip der Strukturstückliste modular zusammengefasst. Die Datenzusammenfassung erfolgt entweder additiv oder statistisch. Bei der Querverdichtung werden Einflussgrößen bzw. deren Ausprägungen jeweils auf einer bestimmten Datenebene reduziert. Die Grundbewegung Loslassen wird der Bewegungsfolge Aufnehmen zugeordnet, um ein mehrfaches Platzieren bspw. das Stempeln von Karten mit Drücken der Matrize auf das Stempelkissen nach jedem Stempelvorgang zu ermöglichen. Ein Loslassen des Stempels erfolgt genau ein Mal, nämlich nachdem sämtliche Stempelvorgänge ausgeführt wurden.
30 Zum Löten einer Platine wird mit der linken Hand das Lötzinn gegriffen und mit der rechten Hand der Lötkolben aus einer Vorrichtung gegriffen. Mit dem Lötkolben wird an der Lötstelle das Zinn erhitzt, bis dieses flüssig ist, und die zu verbindenden Bauteile mit dem Lot fixiert. Anschließend werden der Lötkolben und das Zinn abgelegt. Der Vergleich der Analyse des Lötvorgangs mit dem MTM-Grundverfahren und mit MTM- UAS zeigt, dass derselbe Arbeitsprozess mit dem MTM-Grundverfahren mit 14 Grundbewegungen und mit MTM-UAS mit nur vier Grundvorgängen beschrieben wird. UAS fasst die Bewegungen Hinlangen, Greifen, Bringen und Fügen des Lötzinns zu dem Grundvorgang Aufnehmen und Platzieren (AC2) zusammen. Das Hinlangen, Greifen, Bringen, Fügen und Loslassen des Lötkolbens wird zu dem Grundvorgang Hilfsmittel handhaben (HC2) verdichtet. Das Ablegen des Zinns auf dem Tisch wird durch das Platzieren (PA2) in einer ungefähren Lage ausgedrückt. Weiterhin verzichtet UAS auf eine Differenzierung zwischen parallel und sequentiell ablaufenden Bewegungen der linken und der rechten Hand. Trotz der Verdichtung der Modellierung divergiert die Gesamtzeit in diesem Beispiel nur um 6,5 %.
31 Die mit der Weiterentwicklung der Analysiersysteme verbundene Verdichtung von Daten führt zu einer verringerten Anzahl an Systembausteinen, die zur Beschreibung einer Arbeitsaufgabe benötigt wird. Am Beispiel der Teilmontage eines Vergasers wir deutlich, dass im Grundsystem (MTM-1) gegenüber dem Universellen Analysiersystem (MTM- UAS) mehr als die fünffache Anzahl an Bausteinen zur Beschreibung der gleichen Aufgabe notwendig ist. Die geringere Anzahl notwendiger Bausteine in MTM-UAS führt zu einem geringeren Zeitaufwand bei der Durchführung der Analyse. Dieser Vorteil wird jedoch nur durch eine geringere Genauigkeit der Analyse erreicht; insbesondere geht diese mit einem geringeren Methodenniveau einher die Tätigkeit wird also weniger detailliert beschrieben. Dies zeigt sich an den unterschiedlichen analysierten Ausführungsdauern: Für MTM-UAS ist die analysierte Zeit aufgrund der geringeren Detaillierung üblicherweise höher als im Grundsystem.
32
33
Aufgrund der Differenzen zwischen Ist- und Soll-Zeiten gilt es, die Ursachen zu klären und ggf. abzustellen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren zur
 Aufgrund der Differenzen zwischen Ist- und Soll-Zeiten gilt es, die Ursachen zu klären und ggf. abzustellen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren zur Zeitdatenermittlung. Experimentelle Verfahren dienen
Aufgrund der Differenzen zwischen Ist- und Soll-Zeiten gilt es, die Ursachen zu klären und ggf. abzustellen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren zur Zeitdatenermittlung. Experimentelle Verfahren dienen
Zur Ermittlung von Zeitdaten wurde eine Reihe von Methoden entwickelt, die sich nach unterschiedlichen Kriterien systematisieren lassen.
 Zur Ermittlung von Zeitdaten wurde eine Reihe von Methoden entwickelt, die sich nach unterschiedlichen Kriterien systematisieren lassen. Wird von einigen Sonderformen der Zeitdatenermittlung (z.b. Befragen,
Zur Ermittlung von Zeitdaten wurde eine Reihe von Methoden entwickelt, die sich nach unterschiedlichen Kriterien systematisieren lassen. Wird von einigen Sonderformen der Zeitdatenermittlung (z.b. Befragen,
Einführung in die Arbeitswissenschaft
 Einführung in die Arbeitswissenschaft Lehreinheit 5 Modellierung und Optimierung manueller Arbeitsprozesse mit MTM Sommersemester 2016 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher M. Schlick Lehrstuhl
Einführung in die Arbeitswissenschaft Lehreinheit 5 Modellierung und Optimierung manueller Arbeitsprozesse mit MTM Sommersemester 2016 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher M. Schlick Lehrstuhl
Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP) - Abteilung Arbeitswissenschaft- MTM. Methods Time Measurement
 MTM Methods Time Measurement Ein System vorbestimmter Zeiten Kapitel 10 S. 25 67 Gliederung Theoretische Grundlagen Vorgehen beim MTM-Verfahren Voraussetzungen und Ziele 5 Grundbewegungen Gleichzeitige/Kombinierte
MTM Methods Time Measurement Ein System vorbestimmter Zeiten Kapitel 10 S. 25 67 Gliederung Theoretische Grundlagen Vorgehen beim MTM-Verfahren Voraussetzungen und Ziele 5 Grundbewegungen Gleichzeitige/Kombinierte
Mehr Tun Müssen? 100 Jahre Produktivitätsmanagement INHALTSVERZEICHNIS
 INHALTSVERZEICHNIS TEIL I: DIE ENTWICKLUNG DES PRODUKTIVITÄTSMANAGEMENTS IN DEN LETZTEN 100 JAHREN 11 1. Mehr tun müssen? 12 2. Produktivität der Arbeit 17 2.1 Definition 18 2.2 Produktivitätskennzahlen
INHALTSVERZEICHNIS TEIL I: DIE ENTWICKLUNG DES PRODUKTIVITÄTSMANAGEMENTS IN DEN LETZTEN 100 JAHREN 11 1. Mehr tun müssen? 12 2. Produktivität der Arbeit 17 2.1 Definition 18 2.2 Produktivitätskennzahlen
AUSBILDUNGEN UND. VERANSTALTUNGEN erste Fassung Termine 2017/18
 AUSBILDUNGEN UND VERANSTALTUNGEN erste Fassung 10.01.2017 Termine 2017/18 MTM Ausbildung Praktiker I MTM Ausbildung Praktiker II MTM Instruktoren/Praktiker Seminare MTM Einführungsseminare (EIE Ausbildung)
AUSBILDUNGEN UND VERANSTALTUNGEN erste Fassung 10.01.2017 Termine 2017/18 MTM Ausbildung Praktiker I MTM Ausbildung Praktiker II MTM Instruktoren/Praktiker Seminare MTM Einführungsseminare (EIE Ausbildung)
Optimierte Anlagekonzepte für Meistereigehöfte. Karlsruher Erfahrungsaustausch Straßenbetrieb
 Fakultät Maschinenwesen, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft Optimierte Anlagekonzepte für Meistereigehöfte Karlsruher Erfahrungsaustausch Straßenbetrieb
Fakultät Maschinenwesen, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft Optimierte Anlagekonzepte für Meistereigehöfte Karlsruher Erfahrungsaustausch Straßenbetrieb
AUSBILDUNGEN UND. VERANSTALTUNGEN Erste Fassung Termine 2013/2014
 AUSBILDUNGEN UND VERANSTALTUNGEN Erste Fassung 03.2012 Termine 2013/2014 Ausbildung Praktiker I Ausbildung Praktiker II Instruktoren/Praktiker Seminare Einführungsseminare (EIE Ausbildung) ÖSTERREICHISCHE
AUSBILDUNGEN UND VERANSTALTUNGEN Erste Fassung 03.2012 Termine 2013/2014 Ausbildung Praktiker I Ausbildung Praktiker II Instruktoren/Praktiker Seminare Einführungsseminare (EIE Ausbildung) ÖSTERREICHISCHE
Arbeitswissenschaft I / Betriebsorganisation (AW I)
 Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen Arbeitswissenschaft I / Betriebsorganisation (AW I) Lehreinheit 5 Zeitwirtschaft II Wintersemester 2005/2006 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christopher
Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen Arbeitswissenschaft I / Betriebsorganisation (AW I) Lehreinheit 5 Zeitwirtschaft II Wintersemester 2005/2006 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christopher
4. Lehreinheit. Zeitwirtschaft II. 1 Einführung... 4-2. 2 Grundlagen der MTM-Methode... 4-4. 3 Fallbeispiel zur MTM-Methode...
 Arbeitswissenschaft II Sommersemester 2005 Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen 4. Lehreinheit Zeitwirtschaft II Lernziele 1 Einführung... 4-2 2 Grundlagen der MTM-Methode...
Arbeitswissenschaft II Sommersemester 2005 Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen 4. Lehreinheit Zeitwirtschaft II Lernziele 1 Einführung... 4-2 2 Grundlagen der MTM-Methode...
Methoden der Zeitwirtschaft
 Methoden der Zeitwirtschaft Von der Zeit- / Arbeitswirtschaft zum Zeit-Management - Erfolgspotenziale des modernen Zeit-Managements AWF-Seminar 22. und 23. März 2004 Erik Mesenhöller Zur Person 1996-2003
Methoden der Zeitwirtschaft Von der Zeit- / Arbeitswirtschaft zum Zeit-Management - Erfolgspotenziale des modernen Zeit-Managements AWF-Seminar 22. und 23. März 2004 Erik Mesenhöller Zur Person 1996-2003
Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) sind eine semiformale Modellierungssprache zur Erfassung und Darstellung von Geschäftsprozessen.
 Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) sind eine semiformale Modellierungssprache zur Erfassung und Darstellung von Geschäftsprozessen. Überblick: Entwickelt wurde die EPK-Methode 1992 am Institut für
Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) sind eine semiformale Modellierungssprache zur Erfassung und Darstellung von Geschäftsprozessen. Überblick: Entwickelt wurde die EPK-Methode 1992 am Institut für
Berufsbildende Schulen Osnabrück Brinkstraße
 Name: Klasse: Berufsbildende Schulen Osnabrück Brinkstraße IP-Subnetze Blatt: Datum: Hintergrund: In dieser Übung erhalten Sie grundlegende Informationen zu IP- Subnetzmasken und deren Einsatz in TCP/IP-Netzen.
Name: Klasse: Berufsbildende Schulen Osnabrück Brinkstraße IP-Subnetze Blatt: Datum: Hintergrund: In dieser Übung erhalten Sie grundlegende Informationen zu IP- Subnetzmasken und deren Einsatz in TCP/IP-Netzen.
Vorlagen für Ihre Zeitplanung
 1 Hier finden Sie einfache Methoden und Instrumente, die bei der Analyse Ihrer Arbeitsabläufe und der Identifikation von individuellen Zeitfressern hilfreich sind. 1. Pareto-Prinzip 2. ALPEN-Methode 3.
1 Hier finden Sie einfache Methoden und Instrumente, die bei der Analyse Ihrer Arbeitsabläufe und der Identifikation von individuellen Zeitfressern hilfreich sind. 1. Pareto-Prinzip 2. ALPEN-Methode 3.
Lernzeit bei Montageaufgaben Prognose und Beeinflussung
 ISSN 2196-3371 Handreichungen für die betriebliche Praxis Lernzeit bei Montageaufgaben Prognose und Beeinflussung www.flexpro.info In neuen oder umstrukturierten Montagebereichen sind die Arbeitsabläufe
ISSN 2196-3371 Handreichungen für die betriebliche Praxis Lernzeit bei Montageaufgaben Prognose und Beeinflussung www.flexpro.info In neuen oder umstrukturierten Montagebereichen sind die Arbeitsabläufe
Hybride Wertschöpfungsoptimierung Wertstromdesign und Methods-Time Measurement in Theorie und Praxis
 Hybride Wertschöpfungsoptimierung Wertstromdesign und Methods-Time Measurement in Theorie und Praxis Eine Methodenkombination zur Steigerung von Produktivität und zur Reduktion der Durchlaufzeit Autoren:
Hybride Wertschöpfungsoptimierung Wertstromdesign und Methods-Time Measurement in Theorie und Praxis Eine Methodenkombination zur Steigerung von Produktivität und zur Reduktion der Durchlaufzeit Autoren:
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen. WS 2009/2010 Kapitel 1.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Unregelmäßig geformte Scheibe Best.- Nr. MD02256
 Unregelmäßig geformte Scheibe Best.- Nr. MD02256 Momentenlehre Ziel Die unregelmäßig geformte Scheibe wurde gewählt, um den Statik-Kurs zu vervollständigen und um einige praktische Versuche durchzuführen.
Unregelmäßig geformte Scheibe Best.- Nr. MD02256 Momentenlehre Ziel Die unregelmäßig geformte Scheibe wurde gewählt, um den Statik-Kurs zu vervollständigen und um einige praktische Versuche durchzuführen.
Midas Metadata yield by Data Analysis
 Midas Metadata yield by Data Analysis Glossar powered by Was ist Text Mining? Unter Text Mining versteht sich im Allgemeinen die Extraktion von strukturierten Informationen aus unstrukturierten oder semistrukturierten
Midas Metadata yield by Data Analysis Glossar powered by Was ist Text Mining? Unter Text Mining versteht sich im Allgemeinen die Extraktion von strukturierten Informationen aus unstrukturierten oder semistrukturierten
Cox-Regression. Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells
 Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Physik GK ph1, 2. KA Kreisbew., Schwingungen und Wellen Lösung
 Aufgabe 1: Kreisbewegung Einige Spielplätze haben sogenannte Drehscheiben: Kreisförmige Plattformen, die in Rotation versetzt werden können. Wir betrachten eine Drehplattform mit einem Radius von r 0 =m,
Aufgabe 1: Kreisbewegung Einige Spielplätze haben sogenannte Drehscheiben: Kreisförmige Plattformen, die in Rotation versetzt werden können. Wir betrachten eine Drehplattform mit einem Radius von r 0 =m,
Optimalcodierung. Thema: Optimalcodierung. Ziele
 Optimalcodierung Ziele Diese rechnerischen und experimentellen Übungen dienen der Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der Optimalcodierung, mit der die Zeichen diskreter Quellen codiert werden können.
Optimalcodierung Ziele Diese rechnerischen und experimentellen Übungen dienen der Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der Optimalcodierung, mit der die Zeichen diskreter Quellen codiert werden können.
Aktiv wirkender Hilfsrahmen. Beschreibung PGRT
 Beschreibung Beschreibung Ein aktiv wirkender Hilfsrahmen ist eine Konstruktion, deren Verankerung dazu führt, dass die vorhandenen Rahmen wie ein Fahrgestellrahmen statt wie zwei getrennte Rahmen zusammenwirken.
Beschreibung Beschreibung Ein aktiv wirkender Hilfsrahmen ist eine Konstruktion, deren Verankerung dazu führt, dass die vorhandenen Rahmen wie ein Fahrgestellrahmen statt wie zwei getrennte Rahmen zusammenwirken.
Multimomentaufnahme. Fachhochschule Köln Campus Gummersbach Arbeitsorganisation Dr. Kopp. Multimomentaufnahme. Arbeitsorganisation
 1 Gliederung der Präsentation - Definition - Zeitstudien Einordnung - Prinzip und Verfahrensformen - Genereller Ablauf - Planung von MM-Studien 2 Definition multum momentum viel Augenblick Die besteht
1 Gliederung der Präsentation - Definition - Zeitstudien Einordnung - Prinzip und Verfahrensformen - Genereller Ablauf - Planung von MM-Studien 2 Definition multum momentum viel Augenblick Die besteht
Lötworkshopskript. Der FM-Transmitter. Angeboten von Fachschaft Elektrotechnik Skript von Viktor Weinelt und Alexandru Trifan
 Lötworkshopskript Der FM-Transmitter Angeboten von Fachschaft Elektrotechnik Skript von Viktor Weinelt und Alexandru Trifan 1. Was wird gebaut? In diesem Lötkurs wird Schritt für Schritt erklärt, wie ihr
Lötworkshopskript Der FM-Transmitter Angeboten von Fachschaft Elektrotechnik Skript von Viktor Weinelt und Alexandru Trifan 1. Was wird gebaut? In diesem Lötkurs wird Schritt für Schritt erklärt, wie ihr
Warum manche AOI-Bediener ruhiger schlafen
 Warum manche AOI-Bediener ruhiger schlafen Über die Vorteile einer Referenzdatenbank in der AOI-Software Eine bekannte Situation Jeder Bediener von Automatischen Optischen Inspektionssystemen kennt diese
Warum manche AOI-Bediener ruhiger schlafen Über die Vorteile einer Referenzdatenbank in der AOI-Software Eine bekannte Situation Jeder Bediener von Automatischen Optischen Inspektionssystemen kennt diese
HANDGERÄT KEULE - GRUNDBEWEGUNGEN
 HANDGERÄT KEULE - GRUNDBEWEGUNGEN Autoren: Magdalena Gonserowski, Julia Bubach 2016 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Einführung o Gerätenormen o Allgemeine Handhabung Fünf typische Technikgruppen mit der
HANDGERÄT KEULE - GRUNDBEWEGUNGEN Autoren: Magdalena Gonserowski, Julia Bubach 2016 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Einführung o Gerätenormen o Allgemeine Handhabung Fünf typische Technikgruppen mit der
Trendlinien. Können die Messwerte mit einer linearen Funktion beschrieben werden?
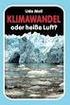 Trendlinien Können die Messwerte mit einer linearen Funktion beschrieben werden? Motorradfahrt Auf einer Versuchsanlage für Motorräder wird ein neuer Motor ausprobiert. Jede Sekunde werden die zurückgelegte
Trendlinien Können die Messwerte mit einer linearen Funktion beschrieben werden? Motorradfahrt Auf einer Versuchsanlage für Motorräder wird ein neuer Motor ausprobiert. Jede Sekunde werden die zurückgelegte
Korrekte Montage der Typen A, B und BR. Berechnungsbeispiel der Schraubenlängen. mit den Typen A und B in M20. Nockenhöhen 90º 90º <_ 5º >90º 5-8º
 Kreuzverbindung Trägerklemmverbindungen 1 Bestandteile einer Kreuzverbindung 1. Mutter Nach DIN 934 (ISO 4032). Festigkeitsklasse 8. 2. Unterlegscheibe Nach DIN 125 (ISO 7089). 3. Lindapter Klemmen Je
Kreuzverbindung Trägerklemmverbindungen 1 Bestandteile einer Kreuzverbindung 1. Mutter Nach DIN 934 (ISO 4032). Festigkeitsklasse 8. 2. Unterlegscheibe Nach DIN 125 (ISO 7089). 3. Lindapter Klemmen Je
Lötanleitung LED Kerze
 Lötanleitung LED Kerze Autor: Cornelius Franz Bezugsadress: www.du-kannst-mitspielen.de Die LED Kerze stellt eine brennende Flamme auf zwei LED Matrizen mit insgesamt 288 LEDs dar. Die Farbe der LEDs kann
Lötanleitung LED Kerze Autor: Cornelius Franz Bezugsadress: www.du-kannst-mitspielen.de Die LED Kerze stellt eine brennende Flamme auf zwei LED Matrizen mit insgesamt 288 LEDs dar. Die Farbe der LEDs kann
Schritt für Schritt - Bauanleitung
 Sideboard Light Pyramide Schritt für Schritt - Bauanleitung www.copyclaim.com/40d07772-802a-800d-428a-3833217e418c Die Leuchten aus der Reihe Sideboard Lights bestehen aus zwei getrennten Teilen, der Leuchte
Sideboard Light Pyramide Schritt für Schritt - Bauanleitung www.copyclaim.com/40d07772-802a-800d-428a-3833217e418c Die Leuchten aus der Reihe Sideboard Lights bestehen aus zwei getrennten Teilen, der Leuchte
Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres
 Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres Historisches und Grundlagen: Generell wird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Fernrohren unterschieden. Auf der einen Seite gibt es das
Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres Historisches und Grundlagen: Generell wird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Fernrohren unterschieden. Auf der einen Seite gibt es das
Resümee und Ausblick: Entwicklungen der Prozesssprache MTM
 Resümee und Ausblick: Entwicklungen der Prozesssprache MTM Peter Kuhlang, Thomas Finsterbusch, Thomas Weber Abstract Die in jüngster Zeit entstandenen MTM 92 Prozessbausteine mit immanenter Modellbildung
Resümee und Ausblick: Entwicklungen der Prozesssprache MTM Peter Kuhlang, Thomas Finsterbusch, Thomas Weber Abstract Die in jüngster Zeit entstandenen MTM 92 Prozessbausteine mit immanenter Modellbildung
7 Einteilung der Vergleiche
 62 7 Einteilung der Vergleiche Man kann Vergleiche vergleichen, um Gleichheit und Ungleichheit der Vergleiche zu erkennen. Gleichheit der Vergleiche besteht in Hinsicht auf die Eigenschaften, die in der
62 7 Einteilung der Vergleiche Man kann Vergleiche vergleichen, um Gleichheit und Ungleichheit der Vergleiche zu erkennen. Gleichheit der Vergleiche besteht in Hinsicht auf die Eigenschaften, die in der
Technische Skizzen von einfachen Gegenständen aus dem Bereich der Technik lesen und anfertigen
 Bausteinbeschreibung M7.1 [M. Oppel R. Haberberger] 1. Bezeichnung Technik/TZ 2. Zeitlicher Umfang 8 Unterrichtsstunden Technische Skizzen von einfachen Gegenständen aus dem Bereich der Technik lesen und
Bausteinbeschreibung M7.1 [M. Oppel R. Haberberger] 1. Bezeichnung Technik/TZ 2. Zeitlicher Umfang 8 Unterrichtsstunden Technische Skizzen von einfachen Gegenständen aus dem Bereich der Technik lesen und
Welche Axiome sind Grundlage der axiomatischen Wahrscheinlichkeitsdefinition von Kolmogoroff?
 2. Übung: Wahrscheinlichkeitsrechnung Aufgabe 1 Welche Axiome sind Grundlage der axiomatischen Wahrscheinlichkeitsdefinition von Kolmogoroff? a) P ist nichtnegativ. b) P ist additiv. c) P ist multiplikativ.
2. Übung: Wahrscheinlichkeitsrechnung Aufgabe 1 Welche Axiome sind Grundlage der axiomatischen Wahrscheinlichkeitsdefinition von Kolmogoroff? a) P ist nichtnegativ. b) P ist additiv. c) P ist multiplikativ.
Algorithmen und Datenstrukturen 2
 Algorithmen und Datenstrukturen 2 Sommersemester 2007 11. Vorlesung Peter F. Stadler Universität Leipzig Institut für Informatik studla@bioinf.uni-leipzig.de Das Rucksack-Problem Ein Dieb, der einen Safe
Algorithmen und Datenstrukturen 2 Sommersemester 2007 11. Vorlesung Peter F. Stadler Universität Leipzig Institut für Informatik studla@bioinf.uni-leipzig.de Das Rucksack-Problem Ein Dieb, der einen Safe
Wahrscheinlichkeitsverteilungen
 Universität Bielefeld 3. Mai 2005 Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Das Ziehen einer Stichprobe ist die Realisierung eines Zufallsexperimentes. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet
Universität Bielefeld 3. Mai 2005 Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Das Ziehen einer Stichprobe ist die Realisierung eines Zufallsexperimentes. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet
Algorithmen und Datenstrukturen 2
 Algorithmen und Datenstrukturen 2 Sommersemester 2009 11. Vorlesung Uwe Quasthoff Universität Leipzig Institut für Informatik quasthoff@informatik.uni-leipzig.de Das Rucksack-Problem Ein Dieb, der einen
Algorithmen und Datenstrukturen 2 Sommersemester 2009 11. Vorlesung Uwe Quasthoff Universität Leipzig Institut für Informatik quasthoff@informatik.uni-leipzig.de Das Rucksack-Problem Ein Dieb, der einen
Hörzeichen: Platz", Bleib" - Sitz", Steh", Platz" und/oder Sichtzeichen
 Distanzkontrolle Das Ziel dieser Übung ist, dass der Hund aus einer Entfernung von 20 Schritten auf Kommando zwischen den Positionen sitz - platz- steh wechselt; die erste und letzte Position ist immer
Distanzkontrolle Das Ziel dieser Übung ist, dass der Hund aus einer Entfernung von 20 Schritten auf Kommando zwischen den Positionen sitz - platz- steh wechselt; die erste und letzte Position ist immer
LÖTEN. Vortrag von Dennis Jozefoski.
 LÖTEN Vortrag von Dennis Jozefoski http://www.sbz-monteur.de/wp-content/gallery/loeti/erkl%c3%a4r%20mal%20l%c3%b6ten.png Inhaltsangabe Definition Arbeitsmaterialien Lötverfahren Tipps zum richtigen Löten
LÖTEN Vortrag von Dennis Jozefoski http://www.sbz-monteur.de/wp-content/gallery/loeti/erkl%c3%a4r%20mal%20l%c3%b6ten.png Inhaltsangabe Definition Arbeitsmaterialien Lötverfahren Tipps zum richtigen Löten
Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine
 Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine Fabian Schmid-Michels Nils Brüdigam Universität Bielefeld Wintersemester 2006/2007 Grundpraktikum I 11.01.2007 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 2 Theorie 2 3
Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine Fabian Schmid-Michels Nils Brüdigam Universität Bielefeld Wintersemester 2006/2007 Grundpraktikum I 11.01.2007 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 2 Theorie 2 3
Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine e.v. Sportverband für das Polizei- und Schutzhundwesen Mitglied im VDH und der FCI
 NeuePrüfungsordnung Obedience zum01.01.2016 Information zur neuen PO Die Neu Übung 1. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Verhalten gegenüber anderen Hunden Stehen und Betasten 2 Minuten Liegen in einer Gruppe,
NeuePrüfungsordnung Obedience zum01.01.2016 Information zur neuen PO Die Neu Übung 1. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Verhalten gegenüber anderen Hunden Stehen und Betasten 2 Minuten Liegen in einer Gruppe,
Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung
 Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung von Wolfgang Laurig Die Begriffe "Belastung" und "Beanspruchung" Eine erste Verwendung der beiden Worte Belastung" und Beanspruchung" mit Hinweisen
Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung von Wolfgang Laurig Die Begriffe "Belastung" und "Beanspruchung" Eine erste Verwendung der beiden Worte Belastung" und Beanspruchung" mit Hinweisen
Wassermelder HMS100 WD. Bedienungsanleitung. ELV AG PF 1000 D Leer Telefon 0491/ Telefax 0491/
 Wassermelder HMS100 WD Bedienungsanleitung ELV AG PF 1000 D-26787 Leer Telefon 0491/6008-88 Telefax 0491/6008-244 1 1. Allgemeines Der Wassermelder registriert über in das Gehäuse integrierte Fühler das
Wassermelder HMS100 WD Bedienungsanleitung ELV AG PF 1000 D-26787 Leer Telefon 0491/6008-88 Telefax 0491/6008-244 1 1. Allgemeines Der Wassermelder registriert über in das Gehäuse integrierte Fühler das
Diese Arbeiten werden dann entsprechend der in der Planung festgelegten Reihenfolge
 Einführung Sattelschlepper In den Projektunterlagen befindet sich hierzu die Vorlage eines Arbeitsplanungsbogens. In dieses Formblatt (evt. kopieren für verschiedene Lösungswege) werden die geplanten Arbeitsschritte,
Einführung Sattelschlepper In den Projektunterlagen befindet sich hierzu die Vorlage eines Arbeitsplanungsbogens. In dieses Formblatt (evt. kopieren für verschiedene Lösungswege) werden die geplanten Arbeitsschritte,
Download. Ähnlichkeit Strahlensätze an Stationen. Übungsmaterial zu den Bildungsstandards. Marco Bettner, Erik Dinges
 Download Marco Bettner, Erik Dinges Ähnlichkeit Strahlensätze an Stationen Übungsmaterial zu den Bildungsstandards Downloadauszug aus dem Originaltitel: Ähnlichkeit und Strahlensätze an Stationen Übungsmaterial
Download Marco Bettner, Erik Dinges Ähnlichkeit Strahlensätze an Stationen Übungsmaterial zu den Bildungsstandards Downloadauszug aus dem Originaltitel: Ähnlichkeit und Strahlensätze an Stationen Übungsmaterial
Logo. Zukunftsanalyse: Szenario - Technik (Einleitung)
 Zukunftsanalyse: Szenario - Technik (Einleitung) Anwendungsbereiche: _Vorbereitung von Entscheidungen _Orientierung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen _Strategieentwicklung und -überprüfung _Projekt
Zukunftsanalyse: Szenario - Technik (Einleitung) Anwendungsbereiche: _Vorbereitung von Entscheidungen _Orientierung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen _Strategieentwicklung und -überprüfung _Projekt
Physik 4, Übung 4, Prof. Förster
 Physik 4, Übung 4, Prof. Förster Christoph Hansen Emailkontakt Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls
Physik 4, Übung 4, Prof. Förster Christoph Hansen Emailkontakt Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls
Tabelle 1.5: Relative Wichtigkeit von Ausprägungen.
 4 1 Einleitung nichtern wichtig sind. Zu diesem Zweck werden die Differenzen zwischen der bevorzugten Ausprägung eines Merkmals, also die mit dem höchsten Teilnutzenwert, und der Ausprägung mit dem geringsten
4 1 Einleitung nichtern wichtig sind. Zu diesem Zweck werden die Differenzen zwischen der bevorzugten Ausprägung eines Merkmals, also die mit dem höchsten Teilnutzenwert, und der Ausprägung mit dem geringsten
1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte. D. Horstmann: Oktober
 1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte D. Horstmann: Oktober 2014 4 Graphische Darstellung von Daten und unterschiedliche Mittelwerte Eine Umfrage nach der Körpergröße
1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte D. Horstmann: Oktober 2014 4 Graphische Darstellung von Daten und unterschiedliche Mittelwerte Eine Umfrage nach der Körpergröße
Aufgaben zum Thema Verklemmungen
 Aufgaben zum Thema Verklemmungen V1. Untersuchen Sie das folgende Prozeßsystem auf das Auftreten von Deadlocks (s1, s2, s3: binäre Semaphore, mit true initialisiert): 95/5 Prozeß 1 Prozeß 2 Prozeß 3 P(s1);
Aufgaben zum Thema Verklemmungen V1. Untersuchen Sie das folgende Prozeßsystem auf das Auftreten von Deadlocks (s1, s2, s3: binäre Semaphore, mit true initialisiert): 95/5 Prozeß 1 Prozeß 2 Prozeß 3 P(s1);
wav.de Stand: 01/2017 Messen und Lehren
 Stand: 01/2017 Messen und Lehren Prüfen Vergleich des geforderten Soll-Zustands mit dem tatsächlichen Ist-Zustand Geschwindigkeit beim Autofahren Temperatur im Wohnraum. Man unterteilt das Prüfen in Messen
Stand: 01/2017 Messen und Lehren Prüfen Vergleich des geforderten Soll-Zustands mit dem tatsächlichen Ist-Zustand Geschwindigkeit beim Autofahren Temperatur im Wohnraum. Man unterteilt das Prüfen in Messen
Prüfungsarbeit Mathematik Gymnasium
 Prüfungsteil 1: Aufgabe 1 a) In welchem Maßstab müsste das abgebildete Modellauto vergrößert werden, damit es ungefähr so groß wäre wie das Original? Kreuze an! 1 : 10 1 : 100 1 : 1 000 1 : 10 000 b) Kann
Prüfungsteil 1: Aufgabe 1 a) In welchem Maßstab müsste das abgebildete Modellauto vergrößert werden, damit es ungefähr so groß wäre wie das Original? Kreuze an! 1 : 10 1 : 100 1 : 1 000 1 : 10 000 b) Kann
Gegeben ist die in Abbildung 1 dargestellte zentrische Schubkurbel mit den Längen a=50mm und b=200mm. Zu bestimmen sind:
 1 Aufgabenstellung Gegeben ist die in Abbildung 1 dargestellte zentrische Schubkurbel mit den Längen a=50mm und b=200mm. Zu bestimmen sind: 1. Die Geschwindigkeit υ B am Gleitsteinzapfen (Kolbenbolzen)
1 Aufgabenstellung Gegeben ist die in Abbildung 1 dargestellte zentrische Schubkurbel mit den Längen a=50mm und b=200mm. Zu bestimmen sind: 1. Die Geschwindigkeit υ B am Gleitsteinzapfen (Kolbenbolzen)
Narrow It Down - Anweisungen zum Eingrenzen
 BITTE PRÜFEN SIE, OB DIESES DOKUMENTS WIRKLICH AUSGEDRUCKT WERDEN MUSS. Narrow It Down - Anweisungen zum Eingrenzen Das Spiel spielen Narrow It Down hilft Schülern dabei, Fragen zu einer Vielzahl von Themen
BITTE PRÜFEN SIE, OB DIESES DOKUMENTS WIRKLICH AUSGEDRUCKT WERDEN MUSS. Narrow It Down - Anweisungen zum Eingrenzen Das Spiel spielen Narrow It Down hilft Schülern dabei, Fragen zu einer Vielzahl von Themen
GROBBLECHE MIT VERBESSERTEN EBENHEITSTOLERANZEN ÜBER DIE GESAMTE BLECHOBERFLÄCHE
 DIPLAN GROBBLECHE MIT VERBESSERTEN EBENHEITSTOLERANZEN ÜBER DIE GESAMTE BLECHOBERFLÄCHE Spezifikation DH-D54-B Ausgabe Oktober 2013 Grobbleche nach DIPLAN Spezifikation werden eingesetzt, wenn enge Ebenheitstoleranzen
DIPLAN GROBBLECHE MIT VERBESSERTEN EBENHEITSTOLERANZEN ÜBER DIE GESAMTE BLECHOBERFLÄCHE Spezifikation DH-D54-B Ausgabe Oktober 2013 Grobbleche nach DIPLAN Spezifikation werden eingesetzt, wenn enge Ebenheitstoleranzen
2 Kombinatorik. 56 W.Kössler, Humboldt-Universität zu Berlin
 2 Kombinatorik Aufgabenstellung: Anzahl der verschiedenen Zusammenstellungen von Objekten. Je nach Art der zusätzlichen Forderungen, ist zu unterscheiden, welche Zusammenstellungen als gleich, und welche
2 Kombinatorik Aufgabenstellung: Anzahl der verschiedenen Zusammenstellungen von Objekten. Je nach Art der zusätzlichen Forderungen, ist zu unterscheiden, welche Zusammenstellungen als gleich, und welche
DWH Automatisierung mit Data Vault 2.0
 DWH Automatisierung mit Data Vault 2.0 Andre Dörr Trevisto AG Nürnberg Schlüsselworte Architektur, DWH, Data Vault Einleitung Wenn man die Entwicklung von ETL / ELT Prozessen für eine klassische DWH Architektur
DWH Automatisierung mit Data Vault 2.0 Andre Dörr Trevisto AG Nürnberg Schlüsselworte Architektur, DWH, Data Vault Einleitung Wenn man die Entwicklung von ETL / ELT Prozessen für eine klassische DWH Architektur
HM I Tutorium 1. Lucas Kunz. 27. Oktober 2016
 HM I Tutorium 1 Lucas Kunz 27. Oktober 2016 Inhaltsverzeichnis 1 Theorie 2 1.1 Logische Verknüpfungen............................ 2 1.2 Quantoren.................................... 3 1.3 Mengen und ihre
HM I Tutorium 1 Lucas Kunz 27. Oktober 2016 Inhaltsverzeichnis 1 Theorie 2 1.1 Logische Verknüpfungen............................ 2 1.2 Quantoren.................................... 3 1.3 Mengen und ihre
Benutzerdefinierte Housekeepinglisten in SAP BW //
 Was wir vorhersagen, soll auch eintreffen! Benutzerdefinierte Housekeepinglisten in SAP BW // Stefan Rutte 1. Housekeepingliste anlegen Zum Anlegen der Housekeepingliste muss der Aufgaben-Manager mit der
Was wir vorhersagen, soll auch eintreffen! Benutzerdefinierte Housekeepinglisten in SAP BW // Stefan Rutte 1. Housekeepingliste anlegen Zum Anlegen der Housekeepingliste muss der Aufgaben-Manager mit der
3 Aufgabenstellungen. 3.1 Greiferkonstruktion
 25 3 Aufgabenstellungen Im Rahmen des Praktikums werden grundlegende Modellierungstechniken vor allem anhand der Komponenten der Baugruppe Greifer und verschiedener Antriebskomponenten erläutert. Darüber
25 3 Aufgabenstellungen Im Rahmen des Praktikums werden grundlegende Modellierungstechniken vor allem anhand der Komponenten der Baugruppe Greifer und verschiedener Antriebskomponenten erläutert. Darüber
SACHSEN. Das Know-how REFA Grundausbildung 2.0 (kompakt - für Schüler mit Vorkenntnissen) Die Modalitäten. Der Kontakt
 Das Know-how REFA Grundausbildung 2.0 Dieses Seminar ist speziell für Schüler mit Vorkenntnissen in den Themengebieten der REFA Grundausbildung 2.0. Es ist verkürzt und baut auf den Vorkenntnissen der
Das Know-how REFA Grundausbildung 2.0 Dieses Seminar ist speziell für Schüler mit Vorkenntnissen in den Themengebieten der REFA Grundausbildung 2.0. Es ist verkürzt und baut auf den Vorkenntnissen der
Abbildung 1.4: Strecken abtragen
 1.1 Vom Geodreieck zum Axiomensystem 15 (II/4*) Von drei verschiedenen Punkten einer Geraden liegt mindestens einer zwischen den beiden anderen. Nun sind wir in der Lage, den Begriff Strecke wie folgt
1.1 Vom Geodreieck zum Axiomensystem 15 (II/4*) Von drei verschiedenen Punkten einer Geraden liegt mindestens einer zwischen den beiden anderen. Nun sind wir in der Lage, den Begriff Strecke wie folgt
Kugelgelenke und homokinetische Gelenke
 Kugelgelenke und homokinetische Gelenke Fixierung Rotation Längsachse möglich bei homokinetischer Ausführung oder mit Verdrehsicherung Grosse Kräfte übertragbar Kompakte Bauweise Geeignet für Anwendungen
Kugelgelenke und homokinetische Gelenke Fixierung Rotation Längsachse möglich bei homokinetischer Ausführung oder mit Verdrehsicherung Grosse Kräfte übertragbar Kompakte Bauweise Geeignet für Anwendungen
Benutzerhandbuch für die Extension: Serienbriefbedingungen. Version 1.0.0
 Benutzerhandbuch für die Extension: Serienbriefbedingungen Version 1.0.0 Autor: Jörg Schmidt Stand: 18.01.2010 Erstellt im Rahmen des Extensionwettbewerbs (2009) des: Inhalt: 1 Installation...3 2 Die Bedienung
Benutzerhandbuch für die Extension: Serienbriefbedingungen Version 1.0.0 Autor: Jörg Schmidt Stand: 18.01.2010 Erstellt im Rahmen des Extensionwettbewerbs (2009) des: Inhalt: 1 Installation...3 2 Die Bedienung
Mathematik B-Tag Freitag, 20. November, 8:00 15:00 Uhr. Um die Ecke. Mathematik B-Tag Seite 1 von 9 -
 Mathematik B-Tag 2015 Freitag, 20. November, 8:00 15:00 Uhr Um die Ecke Mathematik B-Tag 2015 - Seite 1 von 9 - Erkundung 1 (Klavier) Ein Klavier soll durch einen 1 m breiten Gang um die Ecke (rechter
Mathematik B-Tag 2015 Freitag, 20. November, 8:00 15:00 Uhr Um die Ecke Mathematik B-Tag 2015 - Seite 1 von 9 - Erkundung 1 (Klavier) Ein Klavier soll durch einen 1 m breiten Gang um die Ecke (rechter
Zusammenfassung Stochastik
 Zusammenfassung Stochastik Die relative Häufigkeit Ein Experiment, dessen Ausgang nicht vorhersagbar ist, heißt Zufallsexperiment (ZE). Ein Würfel wird 40-mal geworfen, mit folgendem Ergebnis Augenzahl
Zusammenfassung Stochastik Die relative Häufigkeit Ein Experiment, dessen Ausgang nicht vorhersagbar ist, heißt Zufallsexperiment (ZE). Ein Würfel wird 40-mal geworfen, mit folgendem Ergebnis Augenzahl
Wie ist der Druck p allgemein definiert. Wie groß ist der Luftdruck unter Normalbedingungen ungefähr? Welche Einheit hat er?
 Wie ist der Druck p allgemein definiert? Welche Einheit hat er? Wie groß ist der Luftdruck unter Normalbedingungen ungefähr? Was kann man sich anschaulich unter dem Stempeldruck in einer Flüssigkeit vorstellen?
Wie ist der Druck p allgemein definiert? Welche Einheit hat er? Wie groß ist der Luftdruck unter Normalbedingungen ungefähr? Was kann man sich anschaulich unter dem Stempeldruck in einer Flüssigkeit vorstellen?
Das Kind weist ausreichende Fertigkeiten in der Addition und Subtraktion auf, kann also in der Regel Aufgaben wie und 70-7 richtig lösen.
 Einführung Das Einmaleins wird häufig in der dritten Klasse eingeführt und entsprechend gute Kenntnisse in diesem Bereich erleichtern das Lösen vieler Aufgaben. Weiterhin wird ab der vierten Klasse das
Einführung Das Einmaleins wird häufig in der dritten Klasse eingeführt und entsprechend gute Kenntnisse in diesem Bereich erleichtern das Lösen vieler Aufgaben. Weiterhin wird ab der vierten Klasse das
Arbeitsblatt: Wie rede ich mit einem Roboter?
 Arbeitsblatt: Wie rede ich mit einem Roboter? Ausgangslage: Ein Roboter besitzt Sensoren, um seine Umgebung wahrzunehmen, und Aktoren, um seine Umgebung zu beeinflussen. Auch Menschen besitzen Sensoren
Arbeitsblatt: Wie rede ich mit einem Roboter? Ausgangslage: Ein Roboter besitzt Sensoren, um seine Umgebung wahrzunehmen, und Aktoren, um seine Umgebung zu beeinflussen. Auch Menschen besitzen Sensoren
Im allerersten Unterabschnitt wollen wir uns mit einer elementaren Struktur innerhalb der Mathematik beschäftigen: Mengen.
 Kapitel 1 - Mathematische Grundlagen Seite 1 1 - Mengen Im allerersten Unterabschnitt wollen wir uns mit einer elementaren Struktur innerhalb der Mathematik beschäftigen: Mengen. Definition 1.1 (G. Cantor.
Kapitel 1 - Mathematische Grundlagen Seite 1 1 - Mengen Im allerersten Unterabschnitt wollen wir uns mit einer elementaren Struktur innerhalb der Mathematik beschäftigen: Mengen. Definition 1.1 (G. Cantor.
Umsetzung einer Leistungsbeschreibung
 Betriebliche Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau Ausbildungsbetrieb Karl Mustermann GmbH Umsetzung einer Leistungsbeschreibung Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Gärtner/zur Gärtnerin
Betriebliche Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau Ausbildungsbetrieb Karl Mustermann GmbH Umsetzung einer Leistungsbeschreibung Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Gärtner/zur Gärtnerin
Die vorliegende Arbeit besteht aus einem Pflicht- und einem Wahlteil. Im Wahlteil sind von den vier Wahlaufgaben mindestens zwei zu bearbeiten.
 Realschulabschlussprüfung 2000 Mathematik Seite 1 Hinweise für Schülerinnen und Schüler: Die vorliegende Arbeit besteht aus einem Pflicht- und einem Wahlteil. Im Pflichtteil sind alle vier Aufgaben zu
Realschulabschlussprüfung 2000 Mathematik Seite 1 Hinweise für Schülerinnen und Schüler: Die vorliegende Arbeit besteht aus einem Pflicht- und einem Wahlteil. Im Pflichtteil sind alle vier Aufgaben zu
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
 Betrifft 1 Biomechanische Prinzipien 33 DR. MARTIN HILLEBRECHT Das biomechanische Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges 1 BIOMECHANISCHE PRINZIPIEN HOCHMUTH nennt bei der Aufzählung der Aufgaben der
Betrifft 1 Biomechanische Prinzipien 33 DR. MARTIN HILLEBRECHT Das biomechanische Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges 1 BIOMECHANISCHE PRINZIPIEN HOCHMUTH nennt bei der Aufzählung der Aufgaben der
HYPERTONIE ASSESSMENT TOOL (HAT)
 HYPERTONIE ASSESSMENT TOOL (HAT) Authors: Fehlings, D., Switzer, L., Jethwa, A., Mink, J., Macarthur, C., Knights, S., & Fehlings, T. Deutsche Übersetzung: Victoria Frontzek-Weps & Petra Marsico, 2014
HYPERTONIE ASSESSMENT TOOL (HAT) Authors: Fehlings, D., Switzer, L., Jethwa, A., Mink, J., Macarthur, C., Knights, S., & Fehlings, T. Deutsche Übersetzung: Victoria Frontzek-Weps & Petra Marsico, 2014
Kompetenzen Natur und Technik Check S2/S3
 Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen Natur und Technik Check S2/S3 Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse dargestellt?
Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen Natur und Technik Check S2/S3 Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse dargestellt?
Kombinatorik. 1. Permutationen 2. Variationen 3. Kombinationen. ad 1) Permutationen. a) Permutationen von n verschiedenen Elementen
 Kombinatorik Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zusammengesetzten Ereignisses ist oft erforderlich, zwei verschiedene Anzahlen zu berechnen: die Anzahl aller Elementarereignisse und die Anzahl
Kombinatorik Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zusammengesetzten Ereignisses ist oft erforderlich, zwei verschiedene Anzahlen zu berechnen: die Anzahl aller Elementarereignisse und die Anzahl
Lötanleitung Mit dieser Anleitung erhalten Sie eine Einführung, wie Sie die bestimmten Komponenten richtig löten.
 Lötanleitung Mit dieser Anleitung erhalten Sie eine Einführung, wie Sie die bestimmten Komponenten richtig löten. Ausrüstung Sie benötigen folgende Ausrüstung: - Lötkolben Basislötkolben Regulierbarer
Lötanleitung Mit dieser Anleitung erhalten Sie eine Einführung, wie Sie die bestimmten Komponenten richtig löten. Ausrüstung Sie benötigen folgende Ausrüstung: - Lötkolben Basislötkolben Regulierbarer
Wie
 drag to move object Was Das Pattern drag to move object bietet die Möglichkeit, ein UI-Element in einer Touch- Bedienoberfläche zu verschieben. Wie Aktion des Benutzers Der Benutzer berührt das UI-Element
drag to move object Was Das Pattern drag to move object bietet die Möglichkeit, ein UI-Element in einer Touch- Bedienoberfläche zu verschieben. Wie Aktion des Benutzers Der Benutzer berührt das UI-Element
Diplomprüfung für Vermessungsingenieure Herbsttrimester 2009 Fach: Geoinformationssysteme
 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reinhardt Institut für Geoinformation und Landentwicklung Universität der Bundeswehr München D-85577 Neubiberg Diplomprüfung für Vermessungsingenieure Herbsttrimester 2009
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reinhardt Institut für Geoinformation und Landentwicklung Universität der Bundeswehr München D-85577 Neubiberg Diplomprüfung für Vermessungsingenieure Herbsttrimester 2009
imac Intel 27" EMC 2639 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
 imac Intel 27" EMC 2639 AirPort/Bluetooth Karte austauschen Austausch der AirPort/Bluetooth Karte am imac Intel 27" EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA de.ifixit.com Seite 1 von
imac Intel 27" EMC 2639 AirPort/Bluetooth Karte austauschen Austausch der AirPort/Bluetooth Karte am imac Intel 27" EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA de.ifixit.com Seite 1 von
Vorlesung. Prof. Janis Voigtländer Übungsleitung: Dennis Nolte. Mathematische Strukturen Sommersemester 2017
 Vorlesung Mathematische Strukturen Sommersemester 017 Prof. Janis Voigtländer Übungsleitung: Dennis Nolte Kombinatorik: Einführung Es folgt eine Einführung in die abzählende Kombinatorik. Dabei geht es
Vorlesung Mathematische Strukturen Sommersemester 017 Prof. Janis Voigtländer Übungsleitung: Dennis Nolte Kombinatorik: Einführung Es folgt eine Einführung in die abzählende Kombinatorik. Dabei geht es
1 Abdeckung Getriebe 2 Bremskolben 3 Bremshebel 4 Senkkopfschraube 3 x 12 mm
 Die Abdeckung für das Getriebe In der aktuellen Bauphase montierst du den Bremskolben und verbindest ihn mit der Bremsanlage deines RB7-Racers. AnschlieSSend bringst du die gebtriebeabdeckung an. 1 Werkzeug
Die Abdeckung für das Getriebe In der aktuellen Bauphase montierst du den Bremskolben und verbindest ihn mit der Bremsanlage deines RB7-Racers. AnschlieSSend bringst du die gebtriebeabdeckung an. 1 Werkzeug
Prüfbericht Nr. 2013-1808
 Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2013-1808
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2013-1808
Ishikawa Ursache - Wirkungsdiagramm Definition
 Ishikawa Ursache - Wirkungsdiagramm Definition by Andre Kapust - Donnerstag, Januar 01, 1970 https://www.quality.de/ishikawa-ursache-wirkungsdiagramm-definition/ Überblick Ursache-Wirkungs-Diagramm Ein
Ishikawa Ursache - Wirkungsdiagramm Definition by Andre Kapust - Donnerstag, Januar 01, 1970 https://www.quality.de/ishikawa-ursache-wirkungsdiagramm-definition/ Überblick Ursache-Wirkungs-Diagramm Ein
1. Zug und Druck in Stäben
 1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger
1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger
Bild-Erkennung & -Interpretation
 Kapitel I Bild-Erkennung & -Interpretation FH Aachen / Jülich, FB 9 Prof. Dr. rer.nat. Walter Hillen (Dig Img I) 1 Einführung Schritte zur Bilderkennung und Interpretation: Bild-Erfassung Vorverarbeitung
Kapitel I Bild-Erkennung & -Interpretation FH Aachen / Jülich, FB 9 Prof. Dr. rer.nat. Walter Hillen (Dig Img I) 1 Einführung Schritte zur Bilderkennung und Interpretation: Bild-Erfassung Vorverarbeitung
Relationen und Graphentheorie
 Seite Graphentheorie- Relationen und Graphentheorie Grundbegriffe. Relationen- und Graphentheorie gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln der Informatik, die aus der diskretenmathematik stammen. Ein Graph
Seite Graphentheorie- Relationen und Graphentheorie Grundbegriffe. Relationen- und Graphentheorie gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln der Informatik, die aus der diskretenmathematik stammen. Ein Graph
Übungen Softwaretechnik I
 Universität Stuttgart Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme Prof. Dr.-Ing. M. Weyrich Übungen Softwaretechnik I Übung 5: Objektorientierte Analyse Einführung Objektorientierung in der
Universität Stuttgart Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme Prof. Dr.-Ing. M. Weyrich Übungen Softwaretechnik I Übung 5: Objektorientierte Analyse Einführung Objektorientierung in der
3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse
 3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Bewegungen in Videos Objektbewegungen (object motion) Kameraoperationen bzw. Kamerabewegungen (camera motion) Semantische Informationen
3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Bewegungen in Videos Objektbewegungen (object motion) Kameraoperationen bzw. Kamerabewegungen (camera motion) Semantische Informationen
Prototypische Schularbeit für die 7. Klasse (Autor: Gottfried Gurtner)
 Prototypische Schularbeit für die 7. Klasse (Autor: Gottfried Gurtner) Lernstoff: Grundkompetenzen zu funktionalen Abhängigkeiten der 5. und 6. Klasse (FA1.1 FA5.6) Grundkompetenzen zur Analysis der 7.
Prototypische Schularbeit für die 7. Klasse (Autor: Gottfried Gurtner) Lernstoff: Grundkompetenzen zu funktionalen Abhängigkeiten der 5. und 6. Klasse (FA1.1 FA5.6) Grundkompetenzen zur Analysis der 7.
TU München, Fakultät für Informatik Lehrstuhl III: Datenbanksysteme Prof. Alfons Kemper, Ph.D.
 TU München, Fakultät für Informatik Lehrstuhl III: Datenbanksysteme Prof. Alfons Kemper, Ph.D. Blatt Nr. 10 Übung zur Vorlesung Grundlagen: Datenbanken im WS16/17 Harald Lang, Linnea Passing (gdb@in.tum.de)
TU München, Fakultät für Informatik Lehrstuhl III: Datenbanksysteme Prof. Alfons Kemper, Ph.D. Blatt Nr. 10 Übung zur Vorlesung Grundlagen: Datenbanken im WS16/17 Harald Lang, Linnea Passing (gdb@in.tum.de)
Anwendungsbeispiel Strahlensatz
 Anwendungsbeispiel Strahlensatz L5 Das berühmteste Beispiel der Proportionalität ist der Strahlensatz aus der Geometrie (siehe dazu auch Geometrie). Hier noch einmal die Hauptsätze des Strahlensatzes:
Anwendungsbeispiel Strahlensatz L5 Das berühmteste Beispiel der Proportionalität ist der Strahlensatz aus der Geometrie (siehe dazu auch Geometrie). Hier noch einmal die Hauptsätze des Strahlensatzes:
Taylor auf dem Jakobsweg
 Taylor auf dem Jakobsweg Fallbeispiel zur Reaktivierung der Zeitwirtschaft bei Bosch Rexroth Ein Beitrag zur Steigerung der Produktivität am Standort Deutschland Ingo Janas Aachen, den 18. September 2008
Taylor auf dem Jakobsweg Fallbeispiel zur Reaktivierung der Zeitwirtschaft bei Bosch Rexroth Ein Beitrag zur Steigerung der Produktivität am Standort Deutschland Ingo Janas Aachen, den 18. September 2008
Statistik für Betriebswirte 1 Probeklausur Universität Hamburg Wintersemester 2016/ Dezember 2016
 Statistik für Betriebswirte 1 Probeklausur Universität Hamburg Wintersemester 2016/2017 16. Dezember 2016 1 Aufgabe 1: Beschreibung univariater Daten (30 Punkte) Ein Autohändler verkauft Autos in fünf
Statistik für Betriebswirte 1 Probeklausur Universität Hamburg Wintersemester 2016/2017 16. Dezember 2016 1 Aufgabe 1: Beschreibung univariater Daten (30 Punkte) Ein Autohändler verkauft Autos in fünf
STATISTIK I Übung 04 Spannweite und IQR. 1 Kurze Wiederholung. Was sind Dispersionsparameter?
 STATISTIK I Übung 04 Spannweite und IQR 1 Kurze Wiederholung Was sind Dispersionsparameter? Die sogenannten Dispersionsparameter oder statistischen Streuungsmaße geben Auskunft darüber, wie die Werte einer
STATISTIK I Übung 04 Spannweite und IQR 1 Kurze Wiederholung Was sind Dispersionsparameter? Die sogenannten Dispersionsparameter oder statistischen Streuungsmaße geben Auskunft darüber, wie die Werte einer
2.3 Linienarten und Linienbreiten nach DIN 15 T1
 Angebots- Zeichnung Fundament- Zeichnung Zeichnung zur Erläuterung einer Ausschreibung oder zur Abgabe eines Angebotes Enthält Angaben über die Fertigung des Fundamentes für die Aufstellung der Maschine
Angebots- Zeichnung Fundament- Zeichnung Zeichnung zur Erläuterung einer Ausschreibung oder zur Abgabe eines Angebotes Enthält Angaben über die Fertigung des Fundamentes für die Aufstellung der Maschine
Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten
 Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten Wurfs Unterrichtsvorschlag, benötigtes Material und Arbeitsblätter Von der Physik aus betrachtet.. Einführendes Experiment Die Kinematik
Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten Wurfs Unterrichtsvorschlag, benötigtes Material und Arbeitsblätter Von der Physik aus betrachtet.. Einführendes Experiment Die Kinematik
