Förderprogramm Landschaftsqualitätsprojekte Aargau
|
|
|
- Catharina Kohl
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Landwirtschaft Aargau Förderprogramm Landschaftsqualitätsprojekte Aargau Version 2 vom 29. Juli 2014 Bearbeitung: DüCo GmbH, Büro für Landschaftsarchitektur, 5702 Niederlenz Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 1/35
2 Auftraggeber Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Landschaft und Gewässer ALG Sektion Natur und Landschaft Sebastian Meyer Entfelderstrasse Aarau Auftragnehmer DüCo GmbH Büro für Landschaftsarchitektur Victor Condrau, Elisabeth Dürig Dipl. Ing. Landschaftsarchitekten FH Staufbergstrasse 11 A 5702 Niederlenz 062' , info@dueco.ch GIS-Support: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Institut für Landschaft und Freiraum ILF Ko-Referent Michael Schmitt, HSR Begleitung Arbeitsgruppe Sebastian Meyer, Thomas Egloff (Abteilung Landschaft und Gewässer) Daniel Müller, Markus Peter, Louis Schneider, (Landwirtschaft Aargau) Kontaktadresse für Regionen Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Landschaft und Gewässer ALG, Sektion Natur und Landschaft Sebastian Meyer Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau Telefon , Telefon direkt , Fax sebastian.meyer@ag.ch Kontaktadresse für Gemeinden Interessierte Gemeinden wenden sich bitte direkt an ihren Regionalplanungsverband. Kontaktadresse für Landwirte Departement Finanzen und Ressourcen Landwirtschaft Aargau, Direktzahlungen & Beiträge Louis Schneider Tellistrasse 67, 5001 Aarau Telefon , Telefon direkt , Fax louis.schneider@ag.ch Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 2/35
3 Inhaltsverzeichnis 1 Ziele und Inhalte des kantonalen Förderprogrammes LQ Adressaten und Ziele des Förderprogramms Dokumente Ausgangslage Landschaft unter Druck Ausgangslage Landwirtschaftspolitik Landschaft als Teil der Lebensqualität Ziele Landschaftsqualität LQ-Projektgebiete Grundsätze Kohärenz zwischen LEP und LQ-Perimeter LQ-Regionen Prioritäten Organisation, Trägerschaft, Rollenverteilung Übersicht Organisation eines LQ-Projektes Akteure im Projekt Rolle des Bundes Rolle des Kantons Rolle der Trägerschaften Rolle der Landschaftskommission Rolle der Fachperson Landschaft Rolle des Landwirtschaftsberaters Rolle der Landwirte Partizipation, Kommunikation Vorgehen LQ-Projekte Übersicht Projektphasen in einem LQ-Projekt Projektphasen, Beteiligte, Produkte Evaluation Beitragsberechtigung und Beitragsbemessung Berechtigte Leistungen der Betriebe Nicht-beitragsberechtigte Leistungen Beiträge für bestehende und neue Landschaftselemente Berechtigte Flächen Berechtigte Landwirtschaftsbetriebe, Eintrittskriterien Beteiligungsformen für Landwirte Beitragsbemessung Kosten und Finanzierung Bund, Kanton und Trägerschaften Coaching-Beiträge BLW für die Projekterarbeitung Kosten- und Finanzierungsübersicht für LQ-Projekte Beitrags- und Restfinanzierung (Berechnungsbeispiel Gemeinde Musterwil) Checkliste für LQ-Beteiligungen Checkliste für Landwirte Checkliste für regionale Trägerschaften Checkliste für kommunale Trägerschaften, Gemeinden...34 Beilagen Bund Dokumente Kanton Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 3/35
4 Abkürzungen BDB: Biodiversitätsbeiträge BF: Betriebsfläche BFF: Biodiversitätsförderflächen BLN: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung BLW: Bundesamt für Landwirtschaft DZV: Direktzahlungsverordnung des Bundesrates Labiola: Kantonales Programm und Richtlinie für Bewirtschaftungsverträge Landwirtschaft Biodiversität Landschaft LaKo: Landschaftskommission, Arbeitsgruppe o.ä. LBV: Landwirtschaftliche Begriffsverordnung des Bundesrates LEP: Landschaftsentwicklungsprogramm LN: Landwirtschaftliche Nutzfläche LQ: Landschaftsqualität LQB: Landschaftsqualitätsbeiträge LwG: Landwirtschaftsgesetz NST: Normalstoss (entspricht der Sömmerung einer Raufutter verzehrenden Grossvieheinheit (RGVE) während 100 Tagen). ÖLN: Ökologischer Leistungsnachweis, gemäss DZV Repla: Regionalplanungsverband, Planungsregion, regionaler Gemeindeverbund o.ä. VB: Vernetzungsbeiträge Textquellen Projektbericht Pilotprojekt Limmattal, 2012 (Andreas Bosshard, Victor Condrau) LQ-Richtlinie BLW, 2013 Kantonaler Richtplan Aargau, 2012 Kap. 2.3: Landschaftsdefinition gemäss der Europäischen Landschaftskonvention des Europarates 2000; Handbuch Landschaftsqualität Kanton Zürich, H.M. Schmitt 2013 Abbildungen Falls nichts weiteres vermerkt ist, stammen alle Abbildungen von DüCo GmbH, 5702 Niederlenz. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 4/35
5 Zusammenfassung Landschaftsqualitätsbeiträge sind ein neues Instrument in der Direktzahlungsverordnung aufgrund der Agrarpolitik Im Rahmen von Landschaftsqualitätsprojekten (LQ-Projekten) sollen gezielt Leistungen von Landwirtinnen und Landwirten unterstützt und gefördert werden, mit denen sie die Qualität der Kulturlandschaft erhalten und fördern. Während bei der Biodiversität die Förderung von Arten, die Vielfalt der Lebensräume und deren Vernetzung im Vordergrund stehen, motivieren die Landschaftsqualitätsbeiträge (LQ-Beiträge) zum Erhalten, Aufwerten und Neuschaffen von landschaftlichen Qualitäten. Sie tragen dazu bei, die Vielfältigkeit der Kulturlandschaft, den regionalen Charakter und die Erholungsqualität zu erhalten und zu fördern. Die Initiative für ein LQ-Projekt kann durch verschiedene Akteure ergriffen werden; z.b. Landwirte, Gemeinden, regionale Planungsverbände (Replas) oder Vereine. Im Kanton Aargau werden LQ-Projekte auf regionaler Stufe erarbeitet. Die Perimeter orientieren sich i.d.r. an den bestehenden regionalen Landschaftsentwicklungsprogrammen LEP. Die Trägerschaft für die Erarbeitung eines regionales LQ-Projektes liegt i.d.r. bei einer regionalen Trägerschaft, z. B. Repla mit seiner Landschaftskommission oder Jurapark Aargau. Der Partizipation der betroffenen Bevölkerung und der Landwirte wird ein hoher Stellenwert zugemessen. Das regionale LQ-Projekt wird in Form eines Berichtes mit Plan durch die Trägerschaft beim Kanton eingereicht. Dieser prüft die Inhalte und ersucht den Bund um die Genehmigung. Bei positivem Bescheid kann im Folgejahr mit der Umsetzung begonnen werden. Diese erfolgt auf Gemeindestufe, i.d.r. in verschiedenen Etappen, wobei die interessierten Gemeinden spätestens innert vier Jahren nach der regionalen Projekterarbeitung mit der Umsetzung beginnen müssen. Bei Bedarf kann durch eine kommunale LaKo das regionale LQ-Projekt auf Stufe Gemeinde mit ortsspezifischen Prioritäten verfeinert und weiterentwickelt werden. Für die Finanzierung der LQ-Projekterarbeitung können die Trägerschaften basierend auf einer Projektskizze bei Bund und Kanton ein Beitragsgesuch einreichen. Der Beizug einer Fachperson Landschaft ist für die Projekterarbeitung und Beratung der Trägerschaft zwingend. Die Hauptakteure für die Realisierung der LQ-Massnahmen sind die direktzahlungsberechtigten Landwirte. Die Beteiligung erfolgt auf Freiwilligkeit und setzt einen Vertragsabschluss mit 8- jähriger Laufzeit voraus. Die Leistungen der Landwirte, z.b. die Pflege einer bestehenden landschaftsbildprägenden Allee entlang eines Wanderweges oder die Aufwertung eines Ackerbaugebietes durch farbige Hauptkulturen, werden durch LQ-Beiträge abgegolten. Die Massnahmen bzw. die jährlichen Beiträge an die Landbewirtschafterinnen und -bewirtschafter werden zu 90% durch den Bund und zu 10% durch eine Trägerschaft finanziert. Im Kanton Aargau ist vorgesehen, dass die Gemeinden als kommunale Trägerschaft den nicht von Bundesbeiträgen gedeckten Kostenanteil übernehmen. LQ-Massnahmen, welche nicht auf der Betriebsfläche, i. d. R. landwirtschaftliche Nutzfläche, stattfinden (z. B. Wald und Siedlungsgebiet), können nicht durch LQ-Beiträge unterstützt werden. Trotzdem sollen im gesamtheitlichen Kontext auch Ziele und Massnahmen formuliert werden, die über andere Instrumente umgesetzt und finanziert werden. Die Landwirte werden durch eine Fachperson beraten. Ziel ist, dass gemeinsam mit dem Landwirt qualitativ hochstehende und für den Bewirtschafter sinnvolle und fair finanzierte Massnahmen umgesetzt werden können, die auch der Allgemeinheit zugute kommen. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 5/35
6 1 Ziele und Inhalte des kantonalen Förderprogrammes LQ 1.1 Adressaten und Ziele des Förderprogramms Das vorliegende Dokument richtet sich an mögliche Trägerschaften von LQ-Projekten, Landwirte als Hauptakteure in der Umsetzung und an weitere interessierte Organisationen oder Einzelpersonen. Die kantonalen Fachstellen möchten mit diesem Förderprogramm die Trägerschaften von LQ- Projekten dabei unterstützen, vielfältige, erlebnisreiche und regionaltypische Landschaften zu erhalten, aufzuwerten und zu gestalten. Das Förderprogramm ergänzt dabei die LQ-Richtlinie des BLW (2013) für LQ-Projekte im Kanton Aargau. Es definiert die Ziele, Inhalte, Beteiligten und deren Aufgabenteilungen. Es beschreibt zudem, wie LQ-Projekte erarbeitet und finanziert werden. 1.2 Dokumente Für die Erarbeitung eines LQ-Projektes stehen zahlreiche Arbeitshilfen zur Verfügung (vgl. Zusammenstellung im Anhang). Abrufbar unter >Direktzahlungen und Beiträge > Beitragsarten > Landschaftsqualitätsbeiträge 2 Ausgangslage 2.1 Landschaft unter Druck Mit dem wirtschaftlichen Wachstum, den weiterhin zunehmenden Flächenansprüchen von Siedlung und Verkehr ist der Druck auf Kulturland, Natur und Landschaft enorm gewachsen. Zudem steht auch die Landwirtschaft zunehmend unter Druck, sei es durch die wirtschaftliche Globalisierung, den Rationalisierungsdruck, die Herausforderung einer multifunktionalen Landwirtschaft mit Landschaftsleistungen für die Allgemeinheit usw. Verschiedene Berichte und Studien wie der vom Aargauer Regierungsrat herausgegebene "Dritte Bericht nachhaltige Entwicklung im Kanton Aargau" (2012) weisen auf weiterhin zunehmende Defizite hin bei der Naturnähe und der landschaftlicher Vielfalt sowie bei der Fläche des für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehenden Kulturlands. Gleichzeitig hat in den letzten Jahren die Nachfrage nach naturnahen, vielfältigen Erholungsräumen stark zugenommen. Verschiedene repräsentative Umfragen sehen Natur und Landschaft gar als wichtigsten Standortfaktor unseres Kantons. Und gleichzeitig wird aufgrund der globalen Entwicklung die langfristige Sicherung der Ernährungsgrundlage und damit die Sicherung von unverbauten Böden immer wichtiger. Die grosse Bedeutung einer vielfältigen Natur und (Kultur-)Landschaft für unseren Kanton und der grosse Handlungsbedarf für Massnahmen zur Erhaltung und Förderung von Natur, Landschaft und Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und als Erholungsraum kommen in den verschiedensten Strategien, Konzepten und Planungsgrundlagen des Kantons sehr deutlich zum Ausdruck. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 6/35
7 Zeitungsartikel AZ Befragung der Bevölkerung 2011: Was ist ihnen am wichtigsten im Aargau? Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 7/35
8 2.2 Ausgangslage Landwirtschaftspolitik Kern der Agrarpolitik ist die Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems. Die Direktzahlungen an die Bauern werden ab 2014 gezielter auf die von der Bevölkerung gewünschten gemeinwirtschaftlichen Leistungen ausgerichtet. Damit soll die Wirksamkeit und die Effizienz des Direktzahlungssystems und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft verbessert werden. Neu sollen in diesem Zusammenhang Landschaftsqualitätsbeiträge ausbezahlt werden. Landschaftsqualitätsbeiträge werden zur Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften gewährt (Art. 74 LwG). Konzept und Aufbau des Weiterentwickelten Direktzahlungssystems, BLW Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 8/35
9 2.3 Landschaft als Teil der Lebensqualität Landschaften umfassen den gesamten Raum so wie wir ihn wahrnehmen und erleben. Sie sind dynamische Wirkungsgefüge und entwickeln sich aufgrund natürlicher Faktoren und durch die menschliche Nutzung und Gestaltung stetig weiter. Dadurch entstehen ganz unterschiedliche Landschaften, z.b. Gebirgs-, Agrar-, Wald-, Moor-, Fluss- oder Siedlungslandschaften. Bei Landschaftsqualitätsprojekten im Zusammenhang mit der DZV des Bundes liegt der Fokus auf den landwirtschaftlich genutzten Landschaften. Diese landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaften sind im Sinne der Multifunktionalität sowohl Produktionsraum von Nahrungsmitteln als auch erlebnisreicher Erholungsraum, geschichtsträchtiger Kultur- und Identifikationsraum und vielfältiger Naturraum. Schöne Landschaften erfreuen uns mit ihrer Erlebnisvielfalt, Natürlichkeit und ihrer ortstypischen Eigenheit. Es macht Freude, in ihnen zu arbeiten, zu wohnen und sich in ihnen zu erholen. Durch angepasste landwirtschaftliche Nutzung, das Pflegen und Aufwerten, aber auch Neuschaffen der landschaftlichen Qualitäten lassen sich Agrarlandschaften zu charakteristischen und identitätsstiftenden Landschaften für unsere Gesellschaft entwickeln und erhalten. LQ-Beiträge entgelten Landwirte und Landwirtinnen in diesem Anliegen. Die Qualität einer Landschaft misst sich daran, inwiefern sie diese Leistungen zu erbringen vermag. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 9/35
10 3 Ziele Landschaftsqualität Landschaftsqualitätsbeiträge Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind eine regionalisierte Direktzahlungsart und werden basierend auf regionalen Leitbildern und Landschaftszielen projektbezogen ausgerichtet. Sie ermöglichen die gezielte Pflege traditioneller Kulturlandschaften und die nachhaltige Neugestaltung von Landschaftsräumen. Sie tragen dazu bei, die regionalspezifischen Ansprüche der Bevölkerung an ihre Umgebung zu erfüllen und somit die landschaftliche Vielfalt der Schweiz zu erhalten. Im Zentrum stehen einerseits die Erhaltung wertvoller traditioneller Kulturlandschaften oder Reste davon und andererseits die Aufwertung bzw. Neugestaltung landschaftlich meist unattraktiver Agglomerationslandschaften. Ziele und Nutzen für die Landwirtschaft Für die Landwirtschaft bietet sich die Chance für einen neuen Erwerbszweig. Nebst Nahrungsmittelproduktion und Ökologie sollen neu auch Leistungen für attraktive, naturverträgliche Erholungslandschaften fair abgegolten werden können. Ziele und Nutzen für die Bevölkerung Die Landschaftsqualitätsziele bestimmen die Entwicklungsrichtung einer Landschaft hinsichtlich einer hohen Qualität bezüglich Landschaftsästhetik, Identität, Erlebniswert, Erholung und ganzheitliche Gesundheitsförderung für die Bevölkerung. Ziele und Nutzen für die Gemeinde Für die Gemeinden tragen attraktive Landschaften viel zu Wettbewerbsvorteilen bezüglich Standortmarketing bei. Diverse Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der Wahl einer Gemeinde als neuen Wohnort nicht allein finanzielle Aspekt (z. B. Steuerfuss) ausschlaggebend sind, sondern ebenso die Lebensqualität, Erholungsattraktivität und ein attraktives Landschaftsbild. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 10/35
11 4 LQ-Projektgebiete 4.1 Grundsätze Ein LQ-Projektgebiet umfasst landwirtschaftlich genutzte und andere Flächen wie Wald, Siedlungsfläche, etc. Die Gebietsgrösse muss im Minimum 10 km 2 betragen und darf maximal 500 km 2 nicht überschreiten. Die betroffenen Gemeinden sind mit dem gesamten Gemeindebann in das Projektgebiet einzubeziehen. Die LQ-Beiträge gemäss DZV können aber nur für Massnahmen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ausbezahlt werden. Grundsätzlich steht es allen Regionen frei, sich beim Kanton für die Erarbeitung eines regionalen LQ-Projektes zu bewerben. 4.2 Kohärenz zwischen LEP und LQ-Perimeter In den Jahren 2000 bis 2005 erarbeitete der Kanton Aargau zusammen mit den jeweiligen Regionalplanungsverbänden regionale Landschaftsentwicklungsprogramme (LEP). Darin wurden die Entwicklungsziele mit Schwergewicht Biodiversität festgelegt, welche als konzeptionelle Grundlage für lokale Vernetzungsprojekte mit der Landwirtschaft dienen. Um kohärente Ergänzungen bezüglich Landschaftsqualität erarbeiten zu können, werden für LQ- Projekte die gleichen LEP-Perimeter bearbeitet. Zudem bieten die bestehenden regionalen Strukturen, wie regionale Planungsverbände, Landschaftskommissionen, usw. ideale Voraussetzungen für eine gut funktionierende Koordination und Zusammenarbeit. Da einzelne Gemeinden die Zugehörigkeit zur Repla gewechselt oder fusioniert haben, ist im Einzelfall die Perimeterzugehörigkeit pragmatisch anzugehen und fallweise zu entscheiden. Ein gewisser Spielraum soll gewährleistet sein. 4.3 LQ-Regionen Im Kanton Aargau werden 15 verschiedene LQ-Regionen, welche mehrheitlich den bisherigen LEP-Regionen entsprechen, ausgeschieden (vgl. Karte LQ-Regionen Kanton Aargau ). Benachbarte Regionen können auch zusammen ein LQ-Projekt erarbeiten bzw. für die Erarbeitung eng zusammenarbeiten. Bemerkungen zu einzelnen Regionen und Gemeinden: Die ehemalige LEP-Region "Lenzburg und Umgebung" fusionierte 2010 mit der Region "Seetal" und bildet heute ein sehr grosses Gebiet mit zwei sehr unterschiedlichen Landschaftstypen. Aus diesem Grund wird für Lenzburg-Seetal ein zusammenhängendes LQ-Projekt erarbeitet. Dadurch ergeben sich zahlreiche Synergien. Die Gemeinden Dürrenäsch und Leutwil gehörten in der LEP-Erarbeitung von 2002 zur Repla Seetal und wurden damals in diesem LEP mitbearbeitet. Aktuell gehören diese beiden Gemeinden zu keiner Repla. Den beiden Gemeinden wird empfohlen, sich in ein LQ-Projekt einzukaufen oder sich einer Repla anzuschliessen. Der Jurapark Aargau wird als eigene LQ-Region ausgeschieden. Die angrenzenden Repla- Regionen werden deshalb ohne die Jurapark-Gemeinden bearbeitet. Zwischen den benachbarten Replas in vergleichbaren Landschaften ist eine Zusammenarbeit und gegenseitige Abstimmung erwünscht (insbesondere auch für die Gemeinde Schwaderloch). Gemeinden, die in zwei Replas Mitglied sind, müssen sich entscheiden, in welchem LQ-Projekt sie teilnehmen werden. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 11/35
12 4.4 Prioritäten 2012 wurde im Kanton Aargau ein erstes LQ-Projekt, als eines von vier Pilotprojekten des Bundes, im Limmattal gestartet. Beteiligte Gemeinden sind: Wettingen, Würenlos, Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach, Bergdietikon. Dieses LQ-Projekt wurde umgesetzt, später evaluiert und wird nun weitergeführt. Aus finanziellen, fachlichen und organisatorischen Gründen kann der Kanton für die Ausarbeitung und etappenweise Realisierung von LQ-Projekten regionale Prioritäten setzen. Diese werden nach folgenden Hauptkriterien festgelegt: Kantonale und regionale Schwerpunkte Landschaft Synergiemöglichkeiten zwischen bestehenden Vernetzungsverträgen und neuen LQ- Massnahmen Handlungsbedarf bezüglich Vertragserneuerungen im Bereich Vernetzung, Biodiversität. Grundsätzlich sollen aber alle Landwirte die Möglichkeit haben, sich an der Umsetzung regionaler LQ-Projekte zu beteiligen, sofern die Co-Finanzierung gesichert ist. Synergiemöglichkeiten zwischen bestehenden Vernetzungsverträgen und neuen LQ- Massnahmen Stehen in einer Gemeinde mehrere Vertragserneuerungen an bezüglich Biodiversität, ist es sinnvoll, in diesen Gemeinden das regionale LQ-Projekt prioritär umzusetzen. Dadurch können sich fachliche wertvolle Synergien ergeben. Vernetzungs- und LQ-Projekte können auch unabhängig voneinander umgesetzt werden. Kantonale und regionale Schwerpunkte Landschaft Im kantonalen Richtplan und Raumentwicklungskonzept werden folgende Landschaftstypen bzw. landschaftliche Schwerpunkte unterschieden: BLN-Gebiete Dekretsgebiete Regionale Naturpärke (Jurapark Aargau) Agglomerationspärke Beitrags- und Aufwertungsgebiete Für diese Gebiete möchte sich der Kanton prioritär engagieren. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 12/35
13 Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx Seite 13 von 35
14 5 Organisation, Trägerschaft, Rollenverteilung 5.1 Übersicht Organisation eines LQ-Projektes Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx Seite 14 von 35
15 5.2 Akteure im Projekt Folgende Akteure sind in einem LQ-Projekt involviert und sollen in den jeweiligen Arbeitsphasen einbezogen werden: Kantonale Behörden: Landwirtschaft Aargau, Abteilung Landschaft und Gewässer, Abteilung Wald, Abteilung Raumentwicklung Regionale Planungsverbände REPLAS, Jurapark Aargau, Gemeindeverbände, Gemeinden, Landschaftskommissionen Landwirte: Bewirtschafter von Flächen im Projektgebiet Schlüsselakteure: Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft (ehemals Ackerbaustellenleiter), lokale Experten und Vereine/Organisationen aus den Bereichen Natur und Landschaft, Wald, Raumentwicklung, Freizeit, Erholung, Tourismus etc. Vertretungen von anderen raumwirksamen regionalen Projekten (Pärke, PRE etc.) Bevölkerung des Projektgebietes, der betroffenen Gemeinden Fachperson Landschaft: Fachplaner für Regionen, Gemeinden, Landschaftskommissionen 5.3 Rolle des Bundes Der Bund erarbeitet Richtlinien und Arbeitshilfen, basierend auf der neuen Agrarpolitik AP Er prüft und bewilligt die eingereichten regionalen LQ-Projekte des Kantons, allenfalls mit Vorgaben zur Überarbeitung, und finanziert grösstenteils die Massnahmen. 5.4 Rolle des Kantons Der Kanton übernimmt innerhalb der LQ-Projekte wichtige Aufgaben und Leistungen, welche den Prozess anleiten, begleiten und kontrollieren. Er setzt dazu die Rahmenbedingungen, stellt Arbeitshilfen sowie Planungsgrundlagen zur Verfügung, beurteilt und genehmigt die Projekte. Aufgaben und Leistungen des Kantons Erarbeitung Kantonales Förderprogramm LQ mit Rahmenbedingungen, Massnahmen- und Beitragskonzept, Arbeitshilfen Mitfinanzierung regionaler LQ-Projekte Prüfung und Bewilligung regionaler LQ-Projekte, bei Bedarf Prüfung lokaler LQ-Projektergänzungen Auskünfte an Regionen, Gemeinden, Trägerschaften Auszahlung Bundesbeiträge an Landwirte, Vertragspartner von Landwirten 5.5 Rolle der Trägerschaften Für das Erarbeiten eines LQ-Projektes ist auf regionaler Stufe eine Trägerschaft und eine dazu gehörenden LaKo zwingend. Für die Umsetzung auf kommunaler Stufe braucht es eine kommunale Trägerschaft; i.d.r. sind dies die Gemeinden. Es wird dadurch die regionale bzw. lokale Verankerung der Projekte und eine Sensibilisierung in der Bevölkerung angestrebt. Die von den Landwirten erbrachten landschaftlichen Leistungen für die Öffentlichkeit sollen auf diese Weise verstärkt wahrgenommen und der Bottom-up-Prozess gefördert werden. Es wird zwischen regionalen und kommunalen Trägerschaften unterschieden. Die regionale Trägerschaft ist für das Erarbeiten eines regionalen LQ-Projektes zuständig. Die kommunale Trägerschaft ist für deren Umsetzung auf Gemeindeebene verantwortlich. Die wichtigsten Aufgaben der Trägerschaften in Kürze: Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 15/35
16 Regionale Trägerschaft Handlungsstufe Region (LQ-Perimeter) Erarbeitung eines regionalen LQ-Projektes Mitfinanzierung regionaler LQ-Projekte Koordination, Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit auf regionaler Stufe Ansprechpartner für Gemeinden und Kanton Evtl. gemeindeübergreifende Beratungsangebote für Landwirte Berichterstattung an Kanton (Zwischen- und Schlussbericht) Erfolgskontrolle auf Stufe Region, Gesamtsicht Lokale Trägerschaft Handlungsstufe Gemeinde Umsetzung des regionalen LQ-Projektes auf Gemeindeebene Co-Finanzierung der LQ-Massnahmen Koordination, Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit auf kommunaler Stufe Ansprechpartner für Landwirte und Bevölkerung in der Gemeinde Evtl. Beratungsangebote für Landwirte auf Gemeindeebene Berichterstattung an regionale LaKo Erfolgs-Rückmeldungen aus den Gemeinden an die regionale LaKo Regionale Trägerschaften für regionale LQ-Projekte Die Trägerschaft muss über eine geeignete Rechtsform verfügen. In Frage kommen z. B. ein Regionalplanungsverband, Gemeindeverband, Verein (Z. B. Naturpark), Stiftung. Die regionale Trägerschaft muss eine breite Interessensvertretung gewährleisten (Natur und Landschaft, Erholung, Landwirtschaft, Wald, Gemeindebehörden). Der Einbezug der betroffenen Gemeinden und kantonalen Fachstellen sowie die Aufgabenteilung müssen klar geregelt sein. Aufgaben der regionalen Trägerschaften Iniziierung von LQ-Projekten (Anstoss kann auch von aussen kommen) Erarbeitung eines regionalen LQ-Projektes unter Einbezug einer Fachperson Landschaft. Federführung durch regionale Landschaftskommission Projektskizze für das regionale LQ-Projekt erarbeiten als Beitragsgesuch für Coaching- Beiträge an das BLW und den Kantonsbeitrag Gesamtkoordination im regionalen LQ-Projektgebiet Kontakte zu den Gemeinden und kantonalen Fachstellen Gemeindeübergreifende Orientierungen, Informationsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit Hilfestellungen, Beratungen von Gemeinden Berichterstattung an Kanton Erfolgskontrolle (Wirkungskontrolle) gemäss Vorgaben des kantonalen Förderprogramms LQ auf regionaler Stufe Die regionalen Trägerschaften setzen für die genannten Aufgaben eine regionale LaKo ein. Die Checkliste im Kap. 9 hilft einer regionalen Trägerschaft zu beurteilen, ob sie ein regionales LQ-Projekt lancieren und durchführen kann Lokale Trägerschaften für die Umsetzung der regionalen LQ-Projekte Die Gemeinden übernehmen die Trägerschaft für die Umsetzung und allfällige Detaillierung/Weiterentwicklung des regionalen LQ-Projektes auf kommunaler Stufe. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 16/35
17 Aufgaben der kommunalen Trägerschaften Projektlancierung in der Gemeinde organisieren Evtl. Ergänzung der regionalen Umsetzungs- und Wirkungsziele für die Gemeinde erarbeiten Sicherstellung einer ausreichenden Beteiligung der Landwirte Bereitstellen der finanziellen Ressourcen in der Gemeinde gemäss Finanzierungskonzept, Co-Finanzierung 10% der LQ-Massnahmen, Finanzierung von Massnahmen, die nicht DZVbeitragsberechtigt sind Anlaufstelle für Landwirte und Bevölkerung Verantwortung für Begleitmassnahmen zur Aufwertung der Landschaftsqualität, die nicht über LQ-Projekte gemäss DZV finanziert werden können (z.b. reine Erholungsangebote, Sitzbänke usw.) Orientierung der Landwirte über Projektstand, Zielerreichung und Änderungen Öffentlichkeitsarbeit Rückmeldungen an regionale LaKo für die Erfolgskontrolle (Wirkungskontrolle) Berichterstattung an die regionale LaKo Die Checkliste im Kap. 9 hilft einer kommunalen Trägerschaft zu beurteilen, ob sie ein regionales Landschaftsqualitätsprojekt umsetzen kann. 5.6 Rolle der Landschaftskommission Die Trägerschaften delegieren die eigentlichen Projektarbeiten (vgl. Aufgaben der Trägerschaften ) an eine bestehende Kommission oder Arbeitsgruppe, oder sie gründen dazu eine neue La- Ko. Eine breit abgestützte LaKo stellt die Integration der verschiedenen Interessensvertreter sicher. So kann der Aufwand für das Beteiligungsverfahren gering gehalten werden. Die LaKo besteht aus ca Personen, mit mind. je 2 Vertretern aus Gemeindebehörden, Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft, Bevölkerung. Die Anliegen aus dem Bereich Erholung muss vertreten sein z.b. durch Bevölkerungsvertreter. Die regionale LaKo ist für das Erarbeiten eines regionalen LQ-Projektes zuständig. Empfehlung: Die kommunale LaKo ist für deren Umsetzung auf Gemeindeebene verantwortlich. 5.7 Rolle der Fachperson Landschaft Für das Erarbeiten eines regionalen LQ-Projektes ist eine Fachperson Landschaft zu beauftragen. Auch auf kommunaler Stufe kann diese Fachperson für die Beratung der Gemeinden beigezogen werden. Die Fachperson Landschaft ist in der Lage: ein Projekt zu entwickeln und zu leiten bestehende Grundlagen und übergeordnete Ziele zu Landschaft und Raumplanung zu sammeln und zu beurteilen; Landschaften zu analysieren (u.a. formelle, ästhetische, funktionelle, historische, kulturelle und subjektive Aspekte); Bedürfnisse und Anliegen an die Landschaft von Betroffenen zu erheben und zu beurteilen; die Stärken und Defizite der Landschaft und Potenziale zu einer qualitativen Landschaftsentwicklung zu ermitteln; landschaftliche Ziele zu formulieren; innovative und kreative Lösungen zu erarbeiten; inhaltlich und gestalterisch überzeugende Massnahmen vorzuschlagen Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 17/35
18 5.8 Rolle des Landwirtschaftsberaters Der Landwirtschaftsberater ist auf der Stufe Landwirtschaftsbetrieb tätig. Um eine hohe Qualität in LQ- und Vernetzungsprojekten zu erreichen, wird analog zur Vernetzung auch für die Umsetzung von LQ-Projekten eine gesamtbetriebliche Beratung empfohlen, damit das Projekt im Sinne der Zielsetzungen der regionalen LaKo umgesetzt wird (vgl. Kap. 7.6). Obwohl der Kanton keine LQ-Beratungen finanzieren kann, ist der Landwirtschaftsberater bei LABIOLA- Vertragserneuerungen angehalten, neben der Vernetzung auch LQ zu beraten. Der Landwirtschaftsberater ist für folgende Aufgaben zuständig: Beratung der Landwirte in der Umsetzungsphase LQ und Vernetzung mit Vertragsausarbeitung Optimierung der Koordination und Synergien zwischen LQ- und Vernetzungsmassnahmen Der Landwirtschaftsberater hat sich entsprechend über das LQ-Projekt zu informieren. Zudem kann der Landwirtschaftsberater bereits während der Partizipation eine Rolle übernehmen, weil er einerseits "seine" Landwirte und das Gebiet und andererseits Fachkenntnisse in Landschaft, Ökologie und Landwirtschaft mitbringt. 5.9 Rolle der Landwirte Hauptakteur bei der Umsetzung von LQ-Massnahmen Pflege von bestehenden und neuen Objekten, Aufwertungen, Realisierung von Neuanlagen Vertragsnehmer Leistungserbringer und Beitragsempfänger gemäss vereinbarter Umsetzung von Massnahmen während der Projektdauer von 8 Jahren Die Checkliste im Kap. 9 hilft dem Bewirtschafter zu beurteilen, ob er sich an einem LQ-Projekt beteiligen kann Partizipation, Kommunikation Der Beteiligung der lokalen AkteurInnen wird bei den LQ-Projekten gemäss LQ-Richtlinie BLW (2013) ein wichtiger Platz eingeräumt. Das Beteiligungsverfahren soll einfach und effizient durchgeführt werden und sicher stellen, dass die angestrebte Landschaftsaufwertung und Entwicklung die Ansprüche der Bevölkerung und der beteiligten Landwirte erfüllt. Mit der Partizipation können zudem die regionalen Besonderheiten und Befindlichkeiten berücksichtigt werden. Ebenso können vorhandenes Wissen, Erfahrungen und Erwartungen ins Projekt einfliessen. Die Bevölkerung und wichtige Akteure können für das Thema Landschaft ihrer Region sensibilisiert werden. Dadurch wird die Umsetzung vorbereitet und erleichtert. Das Kommunikationskonzept der Trägerschaften gibt Auskunft, wer, wann, worüber und wie informiert bzw. beigezogen wird. Weitere Hinweise zur Partizipation vgl. Arbeitshilfe 2: Beteiligungsverfahren in Landschaftsqualitätsprojekten (Beilagen Bund). Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 18/35
19 6 Vorgehen LQ-Projekte 6.1 Übersicht Projektphasen in einem LQ-Projekt Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 19/35
20 6.2 Projektphasen, Beteiligte, Produkte Im Kanton Aargau sind LQ-Projekte nach folgendem Ablauf zu erarbeiten und umzusetzen: Ein detaillierter Beschrieb der Arbeitsphasen befindet sich im kantonalen Zusatzdokument 1 Projektleitfaden für Trägerschaften. Hinweis: Bei späteren Projekterarbeitungen verschieben sich die Termine jeweils um ein Jahr. Projektphasen Entscheide, Akteure Termine 1 Initiative, Start 1.1 Projektinitiative ergreifen Beschluss der Region, ein LQ-Projekt zu starten Projektorganisation festlegen LaKo beauftragen, evtl. gründen Fachperson Landschaft bestimmen Kommunikationskonzept 1.2 Projektskizze für Coaching-Beiträge Mitfinanzierungsgesuch für Projekterarbeitung an Bund und Kanton 2 Erarbeitung Regionales LQ - Projekt Analyse, Leitbild, Ziele und Massnahmen, Kostenschätzung Partizipation Projekteinreichung an Kanton Prüfung und Ergänzungen Kanton 3 Projekteinreichung, Bewilligung Bund 3.1 Einreichung Projektberichte regionaler LQ- Projekte Prüfung durch BLW 3.2 Projektbewilligung BLW Information an Trägerschaften durch Kanton Orientierung der Projektgemeinden durch regionale Trägerschaft 4 Umsetzung 4.1 Orientierung Landwirte und Bevölkerung Orientierung Landwirte, Bevölkerung Evtl. gemeindeübergreifende Beratung durch Region oder Einstiegsberatung durch Gemeinde für alle interessierten Landwirte (keine eigentliche Betriebsberatung) 4.2 Selbstdeklaration via Internet Anmeldung durch Landwirt: Agriportal Synergien mit Biodiversität Prüfung durch Kanton (Inhalte und Kosten) Region Gemeinden Einreichung an BLW durch reg. Trägerschaft Einreichung an Kanton durch reg. Trägerschaft (siehe Kontaktadresse für Regionen) ev. Überarbeitungen durch Trägerschaft Einreichung zur Bewilligung an BLW durch Kanton ev. Überarbeitungen durch Kanton und Trägerschaft Bewilligung durch BLW regionale LaKo, Trägerschaften, evtl. kommunale LaKo, Landwirte Landwirt, Vertragsabschlüsse (Kopie an reg. LaKo) evtl. Überarbeitungen zu Projektbeginn 2014 zu Projektbeginn 2014 Bis 30. September 2014 Bis 31. Oktober 2014 Spätestens bis 31. März 2015 Spätestens ab 1. April 2015 bis 31. August 2015 Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 20/35
21 Projektphasen 4.3 Umsetzung 2015 Pflege, Aufwertungen, Neuanlagen, Pflanzungen gem. Vertrag Entscheide, Akteure Termine Nach Vertragsunterzeichnung 4.4 Finanzierungsforderungsgesuch Prüfung BLW Ende Sept Kanton an BLW 4.5 Auszahlungen LQ-Beiträge Auszahlung Kanton an Landwirte 10. November Umsetzung ab 2016 Aufwertungen, Neuanlagen, Pflanzungen gem. Vertrag, die im ersten Vertragsjahr nicht realisiert werden konnten Pflegemassnahmen gem. Vertrag Ab Erfolgskontrolle, Weiterführung 5.1 Evaluation Umsetzung der Massnahmen evaluieren Kanton Region (Einbezug der Gemeinden) 5.2 Projektbericht anpassen Projektbericht einreichen beim BLW durch Kanton Prüfung des Berichtes und der Verlängerung durch BLW ev. Überarbeitungen durch Kanton und Trägerschaft 5.3 Projektverlängerung Bewilligung durch BLW Im letzten Jahr der Umsetzungsperiode Weitere 8 Jahre 6.3 Evaluation Im letzten Jahr der Umsetzungsperiode bewertet gemäss LQ-Richtlinie BLW (2013) der Kanton die Zielerreichung nach Vorgabe des Evaluationskonzeptes. Die Bewertung der Umsetzungsziele erfolgt detailliert. Die Evaluation der Wirkungsziele beinhaltet zumindest die Beschreibung der Landschaftsentwicklung im Projektgebiet. Die Umsetzungskontrolle erfolgt durch den Kanton. Die Wirkungskontrolle findet auf Stufe Region statt, gemäss dem kantonalen Evaluationskonzept. Hauptverantwortlich dafür sind die Regionen als Trägerschaften für die reg. Projekte. Sie müssen die nötigen Angaben aus den Gemeinden einholen und in ihre Erfolgskontrolle einbauen. Weiterführung (gemäss LQ-Richtlinie BLW, 2013) Vor Ablauf der achtjährigen Projektdauer ist der Zielerreichungsgrad zu überprüfen. Die definierten Umsetzungsziele müssen für eine Weiterführung des Projektes zu 80 Prozent erreicht werden. In begründeten Fällen kann davon abgewichen werden. Voraussetzung für die Bewilligung einer weiteren Umsetzungsperiode ist, dass am Ende der ersten Umsetzungsperiode eines 8-jährigen LQ-Projektes entweder 2/3 der Bewirtschafter Vereinbarungen abgeschlossen haben, oder die vertragnehmenden Betriebe 2/3 der LN- bzw. BF im Projektgebiet bewirtschaften. Der Bund prüft den angepassten Projektbericht. Nach Massgabe dieser Beurteilung wird eine weitere Umsetzungsperiode bewilligt. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 21/35
22 7 Beitragsberechtigung und Beitragsbemessung 7.1 Berechtigte Leistungen der Betriebe Mit LQB können einmalige und jährlich wiederkehrende Leistungen unterstützt werden, die im Rahmen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung durch die berechtigten Betriebe erbracht werden (z.b. Pflege einer Allee oder Neuansaaten farbiger Ackerbegleitflora). Die landwirtschaftliche Nutzung der Parzelle muss die Hauptzweckbestimmung bleiben. Grundsätzlich können diejenigen Landschaftsleistungen gefördert werden, die mit den regionalen Landschaftszielen in Einklang stehen. 7.2 Nicht-beitragsberechtigte Leistungen Folgende Massnahmen und Leistungen können nicht mit LQB unterstützt werde: Massnahmen ohne kulturlandschaftliche Bedeutung Landschaftsrelevante Aufwertungsmassnahmen, deren Resultat nicht den Zweckbestimmungen der LN entspricht, z.b. Bachöffnungen, Bachrenaturierungen Eine grossflächige Nutzungsaufgabe Bauliche Massnahmen oder Investitionen in Maschinen (Förderbereich der Strukturverbesserungen) Weidehaltung von Tieren, welche bereits mit Sömmerungs- oder Tierwohlbeiträgen (regelmässiger Auslauf im Freien RAUS) gefördert wird Administration, Beratung, Information, Kommunikation und Erfolgskontrolle. Die Verantwortung und Finanzierung dafür liegt bei der Projektträgerschaft. Die beitragsberechtigten Massnahmentypen und deren Anforderungen und Beiträge befinden sich im kantonalen Zusatzdokument Beiträge für bestehende und neue Landschaftselemente Beiträge für Bestehendes Es können für bereits bestehende Objekte LQ-Beiträge ausbezahlt werden, falls diese gemäss LQ-Projekt förderungswürdig sind Beiträge für Aufwertungen und Neugestaltungen Bei der Neuschaffung oder Aufwertung eines Objektes fallen die Initialkosten oftmals nur einmalig an. Sie können relativ hoch sein, beispielsweise wenn Trockenmauern angelegt oder Bäume gepflanzt werden. Deshalb werden in der Regel und in Rücksprache mit dem Kanton die Initialkosten mit einem einmaligen Beitrag gemäss den Angaben der Richtlinie Labiola des Kantons vergütet. Die darauffolgenden Pflegebeiträge werden während der Vertragsperiode jährlich ausbezahlt. Kosten für Baum- und Heckenpflanzungen und Saatgut können durch das LQ-Projekt mitfinanziert werden, sofern diese von landschaftlicher Bedeutung sind. Dabei gelten folgende Regelungen: Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 22/35
23 Leistungen Projekt: Pflanzgutkosten für Hochstamm-Obstbäume, Feldbäume und Heckensträucher werden rückvergütet (Rechnungsbeleg mit Sortenliste an Kanton, LWAG, einsenden): Ansätze gemäss Massnahmen- und Beitragskonzept. Saatgutkosten werden direkt durch den Landwirt finanziert und werden mit den jährlichen Beiträgen rückvergütet. Kleinstrukturen werden nicht finanziert. Leistungen Landwirt: Eigenleistungen in Form von Arbeiten für die Ausführung und die dazu nötigen Maschinenkosten, Baumschutzvorkehrungen u. dgl. 7.4 Berechtigte Flächen Betriebsfläche LQ-Beiträge können auf der im Projektgebiet gelegenen Betriebsfläche der berechtigten Betriebe ausgerichtet werden. Es muss sich dabei um eigene oder gepachtete BF handeln. Massnahmen ausserhalb dieser Flächen können nicht mit LQ-Beiträgen gemäss DZV unterstützt werden. Waldränder Waldränder gehören zum Waldareal. Eine Unterstützung von Leistungen, für die bereits das Waldgesetz Subventionen vorsieht, ist deshalb gemäss LQ Richtlinie BLW (2013), ausgeschlossen. Im Rahmen von LQ-Projekten ist eine Vereinbarung von Leistungen zur Pflege oder zur Aufwertung von Waldrändern deshalb nur möglich, sofern entsprechende, auf die Projektziele ausgerichtete Massnahmen im (vom BLW bewilligten) regionalen Massnahmenkonzept figurieren, falls Vereinbarungen auf der im Eigentum stehenden oder gepachteten Betriebsfläche abgeschlossen werden (gilt für die Waldränder und angrenzende LN-Fläche), und wenn die Leistungen vom Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin erbracht werden. Waldrandaufwertungen zu Lasten der LN oder eine über die Waldrandpflege hinausgehende Waldbewirtschaftung bleiben von Beiträgen ausgeschlossen. Ist der an die LN angrenzende Wald nicht Betriebsfläche (gemäss Erfahrungen in den Pilotprojekten ist das der Normalfall), ist die Unterstützung der Waldrandpflege nicht zulässig. 7.5 Berechtigte Landwirtschaftsbetriebe, Eintrittskriterien Die Beitragsberechtigung beschränkt sich gemäss LQ Richtlinie BLW (2013) auf direktzahlungsberechtigte Betriebe, Sömmerungsbetriebe und Gemeinschaftsweidebetriebe nach LBV, die Flächen im Projektgebiet bewirtschaften. Voraussetzung ist zudem die Erfüllung des ÖLN bzw. der entsprechenden Anforderungen an die Bewirtschaftung von Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben. Im Kanton Aargau können sich alle berechtigten Landwirte an LQ-Projekten beteiligen, sofern sie im Projektperimeter mindestens 5 Massnahmen des LQ-Projektes realisieren. In den regionalen LQ-Projekten ist dafür zu sorgen, dass nebst dem primären Ziel, der Erhaltung bestehender Landschaftsqualitäten, auch der Weiterentwicklung der Landschaft Rechnung getragen wird (gemäss LQ-Richtlinie BLW (2013). Es ist anzustreben, dass in den Umsetzungszielen die Aufwertungen und Neuanlagen von Objekten mindestens 10% aller Vertragsobjekte ausmachen (kann je nach Strukturiertheit der Region unterschiedlich sein). Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 23/35
24 7.6 Beteiligungsformen für Landwirte Selbstdeklaration Landschaftsqualität Mit der Möglichkeit zur Selbstdeklaration wird den Landwirten ein vereinfachtes Beteiligungsverfahren angeboten. Dabei gelten folgende Vorgaben: Voraussetzung für die Selbstdeklaration ist ein vom Kanton und BLW bewilligtes LQ- Projekt und eine Trägerschaft (Gemeinde), welche die Co-Finanzierung der LQ-Beiträge sicherstellt. Mit der Selbstdeklaration können alle LQ- Massnahmen gemäss bewilligtem LQ-Projekt ausgewählt werden. Die Anmeldung und Auswahl erfolgt durch die Landwirte auf dem Agriportal (kann auch zeitlich versetzt erfolgen). Die Wahl der Massnahmen generiert sogleich eine Vertragsliste, welche vom Vertragnehmer ausgedruckt werden kann. Die Landwirte können jederzeit einsteigen. Die Vertragsdauer für den Landwirt richtet sich nach der jeweiligen Projektdauer der Gemeinde (ab Projektstart max. 8 Jahre). Weil die Massnahmen der Selbstdeklaration ebenfalls durch eine lokale Trägerschaft cofinanziert werden muss, ist es wichtig, dass den Gemeinden dieses Vorgehen transparent kommuniziert wird. Eine Hochrechnung der Beiträge für die LQ-Massnahmen ist empfehlenswert. Dieses Vorgehen ist möglich, weil das BLW keine Beratung für die LQ- Massnahmen voraussetzt Einstiegsberatung Der Kanton beteiligt sich nicht an LQ-Beratungen. Damit ein LQ-Projekt aber im Sinne der Trägerschaften umgesetzt wird und der Landwirt die verschiedenen Zusammenhänge und Synergiemöglichkeiten besser erkennt, ist eine minimale Beratung auf regionaler oder lokaler Ebene empfehlenswert. Dieses Angebot müsste von den Regionen bzw. Gemeinden erbracht werden. Dabei ergeben sich folgende Möglichkeiten: gemeindeübergreifende Beratung für alle interessierten Landwirte durch Region, z. B. durch vertiefte Infoveranstaltungen für jeweils 3-4 benachbarte Gemeinden Einstiegsberatung durch Gemeinde für alle interessierten Landwirte auf Gemeindeebene (keine eigentliche Betriebsberatung) Auf diese Weise können die Trägerschaften Einfluss nehmen und die Landwirte motivieren, wo welche Massnahme prioritär umzusetzen ist. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 24/35
25 7.7 Beitragsbemessung Grundsatz LQ-Beiträge unterstützen Leistungen der Landwirtschaft zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft bezüglich Vielfalt und Qualität. Sie sind auf regionale und kommunale Ansprüche ausgerichtet. Grundsätzlich sind die Beiträge am Aufwand der Leistungserbringung für landschaftsrelevante Elemente zu bemessen. Um unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, können zudem mit einem Bonus zusätzliche Leistungen, Prioritäten und Elemente mit einem besonders hohen landschaftlichen Wert unterstützt werden. Pro LQ-Projekt können gemäss Richtlinie BLW (2013) maximal Beiträge von durchschnittlich 360. Fr. pro ha LN und 240. Fr. pro NST des Normalbesatzes der vertragnehmenden Betriebe ausgerichtet werden. Die Massnahmen werden in Projekten auf Basis regionaler und kommunaler Ziele festgelegt. Der Kanton erarbeitet ein Massnahmen- und Beitragskonzept, in dem die Beitragsansätze festgelegt sind. Der Beitragsschlüssel muss im Projektbericht dargestellt und die Beitragshöhen müssen begründet werden. Der Beitragsschlüssel wird durch den Bund geprüft. Die Beiträge werden auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen über 8 Jahre ausgerichtet Beitragsprinzip Beitragsprinzip für LQ-Beiträge (in Anlehnung an Markus Richner, BLW, 2012) Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 25/35
26 7.7.3 Verteilungsprinzip Zusammenhang von LN der beteiligten Betriebe und Massnahmenbudget (DüCo GmbH, 2013) Plafond für LQ-Beiträge, Budgetierung Bis 2017 gibt es gemäss Richtlinie BLW (2013) einen kantonalen Plafond für LQB: Für LQ- Projekte stellt der Bund jedem Kanton jährlich höchstens 120. Fr. pro ha LN des Kantons und 80. Fr. pro NST zur Verfügung. Ab 2018 wird diese Limite aufgehoben. Für LQB steht pro Projekt jährlich ein Plafond von höchstens 360 Franken pro ha LN der vertragnehmenden Betriebe und 240 Franken pro NST des Normalbesatzes der vertragnehmenden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe zur Verfügung. Der effektiv ausgelöste Beitrag ist leistungsabhängig. Der projektbezogene Plafond wird nur bei anspruchsvollen, qualitativ hochstehenden LQ Projekten und einer entsprechenden Beteiligung der Bewirtschafter erreicht. Falls in einem Projekt die Massnahmen derart umfangreich sind, dass der Einheitsbeitrag die Umsetzung nicht vollständig erlaubt, und nicht alle Leistungen mit dem projektspezifischen Höchstwert (360. Fr. pro ha LN bzw Fr. pro NST) finanziert werden können, ist eine begründete Priorisierung von Massnahmen vorzunehmen oder es ist eine alternative Finanzierung zu suchen. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 26/35
27 7.7.5 Koordination mit den Biodiversitätsbeiträgen Mit Biodiversitätsbeiträgen (Qualität und Vernetzung) werden Naturwerte und mit LQ-Beiträgen Kulturwerte der Landschaft gefördert. Die Beiträge für die Vernetzung von Lebensräumen und LQ werden projektbezogen und vertragsbasiert ausgerichtet (Vernetzungsvertrag mit Beratung, LQ- Vertrag mit Selbstdeklaration). Es sollen Synergien genutzt und eine Koordination in administrativer und inhaltlicher Hinsicht ermöglicht werden. Zu erwartende Synergien Eine Trägerschaft mit zwei koordinierten Projekten. Schnittstelle Ziele: allfällige Zielkonflikte zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und gesellschaftlichen Ansprüchen können erkannt und gelöst werden. Schnittstelle Massnahmen: Doppelfinanzierung kann vermieden werden, Massnahmenkonzept Landschaftsqualität kann gezielt auf Bereiche fokussieren, die über Biodiversitätsbeiträge nicht oder zu wenig gefördert werden. Empfehlungen Koordination von LQ- und Vernetzungsprojekten in den Gemeinden Landschaftsqualität und Vernetzung sind zu koordinieren, Synergien sind zu nutzen. Bei Erneuerung von Vernetzungsprojekten sind idealerweise auch die LQ-Massnahmen mitzuberücksichtigen (zwei Verträge: Vernetzung und LQ). Förderung von Landschaftsleistungen mit Biodiversitäts- und LQ-Beiträgen Elemente vorwiegend traditioneller Kulturlandschaften erfüllen oft gleichzeitig die Ziele im Bereich der Biodiversität und der Landschaftsqualität (z.b. Hecken, Feldobstbäume, Einzelbäume, extensive Wiesen). Für die Bewirtschaftung dieser Elemente können Biodiversitäts- und LQ-Beiträge ausgerichtet werden. Dabei gelten folgende Anforderungen: Zwischen den Massnahmen im Bereich Biodiversität und Landschaftsqualität darf es keine Zielkonflikte geben (z.b. keine Unterstützung von zusätzlichen Einzelbäumen in Gebieten, wo die Feldlerche gefördert wird). Wenn in einem Projekt für eine Massnahme zusätzlich zur Biodiversität ein LQ-Beitrag ausgerichtet werden soll, muss die Kummulierung der Beiträge nachvollziehbar sein. Dies muss aus den Zielen und dem Beitragskonzept klar abgeleitet werden können. Alle Elemente müssen für Erholungssuchende sichtbar sein. Der Beitragsempfänger muss einen Vertrag (Selbstdeklaration) innerhalb des LQ-Projektes abschliessen. Die objektbezogenen Kriterien und Beiträge sind im Massnahmen- und Beitragskonzept zusammengestellt. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 27/35
28 7.7.6 Bemessungsprinzip für LQ-Massnahmen Element 1: Für dieses Element bietet der Biodiversitätsbeitrag einen ausreichenden Anreiz zur Leistungserbringung oder ein zusätzlicher LQ-Beitrag ist gemäss LQ-Projekt nicht gerechtfertigt, z.b. Extensive Wiesen, welche die LQ-Kriterien nicht erfüllen (keine BFF-Qualität 2 und nicht entlang von Wegen). Element 2: Dieses Element erfüllt kein Ziel im Bereich der Biodiversität, ist aber landschaftsrelevant und wird deshalb mit einem LQ-Beitrag gefördert, z.b. Farbige Hauptkulturen oder Einsaat Ackerbegleitflora. Element 3: Das Element ist landschaftlich bedeutend und erhält bereits einen Biodiversitätsbeitrag. Der Anreiz für die Leistungserbringung ist jedoch nicht ausreichend, was zusätzlich einen LQ-Beitrag rechtfertigt, z.b. Hecken. Der LQ-Basisbeitrag ist ein Grundwert für eine landschaftsbezogene Leistung bzw. einen landschaftlichen Grundwert (z. B. Pflege einer Allee). Die Beitragshöhe ergibt sich aus einer betriebswirtschaftlichen Berechnung von Mehraufwand und Minderertrag bezüglich einer durchschnittlichen Nahrungsmittelproduktion auf einem vergleichbaren Standort. Finanzierung von nicht DZV-Massnahmen Für aufwendige Massnahmen, wie z. B. Bachöffnungen, Sanierungen oder Neubauten von Trockenmauern, reine Massnahmen zur Erholungsförderung usw., können keine LQ-Beiträge des Bundes eingesetzt werden. Hier gilt es andere Finanzpartner mit einzubeziehen, z. B. periodische Wiederinstandstellung von Infrastrukturen (PWI), Stiftungen usw. Prinzip zur Bemessung von LQ- und Biodiversitätsbeiträgen, gemäss Richtlinie BLW, 2013 Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 28/35
29 8 Kosten und Finanzierung 8.1 Bund, Kanton und Trägerschaften Der Bund finanziert die beitragsberechtigten LQ-Massnahmen und Leistungen mit 90%. Die restlichen 10% müssen durch eine Trägerschaft co finanziert werden. Im Kanton Aargau sind dies in der Regel die beteiligten Gemeinden. Der Kanton leistet seinen Beitrag durch das Erarbeiten des kantonalen Förderprogrammes mit Arbeitshilfen und die gesamte Projektadministration im Zusammenhang mit Projektprüfung, Bewilligungsverfahren und Beitragsauszahlungen. Zudem unterstützt er die Beratung der Landwirte im Rahmen der Vertragsarbeiten. Für die Finanzierung der LQ-Projekterarbeitung können die Trägerschaften basierend auf einer Projektskizze beim Bund ein Beitragsgesuch einreichen. In Ergänzung zu den Coaching-Beiträgen des Bundes kann der Kanton die Erarbeitung des regionalen LQ-Projektes etwa in der gleichen Beitragshöhe wie der Bund mitfinanzieren. Durch die allfällig bewilligten Beiträge sollte dadurch die fachliche Projekterarbeitung finanziert werden können. Aufwendungen der Trägerschaft erbringt diese in Form von Eigenleistungen. 8.2 Coaching-Beiträge BLW für die Projekterarbeitung Die Erarbeitung eines LQ-Projekts kann vom Bund finanziell unterstützt werden. Dazu kann durch die regionale Trägerschaft dem BLW eine Projektskizze eingereicht werden als Gesuch für die finanzielle Unterstützung einer fachlichen Begleitung zur Vorabklärung des Projekts nach Art. 136 Abs. 3 bis LwG (Coaching). Sie umfasst mindestens: Darstellung und Begründung der Wahl des Projektgebietes; Vorschlag für die Projektorganisation; Kommunikationskonzept; die Herausforderungen und Hauptziele des Projektes; die Grundzüge der Projektfinanzierung; die vorgesehenen Synergien mit kürzlich abgeschlossenen oder laufenden Projekten im Gebiet. Die auf der Grundlage eines Mandats erbrachten und von der Trägerschaft bezahlten Leistungen können vom Bund mit 50% der fakturierten und von der Trägerschaft bezahlten Kosten oder höchstens Fr. unterstützt werden. Grundlage dazu bildet ein Finanzhilfevertrag mit der Trägerschaft. Der Kanton beteiligt sich an der LQ-Projekterarbeitung mit max. Fr. 10'000.. Ein einfaches Schreiben an den Kanton, ALG, plus Kopie der ans BLW eingereichten Projektskizze genügen. Die Gesuchsvorlage für Projektskizzen befindet sich in der Vorlage 1 (Beilagen Bund). Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 29/35
30 8.3 Kosten- und Finanzierungsübersicht für LQ-Projekte Kostenstellen Leistungserbringer Finanzierung, Richtwerte Erarbeitung regionales LQ-Projekt: Regionale LaKo Eigenleistungen regionale Trägerschaft (ca. 10'000. bis Administration, Information und Fachperson Landschaft Kommunikation, Evaluation 20'000. Fr.) Grundlagenbeschaffung, Analyse, Leitbild, Ziele, Projektplan, Massnahmen, Bericht Kanton (max. 10'000. Fr.) Coaching-Beiträge BLW (max. 50% bzw. 20'000. Fr.) Umsetzung: Organisation Evtl. LQ-Detaillierung/ kommunales Massnahmenkonzept Öffentlichkeitsarbeit, Infoveranstaltungen für Landwirte Koordination Umsetzung: Vertrag Selbstdeklaration Evtl. freiwillige Beratung Landwirte Umsetzung: beitragsberechtigte LQ-Massnahmen (inkl. Initialkosten) Umsetzung der nichtbeitragsberechtigten LQ- Massnahmen z.b. reine Erholungsmassnahmen ohne landwirtschaftliche Nutzung Gemeinde Evtl. kommunale LaKo Beratung der LaKo durch Fachperson Landschaft Landwirt evtl. regionale oder kommunale Trägerschaft Berater Landwirt als Vertragsnehmer Gemeinde Vereine Private Landwirte Eigenleistungen Gemeinde (Verwaltungsaufwand Gemeinde, Sitzungsgelder LaKo) Bezahlung Fachperson Landschaft durch regionale Trägerschaft, auf lokaler Ebene Gemeinde (bei Bedarf) Selbstdeklaration: ohne Kostenfolge für den Landwirt Freiwillige Beratung: evtl. durch regionale oder kommunale Trägerschaft oder kostenpflichtig für Landwirt Hauptfinanzierung durch BLW: 90% Co-Finanzierung durch Trägerschaften, i.d.r. Gemeinden: 10% Beitragshöhen gemäss Beitragskonzept Kanton Gemeinde Evtl. Subventionen Kanton Stiftungen, Vereine, NGO, Firmen usw. Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 30/35
31 8.4 Beitrags- und Restfinanzierung (Berechnungsbeispiel Gemeinde Musterwil) Gemeindedaten Gemeindefläche 10.3 km 2 Landwirtschaftliche Nutzfläche 486 ha Vertragsflächen Bestehende Vertragsflächen Biodiversität 32 ha (ca. 6.5% der LN) Vertragsflächen Landschaftsqualität ca. 320 ha (Annahme 66% der LN bzw. Landwirte), teilweise kumuliert mit Vertragsflächen Biodiversität! Beiträge Vernetzungsbeiträge (ca. 1'000. Fr./ha/J.) Anteil Bund 90% Anteil Gemeinde 10% Fr./J Fr./J., Fr./J. LQ-Beiträge inkl. Investitionen für Neupflanzungen u.a. (ca Fr./ha LN) Anteil Bund 90% Anteil Gemeinde 10% Zusätzlich Biodiversitäts-Qualitätsbeiträge (ca. CHF Fr./ha/J.) Kein Anteil Gemeinde (100% durch Bund) 10% Fr./J Fr./J Fr./J Fr./J Fr./J. LQ- und Vernetzungs-Beiträge/J.: Trägerschaft 10%: Fr. Bund 90%: Fr. 90% Total Fr. Gesamthaft fliessen durch LQ- und Biodiversitätsbeiträge jährlich ca Fr. nach Musterwil. Davon bezahlt der Bund ca. 144'300. Fr. und die Trägerschaft (i.d.r. die Gemeinde) ca. 10'700. Fr. (ca. 7,4%). Die Programm- und Beratungskosten sind nicht miteingerechnet. Die Mitfinanzierung der Gemeinden sind nicht als Kosten zu sehen, sondern als Investitionen, die auch Steuereinnahmen generieren. Die Ausgaben für die Co-Finanzierungen werden in den meisten Fällen durch die Steuereinnahmen mehr oder weniger ausgeglichen! Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 31/35
32 9 Checkliste für LQ-Beteiligungen 9.1 Checkliste für Landwirte Anhand der Checkliste können Sie überprüfen, ob Sie sich an einem LQ-Projekt beteiligen können. Falls die folgenden Aussagen für Sie zutreffen, sind Sie eingeladen, sich an der Umsetzung des LQ-Projektes zu beteiligen: Ich 1. bin DZ-berechtigter Landwirt 2. bewirtschafte eigene oder gepachtete BF-Flächen im LQ-Projektgebiet 3. erfülle die Anforderungen des ÖLN 4. beteilige mich am Projekt mit mindestens 5 Massnahmen 5. bin motiviert, die Qualität der Landschaft auch für eine breite Bevölkerung zu erhalten und wenn sinnvoll und machbar auch zu verbessern 6. möchte mich am LQ-Projekt beteiligen und schliesse für die vereinbarten Leistungen einen 8- jährigen Vertrag ab (Selbstdeklaration) Foto: Alfred Gassmann, Lenzburg Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 32/35
33 9.2 Checkliste für regionale Trägerschaften Anhand der folgenden Checkliste können Sie überprüfen, ob Sie ein regionales LQ-Projekt lancieren und durchführen können. Falls die folgenden Aussagen für Sie zutreffen, sind Sie eingeladen, ein LQ-Projekt zu erarbeiten: Wir 1. sind ein regionaler Planungsverband und möchten die Trägerschaft für ein regionales LQ- Projekt übernehmen 2. setzen unsere bestehende regionale Landschaftskommission für die Betreuung des LQ- Projektes ein oder gründen eine neue LaKo 3. setzen unsere LaKo so zusammen, dass im Stellvertreterprinzip alle wichtigen Interessensvertreter miteinbezogen sind 4. beauftragen eine Fachperson Landschaft mit der Ausarbeitung des LQ-Projektes, dessen Kosten durch Coaching-Beiträge des Bundes und durch den Kanton mitfinanziert werden 5. wollen, dass sich in unserer Region genügend Gemeinden an der Umsetzung des Projektes beteiligen 6. sehen es als unser Ziel, dass das Projekt innert 8 Jahre auf mindestens 2/3 der LN oder mit mindestens 2/3 der Landwirte umgesetzt wird 7. sind die Ansprechpartner für Gemeinden und Kanton 8. erbringen unsere Aufwändungen in Form von Eigenleistungen und reichen bei Bund und Kanton zur Finanzierung der Projektkosten eine Projektskizze ein (Coaching-Beiträge) 9. informieren unsere Gemeinden und die Bevölkerung über den Stand der Arbeiten und deren Inhalte in den wichtigen Projektphasen 10. sind interessiert, dass das Thema Landschaftsqualität umfassend angegangen wird und sich nicht nur auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen beschränkt 11. beteiligen uns mit unserer LaKo an der Erfolgskontrolle nach der 8-jährigen Projektdauer und verfassen den geforderten Zwischen- und Schlussbericht Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 33/35
34 9.3 Checkliste für kommunale Trägerschaften, Gemeinden Anhand der folgenden Checkliste können Sie überprüfen, ob Sie ein regionales LQ-Projekt in Ihrer Gemeinde umsetzen können. Falls die folgenden Aussagen für Sie zutreffen, sind Sie eingeladen, zusammen mit Ihren Landwirten das LQ-Projekt realisieren: Wir als Gemeinde 1. möchten die Trägerschaft für die Umsetzung des regionalen LQ-Projektes übernehmen 2. setzen bei Bedarf unsere bestehende kommunale LaKo für die Betreuung des LQ-Projektes und zur Entlastung des Gemeinderates ein oder gründen eine neue LaKo 3. setzen unsere LaKo so zusammen, dass im Stellvertreterprinzip alle wichtigen Interessensvertreter miteinbezogen sind, evtl. mit Begleitung einer Fachperson Landschaft 4. wollen, dass sich in unserer Gemeinde genügend Landwirte an der Umsetzung des Projektes beteiligen 5. sehen es als unser Ziel, dass das Projekt innert 8 Jahre gemäss den Zielsetzungen umgesetzt wird 6. sind die Ansprechpartner für die Landwirte 7. erbringen unsere Aufwändungen in Form von Eigenleistungen und übernehmen die Restfinanzierung der LQ- Massnahmen während der vereinbarten 8-jährigen Vertragsdauer (Co- Finanzierung max. 10%) 8. informieren unsere Bevölkerung und die Landwirte über den Stand der Arbeiten und deren Inhalte in den wichtigen Projektphasen 9. sind interessiert, dass das Thema Landschaftsqualität umfassend angegangen wird und sich nicht nur auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen beschränkt 10. beteiligen uns mit unserer LaKo an der Erfolgskontrolle nach der 8-jährigen Projektdauer Konzept_ LQ_Aargau_2014_07_29.docx 34/35
Informationsveranstaltung
 Regionales Landschaftsqualitätsprojekt: Informationsveranstaltung 29.08.2014 Ausgangslage: Neue Agrarpolitik 2014-17 Bund Landschaft als Teil der Lebensqualität Landschaft unter Druck Neue Agrarpolitik
Regionales Landschaftsqualitätsprojekt: Informationsveranstaltung 29.08.2014 Ausgangslage: Neue Agrarpolitik 2014-17 Bund Landschaft als Teil der Lebensqualität Landschaft unter Druck Neue Agrarpolitik
Kathrin Hasler, Vorstandsmitglied Fricktal Regio Planungsverband. Fricktalkonferenz. 22. Januar 2016
 Landschaftsqualitäts-Projekt Fricktal und Anhörung Verpflichtungskredit «Programm Labiola» Kathrin Hasler, Vorstandsmitglied Fricktal Regio Planungsverband Inhalt 1. Ausgangslage 2. Um was geht es 3. Beispiele
Landschaftsqualitäts-Projekt Fricktal und Anhörung Verpflichtungskredit «Programm Labiola» Kathrin Hasler, Vorstandsmitglied Fricktal Regio Planungsverband Inhalt 1. Ausgangslage 2. Um was geht es 3. Beispiele
Die neue Agrarpolitik und ihre Wechselwirkungen mit dem Wald
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Die neue Agrarpolitik und ihre Wechselwirkungen mit dem Wald Jahresversammlung des Schweizerischen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Die neue Agrarpolitik und ihre Wechselwirkungen mit dem Wald Jahresversammlung des Schweizerischen
Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsbeiträge 26.8.2014, Gipf-Oberfrick. 3.9.2014, Schinznach
 Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsbeiträge 26.8.2014, Gipf-Oberfrick 3.9.2014, Schinznach 1. Begrüssung 2. LQ-Projekte im Rahmen der AP 14/17 3. Organisation, Trägerschaft, Rollenverteilung 4. LQ-Projekt:
Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsbeiträge 26.8.2014, Gipf-Oberfrick 3.9.2014, Schinznach 1. Begrüssung 2. LQ-Projekte im Rahmen der AP 14/17 3. Organisation, Trägerschaft, Rollenverteilung 4. LQ-Projekt:
FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
 Bauernverband Aargau Im Roos 5, 5630 Muri Tel. 056 460 50 50 Fax 056 460 50 54 info@bvaargau.ch www.bvaargau.ch BVA Versicherungen 056 460 50 40 BVA Treuhand 056 460 50 55 Standesvertretung FRAGEBOGEN
Bauernverband Aargau Im Roos 5, 5630 Muri Tel. 056 460 50 50 Fax 056 460 50 54 info@bvaargau.ch www.bvaargau.ch BVA Versicherungen 056 460 50 40 BVA Treuhand 056 460 50 55 Standesvertretung FRAGEBOGEN
LANDSCHAFTSQUALITÄTSBEITRÄGE
 Institut agricole de l Etat de Fribourg IAG Service de l agriculture Service de l agriculture SAgri Amt für Landwirtschaft LwA LANDSCHAFTSQUALITÄTSBEITRÄGE Januar Februar 2015 Direction des institutions,
Institut agricole de l Etat de Fribourg IAG Service de l agriculture Service de l agriculture SAgri Amt für Landwirtschaft LwA LANDSCHAFTSQUALITÄTSBEITRÄGE Januar Februar 2015 Direction des institutions,
Kanton Bern. 30. Juni 2015 VOL/LANAT/ADZ
 Themen: AGFF-Alpwirtschaftstagung 2015 1. Direktzahlungen 2014 Sömmerungsgebiet 2. Direktzahlungsverordnung 3. Alpungsbeiträge / Sömmerungsbeiträge 4. Fragen Direktzahlungen 2014 Sömmerungsgebiet Sömmerungsbeiträge
Themen: AGFF-Alpwirtschaftstagung 2015 1. Direktzahlungen 2014 Sömmerungsgebiet 2. Direktzahlungsverordnung 3. Alpungsbeiträge / Sömmerungsbeiträge 4. Fragen Direktzahlungen 2014 Sömmerungsgebiet Sömmerungsbeiträge
Biodiversität in der Schweizer Landwirtschaft Bern 07. März 2005
 Agrarpolitik 2011 und Biodiversität in der Schweizer Landwirtschaft Thomas P. Schmid Leiter Geschäftsbereich Umwelt, Ökologie, Energie und Transport Schweizerischer Bauernverband Inhaltsübersicht Wer beeinflusst
Agrarpolitik 2011 und Biodiversität in der Schweizer Landwirtschaft Thomas P. Schmid Leiter Geschäftsbereich Umwelt, Ökologie, Energie und Transport Schweizerischer Bauernverband Inhaltsübersicht Wer beeinflusst
Landschaftsqualität aus Sicht der Raumplanung
 Bundesamt für Raumentwicklung ARE Office fédéral du développement territorial ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Uffizi federal da svilup dal territori ARE Landschaftsqualität aus Sicht
Bundesamt für Raumentwicklung ARE Office fédéral du développement territorial ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Uffizi federal da svilup dal territori ARE Landschaftsqualität aus Sicht
Einwohnergemeinde Jegenstorf. Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes
 Einwohnergemeinde Jegenstorf Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes 01. Januar 2012 Der Gemeinderat, gestützt auf - Art. 431 des Gemeindebaureglementes
Einwohnergemeinde Jegenstorf Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes 01. Januar 2012 Der Gemeinderat, gestützt auf - Art. 431 des Gemeindebaureglementes
Stand: Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1. Dienststelle für Wald und Landschaft
 Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Wald Natur, Landschaft und Wald Funktionen des Waldes Stand: 21.09.2005 Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1 Instanzen zuständig für das Objekt
Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Wald Natur, Landschaft und Wald Funktionen des Waldes Stand: 21.09.2005 Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1 Instanzen zuständig für das Objekt
Aus «ökologischen Ausgleichsflächen öaf» werden «Biodiversitätsförderflächen BFF» Alle Qualitätsstufen zu 100% vom Bund finanziert
 Übersicht Aus «ökologischen Ausgleichsflächen öaf» werden «Biodiversitätsförderflächen BFF» BFF neu in drei Qualitätsstufen Qualitätsstufe I: heute: ökologische Ausgleichsflächen Qualitätsstufe II: heute:
Übersicht Aus «ökologischen Ausgleichsflächen öaf» werden «Biodiversitätsförderflächen BFF» BFF neu in drei Qualitätsstufen Qualitätsstufe I: heute: ökologische Ausgleichsflächen Qualitätsstufe II: heute:
LQB: Fragen - Antworten. Allgemeine Fragen. Stichwort Frage Antwort
 Kanton Zürich Baudirektion LQB: Fragen - Antworten Amt für Landschaft und Natur Abteilung Landwirtschaft Allgemeine Fragen Stichwort Frage Antwort Abrechnungsbetrieb / Produktionsstätten Auslandflächen
Kanton Zürich Baudirektion LQB: Fragen - Antworten Amt für Landschaft und Natur Abteilung Landwirtschaft Allgemeine Fragen Stichwort Frage Antwort Abrechnungsbetrieb / Produktionsstätten Auslandflächen
Weiterentwicklung der Landwirtschaftlichen Planung zur Stärkung der sektor- und gemeindeübergreifenden Planung
 Weiterentwicklung der Landwirtschaftlichen Planung zur Stärkung der sektor- und gemeindeübergreifenden Planung 1. Ausgangslage und Problemstellung Die Landwirtschaftliche Planung (LP) erlaubt
Weiterentwicklung der Landwirtschaftlichen Planung zur Stärkung der sektor- und gemeindeübergreifenden Planung 1. Ausgangslage und Problemstellung Die Landwirtschaftliche Planung (LP) erlaubt
Altersleitbild der Gemeinde Egg (angepasst per ) Lebensqualität im Alter
 Altersleitbild 2013-2016 der Gemeinde Egg (angepasst per 09.01.2015) Lebensqualität im Alter Vorwort Dem Gemeinderat Egg ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich auch die älteren Einwohnerinnen und Einwohner
Altersleitbild 2013-2016 der Gemeinde Egg (angepasst per 09.01.2015) Lebensqualität im Alter Vorwort Dem Gemeinderat Egg ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich auch die älteren Einwohnerinnen und Einwohner
forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE forum.landschaft 19.11.2015 1
 forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE 1 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL REGIONALER NATURPARK VON NATIONALER BEDEUTUNG 2 REGIONALER NATURPARK BINNTAL ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE NATUR- UND KULTURWERTE
forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE 1 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL REGIONALER NATURPARK VON NATIONALER BEDEUTUNG 2 REGIONALER NATURPARK BINNTAL ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE NATUR- UND KULTURWERTE
Leitfaden kantonales Vernetzungskonzept
 Leitfaden kantonales Vernetzungskonzept Modular aufgebautes Vernetzungskonzept ab 2013 (2. Vertragsperiode) Die Vertragsperiode des ersten Vernetzungsprojektes endete 2012. Infolge dessen beschloss der
Leitfaden kantonales Vernetzungskonzept Modular aufgebautes Vernetzungskonzept ab 2013 (2. Vertragsperiode) Die Vertragsperiode des ersten Vernetzungsprojektes endete 2012. Infolge dessen beschloss der
Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt tfü für rum Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz, BAFU BÖA Jahrestagung, 20. November 2012 Langfristiges
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt tfü für rum Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz, BAFU BÖA Jahrestagung, 20. November 2012 Langfristiges
Gemeinderätliches. Leitbild
 Gemeinderätliches Leitbild 2014-2017 Vorwort Liebe Spreitenbacherinnen Liebe Spreitenbacher Wenn einer nicht weiss, wohin er will, darf er sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Nicht nach diesem
Gemeinderätliches Leitbild 2014-2017 Vorwort Liebe Spreitenbacherinnen Liebe Spreitenbacher Wenn einer nicht weiss, wohin er will, darf er sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Nicht nach diesem
DEPARTEMENT FÜR VÖLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG
 DEPARTEMENT FÜR VÖLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG Weisung zur kantonalen Politik im Bereich der Biodiversität, Landschaftsqualität sowie Nutzung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen in der
DEPARTEMENT FÜR VÖLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG Weisung zur kantonalen Politik im Bereich der Biodiversität, Landschaftsqualität sowie Nutzung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen in der
Auf dem Weg zum naturnahen Zustand? Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung des revidierten Gewässerschutzgesetzes
 Annina Joost Auf dem Weg zum naturnahen Zustand? Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung des revidierten Gewässerschutzgesetzes Bachelorarbeit Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Annina Joost Auf dem Weg zum naturnahen Zustand? Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung des revidierten Gewässerschutzgesetzes Bachelorarbeit Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Leitbild 2020 Leitbild 2020 Seite 1
 Landwirtschaft beider Basel Leitbild 2020 Leitbild 2020 Seite 1 Landwirtschaftsbetriebe beider Basel: unternehmerisch und vielfältig Wir haben eine vielfältige Landwirtschaft. Wir anerkennen und fördern
Landwirtschaft beider Basel Leitbild 2020 Leitbild 2020 Seite 1 Landwirtschaftsbetriebe beider Basel: unternehmerisch und vielfältig Wir haben eine vielfältige Landwirtschaft. Wir anerkennen und fördern
Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft
 Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft Nachhaltige Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich Editorial Bild: HSR Landschaft geht uns alle an! Sei es, weil wir in ihr arbeiten, uns darin erholen, darin
Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft Nachhaltige Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich Editorial Bild: HSR Landschaft geht uns alle an! Sei es, weil wir in ihr arbeiten, uns darin erholen, darin
Ackerbaustellen-Tagung
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Ackerbaustellen-Tagung 12. / 13. Januar 2016 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Landschaftsqualität Projekte Rahel Tommasini,
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Ackerbaustellen-Tagung 12. / 13. Januar 2016 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Landschaftsqualität Projekte Rahel Tommasini,
RB GESETZ über die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Uri (Kantonales Kinderund Jugendförderungsgesetz, KKJFG)
 RB 10.4211 GESETZ über die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Uri (Kantonales Kinderund Jugendförderungsgesetz, KKJFG) (vom ) Das Volk des Kantons Uri, gestützt auf Artikel 90 Absatz 1 der
RB 10.4211 GESETZ über die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Uri (Kantonales Kinderund Jugendförderungsgesetz, KKJFG) (vom ) Das Volk des Kantons Uri, gestützt auf Artikel 90 Absatz 1 der
Pärke von nationaler Bedeutung Präsentation Plattform Naturwissenschaften und Region
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Pärke von nationaler Bedeutung Präsentation Plattform Naturwissenschaften und Region,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Pärke von nationaler Bedeutung Präsentation Plattform Naturwissenschaften und Region,
Biodiversität verwalten Ökologischer Ausgleich in der Landwirtschaft
 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Biodiversität verwalten Ökologischer Ausgleich in der Landwirtschaft BÖA Jahrestagung 23. März 2010 Spa/2010-03-01/230 Inhalt
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Biodiversität verwalten Ökologischer Ausgleich in der Landwirtschaft BÖA Jahrestagung 23. März 2010 Spa/2010-03-01/230 Inhalt
Anpassung kantonaler Richtplan Kapitel L 4 Wald
 Baudirektion Amt für Raumplanung Anpassung kantonaler Richtplan Kapitel L 4 Wald Synopse, November 2007 Verwaltungsgebäude 1 an der Aa Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug T 041 728 54 80, F 041 728 54
Baudirektion Amt für Raumplanung Anpassung kantonaler Richtplan Kapitel L 4 Wald Synopse, November 2007 Verwaltungsgebäude 1 an der Aa Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug T 041 728 54 80, F 041 728 54
Konzept Biber - Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz. Rückmeldeformular. Name / Firma / Organisation / Amt
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Konzept Biber Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz Rückmeldeformular Name
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Konzept Biber Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz Rückmeldeformular Name
Planungsbericht Mobilitätsstrategie (mobilitätaargau); Anhörung. Privatperson
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Verkehr Entfelderstrasse 22 5001 Aarau FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG Planungsbericht Mobilitätsstrategie (mobilitätaargau); Anhörung vom 4. April 2016 bis 27. Juni
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Verkehr Entfelderstrasse 22 5001 Aarau FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG Planungsbericht Mobilitätsstrategie (mobilitätaargau); Anhörung vom 4. April 2016 bis 27. Juni
Überblick: Direktzahlungen an Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe. Bern, Januar 2015
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und ländliche Entwicklung Bern, Januar 2015 Überblick: Direktzahlungen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und ländliche Entwicklung Bern, Januar 2015 Überblick: Direktzahlungen
- Im Interesse der zukünftigen Generationen - Für gesunde Finanzen - Zum Schutz der Umwelt
 Projekte beurteilen nach den Grundsätzen der Nachhaltigen Entwicklung - Im Interesse der zukünftigen Generationen - Für gesunde Finanzen - Zum Schutz der Umwelt Sie wollen ein neues Quartier planen, das
Projekte beurteilen nach den Grundsätzen der Nachhaltigen Entwicklung - Im Interesse der zukünftigen Generationen - Für gesunde Finanzen - Zum Schutz der Umwelt Sie wollen ein neues Quartier planen, das
Verordnung über Förderungsbeiträge an Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus
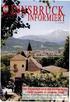 84.5 Verordnung über Förderungsbeiträge an Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus Vom 0. Mai 0 (Stand. Juni 05) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf 74 Absatz und 06a Absatz
84.5 Verordnung über Förderungsbeiträge an Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus Vom 0. Mai 0 (Stand. Juni 05) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf 74 Absatz und 06a Absatz
Landesgartenschauen und Gartenschauen Natur in der Stadt/Gemeinde
 Ziele und Grundsätze zur Durchführung von Landesgartenschauen und Gartenschauen Natur in der Stadt/Gemeinde in Bayern 1. Zielsetzung Landesgartenschauen und Gartenschauen Natur in der Stadt/Gemeinde sollen
Ziele und Grundsätze zur Durchführung von Landesgartenschauen und Gartenschauen Natur in der Stadt/Gemeinde in Bayern 1. Zielsetzung Landesgartenschauen und Gartenschauen Natur in der Stadt/Gemeinde sollen
Förderung von preisgünstigem Wohnraum auf Gemeindeebene
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Wohnungswesen BWO Förderung von preisgünstigem Wohnraum auf Gemeindeebene Ernst Hauri, Direktor BWO Übersicht Besteht
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Wohnungswesen BWO Förderung von preisgünstigem Wohnraum auf Gemeindeebene Ernst Hauri, Direktor BWO Übersicht Besteht
Verordnung über Förderbeiträge nach dem Energiegesetz
 490.0 Verordnung über Förderbeiträge nach dem Energiegesetz Vom 5. Dezember 009 (Stand. Januar 00) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf 74 Absatz der Kantonsverfassung vom 7. Mai
490.0 Verordnung über Förderbeiträge nach dem Energiegesetz Vom 5. Dezember 009 (Stand. Januar 00) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf 74 Absatz der Kantonsverfassung vom 7. Mai
Konzept Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB)
 Konzept Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB) Förderung der Medienkompetenz der Lernenden, der Eltern und der Lehrpersonen Überarbeitete Version Juli 2014 Ausgangslage Medien ändern sich in unserer
Konzept Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB) Förderung der Medienkompetenz der Lernenden, der Eltern und der Lehrpersonen Überarbeitete Version Juli 2014 Ausgangslage Medien ändern sich in unserer
Freiräume in Quartier und Gemeinde ein wertvolles Gut
 Bundesamt für Raumentwicklung ARE Bundesamt für Wohnungswesen BWO Bundesamt für Gesundheit BAG Bundesamt für Landwirtschaft BLW Bundesamt für Sport BASPO Bundesamt für Strassen ASTRA Bundesamt für Umwelt
Bundesamt für Raumentwicklung ARE Bundesamt für Wohnungswesen BWO Bundesamt für Gesundheit BAG Bundesamt für Landwirtschaft BLW Bundesamt für Sport BASPO Bundesamt für Strassen ASTRA Bundesamt für Umwelt
Richtlinien für die Abgabe von Pachtland
 Richtlinien für die Abgabe von Pachtland gültig ab: 01. Juli 2014 Revidiert: Mai / Juni 2014 Vom Gemeinderat erlassen am: 04. Juni 2014 Erste Inkraftsetzung per: 01. November 2011 gestützt auf das Einführungsgesetz
Richtlinien für die Abgabe von Pachtland gültig ab: 01. Juli 2014 Revidiert: Mai / Juni 2014 Vom Gemeinderat erlassen am: 04. Juni 2014 Erste Inkraftsetzung per: 01. November 2011 gestützt auf das Einführungsgesetz
INFORMATIK-BESCHAFFUNG
 Leistungsübersicht Von Anbietern unabhängige Entscheidungsgrundlagen Optimale Evaluationen und langfristige Investitionen Minimierte technische und finanzielle Risiken Effiziente und zielgerichtete Beschaffungen
Leistungsübersicht Von Anbietern unabhängige Entscheidungsgrundlagen Optimale Evaluationen und langfristige Investitionen Minimierte technische und finanzielle Risiken Effiziente und zielgerichtete Beschaffungen
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums ELER
 Gegenwart und Zukunft der EU-Strukturförderung in Baden-Württemberg Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums ELER Hans-Peter Riedlberger Programmkoordinierung ELER Informationsveranstaltung
Gegenwart und Zukunft der EU-Strukturförderung in Baden-Württemberg Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums ELER Hans-Peter Riedlberger Programmkoordinierung ELER Informationsveranstaltung
Richtlinien. für das Pachtland der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Bünzen
 Richtlinien für das Pachtland der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Bünzen Ausgabe 2014 Pachtrichtlinien 1 1. Zuteilungskriterien 1.1 Pachtberechtigt sind - Betriebe, Betriebsgemeinschaften und Personengesellschaften,
Richtlinien für das Pachtland der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Bünzen Ausgabe 2014 Pachtrichtlinien 1 1. Zuteilungskriterien 1.1 Pachtberechtigt sind - Betriebe, Betriebsgemeinschaften und Personengesellschaften,
Die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - Gemeinsamkeiten, Synergien und Unterschiede
 Die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - Gemeinsamkeiten, Synergien und Unterschiede 18.03.2015 1 Gliederung - Rechtlicher Rahmen - Ziele der Richtlinien
Die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - Gemeinsamkeiten, Synergien und Unterschiede 18.03.2015 1 Gliederung - Rechtlicher Rahmen - Ziele der Richtlinien
Pressemitteilung. Einwohnergemeinderat. Aus dem Einwohnergemeinderat Sarnen
 Einwohnergemeinderat Pressemitteilung Aus dem Einwohnergemeinderat Sarnen Gemeindeverwaltung: Projekt Überprüfung der Organisationsstruktur mit der Einrichtung einer Geschäftsleitung Es ist das Ziel des
Einwohnergemeinderat Pressemitteilung Aus dem Einwohnergemeinderat Sarnen Gemeindeverwaltung: Projekt Überprüfung der Organisationsstruktur mit der Einrichtung einer Geschäftsleitung Es ist das Ziel des
ENERGIEFÖRDERRICHTLINIEN
 ENERGIEFÖRDERRICHTLINIEN Richtlinien zur Förderung der rationellen Energienutzung und erneuerbarer Energieträger 02 Der Gemeinderat Baar erlässt, gestützt auf 84 des Gemeindegesetzes und Artikel 20 der
ENERGIEFÖRDERRICHTLINIEN Richtlinien zur Förderung der rationellen Energienutzung und erneuerbarer Energieträger 02 Der Gemeinderat Baar erlässt, gestützt auf 84 des Gemeindegesetzes und Artikel 20 der
Energiefondsreglement
 Energiefondsreglement 2015-271/83.05 Der Gemeinderat Waldkirch erlässt gestützt auf Art. 3 Gemeindegesetz vom 21. April 2009 (sgs 151.2) und Art. 34 Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Waldkirch vom
Energiefondsreglement 2015-271/83.05 Der Gemeinderat Waldkirch erlässt gestützt auf Art. 3 Gemeindegesetz vom 21. April 2009 (sgs 151.2) und Art. 34 Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Waldkirch vom
Naturschutz in der Gemeinde Pflicht und Kür!
 Naturschutz in der Gemeinde Pflicht und Kür! Théophile Robert, La vielle Aar, 1898 Roter Faden Weshalb überhaupt Naturschutz? Aktuelle Biodiversitätsverluste, (zu) viele Gründe Pflichten der Gemeinde Handlungsmöglichkeiten
Naturschutz in der Gemeinde Pflicht und Kür! Théophile Robert, La vielle Aar, 1898 Roter Faden Weshalb überhaupt Naturschutz? Aktuelle Biodiversitätsverluste, (zu) viele Gründe Pflichten der Gemeinde Handlungsmöglichkeiten
Projektbeschreibung (als Anlage zum Förderantrag)
 Projektbeschreibung (als Anlage zum Förderantrag) Projekttitel: Entwicklungsstudie Bretterschachten Antragsteller: Markt Bodenmais, Bahnhofstraße 56, 94249 Bodenmais Gesamtkosten: ca. 20.000,- LAG: ARBERLAND
Projektbeschreibung (als Anlage zum Förderantrag) Projekttitel: Entwicklungsstudie Bretterschachten Antragsteller: Markt Bodenmais, Bahnhofstraße 56, 94249 Bodenmais Gesamtkosten: ca. 20.000,- LAG: ARBERLAND
Gemeindeorientierte Frühintervention bei Sucht, Gewalt und sozialer Ausgrenzung Jugendlicher Ein Programm im Auftrag des BAG
 Gemeindeorientierte Frühintervention bei Sucht, Gewalt und sozialer Ausgrenzung Jugendlicher Ein Programm im Auftrag des BAG 01.11.2007 28.02.2011 Konzept Kurzversion Auftraggeber: Bundesamt für Gesundheit
Gemeindeorientierte Frühintervention bei Sucht, Gewalt und sozialer Ausgrenzung Jugendlicher Ein Programm im Auftrag des BAG 01.11.2007 28.02.2011 Konzept Kurzversion Auftraggeber: Bundesamt für Gesundheit
AG JONEN AKTIV, ATTRAKTIV, LEBENDIG. Jonen
 JONEN AKTIV, ATTRAKTIV, LEBENDIG Eine Gemeinde in die Zukunft zu führen, bedarf der Mitarbeit aller. Das Leitbild der Gemeinde Jonen dient als Fundament für die weitere Entwicklung des Dorfes. Es setzt
JONEN AKTIV, ATTRAKTIV, LEBENDIG Eine Gemeinde in die Zukunft zu führen, bedarf der Mitarbeit aller. Das Leitbild der Gemeinde Jonen dient als Fundament für die weitere Entwicklung des Dorfes. Es setzt
Ernährungssouveränität
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Alpenkonvention: Plattform Landwirtschaft Ein Diskussionsbeitrag seitens Schweiz zum Thema Ernährungssouveränität
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Alpenkonvention: Plattform Landwirtschaft Ein Diskussionsbeitrag seitens Schweiz zum Thema Ernährungssouveränität
Niedersächsisches Ministerium für f r Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
 EFRE-Förderung Erneuerung und Entwicklung städtischer Gebiete in Niedersachsen ab 2007 im Zielgebiet Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung RWB Ein Überblick Katy Renner-Köhne Inhalt Einordnung
EFRE-Förderung Erneuerung und Entwicklung städtischer Gebiete in Niedersachsen ab 2007 im Zielgebiet Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung RWB Ein Überblick Katy Renner-Köhne Inhalt Einordnung
Alpenweite Qualitätsstandards für naturnahen Tourismus
 ILF-Tagung 2014, 29. Oktober 2014 Alpenweite Qualitätsstandards für naturnahen Tourismus Lea Ketterer Bonnelame Dominik Siegrist ILF Institut für Landschaft und Freiraum INHALT Naturnaher Tourismus: Definition
ILF-Tagung 2014, 29. Oktober 2014 Alpenweite Qualitätsstandards für naturnahen Tourismus Lea Ketterer Bonnelame Dominik Siegrist ILF Institut für Landschaft und Freiraum INHALT Naturnaher Tourismus: Definition
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT
 INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
Antrag zur Korrektur der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)- Anleitung
 Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Landwirtschaftsamt Antrag zur Korrektur der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)- Anleitung Ablauf des Verfahrens: 1. Der Bewirtschafter reicht per E-Mail oder
Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Landwirtschaftsamt Antrag zur Korrektur der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)- Anleitung Ablauf des Verfahrens: 1. Der Bewirtschafter reicht per E-Mail oder
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Richtlinie Objektschutz Hochwasser
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Richtlinie Objektschutz Hochwasser Vorentwurf, Fassung vom 1. Juli 015 Rechtliche Bedeutung Die Richtlinie Objektschutz Hochwasser ist
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Richtlinie Objektschutz Hochwasser Vorentwurf, Fassung vom 1. Juli 015 Rechtliche Bedeutung Die Richtlinie Objektschutz Hochwasser ist
REGLEMENT FÜR DIE EVENT- UND TOURISMUSORGANISATION IN SAMEDAN. I. Allgemeine Bestimmungen
 10.104 REGLEMENT FÜR DIE EVENT- UND TOURISMUSORGANISATION IN SAMEDAN Gestützt auf Art. 49 Ziffer 1 der Gemeindeverfassung von Samedan erlassen am 16. September 2008 I. Allgemeine Bestimmungen Art. 1 Dieses
10.104 REGLEMENT FÜR DIE EVENT- UND TOURISMUSORGANISATION IN SAMEDAN Gestützt auf Art. 49 Ziffer 1 der Gemeindeverfassung von Samedan erlassen am 16. September 2008 I. Allgemeine Bestimmungen Art. 1 Dieses
Positionspapier Schulleitung
 Positionspapier Schulleitung Mit diesem Positionspapier formuliert der VSLCH sein Berufsverständnis und klärt die Rollen der lokalen Schulbehörde, der Schulleitungen und der Lehrpersonen. Schulen brauchen
Positionspapier Schulleitung Mit diesem Positionspapier formuliert der VSLCH sein Berufsverständnis und klärt die Rollen der lokalen Schulbehörde, der Schulleitungen und der Lehrpersonen. Schulen brauchen
Verordnung des EDI über das Förderungskonzept für die Leseförderung
 Verordnung des EDI über das Förderungskonzept für die Leseförderung vom 5. Juli 2016 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), gestützt auf Artikel 28 Absatz 1 des Kulturförderungsgesetzes vom 11.
Verordnung des EDI über das Förderungskonzept für die Leseförderung vom 5. Juli 2016 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), gestützt auf Artikel 28 Absatz 1 des Kulturförderungsgesetzes vom 11.
Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern
 Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern 1. Juni 2015, Brüssel Anton Dippold Umsetzung der ELER-VO in Bayern Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt
Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern 1. Juni 2015, Brüssel Anton Dippold Umsetzung der ELER-VO in Bayern Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt
Faktenblatt BLN / Nr. 1 September 2014
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Sektion Landschaftsmanagement Faktenblatt BLN / Nr. 1
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Sektion Landschaftsmanagement Faktenblatt BLN / Nr. 1
1. Z U K U N F T S W E R K S T A T T 24. November 2012
 Kanton Aargau Gemeinde Ehrendingen «Gemeinsam im Dialog» ZUKUNFTSWERKSTATT 1. Z U K U N F T S W E R K S T A T T 24. November 2012 1 Grundsätzliches 2 Positionierungen 3 Ehrendingen heute, Stärken und Schwächen
Kanton Aargau Gemeinde Ehrendingen «Gemeinsam im Dialog» ZUKUNFTSWERKSTATT 1. Z U K U N F T S W E R K S T A T T 24. November 2012 1 Grundsätzliches 2 Positionierungen 3 Ehrendingen heute, Stärken und Schwächen
Es freut mich, dass ich die heutige Tagung als Präsident der Bau, Planungs und Umweltdirektorenkonferenz eröffnen kann. Dies aus drei Gründen:
 1 Es freut mich, dass ich die heutige Tagung als Präsident der Bau, Planungs und Umweltdirektorenkonferenz eröffnen kann. Dies aus drei Gründen: Erstens sind die Gewässer ein Thema, das bewegt. Der Schutz
1 Es freut mich, dass ich die heutige Tagung als Präsident der Bau, Planungs und Umweltdirektorenkonferenz eröffnen kann. Dies aus drei Gründen: Erstens sind die Gewässer ein Thema, das bewegt. Der Schutz
Verordnung über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik
 Verordnung über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik 901.022 vom 28. November 2007 (Stand am 1. Januar 2013) Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 12 Absatz
Verordnung über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik 901.022 vom 28. November 2007 (Stand am 1. Januar 2013) Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 12 Absatz
Gefährliche Arbeiten oder Arbeiten mit einem hohen Gefahrenpotenzial
 Gefährliche Arbeiten oder Arbeiten mit einem hohen Gefahrenpotenzial Begleitende Massnahmen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Lernende zwischen 15 und 18 Jahren Aufgaben der Kantone in Betrieben
Gefährliche Arbeiten oder Arbeiten mit einem hohen Gefahrenpotenzial Begleitende Massnahmen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Lernende zwischen 15 und 18 Jahren Aufgaben der Kantone in Betrieben
Daten- u. Darstellungsmodell DDM Strukturverbesserungen / GIS-Services BLW
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft suissemelio Fachtagung 16.06.2015 Daten- u. Darstellungsmodell DDM Strukturverbesserungen / GIS-Services
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft suissemelio Fachtagung 16.06.2015 Daten- u. Darstellungsmodell DDM Strukturverbesserungen / GIS-Services
Verordnung zum Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juli 1979 (Raumplanungsverordnung)
 700. Verordnung zum Bundesgesetz über die Raumplanung vom. Juli 979 (Raumplanungsverordnung) vom 4. Dezember 98 Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, gestützt auf Art. 6 Abs. des Bundesgesetzes vom.
700. Verordnung zum Bundesgesetz über die Raumplanung vom. Juli 979 (Raumplanungsverordnung) vom 4. Dezember 98 Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, gestützt auf Art. 6 Abs. des Bundesgesetzes vom.
Naturschutz in Gemeinden
 Eine Pusch-Tagung Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden Montag, 19. September 2016, 9.15 Uhr bis 16.30 Uhr, Volkshaus, Zürich PUSCH PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ Ökologische Infrastruktur:
Eine Pusch-Tagung Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden Montag, 19. September 2016, 9.15 Uhr bis 16.30 Uhr, Volkshaus, Zürich PUSCH PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ Ökologische Infrastruktur:
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen
 Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO 2-Verordnung) Änderung vom 22. Juni 2016 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die CO 2-Verordnung vom 30. November 2012 1 wird wie folgt geändert:
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO 2-Verordnung) Änderung vom 22. Juni 2016 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die CO 2-Verordnung vom 30. November 2012 1 wird wie folgt geändert:
Arbeitsgruppe GIS-Strukturverbesserungen Zwischenbericht 4
 Präsentation vom 2.März 2011 suissemelio, Fachtagung 18. Juni 2014, Olten Arbeitsgruppe GIS-Strukturverbesserungen Zwischenbericht 4 Daten- und Darstellungsmodell Werner Wehrli, Strukturverbesserungen
Präsentation vom 2.März 2011 suissemelio, Fachtagung 18. Juni 2014, Olten Arbeitsgruppe GIS-Strukturverbesserungen Zwischenbericht 4 Daten- und Darstellungsmodell Werner Wehrli, Strukturverbesserungen
BKS JUGEND. Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau
 BKS JUGEND Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau Dieses Leitbild ist im Auftrag des Regierungsrates entstanden aus der Zusammenarbeit der regierungsrätlichen Jugendkommission und der kantonalen Fachstelle
BKS JUGEND Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau Dieses Leitbild ist im Auftrag des Regierungsrates entstanden aus der Zusammenarbeit der regierungsrätlichen Jugendkommission und der kantonalen Fachstelle
Marketingkonzeption zur Umsetzung von Projekten in den Landes Kanu- Verbänden und Vereinen im Freizeitund Kanuwandersport
 Marketingkonzeption zur Umsetzung von Projekten in den Landes Kanu- Verbänden und Vereinen im Freizeitund Kanuwandersport DKV-Verbandsausschuss, Mainz, 17.11.2007 Hermann Thiebes DKV-Vizepräsident Freizeit-
Marketingkonzeption zur Umsetzung von Projekten in den Landes Kanu- Verbänden und Vereinen im Freizeitund Kanuwandersport DKV-Verbandsausschuss, Mainz, 17.11.2007 Hermann Thiebes DKV-Vizepräsident Freizeit-
REGIONALE STRATEGIEN FÜR DIE WASSERKRAFTNUTZUNG UND DEN SCHUTZ DER GEWÄSSER. Standpunkt der Arbeitsgruppe Dialog Wasserkraft
 REGIONALE STRATEGIEN FÜR DIE WASSERKRAFTNUTZUNG UND DEN SCHUTZ DER GEWÄSSER Standpunkt der Arbeitsgruppe Dialog Wasserkraft Version vom 27. September 2010 Die Interessen an den Gewässern sind vielfältig.
REGIONALE STRATEGIEN FÜR DIE WASSERKRAFTNUTZUNG UND DEN SCHUTZ DER GEWÄSSER Standpunkt der Arbeitsgruppe Dialog Wasserkraft Version vom 27. September 2010 Die Interessen an den Gewässern sind vielfältig.
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli
 Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan)
 Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
SCHÜTZEN FÖRDERN BETEILIGEN. Programm Kinder- und Jugendpolitik Kanton Schaffhausen. Kurzfassung
 SCHÜTZEN FÖRDERN BETEILIGEN Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018 Kanton Schaffhausen Kurzfassung VORWORT Am 1. Januar 2013 trat das Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit
SCHÜTZEN FÖRDERN BETEILIGEN Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018 Kanton Schaffhausen Kurzfassung VORWORT Am 1. Januar 2013 trat das Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit
s Parlamentarische Initiative. Schutz und Nutzung der Gewässer (UREK-S) (Differenzen)
 Ständerat Herbstsession 009 e-parl 8.06.009 - - :30 07.9 s Parlamentarische Initiative. Schutz und Nutzung der Gewässer (UREK-S) (Differenzen) Entwurf der für Umwelt, Energie und Raumplanung des Bundesrates
Ständerat Herbstsession 009 e-parl 8.06.009 - - :30 07.9 s Parlamentarische Initiative. Schutz und Nutzung der Gewässer (UREK-S) (Differenzen) Entwurf der für Umwelt, Energie und Raumplanung des Bundesrates
Handbuch für Schulräte und Schulleitungen. Die Schulen legen im Schulprogramm periodisch fest, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen wollen.
 SCHULPROGRAMM 1. Bestimmungen Bildungsgesetz 59 Bildungsgesetz 1 Die Schulen legen im Schulprogramm periodisch fest, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen wollen. 2 Das Schulprogramm gibt insbesondere
SCHULPROGRAMM 1. Bestimmungen Bildungsgesetz 59 Bildungsgesetz 1 Die Schulen legen im Schulprogramm periodisch fest, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen wollen. 2 Das Schulprogramm gibt insbesondere
Kräfte bündeln Regionen stärken Chancen durch die neuen Förderprogramme für die steirischen Regionen
 Landeshauptmann-Stv. Mag. Michael Schickhofer PRESSEINFORMATION 12.11.2015 Kräfte bündeln Regionen stärken Chancen durch die neuen Förderprogramme für die steirischen Regionen Kräfte bündeln Regionen stärken
Landeshauptmann-Stv. Mag. Michael Schickhofer PRESSEINFORMATION 12.11.2015 Kräfte bündeln Regionen stärken Chancen durch die neuen Förderprogramme für die steirischen Regionen Kräfte bündeln Regionen stärken
Vorwort. Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.
 Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Landschaftspflege in M-V Aspekte des Umgangs mit Kulturlandschaft
 Landschaftspflege in M-V Aspekte des Umgangs mit Kulturlandschaft Landschaftspflege in M-V Aspekte des Umgangs mit Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommern ist ganz überwiegend ländliche Kulturlandschaft
Landschaftspflege in M-V Aspekte des Umgangs mit Kulturlandschaft Landschaftspflege in M-V Aspekte des Umgangs mit Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommern ist ganz überwiegend ländliche Kulturlandschaft
Kanton Zürich Gesundheitsdirektion Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz (SPFG)
 Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz (SPFG) Medienkonferenz vom 28. Januar 2011 mit Thomas Heiniger, Gesundheitsdirektor Martin Brunnschweiler, Generalsekretär Hanspeter Conrad, Leiter Finanzen und
Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz (SPFG) Medienkonferenz vom 28. Januar 2011 mit Thomas Heiniger, Gesundheitsdirektor Martin Brunnschweiler, Generalsekretär Hanspeter Conrad, Leiter Finanzen und
Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs
 74. Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom. September 988 (Stand. Januar 00). Allgemeines Grundsatz Kanton und Ortsgemeinden fördern unter Berücksichtigung volks- und betriebswirtschaftlicher
74. Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom. September 988 (Stand. Januar 00). Allgemeines Grundsatz Kanton und Ortsgemeinden fördern unter Berücksichtigung volks- und betriebswirtschaftlicher
Pflegefinanzierung im Kanton Thurgau
 Sozialversicherungszentrum Thurgau Pflegefinanzierung im Kanton Thurgau Sozialversicherungszentrum Thurgau St. Gallerstrasse 11, Postfach 8501 Frauenfeld T 058 225 75 75, F 058 225 75 76 www.svztg.ch Öffnungszeiten:
Sozialversicherungszentrum Thurgau Pflegefinanzierung im Kanton Thurgau Sozialversicherungszentrum Thurgau St. Gallerstrasse 11, Postfach 8501 Frauenfeld T 058 225 75 75, F 058 225 75 76 www.svztg.ch Öffnungszeiten:
NETZWERK NACHHALTIGES BAUEN SCHWEIZ NNBS
 NETZWERK NACHHALTIGES BAUEN SCHWEIZ NNBS Novatlantis Bauforum 27. August 2013, Zürich Joe Luthiger, NNBS Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS Bestandteil der vierten Strategie «Nachhaltige Entwicklung»
NETZWERK NACHHALTIGES BAUEN SCHWEIZ NNBS Novatlantis Bauforum 27. August 2013, Zürich Joe Luthiger, NNBS Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS Bestandteil der vierten Strategie «Nachhaltige Entwicklung»
REGLEMENT ÜBER KOMMUNALE BEWIRTSCHAFTUNGSBEITRÄGE FÜR NATURSCHUTZLEISTUNGEN INVENTARISIERTER NATURSCHUTZOBJEKTE
 300.03.0 Rgl Nat REGLEMENT ÜBER KOMMUNALE BEWIRTSCHAFTUNGSBEITRÄGE FÜR NATURSCHUTZLEISTUNGEN INVENTARISIERTER NATURSCHUTZOBJEKTE vom 8. Juni 0 in Kraft ab. November 0 Stadthaus Märtplatz 9 Postfach 8307
300.03.0 Rgl Nat REGLEMENT ÜBER KOMMUNALE BEWIRTSCHAFTUNGSBEITRÄGE FÜR NATURSCHUTZLEISTUNGEN INVENTARISIERTER NATURSCHUTZOBJEKTE vom 8. Juni 0 in Kraft ab. November 0 Stadthaus Märtplatz 9 Postfach 8307
Kinder- und Jugendpolitik in der Schweiz : Fragen, Herausforderungen und Perspektiven
 Kinder- und Jugendpolitik in der Schweiz : Fragen, Herausforderungen und Perspektiven Pierre Maudet, Präsident der EKKJ Inputreferat an der Jahresversammlung der SODK, 21.05.2015, Thun In der Schweiz geht
Kinder- und Jugendpolitik in der Schweiz : Fragen, Herausforderungen und Perspektiven Pierre Maudet, Präsident der EKKJ Inputreferat an der Jahresversammlung der SODK, 21.05.2015, Thun In der Schweiz geht
Unterstützungs- und Beratungsangebot zur Erarbeitung eines kantonalen Tabakpräventionsprogramms
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG Tabakpräventionsfonds Unterstützungs- und Beratungsangebot zur Erarbeitung eines kantonalen Tabakpräventionsprogramms 1/5 VORWORT
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG Tabakpräventionsfonds Unterstützungs- und Beratungsangebot zur Erarbeitung eines kantonalen Tabakpräventionsprogramms 1/5 VORWORT
Gut umsorgt. Dank koordinierter Gesundheitsversorgung.
 Gut umsorgt. Dank koordinierter Gesundheitsversorgung. Wenn alles auf einmal kommt. Die Besuche beim Arzt. Die Betreuung durch die Spitex. Die Rechnung vom Spital. Die Kostenbeteiligung der Krankenkasse.
Gut umsorgt. Dank koordinierter Gesundheitsversorgung. Wenn alles auf einmal kommt. Die Besuche beim Arzt. Die Betreuung durch die Spitex. Die Rechnung vom Spital. Die Kostenbeteiligung der Krankenkasse.
Der Platz der schweizerischen Landwirtschaft in der Wirtschaft und der Gesellschaft. Argumente für die Schweizer Landwirtschaft SBV/USP.
 Der Platz der schweizerischen Landwirtschaft in der Wirtschaft und der Gesellschaft Argumente für die Schweizer Landwirtschaft 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 2. CH-Landwirtschaft in Zahlen 3. Landwirtschaft
Der Platz der schweizerischen Landwirtschaft in der Wirtschaft und der Gesellschaft Argumente für die Schweizer Landwirtschaft 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 2. CH-Landwirtschaft in Zahlen 3. Landwirtschaft
Vergütungsreglement der Verwaltungskommission und der Geschäftsleitung der SVA Aargau
 Vergütungsreglement der Verwaltungskommission und der Geschäftsleitung der SVA Aargau Vom 28. Oktober 2015 Die Verwaltungskommission der SVA Aargau, gestützt auf 5 des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen
Vergütungsreglement der Verwaltungskommission und der Geschäftsleitung der SVA Aargau Vom 28. Oktober 2015 Die Verwaltungskommission der SVA Aargau, gestützt auf 5 des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen
Konzept Nachhaltige Entwicklung BFH / AGNE / Juni Berner Fachhochschule
 Berner Fachhochschule Konzept Nachhaltige Entwicklung der BFH (Von der Fachhochschulleitung an ihrer Sitzung vom 10. August 2010 genehmigt und im Anhang 2011 zum Leistungsvertrag 2009 2012 mit den Departementen
Berner Fachhochschule Konzept Nachhaltige Entwicklung der BFH (Von der Fachhochschulleitung an ihrer Sitzung vom 10. August 2010 genehmigt und im Anhang 2011 zum Leistungsvertrag 2009 2012 mit den Departementen
Ländliche Entwicklung in Bayern
 Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken Ländliche Entwicklung in Bayern Auftaktveranstaltung Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept Schwarzachtalplus Alexander Zwicker 17. November 2012 Information
Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken Ländliche Entwicklung in Bayern Auftaktveranstaltung Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept Schwarzachtalplus Alexander Zwicker 17. November 2012 Information
Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft
 Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV) vom 4. April 2001 Der Schweizerische Bundesrat,
Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV) vom 4. April 2001 Der Schweizerische Bundesrat,
Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen
 Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen Für folgende Themenbereiche haben wir Leitlinien formuliert: 1. Wichtige Querschnittsanliegen 2. Gemeinwesen und Kultur
Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen Für folgende Themenbereiche haben wir Leitlinien formuliert: 1. Wichtige Querschnittsanliegen 2. Gemeinwesen und Kultur
Basiswert Übergangsbeitrag - Details der Berechnung
 Volkswirtschaftsdirektion Landwirtschaftsamt Merkblatt Basiswert Übergangsbeitrag - Details der Berechnung Juli 2014 1. Übergangsbeitrag Basiswert: Der Basiswert wird 2014 einmalig für jeden Betrieb festgelegt.
Volkswirtschaftsdirektion Landwirtschaftsamt Merkblatt Basiswert Übergangsbeitrag - Details der Berechnung Juli 2014 1. Übergangsbeitrag Basiswert: Der Basiswert wird 2014 einmalig für jeden Betrieb festgelegt.
Hinschauen und Handeln Frühintervention in Gemeinden. Pilotphase 2006 / 2007 Kurzbeschrieb
 Hinschauen und Handeln Frühintervention in Gemeinden Pilotphase 2006 / 2007 Kurzbeschrieb 1. Die kommunale Strategie zur Frühintervention Was bedeutet Frühintervention? Frühintervention bedeutet die frühzeitige,
Hinschauen und Handeln Frühintervention in Gemeinden Pilotphase 2006 / 2007 Kurzbeschrieb 1. Die kommunale Strategie zur Frühintervention Was bedeutet Frühintervention? Frühintervention bedeutet die frühzeitige,
Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der EG-HWRM-RL und EG- WRRL
 19. Gewässersymposium Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der EG-HWRM-RL und EG- WRRL Corinna Baumgarten - Umweltbundesamt Abteilung
19. Gewässersymposium Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der EG-HWRM-RL und EG- WRRL Corinna Baumgarten - Umweltbundesamt Abteilung
Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden gebührenfinanzierter Lokalradios-
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Kommunikation BAKOM Abteilung Medien Sektion Grundlagen Medien BAKOM 15. August 2016 Finanzhilfen für die Aus-
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Kommunikation BAKOM Abteilung Medien Sektion Grundlagen Medien BAKOM 15. August 2016 Finanzhilfen für die Aus-
Älter werden in Münchenstein. Leitbild der Gemeinde Münchenstein
 Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
