8. Pflegefamilientag Dokumentation vom
|
|
|
- Irma Catharina Fürst
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 8. Pflegefamilientag Dokumentation vom /1 Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung
2 8. Pflegefamilientag Dokumentation vom
3 Herausgeber: Stadt Leipzig Der Oberbürgermeister Amt für Jugend, Familie und Bildung, 1. Auflage 01 Verantwortlich: Siegfried Haller Redaktion: Angelika Weires Titelfoto und Fotos: Florian Pappert Layout und Satz: Annett König Verlag: Stadt Leipzig/Amt für Jugend, Familie und Bildung Redaktionsschluss: Anschrift: Stadt Leipzig Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Str Leipzig Telefon: Fax: jugend-familie-bildung@leipzig.de Internet: Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit Quellenangabe gestattet.
4 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4. Veranstaltungsbericht 5.1 Begrüßung und Einführung 5. Fachvortrag 6.3 Gesprächsgruppen Gesprächsgruppe Gesprächsgruppe Gesprächsgruppe Gesprächsgruppe Präsentation der Ergebnisse 0 3. Kinderbetreuung Kinderprogramm im OFT Völkerfreundschaft 1 3. Kinderprogramm im OFT Am Mühlholz 4. Danke 3
5 1 1. Einleitung Am fand der 8. Leipziger Pflegefamilientag im Offenen Freizeittreff Völkerfreundschaft in Leipzig-Grünau statt. 10 Pflegepersonen, 40 Fachkräfte der Jugendhilfe und 60 Pflegekinder und Pflegegeschwister waren der Einladung des Pflegekinderdienstes gefolgt, um einen interessanten Tag miteinander zu verbringen. Während Pflegeeltern und Fachleute dem Fachvortrag des Diplom-Psychologen Kay-Uwe Fock zum Thema Trennungsbewältigung und Trauerbewältigung in der Pflegefamilie vielfältige Impulse entnehmen konnten und dieses Thema in Arbeitsgruppen unter verschiedenen Aspekten diskutierten, verbrachten die Kinder ab 5 Jahren einen aufregenden Tag im Freitzeittreff Mühlholz, der unter Mitwirkung der Mitarbeiter des Freizeittreffs von der Branddirektion Leipzig, der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Süd und der Jugendfeuerwehr Leipzig-Süd gestaltet wurde. Die jüngeren Kinder, die im Freizeittreff Völkerfreundschaft verblieben waren, wurden von Sportlern des Kindersportzentrum SC DHfK Leipzig e. V. mit spannenden und entspannenden Spielen beschäftigt. Tatkräftige Unterstützung in der Kinderbetreuung leisteten Erzieherinnen aus Leipziger Kindertagesstätten und Horten. 4
6 . Veranstaltungsbericht.1 Begrüßung und Einführung Der Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Bildung, Her Haller begrüßte die Besucher und dankte den Pflegeeltern für ihr Engagement und sprach ihnen, auch im Namen des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung, Dank und gesellschaftliche Anerkennung aus. In den vergangenen 10 Jahren seien in Leipzig fast 100 Pflegefamilien neu gewonnen worden, die sich tagtäglich darum bemühen, die Probleme von Kindern zu lösen, die es nicht leicht haben. Die Abteilungsleiterin Hoheitliche Jugendhilfe im Amt für Jugend, Familie und Bildung, Petra Stibane, begrüßte die Pflegeeltern im Namen des Pflegekinderdienstes und stellte den Programmablauf vor. 5
7 . Fachvortrag Der Hamburger Diplom-Psychologe, Supervisor und Mitarbeiter der Beratungsstelle Freunde der Kinder e. V. hielt den Fachvortrag zum Themenschwerpunkt des 8. Pflegefamilientages. Kay-Uwe Fock ist langjährig in der Beratung, Psychotherapie und Fortbildung von Pflege- und Adoptiveltern tätig. Als Autor hat er regelmäßig Veröffentlichungen z. B. im Blickpunkt Pflegekinder, PFAD, Paten, Familienhandbuch.de. Seit 1993 ist er in der Vortrags- und Seminartätigkeit für Fachkräfte und Pflege- und Adoptiveltern tätig. Vortrag: Chancen für das Pflegekind Trennungsbewältigung und Trauerverarbeitung in der Pflegefamilie Kay-Uwe Fock von Freunde der Kinder e. V. illustriert die Belastungen bei Trennungen und Übergängen und gibt Hinweise, wie die Erwachsenen das Kind entlasten können. Die Trennung von den leiblichen Eltern ist er erste Übergang, den ein Pflegekind erlebt. Diese Trennung ist für jedes Kind äußerst schmerzhaft und verletzend. Menschen werden so unreif geboren, dass ihr Überleben von Erwachsenen abhängt. So sehr sich Erwachsene auch bemühen, die Not des Kindes zu mildern, diese erste Trennung ist für das Kind niemals schmerzfrei zu gestalten. Bitte erinnern Sie sich einmal kurz an Ihren schlimmsten Liebeskummer. Stellen Sie sich vor, der Schmerz wäre zehnmal so schlimm und sie hätten noch keine geistigen Werkzeuge, um zu verstehen, was vor sich geht. Dann können sie sich die Belastung des Kindes durch einen Verlust der Bezugspersonen vielleicht vorstellen. Jedes Pflegekind und jedes Adoptivkind hat die Trennung von seinen Eltern erlebt. Die Kinder kommen mit einem unsicheren oder hochbeängstigenden inneren Bindungsmodell in die Pflegefamilie. Was brauchen diese Kinder zur Trennungsbewältigung am dringendsten? Sie brauchen ein sicheres Bindungsangebot in der Pflegefamilie. Man spricht dann von erworbener Bindungssicherheit. Erst wenn sie sich in der Pflegefamilie innerlich hinreichend sicher fühlen, können sie sich Kay-Uwe Fock auch gefühlsmäßig mit dem Trennungsschmerz auseinandersetzen. Ausbleibende Trennungsreaktion John Bowlby 1 beobachtete bei Kindern zwi schen 1,5 und 3 Jahren mit einer einigermaßen befriedigenden Beziehung zur Mutter folgende Phasen der Trennungsreaktion: 1. Angst: Das Kind protestiert, schreit und weint und wehrt sich mit allen Kräften gegen die Tren nung. Es ist wütend und kämpft um die Wiedergewinnung der geliebten Person. Es nimmt keinen Trost von anderen an.. Verzweiflung: Das Kind ist ruhiger, seine Hoffnung auf Wiederkehr der Mutter ist geschwunden. Es ist innerlich mit dem Verlust beschäftigt und es ist verzweifelt. Diese Verzweiflung kann wie der in Auflehnung umschlagen oder in Apathie übergehen. 1 Bowlby, John: Trennung, Angst und Zorn, München 006 (Ernst Reinhard Verlag). 6
8 3. Loslösung: Das Kind scheint seine Mutter zu vergessen, wenn sie dann wiederkommt, zeigt es merk würdig wenig Interesse (Bowlby) für sie oder scheint sie nicht einmal zu erkennen. In allen drei Phasen können heftige Anfälle von Wut und Destruktivität auftreten. Nach der Wiedervereinigung mit der Bindungsperson zeigten sich die Kinder sehr alarmbereit gegenüber erneuten, auch kleinen Trennungen (exzessives Klammern) und leicht reizbar in Bezug auf wütende Ausbrüche (über das Verlassenwordensein). Diese Alarmbereitschaft der Kinder reduzierte sich nach und nach und die Kinder fassten wieder Vertrauen in die Beziehung zu den Eltern. Interessanterweise zeigen spätere Pflegekinder bei der Herausnahme diese Trennungsreaktion äußerst selten. Sie erkunden das Kinderschutzhaus scheinbar angstfrei und gehen auf fremde Erwachsene unangemessen vertrauensvoll zu. Auch in der Pflegefamilie zeigen sie Angst und Verzweiflung über die Trennung anfangs sehr selten. Erst wenn sie innerlich in der Pflegefamilie angekommen sind, können sie lernen, sich ihren Gefühlen zu stellen und sie zu verarbeiten. Frühe Trennungen gelten als Risikofaktor für die weitere Persönlichkeitsentwicklung. Das Kind erlebt bei der Trennung massiven, beängstigenden Kontrollverlust. Um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen, entwickelt es Kontroll- und Abwehrstrategien. Erlebt es wiederholt Trennungen, können seine Bereitschaft und seine Fähigkeit, Vertrauen in Bezugspersonen zu fassen, zerstört werden. Und die Erinnerungen an frühe, bedrohliche Trennungen wirken weiter: Spätere Übergänge, die das Kind bewältigen muss, können alte Gefühle von Ausgeliefertsein, Ohnmacht und Panik wecken und ihm den Übergang als unüberwindlich erscheinen lassen. So besteht die Gefahr, dass im Lebenslauf immer wieder Brüche auftreten. Trotz dieser Risiken war die Trennung für die späteren Pflegekinder unumgänglich. Ihr Wohl, oft sogar ihr Überleben war in der Herkunftsfamilie gefährdet. Der Übergang in eine Pflegefamilie bietet ihnen die Chance, Bedingungen zu finden, die ihnen erlauben, ihre Entwicklungspotentiale auszuschöpfen. Trennungsbewältigung So wie der Körper vom Moment einer Verletzung an Kräfte bereitstellt, diese zu heilen, mobilisiert der kindliche Organismus Kräfte, die durch die Trennung verursachte seelische Verletzung zu bewältigen. Daher ist die emotionale Nachbereitung dieser ersten Trennung sowohl eine Aufgabe der Pflegefamilie, als auch eine individuelle Aufgabe des Pflegekindes in seinem weiteren Lebenslauf. 3 Ob die Bewältigung einer Trennung gelingt, hängt nicht nur vom Alter des Kindes, dem Ablauf und den Umständen der Trennung ab. Für das Kind besteht der wichtigste Schutzfaktor nach der Trennung darin, eine neue, möglichst sichere und vertrauensvolle Bindung zu den annehmenden Eltern aufzubauen, in der es Unterstützung und Trost in seinem Kummer erfährt. 4 Darüber hinaus braucht es verständliche Erklärungen, die ihm Orientierung geben. Maywald, Jörg: Zwischen Trauma und Chance Trennungen von Kinder im Familienkonflikt, Freiburg 1997 (Lambertus Verlag) 3 Die Rolle der Fachkräfte wird in den Empfehlungen des PFAD Bundesverbandes skizziert: Kindgemäße Gestaltung von Übergangen, in: Blickpunkt Pflegekinder 1/009, S.4 ff. 4 Fock, Kay-Uwe: Trennung als Entwicklungsrisiko, in: Blickpunkt Pflegekinder 3/1995 7
9 Verarbeitung von Verlusten: Das soziale Netz hilft mit! In Untersuchungen zeigte sich, dass sich Waisen- und Scheidungskinder in der Bewältigung der Trennung unterschieden. Waisenkinder zeigten in der Nachuntersuchung weniger Probleme als Scheidungskinder. Woran liegt das? Hier ist die soziale Unterstützung bedeutsam: Bei der Trennung durch den Tod gibt es ein aufgeschlossenes Klima für auftretende Trauer, Wut und Verzweiflung. Das gesamte soziale Netzwerk reagiert einfühlsam und unterstützend auf Waisenkinder. Es gibt anerkannte Modelle und Rituale der Trauerverarbeitung wie Trauerfeier, Trauerzeit und Abschiedsrituale. Auch wenn der überlebende Elternteil durch eigene Trauer in seiner Verfügbarkeit für das Kind eingeschränkt ist, gerät er durch die Trauer des Kindes meist nicht selbst in einen inneren Konflikt. Scheidungskinder erleben, dass der Elternteil, bei dem sie bleiben, Konflikte mit dem getrennten Elternteil hat. Sie fühlen sich oft genötigt, Partei zu ergreifen und geraten in Loyalitätskonflikte. Viele von ihnen geben sich selbst die Schuld an der Trennung der Eltern. Der abwesende Elternteil ist zur Unterstützung der Verarbeitung nicht verfügbar. Der verbleibende Elternteil steht dem Kind wegen eigener Konflikte mit dem getrennten Partner nur eingeschränkt als Ansprechpartner und Trostinstanz zur Verfügung. Auch die soziale Umwelt reagiert zurückhaltend auf das Leid des Kindes: es herrscht Betroffenheit, Modelle für Anteilnahme und feinfühlige Reaktionen auf die inneren Konflikte fehlen. So bleibt das Kind mit seiner Not häufig allein. Pflegekinder befinden sich nach der Trennung in einer noch verworreneren und verwirrenden Situation: Sie haben alles Vertraute verloren und empfinden Kummer, Schmerz, Verzweiflung und Wut. Für die Verarbeitung dieser Gefühle steht ihnen jedoch anfangs noch niemand zu Verfügung, sie haben noch keine sicheren Beziehungen. Sie lösen sich von den leiblichen Eltern ab, ohne ihre Gefühle zu verarbeiten. Ihr vordringliches Ziel nach dem Verlust und der Ablösung ist es, neue Bezugspersonen zu finden. Da es keine Modelle für die Bewältigung dieser Eltern-Verlust-Krise gibt, wird in jeder Pflegefamilie ein eigener Weg der Nachbearbeitung gesucht. Gerade für Pflegekinder fehlt auch das öffentliche Wissen. Ihre neue soziale Umgebung verfügt über keine Vorbilder, um das Kind in der Verarbeitung seiner ambivalenten und schmerzhaften Gefühle zu unterstützen. Gestaltungsspielräume Leibliche Eltern, Fachkräfte und annehmende Eltern haben je nach Situation des Kindes unterschiedliche Gestaltungsspielräume, um die Trennung für das Kind möglichst schonend zu gestalten. Befindet sich das Kind in einer gefährdenden Situation und muss schnell in Obhut genommen werden, bleibt wenig Zeit, die Trennung anzubahnen und das Kind vorzubereiten. Wird ein Kind gegen Willen der Eltern aus der Familie genommen wird, werden die selten in der Lage sein, ihm eine Brücke zu bauen. Befindet sich das Kind jedoch im Kinderschutzhaus oder in einer Bereitschaftspflegefamilie, kann bei diesem zweiten Wechsel eine altersgemäße Anbahnung durchgeführt werden. Das Kind kann Vertrauen in die neuen Bezugspersonen fassen und auch seine neue Umwelt erkunden, bevor es zu einem Übergang kommt. Wenn die Erwachsenen feinfühlig auf die Signale des Kindes reagieren, können sie ihm trotz der Belastung ein Gefühl von Kontrolle vermitteln. 8
10 Was können Fachkräfte tun? Anforderungen an die Hilfeplanung Je nachdem wo und in welcher Beziehungskonstellation sich das Kind befindet, gelten unterschiedliche Prämissen: Bei der Herausnahme eines Kindes aus der Herkunftsfamilie liegen in der Regel schwerwiegende Gründe vor. Dann sollte die Herausnahme unverzüglich erfolgen, damit Gefährdung und Not des Kindes beendet werden. Gleichzeitig sollten die Fachkräfte gemeinsam mit den leiblichen Eltern eine Verbleibensperspektive entwickeln. Ist eine Rückkehr des Kindes nicht innerhalb kurzer Zeit möglich, muss sichergestellt werden, dass sein Grundbedürfnis nach Bindung befriedig wird. Unnötige Zwischenplatzierungen sollten dabei vermieden werden, da sie kleine Kinder außerordentlich belasten. 5 Wenn ein Kind häufig wechselnden Bezugspersonen ausgesetzt wird, sind Bindungsstörungen die Folge. 6 Gleitende Übergänge, also das Kennenlernen der Pflegeeltern in häuslicher Umgebung des Kindes, sind bei Gefährdung weder zu verwirklichen noch zu rechtfertigen. Sie sind nur dann ein realistisches Vorgehen, wenn das Kind nicht in Gefahr ist und die Erwachsenen kooperieren können. Anpassungsleistungen Bei frühen Trennungen stellt sich die Frage, welche Anpassungsleistungen das Kind aufgrund seiner Entwicklung bereits erbringen kann. Wird seine Anpassungsfähigkeit überfordert, reagiert es mit Strategien, die langfri- Fachvortrag Kay-Uwe Fock stig schädlich oder krankmachend sind. An drei Altersstufen werde ich ausführen, welche Anpassungsfähigkeit das Kind hat und welche Unterstützung es braucht. Trennung direkt nach der Geburt Ein Neugeborenes ist extrem hilflos: Es kann den Kopf nicht heben, kann sich nicht fortbewegen und kann seine Bedürfnisse nur elementar mitteilen, durch Mimik, Blicke oder Schreien. Wird es direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt, so finden seine im Mutterleib gelernten Erwartungen über Geruch, Geschmack, Stimme 7, und Rhythmus der Le benswelt keinen Anknüpfungspunkt 8. Dieser Verlust trifft das Neugeborene mit überwältigender Wucht. Es erlebt unkontrollierbaren Stress, hat aber keine geistigen oder sprachlichen Bewälti gungsmöglichkeiten. 5 Scheuerer-Englisch, Hermann: Kindliche Sicherheit als Leitlinie fachlichen Handelns Fremdplatzierung und Bindung von Kindern in Pflegefamilien, Frankfurt/M. 004 (PFAD Bundesverband Verlag) 6 Brisch, Karl-Heinz: Bindungsstörungen Von der Bindungstheorie zu Bindungstherapie, Stuttgart 1999 (Klett-Cotta Verlag), S.153 ff. 7 Tomatis, Alfred: Klangwelt Mutterleib Die Anfänge der Kommunikation zwischen Mutter und Kind, München 1999 (Deutscher Taschenbuch Verlag) 8 Bonus, Bettina: Mit den Augen eines Kindes sehen lernen, Band 1: Zur Entstehung einer Frühtraumatisierung bei Pflege- und Adoptivkindern und ihren möglichen Folgen, Norderstedt 006 (Books on Demand Verlag). 9
11 Sein Organismus reagiert aus Selbstschutz bereits nach kurzer Zeit mit dem Absperren (Dissoziation) der Bedrohungs- und Ohnmachtsgefühle. Diese frühe Trennung und die damit verbundene Traumatisierung 9 wurde lange Zeit unterschätzt. Der Säugling selbst zeigt seine Not, Belastung und Verwirrung nicht lange offen, da sein Organismus die hohe Erregung schnell dämpfen muss, um sich selbst zu schützen. Früher hielt man Kinder für robust 10 und war überzeugt, dass sie an so frühe Ereignisse keine Erinnerungen haben. Diese Vorstellung gilt als überholt, seit man aus der Traumaforschung weiß, dass gerade die im Unbewussten gespeicherten Erfahrungen lange weiterwirken. Dem Neugeborenen würde eine Person helfen, die ihm zur Verfügung steht und tut, was sie kann, um es zu beruhigen. Dazu gehört, ihm mit warmer Stimme zu erklären, was gerade passiert 11, ihm einfühlsamen Körperkontakt zu gewähren und seine Erregung zu dämpfen, so gut es geht. 1 Die Begleitperson und auch die aufnehmenden Pflegeeltern sollten sich dessen bewusst sein, dass das Kind eine Krise und einen Verlust erlebt. Denn ihre Einfühlung hilft dem Kind dabei, sich selbst zu finden. Trennung in der Phase des Bindungsaufbaus Wenn ein Kind gerade lernt, eine exklusive Bindung einzugehen, also zwischen ca. 6 und ca. 18 Monaten 13 reagiert es besonders sensibel auf Trennungen. Es bevorzugt vertraute Personen und drückt beim Fremdeln Angst und Ablehnung gegenüber unvertrauten Personen aus. Es entwickelt Strategien, die vertraute Bindungsperson für sich zu gewinnen. Es lernt, sich mit seinen Gefühlen und seinem Verhalten auf eine Bindungsperson auszurichten. Dadurch gewinnt es auch innere Modelle von sich selbst. 14 Wird es gut versorgt, gewinnt es Selbstvertrauen. In diesem Alter kann das Kind selbst Nähe und Distanz herstellen und seine Bedürfnisse differenzierter zeigen. Trotzdem kann es eine Trennung weder verstehen, noch sich darauf vorbereiten. Es ist auf sensible Erwachsene angewiesen, die genau beobachten und richtig deuten können, was das Kind ausdrückt, sodass sie angemessen auf seine Gefühle Bedürfnisse eingehen können. Eine Trennung zu diesem Zeitpunkt ist sehr belastend, da das Kind im Bindungsaufbau nur über instabile, unfertige Strategien und innere Modelle verfügt. Durch neue Bezugspersonen werden sie unbrauchbar und müssen sich neu entwickeln. Ist das Kind in diesem Alter in der Herkunftsfamilie gefährdet, muss es trotzdem herausgenommen werden. Es sollte jedoch in diesem Alter entweder gar nicht oder nur kurz im Kinderschutzhaus untergebracht werden, da dort ein Bindungsaufbau nicht möglich ist. 15 Befindet sich das Kind in der Phase des Bindungsaufbaus in einer förderlichen Umgebung, ist es oft günstiger, wenn die Trennung aufgeschoben wird, bis das Kind stabile und sichere innere Modelle und Verhaltensmuster entwickelt hat. Ab ca. eineinhalb Jahren kann es seine Erwartungen nach Trost und Schutz an neue Bezugspersonen richten. 9 Fock, Kay-Uwe: Wer ist denn hier im falschen Film Traumatisierung erkennen in Pflege- und Adoptivfamilien, Hamburg 005 (Tagungsband von Freunde der Kinder e. V.) 10 Perry, Bruce: Der Junge, der wie ein Hund gehalten wurde, München 008 (Kösel Verlag) 11 Eliacheff, Caroline: Das Kind, das eine Katze sein wollte, München 009 (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1 Fock, Kay-Uwe: So wird Neugeborenen die Trennung von der Mutter erleichtert, in: Blickpunkt Pflegekinder 1/009, S. 8f. 13 Brisch, Karl-Heinz: Bindung und Trauma, Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern, Stuttgart 003 (Klett-Cotta Verlag) 14 Fock, Kay-Uwe: Sicherheit finden, Hamburg 005 (Tagungsband von Freunde der Kinder e. V. 15 Fock, Kay-Uwe: Das Bereitschaftspflegedilemma, in: Blickpunkt Pflegekinder 3/007 10
12 Ist ein Wechsel unvermeidlich, helfen dem Kind Übergangsobjekte: Vertraute Gegenstände, Kuscheltiere, Spielzeug, Kleidung, Bettwäsche, Fotos und Bilder. Im Rahmen einer Anbahnung kann das Kind die neuen Bezugspersonen und die neue Umgebung kennen lernen. Das vermittelt ihm ein Mindestmaß an Kontrolle bei der Trennung und reduziert seinen Stress. Für die Erwachsenen kann das sehr schmerzhaft sein, weil das Kind jetzt eine deutliche Trennungsreaktion zeigt. Doch gerade der Ausdruck von Trauer, Schmerz und Zorn hilft ihm bei der Bewältigung eines Überganges. Trennung im Alter von Jahren In diesem Alter beginnt das Kind sich sprachlich mitzuteilen, es ist mobil und reguliert Nähe und Distanz eigenständig. Sein eigener Wille hat sich entwickelt und es verfolgt seine Ziele sehr nachdrücklich. Sein Zeithorizont hat sich erweitert und das Kind kann Vorstellungen entwickeln. Nach wie vor ist sein dringendstes Bedürfnis auf sichere Bindungen gerichtet. Unter ungünstigen Erziehungsbedingungen hat es vielfältige Strategien zur Abwehr von Ohnmacht und Ausgeliefertsein entwickelt. Die Trennung von den leiblichen Eltern bedeutet für das Kind also nicht nur den Verlust der vertrauten Personen und der vertrauten Umgebung. Auch seine erprobten und bisher wirksamen Bewältigungsstrategien werden plötzlich nutzlos. Es ist einer Situation ausgeliefert, für die es keine Strategie hat. Trotzdem verfügt das Kind jetzt über wesentlich mehr Möglichkeiten: Es kann und will mitentscheiden. Erwachsene können ihm erklären, was vor sich geht. Mit Bildern und Geschichten kann sich das Kind in der Vorstellung auf Übergänge vorbereiten. Gleichzeitig ist es weiterhin sehr darauf angewiesen, dass die Erwachsenen zwischen den Zeilen seines Verhaltens lesen und feinfühlig genug sind, seine Signale feinfühlig zu beantworten. Was können Pflegeeltern tun? Zu allererst geht es für Pflegeeltern darum, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen. Denn nach einer Trennung von den leiblichen Eltern braucht ein Kind neue Beziehungen und Bindungen. Im Alter bis zu 18 Monaten gelingt dieser Bindungsaufbau sehr schnell. Grawe berichtet, dass einjährige Kinder bereits nach drei Monaten in einer neuen Familie geordnete Bindungsstrategien zu den neuen Bezugspersonen zeigen. 16 Die zunehmende emotionale Sicherheit und das wachsende Vertrauen des Kindes bilden das Fundament für die Auseinandersetzung mit seinen unverarbeiteten Gefühlen. Wenn es beginnt, sich sicher zu fühlen, kann es Fragen stellen. Das tut es aber nur, wenn ihm das Klima aufgeschlossen erscheint. Dann braucht es kindgemäße Erklärungen, die ihm helfen. Wenn der Opa gestorben ist, sagt man dem kleinen Kind: Der Opa ist jetzt im Himmel. Diese Erklärung ist eigentlich keine, aber sie hilft dem Kind, sich mit dem Tod des Opas auseinanderzusetzen und reduziert seinen Schmerz über den Verlust. Die Aufgaben der Erwachsenen Erwachsenen müssen bestimmte Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Pflegekind die Trennung von den leiblichen Eltern gut bewältigen kann. Dabei haben Pflegeeltern, leibliche Eltern und Fachkräfte sehr unterschiedliche Aufgaben. 16 Grawe, Klaus: Neuropsychotherapie, Göttingen 004 (Hogrefe Verlag) 11
13 Die Pflegeeltern bieten dem Kind eine sichere Bindung an. Sie unterstützen das Kind, trösten es und geben ihm Orientierung. Sie bieten dem Kind Erklärungen dafür, warum es bei ihnen lebt und unterstützen es dabei, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Sie ermöglichen dem Kind, seine Gefühle zu erkunden und schaffen Gesprächsanlässe, die dem Kind bei der Klärung und Verarbeitung seiner Gefühle helfen. Dabei achten sie auf die Zwischentöne, auf das Ungesagte und die unausgesprochenen Gefühle des Kindes. Bei kleinen Kindern kann das Puppenspiel mit einer Handpuppe oder einem sprechendes Kuscheltier helfen, seine Gefühle zu ordnen. Manchmal ist es gut, gemeinsam mit dem Kind zu trauern. Manchmal ist es gut, gemeinsame Phantasien zu entwickeln, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und manchmal ist es auch gut, Quatsch zu machen. Die Pflegeeltern brauchen ein realistisches Modell von sich selbst und den Gefühlen, die die Verletzungen des Kindes in ihnen auslösen. Und sie sollten sich ihre Gefühle gegenüber den leiblichen Eltern nüchtern vor Augen führen, damit sie diese zurückstellen können, wenn sie das Kind bei der Bewältigung seiner Gefühle unterstützen. Die Fachkräfte beraten die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern. Ihre vordringlichste Aufgabe ist es, möglichst bald (und je jünger das Kind ist umso schneller) seine Verbleibensperspektive zu klären. Denn ohne diese Klärung kann das Kind sich in der Pflegefamilie nicht verankern und wirklich sicher fühlen. Es kann dann keine hin- Gesprächsgruppe 1 reichend sichere Bindung an die Pflegeeltern entwickeln, die ihm die Verarbeitung seiner Gefühle von Kummer, Trauer, Schmerz und Angst sowie der Wut über die Trennung von den leiblichen Eltern ermöglicht. Bei älteren Kindern kann es sinnvoll sein, dass sich auch Fachkräfte als neutrale Gesprächspartner für die Trennungsverarbeitung zur Verfügung stellen, indem sie Informationen geben oder einfach zuhören. Eine weitere Aufgabe der Fachkräfte ist die Planung und ggf. Begleitung der Umgangskontakte. Hier gilt es, eine Form und einen Rhythmus zu finden, die den Interessen des Kindes entsprechen und es nicht überfordern. Überlastungsreaktionen des Kindes, wie z. B. Albträume, Einnässen, Schreianfälle, Zerstörungswut oder Verwirrung vor oder nach Umgangskontakten sind ernstzunehmende Alarmzeichen, die nicht nur die Trennungsverarbeitung verhindern, sondern auch die Entwicklung des Kindes schädigen können. Hier sollten Art und Umfang der Umgangskontakte so verändert werden, dass das Kind sich sicher fühlen kann. Alle Fachkräfte sollten eine pragmatische Zusammenarbeit zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern entwickeln helfen und unterstützen, die vordringlich an den Bedürfnissen des Kindes nach Sicherheit und Entwicklung orientiert ist. Die leiblichen Eltern haben sicher die schmerzhaftesten Aufgaben: Sie müssen den eigenen Trennungsschmerz ebenso bewältigen wie Versagens- Scham- und Schuldgefühle. Kein Mensch kann diese Gefühle allein verarbeiten. Daher brauchen sie Berater, die ihnen helfen sich ihrer Wut, ihrem Kummer und ihrer Trauer zu stellen, anstatt diese einzukapseln, zu verleugnen oder sie gar dadurch bewältigen zu wollen, dass sie dem Kind unrealistische Versprechungen über seine Rückkehr machen. 1
14 Mit guter Beratung könnten sie sich eine neue Form ihrer Elternrolle erarbeiten und ihr Kind bei dessen Entwicklung unterstützen. Leider gibt es nach meiner Erfahrung in der Praxis zu wenige qualifizierte Angebote, sodass viele abgebende Eltern mit ihren verletzten Gefühlen alleingelassen werden. In Umgangskontakten können diese unverarbeiteten Gefühle wieder aktiviert werden. Das kann dazu führen, dass ein Kind widersprüchliche Signale empfängt, die seine eigene Trennungsbewältigung erschweren. Rituale der Nachbereitung erfinden: Biographiearbeit Pflegekinder brauchen altersgemäß gute Erklärungen für ihre Lebenslage. 17 Methoden der Biographiearbeit liefern wertvolle Werkzeuge, um Brüche und Übergänge im Lebenslauf für das Kind verstehbar zu machen. Ausführliche Anregungen geben Ryan und Walker 18 und Irmela Wiemann 19. Eine Kurzübersicht steht unter zum Herunterladen bereit. Eine gute Geschichte sollte folgende Kriterien erfüllen: Sie sollte plausibel sein, das Kind von Schuld entlasten und die leiblichen Eltern nicht anklagen. Es kommt dabei weniger auf die objektive Realität an, als auf die sinnstiftende und entlastende Funktion für das Kind. Je älter das Kind wird, desto mehr geistige Mittel hat es, seinen Lebenslauf zu verstehen und frühe Trennungen neu zu bewerten. Dazu gehört die Anerkennung des Schmerzes und der existentiellen Bindung an die leiblichen Eltern. Nachbereitung ist Vorbereitung! Die nachträgliche Bearbeitung der Verlusterfahrungen geht Hand in Hand mit der Vorbereitung auf neue Übergänge. Im Alltag sollte die Kunst der kleinen Trennungen praktiziert werden, bei der das Kind lernt: Die Pflegemutter kommt verlässlich wieder, sie hält Wort und Ich werde nicht noch einmal verlassen. Ein abgestuftes Trennungstraining hilft ihm, eigene Kompetenzen zu entwickeln und seine Trennungsangst zu bewältigen. Dazu muss das Kind immer wieder erleben, dass es Kontrolle über die Situation hat. Auch andere alltägliche Herausforderungen und Aufgaben, die das Kind bewältigen kann, stabilisieren sein Gefühl, Kontrolle zu haben. Die guten Nachrichten: Es kann besser werden! Spätere Übergänge, z. B. in der Pubertät können im Jugendlichen die alten Gefühle von Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Ohnmacht auslösen, wie er sie als Säugling bei der frühen Trennung erlebte 0. Joachim Bauer spricht von einem biologischen Fingerabdruck, den frühkindliche Stress-, Trennungsund Verlusterfahrungen im Organismus hinterlassen. Allerdings berichtet er auch, dass diese Erfahrungen in der Pubertät besonders gut nachbearbeitet werden können. 1 Voraussetzung dafür ist, dass das Kind wenigstens eine vertrauensvolle Bindungsbeziehung hat. Daher stellt sich sowohl für Pflegeeltern, als auch für das jugendliche Pflegekind die schwierige Aufgabe, den familiären Zusammenhalt gerade in der Pubertät zu kultivieren. Das heißt: Immer wieder miteinander reden, Regeln verhandeln, gemeinsame erfreuliche Aktivitäten unternehmen und den Jugendlichen in seiner wachsenden Autonomie begleiten. 17 Fock, Kay-Uwe: Stigmatisierung vorbeugen Eine offizielle Geschichte entwickeln, in: Blickpunkt Pflegekinder 1/ Ryan, Tony und Rodger Walker: Wo gehöre ich hin? Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen, Weinheim 1997 (Beltz Verlag) 19 Wiemann, Irmela: Wie viel Wahrheit braucht mein Kind?, Reinbek 003 (Rowohlt Verlag) 0 Kay-Uwe Fock: Chaos oder zweite Chance? Pubertät bei Pflegekindern, in: Blickpunkt Pflegekinder /010 S. 0 ff. 1 Bauer, Joachim: Prinzip Menschlichkeit Warum wir von Natur aus kooperieren, Hamburg, 006 (Hoffmann und Campe Verlag), S. 90ff. 13
15 .3 Gesprächsgruppen Nach der Mittagspause wurde in vier Gesprächsgruppen das Thema des Vortrags unter verschiedenen Aspekten diskutiert..3.1 Gesprächsgruppe 1 Werkzeugkiste Trennungsbewältigung, Dipl.-Psych. Kay-Uwe Fock Der Referent hatte vier Aspekte für die Werkzeugkiste vorbereitet: 1. Trennungsbewältigung und Trauerverarbeitung. Die offizielle Geschichte des Kindes 3. Umgangskontakte sicher gestalten 4. Selbstregulation Durch interessierte Fragen der Teilnehmer entstand schnell eine Gesprächsatmosphäre, in der Pflegeeltern mit dem Referenten und untereinander vielfältige Fragen aus dem Zusammenleben mit ihren Kindern bewegten. Eine wichtige Voraussetzung für Trennungsbewältigung ist die Bindungssicherheit des Pflegekindes. Dieses Themenfeld prägte den Beginn der Diskussion. Pflegeeltern sollten vorhersehbar und verfügbar sein. Ein stetig gleicher Tagesrhythmus und eine gleichbleibende Tagesstruktur sind für unsere Pflegekinder von hoher Bedeutung. Ein äußerst wichtiger Punkt ist das feinfühlige Reagieren auf Stress. Pflegekinder sind ständig alarmbereit. Sie reagieren sehr sensibel auf Stress, Anforderung, Überforderung. Pflegeeltern müssen ihre Pflegekinder sehr gut kennen lernen, um den Zeitpunkt des erhöhten Stresspegels mitzubekommen. Sie sollten wissen, dass das Kind dann keine Anforderungen mehr erfüllen kann, sondern feinfühlige Zuwendung benötigt, im äußersten Fall auch Gesprächsgruppe 1 ein ruhiges Zimmer mit einer Auszeit, um sich beruhigen zu können, hilfreich. Das ist besonders wichtig in den Abendstunden, damit das Kind den Tag gut abschließen kann, am besten mit einem gleichbleibenden Ritual des Zubettbringens. Damit ein Kind seine Trauer verarbeiten kann, sollten Pflegeeltern ihm helfen, seine Gefühle zu erkunden und zu klären. Dabei sollten sie weder die Trauer beschwichtigen noch von der vorhandenen Trauer ablenken. Wichtig ist für die Kinder, dass jemand da ist, der ihnen zuhört, sie tröstet und versteht. Trauerrituale helfen dem Kind mit seinen Gefühlen umzugehen. Es wird empfohlen, die Erinnerungen, Mitteilungen, Gefühle der Kinder aufzuschreiben, da sie sich später oft nicht mehr erinnern. Die Führung eines Tagebuches macht Sinn. Herr Fock ging auf die vielfältigen und interessierten Fragen der Teilnehmer ein und wies darauf hin, dass Pflegekinder oft in alte Verhaltensmuster, z. B. in Vermeidungsverhalten verfallen und dann Beziehungsangebote nicht annehmen können, sich abweisend verhalten. Hier sollte man sich nicht auf- 14
16 drängen, sondern sensibel nachfragen, ergründen ( Ach Mensch, möchtest Du gar nicht? ). Manchmal hilft, den Augenkontakt wegzulassen, sich sozusagen von der Seite heranzuschleichen. Manchmal ist weniger mehr. Man sollte die Kinder kommen lassen. Ein weiterer Beitrag zur Bindungssicherheit als Basis der Trennungs- und Trauerverarbeitung ist der kompetente Umgang mit Eskalationen. Humorvoll meinte Herr Fock: Ihre Pflegekinder machen Ihnen Konfliktangebote, die Sie nicht ablehnen können. Hier gab es eine kleine Vorführung: Herr Fock bat einen Teilnehmer, ihm zu helfen, den Zuschauern einen lebendigen Eindruck von Eskalationen zu vermitteln. Es wurde geklärt, wer den Vater und wer den Sohn darstellen sollte. Dann ergriff Herr Fock die Hand des Freiwilligen (Sohnes) und jeder versuchte nun, den anderen wegzudrücken. Es wurde schnell deutlich, dass in dieser Situation nur der Vater die Möglichkeit hat, den Konflikt zu entschärfen, indem er den Druck aus der Situation nimmt und vielleicht sogar von der Angriffsline geht. Herr Fock wies nachdrücklich darauf hin, dass Augenkontakt hier nicht förderlich ist, sondern dass die wütenden und angreifenden Blicke die Kampfbereitschaft von Vater und Sohn intensivieren und feinfühlige Lösungen erschweren. Ein Pflegevater wies darauf hin, dass die Pflegeeltern auch etwas anbieten können, zum Beispiel gemeinsam etwas tun. Daraufhin sammelten die Teilnehmer Aktivitäten, die der Entspannung, Entlastung, Deeskalation dienen können: gemeinsam Holz hacken, gemeinsam Berge besteigen, gemeinsam Lesen, gemeinsam bügeln und so weiter. Die Geschichte einer Teilnehmerin, die Frieden stiftend zum Pflegekind sagte: Ich nehme Deine Entschuldigung an. und ein erstaunt nachdenkliches, aber erleichtertes Wirklich? bekam, ließ erahnen, wie viel Verletzung und Unsicherheit hier noch verborgen sind. Deshalb empfahl der Referent, die Arbeit der Pflegeeltern wertschätzend, an den Stärken der Kinder anzusetzen mit dem beispielhaften Satz an das Pflegekind: Du hast ganz früh gelernt, für dich selbst zu sorgen. Die kleine Kaffeepause bot Raum für intensive Gespräche der Eltern untereinander. Anschließend gab es eine kleine Übung: Herr Fock bat die Teilnehmer, sich zu zweit voreinander aufzustellen und genauso zu klatschen, wie er es mit einem Freiwilligen tat: Es wurde im Wechsel rechts und links und auch überkreuz geklatscht. Dadurch wurden beide Gehirnhälften abwechselnd aktiviert. Der Effekt auf den Hirnzustand der Teilnehmer zeigte sich sofort in Heiterkeit, Lachen, gesteigerter Wachheit und Konzentration. Herr Fock gab dazu folgende Erklärung ab: Das ist ein ganz simples Mittel, um dem Organismus zu helfen, problematische Gefühle und Erinnerungen zu verarbeiten. Denn traumatische Erinnerungen können den Organismus blitzschnell in einen Zustand von Kampfbereitschaft versetzen. Die Gefühle überfluten den Organismus und neigen dazu, alle Ressourcen im Gehirn zu belegen. Die abwechselnde Reizung jeweils einer Hirnhälfte unterläuft das, indem sie einen Ablenkungsreiz bietet. Diese lateralisierte Reizung des Gehirns wird z. B. in der Traumatherapie beim EMDR genutzt. Sie können das im Alltag Ihrer Familie als kurioses kleines Ritual installieren. Dazu üben Sie das Klatschen mit dem Kind in einer ruhigen, entspannten Situation ein. Wenn das Klatschen vertraut ist, können Sie es einsetzen, wenn Sie einen Konflikt sich anbahnen sehen, oder um nach einer Eskalation dem Organismus des Kindes (und Ihrem eigenen) bei der Beruhigung zu helfen. Gerade in der Pubertät der Pflegekinder haben Pflegeeltern oft die Befürchtung, dass der Streit sich in körperliche Auseinandersetzungen verschärfen könnte. Herr Fock wies darauf hin, dass in dieser Entwicklungsphase die Identitätsfindung beginnt und der/die Jugendliche sich in der Auseinandersetzung mit seiner Herkunft mit den Pflegeeltern reibt. In diesen Fällen sollten die Pflegeeltern an anderer, entspannter Stelle versuchen, mit ihm/ihr in Kontakt zu kommen, herauszufinden, wie er/sie empfindet. Die Pflegeeltern benötigen nun gute Antworten auf die Fragen des/der suchenden Jugendlichen. Dafür 15
17 ist es sinnvoll so viel wie möglich über die Herkunft des Pflegekindes zu wissen. In diesem Zusammenhang wurden die Pflegeeltern aufgefordert, bei den betreuenden Sozialarbeitern nachzufragen, Informationen zu sammeln. Zur Unterstützung der Trennungsbewältigung und damit Pflegekinder in ihrem sozialen Umfeld, bei Nachfragen zu dem Woher und Warum, nicht in eine unsichere Situation kommen, ist es sinnvoll, gemeinsam mit den Eltern eine offizielle Geschichte zu erarbeiten. Dabei kommt es nicht so sehr auf die Fakten an, sondern sie muss kindgemäß verdaulich sein. Eine offizielle Geschichte sollte wahrheitsgemäß sozial akzeptabel spontan abrufbar widerspruchsfrei mit Zukunftsperspektive und ohne Anklagen erzählt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass Wahrheit nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv betrachtet werden kann. Sie sollte keine barmherzigen Lügen beinhalten. Damit sich sowohl Pflegeeltern als auch Pflegekind besser mit der Herkunftsgeschichte befassen können, kann anhand von Alter, Lebensort und der damals vorhandenen Bezugspersonen in Hinsicht auf bindungsrelevante Ereignisse eine Einschätzung der emotionalen Bedeutung und der damaligen Ressourcen des Kindes vorgenommen werden. Wenn man dann noch die damals vorhandenen Ressourcen im System ergründet, ist man vielleicht besser in der Lage, zu verstehen, was dem Kind damals passiert ist, wie es ihm ergangen ist. Kay-Uwe Fock bot für diese Art der Biografie-Arbeit eine Tabelle als Arbeitsmethode an, die bei ihm oder beim PKD Leipzig abgerufen werden kann. Mit einer frühzeitig beginnenden Biografiearbeit, die gemeinsam mit den Pflegekindern erfolgen sollte, können Unsicherheit, pubertärer Frust und Aggressionen abgebaut werden. Gerade die Pubertät sollte als Chance zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte der Pflegekinder genutzt werden, denn sie bietet ein wichtiges Entwicklungsfenster, um die frühen problematischen Erinnerungen zu verarbeiten. Voraussetzung dafür sind wiederum die tragfähigen Beziehungen zu den Pflegeeltern, in den sich das Kind ernstgenommen und angenommen fühlen kann. Die Arbeitsgruppe war sehr lebendig und streckenweise sogar witzig (trotz der schwierigen Themen). Es entstand ein anregendes Gespräch, indem die Pflegeeltern aufeinander Bezug nahmen und einander durch wertvolle Erfahrungen und praktische Tipps stärkten. Im Verlauf der Gesprächsgruppe wurden Literaturhinweise für die Teilnehmer gegeben: John Cleese, Robin Skynner,...Familie sein dagegen sehr,,90, ISBN Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneuronen, 7,95, ISBN Omer, Haim und von Schlippe, Arist: Autorität ohne Gewalt, Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen, Elterliche Präsenz als systemisches Konzept, Göttingen 004, Vandenhoek und RuprechtShapiro, Francine: EMDR Grundlagen und Praxis, Handbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen, Paderborn 1998, Junfermann Monika Wiedemann-Kaiser, Die Himmelsrutsche Geschichten von verlassenen Kindern, die neue Eltern suchen, 5,75, ISBN
18 .3. Gesprächsgruppe Lasst mich gehen Doch verlasst mich nicht! Trennungsbewältigung aus Sicht der Pflegefamilie Referenten: Frau Heike Herbst, Kindernest e. V. Herr Müller-Freudenthal, Kindernest e. V. (Vorsitzender und Pflegevater) Frau Gerhild Landeck, Landesverband der Pflege- und Adoptiveltern e. V. In dieser Gruppe wurde die Thematik besprochen, was Pflegeeltern und Pflegekinder erwartet, wenn die Pflegekinder erwachsen werden. Probleme der Pubertät spielen eine Rolle und im Vordergrund steht für die Aufgabe, los zu lassen und gleichzeitig weiterhin Sicherheit zu vermitteln. Dabei ist die Abnabelung der Pflegekinder von den Jugendlichen besonders schwierig, da sie aufgrund ihrer Biographie besondere Verlassensängste. Die Pflegeeltern und die Fachleute tauschten ihre Erfahrungen aus und entwickelten Vorschläge, mit der besonderen Situation umzugehen. Gesprächsgruppe.3.3. Gesprächgruppe 3 Geschwister am Scheideweg - Wie ein Vormund entscheidet - die Vereinsvormünder des Fairbund e. V. geben anhand eines Fallbeispieles Einblick in ihre Berufspraxis Referenten: Frau Bredau, Herr Steingrüber, Vereinsvormünder des Fairbund e. V., Frau Lose, Familientherapeutin des Fairbund e. V. Inhalte und Ziele der Gesprächsgruppe Vorstellen des Vereins und seiner Tätigkeitsfelder Vorstellen der Arbeit eines Vereinsvormundes Erfahrungsaustausch zwischen den Pflegeeltern sowie mit den Vereinsvormündern Fallvorstellung durch Frau Bredau und Verfolgung des Prozesses einer Lösungsfindung anhand einer Aufstellung / Darstellung aller Institutionen / Personen und wichtigen Faktoren mit Hilfe einer Lebenslinie / eines Zeitstrahls der betroffenen Kinder Gesprächsgruppe 3 17
19 In einer sehr emotionalen Runde stellten sich alle Teilnehmer des Workshops vor und machten ihre Erwartungen anhand von persönlichen Erlebnissen deutlich. Bei der nachfolgenden Betrachtung der Familiengeschichte der Geschwister Benny (geb. 00) und Philip (geb. 006) ergaben sich viele Lebensstationen: z. B. die Inobhutnahme 007, regelmäßige Besuche der Mutti im Kinderheim, der plötzliche Abbruch des Kontaktes zur Mutti, der Umzug in ein anderes Kinderheim 008 sowie der Sorgerechtsentzug 009. Zum Verdeutlichen der damaligen Situation der Kinder, wurde durch die Rollenvergabe 1. Vormund. Kinder (Benny, Philip) 3. Team des Vormundes 4. Kinderheim 5. Schule 6. ASD 7. Vater von Benny eine Momentaufnahme gestellt, welche durch Frau Lose begleitet und moderiert wurde. Durch Rollenverteilung an die Workshop -Teilnehmer mit einem jeweils typischen Satz, welcher auf Zetteln vorbereitet war, sollte die Komplexität der Arbeit eines Vormundes aufgezeigt werden. Daraus ergaben sich für alle Beteiligten viele Fragen, z. B.: Die Kinder müssen aus dem Heim raus. Aber wie? Wir müssen eine Pflegefamilie für beide Kinder finden. Oder doch lieber zwei Pflegefamilien - für jedes Kind eine eigene? Wir sollten eine Adoption prüfen! Wo ist der Vater? Wir brauchen eine Fallbesprechung, eine Helferkonferenz und wir müssen Berichte einfordern! Anschließend durften alle Mitwirkenden ihre Fall-Rolle wieder abgeben und weiter als Workshop Teilnehmer arbeiten. Es erfolgte eine Auswertung und Reflexion der eingenommenen Rollen und ein Beschreiben der wahrgenommenen Gefühle. Danach löste Frau Bredau den Fall auf. Da sich beide Kinder in der Entwicklung gegenseitig behindert hätten, gab es eine getrennte Vermittlung. Für Benny konnte eine Adoptivfamilie gefunden werden, da Mutter und Vater nicht zur Verfügung standen. Bei Philip wurde der Vater als Ressource erkannt, da er aber nicht bei ihm leben konnte, wurde er in eine Pflegefamilie vermittelt. Beide Geschwister leben jetzt in räumlicher Nähe und haben telefonischen und persönlichen Kontakt. In der abschließenden Diskussion mit den Teilnehmern ergaben sich folgende Themenschwerpunkte: Im Erfahrungsaustausch wünschten sich viele, besonders Großeltern, die ihre Enkel als Pflegekinder aufnehmen, einen professionellen Beistand für die Geschwisterkinder, die nicht in der Familie bleiben konnten und dann anderweitig untergebracht wurden. Die Teilnehmer wünschten sich, dass besonders Schulen und Kindergärten, mit denen Pflegeeltern zu tun haben, besser über die Thematik eines Pflegekindes informiert sind. Die getrennte oder gemeinsame Vermittlung von Geschwisterkindern ist immer eine Einzelfallentscheidung und wird ganz besonders kritisch betrachtet. Der Pflegekinderdienst ist immer Ansprechpartner für die Probleme der Pflegeeltern. Er berät, begleitet und vermittelt verschiedenste Hilfsangebote. 18
20 .3.4. Gesprächsgruppe 4 Pflegekinder agieren oft ohne Worte Was können Pflegeeltern tun? Eine Bereitschaftspflegemutter lässt die Teilnehmer an ihren Erfahrungen mit 18 Pflegekindern teilhaben Referentinnen: Frau Wiegand, Diakonie Leipzig e. V. und Frau Anyiam, Bereitschaftspflegemutter Inhalte und Ziele der Gesprächsgruppe: Vorstellung der Familiären Bereitschaftspflege unter der Trägerschaft der Diakonie Leipzig e. V. Vorstellung der Arbeit von Familiärer Bereitschaftspflege anhand des umfangreichen Erfahrungsschatzes der Bereitschaftspflegemutter Frau Anyiam Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern und Referentinnen Innerhalb der Gesprächsrunde definierte Frau Wiegand den Teilnehmern den Phasenverlauf zur Inobhutnahme von Kindern in Familiäre Bereitschaftspflege. Die Aufnahme eines Kindes in die Familiäre Bereitschaftspflege bedeutet für das Kind eine Gesprächsgruppe 4 Akutsituation mit hohem Erregungszustand. Auf die Aufnahmesituation wird dann mit einer Schockreaktion reagiert, welche durch Angst und Panik dominiert wird. In der nächsten Phase ist das Kind völlig orientierungslos und erlebet alles als fremd und nichts passt zu den eigenen Erfahrungen und Verhaltensmustern. Die Phase der Desorientierung kann durch folgende mögliche Verhaltensweisen und Reaktionen eines Kindes geprägt sein: Schwierigkeiten, Grenzen und Regeln erkennen zu können, distanzloses Verhalten, Erstarrung, ambivalente Signale. Die o.g. Beispiele sind Folgen der seelischen und/oder körperlichen Verletzung des Kindes. Die Kinder benötigen neben der Grundbedürfnisbefriedigung vor allem eine klare Struktur im Tagesablauf und eine verlässliche Bezugsperson. Dadurch kann bei dem hochverunsichertem Kind über die Zeit eine Beruhigung (Phase der Beruhigung) eintreten. Das Kind gewinnt durch die erlebte Sicherheit die Kontrolle über seine Erfahrungswelt zurück. Anschließend ist es möglich, dass sich das Kind stabilisiert. Erst in der Phase der Stabilisierung kann behutsam mit erzieherischen Handlungen reagiert werden. Die abschließende Phase ist die Phase der Neuorientierung. In dieser Phase ist der Erregungszustand des Kindes im Vergleich zur Ausgangssituation deutlich verringert. Das Kind nimmt nach den traumatisierenden Erlebnissen die Umwelt wieder augenblicks- und zukunftsbezogener wahr. In dieser Phase benötigt das Kind die klare Botschaft, dass die verantwortlichen Erwachsenen nach einer geeigneten Zukunft suchen. Dies wirkt wiederum entlastend auf das Kind und gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit. Die erarbeitete Grundlage wurde durch eine Vielzahl von (kreativen) Beispielen aus der praktischen Arbeit der erfahrenen Bereitschaftspflegemutter, Frau Anyiam, verdeutlicht und vertieft. Den Referentinnen ist es gelungen, die Teilnehmer auf eine Reise in die emotionale Gefühlswelt der aufzunehmenden Kinder mitzunehmen. Innerhalb der Gesprächsgruppe kam es zu einem sehr wertschätzenden und erfahrungsreichen Austausch aller Beteiligten. 19
21 Kinderbetreuung.4 Präsentation der Ergebnisse Zum Abschluss der Veranstaltung fanden sich alle Teilnehmer wieder im Großen Saal zusammen, wo nach der Vorstellung der Inhalte der Gesprächsgruppen die Verabschiedung statt fand. 3 0
22 Kinderbetreuung 3. Kinderbetreuung 3.1 Kinderprogramm im OFT Völkerfreundschaft für die Kleinen 3 1
23 Danke 3. Kinderbetreuung im OFT Am Mühlholz 4
24 4. Danke Einen herzlichen Dank an die Branddirektion Leipzig, die Freiwillige Feuerwehr Leipzig-Süd und die Jugendfeuerwehr Leipzig-Süd an die Sportler des Kindersportzentrum SC DHfK Leipzig e.v die mitwirkenden Erzieherinnen aus Kindertagesstätten und Horten die Fachleute, die Gesprächsgruppen anboten die Pflegeeltern, Pflegekinder und Pflegegeschwister. 5 Mitarbeiterinnen des Leipziger Pflegekinderdienstes Vorankündigung: Der 9. Pflegefamilientag findet am statt. 3
Du nervst mich schon, wenn Du den Mund aufmachst!
 Du nervst mich schon, wenn Du den Mund aufmachst! Bindungsstörungen und Aggressionen Monika Biener, Dipl. Psych. Marita Brümmer, VHT-Trainerin John Bowlby: Bindung ist das gefühlsgetragene Band, das eine
Du nervst mich schon, wenn Du den Mund aufmachst! Bindungsstörungen und Aggressionen Monika Biener, Dipl. Psych. Marita Brümmer, VHT-Trainerin John Bowlby: Bindung ist das gefühlsgetragene Band, das eine
8. Pflegefamilientag am
 8. Pflegefamilientag am 17.09.2011 3/11 Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung 8. Pflegefamilientag am 17.09.2011 Herausgeber: Stadt Leipzig Der Oberbürgermeister
8. Pflegefamilientag am 17.09.2011 3/11 Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung 8. Pflegefamilientag am 17.09.2011 Herausgeber: Stadt Leipzig Der Oberbürgermeister
ETZ-Gruppe Kleve e.v. MUK
 ETZ-Gruppe MUTTER UND KIND Begleitung In den letzten Jahren haben sich immer häufiger schwangere Frauen und junge Mütter bei der Netzgruppe gemeldet, die auf der Suche nach einer Unterkunft waren und Unterstützung
ETZ-Gruppe MUTTER UND KIND Begleitung In den letzten Jahren haben sich immer häufiger schwangere Frauen und junge Mütter bei der Netzgruppe gemeldet, die auf der Suche nach einer Unterkunft waren und Unterstützung
Wie erleben Kinder Sterben und Tod?
 Wie erleben Kinder Sterben und Tod? Unterschiede Kinder-/Erwachsenentrauer 4 Elemente des Todes: Irreversibilität Kausalität Universalität Nonfunktionalität Unterschiede zwischen kindlicher und erwachsener
Wie erleben Kinder Sterben und Tod? Unterschiede Kinder-/Erwachsenentrauer 4 Elemente des Todes: Irreversibilität Kausalität Universalität Nonfunktionalität Unterschiede zwischen kindlicher und erwachsener
Inhalt. Christoph Malter: Vorwort 11. Einleitung Die Familienpflege 17
 Inhalt Christoph Malter: Vorwort 11 Einleitung 13 1 Die Familienpflege 17 Welche Formen von Familienpflegesteilen gibt es und wodurch unterscheiden sie sich? 18 a) Tages- und Wochenpflege 19 b) Die Kurzzeitpflegestelle
Inhalt Christoph Malter: Vorwort 11 Einleitung 13 1 Die Familienpflege 17 Welche Formen von Familienpflegesteilen gibt es und wodurch unterscheiden sie sich? 18 a) Tages- und Wochenpflege 19 b) Die Kurzzeitpflegestelle
Inhalt. Danksagung 10. Vorwort 11. Einleitung 13
 Inhalt Danksagung 10 Vorwort 11 Einleitung 13 1 Die Familienpflege 17 Welche Formen von Familienpflegestellen gibt es und wodurch unterscheiden sie sich? 18 a) Tages- und Wochenpflege 19 b) Die Kurzzeitpflegestelle
Inhalt Danksagung 10 Vorwort 11 Einleitung 13 1 Die Familienpflege 17 Welche Formen von Familienpflegestellen gibt es und wodurch unterscheiden sie sich? 18 a) Tages- und Wochenpflege 19 b) Die Kurzzeitpflegestelle
Emotionale Entwicklung
 Emotionale Entwicklung Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz und ihre Bedeutung Die eigenen Gefühle verstehen, sie anderen erklären, Strategien entwickeln, wie negative Emotionen überwunden werden
Emotionale Entwicklung Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz und ihre Bedeutung Die eigenen Gefühle verstehen, sie anderen erklären, Strategien entwickeln, wie negative Emotionen überwunden werden
Beratungsdienst für Eltern, Jugendliche und Kinder. Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen
 Beratungsdienst für Eltern, Jugendliche und Kinder Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen Trauer kann inner- und außerhalb der Schule oder z. B einer
Beratungsdienst für Eltern, Jugendliche und Kinder Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen Trauer kann inner- und außerhalb der Schule oder z. B einer
!"# # # $% # & '() '* ) ) '()
 !"# # # $% # & '() '* ) ) '() ' &+,+%$,+ +#!"# $% &%!' (!$ ) $ *+ $' +", #" --./"0 " % ' 1"#./234 5 6 4$7308090. 48- Wenn ich jetzt irgendetwas mit Freunden klären muss, zum Beispiel wenn wir Streit oder
!"# # # $% # & '() '* ) ) '() ' &+,+%$,+ +#!"# $% &%!' (!$ ) $ *+ $' +", #" --./"0 " % ' 1"#./234 5 6 4$7308090. 48- Wenn ich jetzt irgendetwas mit Freunden klären muss, zum Beispiel wenn wir Streit oder
Fortbildungsübersicht des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen. Januar bis Juli 2013
 Fortbildungsübersicht des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen Januar bis Juli 2013 1. Die kollegiale Fallbesprechung 2. Elterngespräche sicher führen 3. Förderung der sozial-emotionalen
Fortbildungsübersicht des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen Januar bis Juli 2013 1. Die kollegiale Fallbesprechung 2. Elterngespräche sicher führen 3. Förderung der sozial-emotionalen
Was ist Vertrauen? a) b) c) Frage. Vertraut mir das Kind. Vertraut sich das Kind selbst. Vertraue ich dem Kind. Bezugsperson, Vorbild
 Was ist Vertrauen? a) b) c) Vertraut mir das Kind Vertraue ich dem Kind Vertraut sich das Kind selbst Frage Bezugsperson, Vorbild Anerkennung, Wahrnehmung, Respekt Selbstvertrauen Aspekt Ich verlasse mich
Was ist Vertrauen? a) b) c) Vertraut mir das Kind Vertraue ich dem Kind Vertraut sich das Kind selbst Frage Bezugsperson, Vorbild Anerkennung, Wahrnehmung, Respekt Selbstvertrauen Aspekt Ich verlasse mich
Kinder können in ihren Familien häufig massiv angstbesetzte Situationen erlebt haben, wie z.b.
 Kinder können in ihren Familien häufig massiv angstbesetzte Situationen erlebt haben, wie z.b. häusliche Gewalt Vernachlässigung unsichere oder oft wechselnde Bindungspersonen emotionale Ablehnung körperliche
Kinder können in ihren Familien häufig massiv angstbesetzte Situationen erlebt haben, wie z.b. häusliche Gewalt Vernachlässigung unsichere oder oft wechselnde Bindungspersonen emotionale Ablehnung körperliche
Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben
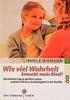 BALANCE Ratgeber - Jugend + Erziehung Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben Informationen und Hilfen für Familien Bearbeitet von Irmela Wiemann 4. Auflage 2014 2014. Taschenbuch. 231 S. Paperback
BALANCE Ratgeber - Jugend + Erziehung Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben Informationen und Hilfen für Familien Bearbeitet von Irmela Wiemann 4. Auflage 2014 2014. Taschenbuch. 231 S. Paperback
Aggression. Umgang mit einem wichtigen Gefühl
 Aggression Umgang mit einem wichtigen Gefühl Ein familylab Vortrag von Caroline Märki Leiterin familylab.ch Familienberaterin nach Jesper Juul Eltern-und Erwachsenenbildnerin mit eidg. FA Mutter von drei
Aggression Umgang mit einem wichtigen Gefühl Ein familylab Vortrag von Caroline Märki Leiterin familylab.ch Familienberaterin nach Jesper Juul Eltern-und Erwachsenenbildnerin mit eidg. FA Mutter von drei
Fachtag. Herkunftsfamilie Kind Pflegefamilie. Gute Kooperation gelingt nicht von alleine
 Fachtag Herkunftsfamilie Kind Pflegefamilie Gute Kooperation gelingt nicht von alleine Forschungsgruppe Pflegekinder Universität Siegen, 22. September 2015 Tagesprogramm 09:30 Uhr Stehcafé 10:00 Uhr Begrüßung
Fachtag Herkunftsfamilie Kind Pflegefamilie Gute Kooperation gelingt nicht von alleine Forschungsgruppe Pflegekinder Universität Siegen, 22. September 2015 Tagesprogramm 09:30 Uhr Stehcafé 10:00 Uhr Begrüßung
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Systemisch-lösungsfokussierte Herkunftselternarbeit. Mag. Theresa Mühlberger und Eva Bovo, MSc
 Systemisch-lösungsfokussierte Herkunftselternarbeit Mag. Theresa Mühlberger und Eva Bovo, MSc Herzlich Willkommen! Psychosoziale Familienbegleitung Methoden, Instrumente und Techniken Spannungsfeld Herkunftseltern-Pflegefamilie
Systemisch-lösungsfokussierte Herkunftselternarbeit Mag. Theresa Mühlberger und Eva Bovo, MSc Herzlich Willkommen! Psychosoziale Familienbegleitung Methoden, Instrumente und Techniken Spannungsfeld Herkunftseltern-Pflegefamilie
Vom Umgang mit den Kindern krebskranker Eltern
 Vom Umgang mit den Kindern krebskranker Eltern Workshop in St. Gallen am 26.8.2011 Zahlen kein umfassendes Krebsregister in Deutschland nur grobe Schätzungen In Schweiz, Österreich und Deutschland zusammen
Vom Umgang mit den Kindern krebskranker Eltern Workshop in St. Gallen am 26.8.2011 Zahlen kein umfassendes Krebsregister in Deutschland nur grobe Schätzungen In Schweiz, Österreich und Deutschland zusammen
Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben
 Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben Informationen und Hilfen für Familien Irmela Wiemann BALANC E ratgeber 14 auch wieder hergeben. Deshalb sorgt Leonie vor: Sie signalisiert ihrer Pflegemama:
Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben Informationen und Hilfen für Familien Irmela Wiemann BALANC E ratgeber 14 auch wieder hergeben. Deshalb sorgt Leonie vor: Sie signalisiert ihrer Pflegemama:
Bindung als Voraussetzung für die weitere Entwicklung
 Bindung als Voraussetzung für die weitere Entwicklung Fabienne Becker-Stoll Staatsinstitut für Frühpädagogik Fotos: Jochen Fiebig, IFP, 2007 in Krippen der LHM Seelische Grundbedürfnisse Edward Deci &
Bindung als Voraussetzung für die weitere Entwicklung Fabienne Becker-Stoll Staatsinstitut für Frühpädagogik Fotos: Jochen Fiebig, IFP, 2007 in Krippen der LHM Seelische Grundbedürfnisse Edward Deci &
Eingewöhnung Kindertagesstätte Spielkiste Magdeburg. Transition Übergang Familie Kindertagesstätte Krippe 0 3 Jahre
 Eingewöhnung Kindertagesstätte Spielkiste Magdeburg Transition Übergang Familie Kindertagesstätte Krippe 0 3 Jahre Umsetzung des Modells Die ersten Tage ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege
Eingewöhnung Kindertagesstätte Spielkiste Magdeburg Transition Übergang Familie Kindertagesstätte Krippe 0 3 Jahre Umsetzung des Modells Die ersten Tage ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege
Von der Scham zur Selbstachtung
 Von der Scham zur Selbstachtung Disability Pride Tagung Die Scham ist vorbei! Verstecken war gestern Aufbruch ist heute Vielfalt ist morgen! Vortrag: Petra Stephan (Dipl.-Psych.) 1 Intime Situationen 2
Von der Scham zur Selbstachtung Disability Pride Tagung Die Scham ist vorbei! Verstecken war gestern Aufbruch ist heute Vielfalt ist morgen! Vortrag: Petra Stephan (Dipl.-Psych.) 1 Intime Situationen 2
Alle(s) zum Wohl des Kindes - Zusammenarbeit von
 Alle(s) zum Wohl des Kindes - Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit von Familiengericht und Jugendamt Das Pflegekind und seine Bezugspersonen Besonderheiten im Bindungs- und Beziehungserleben von Pflegekindern
Alle(s) zum Wohl des Kindes - Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit von Familiengericht und Jugendamt Das Pflegekind und seine Bezugspersonen Besonderheiten im Bindungs- und Beziehungserleben von Pflegekindern
Stopp! Festhalten! Grundlagen der Bindungstheorien und ihre Bedeutung für die Therapie
 Stopp! Festhalten! n und ihre Bedeutung für die Therapie Jessica Kuhl DKSB Frühe Hilfen Dipl. Sozialpädagogin, systemischer Coach, Erzieherin Birgit Pammé SI,- und Bobath Ergo Lehrtherapeutin Diplomierte
Stopp! Festhalten! n und ihre Bedeutung für die Therapie Jessica Kuhl DKSB Frühe Hilfen Dipl. Sozialpädagogin, systemischer Coach, Erzieherin Birgit Pammé SI,- und Bobath Ergo Lehrtherapeutin Diplomierte
Autonomie in Verbundenheit. Selbstbestimmt leben nach einem Auszug aus dem Elternhaus!?
 Tagung Selbstbestimmt Wohnen in NRW 09.03.2018 Autonomie in Verbundenheit Selbstbestimmt leben nach einem Auszug aus dem Elternhaus!? Prof. Dr. Ute Fischer, Berlin Prämisse Ein Auszug aus dem Elternhaus
Tagung Selbstbestimmt Wohnen in NRW 09.03.2018 Autonomie in Verbundenheit Selbstbestimmt leben nach einem Auszug aus dem Elternhaus!? Prof. Dr. Ute Fischer, Berlin Prämisse Ein Auszug aus dem Elternhaus
+ Was erwartet Sie? Vom Schuldgefühl zur Verantwortung Angehörige im Spannungsfeld von Kontrolle und Hilflosigkeit
 + Vom Schuldgefühl zur Verantwortung Angehörige im Spannungsfeld von Kontrolle und Hilflosigkeit Gerontologisches Forum Bonn, 12. Juni 2017 Ursula Becker + Was erwartet Sie? n Demenz der uneindeutige Verlust
+ Vom Schuldgefühl zur Verantwortung Angehörige im Spannungsfeld von Kontrolle und Hilflosigkeit Gerontologisches Forum Bonn, 12. Juni 2017 Ursula Becker + Was erwartet Sie? n Demenz der uneindeutige Verlust
Eingewöhnungskonzept. der Krabbelgruppe Wilde Gummistiefel
 Eingewöhnungskonzept der Krabbelgruppe Wilde Gummistiefel Viele Kinder machen in der Kindergruppe die ersten kontinuierlichen Erfahrungen mit einer neuen und fremden Umgebung, anderen Kindern und Erwachsenen.
Eingewöhnungskonzept der Krabbelgruppe Wilde Gummistiefel Viele Kinder machen in der Kindergruppe die ersten kontinuierlichen Erfahrungen mit einer neuen und fremden Umgebung, anderen Kindern und Erwachsenen.
Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,' '
 Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 1 Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,'28.11.2014' Manchmal habe ich Angst, was mit
Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 1 Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,'28.11.2014' Manchmal habe ich Angst, was mit
Konzept für die Kinder- und Jugendtrauerarbeit Salzgitter
 Konzept für die Kinder- und Jugendtrauerarbeit Salzgitter (Stand Juli 2015) Trauer ist eine natürliche, gesunde Reaktion auf einen Verlust. Der Bereich Kinder- und Jugendtrauerarbeit der Hospiz Initiative
Konzept für die Kinder- und Jugendtrauerarbeit Salzgitter (Stand Juli 2015) Trauer ist eine natürliche, gesunde Reaktion auf einen Verlust. Der Bereich Kinder- und Jugendtrauerarbeit der Hospiz Initiative
Geschwister in Pflegefamilien getrennte oder gemeinsame Vermittlung?
 Impulse-Veranstaltung vom 23.09.2013 Geschwister in Pflegefamilien getrennte oder gemeinsame Vermittlung? Zu Beginn der Impulse-Veranstaltung hielt Frau Reimer ein Referat und zeigte Filmausschnitte zur
Impulse-Veranstaltung vom 23.09.2013 Geschwister in Pflegefamilien getrennte oder gemeinsame Vermittlung? Zu Beginn der Impulse-Veranstaltung hielt Frau Reimer ein Referat und zeigte Filmausschnitte zur
Eingewöhnungskonzept der Kindertagesstätte. Käte Duncker
 Eingewöhnungskonzept der Kindertagesstätte Käte Duncker Eine behutsame und individuelle Eingewöhnung ist uns sehr wichtig, um dem Kind einen guten Start in die Kita zu ermöglichen. Wir orientieren uns
Eingewöhnungskonzept der Kindertagesstätte Käte Duncker Eine behutsame und individuelle Eingewöhnung ist uns sehr wichtig, um dem Kind einen guten Start in die Kita zu ermöglichen. Wir orientieren uns
Das Kind. im Mittelpunkt Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir sind für Sie da. Adoptionsberatung und -vermittlung der Caritas
 Wir sind für Sie da Bei allen Fragen zum Thema Adoption stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir beraten Sie unverbindlich, ergebnisoffen und auf Wunsch auch anonym. Adoptionsberatung und -vermittlung
Wir sind für Sie da Bei allen Fragen zum Thema Adoption stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir beraten Sie unverbindlich, ergebnisoffen und auf Wunsch auch anonym. Adoptionsberatung und -vermittlung
Themenabend am : Aggression was tun? Referentin: A. Sewing. Definition Ursachen/ Auslöser Vorbeugung Deeskalation
 Themenabend am 13.6.2013: Aggression was tun? Referentin: A. Sewing Definition Ursachen/ Auslöser Vorbeugung Deeskalation Definition: Aggression verletzend gefährdend zerstörend soziale Grenzen überschreitend
Themenabend am 13.6.2013: Aggression was tun? Referentin: A. Sewing Definition Ursachen/ Auslöser Vorbeugung Deeskalation Definition: Aggression verletzend gefährdend zerstörend soziale Grenzen überschreitend
Mütterliche Bindungserfahrung und Beziehungsqualität zum eigenen Kind
 Leuchtturm-Preis 2015 der Stiftung Ravensburger Verlag Mütterliche Bindungserfahrung und Beziehungsqualität zum eigenen Kind F A B I E N N E B E C K E R - S T O L L S T A A T S I N S T I T U T F Ü R F
Leuchtturm-Preis 2015 der Stiftung Ravensburger Verlag Mütterliche Bindungserfahrung und Beziehungsqualität zum eigenen Kind F A B I E N N E B E C K E R - S T O L L S T A A T S I N S T I T U T F Ü R F
Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst?
 Kinder als Zeugen elterlicher Gewalt Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 04.03.2016 Alexander Korittko 6 Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten oder anderen vertrauten
Kinder als Zeugen elterlicher Gewalt Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 04.03.2016 Alexander Korittko 6 Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten oder anderen vertrauten
Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt
 Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt P Ä D A G O G I S C H E W E R K T A G U N G 1 3. 1 5. J U L I 2 0 1 0 S A L Z B U R G Ich darf Sie durch diesen Workshop begleiten: Klinische- u. Gesundheitspsychologin
Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt P Ä D A G O G I S C H E W E R K T A G U N G 1 3. 1 5. J U L I 2 0 1 0 S A L Z B U R G Ich darf Sie durch diesen Workshop begleiten: Klinische- u. Gesundheitspsychologin
Einleitung Vorbereitungsphase
 10 Es wird im Allgemeinen viel zu wenig wahrgenommen, dass, wenn es an elterlicher Unterstützung mangelt, Dreijährige noch Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in den Kindergarten haben. Forschungen auf
10 Es wird im Allgemeinen viel zu wenig wahrgenommen, dass, wenn es an elterlicher Unterstützung mangelt, Dreijährige noch Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in den Kindergarten haben. Forschungen auf
Eingewöhnungskonzept
 Eingewöhnungskonzept Kinderkrippe Koalabär GmbH Hauptstrasse 35 5032 Aarau Rohr 1 Worum geht es in der Eingewöhnung? Der Eintritt in die Kindertagesstätte stellt für ein Kind eine große Herausforderung
Eingewöhnungskonzept Kinderkrippe Koalabär GmbH Hauptstrasse 35 5032 Aarau Rohr 1 Worum geht es in der Eingewöhnung? Der Eintritt in die Kindertagesstätte stellt für ein Kind eine große Herausforderung
Umgang mit einem belastenden Ereignis
 Departement für Erziehung und Kultur Amt für Volksschule SKIT Schulisches Kriseninterventionsteam Umgang mit einem belastenden Ereignis Orientierungshilfe für Eltern und Bezugspersonen Aussergewöhnlich
Departement für Erziehung und Kultur Amt für Volksschule SKIT Schulisches Kriseninterventionsteam Umgang mit einem belastenden Ereignis Orientierungshilfe für Eltern und Bezugspersonen Aussergewöhnlich
PFAD für Kinder, Pflege- und Adoptivfamilien im Landkreis Roth und Umgebung e.v. Supervision zur Stärkung der leiblichen Kinder von Pflegefamilien
 Supervision zur Stärkung der leiblichen Kinder von Pflegefamilien Ein Pflegekind kann viel Unruhe in einer Familie bedeuten, die Hierarchien und Stellenwerte für die leiblichen Kinder verändern sich mit
Supervision zur Stärkung der leiblichen Kinder von Pflegefamilien Ein Pflegekind kann viel Unruhe in einer Familie bedeuten, die Hierarchien und Stellenwerte für die leiblichen Kinder verändern sich mit
Adoptivfamilien. Gliederung. Gesetzliche Voraussetzungen und der Adoptionsvermittlungsprozess. Beweggründe für eine Adoption
 Adoptivfamilien Gliederung Gesetzliche Voraussetzungen und der Adoptionsvermittlungsprozess Beweggründe für eine Adoption Zusammenleben in der Adoptivfamilie Identitätsfindung adoptierter Kinder 1 Gesetzliche
Adoptivfamilien Gliederung Gesetzliche Voraussetzungen und der Adoptionsvermittlungsprozess Beweggründe für eine Adoption Zusammenleben in der Adoptivfamilie Identitätsfindung adoptierter Kinder 1 Gesetzliche
Trauma, Beziehung und Beziehungslosigkeit. Können wir unserer Erinnerung trauen? Was ist Erinnerung überhaupt, und wo wird sie gespeichert?
 Trauma, Beziehung und Beziehungslosigkeit Können wir unserer Erinnerung trauen? Was ist Erinnerung überhaupt, und wo wird sie gespeichert? Die einzig verlässlichen Erinnerungen sind die Erinnerungen des
Trauma, Beziehung und Beziehungslosigkeit Können wir unserer Erinnerung trauen? Was ist Erinnerung überhaupt, und wo wird sie gespeichert? Die einzig verlässlichen Erinnerungen sind die Erinnerungen des
Da Beate Wegmann ihre Situation in den darauf folgenden Monaten nicht grundsätzlich verändern
 W enn Eltern ihre Kinder nicht angemessen versorgen können, dann kann das sehr unterschiedliche Gründe haben: eine Krise in der Familie. Überforderung in der Erziehung, Krankheit, ein fehlendes Netzwerk
W enn Eltern ihre Kinder nicht angemessen versorgen können, dann kann das sehr unterschiedliche Gründe haben: eine Krise in der Familie. Überforderung in der Erziehung, Krankheit, ein fehlendes Netzwerk
Trost & Stärkung. Im Ernstfall
 Trost & Stärkung Im Ernstfall feinfühlig begleiten Der Verlust eines nahe stehenden Menschen bricht in unser Leben ein und hinterlässt Trauer, Wut und Hilflosigkeit. Das normale Leben gerät aus dem Takt.
Trost & Stärkung Im Ernstfall feinfühlig begleiten Der Verlust eines nahe stehenden Menschen bricht in unser Leben ein und hinterlässt Trauer, Wut und Hilflosigkeit. Das normale Leben gerät aus dem Takt.
IV Der personzentrierte Ansatz und die Bindungstheorie
 Seminar: Psychotherapeutische Methoden in der Beratung Sitzung:13.06.2013 IV Der personzentrierte Ansatz und die Bindungstheorie Von Dieter Höger Referenten: Bettina Tomascsik, Elena Schweikert, Kristina
Seminar: Psychotherapeutische Methoden in der Beratung Sitzung:13.06.2013 IV Der personzentrierte Ansatz und die Bindungstheorie Von Dieter Höger Referenten: Bettina Tomascsik, Elena Schweikert, Kristina
Helfen Sie einem. anderen Kind, obenauf zu sein bewerben Sie sich für eine. Erziehungsstelle!
 Helfen Sie einem anderen Kind, obenauf zu sein bewerben Sie sich für eine Erziehungsstelle! Warum manche Kinder NEUE PERSPEKTIVEN brauchen Es gibt Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten
Helfen Sie einem anderen Kind, obenauf zu sein bewerben Sie sich für eine Erziehungsstelle! Warum manche Kinder NEUE PERSPEKTIVEN brauchen Es gibt Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten
Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe ein Weg aus der Ohnmacht. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen (Wilma Weiß, 41)
 Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe ein Weg aus der Ohnmacht Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen (Wilma Weiß, 41) Wer sind wir? Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz, Münster
Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe ein Weg aus der Ohnmacht Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen (Wilma Weiß, 41) Wer sind wir? Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz, Münster
Vorgehen im Umgang mit suchtbelasteten Familien in der Jugendhilfe
 Vorgehen im Umgang mit suchtbelasteten Familien in der Jugendhilfe Hans Leitner Geschäftsführer Start ggmbh Leiter der Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg Fachliche Hinweise zur Unterstützung,
Vorgehen im Umgang mit suchtbelasteten Familien in der Jugendhilfe Hans Leitner Geschäftsführer Start ggmbh Leiter der Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg Fachliche Hinweise zur Unterstützung,
WORKSHOP "KINDER & SCHULD" Sandra Bergmann BKNFS Hamburg
 WORKSHOP "KINDER & SCHULD" Sandra Bergmann BKNFS 05. 07.06.2013 Hamburg S.Bergmann@psnv drk.de PHYSISCHEBESONDERHEITEN VON KINDERN IN NOTFÄLLEN Größerer Flüssigkeits &Wärmeverlust als Erwachsene Wahrnehmung
WORKSHOP "KINDER & SCHULD" Sandra Bergmann BKNFS 05. 07.06.2013 Hamburg S.Bergmann@psnv drk.de PHYSISCHEBESONDERHEITEN VON KINDERN IN NOTFÄLLEN Größerer Flüssigkeits &Wärmeverlust als Erwachsene Wahrnehmung
Inhalt Autismusspektrumsstörung: Eltern verstehen hilfreich kommunizieren
 Autismusspektrumsstörung: Eltern verstehen hilfreich kommunizieren Coesfeld, 12.11.2014 2 Inhalt 1. Die Zusammenarbeit mit Eltern 2. Besondere Kinder - Besondere Eltern? 3. Exkurs: Wir gegen den Rest der
Autismusspektrumsstörung: Eltern verstehen hilfreich kommunizieren Coesfeld, 12.11.2014 2 Inhalt 1. Die Zusammenarbeit mit Eltern 2. Besondere Kinder - Besondere Eltern? 3. Exkurs: Wir gegen den Rest der
Reinhardts Gerontologische Reihe Band 33
 a Reinhardts Gerontologische Reihe Band 33 Wilhelm Stuhlmann Demenz braucht Bindung Wie man Biographiearbeit in der Altenpflege einsetzt 2., überarbeitete Auflage Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst
a Reinhardts Gerontologische Reihe Band 33 Wilhelm Stuhlmann Demenz braucht Bindung Wie man Biographiearbeit in der Altenpflege einsetzt 2., überarbeitete Auflage Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst
Fortbildung Beratung Betreuung
 Fortbildung Beratung Betreuung für Pflege- / Adoptivfamilien mobil kompetent praxisnah Leitung Bereich Fortbildung: Barbara Lütgen-Wienand PfliZ-im-Nest Münchener Straße 11a 12309 Berlin Tel. / Fax 030
Fortbildung Beratung Betreuung für Pflege- / Adoptivfamilien mobil kompetent praxisnah Leitung Bereich Fortbildung: Barbara Lütgen-Wienand PfliZ-im-Nest Münchener Straße 11a 12309 Berlin Tel. / Fax 030
Ich lasse Dich gehen
 Ich lasse Dich gehen RPB 2.11.2015 Umbruch, Stolperstein, der uns aus dem Tritt geraten lässt oder gar aus dem Trott und uns einlädt, achtsamer weiterzugehen 1 Fragen und belastende Momente in der Beziehung
Ich lasse Dich gehen RPB 2.11.2015 Umbruch, Stolperstein, der uns aus dem Tritt geraten lässt oder gar aus dem Trott und uns einlädt, achtsamer weiterzugehen 1 Fragen und belastende Momente in der Beziehung
Geschwister in Pflegefamilien getrennte oder gemeinsame Vermittlung? Berlin, Dipl. Päd. Daniela Reimer Universität Siegen
 Geschwister in Pflegefamilien getrennte oder gemeinsame Vermittlung? Berlin, 23.09.2013 Dipl. Päd. Daniela Reimer Universität Siegen http://www.youtube.com/watch?v=zkv96_w1mew "Geschwisterbindungen reichen
Geschwister in Pflegefamilien getrennte oder gemeinsame Vermittlung? Berlin, 23.09.2013 Dipl. Päd. Daniela Reimer Universität Siegen http://www.youtube.com/watch?v=zkv96_w1mew "Geschwisterbindungen reichen
Hintergrundwissen Trauma. E. L. Iskenius, Rostock
 Hintergrundwissen Trauma E. L. Iskenius, Rostock Wichtig!!! Zunächst den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, auch zum Überleben, seinen Ressourcen und seinen Stärken begegnen. Reaktionen auf das Trauma
Hintergrundwissen Trauma E. L. Iskenius, Rostock Wichtig!!! Zunächst den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, auch zum Überleben, seinen Ressourcen und seinen Stärken begegnen. Reaktionen auf das Trauma
Schutz des Pflegekindes: Rechtliche Anforderungen und fachlicher Alltag
 Schutz des Pflegekindes: Rechtliche Anforderungen und fachlicher Alltag Kinder in Pflegefamilien Förderung Beteiligung Schutz Dr. Thomas Meysen Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)
Schutz des Pflegekindes: Rechtliche Anforderungen und fachlicher Alltag Kinder in Pflegefamilien Förderung Beteiligung Schutz Dr. Thomas Meysen Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)
KATH. KINDERTAGESEINRICHTUNG REGENBOGENLAND AM SPORTPLATZ FAULBACH TEL: HANDY:
 DIE EINGEWÖHNUNGSZEIT IN DER PIEPMATZKRIPPE KATH. KINDERTAGESEINRICHTUNG REGENBOGENLAND AM SPORTPLATZ 4 97906 FAULBACH TEL: 09392-1892 HANDY: 0175-5321349 E-Mail: leitung@regenbogenland-faulbach.de Liebe
DIE EINGEWÖHNUNGSZEIT IN DER PIEPMATZKRIPPE KATH. KINDERTAGESEINRICHTUNG REGENBOGENLAND AM SPORTPLATZ 4 97906 FAULBACH TEL: 09392-1892 HANDY: 0175-5321349 E-Mail: leitung@regenbogenland-faulbach.de Liebe
Bindung. Definition nach John Bowlby:
 Bindung und Bildung Bindung Definition nach John Bowlby: Beziehung ist der übergeordnete Begriff Bindung ist Teil von Beziehung Mutter und Säugling sind Teilnehmer/innen in einem sich wechselseitig bedingenden
Bindung und Bildung Bindung Definition nach John Bowlby: Beziehung ist der übergeordnete Begriff Bindung ist Teil von Beziehung Mutter und Säugling sind Teilnehmer/innen in einem sich wechselseitig bedingenden
Fortbildungsprogramm 2018
 Fortbildungsprogramm 2018 für Adoptiv- und Pflegeeltern / Westfälische Pflegefamilien Wie werden wir eine Pflege-/Adoptivfamilie Informationsabend für Interessierte Der Fachdienst des SkF lädt Paare und
Fortbildungsprogramm 2018 für Adoptiv- und Pflegeeltern / Westfälische Pflegefamilien Wie werden wir eine Pflege-/Adoptivfamilie Informationsabend für Interessierte Der Fachdienst des SkF lädt Paare und
Brauche ich eine Trauerbegleitung?
 Brauche ich eine Trauerbegleitung? Fragebogen für Jugendliche Dieser Fragebogen soll dir helfen herauszufinden, ob eine Trauerbegleitung für dich sinnvoll ist. Wenn Du einen lieben Menschen durch einen
Brauche ich eine Trauerbegleitung? Fragebogen für Jugendliche Dieser Fragebogen soll dir helfen herauszufinden, ob eine Trauerbegleitung für dich sinnvoll ist. Wenn Du einen lieben Menschen durch einen
Materialienset zum traumapädagogischen Handeln
 Materialienset zum traumapädagogischen Handeln Selbsteinschätzung und Orientierung im beruflichen Alltagsdschungel 5 Traumaviereck-Karten 1 Zeitlinie 1 Ressourcenbarometer 1 Geschichte über die Zusammenarbeit
Materialienset zum traumapädagogischen Handeln Selbsteinschätzung und Orientierung im beruflichen Alltagsdschungel 5 Traumaviereck-Karten 1 Zeitlinie 1 Ressourcenbarometer 1 Geschichte über die Zusammenarbeit
Trauma-sensibles Vorgehen in
 Trauma-sensibles Vorgehen in der Intervention und Selbstfürsorge Petra Wünsche Diplom-Psychologin Traumatisches Erleben und Folgen Trauma Ereignis Emotionales Erleben Folgen (normal!) Bedrohung für Leib
Trauma-sensibles Vorgehen in der Intervention und Selbstfürsorge Petra Wünsche Diplom-Psychologin Traumatisches Erleben und Folgen Trauma Ereignis Emotionales Erleben Folgen (normal!) Bedrohung für Leib
Reise in die eigene Schwangerschaft und Geburt
 Reise in die eigene Schwangerschaft und Geburt Therapeutisches Intensiv - Seminar Frühste Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper am Ursprung lösen UNSERE UR- WUNDE UND UR- POTENTIAL BERÜHREN Wenn es
Reise in die eigene Schwangerschaft und Geburt Therapeutisches Intensiv - Seminar Frühste Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper am Ursprung lösen UNSERE UR- WUNDE UND UR- POTENTIAL BERÜHREN Wenn es
Definition Zu den beiden leiblichen Elternteilen tritt mindestens ein sozialer Elternteil hinzu, oder ein verstorbener Elternteil wird durch einen soz
 Patchworkfamilie Definition Zu den beiden leiblichen Elternteilen tritt mindestens ein sozialer Elternteil hinzu, oder ein verstorbener Elternteil wird durch einen sozialen Elternteil ersetzt. Alle Stieffamilien
Patchworkfamilie Definition Zu den beiden leiblichen Elternteilen tritt mindestens ein sozialer Elternteil hinzu, oder ein verstorbener Elternteil wird durch einen sozialen Elternteil ersetzt. Alle Stieffamilien
Demenz braucht Bindung
 Wilhelm Stuhlmann Demenz braucht Bindung Wie man Biographiearbeit in der Altenpflege einsetzt 3., aktualisierte Auflage Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Dr. med. Wilhelm
Wilhelm Stuhlmann Demenz braucht Bindung Wie man Biographiearbeit in der Altenpflege einsetzt 3., aktualisierte Auflage Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Dr. med. Wilhelm
Unser Kind lebt in einer Pflegefamilie
 Unser Kind lebt in einer Pflegefamilie Freistaat Sachsen Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales IMPRESSUM Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales Abteilung 4 - Landesjugendamt
Unser Kind lebt in einer Pflegefamilie Freistaat Sachsen Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales IMPRESSUM Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales Abteilung 4 - Landesjugendamt
Angebotskatalog für Referate, Workshops und Seminare
 Angebotskatalog für Referate, Workshops und Seminare Referat oder Workshop Starke Kinder Fit für die Zukunft! Das gesunde Selbstwertgefühl entscheidet sehr über die Qualität unseres Lebens und unserer
Angebotskatalog für Referate, Workshops und Seminare Referat oder Workshop Starke Kinder Fit für die Zukunft! Das gesunde Selbstwertgefühl entscheidet sehr über die Qualität unseres Lebens und unserer
Krisen meistern Krisen meistern: Gefahr des Scheiterns und Chance des Neuanfangs
 Krisen meistern: Gefahr des Scheiterns und Chance des Neuanfangs 1 Inhalt 1. Was ist eine Krise? 2. Arten von Krisen 3. Entstehung einer Krise 4. Die vier Phasen einer Krise 5. Einflüsse auf den Umgang
Krisen meistern: Gefahr des Scheiterns und Chance des Neuanfangs 1 Inhalt 1. Was ist eine Krise? 2. Arten von Krisen 3. Entstehung einer Krise 4. Die vier Phasen einer Krise 5. Einflüsse auf den Umgang
Kindern die Krankheit ihrer Eltern erklären
 Was macht der Krebs mit uns? Kindern die Krankheit ihrer Eltern erklären Sabine Brütting BALANCE ratgeber Empfohlen von 14 reagieren mit Aggressionen. Viele Eltern können das aggressive Verhalten zunächst
Was macht der Krebs mit uns? Kindern die Krankheit ihrer Eltern erklären Sabine Brütting BALANCE ratgeber Empfohlen von 14 reagieren mit Aggressionen. Viele Eltern können das aggressive Verhalten zunächst
Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin
 Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Definition von Trauer Psychische
Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Definition von Trauer Psychische
Generationenübergreifendes Arbeiten mit Kindern und Senioren
 Generationenübergreifendes Arbeiten mit Kindern und Senioren Noch vor 150 Jahren lebte die Mehrzahl der Menschen im ländlichen Raum. War man aufgrund des Alters nicht mehr in der Lage die tägliche Arbeit
Generationenübergreifendes Arbeiten mit Kindern und Senioren Noch vor 150 Jahren lebte die Mehrzahl der Menschen im ländlichen Raum. War man aufgrund des Alters nicht mehr in der Lage die tägliche Arbeit
Wie geht es nach der Trennung mit den Kindern weiter? Dr. Claus Koch Pädagogisches Institut Berlin
 Wie geht es nach der Trennung mit den Kindern weiter? Dr. Claus Koch Pädagogisches Institut Berlin Wie geht es nach er Trennung mit den Kindern weiter? Die Trennung Schuldgefühle Das Alter des Kindes spielt
Wie geht es nach der Trennung mit den Kindern weiter? Dr. Claus Koch Pädagogisches Institut Berlin Wie geht es nach er Trennung mit den Kindern weiter? Die Trennung Schuldgefühle Das Alter des Kindes spielt
2. Selbstbild und Rolle klar(e) Haltung zeigen Zusammenarbeit mit Eltern Problemverhalten in Fähigkeiten verwandeln 8
 Sie finden hier Ausschreibungen einiger Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen. Für eine endgültige Festlegung von Inhalten und Zielen, ist es mir wichtig, diese mit Ihnen zusammen auf der Grundlage
Sie finden hier Ausschreibungen einiger Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen. Für eine endgültige Festlegung von Inhalten und Zielen, ist es mir wichtig, diese mit Ihnen zusammen auf der Grundlage
SYTEMISCHE SELBST-INTEGRATION. Dr. med. Ero Langlotz. Psychiater, Systemtherapeut
 SYTEMISCHE SELBST-INTEGRATION Dr. med. Ero Langlotz Psychiater, Systemtherapeut BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE versteht psychische Störungen als Folge biologischer Vorgänge. Die Hypothese ist: die genetische
SYTEMISCHE SELBST-INTEGRATION Dr. med. Ero Langlotz Psychiater, Systemtherapeut BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE versteht psychische Störungen als Folge biologischer Vorgänge. Die Hypothese ist: die genetische
Stationäre Drogentherapie Bindungsorientierte Behandlungsansätze für Eltern und Kind. Udo Röser Therapiedorf Villa Lilly, Bad Schwalbach
 Stationäre Drogentherapie Bindungsorientierte Behandlungsansätze für Eltern und Kind Udo Röser Therapiedorf Villa Lilly, Bad Schwalbach Die Qualität der Mutter-Kind Bindung als Schutzfaktor für die psychische
Stationäre Drogentherapie Bindungsorientierte Behandlungsansätze für Eltern und Kind Udo Röser Therapiedorf Villa Lilly, Bad Schwalbach Die Qualität der Mutter-Kind Bindung als Schutzfaktor für die psychische
Weg-Weiser. Kinder- und Jugend-Hilfe. Hinweise in Leichter Sprache. Ein Ein Rat-Geber für für behinderte und und chronisch kranke Eltern
 Weg-Weiser Kinder- und Jugend-Hilfe Hinweise in Leichter Sprache Ein Ein Rat-Geber für für behinderte und und chronisch kranke Eltern Wer hat das Heft geschrieben? Martina Müller hat den Text geschrieben.
Weg-Weiser Kinder- und Jugend-Hilfe Hinweise in Leichter Sprache Ein Ein Rat-Geber für für behinderte und und chronisch kranke Eltern Wer hat das Heft geschrieben? Martina Müller hat den Text geschrieben.
Sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern
 . Sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern lucyna.wronska@gmx.net 01.12.2016 www.isp-dortmund.de . 01.12.2016 www.isp-dortmund.de Zwischen persönlicher Offenbarung und gesellschaftlicher Verarbeitung?
. Sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern lucyna.wronska@gmx.net 01.12.2016 www.isp-dortmund.de . 01.12.2016 www.isp-dortmund.de Zwischen persönlicher Offenbarung und gesellschaftlicher Verarbeitung?
Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst?
 Fachtagung München : Zwischen Kinderschutz und Elternrecht Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 09.06.2016 Alexander Korittko 1 Wurzeln und Flügel ! Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern,
Fachtagung München : Zwischen Kinderschutz und Elternrecht Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 09.06.2016 Alexander Korittko 1 Wurzeln und Flügel ! Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern,
Bremerhaven. (Clara Rinaldi)
 Bremerhaven Elterninformation Die ersten Tage in der Krippe Ellhornstraße Krippe Ellhornstraße Wir helfen! Verlässliche Nächstenliebe www.diakonie-bhv.de Kinder brauchen eine Umgebung, in der sie sich
Bremerhaven Elterninformation Die ersten Tage in der Krippe Ellhornstraße Krippe Ellhornstraße Wir helfen! Verlässliche Nächstenliebe www.diakonie-bhv.de Kinder brauchen eine Umgebung, in der sie sich
für eltern familien kinder jugendliche puzzle vermittlung von gastfamilien
 für eltern familien kinder jugendliche puzzle vermittlung von gastfamilien puzzle vermittlung von gastfamilien Puzzle ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche in einer Not - oder schwierigen Lebenssituation.
für eltern familien kinder jugendliche puzzle vermittlung von gastfamilien puzzle vermittlung von gastfamilien Puzzle ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche in einer Not - oder schwierigen Lebenssituation.
Du + Ich = Freundschaft
 Elterncoaching Du + Ich = Freundschaft Was wäre ein Leben ohne Freunde? Wahrscheinlich ziemlich einsam, traurig und langweilig. Freunde sind für einen da, hören zu, wenn man Probleme hat, akzeptieren einen
Elterncoaching Du + Ich = Freundschaft Was wäre ein Leben ohne Freunde? Wahrscheinlich ziemlich einsam, traurig und langweilig. Freunde sind für einen da, hören zu, wenn man Probleme hat, akzeptieren einen
Die Bedeutung der sicheren Bindung. Chancen und Risiken der kindlichen Entwicklung
 Die Bedeutung der sicheren Bindung. Chancen und Risiken der kindlichen Entwicklung Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik
Die Bedeutung der sicheren Bindung. Chancen und Risiken der kindlichen Entwicklung Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik
WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung
 WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung 1. Sensibilisierung 2. Mythen abbauen LERNZIELE 3. Sekundäre Viktimisierung verhindern
WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung 1. Sensibilisierung 2. Mythen abbauen LERNZIELE 3. Sekundäre Viktimisierung verhindern
Herzlich willkommen. Kinder und Jugendliche im Umgang mit Stress stärken. 14. März 2017 Cornelia Meierhans und Susanne Anliker
 16.03.2017 Herzlich willkommen Berner Gesundheit Kinder und Jugendliche im Umgang mit Stress stärken 14. März 2017 Cornelia Meierhans und Susanne Anliker Gemeinsam für mehr Gesundheit 1 Überblick 1. Angebote
16.03.2017 Herzlich willkommen Berner Gesundheit Kinder und Jugendliche im Umgang mit Stress stärken 14. März 2017 Cornelia Meierhans und Susanne Anliker Gemeinsam für mehr Gesundheit 1 Überblick 1. Angebote
Lernen und Motivation
 Lernen und Motivation Worauf es ankommt, wenn Sie Ihr Kind wirklich unterstützen wollen Gedanken, Ideen und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen März 2014, zusammengetragen von Hansueli Weber
Lernen und Motivation Worauf es ankommt, wenn Sie Ihr Kind wirklich unterstützen wollen Gedanken, Ideen und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen März 2014, zusammengetragen von Hansueli Weber
BAP-Workshop 2018: 28./ Folien zum Workshop 3:
 BAP-Workshop 2018: 28./29.04.2018 Folien zum Workshop 3: Leonhard Schrenker 2018 Leonhard Schrenker Diplom-Psychologe/Psychotherapeut International zertifizierter Trainer und Supervisor für Pesso-Therapie
BAP-Workshop 2018: 28./29.04.2018 Folien zum Workshop 3: Leonhard Schrenker 2018 Leonhard Schrenker Diplom-Psychologe/Psychotherapeut International zertifizierter Trainer und Supervisor für Pesso-Therapie
Wir sollten lernen. mit den Augen. des Kindes zu sehen. mit den Ohren. des Kindes zu hören. mit dem Herzen. des Kindes zu fühlen.
 Wir sollten lernen mit den Augen mit den Ohren mit dem Herzen des Kindes zu sehen des Kindes zu hören des Kindes zu fühlen Alfred Adler 1 Achtsamkeit Was verstehen Sie unter Achtsamkeit? 2 Worte wirken!
Wir sollten lernen mit den Augen mit den Ohren mit dem Herzen des Kindes zu sehen des Kindes zu hören des Kindes zu fühlen Alfred Adler 1 Achtsamkeit Was verstehen Sie unter Achtsamkeit? 2 Worte wirken!
Kindern Grenzen setzen wie geht das liebevoll und feinfühlig?
 Kindern Grenzen setzen wie geht das liebevoll und feinfühlig? Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie Ludwig-Maximilians-Universität
Kindern Grenzen setzen wie geht das liebevoll und feinfühlig? Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie Ludwig-Maximilians-Universität
Konstruktive Kommunikation Nach Marshall Rosenbergs Gewaltfreier Kommunikation
 Konstruktive Kommunikation Nach Marshall Rosenbergs Gewaltfreier Kommunikation Quelle: Marshall Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation Paderborn 2001 Die seelischen Funktionen Denken Vorstellungen Interpretationen
Konstruktive Kommunikation Nach Marshall Rosenbergs Gewaltfreier Kommunikation Quelle: Marshall Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation Paderborn 2001 Die seelischen Funktionen Denken Vorstellungen Interpretationen
Ressourcen fördern - Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen psychisch kranker Eltern
 Ressourcen fördern - Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen psychisch kranker Eltern Wissenschaftliche Mitarbeiterin Diplom- Sozialpädagogin/ Diplom- Sozialarbeiterin Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen
Ressourcen fördern - Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen psychisch kranker Eltern Wissenschaftliche Mitarbeiterin Diplom- Sozialpädagogin/ Diplom- Sozialarbeiterin Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen
Eingewöhnung. in der Kindervilla Ali Baba geben.
 Eingewöhnung in der Kindervilla Ali Baba Liebe Eltern Wir freuen uns, Sie und ihr Kind bei uns begrüssen zu dürfen. Der Eintritt in die Kindervilla ist für Ihr Kind und für Sie eine grosse Veränderung
Eingewöhnung in der Kindervilla Ali Baba Liebe Eltern Wir freuen uns, Sie und ihr Kind bei uns begrüssen zu dürfen. Der Eintritt in die Kindervilla ist für Ihr Kind und für Sie eine grosse Veränderung
Impuls Erziehungsberatung
 kjz Männedorf Impuls Erziehungsberatung Mit Eltern im Dialog Programm 2016 Gruppenangebote zu Erziehungs- und Familienfragen Der Alltag mit kleinen Kindern ist lebendig, aber auch anstrengend. Jeder Tag
kjz Männedorf Impuls Erziehungsberatung Mit Eltern im Dialog Programm 2016 Gruppenangebote zu Erziehungs- und Familienfragen Der Alltag mit kleinen Kindern ist lebendig, aber auch anstrengend. Jeder Tag
Zur Psychodynamik von Kindern, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind
 Zur Psychodynamik von Kindern, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind Evelyn Heyer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin PRISMA-SUPERVISION.DE Häusliche Gewalt Ängstigt Belastet
Zur Psychodynamik von Kindern, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind Evelyn Heyer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin PRISMA-SUPERVISION.DE Häusliche Gewalt Ängstigt Belastet
Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung. Trauma und Bindung
 Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung Trauma und Bindung Auswirkungen erlebter Traumatisierung auf die Mutter-Kind-Beziehung Trauma Was kennzeichnet ein Trauma? Ausgangspunkt:
Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung Trauma und Bindung Auswirkungen erlebter Traumatisierung auf die Mutter-Kind-Beziehung Trauma Was kennzeichnet ein Trauma? Ausgangspunkt:
Bindungstheorien Aufbau von Bindungen. FTS 2017 Prof. Dr. Kerstin Dietzel
 Bindungstheorien Aufbau von Bindungen FTS 2017 Prof. Dr. Kerstin Dietzel Gliederung 1. Aufbau des Bindungssystems 2. Phasen der Mutter-Kind-Beziehung 3. Bindung und Exploration 4. Fremde Situation 5. Bindung
Bindungstheorien Aufbau von Bindungen FTS 2017 Prof. Dr. Kerstin Dietzel Gliederung 1. Aufbau des Bindungssystems 2. Phasen der Mutter-Kind-Beziehung 3. Bindung und Exploration 4. Fremde Situation 5. Bindung
Meine Zukunft beginnt JETZT!
 Meine Zukunft beginnt JETZT! Ein kleiner Leitfaden zur persönlichen Zukunftsgestaltung. Lebenshilfe Vorarlberg, im September 2011 Menschen brauchen Menschen. Lebenshilfe Vorarlberg Sieh Dir den Weg genau
Meine Zukunft beginnt JETZT! Ein kleiner Leitfaden zur persönlichen Zukunftsgestaltung. Lebenshilfe Vorarlberg, im September 2011 Menschen brauchen Menschen. Lebenshilfe Vorarlberg Sieh Dir den Weg genau
Daneben und doch mittendrin
 Daneben und doch mittendrin Eine Geschichte aus dem Leben aus meinem Leben! Es geht um meine Geschichte und um Erfahrungen aus meinem Leben. Deshalb möchte ich mich zuerst kurz vorstellen. Ich bin 39 Jahre
Daneben und doch mittendrin Eine Geschichte aus dem Leben aus meinem Leben! Es geht um meine Geschichte und um Erfahrungen aus meinem Leben. Deshalb möchte ich mich zuerst kurz vorstellen. Ich bin 39 Jahre
Dürfen Geschwister getrennt werden?
 Dürfen Geschwister getrennt werden? Rechtliche und psychologische Aspekte-ein Widerspruch? :»Geschwister gehören zusammen!»? Im Kontext von Fremdplatzierungen 1. Konstellationen der Unterbringung 2. Hypothesen
Dürfen Geschwister getrennt werden? Rechtliche und psychologische Aspekte-ein Widerspruch? :»Geschwister gehören zusammen!»? Im Kontext von Fremdplatzierungen 1. Konstellationen der Unterbringung 2. Hypothesen
