Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben
|
|
|
- Ilse Geisler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben Schwerpunktbericht zur Trendanalyse des Nationalen Aktionsplanes für das Umsetzungsjahr 2000 Berichtsband 1
2
3 Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben Schwerpunktbericht zur Trendanalyse des Nationalen Aktionsplanes für das Umsetzungsjahr 2000 Petra Gregoritsch Monika Kalmár Günter Kernbeiß Ursula Lehner Berichtsband 1 des Gesamtprojektes
4 Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten der Frauen Stubenring 1, A-1010 Wien. Redaktion: Agnes Schulmeister Für den Inhalt verantwortlich: a.o. Univ.-Prof. Dr. Michael Wagner-Pinter Synthesis Forschung, Agnes Schulmeister. Druck: BMLV Heeresdruckerei, Wien Nachdruck: 2007 Wien 2002
5 Vorwort Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat Synthesis Forschung im Dezember 2000 mit der Aufgabe betraut, die Differenzen zwischen Frauen und Männern im Erwerbsleben zu untersuchen. Ein besonderer Wert ist in diesem Zusammenhang darauf gelegt worden, die Untersuchung bis an den aktuellen Zeitrand heranzuführen, eine alle Erwerbspersonen und Arbeitgeberbetriebe erfassende Datenbasis zu nutzen und für analytische Zwecke einen hohen Differenzierungsgrad bei der Bestimmung von Ursachenfeldern einzusetzen. Als ersten Teil der Untersuchung legt Synthesis Forschung nun den Bericht»Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben«vor. Der Bericht dient als Grundlage für die im Nationalen Aktionsplan vorgesehenen jährlichen Trendanalysen zur Säule IV des Nationalen Aktionsplanes (»Chancengleichheit«). Der Bericht führt nun Ende März 2001 die Darstellung bis an den aktuellen Zeitrand (das Jahr 2000 ist vollständig eingeschlossen) heran; dies bedingt, dass die verwendete Datenbasis als»vorläufig«anzusehen ist. Gewisse Revisionen werden unter Umständen in den kommenden Monaten auftreten, ohne dass deshalb die zentralen Befunde dadurch erschüttert würden. Für die Synthesis Forschung: Mag a. Petra Gregoritsch
6
7 Inhalt 1 Ausgangsperspektive und zusammenfassender Befund 5 Trendanalyse als Zweck des Berichtes 7 Zielsetzungen des NAP in Hinblick auf Chancengleichheit 8 Themen der Trendanalyse 9 Zusammenfassender Befund 10 2 Analyseschwerpunkt A: Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern 11 Erwerbsbeteiligung 13 Standardbeschäftigung 14 Vollzeit- und Teilzeitarbeit 15 Arbeitslosigkeit 16 3 Analyseschwerpunkt B: unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung 23 Unterschiedliche Zugänglichkeit zu Berufspositionen 25 Beschäftigungsanteile nach Wirtschaftsabteilungen 26 Einkommensunterschiede bei Vollzeit/Teilzeit 27 Einfluss der Qualifikation auf die Einkommensdifferenz 28 Harmonisierte Indikatoren 29 4 Der SYNDEX ein Maß zur Bestimmung der Chancengleichheit 41 Vier Ursachenfelder ein Indexwert 43 Das Berichtsjahr 2000 im Lichte von SYNDEX 44 5 Datengrundlagen 45 Der Datenkörper Synthesis-Erwerb 47 Datenquellen 48 Verknüpfung der Daten 49 Arbeitsplatzkonzept 50
8 Inhalt Anhang Begriffserläuterungen 53 Verzeichnis der Berufe 57 Verzeichnis der Qualifikationen 61 Verzeichnis der Wirtschaftsabteilungen 62 Verzeichnis der Tabellen 65 Verzeichnis der Grafiken 68 Verzeichnis der Projektberichte 70
9 Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben 1 Ausgangsperspektive und zusammenfassender Befund Trendanalyse als Zweck des Berichtes 7 Zielsetzungen des NAP in Hinblick auf Chancengleichheit 8 Themen der Trendanalyse 9 Zusammenfassender Befund 10 5
10 6
11 und zusammenfassender Befund Trendanalyse 1 Ausgangsperspektive und zusammenfassender Befund 1 Ausgangsperspektive als Zweck des Berichtes Der Nationale Aktionsplan: Ziele, Maßnahmen, Fortschrittsberichterstattung Entwicklung des Arbeitsmarktes in Bezug auf die angestrebten Ziele Im Rahmen des so genannten»luxemburger Prozesses«erstellt der Europäische Rat jährlich die Leitlinien zur Europäischen Beschäftigungsstrategie. An diesen Leitlinien orientieren sich die Nationalen Aktionspläne, die von den einzelnen Unionsmitgliedern erstellt werden. In diesen Nationalen Aktionsplänen werden einerseits die angestrebten Ziele und die in Aussicht genommenen Maßnahmen dargestellt; andererseits kommt es zu einer Fortschrittsberichterstattung. Eine solche Fortschrittsberichterstattung erfolgt stets aus mehreren Perspektiven. Eine der Perspektiven betrifft die Zielsetzungen. Eine zweite Perspektive gilt den Erfahrungen bei der Implementierung von Maßnahmen und Programmen, die im NAP angekündigt wurden. Aus einer dritten Perspektive werden die unmittelbaren Wirkungen, die von den gesetzten Maßnahmen ausgehen, untersucht. Eine vierte Perspektive widmet sich der Frage: Inwieweit entsprechen die beobachteten Entwicklungen den angestrebten Zielen? An dieser vierten Frage sind die folgenden Befunde in Hinblick auf die»chancengleichheit von Frauen und Männern«orientiert. Grafik 1 Evaluation des Nationalen Aktionsplanes aus spezifischen Perspektiven Evaluierung des NAP Empirische Politische Zielsetzungen Implementierung der angekündigten Maßnahmen Beobachtbare Wirkungen der gesetzten Maßnahmen Trendanalysen der Entwicklungen zu den relevanten Zielsetzungen 7
12 1 Ausgangsperspektive und zusammenfassender Befund Zielsetzungen des NAP in Hinblick auf Chancengleichheit Um jene Entwicklungen abgrenzen zu können, auf die sich eine empirische Trendanalyse zu konzentrieren hat, ist es notwendig, die Zielsetzungen des NAP im Bereich»Chancengleichheit von Frauen und Männern«abzugrenzen.»Gender Mainstreaming«als Ziel 3 Leitlinien zur Chancengleichheit Leitlinie 17 Die Europäische Beschäftigungsstrategie markiert die Zielsetzung der Herstellung von Chancengleichheit auf doppelte Weise: Einerseits wird»chancengleichheit«als eine Art von Querschnittsmaterie angesehen, die es überall einzubringen gilt (»Gender Mainstreaming«); sämtliche statistischen Befunde zu den Nationalen Aktionsplänen sind deshalb nach Frauen und Männern getrennt auszuweisen. Andererseits ist die Chancengleichheit auch das Thema einer der vier»säulen«des Nationalen Aktionsplanes. In dieser IV. Säule sind die drei»leitlinien«gesondert angeführt. Im Rahmen des vorliegenden Berichtes werden jene Entwicklungen dargestellt, die den»abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede«(Leitlinie 17) betreffen. Grafik 2 Ziele des Nationalen Aktionsplanes 2001 Die drei Leitlinien im Rahmen der Säule IV Verstärkung der Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen und Männer (= Säule IV des NAP) Verwirklichung der Chancengleichheit Abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede Vereinbarkeit von Familie und Beruf 8
13 1 Ausgangsperspektive und zusammenfassender Befund Themen der Trendanalyse Aus den allgemeinen und speziellen Zielsetzungen der»chancengleichheit«ergibt sich ein Themenkreis jener Bereiche, die für die Befunde zu den Differenzen zwischen Frauen und Männern darzustellen sind. 5 Untersuchungsfelder: Erwerbsbeteiligung, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Arbeitszeit, Einkommen Ausgangspunkt des Themenkreises ist die Frage, inwieweit überhaupt eine aktive Beteiligung am Erwerbsleben zu beobachten ist. Daran schließt die Untersuchung darüber an, inwieweit es gelingt, die angestrebte Erwerbsbeteiligung auch tatsächlich in Beschäftigung umzusetzen. Diesem Themenbereich gehört (gewissermaßen als Gegenstück) die Darstellung des»ausmaßes an Arbeitslosigkeit«unter Männern und Frauen an. In Bezug auf eine Nutzung des mit Beschäftigung verbundenen Erwerbspotentials bildet die Differenzierung nach Teilzeit und Vollzeitarbeit ein weiteres relevantes Untersuchungsfeld. Der Abschluss des Themenkreises ist dann der Frage gewidmet: Wie wirken sich die einzelnen Elemente der Erwerbsbeteiligung auf die Stellung von Frauen und Männern in der österreichischen Einkommenspyramide aus? Grafik 3 Arbeitsmarktbezogene»Differenzen zwischen Geschlechtern«Komponenten der Analyse Dimensionen des Arbeitsmarktgeschehens, in denen "Gender Gaps" identifiziert und in ihrer Entwicklung empirisch dokumentiert werden Beschäftigung Arbeitslosigkeit Erwerbsbeteiligung Wochenarbeitszeit Einkommen 9
14 1 Ausgangsperspektive und zusammenfassender Befund Grafik 4. Grafik 4. Zusammenfassender Befund Bei der Abwägung einzelner Faktoren ergibt sich für Österreich der Befund einer Konvergenz der Erwerbschancen zwischen Frauen und Männern. Diese Konvergenz zeigt sich sowohl bei einer mittelfristigen Betrachtung für die Jahre 1995 bis 2000 als auch in Hinblick auf das NAP-Umsetzungsjahr Die im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes gesetzten beschäftigungspolitischen Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass es im Jahr 2000 zu einer Konvergenz zwischen Frauen und Männern in folgenden Bereichen gekommen ist: Erwerbsbeteiligung Standardbeschäftigung Arbeitslosigkeit Der größte Unterschied besteht noch immer im Bereich der Erwerbseinkommen. So hat beim Einkommen aus unselbstständiger Beschäftigung die Differenz zwischen Frauen und Männern zugenommen. Lesebeispiel: Die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung (dargestellt durch die Erwerbsquoten) hat sich um 8 Indexpunkte verringert. (Rechenbeispiel: Erwerbsquoten 2000: Frauen: 67,8%, Männer: 77,3%. Die Differenz von 9,5%-Punkten ergibt bezogen auf 67,8% 14 Indexpunkte. Erwerbsquoten 1995: Frauen: 62,8%, Männer: 76,3%. Die Differenz von 13,8%-Punkten ergibt bezogen auf 62,8% 22 Indexpunkte = 8 Indexpunkte.) Grafik 4 Konvergenz/Divergenz zwischen Frauen und Männern Veränderung der Ungleichheit von 1995 auf ,0 Indexpunkte Erwerbsquote -9,0 Indexpunkte -4,5 Indexpunkte Verringerung der Ungleichheit im Bereich»Erwerbsbeteiligung«Einkommensdifferenz wächst weiter Beschäftigungsquote Arbeitslosenquote 1,6 Prozentpunkte Einkommen 0 Indexpunkte SYNDEX Weiterführende Informationen zum Syndex im Anhang. 10
15 Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben 2 Analyseschwerpunkt A: Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Erwerbsbeteiligung 13 Standardbeschäftigung 14 Vollzeit- und Teilzeitarbeit 15 Arbeitslosigkeit 16 11
16 12
17 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern 2 Erwerbsbeteiligung Tabelle 3. Tabelle 3 und 4, Grafik 5. Tabelle 5. Die Erwerbsbeteiligung der Frauen steigt Der Differenzindex der Erwerbsbeteiligung sinkt Im Jahr 2000 hat die Erwerbsbeteiligung der Frauen gegenüber 1999 deutlich zugenommen. Dagegen ist die Erwerbsbeteiligung der Männer etwas gefallen. Dies führt zu einer Abnahme des Differenzindex für die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern. Dieser Differenzindex errechnet sich in zwei Schritten: Im ersten Schritt wird die Differenz der Erwerbsquoten zwischen Frauen und Männern (in Prozentpunkten ausgedrückt) gebildet; im zweiten Schritt wird diese Differenz auf die kleinere Quote (die Erwerbsquote der Frauen) bezogen. Für Österreich lässt sich mittelfristig ein Trend konstatieren, in dem Frauen in ihrer Erwerbsbeteiligung gegenüber Männern aufholen. Die Erwerbsquote von Frauen (inkl. geringfügige Beschäftigung) hat zwischen 1995 und 2000 um fünf Prozentpunkte zugenommen. Dadurch ist der Differenzindex der Erwerbsbeteiligung innerhalb von fünf Jahren um ein gutes Drittel zurückgegangen. Besonders ausgeprägt ist die (mittelfristige) Zunahme der Erwerbsbeteiligung (ohne geringfügige Beschäftigung) von Frauen der Altersgruppen»25 29 Jahre«und»50 54 Jahre«. Lesebeispiel: Im Jahr 1995 betrug die Erwerbsquote der Frauen 62,8%, die der Männer 76,6%. Die Erwerbsquote der Männer lag damit um 22 Indexpunkte höher als jene der Frauen. (Rechenbeispiel: Erwerbsquoten 1995: Frauen: 62,8%, Männer: 76,3%. Die Differenz von 13,8%-Punkten ergibt bezogen auf 62,8% 22 Indexpunkte.) Grafik 5 Die Erwerbsbeteiligung der Frauen steigt stärker Erwerbsquoten von Frauen und Männern 1995, 1999 und ,8% 76,6% 77,8% 77,3% 22 Indexpunkte 66,8% 16,5 67,8% Indexpunkte 14 Indexpunkte Frauen Männer Weiterführende Informationen in Tabelle 3. 13
18 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabellen 4 und 5, Grafik 6. Tabelle 5. Grafik 6. Mehr Frauen in Standardbeschäftigung Der Differenzindex der Standardbeschäftigungsquote sinkt Standardbeschäftigung Die erhöhte Erwerbsbeteiligung führt Frauen vor allem in (voll sozialversicherungspflichtige) Standardbeschäftigungsverhältnisse. Im Laufe der neunziger Jahre ist dabei eine wichtige»marke«überschritten worden. Die Standardbeschäftigung erreichte 1995 noch nicht ganz die Hälfte der Zahl der Frauen im erwerbsfähigen Alter (das heißt Jahre). Im Jahr 1999 war dagegen die Hälfte schon überschritten: Im Jahr 2000 hat die Standardbeschäftigungsquote der Frauen um weitere 1,2 Prozentpunkte zugenommen. Stark überdurchschnittliche Zuwächse der Standardbeschäftigungsquote sind in der Altersgruppe»50 54 Jahre«zu verzeichnen. Da zudem die Beschäftigungsquote der Männer fällt, nimmt der Differenzindex in Bezug auf die Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern deutlich ab. Lesebeispiel: Im Jahr 1995 betrug die Standardbeschäftigungsquote der Frauen 49,4%, die der Männer 63,7%. Die Standardbeschäftigungsquote der Männer lag damit um 29 Indexpunkte höher als jene der Frauen. (Rechenbeispiel: Standardbeschäftigungsquoten 1995: Frauen: 49,4%, Männer: 63,7%. Die Differenz von 14,3%-Punkten ergibt bezogen auf 49,4% 29 Indexpunkte.) Grafik 6 Frauen gewinnen bei Standardbeschäftigung an Terrain Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern 1995, 1999 und ,4% 63,7% 63,2% 63,1% 29 Indexpunkte 20 Indexpunkte 51,3% 23 52,5% Indexpunkte Frauen Männer Weiterführende Informationen in Tabelle 4. 14
19 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern 1 Geringfügige Beschäftigung ist nicht enthalten. Tabelle 6, Grafik 7. Grafik Wochenstunden als Grenze zwischen Vollzeit und Teilzeit Knapp 8% der Frauen im erwerbsfähigen Alter sind teilzeitbeschäftigt Vollzeit- und Teilzeitarbeit Die Ausweitung der Beschäftigung führt Frauen zum Teil auf Arbeitsplätze, auf denen die Wochenarbeitszeit deutlich unter der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit liegt. Im Folgenden wird eine Wochenarbeitszeit von weniger als 30 Stunden als»teilzeit«1 bezeichnet. Wochenarbeitszeiten ab 30 Stunden gelten als»vollzeit«; dies ist weniger als die kollektivvertragliche Standardwochenarbeitszeit. Diese Vorgehensweise entspricht einer Empfehlung der OECD. Im Kreis aller Männer im erwerbsfähigen Alter (15 64 Jahre) hat der Bestand an Teilzeitbeschäftigung rund 1,4% ausgemacht. Bei den Frauen hat die analoge Teilzeitbeschäftigungsquote im Jahr 2000 rund 7,7% betragen. Der Differenzindex für die Teilzeitbeschäftigungsquote ergibt für das Jahr 2000 einen Indexwert von 450 Indexpunkten. (Die Teilzeitbeschäftigungsquote der Frauen ist somit um das Viereinhalbfache höher als jene der Männer.) Dies stellt ein erhebliches Ursachenfeld für Einkommensungleichheit dar. Im Bereich der Vollzeitbeschäftigung wird ein Indexwert von 37,5 Punkten für den Unterschied in den Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern erreicht. Lesebeispiel: Im Jahr 2000 betrug die Vollzeitbeschäftigungsquote der Frauen 44,8%, die der Männer 61,6%. Die Vollzeitbeschäftigungsquote der Männer lag damit um 37,5 Indexpunkte höher als jene der Frauen. (Rechenbeispiel: Vollzeitbeschäftigungsquoten 2000: Frauen: 44,8%, Männer: 61,6%. Die Differenz von 16,8%-Punkten ergibt bezogen auf 44,8% 37,5 Indexpunkte.) Grafik 7 Kleinteilige Arbeitszeitverhältnisse auf Frauen konzentriert Voll- und Teilzeitbeschäftigungsquoten von Frauen und Männern ,8% 61,6% 37,5 Indexpunkte 7,7% 450 Indexpunkte 5,6% 1,4% 2,0% 180 Indexpunkte Vollzeit Teilzeit Geringfügige Beschäftigung Frauen Männer Weiterführende Informationen in Tabelle 6. 15
20 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabellen 3, 4 und 5, Grafik 8. Grafik 8. Arbeitslosenquote sinkt bei Frauen und Männern Bei Frauen führt erhöhte Beschäftigung zu sinkender Arbeitslosenquote Arbeitslosigkeit 1999 und 2000 fällt in Österreich die Arbeitslosigkeit. Dies hat bei steigender Beschäftigung die Arbeitslosenquote abnehmen lassen. Diese hat nach österreichischer (nicht»harmonisierter«) Berechnungsmethode im Jahr 2000 rund 6,2% für Frauen und rund 5,8% für Männer betragen (ohne Karenzgeldbezieher/innen und Präsenzdiener). Von den beiden Bestimmungsfaktoren der Arbeitslosenquote (Bestand an Arbeitslosen, bezogen auf die Summe an Arbeitslosen und Beschäftigten) ist für die Frauen die Beschäftigungsentwicklung maßgeblicher, während bei den Männern die sinkende Arbeitslosigkeit den Ausschlag gibt. Im Jahr 1999 zeigte der Differenzindex in Bezug auf die Arbeitslosenquote noch einen Unterschied von 11 Indexpunkten an; im Jahr 2000 ist der Unterschied auf 7 Indexpunkte zurückgegangen. Lesebeispiel: Im Jahr 1995 betrug die Arbeitslosenquote der Frauen 7,2%, die der Männer 6,4%. Die Arbeitslosenquote der Männer lag damit um 12,5 Indexpunkte höher als jene der Frauen. (Rechenbeispiel: Arbeitslosenquoten 1995: Frauen: 7,2%, Männer: 6,4%. Die Differenz von 0,8%- Punkten ergibt bezogen auf 6,4% 12,5 Indexpunkte.) Grafik 8 Arbeitslosenquote der Frauen fällt rascher Arbeitslosenquoten von Frauen und Männern 1995, 1999 und ,2% 7,2% 6,4% 12,5 6,5% Indexpunkte 11 Indexpunkte 6,2% 5,8% 7 Indexpunkte Frauen Männer Informationen in Tabelle 4. 16
21 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabelle 1 Frauen und Männer in der österreichischen Wohnbevölkerung im Erwerbsalter Altersgruppen und Qualifikationen nach Geschlecht 1995, 1999 und Veränderung 1999/2000 Veränderung 1995/2000 Alle Frauen ,3% +1,1% Alter Jahre ,3% 6,0% Jahre ,2% 16,2% Jahre ,4% +6,7% Jahre ,3% +9,5% Jahre ,8% 3,0% Jahre ,8% +12,8% Qualifikation Universität/Hochschule ,0% +18,6% Höhere Schule mit Matura ,1% +12,4% Fachschule ohne Matura ,4% +1,9% Lehrabschluss/Meisterprüf ,1% +12,2% Pflichtschulabschluss ,7% 13,1% Alle Männer ,4% +1,0% Alter Jahre ,2% 6,1% Jahre ,8% 20,6% Jahre ,2% +4,9% Jahre ,3% +9,4% Jahre ,1% 1,1% Jahre ,8% +12,8% Jahre ,7% +14,9% Qualifikation Universität/Hochschule ,8% +11,7% Höhere Schule mit Matura ,6% +4,8% Fachschule ohne Matura ,5% +1,4% Lehrabschluss/Meisterprüf ,6% +10,9% Pflichtschulabschluss ,9% 19,6% Rohdaten: Statistik Austria. Für 2000: Synthesis- Fortschreibung. 17
22 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabelle 2 Arbeitsmarktaktivitäten der österreichischen Wohnbevölkerung Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Erwerbsbeteiligung 1995, 1999 und Veränderung 1999/2000 Veränderung 1995/2000 Erwerbsaktiv ,4% +5,1% Standardbeschäftigung ,0% +3,2% Geringfügige Beschäftigung ,0% +61,8% Sonst. unselbst. Beschäftigung ,4% Selbstständige Beschäftigung ,4% +4,9% Arbeitslosigkeit ,4% 9,9% Beschäftigungsquote 7 69,1% 68,4% 65,9% +0,8 PP +3,2 PP Arbeitslosenquote 8 6,0% 6,8% 6,8% 0,8 PP 0,8 PP Erwerbsquote 9 72,8% 72,6% 70,0% +0,2 PP +2,8 PP 1 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger und unselbstständiger Beschäftigung (inklusive geringfügiger und sonstiger Beschäftigung, ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) und vorgemerkter Arbeitslosigkeit (= Arbeitskräftepotential). 2 Jahresdurchschnittsbestand an voll versicherungspflichtiger unselbständiger Beschäftigung. 3 Jahresdurchschnittsbestand an geringfügiger Beschäftigung. 4 Jahresdurchschnittsbestand an freien Dienstverträgen und Werkverträgen (laut ASVG). 5 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger Beschäftigung in und außerhalb der Landwirtschaft. 6 Jahresdurchschnittsbestand an vorgemerkter Arbeitslosigkeit. 7 Jahresdurchschnittsbestand an selbst- ständiger und unselbst-ständiger Beschäftigung (inklusive geringfügiger Beschäftigung und sonstiger unselbstständiger Beschäftigung, ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). 8 Jahresdurchschnittsbestand an vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf das standardbeschäftigte Arbeitskräftepotential (=Standardbeschäftigung und Arbeitslosigkeit). 9 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger und unselbstständiger Beschäftigung (inklusive geringfügiger Beschäftigung und sonstiger unselbstständiger Beschäftigung, ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) und vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). Anmerkung: PP-Prozentpunkte Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik, Bevölkerungsfortschreibung), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 18
23 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabelle 3 Arbeitsmarktaktivitäten von Frauen und Männern Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Erwerbsbeteiligung nach Geschlecht 1995, 1999 und Veränderung 1999/2000 Veränderung 1995/2000 Frauen Erwerbsaktiv ,2% +9,3% Standardbeschäftigung ,1% +7,4% Geringfügige Beschäftigung ,8% +58,0% Sonst. unselbst. Beschäftigung ,8% Selbstständige Beschäftigung ,3% 0,5% Arbeitslosigkeit ,4% 9,3% Beschäftigungsquote 7 64,4% 62,9% 58,9% +1,5 PP +5,5 PP Arbeitslosenquote 8 6,2% 7,2% 7,2% 1,0 PP 1,1 PP Erwerbsquote 9 67,8% 66,8% 62,8% +1,0 PP +5,1 PP Männer Erwerbsaktiv ,3% +2,0% Standardbeschäftigung ,1% +0,1% Geringfügige Beschäftigung ,4% +72,2% Sonst. unselbst. Beschäftigung ,0% Selbstständige Beschäftigung ,9% +8,8% Arbeitslosigkeit ,5% 10,4% Beschäftigungsquote 7 73,4% 73,4% 72,2% +1,3 PP Arbeitslosenquote 8 5,8% 6,5% 6,4% 0,7 PP 0,6 PP Erwerbsquote 9 77,3% 77,8% 76,6% 0,5 PP +0,8 PP 1 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger und unselbstständiger Beschäftigung (inklusive geringfügiger und sonstiger Beschäftigung, ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) und vorgemerkter Arbeitslosigkeit. (= Arbeitskräftepotential). 2 Jahresdurchschnittsbestand an voll versicherungspflichtiger unselbständiger Beschäftigung. 3 Jahresdurchschnittsbestand an geringfügiger Beschäftigung. 4 Jahresdurchschnittsbestand an freien Dienstverträgen und Werkverträgen (laut ASVG). 5 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger Beschäftigung in und außerhalb der Landwirtschaft. 6 Jahresdurchschnittsbestand an vorgemerkter Arbeitslosigkeit. 7 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger und unselbstständiger Beschäftigung (inkl. geringf. und sonst. Beschäftigung, ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). 8 Jahresdurchschnittsbestand an vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf das standardbeschäftigte Arbeitskräftepotential (=Standardbeschäftigung und Arbeitslosigkeit). 9 Jahresdurchschnittsbestand an selbstständiger und unselbstständiger Beschäftigung (inkl. geringf. und sonst. Beschäftigung, ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) und vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). Anmerkung: PP-Prozentpunkte Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik, Bevölkerungsfortschreibung), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 19
24 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabelle 4 Teilnahme am unselbstständigen Erwerbsleben von Frauen und Männern Erwerbsquoten, Beschäftigungsquoten und Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen 1995, 1999 und Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Erwerbsquote/ Standardbeschäftigung 1 56,0% 67,0% 55,3% 67,7% 53,3% 68,0% Jahre 45,7% 54,5% 48,6% 55,3% 50,4% 56,0% Jahre 65,0% 76,5% 64,1% 76,8% 59,0% 77,7% Jahre 63,8% 81,2% 62,4% 81,3% 59,2% 82,6% Jahre 65,8% 79,3% 64,0% 79,5% 61,5% 80,5% Jahre 55,8% 72,3% 54,3% 70,9% 47,1% 67,9% Jahre 18,2% 50,7% 18,5% 51,7% 18,1% 52,0% 60 Jahre und älter 10,7% 12,4% 9,3% Standardbeschäftigungsquote 52,5% 63,1% 51,3% 63,2% 49,4% 63,7% Jahre 43,0% 51,4% 45,5% 51,8% 47,1% 52,2% Jahre 60,9% 72,2% 59,3% 72,1% 54,2% 72,6% Jahre 59,8% 77,1% 57,8% 76,8% 54,8% 77,9% Jahre 62,5% 75,3% 60,2% 75,0% 57,9% 75,9% Jahre 51,0% 67,5% 48,6% 65,3% 42,1% 62,2% Jahre 16,7% 44,9% 16,8% 45,0% 17,2% 47,2% 60 Jahre und älter 10,0% 11,7% 9,0% Arbeitslosenquote 3 6,2% 5,8% 7,2% 6,5% 7,2% 6,4% Jahre 6,0% 5,7% 6,5% 6,3% 6,6% 6,8% Jahre 6,3% 5,5% 7,5% 6,1% 8,2% 6,6% Jahre 6,2% 5,0% 7,3% 5,5% 7,5% 5,7% Jahre 5,0% 5,2% 5,9% 5,7% 5,9% 5,7% Jahre 8,5% 6,6% 10,6% 7,9% 10,7% 8,4% Jahre 8,5% 11,5% 8,7% 13,0% 4,8% 9,4% 60 Jahre und älter 6,3% 5,2% 2,8% 1 Jahresdurchschnittsbestand an Standardbeschäftigung (ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) und vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). 2 Jahresdurchschnittsbestand an Standardbeschäftigung (ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). 3 Jahresdurchschnittsbestand an vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf das standardbeschäftigte Arbeitskräftepotential. Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik, Bevölkerungsfortschreibung), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 20
25 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabelle 5 Die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung in den einzelnen Altersgruppen Veränderung von Erwerbsquoten, Beschäftigungsquoten und Arbeitslosenquoten von Frauen und Männern Veränderung 1999/2000 Veränderung 1995/2000 in Prozentpunkten in Prozentpunkten Frauen Männer Frauen Männer Erwerbsquote/Standardbeschäftigung 1 +0,7 0,7 +2,7 1, Jahre 2,9 0,8 4,7 1, Jahre +0,9 0,4 +6,0 1, Jahre +1,4 0,2 +4,6 1, Jahre +1,8 0,2 +4,3 1, Jahre +1,5 +1,3 +8,7 +4, Jahre 0,2 1,0 +0,1 1,3 60 Jahre und älter 1,7 +1,4 Standardbeschäftigungsquote 2 +1,2 0,2 +3,1 0, Jahre 2,5 0,4 4,1 0, Jahre +1,6 +0,1 +6,7 0, Jahre +2,0 +0,3 +5,1 0, Jahre +2,3 +0,3 +4,6 0, Jahre +2,5 +2,2 +8,9 +5, Jahre 0,2 0,1 0,5 2,3 60 Jahre und älter 1,7 +1,0 Arbeitslosenquote 3 1,0 0,7 1,1 0, Jahre 0,5 0,6 0,6 1, Jahre 1,2 0,6 1,9 1, Jahre 1,1 0,5 1,3 0, Jahre 0,8 0,6 0,8 0, Jahre 2,1 1,3 2,1 1, Jahre 0,2 1,4 +3,7 +2,2 60 Jahre und älter 6,3% 2,8% 60 Jahre und älter +1,1 +3,5 1 Jahresdurchschnittsbestand an Standardbeschäftigung (ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) und vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf die Bevölkerung im erwerbs- fähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). 2 Jahresdurchschnittsbestand an Standardbeschäftigung (ohne Karenzgeldbezug und Präsenzdienst) bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre, Männer: Jahre). 3 Jahresdurchschnittsbestand an vorgemerkter Arbeitslosigkeit bezogen auf das standardbeschäftigte Arbeitskräftepotential. Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik, Bevölkerungsfortschreibung), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 21
26 2 Erwerbsaktivitäten von Frauen und Männern Tabelle 6 Voll- und Teilzeitbeschäftigung von Frauen und Männern Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungsquoten nach Geschlecht 1995, 1999 und 2000 Standardbeschäftigung Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Vollzeit 1 Bestand Quote 2 44,8% 61,6% 44,0% 61,8% 42,6% 62,5% Teilzeit 3 Bestand Quote 4 7,7% 1,4% 7,3% 1,4% 6,8% 1,1% Geringfügige Beschäftigung Bestand Quote 5 5,6% 2,0% 5,4% 1,9% 3,6% 1,2% Anmerkung: Für rund Normalarbeitszeit von 30 4 Anteil des Jahresdurch- Rohdaten: Arbeitsplätze liegen keine Ar- Wochenstunden oder mehr. schnittsbestandes an Teilzeitbe- Hauptverband der Österreichi- beitszeitinformationen vor. Die 2 Anteil des Jahresdurch- schäftigung an der Bevölkerung schen Sozialversicherungsträger Summe der Bestände aller Voll- schnittsbestandes an Vollzeitbe- im erwerbsfähigen Alter (Frauen: (vorläufige Daten), Arbeitsmarkt- und Teilzeitarbeitsplätze ergibt schäftigung an der Bevölkerung Jahre, Männer: service, Statistik Austria (Arbeits- daher nicht den Gesamtbestand im erwerbsfähigen Alter (Frauen: Jahre). kräfteerhebung, Lohnsteuerstatis- an Arbeitsplätzen (vgl. Tabelle 3) Jahre, Männer: Anteil des Jahresdurch- tik, Bevölkerungsfortschreibung), Jahre). schnittsbestandes an geringfügi- Personaljahrbuch des Bundes, 3 Normalarbeitszeit von weni- ger Beschäftigung an der Bevöl- Personalinformationssystem des ger als 30 Wochenstunden, kerung im erwerbsfähigen Alter Bundes. jedoch ohne geringfügige Be- (Frauen: Jahre, Männer: schäftigung Jahre). Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 22
27 Die Stellung der Frauen im österreichischen Erwerbsleben 3 Analyseschwerpunkt B: unselbständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Unterschiedliche Zugänglichkeit zu Berufspositionen 25 Beschäftigungsanteile nach Wirtschaftsabteilungen 26 Einkommensunterschiede bei Vollzeit/Teilzeit 27 Einfluss der Qualifikation auf die Einkommensdifferenz 28 Harmonisierte Indikatoren 29 23
28 24
29 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung 1 Um den Arbeitszeiteffekt gering zu halten, erfolgt hier eine Beschränkung auf Vollzeitbeschäftigung. Tabelle»Ungleichheitsindikatoren auf Basis der EU- Definitionen«, S. 29, Tabelle 7. Tabelle 7. 3»Handwerk«und»Verwaltungsberufe«spielen größte Rolle bei Segregation Unterschiedliche Zugänglichkeit zu Berufspositionen Frauen und Männer verteilen sich in Österreich recht unterschiedlich auf die zwölf Kategorien der an der internationalen ISCO-Definition orientierten Berufsklassifikation. In diesem Zusammenhang spielen zwei Berufskategorien eine dominante Rolle: Die eine Kategorie (»Handwerkliche Berufe«) ist eine Männerdomäne, in der anderen Kategorie (»Verwaltungs- und Büroberufe«) überwiegen bei weitem Frauen. Das Berufsprofil»Handwerk mit Lehre«ist auf rund 17% der Arbeitsplätze (Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung) erforderlich; diese 17% sind aber für nahezu ein Drittel der geschlechtsbezogenen Berufssegregation in Österreich verantwortlich, wie sie in der Tabelle»Ungleichheitsindikatoren«angeführt ist. (Der Index der geschlechtsspezifischen Unterschiede nach Berufen beträgt im Jahr ,5.) Die»Verwaltungs- und Büroberufe«charakterisieren nicht ganz 20% der österreichischen Arbeitsplätze; sie sind aber für rund ein Viertel der geschlechtsspezifischen Berufssegregation verantwortlich. Mittelfristig nehmen die Handwerksberufe ab, die Verwaltungs- und Büroberufe zu. Lesebeispiel: Im Jahr 2000 waren 8,5% des Jahresdurchschnittsbestands vollzeitbeschäftigter Frauen auf Arbeitsplätzen mit dem Berufsprofil»Hoch qualifiziertes Personal«tätig. Bei den vollzeitbeschäftigten Männern betrug der entsprechende Anteil 9,8%. Die Differenz von 1,3%-Punkten entspricht bezogen auf 8,5% 15 Indexpunkte. D.h., der Beschäftigungsanteil der Männer ist in der Berufsgruppe»Hoch qualifiziertes Personal«um 15% höher als der entsprechende Anteil bei den Frauen. Grafik 9 Handwerk und Verwaltung sind großteils für Berufssegregation verantwortlich Beschäftigungsanteile in ausgewählten Berufsgruppen (Vollzeit 1 ) ,5% 33,4% 9,8% 15 9,3% Indexpunkte Hoch qualifiziertes Personal Verwaltungs- und Büropersonal 5,4% 26,5% 259 Indexpunkte 391 Indexpunkte Handwerkliches Personal Frauen Männer Weiterführende Informationen in Tabelle 8. 25
30 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung 1 Um den Arbeitszeiteffekt gering zu halten, erfolgt eine Beschränkung auf Vollzeitbeschäftigung. Tabelle 9. Grafik 10. Tabelle 10, Grafik 10. Größte Gleichverteilung in der öffentlichen Verwaltung Öffentliche Verwaltung: Höherer Beschäftigungsanteil bei Frauen Sachgüterproduktion bietet Männern mehr Arbeitsplätze Beschäftigungsanteile nach Wirtschaftsabteilungen Die öffentliche Verwaltung bietet von allen Arbeitgeber/innen die relativ größte Gleichverteilung zwischen Frauen und Männern. Das zeigt sich in Hinblick auf die Anteile von Frauen und Männern an den Beschäftigten des öffentlichen Sektors. Jeweils rund Frauen und Männer sind in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Diese Parität in der Beschäftigung führt dazu, dass die öffentliche Verwaltung für Frauen eine höhere Signifikanz als für Männer besitzt. Dies kommt in den branchenspezifischen Beschäftigungsanteilen zum Ausdruck. Der Beschäftigungsanteil (Vollzeitbeschäftigung) der Frauen in der öffentlichen Verwaltung ist deutlich höher als jener der Männer. Der Abstand beträgt 6 Prozentpunkte, was bezogen auf den kleineren Anteil (den der Männer) eine Differenz von 45 Indexpunkten ergibt. In der Sachgüterproduktion liegt der Fall umgekehrt; die Sachgüterproduktion bietet ein Viertel der (Vollzeit-) Beschäftigungsmöglichkeiten für Männer, aber nur zu rund 14% für Frauen. Die Differenz beträgt 87,5 Indexpunkte. Lesebeispiel: Im Jahr 2000 waren 13,6% der vollzeitbeschäftigten Frauen in der Wirtschaftsabteilung»Sachgütererzeugung«tätig. Bei den vollzeitbeschäftigten Männern betrug der entsprechende Anteil 25,5%. Die Differenz von 11,9%-Punkten entspricht bezogen auf 13,6% 87,5 Indexpunkte. D.h., der Beschäftigungsanteil der Männer ist in der Wirtschaftsabteilung»Sachgütererzeugung«um 87,5% höher als der entsprechende Anteil bei den Frauen. Grafik 10 Hohe Segregation in der Sachgütererzeugung Beschäftigungsanteile in ausgewählten Wirtschaftsabteilungen (Vollzeit 1 ) ,6% 25,5% 87,5 Indexpunkte 19,3% 13,3% 45 Indexpunkte 8,3% 1,7% 388 Indexpunkte Sachgütererzeugung Öffentliche Verwaltung Gesundheit/Soziales Frauen Männer Weiterführende Informationen in Tabelle
31 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 10. Tabellen 12, 13 und 14, Grafik 11. Geringere Wochenarbeitszeit führt zu geringerem Einkommen Teilzeitbeschäftigte Frauen verdienen um 30,2% weniger als teilzeitbeschäftigte Männer Einkommensunterschiede bei Vollzeit/Teilzeit Männer erzielen im Regelfall stets ein deutlich höheres Erwerbseinkommen aus unselbstständiger Beschäftigung als Frauen. Ein Teil dieser Ungleichheit ist auf die unterschiedliche Wochenarbeitszeit von Frauen und Männern zurückzuführen. Um einen Teil dieses Unterschiedes in den Wochenarbeitszeiten zu erfassen, können die Beschäftigungsverhältnisse in zwei Gruppen unterteilt werden. In der einen Gruppe befinden sich Erwerbstätige, die weniger als 30 Wochenstunden arbeiten (im Jahresdurchschnitt 2000 sind das rund Frauen und Männer); in der anderen Gruppe die Beschäftigten mit einer Wochenarbeitszeit von zumindest 30 Stunden ( Frauen und Männer). Ein Vergleich der Einkommensunterschiede ergibt bei dieser Betrachtung folgendes Bild: Bei einer Wochenarbeitszeit von weniger als 30 Stunden erzielen Frauen ein Einkommen, das 30% niedriger als jenes der Männer liegt. Bei einer Wochenarbeitszeit von zumindest 30 Stunden beträgt der Unterschied 31%. Werden beide Gruppen zusammengefasst, beträgt der Vorsprung der Männer rund 32%. Lesebeispiel: Im Jahr 2000 betrug das Bruttomonatseinkommen standardbeschäftigter Frauen (Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung) im Median ATS ,. Männer verdienten im Median ATS ,. Der Einkommensunterschied von ATS 9.540, entspricht bezogen auf das Einkommen der Männer 31,9%. Grafik 11 Teilzeit allein erklärt nicht die Einkommensunterschiede Einkommen von Frauen und Männern bei Voll- und Teilzeitbeschäftigung ,9% 30,9% ,2% Insgesamt Bei Vollzeitbeschäftigung Bei Teilzeitbeschäftigung Frauen Männer Weiterführende Informationen in den Tabellen 12, 13 und
32 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 15, Grafik 12. Tabelle 15, Grafik 12. Arbeitsplätze mit dem Qualifikationsniveau»Pflichtschulabschluss«bieten Männern mehr Einkommenschancen als Frauen Die Einkommenskonvergenz ist auf hoch qualifizierten Arbeitsplätzen am größten Einfluss der Qualifikation auf die Einkommensdifferenz Frauen, deren Arbeitsplätze einen Pflichtschulabschluss erfordern, sehen sich auch bei Vollzeitbeschäftigung nur sehr beschränkten Verdienstmöglichkeiten gegenüber. Männern bieten dagegen Arbeitsplätze mit der Qualifikation»Pflichtschulabschluss«deutlich mehr Chancen. Ihr Lohnvorsprung gegenüber den gleich (niedrig) qualifizierten Kolleginnen liegt deutlich über dem Durchschnitt aller Bildungsstufen. Der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied liegt hier bei knapp minus 40%. Am ausgeprägtesten ist die Konvergenz zwischen Frauen und Männern auf Arbeitsplätzen, die einen Universitätsabschluss erfordern. Hier kommen Frauen bei Vollzeitbeschäftigung bis auf knapp 9% an die Männer mit gleicher Qualifikation heran. In diesem Vorsprung der Männer spiegelt sich die Tatsache wider, dass auch akademisch ausgebildete Frauen in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen mit einer»gläsernen Decke«konfrontiert sind. Deren Wirkung ist selbst in der öffentlichen Verwaltung zu erkennen. Lesebeispiel: Im Jahr 2000 betrug das Bruttomonatseinkommen vollzeitbeschäftigter Frauen, die auf Arbeitsplätzen mit dem Qualifikationsprofil»Universität«beschäftigt sind, im Median ATS ,. Männer verdienten auf analogen Arbeitsplätzen im Median ATS ,. Der Einkommensunterschied von ATS 3.320, entspricht bezogen auf das Einkommen der Männer 8,6%. Grafik 12 Einkommensdifferenzen bei geringerer Berufsqualifikation höher Einkommen von Frauen und Männern in ausgewählten Qualifikationen (Vollzeit) ,6% ,2% Universität Pflichtschule Frauen Männer Weiterführende Informationen in Tabelle
33 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Ungleichheitsindikatoren auf Basis der EU-Definitionen Harmonisierte Indikatoren Die Europäische Kommission hat sich auf ein Set von Indikatoren festgelegt. Ergänzend zu den bisher dargestellten Kennzahlen sind deshalb abschließend die harmonisierten Indikatoren zur Leitlinie 17 in Jahreswerten 1999 und 2000 ausgewiesen. Indikator Definition Diskrepanz der Arbeitslosenquoten in Prozentpunkten Diskrepanz der Beschäftigungsquoten in Prozentpunkten Index der geschlechtsspezifischen Unterschiede nach Berufen Index der geschlechtsspezifischen Segregation nach Wirtschaftsabteilungen Differenz zwischen den Arbeitslosenquoten bei Frauen und Männern in Prozentpunkten. Differenz zwischen den Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern in Prozentpunkten. Für jeden Beruf wird der durchschnittliche nationale Beschäftigungsanteil von Frauen und Männern ermittelt; die Differenzen werden aufsummiert, um den Gesamtbetrag des geschlechtsspezifischen Ungleichgewichtes zu erhalten. Für jede Branche wird der durchschnittliche Beschäftigungsanteil von Frauen und Männern ermittelt; die Differenzen werden aufsummiert, um den Gesamtbetrag des geschlechtsspezifischen Ungleichgewichtes zu erhalten. 0,4 0,7 10,6 11,9 39,46 39,31 27,61 27,84 Diskrepanz der Entgelte von Verhältnis des Stundenlohn-Index der Männer zu jenem Männern und Frauen der Frauen, bei Erwerbstätigen, die (bei mind. 30 Wochenstunden 1 ) 30 und mehr Stunden beschäftigt sind. Aufgeschlüsselt nach privaten und öffentlichen Sektoren. privat 2 : 1,53 öffentlich 3 : 1,01 privat 2 : 1,52 öffentlich 3 : 1,02 Diskrepanz zwischen den Einkünften von Frauen und Männern Anteil der Frauen, die Einkünfte von weniger als 50% des nationalen mittleren Jahreseinkommens (Median) erzielen, im Vergleich zum entsprechenden Anteil bei den Männern. Frauen: 64,9% Männer: 32,8% Frauen: 65,4% Männer: 32,9% Anmerkung: Ausgangsbasis der Berechnungen ist die Standardbeschäftigung. Geringfügige Beschäftigung und sonstige unselbstständige Beschäftigungen wurden nicht berücksichtigt. 1 Laut EU-Definition 15 Wochenstunden. 2 Arbeiter/innen und Angestellte. 3 Beamte/Beamtinnen. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 29
34 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 7 Berufs- und Qualifikationsprofile von Frauen und Männern Jahresdurchschnittlicher Bestand an Standardbeschäftigung nach Geschlecht, 2000 Frauen Männer Gesamt Berufsgruppen Führungskräfte Hoch qualifiziertes Personal Gehobenes techn. u. med. Personal Gehobenes Dienstleistungspersonal Verwaltungs- und Büropersonal Einfaches Dienstleistungspersonal Land- und forstwirt. Fachkräfte Handwerkliches Personal mit Lehre Anlagenbediener/innen Hilfsarbeitskräfte Streitkräfte/Zivildiener Lehrlinge Qualifikationen Universität/Hochschule Höhere Schule mit Matura Fachschule ohne Matura Lehrabschluss/Meisterprüfung Pflichtschulabschluss Keine abgeschl. Ausbildung Alter Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre und älter Insgesamt Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 30
35 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 8 Voll- und Teilzeitbeschäftigung von Frauen und Männern mit unterschiedlichen Sozialprofilen Jahresdurchschnittlicher Bestand an Standardbeschäftigung nach Geschlecht, 2000 Vollzeit 1 Teilzeit 2 Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt Berufsgruppen Führungskräfte Hoch qualifiziertes Personal Geh. techn. u. med. Personal Geh. Dienstleistungspersonal Verwaltungs-/Büropersonal Einf. Dienstleistungspersonal Land- und forst. Fachkräfte Handwerkliches Personal Anlagenbediener/innen Hilfsarbeitskräfte Streitkräfte/Zivildiener Lehrlinge Qualifikationen Universität/Hochschule Höhere Schule mit Matura Fachschule ohne Matura Lehrabschluss/Meisterprüf Pflichtschulabschluss Keine abgeschl. Ausbildung Alter Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre und älter Insgesamt Anmerkung: Für rund Arbeitsplätze liegen keine Arbeitszeitinformationen vor. Die Summe der Bestände aller Vollund Teilzeitarbeitsplätze ergibt daher nicht den Gesamtbestand an Arbeitsplätzen (vgl. Tabelle 7). 1 Normalarbeitszeit von 30 Wochenstunden oder mehr. 2 Normalarbeitszeit von weniger als 30 Wochenstunden. Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 31
36 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 9 Die Verteilung von Frauen und Männern auf Branchen Jahresdurchschnittlicher Bestand an Standardbeschäftigung nach Geschlecht, 2000 Frauen Männer Gesamt Wirtschaftsabteilungen Land- und Forstwirtschaft Fischerei und Fischzucht Bergbau Sachgüterproduktion Energie-/Wasserversorgung Bauwesen Handel, Reparatur Beherberg.-/Gaststättenwesen Verkehr und Nachrichtenüberm Kredit- und Versicherungswesen Wirtschaftsdienste Öffentliche Verwaltung Unterrichtswesen Gesundheit/Soziales Sonst. öffentl. Dienstleistungen Private Haushalte Exterritoriale Organisationen Alle Branchen Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 32
37 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 10 Voll- und Teilzeitbeschäftigung in den einzelnen Wirtschaftsabteilungen Jahresdurchschnittlicher Bestand an Standardbeschäftigung nach Geschlecht, 2000 Vollzeit 1 Teilzeit 2 Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt Wirtschaftsabteilungen Land- und Forstwirtschaft Fischerei und Fischzucht Bergbau Sachgüterproduktion Energie-/Wasserversorgung Bauwesen Handel, Reparatur Beherb.-/Gaststättenwesen Verkehr/Nachrichtenüberm Kredit-/Versicherungswesen Wirtschaftsdienste Öffentliche Verwaltung Unterrichtswesen Gesundheit/Soziales Sonst. öffentl. Dienstleist Private Haushalte Exterritoriale Organisationen Alle Branchen Anmerkung: Für rund Arbeitsplätze liegen keine Arbeitszeitinformationen vor. Die Summe der Bestände aller Voll- und Teilzeitarbeitsplätze ergibt daher nicht den Gesamtbestand an Arbeitsplätzen (vgl. Tabelle 9). 1 Normalarbeitszeit von 30 Wochenstunden oder mehr. 2 Normalarbeitszeit von weniger als 30 Wochenstunden. Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 33
38 3 Unselbstständige Beschäftigung und ihre Entlohnung Tabelle 11 Geringfügige Beschäftigung von Frauen und Männern Jahresdurchschnittlicher Bestand an geringfügiger Beschäftigung nach Geschlecht, 2000 Frauen Männer Gesamt Wirtschaftsabteilungen Land- und Forstwirtschaft Fischerei und Fischzucht Bergbau Sachgüterproduktion Energie-/Wasserversorgung Bauwesen Handel, Reparatur Beherberg.-/Gaststättenwesen Verkehr und Nachrichtenüberm Kredit- und Versicherungswesen Wirtschaftsdienste Öffentliche Verwaltung Unterrichtswesen Gesundheit/Soziales Sonst. öffentl. Dienstleistungen Private Haushalte Exterritoriale Organisationen Alle Branchen Rohdaten: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (vorläufige Daten), Arbeitsmarktservice, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung, Lohnsteuerstatistik), Personaljahrbuch des Bundes, Personalinformationssystem des Bundes. Datenbasis: Synthesis-Erwerb. 34
Wien und die erweiterte Arbeitsmarktregion Wien
 Dezember 2003 Wien und die erweiterte Arbeitsmarktregion Wien Basisdaten zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Christian Eizinger Monika Kalmár Ursula Lehner Roland Löffler Michael Wagner-Pinter Dieser
Dezember 2003 Wien und die erweiterte Arbeitsmarktregion Wien Basisdaten zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Christian Eizinger Monika Kalmár Ursula Lehner Roland Löffler Michael Wagner-Pinter Dieser
Demographie und Arbeitsmarktentwicklung. Fachexperte der Sektion VI Mag. Manfred Zauner
 Demographie und Arbeitsmarktentwicklung Fachexperte der Sektion VI Mag. Manfred Zauner Arbeitsmarktdaten - Begriffsbestimmungen Teil 1 Beschäftigte Nationale Definition: Unselbständig Beschäftigte: Unselbständige
Demographie und Arbeitsmarktentwicklung Fachexperte der Sektion VI Mag. Manfred Zauner Arbeitsmarktdaten - Begriffsbestimmungen Teil 1 Beschäftigte Nationale Definition: Unselbständig Beschäftigte: Unselbständige
Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell AK Wien
 Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell AK Wien Ausbildung und Arbeitsmarkt WUSSTEN SIE, DASS es einen engen Zusammenhang zwischen Ausbildung und Arbeitslosigkeitsrisiko gibt? fast die Hälfte der Arbeit
Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell AK Wien Ausbildung und Arbeitsmarkt WUSSTEN SIE, DASS es einen engen Zusammenhang zwischen Ausbildung und Arbeitslosigkeitsrisiko gibt? fast die Hälfte der Arbeit
BESCHÄFTIGUNGS- UND ARBEITSMARKTENTWICKLUNG IN DER STEIERMARK 2006 UND 2007 HERBSTPROGNOSE IM RAHMEN VON WIBIS STEIERMARK
 INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE- UND REGIONALPOLITIK DER JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESMBH BESCHÄFTIGUNGS- UND ARBEITSMARKTENTWICKLUNG IN DER STEIERMARK 2006 UND 2007 HERBSTPROGNOSE IM RAHMEN VON WIBIS STEIERMARK
INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE- UND REGIONALPOLITIK DER JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESMBH BESCHÄFTIGUNGS- UND ARBEITSMARKTENTWICKLUNG IN DER STEIERMARK 2006 UND 2007 HERBSTPROGNOSE IM RAHMEN VON WIBIS STEIERMARK
Warum verdienen Frauen weniger als Männer?
 Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Zusammenfassung zentraler Befunde einer empirischen Studie für Österreich zu Beschäftigung und Einkommen von Frauen und Männern Berichtsband 4 Warum verdienen
Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Zusammenfassung zentraler Befunde einer empirischen Studie für Österreich zu Beschäftigung und Einkommen von Frauen und Männern Berichtsband 4 Warum verdienen
Beschäftigungsentwicklung. Arbeitslosigkeit. Arbeitsmarktzahlen im Detail
 Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle Arbeitsmarktzahlen im Detail Beschäftigungsentwicklung Die unselbständige Beschäftigung ist im ersten Quartal des Jahres 2013 im Bundesland Salzburg um
Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle Arbeitsmarktzahlen im Detail Beschäftigungsentwicklung Die unselbständige Beschäftigung ist im ersten Quartal des Jahres 2013 im Bundesland Salzburg um
WIENER ARBEITSMARKTBERICHT. Juli 2015
 WIENER ARBEITSMARKTBERICHT i 2015 Miriam Paprsek 14. ust 2015 er Arbeitsmarktbericht i 2015 Inhalt 1. Aktuelle Trends... 3 2. Unselbstständige Beschäftigung... 4 2.1 Entwicklung der Beschäftigung im Bundesländervergleich...
WIENER ARBEITSMARKTBERICHT i 2015 Miriam Paprsek 14. ust 2015 er Arbeitsmarktbericht i 2015 Inhalt 1. Aktuelle Trends... 3 2. Unselbstständige Beschäftigung... 4 2.1 Entwicklung der Beschäftigung im Bundesländervergleich...
Vortrag an den Ministerrat. Aktuelle Arbeitsmarktlage
 GZ: BMASK-434.001/0343-VI/A/6/2016 Zur Veröffentlichung bestimmt 24/15 Betreff: Arbeitsmarktlage im Monat November 2016 Vortrag an den Ministerrat Aktuelle Arbeitsmarktlage Auch Ende November 2016 bleibt
GZ: BMASK-434.001/0343-VI/A/6/2016 Zur Veröffentlichung bestimmt 24/15 Betreff: Arbeitsmarktlage im Monat November 2016 Vortrag an den Ministerrat Aktuelle Arbeitsmarktlage Auch Ende November 2016 bleibt
Soziales SOZIALE FOLGEN DER KRISE: Welche Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen sich in Österreich?
 Soziales SOZIALE FOLGEN DER KRISE: Welche Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen sich in Österreich? Stand: September 2015 DIE AUSWIRKUNGEN DER WIRTSCHAFTS- KRISE: ENTWICKLUNGEN AM ARBEITS-
Soziales SOZIALE FOLGEN DER KRISE: Welche Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen sich in Österreich? Stand: September 2015 DIE AUSWIRKUNGEN DER WIRTSCHAFTS- KRISE: ENTWICKLUNGEN AM ARBEITS-
Vortrag an den Ministerrat. Aktuelle Arbeitsmarktlage
 GZ: BMASK-434.001/0236-VI/A/6/2016 Zur Veröffentlichung bestimmt Betreff: Arbeitsmarktlage im Monat August 2016 Vortrag an den Ministerrat 11/24 Aktuelle Arbeitsmarktlage Trotz der weiter anhaltenden Zunahme
GZ: BMASK-434.001/0236-VI/A/6/2016 Zur Veröffentlichung bestimmt Betreff: Arbeitsmarktlage im Monat August 2016 Vortrag an den Ministerrat 11/24 Aktuelle Arbeitsmarktlage Trotz der weiter anhaltenden Zunahme
Working Poor in Österreich und im internationalen Vergleich Zahlen, Daten, Fakten.
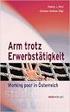 Ursula Till-Tentschert Direktion Bevölkerung 18.Juni 2012 Tagung Working Poor Kardinal König Haus ursula.till-tentschert@statistik.gv.at Working Poor in Österreich und im internationalen Vergleich Zahlen,
Ursula Till-Tentschert Direktion Bevölkerung 18.Juni 2012 Tagung Working Poor Kardinal König Haus ursula.till-tentschert@statistik.gv.at Working Poor in Österreich und im internationalen Vergleich Zahlen,
Der bundesdeutsche Arbeitsmarkt in Zahlen:
 Der bundesdeutsche Arbeitsmarkt in Zahlen: Zeitliche Trends und internationaler Vergleich Ein Referat von Sebastian Wunde Gliederung 1. Definitionen zentraler Arbeitsmarktindikatoren 2. Schwierigkeiten
Der bundesdeutsche Arbeitsmarkt in Zahlen: Zeitliche Trends und internationaler Vergleich Ein Referat von Sebastian Wunde Gliederung 1. Definitionen zentraler Arbeitsmarktindikatoren 2. Schwierigkeiten
III. 24 / Handelskammer Hamburg
 ARBEITSMARKT Die wirtschaftliche Entwicklung Hamburgs spiegelt sich auch im hiesigen Arbeitsmarkt wider. Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte hat die Anzahl der Erwerbstätigen in Hamburg im Jahr 215 einen
ARBEITSMARKT Die wirtschaftliche Entwicklung Hamburgs spiegelt sich auch im hiesigen Arbeitsmarkt wider. Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte hat die Anzahl der Erwerbstätigen in Hamburg im Jahr 215 einen
Atypische Beschäftigung in Österreich Strukturelle Verschiebungen
 Käthe Knittler Bettina Stadler Wiesbaden 30. Mai 2012 e Beschäftigung in Österreich Strukturelle Verschiebungen 2005 2011 www.statistik.at Wir bewegen Informationen Verwendete Daten Der Mikrozensus im
Käthe Knittler Bettina Stadler Wiesbaden 30. Mai 2012 e Beschäftigung in Österreich Strukturelle Verschiebungen 2005 2011 www.statistik.at Wir bewegen Informationen Verwendete Daten Der Mikrozensus im
Zentrale Indikatoren II: Der Arbeitsmarkt: Lohn- und Preisbildung
 K A P I T E L 6 Zentrale Indikatoren II: Arbeitsmarktindikatoren, Inflation (aus Kap. 2) Der Arbeitsmarkt: Lohn- und Preisbildung Vorbereitet von: Christian Feilcke Bearbeitet von: Margareta Kreimer 6-1
K A P I T E L 6 Zentrale Indikatoren II: Arbeitsmarktindikatoren, Inflation (aus Kap. 2) Der Arbeitsmarkt: Lohn- und Preisbildung Vorbereitet von: Christian Feilcke Bearbeitet von: Margareta Kreimer 6-1
Grundbegriffen zur Arbeitslosigkeit mit Schwerpunkt Jugendarbeitslosigkeit. VWL_Mag. Angela Schmiedecker, MSc.
 1 Grundbegriffen zur Arbeitslosigkeit mit Schwerpunkt Jugendarbeitslosigkeit VWL_Mag. Angela Schmiedecker, MSc. Um Güter produzieren zu können, benötigt es folgende Produktionsfaktoren: - Naturkapital
1 Grundbegriffen zur Arbeitslosigkeit mit Schwerpunkt Jugendarbeitslosigkeit VWL_Mag. Angela Schmiedecker, MSc. Um Güter produzieren zu können, benötigt es folgende Produktionsfaktoren: - Naturkapital
Thema Wirtschaft und Beschäftigung
 Statistik-Monitoring Delmenhorst Thema Wirtschaft und Beschäftigung Fachdienst Stand: August 2016 1. Arbeitslosenzahl und -quote 20 Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Stadt Delmenhorst nach Quartalen
Statistik-Monitoring Delmenhorst Thema Wirtschaft und Beschäftigung Fachdienst Stand: August 2016 1. Arbeitslosenzahl und -quote 20 Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Stadt Delmenhorst nach Quartalen
Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern wovon hängen sie ab?
 WSI-Herbstforum 2014 Arbeitszeiten der Zukunft: Selbstbestimmt, geschlechtergerecht, nachhaltig! Herausforderungen für die Arbeitszeitpolitik Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern wovon hängen sie
WSI-Herbstforum 2014 Arbeitszeiten der Zukunft: Selbstbestimmt, geschlechtergerecht, nachhaltig! Herausforderungen für die Arbeitszeitpolitik Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern wovon hängen sie
Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit im höheren Erwerbsalter ein statistischer Überblick
 Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit im höheren Erwerbsalter ein statistischer Überblick Menschen im höheren Erwerbsalter sind europaweit ein bislang unzureichend genutztes Arbeitskräftepotenzial. Ihre
Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit im höheren Erwerbsalter ein statistischer Überblick Menschen im höheren Erwerbsalter sind europaweit ein bislang unzureichend genutztes Arbeitskräftepotenzial. Ihre
OECD-Veröffentlichung Bildung auf einen Blick. Wesentliche Ergebnisse der Ausgabe 2011
 OECD-Veröffentlichung Bildung auf einen Blick Wesentliche Ergebnisse der Ausgabe 2011 Mit ihrer jährlich erscheinenden Publikation Education at a Glance/Bildung auf einen Blick bietet die OECD einen indikatorenbasierten
OECD-Veröffentlichung Bildung auf einen Blick Wesentliche Ergebnisse der Ausgabe 2011 Mit ihrer jährlich erscheinenden Publikation Education at a Glance/Bildung auf einen Blick bietet die OECD einen indikatorenbasierten
Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten
 Aktuelle Daten und Indikatoren Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 24. Oktober 2016 Inhalt 1. In aller Kürze...2 2. Grafiken und Tabellen...2 Grafik: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten
Aktuelle Daten und Indikatoren Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 24. Oktober 2016 Inhalt 1. In aller Kürze...2 2. Grafiken und Tabellen...2 Grafik: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten
Tabellenanhang Inhalt
 Tabellenanhang Inhalt 1. Arbeitsmarkt 1.1. Neueinstellungen 1.2. Aufgelöste Beschäftigungsverhältnisse 1.3. Bestehende unselbständige Beschäftigungsverhältnisse 1.4. Atypische Erwerbstätige 1.5. Vollzeit/Teilzeit
Tabellenanhang Inhalt 1. Arbeitsmarkt 1.1. Neueinstellungen 1.2. Aufgelöste Beschäftigungsverhältnisse 1.3. Bestehende unselbständige Beschäftigungsverhältnisse 1.4. Atypische Erwerbstätige 1.5. Vollzeit/Teilzeit
Löhne in der Stadt Zürich. 12. November 2015, Dr. Tina Schmid
 Löhne in der 12. November 2015, Dr. Tina Schmid Inhalt 1. Warum Löhne analysieren? 2. Fragestellungen 3. Daten: Schweizerische Lohnstrukturerhebung 4. Ergebnisse 5. Zusammenfassung & Fazit um 12 «Löhne
Löhne in der 12. November 2015, Dr. Tina Schmid Inhalt 1. Warum Löhne analysieren? 2. Fragestellungen 3. Daten: Schweizerische Lohnstrukturerhebung 4. Ergebnisse 5. Zusammenfassung & Fazit um 12 «Löhne
Atypische Beschäftigung
 Atypische Beschäftigung in Seite Daten 1. Überlick 2 2. Kennziffern Struktur 5 3. Kennziffern Entwicklung 8 Diagramme 4. Anteil an Atypischer Beschäftigung in % 9 5. Atypsche Beschäftigung je 1.000 Einwohner
Atypische Beschäftigung in Seite Daten 1. Überlick 2 2. Kennziffern Struktur 5 3. Kennziffern Entwicklung 8 Diagramme 4. Anteil an Atypischer Beschäftigung in % 9 5. Atypsche Beschäftigung je 1.000 Einwohner
Volkszählungen
 Volkszählungen 1754-2001 Quelle: Statistik Austria Verfasser: Karl Hödl, 28. 1. 2016 Volkszählungen werden in Österreich seit 1754 durchgeführt. Die letzte Volkszählung in der bis dahin üblichen Art wurde
Volkszählungen 1754-2001 Quelle: Statistik Austria Verfasser: Karl Hödl, 28. 1. 2016 Volkszählungen werden in Österreich seit 1754 durchgeführt. Die letzte Volkszählung in der bis dahin üblichen Art wurde
Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell AK Wien
 Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell AK Wien Beschäftigungssituation von Wiener ArbeitnehmerInnen mit Migrationshintergrund WUSSTEN SIE, DASS knapp 40 % der Wiener ArbeitnehmerInnen ausländische Wurzeln
Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell AK Wien Beschäftigungssituation von Wiener ArbeitnehmerInnen mit Migrationshintergrund WUSSTEN SIE, DASS knapp 40 % der Wiener ArbeitnehmerInnen ausländische Wurzeln
Wirtschaftswachstum 2012 und 2013 zu gering: Arbeitslosigkeit steigt
 März 2012 Quartalsprognose im Auftrag des Arbeitsmarktservice Österreich Wirtschaftswachstum 2012 und 2013 zu gering: Arbeitslosigkeit steigt Quartalsprognose zum österreichischen Arbeitsmarkt 2012/2013
März 2012 Quartalsprognose im Auftrag des Arbeitsmarktservice Österreich Wirtschaftswachstum 2012 und 2013 zu gering: Arbeitslosigkeit steigt Quartalsprognose zum österreichischen Arbeitsmarkt 2012/2013
Wien wächst Stadttagung der AK Wien, Abteilung Kommunalpolitik
 Wien wächst Stadttagung der AK Wien, Abteilung Kommunalpolitik Themenbereich Arbeitsmarkt/Beschäftigung/Wirtschaft Helmut Mahringer 23.4.2014 Wien wächst - Arbeitsmarkt Deutliches Bevölkerungswachstum
Wien wächst Stadttagung der AK Wien, Abteilung Kommunalpolitik Themenbereich Arbeitsmarkt/Beschäftigung/Wirtschaft Helmut Mahringer 23.4.2014 Wien wächst - Arbeitsmarkt Deutliches Bevölkerungswachstum
Teilzeitarbeit ist weiblich Situation der Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt
 Teilzeitarbeit ist weiblich Situation der Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt Gendermainstreaming-Beauftragte/ Frauenreferentin des AMS Steiermark Statistik AMS Steiermark Höchste Anzahl beim AMS vorgemerkter
Teilzeitarbeit ist weiblich Situation der Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt Gendermainstreaming-Beauftragte/ Frauenreferentin des AMS Steiermark Statistik AMS Steiermark Höchste Anzahl beim AMS vorgemerkter
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 Deutscher Bundestag Drucksache 18/4266 18. Wahlperiode 09.03.2015 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Ulle Schauws, Beate Müller-Gemmeke, weiterer Abgeordneter
Deutscher Bundestag Drucksache 18/4266 18. Wahlperiode 09.03.2015 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Ulle Schauws, Beate Müller-Gemmeke, weiterer Abgeordneter
Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere
 Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle Medieninformation Salzburg, 29. April 2015 50plus: Programme für ältere Arbeitslose Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere 2008-2014 Unselbständige
Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle Medieninformation Salzburg, 29. April 2015 50plus: Programme für ältere Arbeitslose Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere 2008-2014 Unselbständige
Arbeit. Spendenkonto: , Bank für Sozialwirtschaft AG (BLZ ) Bremer Institut. für. smarktforschung. und Jugend. berufshilfe e.v.
 Bremer Institut für Arbeit smarktforschung und Jugend berufshilfe e.v. (BIAJ) An Interessierte Bevenser Straße 5 28329 Bremen Tel. 0421/30 23 80 Von Paul M. Schröder (Verfasser) www.biaj.de email: institut-arbeit-jugend@t-online.de
Bremer Institut für Arbeit smarktforschung und Jugend berufshilfe e.v. (BIAJ) An Interessierte Bevenser Straße 5 28329 Bremen Tel. 0421/30 23 80 Von Paul M. Schröder (Verfasser) www.biaj.de email: institut-arbeit-jugend@t-online.de
Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel I. Halbjahr 2015
 Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel I. Halbjahr 2015 Wien, Juli 2015 www.kmuforschung.ac.at Inhaltsverzeichnis Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel Das I. Halbjahr 2015 im Überblick...
Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel I. Halbjahr 2015 Wien, Juli 2015 www.kmuforschung.ac.at Inhaltsverzeichnis Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel Das I. Halbjahr 2015 im Überblick...
Neue Fakten zur Lohnentwicklung
 DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
Arbeit und Chancengleichheit
 Arbeit und Chancengleichheit 5 Thesen zum Innovationsbedarf aus einer Gender-Perspektive Isabella Kaupa Problemfelder Vollzeitbeschäftigung vs. atypische Beschäftigung, Kern- und Randbelegschaft bezahlte
Arbeit und Chancengleichheit 5 Thesen zum Innovationsbedarf aus einer Gender-Perspektive Isabella Kaupa Problemfelder Vollzeitbeschäftigung vs. atypische Beschäftigung, Kern- und Randbelegschaft bezahlte
Ausgewählte Erwerbstätigenquoten I
 Prozent 80 75 70 65 60 55 50 45 40 78,9 78,4 67,9 57,2 57,1 38,4 79,3 76,6 76,6 78,8 77,2 74,1 71,8 72,7 71,8 70,0 64,7 63,6 65,3 65,4 64,3 55,0 57,8 58,8 58,5 50,0 55,2 44,4 46,1 45,4 41,3 36,3 38,2 37,4
Prozent 80 75 70 65 60 55 50 45 40 78,9 78,4 67,9 57,2 57,1 38,4 79,3 76,6 76,6 78,8 77,2 74,1 71,8 72,7 71,8 70,0 64,7 63,6 65,3 65,4 64,3 55,0 57,8 58,8 58,5 50,0 55,2 44,4 46,1 45,4 41,3 36,3 38,2 37,4
Biografische Einflussfaktoren auf den Gender Pension Gap ein Kohortenvergleich
 Frühjahrstagung der Sektion Alter(n) und Gesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 23./24. März 2012, Bremen Ungleichheitslagen und Lebensführung im Alter Zwischen goldenem Lebensabend und
Frühjahrstagung der Sektion Alter(n) und Gesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 23./24. März 2012, Bremen Ungleichheitslagen und Lebensführung im Alter Zwischen goldenem Lebensabend und
KRISE ALS CHANCE QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE FÜR BESCHÄFTIGTE UND ARBEITSLOSE
 KRISE ALS CHANCE QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE FÜR BESCHÄFTIGTE UND ARBEITSLOSE Bundesminister Rudolf Hundstorfer Wien, 2. Februar 2009 1 QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE FÜR BESCHÄFTIGTE UND ARBEITSLOSE Die globale
KRISE ALS CHANCE QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE FÜR BESCHÄFTIGTE UND ARBEITSLOSE Bundesminister Rudolf Hundstorfer Wien, 2. Februar 2009 1 QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE FÜR BESCHÄFTIGTE UND ARBEITSLOSE Die globale
Der Bericht untersucht die Wirkungen der Flüchtlingszuwanderung auf das Erwerbspersonenpotenzial.
 Aktuelle Berichte Flüchtlingseffekte auf das Erwerbspersonenpotenzial 17/2015 In aller Kürze Der Bericht untersucht die Wirkungen der Flüchtlingszuwanderung auf das Erwerbspersonenpotenzial. Betrachtet
Aktuelle Berichte Flüchtlingseffekte auf das Erwerbspersonenpotenzial 17/2015 In aller Kürze Der Bericht untersucht die Wirkungen der Flüchtlingszuwanderung auf das Erwerbspersonenpotenzial. Betrachtet
WIBIS Steiermark Factsheet Konjunktur Jänner
 Factsheet Konjunktur Jänner 2017.1 AKTIVBESCHÄFTIGUNG Die unselbstständige Aktivbeschäftigung in der Steiermark konnte im Dezember 2016 um +1,8 % erhöht werden (Ö: +1,6 %). Die Zahl der beschäftigten Frauen
Factsheet Konjunktur Jänner 2017.1 AKTIVBESCHÄFTIGUNG Die unselbstständige Aktivbeschäftigung in der Steiermark konnte im Dezember 2016 um +1,8 % erhöht werden (Ö: +1,6 %). Die Zahl der beschäftigten Frauen
Ausgewählte Armutsgefährdungsquoten
 In Prozent, 2011 1 Bevölkerung insgesamt 16,1 Männer Frauen 14,9 17,2 1 Berechnungsgrundlagen: 60%-Median, modifizierte OECD- Skala / Einkommensbezugsjahr: 2011, Erhebungsjahr: 2012, Veröffentlichung:
In Prozent, 2011 1 Bevölkerung insgesamt 16,1 Männer Frauen 14,9 17,2 1 Berechnungsgrundlagen: 60%-Median, modifizierte OECD- Skala / Einkommensbezugsjahr: 2011, Erhebungsjahr: 2012, Veröffentlichung:
Arbeitslose Personen ,6% Frauen ,5% Männer ,5%
 Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner Das Arbeitsmarktservice informiert monatlich aktuell über den österreichischen Arbeitsmarkt. In der vorliegenden
Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner Das Arbeitsmarktservice informiert monatlich aktuell über den österreichischen Arbeitsmarkt. In der vorliegenden
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 5/2038 5. Wahlperiode 23.12.2008
 LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 5/2038 5. Wahlperiode 23.12.2008 KLEINE ANFRAGE der Abgeordneten Regine Lück, Fraktion DIE LINKE Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 5/2038 5. Wahlperiode 23.12.2008 KLEINE ANFRAGE der Abgeordneten Regine Lück, Fraktion DIE LINKE Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen
BASS. Teilzeitarbeit in der Schweiz - Zusammenfassung
 Teilzeitarbeit in der Schweiz - Zusammenfassung Silvia Strub: Teilzeitarbeit in der Schweiz. Eine Untersuchung mit Fokus auf der Geschlechterverteilung und der familiären Situation der Erwerbstätigen,
Teilzeitarbeit in der Schweiz - Zusammenfassung Silvia Strub: Teilzeitarbeit in der Schweiz. Eine Untersuchung mit Fokus auf der Geschlechterverteilung und der familiären Situation der Erwerbstätigen,
Arbeitslosigkeit nach der Finanz- und Wirtschaftskrise (Teil 1)
 (Teil 1) Ausgewählte europäische Staaten, im Jahr 2010 und Veränderung der Spanien 2010 20,1 77,9 Estland 16,9 207,3 Slowakei Irland 13,7 14,4 117,5 51,6 Griechenland Portugal 12,0 12,6 41,2 63,6 Türkei
(Teil 1) Ausgewählte europäische Staaten, im Jahr 2010 und Veränderung der Spanien 2010 20,1 77,9 Estland 16,9 207,3 Slowakei Irland 13,7 14,4 117,5 51,6 Griechenland Portugal 12,0 12,6 41,2 63,6 Türkei
Ausgewählte Armutsgefährdungsquoten (Teil 1)
 (Teil 1) In Prozent, Europäische Union, 2008 Europäische Union (EU) Armutsgefährdungsquote * nach Geschlecht 16,3 * nach Sozialleistungen; Berechnungsgrundlagen: 60%-Median, modifizierte OECD-Skala Männer
(Teil 1) In Prozent, Europäische Union, 2008 Europäische Union (EU) Armutsgefährdungsquote * nach Geschlecht 16,3 * nach Sozialleistungen; Berechnungsgrundlagen: 60%-Median, modifizierte OECD-Skala Männer
Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2015
 Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2015 Herausgeber und Verleger: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger Redaktion: Karl Grillitsch Alle in 1030 Wien, Kundmanngasse
Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2015 Herausgeber und Verleger: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger Redaktion: Karl Grillitsch Alle in 1030 Wien, Kundmanngasse
KMU in Österreich. Situation und Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich. Dr. Walter Bornett November 2009
 KMU in Österreich Situation und Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich Dr. Walter Bornett November 2009 KMU FORSCHUNG AUSTRIA - Datenbanken Datenbanken Bilanzdatenbank Konjunkturdatenbank
KMU in Österreich Situation und Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich Dr. Walter Bornett November 2009 KMU FORSCHUNG AUSTRIA - Datenbanken Datenbanken Bilanzdatenbank Konjunkturdatenbank
Arbeitslose Personen ,0% Frauen ,1% Männer ,9%
 November Dezember Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Das Arbeitsmarktservice informiert monatlich aktuell über den österreichischen Arbeitsmarkt. In der vorliegenden
November Dezember Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Das Arbeitsmarktservice informiert monatlich aktuell über den österreichischen Arbeitsmarkt. In der vorliegenden
Abhängig Beschäftigte mit wöchentlichen Arbeitszeiten
 AZ ARBEITSZEITEN Abhängig Beschäftigte mit wöchentlichen Arbeitszeiten unter 15 Stunden Teilzeitarbeit steigt bei Männern und geht bei Frauen zurück Bearbeitung: Dietmar Hobler, Svenja Pfahl, Sonja Weeber
AZ ARBEITSZEITEN Abhängig Beschäftigte mit wöchentlichen Arbeitszeiten unter 15 Stunden Teilzeitarbeit steigt bei Männern und geht bei Frauen zurück Bearbeitung: Dietmar Hobler, Svenja Pfahl, Sonja Weeber
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern im Bereich Forschung und Entwicklung
 Jänner 2010 Endbericht www.femtech.at Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern im Bereich Forschung und Entwicklung Ausmaß und Ursachen der Einkommensungleichheit Petra Gregoritsch Günter Kernbeiß
Jänner 2010 Endbericht www.femtech.at Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern im Bereich Forschung und Entwicklung Ausmaß und Ursachen der Einkommensungleichheit Petra Gregoritsch Günter Kernbeiß
Arbeitslose Personen ,7% Frauen ,2% Männer ,8%
 Das Arbeitsmarktservice informiert monatlich aktuell über den österreichischen Arbeitsmarkt. In der vorliegenden Übersicht finden Sie Kennzahlen zu Arbeitslosigkeit, SchulungsteilnehmerInnen, unselbstständig
Das Arbeitsmarktservice informiert monatlich aktuell über den österreichischen Arbeitsmarkt. In der vorliegenden Übersicht finden Sie Kennzahlen zu Arbeitslosigkeit, SchulungsteilnehmerInnen, unselbstständig
Arbeitsmarktprognose für Wien
 Mai 2008 Prognose Arbeitsmarktprognose für Wien 2008-2012 Wolfgang Alteneder Ursula Lehner Karin Städtner Michael Wagner-Pinter Dieser Forschungsbericht wurde aus Mitteln des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
Mai 2008 Prognose Arbeitsmarktprognose für Wien 2008-2012 Wolfgang Alteneder Ursula Lehner Karin Städtner Michael Wagner-Pinter Dieser Forschungsbericht wurde aus Mitteln des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
Prüfbericht zur Rente erst ab 67 Vermeintliche Erfolgsquoten bejubelt, harte Fakten verschwiegen
 Matthias W. Birkwald, MdB Rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Platz der Republik 1, 11011 Berlin E-Mail: Telefon 030 227 71215 Fax 030 227 76215 Berlin, den 02.12.2010 Prüfbericht
Matthias W. Birkwald, MdB Rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Platz der Republik 1, 11011 Berlin E-Mail: Telefon 030 227 71215 Fax 030 227 76215 Berlin, den 02.12.2010 Prüfbericht
Landesarmutskonferenz Niedersachsen Arbeit, Armut, Würde in Hannover
 Die im Schatten stehen, sieht man nicht Armut und Ausgrenzung in Deutschland Landesarmutskonferenz Niedersachsen Arbeit, Armut, Würde 17.11.2015 in Hannover Prof. Dr. Gerhard Bäcker Universität Duisburg-Essen
Die im Schatten stehen, sieht man nicht Armut und Ausgrenzung in Deutschland Landesarmutskonferenz Niedersachsen Arbeit, Armut, Würde 17.11.2015 in Hannover Prof. Dr. Gerhard Bäcker Universität Duisburg-Essen
SALZBURGS BEZIRKE IN ZAHLEN. Daten zu Wirtschaft und Bevölkerung. Tennengau
 SALZBURGS BEZIRKE IN ZAHLEN Daten zu Wirtschaft und Bevölkerung Tennengau September 2014 Daten zu Wirtschaft und Bevölkerung Tennengau Wirtschaftskammer Salzburg September 2014 Inhalt I. Bezirksübersichten
SALZBURGS BEZIRKE IN ZAHLEN Daten zu Wirtschaft und Bevölkerung Tennengau September 2014 Daten zu Wirtschaft und Bevölkerung Tennengau Wirtschaftskammer Salzburg September 2014 Inhalt I. Bezirksübersichten
Atypische Beschäftigung
 Atypische Beschäftigung Deutlich weniger Arbeitnehmer als früher verdienen heutzutage ihr Geld in einem klassischen Vollzeitjob. Die Zahl der normalen Arbeitsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren
Atypische Beschäftigung Deutlich weniger Arbeitnehmer als früher verdienen heutzutage ihr Geld in einem klassischen Vollzeitjob. Die Zahl der normalen Arbeitsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren
Arbeit und Erwerb. Beschäftigte
 22 Arbeit und Erwerb Die liechtensteinische Volkswirtschaft weist über viele Jahre ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum auf. Das starke Wirtschaftswachstum in den letzten Dekaden und die Kleinheit
22 Arbeit und Erwerb Die liechtensteinische Volkswirtschaft weist über viele Jahre ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum auf. Das starke Wirtschaftswachstum in den letzten Dekaden und die Kleinheit
Demographischer Quartalsbericht Iserlohn
 Demographischer Quartalsbericht Iserlohn 02 / 2016 Bevölkerungsstand in Iserlohn am 30.06.2016 30.06.2016 31.12.2015 Veränderung absolut Veränderung prozentual Einwohner insgesamt 95.202 95.329-127 -0,13%
Demographischer Quartalsbericht Iserlohn 02 / 2016 Bevölkerungsstand in Iserlohn am 30.06.2016 30.06.2016 31.12.2015 Veränderung absolut Veränderung prozentual Einwohner insgesamt 95.202 95.329-127 -0,13%
Vierteljährlicher Bericht über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt
 Zusammenarbeit Vierteljährlicher Bericht über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt Oktober, November, Dezember 2010,, Quelle: http://www.ams.at/ Oktober Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit
Zusammenarbeit Vierteljährlicher Bericht über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt Oktober, November, Dezember 2010,, Quelle: http://www.ams.at/ Oktober Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit
Arbeit und Bildung. Beschäftigte
 22 Arbeit und Bildung Die liechtensteinische Volkswirtschaft weist über viele Jahre ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum auf. Das starke Wirtschaftswachstum in den letzten Dekaden und die
22 Arbeit und Bildung Die liechtensteinische Volkswirtschaft weist über viele Jahre ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum auf. Das starke Wirtschaftswachstum in den letzten Dekaden und die
Entwicklung und Struktur der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland sowie Aufstiegschancen von Niedrigverdienern. Hermann Gartner, Thomas Rhein (IAB)
 Entwicklung und Struktur der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland sowie Aufstiegschancen von Niedrigverdienern Hermann Gartner, Thomas Rhein (IAB) Präsentation zur Jahrestagung der Sektion Soziale Indikatoren
Entwicklung und Struktur der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland sowie Aufstiegschancen von Niedrigverdienern Hermann Gartner, Thomas Rhein (IAB) Präsentation zur Jahrestagung der Sektion Soziale Indikatoren
Schule was dann? Junge Frauen und Männer in Bayern. Bericht für die Kommission für Mädchen- und Frauenarbeit des Bayerischen Jugendrings.
 Schule was dann? Junge Frauen und Männer in Bayern. Bericht für die Kommission für Mädchen- und Frauenarbeit des Bayerischen Jugendrings. 30.01.07 München PD Dr. Waltraud Cornelißen Forschungsgruppe Gender
Schule was dann? Junge Frauen und Männer in Bayern. Bericht für die Kommission für Mädchen- und Frauenarbeit des Bayerischen Jugendrings. 30.01.07 München PD Dr. Waltraud Cornelißen Forschungsgruppe Gender
Kürzer arbeiten leichter leben!
 Kürzer arbeiten leichter leben! Ergebnisse von Befragungen unter Angestellten zum Thema Arbeitszeit Pressekonferenz am 15.6.2015 Georg Michenthaler IFES - Institut für empirische Sozialforschung GmbH Teinfaltstraße
Kürzer arbeiten leichter leben! Ergebnisse von Befragungen unter Angestellten zum Thema Arbeitszeit Pressekonferenz am 15.6.2015 Georg Michenthaler IFES - Institut für empirische Sozialforschung GmbH Teinfaltstraße
630/AB XXV. GP. Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.
 630/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (textinterpretierte Version) 1 von 8 630/AB XXV. GP Eingelangt am 11.04.2014 BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Anfragebeantwortung Ich beantworte die an
630/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung (textinterpretierte Version) 1 von 8 630/AB XXV. GP Eingelangt am 11.04.2014 BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Anfragebeantwortung Ich beantworte die an
Demographischer Quartalsbericht Iserlohn
 02 / 2013 Bevölkerungsstand in am 30.06.2013 30.06.2013 31.12.2012 Verlust absolut Verlust prozentual Einwohner insgesamt 95.115 95.847-732 -0,76% davon männlich 46.360 46.799-439 -0,94% davon weiblich
02 / 2013 Bevölkerungsstand in am 30.06.2013 30.06.2013 31.12.2012 Verlust absolut Verlust prozentual Einwohner insgesamt 95.115 95.847-732 -0,76% davon männlich 46.360 46.799-439 -0,94% davon weiblich
Die Weltmeisterschaft in Schladming: Was bewirkt zusätzlicher Tourismus?
 11 Die Weltmeisterschaft in Schladming: Was bewirkt zusätzlicher Tourismus? Nachhaltige wirtschaftliche Impulse über 2013 hinaus März 2012 Kurzfassung Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft,
11 Die Weltmeisterschaft in Schladming: Was bewirkt zusätzlicher Tourismus? Nachhaltige wirtschaftliche Impulse über 2013 hinaus März 2012 Kurzfassung Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft,
Daten zur Lebenslage von alleinerziehenden Familien in Deutschland 1
 Factsheet Daten zur Lebenslage von alleinerziehenden Familien in Deutschland 1 Jede fünfte Familie ist alleinerziehend ABBILDUNG 1 Familienformen und Entwicklung der Anzahl der Familien sowie der alleinerziehenden
Factsheet Daten zur Lebenslage von alleinerziehenden Familien in Deutschland 1 Jede fünfte Familie ist alleinerziehend ABBILDUNG 1 Familienformen und Entwicklung der Anzahl der Familien sowie der alleinerziehenden
40 Jahre Frauenbewegung in Deutschland. Arbeitsgruppe 4 Wo wollen Frauen in den nächsten 40 Jahren hin in Erwerbsarbeit?
 40 Jahre Frauenbewegung in Deutschland Arbeitsgruppe 4 Wo wollen Frauen in den nächsten 40 Jahren hin in Erwerbsarbeit? Tagung vom 11. bis 13. Mai 2012 in der Evangelischen Akademie Bad Boll 12. Mai 2012
40 Jahre Frauenbewegung in Deutschland Arbeitsgruppe 4 Wo wollen Frauen in den nächsten 40 Jahren hin in Erwerbsarbeit? Tagung vom 11. bis 13. Mai 2012 in der Evangelischen Akademie Bad Boll 12. Mai 2012
Methodenbeschreibung zur Auswahl der Gefragten Berufe Inhalt
 Methodenbeschreibung zur Auswahl der Gefragten Berufe Inhalt 1. Ausgangslage... 2 2. Statistiken und Kennzahlen... 2 3. Identifikation der Gefragten Berufe... 3 4. Interpretation der Gefragten Berufe...
Methodenbeschreibung zur Auswahl der Gefragten Berufe Inhalt 1. Ausgangslage... 2 2. Statistiken und Kennzahlen... 2 3. Identifikation der Gefragten Berufe... 3 4. Interpretation der Gefragten Berufe...
- I - Inhalt Seite. 1. Problemstellung Bedeutung der beruflichen Weiterbildung Ziel der Untersuchung und Vorgehensweise 8
 - I - Inhalt 1. Problemstellung 1 1.1 Bedeutung der beruflichen Weiterbildung 3 1.2 Ziel der Untersuchung und Vorgehensweise 8 2. Methodische Aspekte 9 2.1 Auswahl der Gebiete 9 2.2 Aussagekraft der statistischen
- I - Inhalt 1. Problemstellung 1 1.1 Bedeutung der beruflichen Weiterbildung 3 1.2 Ziel der Untersuchung und Vorgehensweise 8 2. Methodische Aspekte 9 2.1 Auswahl der Gebiete 9 2.2 Aussagekraft der statistischen
Wohin gehen Studierende mit Behinderungen? Ein offenes Feld in der Arbeitsmarktforschung!
 Wohin gehen Studierende mit Behinderungen? Ein offenes Feld in der Arbeitsmarktforschung! Fachtagung: Übergänge im Lebenslauf mit Behinderungen: Hochschulzugang und Berufszugang mit Behinderung Fulda 08.
Wohin gehen Studierende mit Behinderungen? Ein offenes Feld in der Arbeitsmarktforschung! Fachtagung: Übergänge im Lebenslauf mit Behinderungen: Hochschulzugang und Berufszugang mit Behinderung Fulda 08.
Situation von Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt
 Situation von Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt Ausbildung Klicken Sie, von um Frauen das Titelformat 1971 und 2006 zu Universitäten u.a. 1 9 2006 1971 AHS+BHS 5 14 BMS 9 17 Lehre 13 26 Pflichtschule
Situation von Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt Ausbildung Klicken Sie, von um Frauen das Titelformat 1971 und 2006 zu Universitäten u.a. 1 9 2006 1971 AHS+BHS 5 14 BMS 9 17 Lehre 13 26 Pflichtschule
Arbeitsmarktprofile 2015
 Arbeitsmarktprofile Österreich Inhalt Tabelle 1 Gesamtübersicht über die wichtigsten Arbeitsmarktdaten. 2 Tabelle 2 Arbeitslosenquote nach Regionen. 3 Tabelle 3 Vorgemerkte Arbeitslose nach Regionen......
Arbeitsmarktprofile Österreich Inhalt Tabelle 1 Gesamtübersicht über die wichtigsten Arbeitsmarktdaten. 2 Tabelle 2 Arbeitslosenquote nach Regionen. 3 Tabelle 3 Vorgemerkte Arbeitslose nach Regionen......
Gleichstellung am Arbeitsmarkt und Familienpolitik im europäischen Vergleich
 Quelle: Schweizerischer Nationalfonds Gleichstellung am Arbeitsmarkt und Familienpolitik im europäischen Vergleich Teil 2: Gleichstellung am Arbeitsmarkt? Frauen zwischen Erwerbsintegration und Marginalisierung
Quelle: Schweizerischer Nationalfonds Gleichstellung am Arbeitsmarkt und Familienpolitik im europäischen Vergleich Teil 2: Gleichstellung am Arbeitsmarkt? Frauen zwischen Erwerbsintegration und Marginalisierung
Regionalwirtschaftliche Profile Nordrhein-Westfalen im Vergleich 2016
 NRW.BANK.Research Regionalwirtschaftliche Profile Nordrhein-Westfalen im Vergleich 2016 Ausgewählte Indikatoren Inhalt Einführung 1. Demografie 2. Bruttoinlandsprodukt 3. Bruttowertschöpfung 4. Erwerbstätige
NRW.BANK.Research Regionalwirtschaftliche Profile Nordrhein-Westfalen im Vergleich 2016 Ausgewählte Indikatoren Inhalt Einführung 1. Demografie 2. Bruttoinlandsprodukt 3. Bruttowertschöpfung 4. Erwerbstätige
SALZBURG IM LÄNDERVERGLEICH. Regionalstatistischer Benchmarking-Report
 SALZBURG IM LÄNDERVERGLEICH Regionalstatistischer Benchmarking-Report September 2012 Salzburg im Ländervergleich Regionalstatistischer Benchmarking-Report September 2012 Herausgeber: Wirtschaftskammer
SALZBURG IM LÄNDERVERGLEICH Regionalstatistischer Benchmarking-Report September 2012 Salzburg im Ländervergleich Regionalstatistischer Benchmarking-Report September 2012 Herausgeber: Wirtschaftskammer
Arbeitsmarktprofile 2015
 Österreich Inhalt Tabelle 1 Gesamtübersicht über die wichtigsten Arbeitsmarktdaten. 2 Tabelle 2 Arbeitslosenquote nach Regionen. 3 Tabelle 3 Vorgemerkte Arbeitslose nach Regionen...... 4 Tabelle 4 Vorgemerkte
Österreich Inhalt Tabelle 1 Gesamtübersicht über die wichtigsten Arbeitsmarktdaten. 2 Tabelle 2 Arbeitslosenquote nach Regionen. 3 Tabelle 3 Vorgemerkte Arbeitslose nach Regionen...... 4 Tabelle 4 Vorgemerkte
3. Beschäftigung und Arbeitsmarkt
 Sozialversicherungspflichtig 3. Beschäftigung und Arbeitsmarkt 3.1 Sozialversicherungspflichtig 1990 Veränderung 1990-2000 in % 2000 Veränderung 2000-2009 in % 2009 * Alb-Donau-Kreis 41.428 11,0 45.987
Sozialversicherungspflichtig 3. Beschäftigung und Arbeitsmarkt 3.1 Sozialversicherungspflichtig 1990 Veränderung 1990-2000 in % 2000 Veränderung 2000-2009 in % 2009 * Alb-Donau-Kreis 41.428 11,0 45.987
Wie gut reist Bildung? Ausbildung und Beruf mit und ohne Migration: Zusammenfassung auf Deutsch
 Wie gut reist Bildung? Ausbildung und Beruf mit und ohne Migration: Zusammenfassung auf Deutsch Absicht und Datengrundlage Bis Mitte der 1980er Jahre war die Arbeitsmigration nach Österreich im Wesentlichen
Wie gut reist Bildung? Ausbildung und Beruf mit und ohne Migration: Zusammenfassung auf Deutsch Absicht und Datengrundlage Bis Mitte der 1980er Jahre war die Arbeitsmigration nach Österreich im Wesentlichen
Qualifizierte Berufsausbildung erforderlich. Warum ohne Bildungsabschluss auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr geht
 Qualifizierte Berufsausbildung erforderlich. Warum ohne Bildungsabschluss auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr geht Zagreb, EVBB Konferenz Mag. a Petra Draxl 16. Oktober 2014 Worüber ich sprechen möchte. Einige
Qualifizierte Berufsausbildung erforderlich. Warum ohne Bildungsabschluss auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr geht Zagreb, EVBB Konferenz Mag. a Petra Draxl 16. Oktober 2014 Worüber ich sprechen möchte. Einige
Österreichischer Führungskräfte Monitor Mehrheit wünscht kürzere Arbeitszeit
 Ihre Gesprächspartner: Dr. Johann Kalliauer Mag. Christoph Hofinger Präsident der AK Oberösterreich Institut SORA Österreichischer Führungskräfte Monitor Mehrheit wünscht kürzere Arbeitszeit Pressekonferenz
Ihre Gesprächspartner: Dr. Johann Kalliauer Mag. Christoph Hofinger Präsident der AK Oberösterreich Institut SORA Österreichischer Führungskräfte Monitor Mehrheit wünscht kürzere Arbeitszeit Pressekonferenz
Mobilität und Arbeitsmarkterfolg
 Arbeitspapiere Migration und soziale Mobilität Nr. 35 Mobilität und Arbeitsmarkterfolg August Gächter, 2016-05-08 Inhalt 1. Fragestellung...2 2. Daten und Methoden...2 3. Verteilung der Beschäftigten...3
Arbeitspapiere Migration und soziale Mobilität Nr. 35 Mobilität und Arbeitsmarkterfolg August Gächter, 2016-05-08 Inhalt 1. Fragestellung...2 2. Daten und Methoden...2 3. Verteilung der Beschäftigten...3
Arbeitsmarkt in Österreich
 Arbeitsmarkt in Österreich Beschäftigung, Arbeitslose und Arbeitslosenquote Arbeitsmarkt Österreich Ende März 2016 Beschäftigte Arbeitslose Anzahl Anzahl AL-Quote (%) Österreich 3.556.258 367.576 9,4 Burgenland
Arbeitsmarkt in Österreich Beschäftigung, Arbeitslose und Arbeitslosenquote Arbeitsmarkt Österreich Ende März 2016 Beschäftigte Arbeitslose Anzahl Anzahl AL-Quote (%) Österreich 3.556.258 367.576 9,4 Burgenland
Arbeitsmarktprofile 2015
 Arbeitsmarktprofile 804-Dornbirn Inhalt Tabelle 1 Gesamtübersicht über die wichtigsten Arbeitsmarktdaten. 2 Tabelle 2 Arbeitslosenquote nach Regionen. 3 Tabelle 3 Vorgemerkte Arbeitslose nach Regionen......
Arbeitsmarktprofile 804-Dornbirn Inhalt Tabelle 1 Gesamtübersicht über die wichtigsten Arbeitsmarktdaten. 2 Tabelle 2 Arbeitslosenquote nach Regionen. 3 Tabelle 3 Vorgemerkte Arbeitslose nach Regionen......
Die unendliche Geschichte - Minijobs
 Folien zum Vortrag Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Institut Arbeit und Technik Die unendliche Geschichte - Minijobs
Folien zum Vortrag Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Institut Arbeit und Technik Die unendliche Geschichte - Minijobs
Der Wiener Arbeitsmarkt 2012/2013
 November 2012 Endbericht Der Wiener Arbeitsmarkt 2012/2013 Ausgewählte zielgruppenorientierte Analysen und Prognosen, Arbeitsmarktdynamik und Pendelverhalten Berichtsserie»Wirkungscontrolling 2012«Bericht
November 2012 Endbericht Der Wiener Arbeitsmarkt 2012/2013 Ausgewählte zielgruppenorientierte Analysen und Prognosen, Arbeitsmarktdynamik und Pendelverhalten Berichtsserie»Wirkungscontrolling 2012«Bericht
Maturaaufgaben. Aufgabe 1
 Eva Kovacs (0704419) Maturaaufgaben Aufgabe 1 Thema: Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt in Österreich Im Jahr 2011 erreichte die Zahl der auf der Welt lebenden Menschen die sieben Milliarden Marke.
Eva Kovacs (0704419) Maturaaufgaben Aufgabe 1 Thema: Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt in Österreich Im Jahr 2011 erreichte die Zahl der auf der Welt lebenden Menschen die sieben Milliarden Marke.
Bruck-Mürzzuschlag B621
 Bezirksprofil Bruck-Mürzzuschlag B621 mit den Vergleichsregionen Österreich (AT) WIBIS Steiermark Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem Steiermark Mai 2013 JOANNEUM RESEARCH Zentrum für
Bezirksprofil Bruck-Mürzzuschlag B621 mit den Vergleichsregionen Österreich (AT) WIBIS Steiermark Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem Steiermark Mai 2013 JOANNEUM RESEARCH Zentrum für
Gender Mainstreaming in Österreich auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit? Erfahrungen aus der Umsetzung
 Gender Mainstreaming in Österreich auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit? Erfahrungen aus der Umsetzung Claudia Sorger L&R Social Research, Austria 20-21 April 2005 EU Symposium European Year of Equal
Gender Mainstreaming in Österreich auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit? Erfahrungen aus der Umsetzung Claudia Sorger L&R Social Research, Austria 20-21 April 2005 EU Symposium European Year of Equal
Presse- gespräch. g Dr. Inge Schulz. Allianz Arbeitsmarktbarometer: Berufszufriedenheit der Österreicherinnen und
 Allianz Arbeitsmarktbarometer: Berufszufriedenheit der Österreicherinnen und Öt Österreicher ih g Dr. Inge Schulz Leiterin der Abteilung Human Resources Allianz Gruppe in Österreich Presse- gespräch Wien,
Allianz Arbeitsmarktbarometer: Berufszufriedenheit der Österreicherinnen und Öt Österreicher ih g Dr. Inge Schulz Leiterin der Abteilung Human Resources Allianz Gruppe in Österreich Presse- gespräch Wien,
Der Arbeitsmarkt im Dezember und Jahresrückblick 2016
 Pressemitteilung Nr. 001 / 2017-03. Januar 2017 Der Arbeitsmarkt im Dezember und Jahresrückblick 2016 - Arbeitslosigkeit steigt zum Jahresende moderat - mehr als 1.000 Arbeitslose weniger als im Dezember
Pressemitteilung Nr. 001 / 2017-03. Januar 2017 Der Arbeitsmarkt im Dezember und Jahresrückblick 2016 - Arbeitslosigkeit steigt zum Jahresende moderat - mehr als 1.000 Arbeitslose weniger als im Dezember
VERGLEICH DER BAUWEISEN "MASSIVBAU" VS. "LEICHTBAU" HINSICHTLICH WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKTPOLITISCHER ASPEKTE
 VERGLEICH DER BAUWEISEN "MASSIVBAU" VS. "LEICHTBAU" HINSICHTLICH WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKTPOLITISCHER ASPEKTE Eine volkswirtschaftlich-empirische Untersuchung für Niederösterreich Kurz-/Pressefassung
VERGLEICH DER BAUWEISEN "MASSIVBAU" VS. "LEICHTBAU" HINSICHTLICH WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKTPOLITISCHER ASPEKTE Eine volkswirtschaftlich-empirische Untersuchung für Niederösterreich Kurz-/Pressefassung
Informationen der Statistikstelle
 Informationen der Statistikstelle 31.12.211 31.12.23-125 125-125 125 Bevölkerungsvorausberechnung der Remscheider Bevölkerung 211 bis 23 Herausgeber und Bearbeitung: Stadt Remscheid Die Oberbürgermeisterin
Informationen der Statistikstelle 31.12.211 31.12.23-125 125-125 125 Bevölkerungsvorausberechnung der Remscheider Bevölkerung 211 bis 23 Herausgeber und Bearbeitung: Stadt Remscheid Die Oberbürgermeisterin
Arbeitsmarkt und demografischer Wandel Arbeitsmarkteffekte des demographischen Wandels
 Arbeitsmarkteffekte des demographischen Wandels Tagung der Marie-Luise und Ernst Becker Stiftung Generation 60plus tauglich für die Arbeitswelt 2020? am 14./15. Februar 2006 in Bad Arolsen Dr. Johann Fuchs
Arbeitsmarkteffekte des demographischen Wandels Tagung der Marie-Luise und Ernst Becker Stiftung Generation 60plus tauglich für die Arbeitswelt 2020? am 14./15. Februar 2006 in Bad Arolsen Dr. Johann Fuchs
Armuts- und Reichtumsbericht für Österreich KURZGEFASST
 Armuts- und Reichtumsbericht für Österreich KURZGEFASST Österreichische Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung (ÖGPP) A-114 Wien, Löwelstraße 18, Tel. 664/1427727 www.politikberatung.or.at
Armuts- und Reichtumsbericht für Österreich KURZGEFASST Österreichische Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung (ÖGPP) A-114 Wien, Löwelstraße 18, Tel. 664/1427727 www.politikberatung.or.at
Vierteljährlicher Bericht über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt
 Zusammenarbeit Vierteljährlicher Bericht über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt Jänner, Februar, März 2011,, Quelle: http://www.ams.at/ Jänner Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit 2 Ende
Zusammenarbeit Vierteljährlicher Bericht über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt Jänner, Februar, März 2011,, Quelle: http://www.ams.at/ Jänner Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit 2 Ende
Arbeitsmarkt in Österreich
 Arbeitsmarkt in Österreich Beschäftigung, Arbeitslose und Arbeitslosenquote Arbeitsmarkt Österreich Ende Jänner 2016 Beschäftigte Arbeitslose Anzahl Anzahl AL-Quote (%) Österreich 3.487.848 424.989 10,9
Arbeitsmarkt in Österreich Beschäftigung, Arbeitslose und Arbeitslosenquote Arbeitsmarkt Österreich Ende Jänner 2016 Beschäftigte Arbeitslose Anzahl Anzahl AL-Quote (%) Österreich 3.487.848 424.989 10,9
Relevanz und Auswirkungen des Senioritätsprinzips am österreichischen Arbeitsmarkt
 Relevanz und Auswirkungen des Senioritätsprinzips am österreichischen Arbeitsmarkt Bundesminister Rudolf Hundstorfer Marcel Fink, IHS Helmut Hofer, IHS Aktuelle Arbeitsmarktdaten 50+ Arbeitsmarktdaten
Relevanz und Auswirkungen des Senioritätsprinzips am österreichischen Arbeitsmarkt Bundesminister Rudolf Hundstorfer Marcel Fink, IHS Helmut Hofer, IHS Aktuelle Arbeitsmarktdaten 50+ Arbeitsmarktdaten
Bezirksprofil. Graz-Umgebung B606. mit den Vergleichsregionen. Bundesland Steiermark (AT22) Österreich (AT)
 Bezirksprofil Graz-Umgebung B606 mit den Vergleichsregionen Österreich (AT) WIBIS Steiermark Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem Steiermark Juni 2014 JOANNEUM RESEARCH Zentrum für Wirtschafts-
Bezirksprofil Graz-Umgebung B606 mit den Vergleichsregionen Österreich (AT) WIBIS Steiermark Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem Steiermark Juni 2014 JOANNEUM RESEARCH Zentrum für Wirtschafts-
