Kantonales. Raumentwicklungskonzept
|
|
|
- Gertrud Messner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Kantonales Raumentwicklungskonzept
2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 Warum ein kantonales Raumentwicklungskonzept 3 Fortsetzung des Projekts DT Inhalt des KREK 5 Fünf Raumtypen 5 Grundsätze der Raumentwicklung 6 Gewünschte räumliche Entwicklung des Kantons 8 Das Wallis heute 8 Das Wallis im Jahr Die Karte 12 Raumentwicklungsstrategie 14 Landwirtschaft, Wald, Landschaft und Natur 14 Tourismus und Freizeit 16 Siedlung 18 Verkehr und Mobilität 21 Versorgung und Infrastrukturen 22 2
3 Einleitung Jean-Michel CINA Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung Warum ein kantonales Raumentwicklungskonzept? Der Kanton Wallis steht vor vielfältigen Herausforderungen in der Raumentwicklung. Die Entwicklung der urbanen und ländlichen Teilräume verläuft unterschiedlich dynamisch. Die demographische Entwicklung, die Veränderung der Lebensweise und der Klimawandel haben einen direkten Einfluss auf den Raum und erfordern Antworten und Neuausrichtungen der Raumplanung. Die Raumentwicklung ist daher eine grosse Herausforderung unserer Gesellschaft. Dabei müssen vor allem die folgenden generellen Trends mit Relevanz für Raum und Siedlung beachtet werden: > Bevölkerungswachstum übt Druck auf die Landschaft aus; > steigende Mobilität lässt die Verkehrsinfrastrukturen an die Belastungsgrenzen stossen ; > steigender Wohlstand und veränderte Wohnansprüche; > Lebens- und Wirtschaftsräume entsprechen nicht mehr den institutionellen Grenzen; > der Klimawandel und die Naturgefahren die wesentliche Auswirkungen in einem Gebirgskanton haben. Im Jahr 2010 bekräftigte der Staatsrat seinen Willen, im Bereich der Raumentwicklung Reformen in Angriff zu nehmen, indem er das Projekt Raumentwicklung 2020 (DT 2020) lancierte. Dabei setzte er sich zum Ziel, eine umfassende, nachhaltige, rationelle, kohärente und ausgewogene Raumentwicklungspolitik zum Wohle der Walliser Bevölkerung auszuarbeiten. Für die Umsetzung dieser Ziele, hat der Kanton Wallis die Revision der kantonalen Richtplanung und der entsprechenden Gesetzgebung in Angriff genommen. Das kantonale Raumentwicklungskonzept (KREK) gehört zum strategischen Teil der kantonalen Richtplanung im Sinne von Art. 8 des revidierten RPG, der festhält, dass «Jeder Kanton einen Richtplan erstellt, worin er mindestens festlegt, wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll». Es ersetzt die Raumplanungsziele vom Das KREK gibt einen Gesamtüberblick der gewünschten Raumentwicklung des Kantons und seiner verschiedenen Teilräume. Es bietet einen Orientierungsrahmen und eine Entscheidungshilfe für die raumwirksamen Tätigkeiten. Es fördert die Zusammenarbeit über räumliche, sektorielle und institutionelle Grenzen und wird mit den entsprechenden Konzepten und Strategien auf Bundes- und Kantonsebene abgestimmt, wie das Raumkonzept Schweiz und die Agglomerationsprogramme. 3
4 Als Orientierungshilfe zeigt das KREK den Gemeinden die mittel- und langfristigen Raumplanungsperspektiven des Kantons auf und gibt Impulse für die Entwicklung auf gemeindeübergreifender Ebene. Als strategische Ergänzung zum kantonalen Richtplan (krp) trägt das KREK so zu einer koordinierten Raumentwicklung zwischen den verschiedenen institutionellen Ebenen und einer rationellen Bodennutzung bei. Die im KREK definierte Raumentwicklungsstrategie wird im Rahmen der Erarbeitung des krp, der interkommunalen und kommunalen Planungen sowie von raumrelevanten Projekten konkretisiert und präzisiert (Ab. 1). Raumentwicklungzskonzept Kantonaler Richtplan Projekten und Planungen Strategischer Orientierungsrahmen Räumliche Koordination und Steuerung Konkrete Massnahmen und Projekte Konkretisierung Ab. 1: Verhältnis von KREK, krp und nachgelagerten Planungen Das KREK wurde durch eine Arbeitsgruppe erarbeitet, der unter anderem Vertreter der sozioökonomischen Regionen angehörten und die methodisch und technisch durch externe Experten unterstützt wurde. Anschliessend wurde der Entwurf mit den betroffenen kantonalen Dienststellen sowie den Gemeinden im Rahmen von Workshops diskutiert und zur öffentlichen Vernehmlassung unterbreitet. Das KREK wurde am 11. September 2014 durch den Grossen Rat genehmigt. Fortsetzung des Projekts DT2020 Der Kanton arbeitet derzeit an der 2. Etappe der Revision des kantonalen Ausführungsgesetzes zum Raumplanungsgesetz, welche insbesondere die neuen Anforderungen der RPG-Revision einschliesst, sowie an der Gesamtrevision des kantonalen Richtplanes. Eine öffentliche Vernehmlassung dieser beiden Projekte ist für die erste Hälfte 2015 vorgesehen. Der Entwurf der Teilrevision des krpg wird Ende 2015 und der Entwurf des kantonalen Richtplans Ende 2016 dem Grossen Rat zur Genehmigung vorgelegt. Anschliessend wird der kantonale Richtplan dem Bund zur Genehmigung zugestellt. 4
5 Inhalt des KREK Das KREK besteht aus drei Teilen (Ab. 2) und einer Synthesekarte. Die vier Grundsätze der Raumentwicklung legen die vier übergeordneten strategischen Stossrichtungen für alle raumwirksamen Tätigkeiten des Kantons fest. Die gewünschte räumliche Entwicklung des Kantons skizziert die aktuelle Situation und die künftige Entwicklung in den fünf Raumtypen des Kantons. Die Raumentwicklungsstrategie legt die Raumplanungsziele fest für die gewünschte räumliche Entwicklung in den die folgenden Themenbereiche: «Landwirtschaft, Wald, Landschaft und Natur», «Tourismus und Freizeit», «Siedlung», «Verkehr und Mobilität», «Versorgung und Infrastrukturen». Die Synthesekarte zeigt die Raumtypen und die jeweiligen Strategien. Dabei gilt es zu beachten, dass in der Karte nur jene Strategien berücksichtigt werden, die sich spezifisch auf einen bestimmten Raumtyp beziehen. Strategien, die sich auf das gesamte Kantonsgebiet oder mehrere Raumtypen erstrecken, werden hingegen nur im Text behandelt. Grundsätze der Raumentwicklung (S. 6-7) Gewünschte räumliche Entwicklung des Kantons (S. 8-11) Urbaner Raum mit Zentrum Multifunktionaler Raum in der Rhonetalebene Raum der Talflanken und Seitentäler Alpiner Tourismusraum mit Zentrum Natur- und Landschaftsraum Raumentwicklungsstrategie (S ) Landwirtschaft, Wald, Landschaft und Natur Tourismus und Freizeit Siedlung Verkehr und Mobilität Versorgung und Infrastrukturen Synthesekarte (S ) Ab. 2: Inhalt des KREK Fünf Raumtypen Um die räumliche Entwicklung des Kantons abzubilden, definiert das KREK fünf voneinander abhängige, komplementäre, und zueinander solidarische Raumtypen, die das Kantonsgebiet strukturieren. Jeder dieser Räume hat seine eigenen Merkmale, Qualitäten und Potenziale und steht vor unterschiedlichen Herausforderungen, welche mit den spezifischen Strategien gemeistert werden sollen. Der urbane Raum mit Zentrum beinhaltet die städtischen Zentren in der Talebene, die sich an den Abzweigungen wichtiger Seitentäler oder an Verkehrsknotenpunkten befinden, sowie die Orte im Nahbereich dieser Zentren. Die städtischen Zentren weisen eine hohe Konzentration an wichtigen öffentlichen und privaten Diensten auf und bilden aufgrund der intensiven Pendlerbeziehungen mit ihren Einzugsgebieten echte funktionale Einheiten. Zum multifunktionalen Raum in der Rhonetalebene gehören die grossen landwirtschaftlich genutzten Flächen (Gras-/Milchwirtschaft, Ackerland) im gesamten Rhonetal sowie die Reb-, Obst- und Gemüseanbauflächen zwischen Salgesch und Martinach. Er beinhaltet mehrere regionale Subzentren mit gemischten Tätigkeiten (Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe). Unter dem Begriff «Raum der Talflanken und Seitentäler» werden kleinere und mittlere Gemeinden zusammengefasst, die in traditionelle Kulturlandschaften eingebettet sind und über ein Grundangebot an touristischen Anlagen verfügen. Diese Orte stützen sich auf regionale Subzentren, in denen sich vor allem Tourismus-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe befinden. Der alpine Tourismusraum mit Zentrum umfasst die Höhenkurorte mit einem grossen Beherbergungsangebot und einem vielfältigen Angebot an touristischen Anlagen. Die alpinen Tourismuszentren werden je nach Umsatzstärke in zwei Kategorien eingeteilt (Schätzung basierend auf den Beiträgen und Stimmrechten bei der GV des Verbands der Walliser Bergbahnen). Der Natur- und Landschaftsraum erstreckt sich über das übrige Kantonsgebiet und umfasst die Naturund Kulturlandschaften, welche für die Identität des Wallis stehen. 5
6 Grundsätze der Raumentwicklung Die Grundsätze der Raumentwicklung legen die übergeordneten strategischen Stossrichtungen für alle raumwirksamen Tätigkeiten des Kantons fest. Sie behandeln in erster Linie die Entwicklung und die Kohäsion des Raumes, den Lebensraum und die natürlichen Ressourcen, die Aussenbeziehungen sowie die neuen Formen der räumlichen Organisation, die es umzusetzen gilt. Der Kanton Wallis orientiert seine Raumentwicklung an den folgenden vier Grundsätzen: Entwickeln von differenzierten, sich ergänzenden und solidarischen Räumen im Wallis 1 Der Kanton strebt eine differenzierte Entwicklung der verschiedenen Räume an, unter Berücksichtigung ihrer Stärken und Schwächen. Um die Komplementarität der ländlichen und städtischen Räume zu stärken sowie den innerkantonalen Zusammenhalt sicherzustellen, fördert der Kanton die Vernetzung der Räume sowie die Zusammenarbeit zwischen ihnen. Nutzen und schützen des Lebensraums und der natürlichen Ressourcen in ausgewogener Weise 2 Das Wallis besitzt eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft und ein grosses Potential an erneuerbaren Ressourcen, insbesondere zur Energieproduktion. Die nutzbare Bodenfläche ist jedoch beschränkt. Die grosse Herausforderung des Kantons Wallis besteht darin, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer dauerhaft positiven wirtschaftlichen Entwicklung und dem ausreichenden Schutz seiner natürlichen Ressourcen zu wahren. Ein gesundes wirtschaftliches Wachstum in den Bereichen Industrie und Gewerbe, im Tourismus, zur Energieproduktion und in der Landwirtschaft steht einer rationalen Nutzung der natürlichen Ressourcen gegenüber. Gleichzeitig ist mit dem Boden, insbesondere in der Rhonetalebene, sparsam umzugehen und die Fruchtfolgeflächen sind zu schützen. Offene Flächen sind zu erhalten und der Schutz der einzigartigen Kultur- und Naturlandschaft muss langfristig gesichert werden. 6
7 Stärken der Verbindung mit und der Offenheit gegenüber den Nachbarräumen Der Kanton Wallis will die Anbindung und die Offenheit gegenüber den angrenzenden Regionen und den schweizerischen und europäischen Metropolitanräumen stärken. Er tut dies, indem er die Anschlüsse an das nationale und internationale Verkehrsnetz und an leistungsfähige Telekommunikationsnetze verbessert. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und -regionen in den Bereichen welche einen Einfluss auf die Raumentwicklung haben wie Energie, Tourismus und Verkehr ist weiter zu stärken. 3 Fördern der überkommunalen Zusammenarbeit Ausgehend von einer räumlichen Realität, welche die kommunalen Grenzen immer häufiger überschreitet, muss der Kanton geeignete Steuerungsmöglichkeiten fördern, indem er neue Organisationsformen auf einer zweckmässigen räumlichen Ebene entwickelt. Ziel ist es, die Entwicklung von flexiblen Zusammenarbeitsstrukturen zu unterstützen, welche den unterschiedlichen Aktionsradien über institutionelle Grenzen hinaus gerecht werden. 4 7 Staat Wallis, François Perraudin
8 Gewünschte räumliche Entwicklung des Kantons... Ausgehend von der aktuellen Situation, stellt die gewünschte räumliche Entwicklung des Kantons eine Vision für die fünf Räume dar, mit der Absicht eine geordnete Nutzung des Bodens und eine nachhaltige Besiedelung des Raumes sicherzustellen. Das Wallis heute Der Kanton Wallis ist geprägt durch seine einzigartige topographische Lage inmitten des hochalpinen Alpenraums. So ist er auf drei Seiten eingerahmt von hohen Bergen. Das Rhonetal als verbindende Achse durchläuft das Wallis vom Rhonegletscher bis zum Genfersee. Das Wallis zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt an Räumen aus. Der Kanton besteht aus attraktiven Berglandschaften mit touristischen Spitzendestinationen, traditionellen Kulturlandschaften mit einer produktiven Landwirtschaft und hervorragend an die Schweizer und europäischen Metropolitanräume angebundene urbane Räume. Auf der Grundlage des Projektes Raumentwicklung Valais-Wallis (ProTer VW, 2008) wurden fünf Raumtypen definiert: Der urbane Raum mit Zentren, der multifunktionale Raum in der Rhonetalebene, der Raum der Talflanken und Seitentäler, der alpine Tourismusraum mit Zentren und der Natur- und Landschaftsraum. Jeder dieser Räume hat seine spezifischen Qualitäten. Obwohl sie mit sehr unterschiedlichen Fragen und Herausforderungen konfrontiert sind, ergänzen und unterstützen sie sich gegenseitig. Heute konzentrieren sich 70 Prozent der Bevölkerung und ein Grossteil der wirtschaftlichen Aktivitäten im Industrie- und Dienstleistungssektor in den urbanen Räumen der Rhoneebene, auf nur sechs Prozent der Fläche des Kantons. Die hohe Dynamik in diesen Räumen ist eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung des Wallis. Auf drei Viertel des Kantonsgebietes leben heute nur drei Prozent der Bevölkerung. Diese ländlichen Räume entwickeln sich aufgrund ihrer natürlichen Voraussetzungen wirtschaftlich weniger stark, aber mit Ihren imposanten Gebirgslandschaften prägen sie das Bild und die Identität des Wallis wesentlich und spielen eine wichtige Rolle für den Tourismus. Die Bevölkerungsprognosen des kantonalen Amtes für Statistik und Finanzausgleich vom Mai 2014 gehen im mittleren Szenario davon aus, dass die Bevölkerung im Kanton Wallis bis zum Jahr 2030 (2035) auf über ( ) Einwohnerinnen und Einwohner zunimmt. Durch dieses anhaltend hohe Wachstum werden sich die Unterschiede in den Entwicklungsdynamiken der einzelnen Teilräume noch akzentuieren. Denn das Wachstum dürfte sich weiterhin insbesondere in den urbanen Räumen der Rhoneebene konzentrieren, mit all den Chancen und Herausforderungen die sich für den gesamten Kanton daraus ergeben. 8
9 Das Wallis im Jahr 2030 Auch künftig ist die Vielfalt der Räume eine Stärke des Wallis. Die Dynamik der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ist auch künftig nicht in allen Räumen gleich. Eine regionale Wirtschaftsentwicklung und die Solidarität zwischen den Räumen garantieren aber, dass alle Räume attraktiv für Mensch und Natur bleiben. Die Beziehungen zwischen dem Kanton Wallis und den Metropolitanräumen der Schweiz werden verstärkt, was die Zusammenarbeit und die Netzwerkbildung fördert, sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons verbessert. Die grenzüberschreitende (insbesondere Espace Mont-Blanc) und interkantonale Zusammenarbeit (Region Chablais, Weltkulturerbe Jungfrau-Aletsch, ) erlauben es, gemeinsame nachhaltige Strategien zu entwickeln (Siedlungsentwicklung, Tourismus, Verkehr, ) unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiede. 9
10 gemäss den Raumtypen Der urbane Raum mit seinen städtischen Zentren und den periurbanen Räumen ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons. In ihm konzentriert sich ein Grossteil der Arbeitsplätze und der Bevölkerung. Neben den grundlegenden urbanen Funktionen verfügen die vier Agglomerationen über einen je eigenen Charakter: Die Agglomeration Sion-Sierre ist das Bildungs- Verwaltungs- und Forschungszentrum des Kantons, die Agglomeration Brig-Visp-Naters ist das wirtschaftliche und industrielle Zentrum und Verkehrsknoten des Oberwallis. Monthey-Aigle hat sich als Industriestandort etabliert und Martigny fungiert als Zentrum der Informationstechnologie. Ergänzend dazu übernehmen die Orte Leuk, St. Maurice und Gampel-Steg als Kleinzentren für ihr ländliches Umland wichtige Funktionen als Arbeitsplatzstandorte sowie als Standorte für Versorgung und soziale Infrastruktur. Die städtischen Zentren und ihr Umland sind eng verflochten und ergänzen sich gegenseitig zu einem vielseitigen urbanen Raum. Die städtischen Zentren zeichnen sich durch eine dichte Bebauung von hoher städtebaulicher Qualität und kurze Wege aus. Wohn-, Arbeits- und Einkaufsnutzungen sind gemischt und liegen in Fussdistanz beieinander. Attraktiv gestaltete öffentliche Räume strukturieren die Siedlung und sind Orte der Begegnung. Die städtischen Zentren nehmen für ihre Umgebung und den gesamten Kanton die Funktionen als Verkehrsdrehscheiben und Versorgungszentren wahr. Gleichzeitig sind sie Umsteigeknoten um in die Seitentäler und die alpinen Tourismuszentren zu gelangen. Das Umland ist integraler Bestandteil dieser urbanen Räume und mit öffentlichem und Individualverkehr hervorragend an die städtischen Zentren angebunden. Qualitativ hochstehende und dichte Wohnbauten an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs fördern die Benutzung des öffentlichen Verkehrs. Während gewisse Gemeinden insbesondere Wohnstandorte sind, weisen andere eine funktionale Durchmischung und auch bedeutende Arbeitsplatzgebiete auf. Der multifunktionale Raum in der Rhoneebene umfasst vielfältige Funktionen wie diejenige der Wirtschaft, des Wohnens, der Landwirtschaft, des Hochwasserschutzes und der Landschaft. Die Raumentwicklung in der Rhonetalebene wird durch eine gemeinde- und regionsübergreifende Strategie gesteuert, die sich auf die 3. Rhonekorrektur stützt, um die Konflikte zwischen den verschiedenen Nutzungsansprüchen langfristig zu lösen. Offene, intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen wechseln sich mit ökologisch vernetzten naturnahen Gebieten und Siedlungen ab. Die intensive Landwirtschaft verfügt dank fruchtbaren, kompakten Flächen von einer gewissen Ausdehnung über gute Voraussetzungen. Der für den Hochwasserschutz reservierte Gewässerraum an der Rhone und an seinen Zuflüssen übernimmt auch wichtige Funktionen bei der ökologischen Vernetzung und für die Naherholung. Die Siedlung in der Rhoneebene ist kompakt. Wohn-, Gewerbeund Industriezonen sind so angeordnet, dass Nutzungskonflikte minimiert und das Grundwasser geschützt werden. Die Infrastrukturen zwischen den Siedlungen sind effizient angeordnet. Die Rhoneebene enthält grössere offene und unbebaute Flächen und ist ein abwechslungsreicher Naherholungsraum für die urbanen Räume mit einem breiten Natur- und Freizeitangebot. Ein attraktives Langsamverkehrsnetz verbindet diese Angebote untereinander und mit den urbanen Räumen. Der Raum der Talflanken und Seitentäler mit seinen typischen Ortschaften, die sich in traditionelle Kulturlandschaften einfügen, prägt das Bild des Wallis und hat eine wichtige touristische Bedeutung. Die Dörfer zeichnen sich durch kompakte Ortskerne aus, welche die bauliche und kulturelle Identität prägen. Zeitgemässe Bauten fügen sich in die renovierte und umgenutzte alte Bausubstanz ein. Eine lokale Grundversorgung sowie eine gute verkehrliche Erreichbarkeit tragen zur Attraktivität als Wohn - und Arbeitsorte bei. Die lokale Wirtschaft nutzt in optimaler und nachhaltiger Weise die endogenen Potenziale und stützt sich insbesondere auf den Tourismus, die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Wasserressourcen. Der Agrotourismus und ein auf die Natur und Kultur ausgerichteter sanfter Tourismus ergänzen das Angebot bestehender Wintersportgebiete. Die Kulturlandschaften mit Rebflächen, Alpwiesen und Suonen sind geprägt durch die lange Tradition der menschlichen Bewirtschaftung. Sie haben deshalb einen hohen ökologischen und landschaftlichen Wert. Die Bewirtschaftung erhält die abwechslungsweise freie und bewaldete Landschaft mit hoher Biodiversität und verhindert die ungebremste Ausbreitung des Walds. 10
11 Der alpine Tourismusraum umfasst attraktive Spitzendestinationen mit internationaler Ausstrahlung. Die alpine Landschaft ist das Kernkapital dieser Destinationen. Sie bieten ergänzend ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot an. Die Tourismusinfrastrukturen werden ganzjährig genutzt, Skianlagen sind optimal mit den touristischen Verkehrsangeboten verknüpft. Die Ortszentren sind geprägt durch eine alpine Baukultur, attraktiv gestaltet und laden zum Verweilen und Flanieren ein. Die Tourismuszentren dieses Raumes sind ganzjährig belebt und bieten Einheimischen und Touristen eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität. Die Bewohner und Arbeitskräfte dieser Zentren haben Zugang zu attraktivem und finanziell tragbarem Wohnraum. Die Tourismuszentren sind durch den öffentlichen Verkehr ganzjährig gut an die Knotenpunkte in den städtischen Zentren angebunden. Der Natur- und Landschaftsraum zeichnet sich durch einzigartige naturnahe hochalpine Gebirgslandschaften mit markanten Gipfeln, Gletschern und Wildbächen aus. Er umfasst auch naturnahe bewohnte und unbewohnte Täler mit Alpen und grösseren bewaldeten Gebieten. Die Landschaften und ihre Lebensräume werden langfristig erhalten und in Wert gesetzt, namentlich durch regionale Naturpärke, welche wichtige Impulse für die lokale Wirtschaft geben. In ihnen wird die Entwicklung nachhaltiger Tourismusprojekte gefördert unter Berücksichtigung des natürlichen, landschaftlichen und kulturellen Erbes. Der Natur- und Landschaftsraum wird also vor allem für den sanften Tourismus genutzt und enthält deshalb wenige touristische Infrastrukturen. Die intakten Naturräume sind Repräsentanten für die Identität des Wallis und spielen eine wichtige Rolle für das Bild des Kantons, wie es in der Schweiz und im Ausland vermittelt wird. 11 Staat Wallis, François Perraudin
12 12
13 13
14 Raumentwicklungsstrategie Zur Erhaltung und Steigerung der Qualitäten und der Attraktivität entwickelt der Kanton seine räumliche Struktur weiter. Dazu definiert er eine Entwicklungsstrategie und leitet davon die Raumplanungsziele in fünf Themenbereichen ab. Für die Umsetzung dieser Raumentwicklungsstrategie arbeiten Kanton und Gemeinden eng zusammen Landwirtschaft, Wald, Landschaft und Natur Gute Rahmenbedingungen für eine vielfältige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft schaffen Die hochwertigen Landwirtschaftsflächen, insbesondere die Fruchtfolgeflächen werden langfristig für die Landwirtschaft erhalten, um auch künftig die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Im Rhonetal und an seinen Flanken werden die Voraussetzungen geschaffen, damit auch künftig eine innovative, vielfältige und produktive Landwirtschaft betrieben werden kann. Die landwirtschaftlichen Aktivitäten tragen zur Wertschöpfung, der Biodiversität und dem Schutz des Grundwassers bei. Die traditionellen Kulturlandschaften, wie die Rebberge, Ackerlandterrassen und Alplandschaft werden erhalten und in Wert gesetzt. Sie tragen zum positiven Bild des Wallis und seiner landwirtschaftlichen Produkte bei. In den extensiv genutzten Landwirtschaftsgebieten werden Synergien zwischen Landwirtschaft und Tourismus gefördert. 1.2 Unverbaute Flächen in der Rhoneebene freihalten Insbesondere in der Rhoneebene, wo sich viele Nutzungen konkurrenzieren und die naturnahen Flächen knapp sind, werden Siedlungen möglichst kompakt gehalten. Flächen werden gezielt vor einer weiteren baulichen Tätigkeit freigehalten. Diese Flächen werden landwirtschaftlich genutzt oder in ihrer ökologischen Qualität gestärkt. 1.3 Die vielfältigen Lebensräume erhalten und die ökologische Vernetzung stärken Die Vielfallt an Tier- und Pflanzenarten in Bezug auf die spezielle klimatische, geologische und topografische Situation des Wallis wird erhalten und gefördert. Die ökologische Vernetzung zwischen den naturnahen Gebieten insbesondere entlang der Wasserläufe, Hecken, Wälder, Ortsränder und in den landwirtschaftlich genutzten Flächen wird gefördert. Bei der Planung von Infrastrukturen und der Strukturierung des Siedlungsgebiets wird auf den ökologischen Vernetzungskorridor in der Rhoneebene und dessen vielfältige Funktionen Rücksicht genommen. Die natürlichen Ressourcen werden geschont, damit auch künftige Generationen davon profitieren können. Der unvermehrbaren Ressource Boden wird besonders Sorge getragen. 1.4 Die Natur- und Kulturlandschaften schützen Die vielfältigen Landschaften des Wallis mit ihren natürlichen und menschlichen Prägungen werden erhalten. Die charakteristischen Eigenarten der unterschiedlichen Landschaften werden weiterentwickelt. Regionale Naturpärke schützen langfristig besonders wertvolle naturnahe Landschaften. Die Entwicklung von wirtschaftlichen Aktivitäten und Projekten im Einklang mit der Umwelt wird dort ermöglicht. Schutzwürdige Bauten ausserhalb der Bauzonen werden erhalten und in Wert gesetzt. Die Ausdehnung der Waldfläche im Berggebiet wird eingedämmt, um die vielfältigen Landschaften des Wallis zu erhalten. 14
15 1.5 Die Schutzfunktion sowie die produktive, biologische und soziale Funktion des Waldes stärken Der Wald wird nachhaltig bewirtschaftet, um seine Funktionen, insbesondere die Schutzfunktion gegen Naturgefahren zu erhalten. Die Rahmenbedingungen für die Verwertung von Holz werden verbessert, um den vermehrten Einsatz der nachhaltigen Ressource «Holz» als Energieträger und Baumaterial zu unterstützen. Die Biodiversität im Wald wird bewusst gefördert, insbesondere durch die Errichtung von Reservaten. Die wichtige Erholungsfunktion des Walds insbesondere in der Nähe der Agglomerationen wird gestärkt. 1.6 Die Oberflächengewässer bewahren und renaturieren Die für Fliessgewässer und Seen notwendigen Räume werden gesichert und bewahrt. Diese Räume nehmen einerseits eine Schutzfunktion gegen Hochwasser wahr. Anderseits dienen sie auch der ökologischen Vernetzung und der Erholungsnutzung. Stark korrigierte, ausgebeutete oder künstlich gestaltete Gewässer werden revitalisiert. Ziel ist der Erhalt oder die Wiederherstellung ihrer natürlichen, sozialen und Schutzfunktionen. 15 Staat Wallis, DRE
16 2 2.1 Tourismus und Freizeit Den Tourismus in einem ganzheitlichen Ansatz weiterentwickeln Der Tourismus wird in seiner Bedeutung für die Entwicklung des Kantons in einer ganzheitlichen Betrachtung weiterentwickelt. Die alpine Landschaft als Kernkapital des Tourismus wird erhalten. Das Natur- und Bergerlebnis steht in den Tourismuszentren weiterhin im Zentrum. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Gebieten mit intensivem Tourismus, den naturnahen und landwirtschaftlich genutzten Räumen, muss sichergestellt sein. Das dank zahlreichen Thermalquellen hohe Potenzial im Wellnesstourismus wird in Wert gesetzt und nachhaltig genutzt. 2.2 Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der alpinen Tourismuszentren fördern Die Entwicklung der Skigebiete in den alpinen Tourismuszentren konzentriert sich auf die qualitative Aufwertung und die Modernisierung der bestehenden Infrastrukturen. Die langfristige Wirtschaftlichkeit und Attraktivität der Gebiete steht dabei im Fokus um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Die Potenziale für die Verbindungen von bestehenden komplementären Skigebieten werden geprüft. Die saisonalen Schwankungen im Tourismus werden mit einer bewussten Förderung des Sommertourismus vermindert. Dazu wird der Ausbau von vielfältigen Freizeit- und Kulturangeboten unterstützt. Dies ermöglicht die ganzjährige Nutzung der Tourismusinfrastrukturen. 2.3 Eine hohe Qualität in Siedlungsgestaltung und Architektur in den touristischen Zentren anstreben Eine hohe Lebens- und Siedlungsqualität in den touristischen Zentren ist Voraussetzung für ihre Attraktivität. Eine attraktive Gestaltung der touristischen Zentren und ihrer öffentlichen Räume wird deshalb vom Kanton aktiv gefördert. Die alpine Architektur in den Tourismuszentren wird weiterentwickelt und gefördert. Sie prägt die Identität der Bewohner und macht einen Teil des Charmes der Tourismusdestinationen aus. Die Versorgung mit Wohnraum muss in den Tourismuszentren für die einheimische Bevölkerung zu tragbaren Bedingungen möglich sein. Die bestehende Bausubstanz in den Bergdörfern, welche ein Kulturgut bildet, muss sinnvoll erhalten und genutzt werden. 2.4 Innovative Formen der touristischen Beherbergung stärken Der Kanton entwickelt eine Strategie zur touristischen Beherbergung. Er unterstützt innovative Formen in der Beherbergung und setzt sich für eine Erhöhung des Anteils an bewirtschafteten Betten ein. 2.5 Im Tourismus eine Zusammenarbeit über die kommunalen, regionalen, kantonalen und nationalen Grenzen hinaus anstreben Eine wirkungsvolle Entwicklung von Tourismusdestinationen und -gebieten setzt eine enge Zusammenarbeit der Akteure voraus. Dabei ist eine zielgerichtete Kooperation über Gemeinde-, Regions-, Kantons- und Landesgrenzen hinaus erforderlich. Der Kanton ist bei dieser Zusammenarbeit Türöffner und nimmt eine aktive Rolle ein. 16
17 2.6 Den touristischen Sektor mit einem sich ergänzenden extensiven und intensiven Angebot im ländlichen Raum stärken, indem das Natur-, Landschafts- und Kulturerbe genutzt wird Ein sanfter, auf die Natur und die handwerklichen und kulturellen Aktivitäten ausgerichteter Tourismus wird in den ländlichen Räumen gefördert. Er ergänzt das touristische Angebot der bestehenden Wintersportgebiete. Extensive Tourismusangebote wie Wandern und Alpinismus werden speziell gefördert, wobei auf einen rücksichtsvollen und sorgfältigen Umgang mit Natur und Landschaft hohen Wert gelegt wird. Die Synergien des Tourismus mit der Landwirtschaft werden genutzt im Wissen darum, dass sich diese beiden Branchen in vielen Bereichen ergänzen (z.b. gemeinsame Arbeitskräfte, Absatz regionaler Produkte, Agrotourismus, lokales Handwerk, Nutzung der Kulturlandschaft). 2.7 Ein abwechslungsreiches Angebot an Freizeitverkehr bereitstellen Das Freizeitnetz für den Langsamverkehr wird ausgebaut und stärker mit dem Netz des öffentlichen Verkehrs verknüpft. Eine klare Beschilderung und eine sichere Gestaltung machen den Langsamverkehr für die Freizeit attraktiv. Die touristischen Verkehrsangebote werden stärker vernetzt. Die Erreichbarkeit der touristischen Zentren mit dem öffentlichen Verkehr ist von hoher Qualität. 17 FDDM, Christian Laubacher
18 3 3.1 Siedlung Die Funktionsfähigkeit und den Bevölkerungsbestand in den Dörfern und Gemeinden erhalten Eine dezentralisierte Grundversorgung wird in allen Räumen angeboten. Diese umfasst neben technischen auch soziale Infrastrukturen. Damit werden die Voraussetzungen für attraktive Wohnstandorte und den Erhalt der Bevölkerung geschaffen. Die Gemeinden definieren ihre Entwicklungsstrategie, gestützt auf ihre jeweiligen Stärken und Potenziale, die sie in optimaler und nachhaltiger Weise nutzen. Die Massnahmen zum Erhalt der Beschäftigung werden unterstützt, insbesondere im touristischen Sektor (Agrotourismus, Parahotellerie) und durch die Entwicklung der lokalen Unternehmen. Den Gemeinden mit spezifischen Problemstellungen des Berggebietes und des ländlichen Raums ist dabei ein besonderes Augenmerk zu schenken, namentlich in Bezug auf die Wohnbauhilfe. Die gemeinsame Nutzung von Bildungs-, Verwaltungs- und Versorgungsinfrastrukturen wird angestrebt. Innovative Formen der überkommunalen Zusammenarbeit erlauben eine effiziente Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen. Die historischen Ortszentren als Herzstücke und Begegnungsorte in den Gemeinden werden städtebaulich und funktional weiterentwickelt. Die traditionelle Architektur, die Schützenswerte Ortsbilder und die Kulturgüter werden erhalten, ohne dabei energetisch sinnvolle Veränderungen zu verunmöglichen. Neubauten orientieren sich bezüglich Gestaltung an der traditionellen Baukultur und entwickeln diese weiter. 3.2 Die Wirtschafts- und Innovationsstandorte in den urbanen Räumen stärken Gut erschlossene Arbeitsplatzgebiete werden aktiv entwickelt. In den urbanen Räumen werden wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte an gut mit öffentlichem Verkehr erschlossenen Standorten gemeindeübergreifend abgestimmt und damit eine wirkungsvolle Vernetzung unternehmerischer Tätigkeiten unterstützt. Geeignete Gebiete für neue wirtschaftliche Aktivitäten und kantonal bedeutende Einrichtungen und Nutzungen werden lokalisiert und ihre optimale Nutzung wird gesteuert und überwacht. Die Industriestandorte sowie die die Innovations- und Bildungszentren (The Ark, HES-SO Wallis, Antenne EPFL, etc.) werden in den urbanen Räumen der Rhoneebene konzentriert und entsprechend ihrer jeweiligen Charakteristika entwickelt und gestärkt. 3.3 Eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität fördern Eine hohe architektonische und städtebauliche Gestaltung der Siedlung wird angestrebt. Diese Qualitäten sind sowohl in urbanen als auch in dörflichen Siedlungen einzufordern. Dabei gilt es die Balance zu wahren zwischen der Pflege des baukulturellen Erbes sowie der Stärkung der Ortszentren in ihrer Nutzungsvielfalt und Funktionsfähigkeit. Eine angemessene Versorgung mit öffentlichen Frei- und Grünräumen im Siedlungsgebiet wird sichergestellt. Die Freiräume werden insbesondere in urbanen Gebieten aktiv und attraktiv gestaltet, da sie das Stadtbild prägen und eine wichtige Funktion für die Erholung übernehmen. 18
19 3.4 Der Zersiedelung entgegenwirken, haushälterisch mit dem Boden umgehen und die Siedlung nach innen entwickeln Bestehende Potenziale für eine Siedlungsentwicklung nach Innen (Verdichtung, Umnutzung, Baulücken) werden lokalisiert und mobilisiert. Der Kanton erarbeitet innovative Instrumente, welche den Gemeinden helfen, die Baulandreserven zu mobilisieren, zu bewirtschaften und die Hortung von Bauland zu verhindern und damit die Zersiedelung zu verhindern oder zu reduzieren. Die Innenentwicklung folgt hohen Qualitätsansprüchen. So wird auf die traditionelle Siedlungsstruktur, bestehende ortsbauliche Qualitäten und eine ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiräumen Rücksicht genommen. Bauzonen werden nur in Ausnahmefällen aufgrund eines regional ausgewiesenen Baulandbedarfs und für zweckmässige Bereiche ausgeschieden und unter klaren Bedingungen und Auflagen in Bezug auf die ÖV-Erschliessung, die verdichtete Bauweise und die Verfügbarkeit des Baulandes. 3.5 Hohe baulichen Dichten in geeigneten Gebieten anstreben und gleichzeitig öffentliche Räume aufwerten An geeigneten Stellen, insbesondere in den urbanen Räumen wird eine qualitätvolle Verdichtung angestrebt. Einerseits sind der Planung von öffentlichen Räumen mit hoher Qualität und der Umsetzung von attraktiven Bedingungen für den Langsamverkehr ein besonderes Augenmerk zu schenken. Andererseits sind im Rahmen der Verdichtung auch Frei- und Grünräume abwechslungsreich zu gestalten und naturnahe Flächen zur Förderung der ökologischen Vernetzung zu erhalten. Die Schwerpunkte der künftigen Siedlungsentwicklung liegen an leistungsfähigen Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs. In diesen Gebieten fördern die Gemeinden das Wohnen und Arbeiten, ermöglichen hohe bauliche Dichten und setzen architektonische Akzente. Auch verkehrsintensive Nutzungen werden an diesen Standorten konzentriert. 3.6 Die Siedlung begrenzen, um Räume für die Landwirtschaft und die Natur zu bewahren Die landwirtschaftlichen Flächen und die Naturräume zwischen den Siedlungen werden erhalten. Dazu wird die Siedlung begrenzt. Insbesondere in der dicht besiedelten Rhoneebene werden kompakte Siedlungen angestrebt. Freihaltegebiete sichern die produktive Rolle der Landwirtschaft, unterstützen die Entwicklung von ökologischen Vernetzungskorridoren und dienen der Siedlungstrennung. 3.7 Die Siedlung und den Verkehr aufeinander abstimmen Die Siedlungsentwicklung konzentriert sich auf gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossene Standorte. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs wird bei bedeutenden Siedlungsgebieten mit einer ungenügenden internen Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr angegangen. Arbeits- und Wohnnutzungen und die Mobilität werden insbesondere innerhalb der urbanen Räume koordiniert, so dass die verkehrlichen Auswirkungen minimiert werden können. Die Gemeinden achten deshalb bei ihren Planungen auf einen ausgewogenen Nutzungs- und Dichtemix. 3.8 Die Bevölkerung, Tiere, Infrastrukturen, Kulturgüter und Umwelt vor Naturgefahren oder technischen Gefahren schützen Die Bevölkerung, die Tiere, die Infrastrukturen, die Kulturgüter und die Umwelt werden vor Naturgefahren und technischen Gefahren geschützt. In erster Linie wird der Schutz mit einer vorausschauenden Planung sichergestellt. Bauliche Massnahmen werden getroffen, wenn die Schadenspotenziale besonders hoch sind und wenn sich das Risiko durch Unterhaltsmassnahmen und oder durch raumplanerische Massnahmen nicht minimieren lässt. 19
20 Staat Wallis, DRE 20
21 Verkehr und Mobilität Die Anbindung an die Metropolitanräume in der Schweiz und in Europa stärken Die Anbindung des Kantons und seiner Räume an die nationale und internationale Verkehrsinfrastruktur wird gesichert und verbessert, namentlich auch mit dem Vollausbau der NEAT am Lötschberg. Das Ziel sind möglichst direkte Verbindungen von den städtischen Zentren in die Metropolitanräume von Bern, Arc Lémanique, Zürich, Basel und Mailand Die wichtigsten Strassen- und Schienenverbindungen sind ganzjährig befahrbar. Sichere und leistungsfähige Verkehrsanbindung aller Walliser Gemeinden an die Zentren sicherstellen Die Anbindung (durch Strassen oder im Ausnahmefall durch Seilbahnen) der Gemeinden in allen Räumen des Wallis an die Zentren ist eine Voraussetzung für deren Funktionsfähigkeit. Deshalb werden eine ganzjährige Verfügbarkeit, eine angemessene Leistungsfähigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit dieser Verbindungen sichergestellt. Die Beeinträchtigung der Siedlungsgebiete durch den motorisierten Verkehr wird minimiert. Die Verkehrsplanung und lenkung nimmt auf lärmempfindliche Nutzungen Rücksicht. Die Verbindungen aus dem Umland der urbanen Räume und den Seitentälern zu den städtischen Zentren werden verbessert. Damit können die Verflechtungen zwischen diesen Räumen intensiviert werden. Ein leistungsfähiges, wirtschaftliches und umweltfreundliches ÖV-Angebot bereitstellen Ein attraktives und zum motorisierten Individualverkehr (MIV) konkurrenzfähiges Angebot des öffentlichen Verkehrs (ÖV) wird zwischen den städtischen Zentren angeboten. Die Vernetzung und wechselseitige funktionale Ergänzung der Zentren wird so gestärkt. Die Umsteigemöglichkeiten für Pendlerströme werden optimiert. Dazu wird das System des öffentlichen Verkehrs konsequent auf die leistungsfähigen Knotenpunkte ausgerichtet. Dies ermöglicht geringe Umsteigezeiten. Der öffentliche Verkehr übernimmt in den urbanen Räumen eine wichtige Rolle. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird so weiterentwickelt, dass er für Pendler zu einer echten Alternative zum motorisierten Verkehr wird. Innerhalb der städtischen Zentren werden direkte Nahverkehrsverbindungen angeboten. Der öffentliche Verkehr in den Seitentälern wird nachfrageorientiert entwickelt. Ein Grundangebot des öffentlichen Verkehrs wird auch in peripheren Räumen angeboten. In Randgebieten wird mit innovativen Konzepten die Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Verkehrs verbessert. Die Erschliessung der Tourismuszentren mit dem öffentlichen Verkehr wird verbessert. Der Fahrplan richtet sich an den Touristenströmen aus und stellt über die Knoten in den städtischen Zentren optimale Anschlüsse in die Metropolitanräume sicher. Die kombinierte Mobilität unterstützen Die kombinierte Mobilität wird gefördert. Die Vorteile von verschiedenen Verkehrsträgern werden so kombiniert, dass neue, gut zugängliche und finanziell tragbare Angebote entstehen. Geeignete Infrastrukturen werden an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs bereitgestellt (Park+Ride, Bike+Ride, Mobility). Den Langsamverkehr fördern, insbesondere in städtischen Gebieten In und zwischen den städtischen Zentren werden sichere und direkte Wege und Infrastrukturen für den Langsamverkehr angeboten. Abstellanlagen für Fahrräder werden in den Zentren und an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs bereitgestellt. 21
22 5 5.1 Versorgung und Infrastrukturen Günstige Bedingungen für die lokale und erneuerbare Energieproduktion sowie für die Verwertung der Abwärme schaffen Es werden Voraussetzungen geschaffen, dass die Energieproduktion die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft befriedigen kann. Dabei werden die ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen in die Planung einbezogen. Die Energieversorgung aus Wasserkraft, Hauptenergiequelle des Kantons, wird ergänzt durch die Nutzung anderer lokaler und erneuerbarer energetischer Ressourcen (Wind, Biomasse, Solarenergie für Wärme oder Strom, Geothermie, ). Die Abwärme wird zurückgewonnen und verwertet. 5.2 Den Ressourcen- und Energieverbrauch verringern Der Ressourcen- und Energieverbrauch der Gebäude wird minimiert. Hohe energetische Standards werden sowohl bei Neubauten als auch bei Renovationen gefördert. Industrielle Prozesse werden hinsichtlich ihres Ressourcen- und Energieverbrauchs optimiert. Die Abfallmenge wird begrenzt und deren Verwertung oder Umwandlung in verwertbare Materialien (industrielle Ökologie) werden unterstützt. Recycelbare Rohstoffe werden wiederverwertet. 5.3 Die Versorgungs- und Entsorgungsinfrastrukturen optimieren Die Produktions-, Übertragungs- und Verteilungsinfrastrukturen für Energie werden so geplant, dass die Leistungsfähigkeit der Energieversorgung optimiert und die negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Gewässer, die Natur und das Landschaftsbild minimiert werden. Der Anschluss an ein leistungsfähiges Telekommunikationsnetz wird sichergestellt. Insbesondere in den städtischen Zentren ist dieses Voraussetzung für hochwertige Dienstleistungsbetriebe. Die Infrastrukturen zur Behandlung von Abwasser und der Abfallverwertung werden erhalten und verbessert. Die Abbau- und Deponiestandorte werden sorgfältig gewählt. Die abgebauten Materialien werden haushälterisch genutzt. Nach der Nutzung werden die Standorte rekultiviert. 5.4 Ein ganzheitliches Wassermanagement fördern Die sparsame Wassernutzung wird gefördert und die permanente Versorgung mit Trink- und Leitungswasser von hoher Qualität im ganzen Kanton sichergestellt. Um die hohe Qualität des Grundwassers zu schützen, werden geeignete Massnahmen ergriffen. Das Grundwasser stellt das wichtigste Trinkwasserreservoir für die heutigen und künftigen Generationen dar. Der Kanton schafft Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wassernutzung durch die Landwirtschaft. Bei der Entnahme von Wasser für die Bewässerung wird auf die natürlichen Funktionen der Fliessgewässer und Seen Rücksicht genommen. Die Belastung der Oberflächengewässer und des Grundwassers durch Dünger und Pestizide wird minimiert. Die Energieproduktion durch Wasserkraft wird nur dort entwickelt, wo Sicherheits- und Umweltinteressen es zulassen. 22
23 23 Staat Wallis, Valais Tourisme
24 Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung, DVER Dienststelle für Raumentwicklung Sitten, November 2014 Foto auf der Titelseite : FDDM, Christian Laubacher 24
Kick-off ÖREK 2011. Grundzüge der Raumordnung 1996
 Kick-off ÖREK 2011 RAUMKONZEPT SCHWEIZ Dr. Fritz Wegelin, Bern 1 Grundzüge der Raumordnung 1996 Vom Bund erarbeitet Nach Anhörung der Kantone und weiterer interessierter Kreise (Vernehmlassung) stark überarbeitet
Kick-off ÖREK 2011 RAUMKONZEPT SCHWEIZ Dr. Fritz Wegelin, Bern 1 Grundzüge der Raumordnung 1996 Vom Bund erarbeitet Nach Anhörung der Kantone und weiterer interessierter Kreise (Vernehmlassung) stark überarbeitet
Perspektiven ohne Siedlungswachstum
 Perspektiven ohne Siedlungswachstum Qualitatives Wachstum für die Natur- und Kulturlandschaft im Kanton Zürich Gemeindeforum 2014 Dr. Stefan Lüthi Zürich, 18. November 2014 1 Vielfalt im Metropolitanraum
Perspektiven ohne Siedlungswachstum Qualitatives Wachstum für die Natur- und Kulturlandschaft im Kanton Zürich Gemeindeforum 2014 Dr. Stefan Lüthi Zürich, 18. November 2014 1 Vielfalt im Metropolitanraum
Leitbild Malans. Wohnen und leben in den Bündner Reben
 Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Leitbild Gemeinde Felben-Wellhausen 2003 Überarbeitet 2015. Grundlage für Konkretisierung der Massnahmen. Unsere Leitidee.
 2003 Überarbeitet 2015 Grundlage für Konkretisierung der Massnahmen Unsere Leitidee Felben-Wellhausen Ein wohnliches Dorf zum Leben und Arbeiten in einer aufstrebenden Region 1 Gemeindeentwicklung Bewahrung
2003 Überarbeitet 2015 Grundlage für Konkretisierung der Massnahmen Unsere Leitidee Felben-Wellhausen Ein wohnliches Dorf zum Leben und Arbeiten in einer aufstrebenden Region 1 Gemeindeentwicklung Bewahrung
2 Raumkonzept Uri. Raum- und Zentrenstruktur 2.1. Querverweis Die im Raumkonzept verwendeten
 2 Raumkonzept Uri Der Kanton Uri ist geprägt durch die besondere Schönheit der alpinen Landschaft zwischen Gotthardmassiv und Vierwaldstättersee. Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften mit der Land- und
2 Raumkonzept Uri Der Kanton Uri ist geprägt durch die besondere Schönheit der alpinen Landschaft zwischen Gotthardmassiv und Vierwaldstättersee. Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften mit der Land- und
Die Zukunft des Walliser Tourismus Staatsrat Jean-Michel
 Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung (DVR) Département de l économie et du territoire (DET) Die Zukunft des Walliser Tourismus Staatsrat Jean-Michel Cina Optimisation de la Promotion promotion
Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung (DVR) Département de l économie et du territoire (DET) Die Zukunft des Walliser Tourismus Staatsrat Jean-Michel Cina Optimisation de la Promotion promotion
Die Leitsätze sind langfristig ausgelegt. Sie zeigen die Absicht, Richtung und Bandbreite auf, die als Leitplanken für das Handeln in der Gemeinde
 ist Lebensqualität Präambel Die Leitsätze sind langfristig ausgelegt. Sie zeigen die Absicht, Richtung und Bandbreite auf, die als Leitplanken für das Handeln in der Gemeinde dienen. 2 3 ABSICHT RICHTUNG
ist Lebensqualität Präambel Die Leitsätze sind langfristig ausgelegt. Sie zeigen die Absicht, Richtung und Bandbreite auf, die als Leitplanken für das Handeln in der Gemeinde dienen. 2 3 ABSICHT RICHTUNG
Kantonale Volksinitiative zum Erhalt der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen im Kanton Zürich
 Kantonale Volksinitiative zum Erhalt der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen im Kanton Zürich Eine regionale landwirtschaftliche Produktion, die die Ernährungssouveränität mit möglichst
Kantonale Volksinitiative zum Erhalt der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen im Kanton Zürich Eine regionale landwirtschaftliche Produktion, die die Ernährungssouveränität mit möglichst
Bewegt und verbindet
 Bewegt und verbindet Eine Stadtbahn für das Limmattal Die Limmattalbahn holt diejenigen Gebiete ab, in denen die stärkste Entwicklung stattfindet. Gleichzeitig fördert sie gezielt die innere Verdichtung
Bewegt und verbindet Eine Stadtbahn für das Limmattal Die Limmattalbahn holt diejenigen Gebiete ab, in denen die stärkste Entwicklung stattfindet. Gleichzeitig fördert sie gezielt die innere Verdichtung
S t e c k b r i e f. Kneipen Säle Vereinslokale. Lebensmittelgeschäfte Bäcker Metzger Post Bank
 S t e c k b r i e f 1. Bewerbung von: Gemeinde: a) Ort b) Ortsgruppe c) Stadtteil (Unzutreffendes streichen) Wieso diese Kombination? 2. Einwohnerzahlen 3. Bevölkerungsstruktur (in Prozent) Einwohner 1900
S t e c k b r i e f 1. Bewerbung von: Gemeinde: a) Ort b) Ortsgruppe c) Stadtteil (Unzutreffendes streichen) Wieso diese Kombination? 2. Einwohnerzahlen 3. Bevölkerungsstruktur (in Prozent) Einwohner 1900
MANDATSVORSCHLAG DER AD HOC ARBEITSGRUPPE FUR DIE VORBEREITUNG DES
 MANDATSVORSCHLAG DER AD HOC ARBEITSGRUPPE FUR DIE VORBEREITUNG DES 6. Alpenzustandsberichts 2016 zum Thema Greening the Economy in the Alpine Region für den Zeitraum 2015-2016 1. Einsetzung der Arbeitsgruppe/Plattform
MANDATSVORSCHLAG DER AD HOC ARBEITSGRUPPE FUR DIE VORBEREITUNG DES 6. Alpenzustandsberichts 2016 zum Thema Greening the Economy in the Alpine Region für den Zeitraum 2015-2016 1. Einsetzung der Arbeitsgruppe/Plattform
Legislaturprogramm. 2012 bis 2016
 GEMEINDE BOTTMINGEN Gemeinderat Legislaturprogramm 2012 bis 2016 Bottmingen, im Dezember 2012 2 Legislaturprogramm des Gemeinderats 2012 bis 2016 Im Jahr 2009 hat der Gemeinderat in Form eines Leitbilds
GEMEINDE BOTTMINGEN Gemeinderat Legislaturprogramm 2012 bis 2016 Bottmingen, im Dezember 2012 2 Legislaturprogramm des Gemeinderats 2012 bis 2016 Im Jahr 2009 hat der Gemeinderat in Form eines Leitbilds
Landschaft in den Alpen
 Landschaft in den Alpen Was erwarten Sie von ihr? Eine Umfrage des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck im Rahmen des Interreg-IV-Projektes «Kultur.Land.(Wirt)schaft Strategien für die Kulturlandschaft
Landschaft in den Alpen Was erwarten Sie von ihr? Eine Umfrage des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck im Rahmen des Interreg-IV-Projektes «Kultur.Land.(Wirt)schaft Strategien für die Kulturlandschaft
Ein Strategieprogramm für die Gemeinde Fiesch
 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Page 1 sur 1 Ein Strategieprogramm für die Gemeinde Fiesch eingereicht durch Institut Wirtschaft
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Page 1 sur 1 Ein Strategieprogramm für die Gemeinde Fiesch eingereicht durch Institut Wirtschaft
GÜRP SG Teilrichtplan Siedlung
 FORUM 5 vom 12. März 2015, Wattwil GÜRP SG Teilrichtplan Siedlung Evaluation der Gemeindegespräche zur Festlegung der Siedlungsgebiete im Richtplan und Empfehlungen für die weiteren Schritte von Ursula
FORUM 5 vom 12. März 2015, Wattwil GÜRP SG Teilrichtplan Siedlung Evaluation der Gemeindegespräche zur Festlegung der Siedlungsgebiete im Richtplan und Empfehlungen für die weiteren Schritte von Ursula
Unser Leitbild unser Lebensraum. UNESCO-Welterberegion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut
 Unser Leitbild unser Lebensraum UNESCO-Welterberegion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Ein Leitbild enthält das gemeinsam erarbeitete Einverständnis über die zukünftige Ausrichtung einer Region es stellt
Unser Leitbild unser Lebensraum UNESCO-Welterberegion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Ein Leitbild enthält das gemeinsam erarbeitete Einverständnis über die zukünftige Ausrichtung einer Region es stellt
Gesetz über die Regionalpolitik
 Gesetz über die Regionalpolitik - - vom. Dezember 008 Der Grosse Rat des Kantons Wallis eingesehen das Bundesgesetz über Regionalpolitik vom 6. Oktober 006; eingesehen die Bestimmungen der Artikel 5, und
Gesetz über die Regionalpolitik - - vom. Dezember 008 Der Grosse Rat des Kantons Wallis eingesehen das Bundesgesetz über Regionalpolitik vom 6. Oktober 006; eingesehen die Bestimmungen der Artikel 5, und
Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft
 Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft Nachhaltige Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich Editorial Bild: HSR Landschaft geht uns alle an! Sei es, weil wir in ihr arbeiten, uns darin erholen, darin
Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft Nachhaltige Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich Editorial Bild: HSR Landschaft geht uns alle an! Sei es, weil wir in ihr arbeiten, uns darin erholen, darin
forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE forum.landschaft 19.11.2015 1
 forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE 1 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL REGIONALER NATURPARK VON NATIONALER BEDEUTUNG 2 REGIONALER NATURPARK BINNTAL ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE NATUR- UND KULTURWERTE
forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE 1 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL REGIONALER NATURPARK VON NATIONALER BEDEUTUNG 2 REGIONALER NATURPARK BINNTAL ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE NATUR- UND KULTURWERTE
Stadt am Fluss: Beispiele aus Zürich. Veranstaltungsreihe zur Gestaltung des Ulmer Donauufers 10. April 2008
 Stadt am Fluss: Beispiele aus Zürich Veranstaltungsreihe zur Gestaltung des Ulmer Donauufers 10. April 2008 Zürich ist als Stadtraum, als Erholungs- und als Naturraum in vielen Facetten erlebbar. Wasser
Stadt am Fluss: Beispiele aus Zürich Veranstaltungsreihe zur Gestaltung des Ulmer Donauufers 10. April 2008 Zürich ist als Stadtraum, als Erholungs- und als Naturraum in vielen Facetten erlebbar. Wasser
Charta für eine nachhaltige städtische Mobilität
 Charta für eine nachhaltige städtische Mobilität Gemeinsam für Lebensqualität in unseren Städten Die wachsende Bevölkerung und die allgemeine Zunahme der Mobilität kumulieren sich insbesondere in den Städten
Charta für eine nachhaltige städtische Mobilität Gemeinsam für Lebensqualität in unseren Städten Die wachsende Bevölkerung und die allgemeine Zunahme der Mobilität kumulieren sich insbesondere in den Städten
Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur
 Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur Geotechnik, Infrastrukturbauten, Mobilität und Siedlungsentwicklung: Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen interdisziplinäre Lösungen für zukünftige räumliche
Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur Geotechnik, Infrastrukturbauten, Mobilität und Siedlungsentwicklung: Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen interdisziplinäre Lösungen für zukünftige räumliche
Richtplan 2030. Neue Herausforderungen für die Raumplanung im Kanton Bern
 Richtplan 2030 Neue Herausforderungen für die Raumplanung im Eine Präsentation zur öffentlichen Mitwirkung und Vernehmlassung vom 18. September bis am 18. Dezember 2014 AGR Der ist lebenswert 2 AGR Der
Richtplan 2030 Neue Herausforderungen für die Raumplanung im Eine Präsentation zur öffentlichen Mitwirkung und Vernehmlassung vom 18. September bis am 18. Dezember 2014 AGR Der ist lebenswert 2 AGR Der
Ländliche Infrastrukturen in der Schweiz: Zukunftsperspektiven
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Lebensader Infrastruktur im Ländlichen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Lebensader Infrastruktur im Ländlichen
Leitbild Bezirk Gonten
 Leitbild Bezirk Gonten VORWORT Menschen haben in ihrem Umfeld, in dem sie leben, Vorstellungen und Erwartungen. Wer sich nicht mit der Zukunft auseinandersetzt, wird sich kaum weiter entwickeln. Auch für
Leitbild Bezirk Gonten VORWORT Menschen haben in ihrem Umfeld, in dem sie leben, Vorstellungen und Erwartungen. Wer sich nicht mit der Zukunft auseinandersetzt, wird sich kaum weiter entwickeln. Auch für
Regionales Entwicklungskonzept Fricktal
 Regionales Entwicklungskonzept Fricktal Strategische Herausforderungen Ziele des REK Positionierung als international wettbewerbsfähige Region Integration der stärkeren und schwächeren Gemeinden Bedürfnisse
Regionales Entwicklungskonzept Fricktal Strategische Herausforderungen Ziele des REK Positionierung als international wettbewerbsfähige Region Integration der stärkeren und schwächeren Gemeinden Bedürfnisse
Dokumentation zum Excel Landschaftszersiedelungstool
 Dokumentation zum Excel Landschaftszersiedelungstool für Gebäude 1 Einleitung Das Bewertungstool Landschaftszersiedelung ist im SNBS Tool 307 für Wohnen und Verwaltung integriert und liegt nicht gesondert
Dokumentation zum Excel Landschaftszersiedelungstool für Gebäude 1 Einleitung Das Bewertungstool Landschaftszersiedelung ist im SNBS Tool 307 für Wohnen und Verwaltung integriert und liegt nicht gesondert
Gemeinde Habsburg Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland
 Gemeinde Gesamtrevision Siedlung und Kulturland 1 Agenda Vorstellung Grundlagen / Vorarbeiten zur der Planungskommission Verfahren Zeitplan Kreditantrag 2 Vorstellung Stefan Giess, dipl. Ing. FH in Raumplanung
Gemeinde Gesamtrevision Siedlung und Kulturland 1 Agenda Vorstellung Grundlagen / Vorarbeiten zur der Planungskommission Verfahren Zeitplan Kreditantrag 2 Vorstellung Stefan Giess, dipl. Ing. FH in Raumplanung
Erfahrungen mit der Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) in der Schweiz
 Erfahrungen mit der Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) in der Schweiz Prof. Dr. Daniel Wachter Leiter Sektion Nachhaltige Entwicklung Bundesamt für Raumentwicklung CH-3003 Bern Dritte Fachtagung Bürokratieabbau
Erfahrungen mit der Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) in der Schweiz Prof. Dr. Daniel Wachter Leiter Sektion Nachhaltige Entwicklung Bundesamt für Raumentwicklung CH-3003 Bern Dritte Fachtagung Bürokratieabbau
Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor Immobilien-Summit Flughafenregion, Rümlang, 23. Juni 2015
 Kanton Zürich Finanzdirektion Volkswirtschaftliche Perspektiven: Kanton Zürich und Flughafenregion Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor Immobilien-Summit Flughafenregion, Rümlang, 23. Juni
Kanton Zürich Finanzdirektion Volkswirtschaftliche Perspektiven: Kanton Zürich und Flughafenregion Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor Immobilien-Summit Flughafenregion, Rümlang, 23. Juni
Aktion zur ländlichen Entwicklung. Was ist das?
 Aktion zur ländlichen Entwicklung Was ist das? Inhalt der Präsentation: Was ist eine Aktion zur Ländlichen Entwicklung (ALE)? Die Themen der ALE Die Akteure in der ALE Die Rolle der Örtlichen Kommission
Aktion zur ländlichen Entwicklung Was ist das? Inhalt der Präsentation: Was ist eine Aktion zur Ländlichen Entwicklung (ALE)? Die Themen der ALE Die Akteure in der ALE Die Rolle der Örtlichen Kommission
«Der Zukunft auf der Spur» die Zukunft gestalten
 «Der Zukunft auf der Spur» Blauen - die Zukunft gestalten heute Dorfentwicklungsplan Blauen Ziele, Strategie und Massnahmen Präsentation anlässlich GV «Promotion Laufental» 15. Mai 2013 Heute «Der die
«Der Zukunft auf der Spur» Blauen - die Zukunft gestalten heute Dorfentwicklungsplan Blauen Ziele, Strategie und Massnahmen Präsentation anlässlich GV «Promotion Laufental» 15. Mai 2013 Heute «Der die
Regionale Zentren und ländliche Entwicklung in der Schweiz
 Regionale Zentren und ländliche Entwicklung in der Schweiz Qualitative Studie zur Bedeutung und Funktion regionaler Zentren für die ländliche Entwicklung und deren regionalpolitischer Inwertsetzung im
Regionale Zentren und ländliche Entwicklung in der Schweiz Qualitative Studie zur Bedeutung und Funktion regionaler Zentren für die ländliche Entwicklung und deren regionalpolitischer Inwertsetzung im
Perspektive auf die Wohnpolitik von Olten. 3. Juni 2013
 Perspektive auf die Wohnpolitik von Olten 3. Juni 2013 3. Juni 2013 / Seite 2 Warum boomt Olten nicht? Wohnen im Bestand Workshop Stadt Olten 14. Februar 2013 / Seite 3 Olten Wohnen im Bestand Workshop
Perspektive auf die Wohnpolitik von Olten 3. Juni 2013 3. Juni 2013 / Seite 2 Warum boomt Olten nicht? Wohnen im Bestand Workshop Stadt Olten 14. Februar 2013 / Seite 3 Olten Wohnen im Bestand Workshop
Landschaft als Standortfaktor!? Silvia Tobias Eidgenössische Forschungsanstalt WSL
 Landschaft als Standortfaktor!? Silvia Tobias Eidgenössische Forschungsanstalt WSL Inhalt Landschaft heute Landschaft ist ein Standortfaktor! Landschaftsschutz durch Standortmarketing? Warum das nicht
Landschaft als Standortfaktor!? Silvia Tobias Eidgenössische Forschungsanstalt WSL Inhalt Landschaft heute Landschaft ist ein Standortfaktor! Landschaftsschutz durch Standortmarketing? Warum das nicht
Veröffentlichung zu Zustand und Bedeutung der biologischen Vielfalt in Österreich
 Ländlicher Raum - Ausgabe 01/2014 1 Inge Fiala Veröffentlichung zu Zustand und Bedeutung der biologischen Vielfalt in Österreich Einleitung Die biologische Vielfalt ist weltweit gefährdet und auch in Österreich
Ländlicher Raum - Ausgabe 01/2014 1 Inge Fiala Veröffentlichung zu Zustand und Bedeutung der biologischen Vielfalt in Österreich Einleitung Die biologische Vielfalt ist weltweit gefährdet und auch in Österreich
SKIGEBIETSNACHHALTIGKEIT. Nachhaltigkeit ist das Grundprinzip der europäischen Forstwirtschaft seit vielen Generationen.
 SKIGEBIETSNACHHALTIGKEIT 1. Einleitung: Nachhaltigkeit ist das Grundprinzip der europäischen Forstwirtschaft seit vielen Generationen. Eine Definition aus forstwirtschaftlicher Sicht: Natürliche nachwachsende
SKIGEBIETSNACHHALTIGKEIT 1. Einleitung: Nachhaltigkeit ist das Grundprinzip der europäischen Forstwirtschaft seit vielen Generationen. Eine Definition aus forstwirtschaftlicher Sicht: Natürliche nachwachsende
Verdichtung der städtischen Wohnbevölkerung. Swiss Real Estate Institute 64. Gewerbliche Winterkonferenz Klosters 18.01.2013
 Verdichtung der städtischen Wohnbevölkerung Swiss Real Estate Institute 64. Gewerbliche Winterkonferenz Klosters 18.01.2013 Seit 1981 wächst die Schweizer Wohnbevölkerung nur ausserhalb der grossen Städte
Verdichtung der städtischen Wohnbevölkerung Swiss Real Estate Institute 64. Gewerbliche Winterkonferenz Klosters 18.01.2013 Seit 1981 wächst die Schweizer Wohnbevölkerung nur ausserhalb der grossen Städte
Herausforderung Raumentwicklung Schweiz
 Herausforderung Raumentwicklung Schweiz Die Raumentwicklung der Schweiz verläuft bis heute nicht nachhaltig trotz dem seit Ende der 1970er-Jahre bestehenden Raumplanungsgesetz und der darin verankerten
Herausforderung Raumentwicklung Schweiz Die Raumentwicklung der Schweiz verläuft bis heute nicht nachhaltig trotz dem seit Ende der 1970er-Jahre bestehenden Raumplanungsgesetz und der darin verankerten
KantonsplanerInnen des Metropolitanraums Zürich. Raumordnungskonzept für die Kantone im Metropolitanraum Zürich. Metro-ROK
 KantonsplanerInnen des Metropolitanraums Zürich Raumordnungskonzept für die Kantone im Metropolitanraum Zürich Metro-ROK Zug, 15. Juni 2015 Impressum Herausgeber: KantonsplanerInnen der Kantone Aargau,
KantonsplanerInnen des Metropolitanraums Zürich Raumordnungskonzept für die Kantone im Metropolitanraum Zürich Metro-ROK Zug, 15. Juni 2015 Impressum Herausgeber: KantonsplanerInnen der Kantone Aargau,
InnovationTower: Wo Visionäre wirken.
 InnovationTower: Wo Visionäre wirken. Die Idee: Knotenpunkt der Kreativität. Der InnovationTower ist eine inspirierende Arbeitsumgebung für dynamische Hightechunternehmen. Ein Ort, an dem neue Ideen entwickelt
InnovationTower: Wo Visionäre wirken. Die Idee: Knotenpunkt der Kreativität. Der InnovationTower ist eine inspirierende Arbeitsumgebung für dynamische Hightechunternehmen. Ein Ort, an dem neue Ideen entwickelt
2. TAGESSEMINAR ZUR REK-ENTWICKLUNG 17. FEBRUAR 2014 STADT EICHSTÄTT
 2. TAGESSEMINAR ZUR REK-ENTWICKLUNG MODERATOREN: Markus Gebhardt Simon Lugert 17. FEBRUAR 2014 STADT EICHSTÄTT 1 1 WILLKOMMEN, ZIELE UND ABLAUF 2 REVIEW WORKSHOP 1 WAS VERBINDET UNS? 3 REVIEW WORKSHOP
2. TAGESSEMINAR ZUR REK-ENTWICKLUNG MODERATOREN: Markus Gebhardt Simon Lugert 17. FEBRUAR 2014 STADT EICHSTÄTT 1 1 WILLKOMMEN, ZIELE UND ABLAUF 2 REVIEW WORKSHOP 1 WAS VERBINDET UNS? 3 REVIEW WORKSHOP
Stadel. Windlach. Schüpfheim. Raat. Leitbild Gemeinde Stadel
 Stadel Windlach Raat Schüpfheim Leitbild Gemeinde Stadel Vorwort Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner Das aus dem Jahre 1996 stammende Leitbild wurde durch den Gemeinderat überarbeitet und den heutigen
Stadel Windlach Raat Schüpfheim Leitbild Gemeinde Stadel Vorwort Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner Das aus dem Jahre 1996 stammende Leitbild wurde durch den Gemeinderat überarbeitet und den heutigen
Indikatoren für Ökosystemleistungen: Der Schweizer Ansatz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Ökonomie und Umweltbeobachtung Indikatoren für Ökosystemleistungen: Der Schweizer Ansatz
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Ökonomie und Umweltbeobachtung Indikatoren für Ökosystemleistungen: Der Schweizer Ansatz
Gemeinde Glarus: Organigramm Projekt Parkierungskonzept und Programm öffentliches Forum
 Gemeinde Glarus: Organigramm Projekt Parkierungskonzept und Programm öffentliches Forum Die Gemeinde Glarus erarbeitet ein Parkierungskonzept mit etappierter Umsetzung konkreter Massnahmen. Das Konzept
Gemeinde Glarus: Organigramm Projekt Parkierungskonzept und Programm öffentliches Forum Die Gemeinde Glarus erarbeitet ein Parkierungskonzept mit etappierter Umsetzung konkreter Massnahmen. Das Konzept
Die lokale Situation: Europas ländliche Räume zwischen Anpassungsdruck und neuen Perspektiven am Fallbeispiel Südtirol
 Europäische Konferenz Stadt braucht Land braucht Stadt Freising, 23. bis 25. November 2011 Die lokale Situation: Europas ländliche Räume zwischen Anpassungsdruck und neuen Perspektiven am Fallbeispiel
Europäische Konferenz Stadt braucht Land braucht Stadt Freising, 23. bis 25. November 2011 Die lokale Situation: Europas ländliche Räume zwischen Anpassungsdruck und neuen Perspektiven am Fallbeispiel
E.3 Energieversorgung
 Staatsratsentscheid: Genehmigung durch den Bund: Interaktion mit anderen Blättern: D.1, E.1, E.4, E.5, E.6, E.7 Raumentwicklungsstrategie 5.1 : Günstige Bedingungen für die lokale und erneuerbare Energieproduktion
Staatsratsentscheid: Genehmigung durch den Bund: Interaktion mit anderen Blättern: D.1, E.1, E.4, E.5, E.6, E.7 Raumentwicklungsstrategie 5.1 : Günstige Bedingungen für die lokale und erneuerbare Energieproduktion
Alpentourismus ohne Gletscher?
 Alpentourismus ohne Gletscher? Prof. Dr. Dominik Siegrist Präsident CIPRA International Gletschertagung Salzburg 28. September 2011 Gliederung des Vortrags Ausgangslage Position der CIPRA Positive Beispiele
Alpentourismus ohne Gletscher? Prof. Dr. Dominik Siegrist Präsident CIPRA International Gletschertagung Salzburg 28. September 2011 Gliederung des Vortrags Ausgangslage Position der CIPRA Positive Beispiele
Informatikstrategie 2015-2024 des Staates Wallis. Pressekonferenz vom 7. September 2015
 Informatikstrategie 2015-2024 des Staates Wallis Pressekonferenz vom 7. September 2015 Wichtigkeit der IT-Funktion Kantonales Netz 560 km Glasfasern 8 Zugangspunkte (Knoten) 178 erschlossene Standorte
Informatikstrategie 2015-2024 des Staates Wallis Pressekonferenz vom 7. September 2015 Wichtigkeit der IT-Funktion Kantonales Netz 560 km Glasfasern 8 Zugangspunkte (Knoten) 178 erschlossene Standorte
Wasser-Agenda 21 die schweizerische Wasserwirtschaft in der Zukunft. Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs
 Wasser-Agenda 21 die schweizerische Wasserwirtschaft in der Zukunft Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs 05/07/2007 2 Wasser im Jahr 2030 05/07/2007 3 Wasser im Jahr 2030 05/07/2007 4
Wasser-Agenda 21 die schweizerische Wasserwirtschaft in der Zukunft Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs 05/07/2007 2 Wasser im Jahr 2030 05/07/2007 3 Wasser im Jahr 2030 05/07/2007 4
Melioration im Siedlungsgebiet Landmanagement bei Industriebrachen
 Melioration im Siedlungsgebiet Landmanagement bei Industriebrachen David Naef, Dipl. Kulturing. ETH Tagung 2005 ETHZ Landmanagement visionäre Innovation 15.09.2005 1 Melioration im Siedlungsgebiet? 2 Begriffserweiterung!
Melioration im Siedlungsgebiet Landmanagement bei Industriebrachen David Naef, Dipl. Kulturing. ETH Tagung 2005 ETHZ Landmanagement visionäre Innovation 15.09.2005 1 Melioration im Siedlungsgebiet? 2 Begriffserweiterung!
Mobilität in der Schweiz Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010
 Mobilität in der Schweiz Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Dr. Jürg Marti, Direktor BFS Dr. Maria Lezzi, Direktorin ARE Medienkonferenz Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Erste
Mobilität in der Schweiz Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Dr. Jürg Marti, Direktor BFS Dr. Maria Lezzi, Direktorin ARE Medienkonferenz Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Erste
Projektauswahlkriterien/ Bewertungsmatrix
 Projektauswahlkriterien/ smatrix 1. Grundlegende Eingangskriterien 0/ 1 Förderfähigkeit gemäß den Bestimmungen der EU, des Bundes und des Landes Diese Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Baurecht, Naturschutzrecht
Projektauswahlkriterien/ smatrix 1. Grundlegende Eingangskriterien 0/ 1 Förderfähigkeit gemäß den Bestimmungen der EU, des Bundes und des Landes Diese Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Baurecht, Naturschutzrecht
Agglomerationsprogramme im Kanton St.Gallen
 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Agglomerationsprogramme im Kanton St.Gallen 2. Österreichischer Stadtregionstag, 9. Oktober 2014 in Salzburg Ueli Strauss Gallmann, Amtsleiter, Kantonsplaner
Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Agglomerationsprogramme im Kanton St.Gallen 2. Österreichischer Stadtregionstag, 9. Oktober 2014 in Salzburg Ueli Strauss Gallmann, Amtsleiter, Kantonsplaner
Regionale Gewerbezone Schams
 Regionale Gewerbezone Schams Projektorganisation Strategische Steuergruppe: Fritz Bräsecke, Gemeindepräsident Ferrera Andrea Clopath, Gemeindepräsident Zillis-Reischen Silvio Clopath, Gemeindepräsident
Regionale Gewerbezone Schams Projektorganisation Strategische Steuergruppe: Fritz Bräsecke, Gemeindepräsident Ferrera Andrea Clopath, Gemeindepräsident Zillis-Reischen Silvio Clopath, Gemeindepräsident
EINWOHNERGEMEINDE RIEDHOLZ. Leitbild Riedholz
 EINWOHNERGEMEINDE RIEDHOLZ Leitbild Riedholz Stand 28. April 2014 Einwohnergemeinde Riedholz Leitbild Riedholz Formaler Aufbau Zu jedem Themenbereich ist ein Leitsatz formuliert, welcher die Zielsetzung
EINWOHNERGEMEINDE RIEDHOLZ Leitbild Riedholz Stand 28. April 2014 Einwohnergemeinde Riedholz Leitbild Riedholz Formaler Aufbau Zu jedem Themenbereich ist ein Leitsatz formuliert, welcher die Zielsetzung
geoforum.bl Systematische Raumbeobachtung im Kanton Basel-Landschaft
 Liestal, 20. Mai 2010 geoforum.bl Systematische Raumbeobachtung im Kanton Basel-Landschaft Rüdiger Hof 1 Systematische Raumbeobachtung BL Gliederung: Fachlicher Hintergrund Raumbeobachtung Indikatorenbasierte
Liestal, 20. Mai 2010 geoforum.bl Systematische Raumbeobachtung im Kanton Basel-Landschaft Rüdiger Hof 1 Systematische Raumbeobachtung BL Gliederung: Fachlicher Hintergrund Raumbeobachtung Indikatorenbasierte
Strategie Wasserkraft und Matrix Interessenabwägung von Schutz und Nutzen
 Baudepartement Strategie Wasserkraft und Matrix Interessenabwägung von Schutz und Nutzen Gesetzliche Rahmenbedingungen und Grundlagen Fachtagung/GV ISKB/ADUR,, Stellv. Sektionsleiter, AFU, Energie und
Baudepartement Strategie Wasserkraft und Matrix Interessenabwägung von Schutz und Nutzen Gesetzliche Rahmenbedingungen und Grundlagen Fachtagung/GV ISKB/ADUR,, Stellv. Sektionsleiter, AFU, Energie und
EIN NEUER, LEBENDIGER STADTTEIL PRÄGT DIE ZUKUNFT.
 EIN NEUER, LEBENDIGER STADTTEIL PRÄGT DIE ZUKUNFT. ZUM WOHNEN ZUM ARBEITEN ZUM ERLEBEN DAS NEUE, NACHHALTIGE QUARTIER IN LENZBURG. URBAN LEBEN. ZENTRAL ARBEITEN. ARBEITEN Es entstehen in diesem nachhaltigen
EIN NEUER, LEBENDIGER STADTTEIL PRÄGT DIE ZUKUNFT. ZUM WOHNEN ZUM ARBEITEN ZUM ERLEBEN DAS NEUE, NACHHALTIGE QUARTIER IN LENZBURG. URBAN LEBEN. ZENTRAL ARBEITEN. ARBEITEN Es entstehen in diesem nachhaltigen
PROJEKTE: LÄNDLICHE ENTWICKLUNG BÜLLINGEN
 Die lokale Wirtschaft auf Basis innovativer Ideen unterstützen 1.1. 1.1. Sich auf seine lokalen Stärken berufen und kurze Kreisläufe unterstützen 1.1.1. 1.1.1. Energiegewinnung aus dem Wald für Energiesparprojekte
Die lokale Wirtschaft auf Basis innovativer Ideen unterstützen 1.1. 1.1. Sich auf seine lokalen Stärken berufen und kurze Kreisläufe unterstützen 1.1.1. 1.1.1. Energiegewinnung aus dem Wald für Energiesparprojekte
Informatikleitbild der Kantonalen Verwaltung Zürich
 Informatikleitbild der Kantonalen Verwaltung Zürich Vom KITT verabschiedet am 26. Oktober 2006, vom Regierungsrat genehmigt am 20. Dezember 2006 Einleitung Zweck des Leitbildes Mit dem Informatikleitbild
Informatikleitbild der Kantonalen Verwaltung Zürich Vom KITT verabschiedet am 26. Oktober 2006, vom Regierungsrat genehmigt am 20. Dezember 2006 Einleitung Zweck des Leitbildes Mit dem Informatikleitbild
Power Point Präsentation. Georg Tobler Bundesamt für Raumentwicklung, Bern
 Power Point Präsentation Bundesamt für Raumentwicklung, Bern Quartierentwicklung in der Schweiz: Herausforderungen und Chancen aus nationaler Sicht Quartierentwicklung in der Schweiz: Herausforderungen
Power Point Präsentation Bundesamt für Raumentwicklung, Bern Quartierentwicklung in der Schweiz: Herausforderungen und Chancen aus nationaler Sicht Quartierentwicklung in der Schweiz: Herausforderungen
Mobilität in der Schweiz. Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Mobilität und Verkehr 899-1000.
 11 Mobilität und Verkehr 899-1000 Mobilität in der Schweiz Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Bundesamt für Statistik BFS Bundesamt für Raumentwicklung ARE Neuchâtel, 2012
11 Mobilität und Verkehr 899-1000 Mobilität in der Schweiz Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Bundesamt für Statistik BFS Bundesamt für Raumentwicklung ARE Neuchâtel, 2012
Masterplan Hochschulgebiet Zürich Zentrum. Zukunft des Hochschulstandorts WIE GEHT ES WEITER?
 WIE GEHT ES WEITER? Schrittweise vorgehen und sorgfältig umsetzen Im Hochschulgebiet führten ein langjähriger Investitionsstau und die heutigen und künftigen Bedürfnisse der Institutionen zu einer hohen
WIE GEHT ES WEITER? Schrittweise vorgehen und sorgfältig umsetzen Im Hochschulgebiet führten ein langjähriger Investitionsstau und die heutigen und künftigen Bedürfnisse der Institutionen zu einer hohen
Mobilität Thurgau BTS / OLS
 Mobilität Thurgau BTS / OLS Linienführung BTS im Raum Oberaach Informationsveranstaltung Amriswil, 19. Juni 2013 Linienführung BTS im Raum Oberaach Herzlich willkommen 2 1 Ablauf Einleitung Präsentation
Mobilität Thurgau BTS / OLS Linienführung BTS im Raum Oberaach Informationsveranstaltung Amriswil, 19. Juni 2013 Linienführung BTS im Raum Oberaach Herzlich willkommen 2 1 Ablauf Einleitung Präsentation
Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr (Angebotsverordnung)
 Angebotsverordnung 70. Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr (Angebotsverordnung) (vom. Dezember 988) Der Regierungsrat, gestützt auf 8 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr
Angebotsverordnung 70. Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr (Angebotsverordnung) (vom. Dezember 988) Der Regierungsrat, gestützt auf 8 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr
Gemeindeentwicklungsplan 2010-2015
 Vision Wir sind ein lebendiges Dorf mit bürgerschaftlichem Engagement, sozialem Zusammenhalt, nachhaltigem und energiebewusstem Handeln sowie mit einer florierenden Wirtschaft. Leitsätze Wir wollen eine
Vision Wir sind ein lebendiges Dorf mit bürgerschaftlichem Engagement, sozialem Zusammenhalt, nachhaltigem und energiebewusstem Handeln sowie mit einer florierenden Wirtschaft. Leitsätze Wir wollen eine
Punkt 39 der 878. Sitzung des Bundesrates am 17. Dezember 2010
 Bundesrat Drucksache 771/2/10 15.12.10 Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
Bundesrat Drucksache 771/2/10 15.12.10 Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
Siedlungsstrukturelle Ausgangssituation in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und Ableitung von Entwicklungsvarianten
 Siedlungsstrukturelle Ausgangssituation in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und Ableitung von Entwicklungsvarianten Zwischenstand: 21.08.2007 1 Aufgabenstellung des Moduls Erfassung und Bewertung der
Siedlungsstrukturelle Ausgangssituation in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und Ableitung von Entwicklungsvarianten Zwischenstand: 21.08.2007 1 Aufgabenstellung des Moduls Erfassung und Bewertung der
Agglomerationsprogramme Kanton Zürich
 Agglomerationsprogramme RWU Behördenanlass, 7.9.2011 W. Anreiter 12.10.2010 / Folie 2 09.12.2010/2 Agglomerationsprogramm Vorgaben Bund Programm Agglomerationsverkehr Bundespolitik 12.10.2010 / Folie 3
Agglomerationsprogramme RWU Behördenanlass, 7.9.2011 W. Anreiter 12.10.2010 / Folie 2 09.12.2010/2 Agglomerationsprogramm Vorgaben Bund Programm Agglomerationsverkehr Bundespolitik 12.10.2010 / Folie 3
Unter kapitalistischen Strukturen. Zukunftsmodelle entwickeln
 200 Jahre Hard Unter kapitalistischen Strukturen Zukunftsmodelle entwickeln Das Leben nach dem Kapitalismus "NEUSTART" Vortrag Peter Baccini Samstag, 21. September 2002 Für das Protokoll: Beni Müller,
200 Jahre Hard Unter kapitalistischen Strukturen Zukunftsmodelle entwickeln Das Leben nach dem Kapitalismus "NEUSTART" Vortrag Peter Baccini Samstag, 21. September 2002 Für das Protokoll: Beni Müller,
Werner Müller, Gemeindeammann
 Damit wir uns eines Tages nicht wundern müssen, hat der Gemeinderat entschieden, ein Leitbild für unsere Gemeinde zu entwickeln. Die Zielsetzung bestand darin, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, da
Damit wir uns eines Tages nicht wundern müssen, hat der Gemeinderat entschieden, ein Leitbild für unsere Gemeinde zu entwickeln. Die Zielsetzung bestand darin, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, da
Erneuerbare Energien im Gebirge: Bleiben Landschaftsund Naturschutz auf der Strecke?
 Erneuerbare Energien im Gebirge: Bleiben Landschaftsund Naturschutz auf der Strecke? Energietag, Grafenort, 2.9.2011, Felix Hahn SL - Landschafts- und Naturschutz, Teil Wind- und Solarkraft 1 Gliederung:
Erneuerbare Energien im Gebirge: Bleiben Landschaftsund Naturschutz auf der Strecke? Energietag, Grafenort, 2.9.2011, Felix Hahn SL - Landschafts- und Naturschutz, Teil Wind- und Solarkraft 1 Gliederung:
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
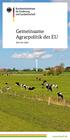 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Unternehmensstandort für bis 2 500 Arbeitsplätze im Kanton Zug ab 2014
 Unternehmensstandort für bis 2 500 Arbeitsplätze im Kanton Zug ab 2014 An zentraler Lage beim Bahnhof Rotkreuz entsteht ein integriertes Quartier mit einem vielfältigen Angebot an Wohnungen (1 500 Bewohner)
Unternehmensstandort für bis 2 500 Arbeitsplätze im Kanton Zug ab 2014 An zentraler Lage beim Bahnhof Rotkreuz entsteht ein integriertes Quartier mit einem vielfältigen Angebot an Wohnungen (1 500 Bewohner)
Limmattalbahn; Investitionsbeitrag zum Bau der Bahninfrastruktur; Verpflichtungskredit vom 19.08.2014 bis 21.11. 2014
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG Limmattalbahn; Investitionsbeitrag zum Bau der Bahninfrastruktur; Verpflichtungskredit vom 19.08.2014 bis 21.11. 2014 Name/Organisation Piratenpartei
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG Limmattalbahn; Investitionsbeitrag zum Bau der Bahninfrastruktur; Verpflichtungskredit vom 19.08.2014 bis 21.11. 2014 Name/Organisation Piratenpartei
Nachhaltige Stadtentwicklung im Innern
 Energiesalon 10 // AFZ, 29.09.10 Nachhaltige Stadtentwicklung im Innern Dr. Philipp Klaus, INURA Zürich Institut Zusammenfassung Nachhaltige Entwicklung im Innern Das Thema der Verdichtung im Stadtinnern
Energiesalon 10 // AFZ, 29.09.10 Nachhaltige Stadtentwicklung im Innern Dr. Philipp Klaus, INURA Zürich Institut Zusammenfassung Nachhaltige Entwicklung im Innern Das Thema der Verdichtung im Stadtinnern
Leader Region Osttirol Gemeindekooperationen als Zukunftschance Potenziale und Chancen des Regionalmanagement in Osttirol
 Leader Region Osttirol Gemeindekooperationen als Zukunftschance Potenziale und Chancen des Regionalmanagement in Osttirol Ablauf Regionsmanagement in Osttirol Gemeindekooperationen in Projekten - Potenziale
Leader Region Osttirol Gemeindekooperationen als Zukunftschance Potenziale und Chancen des Regionalmanagement in Osttirol Ablauf Regionsmanagement in Osttirol Gemeindekooperationen in Projekten - Potenziale
Flächen gewinnen Flächennutzungszertifikate in der Raumplanung
 Flächen gewinnen Flächennutzungszertifikate in der Raumplanung Unsere Landschaft braucht neue Ideen Das schnelle Siedlungswachstum in der Schweiz zieht langfristig dem Natur- und Landschaftsschutz buchstäblich
Flächen gewinnen Flächennutzungszertifikate in der Raumplanung Unsere Landschaft braucht neue Ideen Das schnelle Siedlungswachstum in der Schweiz zieht langfristig dem Natur- und Landschaftsschutz buchstäblich
Projekt Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland, 2. Generation (RGSK BM II)
 Traktandum Nr. 8 Gremium Datum Regionalversammlung 26. Juni 2014 Titel Kommissionen Verkehr und Raumplanung: Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland / Agglomerationsprogramm;
Traktandum Nr. 8 Gremium Datum Regionalversammlung 26. Juni 2014 Titel Kommissionen Verkehr und Raumplanung: Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland / Agglomerationsprogramm;
Stadtverkehr 2025 Zürich macht vorwärts
 Stadtverkehr 2025 Zürich macht vorwärts 17. Juni 2015, Zürich Referent: Mathias Camenzind, Projektleiter Verkehr + Stadtraum Inhaltsübersicht Einführung - zum Referenten - Fakten und Zahlen Stadtverkehr
Stadtverkehr 2025 Zürich macht vorwärts 17. Juni 2015, Zürich Referent: Mathias Camenzind, Projektleiter Verkehr + Stadtraum Inhaltsübersicht Einführung - zum Referenten - Fakten und Zahlen Stadtverkehr
Innovation im Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010: Erfassung der Routen während der Befragung
 Innovation im Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010: Erfassung der Routen während der Befragung Kathrin Rebmann (BFS) Matthias Kowald (ARE) Inhalt Eidgenössisches Departement des Innern EDI 1. Einleitung
Innovation im Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010: Erfassung der Routen während der Befragung Kathrin Rebmann (BFS) Matthias Kowald (ARE) Inhalt Eidgenössisches Departement des Innern EDI 1. Einleitung
2. World Collaborative Mobility Congress 07./08. Mai 2014 Postfinanz Arena Bern
 2. World Collaborative Mobility Congress 07./08. Mai 2014 Postfinanz Arena Bern Blauen FahrMit - Kommunales Mitfahrnetzwerk als Ergänzung des ÖV-Angebotes in einer kleineren Gemeinde der Schweiz Dr. Dieter
2. World Collaborative Mobility Congress 07./08. Mai 2014 Postfinanz Arena Bern Blauen FahrMit - Kommunales Mitfahrnetzwerk als Ergänzung des ÖV-Angebotes in einer kleineren Gemeinde der Schweiz Dr. Dieter
Stellung der Landwirtschaft bei Grossprojekten Landwirtschaftliche Planung mit Partizipation
 1 von 10 Landwirtschaftliche Planung Stellung der Landwirtschaft bei Grossprojekten Landwirtschaftliche Planung mit Partizipation Landmanagement für den Wasserbau - eine nationale Herausforderung 13. September
1 von 10 Landwirtschaftliche Planung Stellung der Landwirtschaft bei Grossprojekten Landwirtschaftliche Planung mit Partizipation Landmanagement für den Wasserbau - eine nationale Herausforderung 13. September
Kommunal laufen national planen
 1 Kommunal laufen national planen Fußgänger-Masterplan auch für Deutschland? Erfahrungen aus der Schweiz Die wichtigsten Handlungsfelder auf Bundesebene: kurzer Rück- und Ausblick Thomas Schweizer, Fussverkehr
1 Kommunal laufen national planen Fußgänger-Masterplan auch für Deutschland? Erfahrungen aus der Schweiz Die wichtigsten Handlungsfelder auf Bundesebene: kurzer Rück- und Ausblick Thomas Schweizer, Fussverkehr
solvay industriepark Ein attraktiver Standort mit Zukunft. Auch für Sie. Die Vorteile auf einen Blick
 solvay industriepark Ein attraktiver Standort mit Zukunft. Auch für Sie. Der Solvay Industriepark Zurzach ist ein attraktiver und innovativer Standort für Chemie-, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen.
solvay industriepark Ein attraktiver Standort mit Zukunft. Auch für Sie. Der Solvay Industriepark Zurzach ist ein attraktiver und innovativer Standort für Chemie-, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen.
M. Siedlungsrand Charakterisierung, Analyse und Massnahmen
 Siedlungsrand Charakterisierung M. Siedlungsrand Charakterisierung, Analyse und Massnahmen Charakterisierung Definition: Der Siedlungsrand ist der Ort, wo die Siedlung und die Landschaft aufeinandertreffen.
Siedlungsrand Charakterisierung M. Siedlungsrand Charakterisierung, Analyse und Massnahmen Charakterisierung Definition: Der Siedlungsrand ist der Ort, wo die Siedlung und die Landschaft aufeinandertreffen.
Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden (GWE, Wirtschaftsentwicklungsgesetz)
 9.00 Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden (GWE, Wirtschaftsentwicklungsgesetz) Vom. Februar 004 (Stand. September 007) Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,
9.00 Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden (GWE, Wirtschaftsentwicklungsgesetz) Vom. Februar 004 (Stand. September 007) Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,
technisch gut ausgestattete Büro-/Praxisräumlichkeiten (Total ca. 200 m2)
 Zu verkaufen in Wohn- und Geschäftshaus technisch gut ausgestattete Büro-/Praxisräumlichkeiten (Total ca. 200 m2) Liegenschaft Gemeinde Wohn- und Geschäftshaus Parallelstrasse 32 3714 Frutigen Objekt STOWE-Einheit
Zu verkaufen in Wohn- und Geschäftshaus technisch gut ausgestattete Büro-/Praxisräumlichkeiten (Total ca. 200 m2) Liegenschaft Gemeinde Wohn- und Geschäftshaus Parallelstrasse 32 3714 Frutigen Objekt STOWE-Einheit
Segment 1: Dienstleistungszentralen
 4..24 Segment : Dienstleistungszentralen Nachfragersegmente im Büromarkt Fahrländer Partner AG Raumentwicklung Eichstrasse 23 845 Zürich +4 44 466 7 info@fpre.ch www.fpre.ch www.fpre.ch 2.. Dienstleistungszentralen:
4..24 Segment : Dienstleistungszentralen Nachfragersegmente im Büromarkt Fahrländer Partner AG Raumentwicklung Eichstrasse 23 845 Zürich +4 44 466 7 info@fpre.ch www.fpre.ch www.fpre.ch 2.. Dienstleistungszentralen:
EINE EU-STRATEGIE FÜR DEN ALPENRAUM (EUSALP) KONSULTATIONSPAPIER
 EINE EU-STRATEGIE FÜR DEN ALPENRAUM (EUSALP) KONSULTATIONSPAPIER 1. EINFÜHRUNG In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. Dezember 2013 heißt es in Absatz 50: ( / ) ersucht der Europäische
EINE EU-STRATEGIE FÜR DEN ALPENRAUM (EUSALP) KONSULTATIONSPAPIER 1. EINFÜHRUNG In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. Dezember 2013 heißt es in Absatz 50: ( / ) ersucht der Europäische
Weltnaturerbe Wattenmeer
 Weltnaturerbe Wattenmeer Nachhaltiger Tourismus in der Weltnaturerbe Wattenmeer Destination eine gemeinsame Strategie Regionale Konsultation Juni 2013 UNESCO Welterbekomitee 2009 Vorbereitung und Umsetzung
Weltnaturerbe Wattenmeer Nachhaltiger Tourismus in der Weltnaturerbe Wattenmeer Destination eine gemeinsame Strategie Regionale Konsultation Juni 2013 UNESCO Welterbekomitee 2009 Vorbereitung und Umsetzung
Duisburger Siedlungen und Stadtquartiere
 Duisburger Siedlungen und Stadtquartiere 1 Inhalt (I) Allgemeiner Stadtüberblick (II) Besondere Wohnlagen in Duisburg (beispielhaft) Wohnen am Wasser Wohninsel mit dörflichen Strukturen Wohninsel am Rhein
Duisburger Siedlungen und Stadtquartiere 1 Inhalt (I) Allgemeiner Stadtüberblick (II) Besondere Wohnlagen in Duisburg (beispielhaft) Wohnen am Wasser Wohninsel mit dörflichen Strukturen Wohninsel am Rhein
Direkte interkontinentale Verkehrsanbindung sicherstellen!
 Flughafen Zürich: Direkte interkontinentale Verkehrsanbindung sicherstellen! In der Zürcher Flughafenpolitik sind viele Fragen offen. Das verunsichert die Bevölkerung, führt zu Widerständen gegen den Flughafen
Flughafen Zürich: Direkte interkontinentale Verkehrsanbindung sicherstellen! In der Zürcher Flughafenpolitik sind viele Fragen offen. Das verunsichert die Bevölkerung, führt zu Widerständen gegen den Flughafen
Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Ostfildern
 Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Ostfildern Kurzzusammenfassung des Abschlussberichts Das Integrierte Klimaschutzkonzept für Ostfildern umfasst Ergebnisse in fünf aufeinander aufbauenden Abschnitten:
Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Ostfildern Kurzzusammenfassung des Abschlussberichts Das Integrierte Klimaschutzkonzept für Ostfildern umfasst Ergebnisse in fünf aufeinander aufbauenden Abschnitten:
STRUKTURWANDEL NACHHALTIG GESTALTEN IMMOBILIEN HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG
 STRUKTURWANDEL NACHHALTIG GESTALTEN IMMOBILIEN HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG HHLA IMMOBILIEN ENTWICKLUNG MIT VERANTWORTUNG HHLA Immobilien gehört zur Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), einem führenden
STRUKTURWANDEL NACHHALTIG GESTALTEN IMMOBILIEN HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG HHLA IMMOBILIEN ENTWICKLUNG MIT VERANTWORTUNG HHLA Immobilien gehört zur Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), einem führenden
LAG Wein, Wald, Wasser. Stellungnahme LAG Wein, Wald, Wasser
 Untere Hauptstraße 14 97291 Thüngersheim Tel. 09364 / 815029 oder 0931/ 9916516 Fax 0931/ 9916518 E-Mail:info@mainkabel.de www.mainkabel.de Stellungnahme Projektnahme: Projektträger: Handlungsfeld: Bachrundweg
Untere Hauptstraße 14 97291 Thüngersheim Tel. 09364 / 815029 oder 0931/ 9916516 Fax 0931/ 9916518 E-Mail:info@mainkabel.de www.mainkabel.de Stellungnahme Projektnahme: Projektträger: Handlungsfeld: Bachrundweg
VLP-ASPAN EINFÜHRUNGSKURS. Einführung in die Raumplanung. Basel 19., 26. März und 2. April 2014
 EINFÜHRUNGSKURS Einführung in die Raumplanung Basel 19., 26. März und 2. April 2014 Kursziele Haben Sie beruflich mit Raumplanungsfragen zu tun, sind aber mit diesem Tätigkeitsgebiet noch wenig vertraut?
EINFÜHRUNGSKURS Einführung in die Raumplanung Basel 19., 26. März und 2. April 2014 Kursziele Haben Sie beruflich mit Raumplanungsfragen zu tun, sind aber mit diesem Tätigkeitsgebiet noch wenig vertraut?
Südwestfalen. Dirk Glaser. DWA Abteilung Bildung und Internationale Zusammenarbeit 19.11.2012. Geschäftsführer Südwestfalen Agentur GmbH
 Politische Strukturprogramme als öffentlichkeitswirksamer Motor für Wasserprojekte Das Beispiel REGIONALE 2013 in Südwestfalen: Chancen auch für die Wasserrahmenrichtlinie? Dirk Glaser Geschäftsführer
Politische Strukturprogramme als öffentlichkeitswirksamer Motor für Wasserprojekte Das Beispiel REGIONALE 2013 in Südwestfalen: Chancen auch für die Wasserrahmenrichtlinie? Dirk Glaser Geschäftsführer
ANSPRUCH UND ARBEITSWEISE
 1 Lokale Entwicklungsstrategien für die Region Altenbeken, Augustdorf, Bad Lippspringe, Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg und Schlangen 2 ANSPRUCH UND ARBEITSWEISE Quellenangabe:
1 Lokale Entwicklungsstrategien für die Region Altenbeken, Augustdorf, Bad Lippspringe, Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg und Schlangen 2 ANSPRUCH UND ARBEITSWEISE Quellenangabe:
