Der Sprecherwechsel bei der zwischenmenschlichen Kommunikation. Turn-taking in human communication and its implications for language processing
|
|
|
- Eduard Weiner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Der Sprecherwechsel bei der zwischenmenschlichen Kommunikation und seine Folgen für die Sprachverarbeitung Turn-taking in human communication and its implications for language processing Levinson, Stephen C. Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Niederlande Korrespondierender Autor Zusammenfassung Das Sprechen als interaktiver Vorgang ist in aller Regel mit einem schnellen Sprecherwechsel (turn-taking) der Gesprächspartner verbunden. Dieses turn-taking-system hat besondere Eigenschaften: Die Reaktionen der Gesprächsteilnehmer auf die Redebeiträge der Gesprächspartner sind äußerst schnell, obwohl diese unterschiedlich lang und oft sehr komplex sein können, sodass für die kognitive Sprachverarbeitung nur sehr wenig Zeit bleibt. Wie sich nun zeigt, hat dieses bisher in der Kognitionsforschung vernachlässigte System tiefgreifende Folgen für die Sprachverarbeitung und den Spracherwerb. Summary Most language usage is interactive, involving rapid turn-taking. The turn-taking system has a number of striking properties: turns are short and responses are remarkably rapid, yet turns are of varying length and often of very complex construction, so that the underlying cognitive processing is highly compressed. Although neglected in cognitive science, the system has deep implications for language processing and acquisition, just now becoming clear. Sprecherwechsel (turn-taking) ein Teil der universellen Infrastruktur von Sprache Sprachen unterscheiden sich auf allen Ebenen, sei es auf der lautlichen, der syntaktischen oder auf der Bedeutungsebene. Aber es gibt eine auffällige Gemeinsamkeit in der Art und Weise, wie Sprechende ihre Sprache gebrauchen nämlich in Form schneller Wechsel von meist kurzen Redebeiträgen, im Folgenden turns genannt [1]. Obwohl es auf den ersten Blick unspektakulär zu sein scheint: Das System des Sprecherwechsels (turn-taking) ermöglicht einen tiefen Einblick in die Sprachverarbeitung und hilft bei der Beantwortung der Frage, warum Sprache so charakteristisch aus kurzen Phrasen- oder Satz-ähnlichen Einheiten mit bestimmten Lautmelodien besteht. Im Gegensatz zur Diversität unterschiedlicher Sprachen besitzt dieses System einen universellen Charakter: ein frühes ontologisches Auftreten sowie ein Fortbestehen in anderen Kommunikationssystemen von Primaten. Beide Merkmale legen den Schluss nahe, dass wir es hier mit einem phylogenetisch interessanten Phänomen zu tun haben, bei dem ein vokalisches turn-taking der 2017 Max-Planck-Gesellschaft 1/6
2 Sprachentwicklung vorausgeht und einen Rahmen für sie schafft. Obwohl dieses System in der Soziologie im Bereich der Konversationsanalyse intensiv untersucht wurde (und wird), spielte es in den Kognitionswissenschaften noch bis vor kurzem kaum eine Rolle. Der menschliche Sprachgebrauch ist vorwiegend interaktiv und in Gespräche eingebunden; in diesem Kontext werden Sprachen auch erworben. Das turn-taking-system hat die folgenden grundlegenden Eigenschaften [2]: Redebeiträge (turns) haben keine vorgegebene Größe; sie sind meist kurz, im Durchschnitt etwa zwei Sekunden lang, aber es gibt auch wenn nötig längere turns, zum Beispiel beim Erzählen einer Geschichte. Da s turn-taking-system fordert von den Sprechern das Vermeiden von Überlappungen; es ist äußerst flexibel im Hinblick auf die Anzahl der Sprecher. Und es ist hocheffizient: Weniger als 5% des Redeflusses beinhaltet simultanes Sprechen von zwei oder mehr Sprechern [die modalen Überlappungen dauern weniger als 100 Millisekunden (ms)], die modale Lücke zwischen zwei turns dauert nur 200 ms, und das System arbeitet genauso effizient, wenn die Sprecher keinen Blickkontakt miteinander haben [2]. Man geht davon aus, dass das System auf der Basis eines Rechts auf minimale turns funktioniert, wobei dem ersten Angesprochenen dieses Recht erteilt wird und dieser nach dem Ende seines Redebeitrags wieder darauf verzichtet. Turns bestehen aus syntaktischen (sprachlichen) Einheiten, die sich prosodisch (also hinsichlich ihrer lautlichen Merkmale) unterscheiden. Dadurch können die Gesprächsteilnehmer das bevorstehende Ende eines Redebeitrags vorhersagen. Eine das turn-ende signalisierende Komponente wurde in der Vergangenheit diskutiert, aber sie kommt zu spät für das Initiieren der Planung einer Antwort; allerdings kann sie dazu führen, einen schon vorbereiteten turn auszulösen [2, 3]. Unseres Wissens nach ist das System, das den Ablauf von Alltagsgesprächen bestimmt, in hohem Maß universell, mit nur minimal zeitlichen Varianten [1], und es unterscheidet sich deutlich von den eher kulturspezifischen Systemen des Sprecherwechsels, wie sie zum Beispiel im Klassenzimmer, im Gerichtssaal oder in Pressekonferenzen benutzt werden. Die kognitive Herausforderung des turn-taking A bb. 1: Das turn-taking-system ist durch einen schnellen Sprecherwechsel gekennzeichnet. Die m odale Reaktionszeit, also die Lücke zwischen zwei Redebeiträgen, beträgt nur ca. 200m s. Max-Planck-Institut für Psycholinguistik/Levinson 2017 Max-Planck-Gesellschaft 2/6
3 Folgende Befunde verdeutlichen die kognitiven Konsequenzen des turn-taking-systems: Ein turn dauert durchschnittlich zwei Sekunden [2]. Im Sprachvergleich zeigt sich, dass die modale Reaktionszeit (d.h. die Lücke zwischen den Redebeiträgen) etwa 200 ms beträgt [1, 2]; das entspricht der durchschnittlichen Länge einer Silbe. Das ist auch der Grenzbereich für unsere Reaktion auf ein einfaches Startsignal, wie es z. B. von einer Startpistole abgegeben wird. Reaktionszeiten werden mit wachsender Anzahl von möglichen Reaktionstypen zunehmend langsamer (Hicksches Gesetz). Man bedenke: Sprachen haben Lexika von mehr als Wörtern. Darüber hinaus ist die Sprachproduktion notorisch langsam die Vorbereitung der Äußerung eines schon experimentell angebahnten Wortes beträgt 600 ms [4], die eines nicht angebahnten Wortes etwa 1000 ms, und die eines kurzen Satzes etwa 1500 ms. Ein Großteil dieser Verzögerung hängt von der langsamen Enkodierung phonologischer Formen und artikulatorischer Gesten ab. Das heißt, dass die Reaktion auf einen Redebeitrag bereits etwa in dessen Mitte geplant werden muss. Die Langsamkeit des Sprachproduktionssystems erfordert, dass sich im interaktiven Sprachgebrauch das Sprachverstehen und die Sprachproduktion überschneiden. Man muss seinen eigenen Redebeitrag bereits planen, während man dem Gesprächspartner zuhört, und dabei vorhersagen, was der Rest seines turns noch beinhalten wird. Betrachten wir dazu die Abbildungen 1-3. Hier hört die Person B einen von der Person A produzierten Redebeitrag. Neben dem einfachen Verstehen des gehörten Signals müssen nun folgende Voraussetzungen für eine sinnvolle und zeitlich adäquate d.h. etwa 200 ms nach dem turn-ende zu gebende Antwort der Person B erfüllt sein: Person B muss so schnell wie möglich versuchen, die Funktion des Redebeitrags von Person A vorherzusagen (B muss erkennen, ob A`s Äußerung eine Frage, ein Angebot, eine Forderung etc. ist), um darauf adäquat zu reagieren (Abb. 1). Anschließend muss Person B sofort mit der Formulierung einer Antwort beginnen, wobei diese alle Stadien der Sprachproduktion Konzeptualisierung, Wortfindung, syntaktische Konstruktion, phonologische Enkodierung und Artikulation durchlaufen muss (Abb. 2). A bb. 2: Alle Stadien der Sprachproduktion sind insgesam t dreim al länger als die Lücke zwischen den Redebeiträgen: Die Produktionszeit eines Wortes dauert 600 m s. MPI für Psycholinguistik/Levinson Unterdessen muss Person B auch die syntaktischen und semantischen Besonderheiten von Person A's turn dazu benutzen, um abzuschätzen, wie lange dieser sein wird und dabei auch auf prosodische (über die Sprache hinausgehende) Hinweise auf ein turn-ende achten (Abb. 3). Sobald Person B solche Hinweise erkennt, muss er/sie die Antwort initiieren. Erste Ergebnisse Kürzlich konnten erste Erkenntnisse zu jedem dieser Stadien gewonnen werden; dabei haben EEG-Analysen eine gute zeitliche Auflösung der dabei involvierten Prozesse geliefert. Das Erkennen von Sprechakten ist nicht-trivial, weil es keine Eins-zu-Eins-Zuordnung von Form und Funktion gibt: Ich habe ein Auto kann die Antwort auf eine Frage, die Einleitung eines Angebots zum Mitfahren oder die Ablehnung eines solchen Angebots sein je nach dem jeweiligem Kontext ( Fährst Du mit dem Zug?, Ich habe gerade den letzten Zug 2017 Max-Planck-Gesellschaft 3/6
4 verpasst., Musst du irgendwohin fahren? ). Mithilfe von EEG-Analysen konnte gezeigt werden, dass das Erkennen der Funktion eines Redebeitrags in diesen einschränkenden Kontexten dennoch sehr schnell innerhalb der ersten 400 ms nach turn-beginn erfolgt [5]. Sobald das Sprachverstehen die Funktion erkennt, kann mit der Vorbereitung der Reaktion auf ihn begonnen werden. A bb. 3: Weil die Produktionszeit eines Wortes viel länger ist als die m odale Reaktionszeit, m uss sich die Produktion der Reaktion m it dem Verstehen des gehörten Redebeitrags überschneiden. Max-Planck-Institut für Psycholinguistik/Levinson Ebenfalls mithilfe von EEG-Analysen wurde gezeigt, dass Produktionsprozesse bereits innerhalb von 500 ms anlaufen, nachdem ausreichende Informationen vorhanden sind; das Signal kann in Bereichen der Sprachenkodierung aufgezeichnet werden [6]. Zur zeitlichen Abschätzung und Vorhersage von Dauer und Ende eines Redebeitrags können lexikalische, semantische und syntaktische Strukturen genutzt werden in günstigen Fällen führt das etwa in der Hälfte der turns zum Erfolg. Das schließt auch die Vorhersage von dabei noch zu realisierenden Wörtern ein. [7]. Experimente mit manipulierten Äußerungen zeigen, dass die semantische Komponente für diese Vorhersagefähigkeit eine große Rolle spielt. Prosodische, über die eigentliche Sprache hinausgehende Hinweise (wie z.b. verlängerte Silben) treten oft gegen Ende eines Redebeitrags auf; es konnte gezeigt werden, dass diese von den Hörern genutzt werden [3]; sie geben wohl das Startsignal für die Produktion der Antwort. Das würde die 200 ms lange modale Lücke erklären, die in etwa unserer minimalen Reaktionszeit entspricht. Vorbereitungen für das Auslösen von Sprache durch solche Hinweise können im Atem-Signal mithilfe eines Plethysmographen erkannt werden [8]; sie werden auch von zuschauenden Anwesenden an den Augenbewegungen erkannt. Die Rolle der Tonhöhe ist dabei noch umstritten; wenn sie ausgefiltert wird, werden die Reaktionszeiten nicht kürzer, aber andere Messungen zeigten, dass sie genutzt wird. Das Multitasking-Problem U n s e r turn-taking-system involviert ein Multitasking von Abläufen innerhalb der Komponenten unseres Sprachverstehens und unserer Sprachproduktion. Ein Multitasking innerhalb ein und derselben Modalität ist ausgesprochen schwierig in diesem Fall kann gezeigt werden, dass dabei große Teile des gleichen neuronalen Substrats genutzt werden. Offenbar kann das nur durch die schnelle Beteiligung verschiedener kognitiver Ressourcen erreicht werden. Diese Überschneidungen von Prozessen des Sprachverstehens und des Sprachgebrauchs führen in der gegenwärtigen psycholinguistischen Theoriebildung zu einer Reihe von Problemen. Es gibt z.b. die Hypothese, dass das Sprachverstehen das System der Sprachproduktion intrinsisch dazu nutzt, um Vorhersagen über den weiteren Verlauf einer Äußerung zu machen. Wenn aber das Sprachproduktionssystem schon damit beschäftigt ist, eine Reaktion auf einen Redebeitrag zu planen, dann 2017 Max-Planck-Gesellschaft 4/6
5 wäre es wohl nicht in der Lage, dem Sprachverstehen zu helfen abgesehen von ganz frühen Stadien eines zu verarbeitenden turns. Gesprächsteilnehmer werden in ihrer Sprachgeschwindigkeit dadurch angetrieben, dass langsame Reaktionen signifikante Kommunikationszeichen sind typischerweise zeigen sie ein Widerstreben an, der erwarteten Antwort zu entsprechen [9]. Diese Schlussfolgerung kann am besten dadurch vermieden werden, dass man die normalen Zeitabläufe in der Sprecherfolge einhält. Das turn-taking-system im Rahmen einer Konversation ist kognitiv offenbar sehr anspruchsvoll: Indem es Vorhersagen und eine frühe Vorbereitung nutzt, reguliert es die Übernahme von Redebeiträgen in einem zeitlichen Bereich, der unserer minimalen Reaktionszeit auf einen Startschuss entspricht. Literaturhinweise [1] Stivers, T.; Enfield, N. J.; Brown, P.; Englert, C.; Hayashi, M.; Heinemann, T.; Hoymann, G.; Rossano, F.; de Ruiter, J. P.; Yoon, K.-E.; Levinson, S. C. Universals and cultural variation in turn-taking in conversation Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106, (2009) [2] Levinson, S. C.; Torreira, F. Timing in turn-taking and its implications for processing models of language Frontiers in Psychology 7, 731 (2015) [3] Bögels, S.; Torreira, F. Listeners use intonational phrase boundaries to project turn ends in spoken interaction Journal of Phonetics 52, (2015) [4] Indefrey, P. The spatial and temporal signatures of word production components: a critical update Frontiers in Psychology 2, 1-16 (2011). [5] Gisladottir, R.; Chwilla, D.; Levinson, S.C. Conversation electrified: ERP correlates of speech act recognition in underspecified utterances PLoS ONE 10, e (2015) [6] Bögels, S.; Magyari, L.; Levinson, S.C. Neural signatures of response planning occur midway through an incoming question in conversation Scientific Reports 5, (2015) [7] Magyari, L.; Bastiaansen, M.; De Ruiter, J. P.; Levinson, S. C. Early anticipation lies behind the speed of response in conversation Journal of Cognitive Neuroscience 26, (2014) [8] Torreira, F.; Bögels, S.; Levinson, S. C. Breathing for answering: the time course of response planning in conversation Frontiers in Psychology 6, 284 (2015) 2017 Max-Planck-Gesellschaft 5/6
6 [9] Kendrick, K.; Torreira, F. The timing and construction of preference: a quantitative study Discourse Processes 52, (2015) 2017 Max-Planck-Gesellschaft 6/6
Lexikalische Substitutionen. Seminar: Sprachproduktion Dozentin: Prof. Dr. Helen Leuninger WS 09/10 Referenten: Anna Schmidt und Tim Krones
 Lexikalische Substitutionen Seminar: Sprachproduktion Dozentin: Prof. Dr. Helen Leuninger WS 09/10 Referenten: Anna Schmidt und Tim Krones Gliederung 1 Substitutionen: Arten und Eigenschaften 2 Entstehung
Lexikalische Substitutionen Seminar: Sprachproduktion Dozentin: Prof. Dr. Helen Leuninger WS 09/10 Referenten: Anna Schmidt und Tim Krones Gliederung 1 Substitutionen: Arten und Eigenschaften 2 Entstehung
Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung
 Sprachen Valentina Slaveva Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität - Mainz Department of English and Linguistics
Sprachen Valentina Slaveva Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität - Mainz Department of English and Linguistics
Experimentelle Pragmatik
 Kursbeschreibung: Experimentelle Pragmatik In dieser Lehrveranstaltung werden die Studierenden in die Grundbegriffe, Theorien und Modelle der Pragmatik eingeführt und ein Einstieg in den Forschungsbereich
Kursbeschreibung: Experimentelle Pragmatik In dieser Lehrveranstaltung werden die Studierenden in die Grundbegriffe, Theorien und Modelle der Pragmatik eingeführt und ein Einstieg in den Forschungsbereich
Vom Gedanken zur Aussprache
 Vom Gedanken zur Aussprache Peter Indefrey F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Nijmegen Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen Was tun wir, wenn wir ein Wort produzieren? Stellen
Vom Gedanken zur Aussprache Peter Indefrey F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Nijmegen Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen Was tun wir, wenn wir ein Wort produzieren? Stellen
Das Kohorten-Modell zur Worterkennung Marslen-Wilson & Tyler 1980
 Das Kohorten-Modell zur Worterkennung Marslen-Wilson & Tyler 1980 Mögliche Modelle a) Autonomes serielles Modell Semantische Verarbeitung Syntaktische Verarbeitung Wortverarbeitung Phomenverarbeitung Autonome
Das Kohorten-Modell zur Worterkennung Marslen-Wilson & Tyler 1980 Mögliche Modelle a) Autonomes serielles Modell Semantische Verarbeitung Syntaktische Verarbeitung Wortverarbeitung Phomenverarbeitung Autonome
Psycholinguistik. p. 1/28
 Psycholinguistik p. 1/28 Psycholinguistik: Allgemeine Fragen Wie und wo wird die Sprache im Gehirn verarbeitet? Sprachentwicklung 1: Wie erwerben Kinder ihre Muttersprache (Erstpracherwerb)? Sprachentwicklung
Psycholinguistik p. 1/28 Psycholinguistik: Allgemeine Fragen Wie und wo wird die Sprache im Gehirn verarbeitet? Sprachentwicklung 1: Wie erwerben Kinder ihre Muttersprache (Erstpracherwerb)? Sprachentwicklung
Sprache wächst mit dem Gehirn Language Develops With the Brain
 Sprache wächst mit dem Gehirn Language Develops With the Brain Brauer, Jens Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig Korrespondierender Autor E-Mail: brauer@cbs.mpg.de Zusammenfassung
Sprache wächst mit dem Gehirn Language Develops With the Brain Brauer, Jens Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig Korrespondierender Autor E-Mail: brauer@cbs.mpg.de Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis. Vorwort...
 Inhaltsverzeichnis Vorwort.......................................................... V 1. Einleitung (Jörg Meibauer/Markus Steinbach)........................ 1 1.1 Was sind»schnittstellen«?..................................
Inhaltsverzeichnis Vorwort.......................................................... V 1. Einleitung (Jörg Meibauer/Markus Steinbach)........................ 1 1.1 Was sind»schnittstellen«?..................................
Geschichte der Psycholinguistik
 Wörter und Morpheme Buchstaben à Zeichen für Sprachlaute Wörter à Zeichen für Bedeutung, Begriffe oder Konzepte Die Relation von Wort zu Bedeutung ist relativ beliebig (Pinker, 1994); z.b.: Hund = chien
Wörter und Morpheme Buchstaben à Zeichen für Sprachlaute Wörter à Zeichen für Bedeutung, Begriffe oder Konzepte Die Relation von Wort zu Bedeutung ist relativ beliebig (Pinker, 1994); z.b.: Hund = chien
Geschichte der Psycholinguistik
 Wörter und Morpheme Buchstaben à Zeichen für Sprachlaute Wörter à Zeichen für Bedeutung, Begriffe oder Konzepte Die Relation von Wort zu Bedeutung ist relativ beliebig (Pinker, 1994); z.b.: Hund = chien
Wörter und Morpheme Buchstaben à Zeichen für Sprachlaute Wörter à Zeichen für Bedeutung, Begriffe oder Konzepte Die Relation von Wort zu Bedeutung ist relativ beliebig (Pinker, 1994); z.b.: Hund = chien
Psycholinguistik. Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt.
 Psycholinguistik Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt. Teilgebiete der Psycholinguistik Können danach klassifiziert
Psycholinguistik Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt. Teilgebiete der Psycholinguistik Können danach klassifiziert
7 Schluss. 7.1 Zusammenfassung
 7 Schluss 7.1 Zusammenfassung In dieser Arbeit wurde die Frage untersucht, ob die Verarbeitung der Sonoritätskontur einer Äußerung lateralisiert ist. Die Hypothese, dass sich für die Lokalisierung der
7 Schluss 7.1 Zusammenfassung In dieser Arbeit wurde die Frage untersucht, ob die Verarbeitung der Sonoritätskontur einer Äußerung lateralisiert ist. Die Hypothese, dass sich für die Lokalisierung der
Sprachproduktion. Psycholinguistik (7/11; HS 2010/2011 Vilnius, den 26. Oktober 2010
 Sprachproduktion Psycholinguistik (7/11; HS 2010/2011 Vilnius, den 26. Oktober 2010 Sprachliche Zentren im Gehirn SSSSensorische Funktionen Motorische Funktionen Sprachliche Zentren im Gehirn Generieren
Sprachproduktion Psycholinguistik (7/11; HS 2010/2011 Vilnius, den 26. Oktober 2010 Sprachliche Zentren im Gehirn SSSSensorische Funktionen Motorische Funktionen Sprachliche Zentren im Gehirn Generieren
Seminar Hören und Sprache Martin Meyer
 Seminar Hören und Sprache Martin Meyer Lilian Aus der Au 09.05.2011 1 1. Wie lernen Kinder Sprache? a. Babysprache und sozialer Einfluss b. Strategien von Kindern Statistisches Lernen Kategorisierungen
Seminar Hören und Sprache Martin Meyer Lilian Aus der Au 09.05.2011 1 1. Wie lernen Kinder Sprache? a. Babysprache und sozialer Einfluss b. Strategien von Kindern Statistisches Lernen Kategorisierungen
Sprache wächst mit dem Gehirn Language Develops With the Brain
 Sprache wächst mit dem Gehirn Language Develops With the Brain Brauer, Jens Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig Korrespondierender Autor E-Mail: brauer@cbs.mpg.de Zusammenfassung
Sprache wächst mit dem Gehirn Language Develops With the Brain Brauer, Jens Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig Korrespondierender Autor E-Mail: brauer@cbs.mpg.de Zusammenfassung
Das Speech Learning Modell nach J. Flege
 Ludwig-Maximillians-Universität München Phonetik und Sprachverarbeitung Masterseminar: Experimentalphonetik Katharina Schmidt Das Speech Learning Modell nach J. Flege am 25. Januar 2017 1 Was sind einige
Ludwig-Maximillians-Universität München Phonetik und Sprachverarbeitung Masterseminar: Experimentalphonetik Katharina Schmidt Das Speech Learning Modell nach J. Flege am 25. Januar 2017 1 Was sind einige
Bewusste Wahrnehmung als dynamischer und plastischer Prozess
 Bewusste Wahrnehmung als dynamischer und plastischer Prozess Melloni, Lucia; Schwiedrzik, Caspar M. Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt am Main Korrespondierender Autor Email: lucia.melloni@brain.mpg.de
Bewusste Wahrnehmung als dynamischer und plastischer Prozess Melloni, Lucia; Schwiedrzik, Caspar M. Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt am Main Korrespondierender Autor Email: lucia.melloni@brain.mpg.de
Computational Neuroscience
 Computational Neuroscience Vorlesung WS 2005/2006 Josef Ammermüller Jutta Kretzberg http://www.uni-oldenburg.de/sinnesphysiologie/ 14508.html Begriffsdefinitionen Computational Neuroscience Churchland
Computational Neuroscience Vorlesung WS 2005/2006 Josef Ammermüller Jutta Kretzberg http://www.uni-oldenburg.de/sinnesphysiologie/ 14508.html Begriffsdefinitionen Computational Neuroscience Churchland
Alles im Griff? Der Einfluss fahrfremder Tätigkeiten
 Alles im Griff? Der Einfluss fahrfremder Tätigkeiten Autofahren früher heute zukünftig Prof. Dr. Sebastian Pannasch Folie 2 Stufen der Automatisierung beim Autofahren Prof. Dr. Sebastian Pannasch Folie
Alles im Griff? Der Einfluss fahrfremder Tätigkeiten Autofahren früher heute zukünftig Prof. Dr. Sebastian Pannasch Folie 2 Stufen der Automatisierung beim Autofahren Prof. Dr. Sebastian Pannasch Folie
Oktober BSL- Nachrichten. Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache
 Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz
Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz
Stereotypes as Energy-Saving Devices
 Stereotypes as Energy-Saving Devices Stereotype 2012 Henrik Singmann Was sind die vermuteten Vorteile davon Stereotype zu benutzen und was wäre die Alternative zum Stereotyp Gebrauch? Welche bisherige
Stereotypes as Energy-Saving Devices Stereotype 2012 Henrik Singmann Was sind die vermuteten Vorteile davon Stereotype zu benutzen und was wäre die Alternative zum Stereotyp Gebrauch? Welche bisherige
Die Rolle der Antwortmodalität beim Wechseln zwischen Aufgaben The role of response modalities in task switching
 Die Rolle der Antwortmodalität beim Wechseln zwischen The role of response modalities in task switching Philipp, Andrea M.; Koch, Iring Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig
Die Rolle der Antwortmodalität beim Wechseln zwischen The role of response modalities in task switching Philipp, Andrea M.; Koch, Iring Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN
 FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
Kulturelle Diversität virtueller Teams als kritischer Erfolgsfaktor in IT-Projekten
 Kulturelle Diversität virtueller Teams als kritischer Erfolgsfaktor in IT-Projekten Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Kulturelle Diversität virtueller Teams als kritischer Erfolgsfaktor in IT-Projekten Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Was versteht man unter Stottern?
 1 Was versteht man unter Stottern? Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, daß man sie ignoriert. Aldous Huxley Was versteht man unter Stottern? 13 Als Stottern werden Unterbrechungen des Redeflusses
1 Was versteht man unter Stottern? Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, daß man sie ignoriert. Aldous Huxley Was versteht man unter Stottern? 13 Als Stottern werden Unterbrechungen des Redeflusses
Zweitspracherwerb und Sprachverarbeitung bei Erwachsenen. Kathleen Neubauer
 Zweitspracherwerb und Sprachverarbeitung bei Erwachsenen Kathleen Neubauer 4. Sitzung am 04.11.2009 Einführung in die Sprachverarbeitung bei Erwachsenen Überblick Grundfragen in der Sprachverarbeitung
Zweitspracherwerb und Sprachverarbeitung bei Erwachsenen Kathleen Neubauer 4. Sitzung am 04.11.2009 Einführung in die Sprachverarbeitung bei Erwachsenen Überblick Grundfragen in der Sprachverarbeitung
Attributionen von Erinnerungsgefühlen und False Fame : Wie Menschen über Nacht berühmt werden
 Attributionen von Erinnerungsgefühlen und False Fame : Wie Menschen über Nacht Gezeigt an einer Studie von Jacoby, Kelley, Brown und Jaeschko: Becoming famous overnight: Limits on the Ability to Avoid
Attributionen von Erinnerungsgefühlen und False Fame : Wie Menschen über Nacht Gezeigt an einer Studie von Jacoby, Kelley, Brown und Jaeschko: Becoming famous overnight: Limits on the Ability to Avoid
Aspects of Language Production
 Aspekte der Sprachproduktion Aspects of Language Production Sprenger, Simone Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Netherlands Korrespondierender Autor E-Mail: simone.sprenger@mpi.nl Zusammenfassung
Aspekte der Sprachproduktion Aspects of Language Production Sprenger, Simone Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Netherlands Korrespondierender Autor E-Mail: simone.sprenger@mpi.nl Zusammenfassung
Denken Gehörlose anders?
 Denken Gehörlose anders? Untersuchungen zum Einfluss der visuell-gestischen Gebärdensprache vs. der vokal-auditiven Lautsprache auf kognitive Strukturen. Klaudia Grote Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft
Denken Gehörlose anders? Untersuchungen zum Einfluss der visuell-gestischen Gebärdensprache vs. der vokal-auditiven Lautsprache auf kognitive Strukturen. Klaudia Grote Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft
Lexical Recognition in Sign Language: Effects of Phonetic Structure and Morphology
 Lexical Recognition in Sign Language: Effects of Phonetic Structure and Morphology Der Text befasst sich mit der phonetischen und morphologischen Struktur der American Sign Language ( ASL). ASL ist die
Lexical Recognition in Sign Language: Effects of Phonetic Structure and Morphology Der Text befasst sich mit der phonetischen und morphologischen Struktur der American Sign Language ( ASL). ASL ist die
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis. Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14.
 Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Bringing sense and simplicity to life
 Neue Einsatzbereiche der digitalen Spracherkennung: Informationsaufbereitung für Elektronische Patientenakten mit Wissensbanken und medizinischen Terminologien Klaus Stanglmayr Wednesday, June 20, 2007
Neue Einsatzbereiche der digitalen Spracherkennung: Informationsaufbereitung für Elektronische Patientenakten mit Wissensbanken und medizinischen Terminologien Klaus Stanglmayr Wednesday, June 20, 2007
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Statistisches Lernen II: Mustererkennung
 Statistisches Lernen II: Mustererkennung Die Ursprünge syntaktischen Wissens: Erkennen von Bestimmungswörtern bei einjährigen Kindern Barbara Höhle und Jürgen Weissenborn Universität Potsdam Sprachwahrnehmung
Statistisches Lernen II: Mustererkennung Die Ursprünge syntaktischen Wissens: Erkennen von Bestimmungswörtern bei einjährigen Kindern Barbara Höhle und Jürgen Weissenborn Universität Potsdam Sprachwahrnehmung
Wortsegmentierung. Rhythmische Segmentierung. Phonotaktische Segmentierung. Katrin Wolfswinkler, Markus Jochim,
 Wortsegmentierung Rhythmische Segmentierung Phonotaktische Segmentierung Katrin Wolfswinkler, Markus Jochim, 21.01.15 Rhythmische Segmentierung Cutler & Butterfield (1992) Cutler (1994) Segmentierungsstrategien
Wortsegmentierung Rhythmische Segmentierung Phonotaktische Segmentierung Katrin Wolfswinkler, Markus Jochim, 21.01.15 Rhythmische Segmentierung Cutler & Butterfield (1992) Cutler (1994) Segmentierungsstrategien
Meilensteine des Spracherwerbs Erwerb von Wort- und Satzbedeutung Lexikon, Semantik, Syntax. Ein Referat von Nicole Faller.
 Meilensteine des Spracherwerbs Erwerb von Wort- und Satzbedeutung Lexikon, Semantik, Syntax Ein Referat von Nicole Faller. Es gibt eine spezifisch menschliche, angeborene Fähigkeit zum Spracherwerb. Der
Meilensteine des Spracherwerbs Erwerb von Wort- und Satzbedeutung Lexikon, Semantik, Syntax Ein Referat von Nicole Faller. Es gibt eine spezifisch menschliche, angeborene Fähigkeit zum Spracherwerb. Der
3 MODELLVORSTELLUNGEN ÜBER DIE SPRACHPRODUKTION 75
 Inhaltsverzeichnis 1 VORBEMERKUNGEN 19 1.1 DIE ZIELGRUPPE 20 1.2 DER FORSCHUNGSSTAND 21 13 DIE ZIELE UND DER AUFBAU DIESER ARBEIT 22 2 DER WORTSCHATZ UND DAS MENTALE LEXIKON 25 2.1 DER WORTSCHATZ 26 2.1.1
Inhaltsverzeichnis 1 VORBEMERKUNGEN 19 1.1 DIE ZIELGRUPPE 20 1.2 DER FORSCHUNGSSTAND 21 13 DIE ZIELE UND DER AUFBAU DIESER ARBEIT 22 2 DER WORTSCHATZ UND DAS MENTALE LEXIKON 25 2.1 DER WORTSCHATZ 26 2.1.1
Ich weiß, was Du als nächstes sagen wirst (aber n. I know what you will say next (but only because I lea how to read)
 Page 1 of 6 Kognitionsforschung Forschungsbericht 2011 - Max-Planck-Institut für Psycholinguistik Ich weiß, was Du als nächstes sagen wirst (aber n weil ich lesen kann) I know what you will say next (but
Page 1 of 6 Kognitionsforschung Forschungsbericht 2011 - Max-Planck-Institut für Psycholinguistik Ich weiß, was Du als nächstes sagen wirst (aber n weil ich lesen kann) I know what you will say next (but
DIE VERBVERARBEITUNG BEI ALZHEIMER-DEMENZ UND PRIMÄR PROGRESSIVER APHASIE EIN VERGLEICH
 DIE VERBVERARBEITUNG BEI ALZHEIMER-DEMENZ UND PRIMÄR PROGRESSIVER APHASIE EIN VERGLEICH Alexandra Madl 19.10.2012 INHALT Einleitung/ Motivation Das Krankheitsbild der Demenz Alzheimer Demenz Primär Progressive
DIE VERBVERARBEITUNG BEI ALZHEIMER-DEMENZ UND PRIMÄR PROGRESSIVER APHASIE EIN VERGLEICH Alexandra Madl 19.10.2012 INHALT Einleitung/ Motivation Das Krankheitsbild der Demenz Alzheimer Demenz Primär Progressive
Die pragmatische Gretchenfrage und ihre Folgen
 Die pragmatische Gretchenfrage und ihre Folgen Johannes Dölling (Leipzig) Nun sag', wie hast du's mit der wörtlichen Bedeutung? Workshop zu Ehren von Manfred Bierwisch, Leipzig, 26.10.2005 1 Ein grundlegendes
Die pragmatische Gretchenfrage und ihre Folgen Johannes Dölling (Leipzig) Nun sag', wie hast du's mit der wörtlichen Bedeutung? Workshop zu Ehren von Manfred Bierwisch, Leipzig, 26.10.2005 1 Ein grundlegendes
Computermodelle für Spracherwerb und Sprachproduktion Computational models of language acquisition and production
 Computermodelle für Spracherwerb und Sprachproduktion Computational models of language acquisition and production Fitz, Hartmut Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Netherlands Korrespondierender
Computermodelle für Spracherwerb und Sprachproduktion Computational models of language acquisition and production Fitz, Hartmut Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Netherlands Korrespondierender
Einführung in die Linguistik, Teil 4
 Einführung in die Linguistik, Teil 4 Menschliche Sprachverarbeitung im Rahmen der Kognitionswissenschaft Markus Bader, Frans Plank, Henning Reetz, Björn Wiemer Einführung in die Linguistik, Teil 4 p. 1/19
Einführung in die Linguistik, Teil 4 Menschliche Sprachverarbeitung im Rahmen der Kognitionswissenschaft Markus Bader, Frans Plank, Henning Reetz, Björn Wiemer Einführung in die Linguistik, Teil 4 p. 1/19
Multitasking Ablenkungen beim Autofahren
 Seminar Ingenieurpsychologie am 23.06.2014 bei Dr. Romy Müller Multitasking Ablenkungen beim Autofahren Referentin: Teresa Janosch Gliederung 1) Definition Multitasking 2) Formen der Ablenkung beim Autofahren
Seminar Ingenieurpsychologie am 23.06.2014 bei Dr. Romy Müller Multitasking Ablenkungen beim Autofahren Referentin: Teresa Janosch Gliederung 1) Definition Multitasking 2) Formen der Ablenkung beim Autofahren
Beabsichtigte und automatische Aspekte der Sprachproduktion und Sprachperzeption. am
 Beabsichtigte und automatische Aspekte der Sprachproduktion und Sprachperzeption am 13.11.2016 1 Vortragsgliederung 1.Grundlagen 2.Hauptfaktoren 2.1.Vokalnasalisierung 2.2.Voice Onset Time 2.3.Vokaldauer
Beabsichtigte und automatische Aspekte der Sprachproduktion und Sprachperzeption am 13.11.2016 1 Vortragsgliederung 1.Grundlagen 2.Hauptfaktoren 2.1.Vokalnasalisierung 2.2.Voice Onset Time 2.3.Vokaldauer
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften
 Methoden der kognitiven Neurowissenschaften SS 2014 Freitag 9 Uhr (ct) Björn Herrmann - Jöran Lepsien - Jonas Obleser Zeitplan Datum Thema 11.4. Einführung und Organisation 18.4. -- Karfreitag -- 25.4.
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften SS 2014 Freitag 9 Uhr (ct) Björn Herrmann - Jöran Lepsien - Jonas Obleser Zeitplan Datum Thema 11.4. Einführung und Organisation 18.4. -- Karfreitag -- 25.4.
Leon Festinger Theorie der kognitiven Dissonanz. Referenten: Bastian Kaiser, Jenja Kromm, Stefanie König, Vivian Blumenthal
 Leon Festinger Theorie der kognitiven Dissonanz Referenten: Bastian Kaiser, Jenja Kromm, Stefanie König, Vivian Blumenthal Gliederung klassisches Experiment Allgemeines zu Leon Festinger Vorüberlegungen
Leon Festinger Theorie der kognitiven Dissonanz Referenten: Bastian Kaiser, Jenja Kromm, Stefanie König, Vivian Blumenthal Gliederung klassisches Experiment Allgemeines zu Leon Festinger Vorüberlegungen
Geburtsschrei. Mit ca. 6 Wochen soziales Lächeln. 2 Gurrlaute, Quietschen, Brummen, Gurren
 Tabellarische Darstellung zum Spracherwerb Um die Komplexität des physiologischen Spracherwerbs darzustellen und um den Bereich des Wortschatzes in den Gesamtkontext der Sprachentwicklung einordnen zu
Tabellarische Darstellung zum Spracherwerb Um die Komplexität des physiologischen Spracherwerbs darzustellen und um den Bereich des Wortschatzes in den Gesamtkontext der Sprachentwicklung einordnen zu
Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implantat? -
 Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implantat? - Überlegungen aus der neuropsychologischen Perspektive Martin Meyer Neuroplasticity and Learning in the Healthy Aging Brain (HAB LAB)
Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implantat? - Überlegungen aus der neuropsychologischen Perspektive Martin Meyer Neuroplasticity and Learning in the Healthy Aging Brain (HAB LAB)
THEORY OF MIND. Sozial-kognitive Entwicklung
 06.12.2010 THEORY OF MIND Sozial-kognitive Entwicklung Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozent: Dipl.-Psych. Susanne Kristen Referentin: Sabine Beil Gliederung 1. Definition und Testparadigma
06.12.2010 THEORY OF MIND Sozial-kognitive Entwicklung Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozent: Dipl.-Psych. Susanne Kristen Referentin: Sabine Beil Gliederung 1. Definition und Testparadigma
Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie
 Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie Do: 11-13; Geb. B21 HS http://www.neuro.psychologie.unisaarland.de/downloads.html 1 26.04. Geschichte der kognitiven Neurowissenschaft (1) 2 3.05. Funktionelle Neuroanatomie
Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie Do: 11-13; Geb. B21 HS http://www.neuro.psychologie.unisaarland.de/downloads.html 1 26.04. Geschichte der kognitiven Neurowissenschaft (1) 2 3.05. Funktionelle Neuroanatomie
- Theoretischer Bezugsrahmen -
 Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Implikatur. - Implikatur = pragmatische Schlussfolgerung / erschlossene Gesprächsandeutung
 Universität Paderborn Fakultät der Kulturwissenschaften: Institut für Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaft Proseminar: Pragmatik (mit fachdidaktischem Anteil) Dienstags 09 11 Uhr Wintersemester
Universität Paderborn Fakultät der Kulturwissenschaften: Institut für Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaft Proseminar: Pragmatik (mit fachdidaktischem Anteil) Dienstags 09 11 Uhr Wintersemester
Allgemeine Psychologie Denken und Sprache
 Allgemeine Psychologie Denken und Sprache von Sieghard Beller und Andrea Bender HOGREFE - GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO ES CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM. KOPENHAGEN. STOCKHOLM In haltsverzeich
Allgemeine Psychologie Denken und Sprache von Sieghard Beller und Andrea Bender HOGREFE - GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO ES CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM. KOPENHAGEN. STOCKHOLM In haltsverzeich
Faktivität und Theory of Mind / Komplexe Syntax und Theory of mind
 Faktivität und Theory of Mind / Komplexe Syntax und Theory of mind Semantik im normalen und gestörten Spracherwerb Prof. Dr. Petra Schulz Referentin: Carolin Ickstadt Gliederung Definition: False belief
Faktivität und Theory of Mind / Komplexe Syntax und Theory of mind Semantik im normalen und gestörten Spracherwerb Prof. Dr. Petra Schulz Referentin: Carolin Ickstadt Gliederung Definition: False belief
3. Klassische Konditionierung
 3. Klassische Konditionierung Ivan Petrovich Pavlov 1849-1936 Russischer Arzt, Wissenschaftler Nobel Preis in Medizin 1904 für seine Forschung zum Verdauungssystem bei Hunden 3. Klassische Konditionierung
3. Klassische Konditionierung Ivan Petrovich Pavlov 1849-1936 Russischer Arzt, Wissenschaftler Nobel Preis in Medizin 1904 für seine Forschung zum Verdauungssystem bei Hunden 3. Klassische Konditionierung
Grundlagenbereich Kognitionswissenschaften
 Grundlagenbereich Kognitionswissenschaften Master Psychologie in Göttingen Fachstudium Evaluation Angewandte Diagnostik Multivariate Statistik Berufspraktikum Professionalisierungsbereich Grundlagenbereiche
Grundlagenbereich Kognitionswissenschaften Master Psychologie in Göttingen Fachstudium Evaluation Angewandte Diagnostik Multivariate Statistik Berufspraktikum Professionalisierungsbereich Grundlagenbereiche
Prosody and the development of comprehension
 SAARLAN Prosody and the development of comprehension Anne Cuttler und David A. Swinney Journal of Child Language 1986 SAARLAN Inhalt Einleitung Paradoxon Experiment 1 Reaktionszeiten Experiment 2 Scrambling
SAARLAN Prosody and the development of comprehension Anne Cuttler und David A. Swinney Journal of Child Language 1986 SAARLAN Inhalt Einleitung Paradoxon Experiment 1 Reaktionszeiten Experiment 2 Scrambling
Information und Produktion. Rolland Brunec Seminar Wissen
 Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient
Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient
Fritz: Die Bedeutung von Fachwissen für das Simultandolmetschen
 Seite 10 Fritz: Die Bedeutung von Fachwissen für das Simultandolmetschen Inhaltsverzeichnis VORWORT... 9 INHALTSVERZEICHNIS... 10 BEGRIFFS- UND ABKÜRZUNGSÜBERSICHT... 13 1. EINLEITUNG... 14 2. WISSEN...
Seite 10 Fritz: Die Bedeutung von Fachwissen für das Simultandolmetschen Inhaltsverzeichnis VORWORT... 9 INHALTSVERZEICHNIS... 10 BEGRIFFS- UND ABKÜRZUNGSÜBERSICHT... 13 1. EINLEITUNG... 14 2. WISSEN...
Der Einfluss von gemeinsamem Handeln auf Prozesse der. Effects of social context on action planning and control. Zusammenfassung.
 Der Einfluss von gemeinsamem Handeln auf Prozesse der Handlungsplanung und Handlungsausführung Effects of social context on action planning and control Sebanz, Natalie; Knoblich, Günther; Prinz, Wolfgang
Der Einfluss von gemeinsamem Handeln auf Prozesse der Handlungsplanung und Handlungsausführung Effects of social context on action planning and control Sebanz, Natalie; Knoblich, Günther; Prinz, Wolfgang
Sprache und Bewegung Sprachbildung im Alltag von Kindertageseinrichtungen
 Sprache und Bewegung Sprachbildung im Alltag von Kindertageseinrichtungen Prof. Dr. Renate Zimmer Bild des Kindes Kinder erfahren und erleben ihre Welt leiblich und entwickeln implizite Vorstellungen über
Sprache und Bewegung Sprachbildung im Alltag von Kindertageseinrichtungen Prof. Dr. Renate Zimmer Bild des Kindes Kinder erfahren und erleben ihre Welt leiblich und entwickeln implizite Vorstellungen über
Wortdekodierung. Vorlesungsunterlagen Speech Communication 2, SS Franz Pernkopf/Erhard Rank
 Wortdekodierung Vorlesungsunterlagen Speech Communication 2, SS 2004 Franz Pernkopf/Erhard Rank Institute of Signal Processing and Speech Communication University of Technology Graz Inffeldgasse 16c, 8010
Wortdekodierung Vorlesungsunterlagen Speech Communication 2, SS 2004 Franz Pernkopf/Erhard Rank Institute of Signal Processing and Speech Communication University of Technology Graz Inffeldgasse 16c, 8010
Erste Analysen zum Turntaking in Dyadengesprächen
 Erste Analysen zum Turntaking in Dyadengesprächen Stephanie Köser, Universität des Saarlandes 11.02.2008 Aufbau Methodisches Vorgehen und Korpus Untersuchungsgegenstand: Turn-taking Signalisierungsmittel
Erste Analysen zum Turntaking in Dyadengesprächen Stephanie Köser, Universität des Saarlandes 11.02.2008 Aufbau Methodisches Vorgehen und Korpus Untersuchungsgegenstand: Turn-taking Signalisierungsmittel
Wörter! Wie entsteht. wo im Gehirn was wie verarbeitet wird. Sich mit dem Gehirn ein Bild vom Gehirn
 Sprache braucht mehr als nur Wörter! Wie entsteht Spracheim Gehirn? Prof. em. Dr. med. Cordula Nitsch Funktionelle Neuroanatomie Universität Basel 16.3.2018 Funktionelle Neuroanatomie beschäftigt sich
Sprache braucht mehr als nur Wörter! Wie entsteht Spracheim Gehirn? Prof. em. Dr. med. Cordula Nitsch Funktionelle Neuroanatomie Universität Basel 16.3.2018 Funktionelle Neuroanatomie beschäftigt sich
Äquivokationen. In der Spracherkennung. Michael Baumann Seminar (mit Bachelorarbeit)
 Äquivokationen In der Spracherkennung Michael Baumann 532 0225336 michael.baumann@student.tuwien.ac.at Seminar (mit Bachelorarbeit) Inhalt Einführung Äquivokation, Ambiguität, Prosodie Signale Beispiele:
Äquivokationen In der Spracherkennung Michael Baumann 532 0225336 michael.baumann@student.tuwien.ac.at Seminar (mit Bachelorarbeit) Inhalt Einführung Äquivokation, Ambiguität, Prosodie Signale Beispiele:
Erst denken, dann reden? Zur zeitlichen Koordination von Sprechen und Denken. Think before you speak? The temporal coordination of thinking and
 Erst denken, dann reden? Zur zeitlichen Koordination von Sprechen und Denken Think before you speak? The temporal coordination of thinking and speaking Konopka, Agnieszka; van de Velde, Maartje; Meyer,
Erst denken, dann reden? Zur zeitlichen Koordination von Sprechen und Denken Think before you speak? The temporal coordination of thinking and speaking Konopka, Agnieszka; van de Velde, Maartje; Meyer,
1. Die Rolle morphologischer Komplexität beim Sprachverstehen?
 BSc-Themen Folgende Themen für Bachelor-Arbeiten werden von der AE Zwitserlood angeboten. Die verwendeten n und Arbeitsbereiche spiegeln unsere Forschungsinteressen wider. Wenn Sie sich für ein interessieren
BSc-Themen Folgende Themen für Bachelor-Arbeiten werden von der AE Zwitserlood angeboten. Die verwendeten n und Arbeitsbereiche spiegeln unsere Forschungsinteressen wider. Wenn Sie sich für ein interessieren
Einführung in die germanistische Linguistik
 Jörg Meibauer / Ulrike Demske / Jochen Geilfuß-Wolfgang / Jürgen Pafel/Karl Heinz Ramers/Monika Rothweiler/ Markus Steinbach Einführung in die germanistische Linguistik 2., aktualisierte Auflage Verlag
Jörg Meibauer / Ulrike Demske / Jochen Geilfuß-Wolfgang / Jürgen Pafel/Karl Heinz Ramers/Monika Rothweiler/ Markus Steinbach Einführung in die germanistische Linguistik 2., aktualisierte Auflage Verlag
EKP-Untersuchungen zur Verarbeitung prosodischer Hinweisreize
 Spektrum Patholinguistik 6 (2013) 115 126 EKP-Untersuchungen zur Verarbeitung prosodischer Hinweisreize 1 Einleitung Julia Holzgrefe Department Linguistik, Universität Potsdam Die Ebene der Prosodie ist
Spektrum Patholinguistik 6 (2013) 115 126 EKP-Untersuchungen zur Verarbeitung prosodischer Hinweisreize 1 Einleitung Julia Holzgrefe Department Linguistik, Universität Potsdam Die Ebene der Prosodie ist
Phonologische Typologie (2) Alena Witzlack-Makarevich SoSe Sitzu
 Phonologische Typologie (2) Alena Witzlack-Makarevich SoSe 2015 4. Sitzu Hauslektüre Bickel, Balthasar and Nichols, Johanna. 2007. InflecGonal morphology (aus T. Shopen Language Typology and Syntac1c Descrip1on)
Phonologische Typologie (2) Alena Witzlack-Makarevich SoSe 2015 4. Sitzu Hauslektüre Bickel, Balthasar and Nichols, Johanna. 2007. InflecGonal morphology (aus T. Shopen Language Typology and Syntac1c Descrip1on)
Pappröhre, die an einem Ende offen und am anderen mit einem Plastikdeckel verschlossen ist. Vernier Mikrofon-Sonde, CBL oder LabPro und TI-83.
 Stehende Wellen Zielsetzung: In diesem Experiment ist es unser Ziel, die Schallwellen zu untersuchen, die entstehen, wenn der Deckel einer Pappröhre mit dem Finger angeschlagen wird. Das Geräusch wird
Stehende Wellen Zielsetzung: In diesem Experiment ist es unser Ziel, die Schallwellen zu untersuchen, die entstehen, wenn der Deckel einer Pappröhre mit dem Finger angeschlagen wird. Das Geräusch wird
Verbessert die schulischen Leistungen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung
 Verbessert die schulischen Leistungen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung Lernen Jedes Kind hat die Chance verdient, effektiv zu lernen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die sprechende
Verbessert die schulischen Leistungen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung Lernen Jedes Kind hat die Chance verdient, effektiv zu lernen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die sprechende
Synchrone Linguistik
 Synchrone Linguistik Phonetik/ Phonologie Morphologie Syntax Semantik Pragmatik Forensische Linguistik Psycholing. Neuroling. Textling. Sozioling. Aphasiologie Angewandte Linguistik 1 Fragen, Ziele und
Synchrone Linguistik Phonetik/ Phonologie Morphologie Syntax Semantik Pragmatik Forensische Linguistik Psycholing. Neuroling. Textling. Sozioling. Aphasiologie Angewandte Linguistik 1 Fragen, Ziele und
Vorwort Vorwort zur 3. Auflage
 Vorwort Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 3. Auflage V VI VI 1 Einleitung (Jörg Meibauer/Markus Steinbach) 1 1.1 Sprache in Literatur und Alltag 1 1.2 Sprache als soziales Phänomen 3 1.3 Sprache als historisches
Vorwort Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 3. Auflage V VI VI 1 Einleitung (Jörg Meibauer/Markus Steinbach) 1 1.1 Sprache in Literatur und Alltag 1 1.2 Sprache als soziales Phänomen 3 1.3 Sprache als historisches
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 1. Einführung: Was ist Künstliche Intelligenz? Malte Helmert Universität Basel 20. Februar 2015 Einführung: Überblick Kapitelüberblick Einführung: 1. Was ist Künstliche
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 1. Einführung: Was ist Künstliche Intelligenz? Malte Helmert Universität Basel 20. Februar 2015 Einführung: Überblick Kapitelüberblick Einführung: 1. Was ist Künstliche
Theorien des Erstspracherwerbs
 Präsentation:Cl audia Kolb 10.05.2011 Quelle: Milupa 1 Theorien des Erstspracherwerbs Goethe-Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Veranstaltung:
Präsentation:Cl audia Kolb 10.05.2011 Quelle: Milupa 1 Theorien des Erstspracherwerbs Goethe-Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Veranstaltung:
Über Broca, Gehirn und Bindung On Broca, Brain and Binding
 Über Broca, Gehirn und Bindung On Broca, Brain and Binding Hagoort, Peter Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Netherlands Korrespondierender Autor E-Mail: peter.hagoort@mpi.nl Zusammenfassung
Über Broca, Gehirn und Bindung On Broca, Brain and Binding Hagoort, Peter Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, Netherlands Korrespondierender Autor E-Mail: peter.hagoort@mpi.nl Zusammenfassung
1.1 Was ist KI? 1.1 Was ist KI? Grundlagen der Künstlichen Intelligenz. 1.2 Menschlich handeln. 1.3 Menschlich denken. 1.
 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 20. Februar 2015 1. Einführung: Was ist Künstliche Intelligenz? Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 1. Einführung: Was ist Künstliche Intelligenz? Malte Helmert
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 20. Februar 2015 1. Einführung: Was ist Künstliche Intelligenz? Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 1. Einführung: Was ist Künstliche Intelligenz? Malte Helmert
I see what you don t say! How language colours our perception
 Ich sehe was, was du nicht sagst! Wie Sprache unsere Wahrnehmung färbt I see what you don t say! How language colours our perception Flecken, Monique; Francken, Jolien Max-Planck-Institut für Psycholinguistik,
Ich sehe was, was du nicht sagst! Wie Sprache unsere Wahrnehmung färbt I see what you don t say! How language colours our perception Flecken, Monique; Francken, Jolien Max-Planck-Institut für Psycholinguistik,
Sprachlehr- & Sprachlernsysteme
 Sprachlehr- & Sprachlernsysteme Tutorielle & Toolartige Systeme Einführung in die Computerlinguistik WS 04/05 Dozentin: Wiebke Petersen Referentin: Maria Ruhnke Tutorielle Systeme lernen durch Instruktion,
Sprachlehr- & Sprachlernsysteme Tutorielle & Toolartige Systeme Einführung in die Computerlinguistik WS 04/05 Dozentin: Wiebke Petersen Referentin: Maria Ruhnke Tutorielle Systeme lernen durch Instruktion,
The Nonverbal Mediation of Self-Fulfilling Prophecies in Interracial Interaction
 The Nonverbal Mediation of Self-Fulfilling Prophecies in Interracial Interaction Carl O. Word, Mark P. Zanna und Joel Cooper (1974) Journal of Experimental Social Psychology, 10, 109-120 Der wissenschaftliche
The Nonverbal Mediation of Self-Fulfilling Prophecies in Interracial Interaction Carl O. Word, Mark P. Zanna und Joel Cooper (1974) Journal of Experimental Social Psychology, 10, 109-120 Der wissenschaftliche
Institut für Künstliche Intelligenz
 Institut für Künstliche Intelligenz Prof. Sebstaian Rudolph --- Computational Logic Prof. Steffen Hölldobler --- Wissensverarbeitung Prof. Ivo F. Sbalzarini --- Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie
Institut für Künstliche Intelligenz Prof. Sebstaian Rudolph --- Computational Logic Prof. Steffen Hölldobler --- Wissensverarbeitung Prof. Ivo F. Sbalzarini --- Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie
2 Perioden in 0.02 s 1 Periode in 0.01 s 100 Perioden in 1 s, Grundfrequenz = 100 Hz
 1. Die Abbildung in (a) zeigt einen synthetischen [i] Vokal. Was ist die Grundfrequenz davon? (Die Zeitachse ist in Sekunden). 2 Perioden in 0.02 s 1 Periode in 0.01 s 100 Perioden in 1 s, Grundfrequenz
1. Die Abbildung in (a) zeigt einen synthetischen [i] Vokal. Was ist die Grundfrequenz davon? (Die Zeitachse ist in Sekunden). 2 Perioden in 0.02 s 1 Periode in 0.01 s 100 Perioden in 1 s, Grundfrequenz
Entwicklungschecks in Kindertagesstätten
 Entwicklungschecks in tagesstätten SEEM 0-6 Seesener Entwicklungsscreening und Elternarbeit für Eltern mit Je frühzeitiger Entwicklungsauffälligkeiten von n erkannt und Eltern motiviert werden, ihre angemessen
Entwicklungschecks in tagesstätten SEEM 0-6 Seesener Entwicklungsscreening und Elternarbeit für Eltern mit Je frühzeitiger Entwicklungsauffälligkeiten von n erkannt und Eltern motiviert werden, ihre angemessen
3D-Gestenerkennung und Sprache - ICONIC
 3D-Gestenerkennung und Sprache - ICONIC im Rahmen des Seminars: Multimodale Mensch-Maschine-Kommunikation Marco Balke (mbalke@techfak.uni-bielefeld.de) 1 Was heißt 3D-Gestenerkennung Verschiedene Gestenkategorien
3D-Gestenerkennung und Sprache - ICONIC im Rahmen des Seminars: Multimodale Mensch-Maschine-Kommunikation Marco Balke (mbalke@techfak.uni-bielefeld.de) 1 Was heißt 3D-Gestenerkennung Verschiedene Gestenkategorien
Allgemeine Psychologie - Denken und Sprache
 Bachelorstudium Psychologie 3 Allgemeine Psychologie - Denken und Sprache Bearbeitet von Sieghard Beller, Andrea Bender 1. Auflage 2010. Taschenbuch. 318 S. Paperback ISBN 978 3 8017 2141 1 Format (B x
Bachelorstudium Psychologie 3 Allgemeine Psychologie - Denken und Sprache Bearbeitet von Sieghard Beller, Andrea Bender 1. Auflage 2010. Taschenbuch. 318 S. Paperback ISBN 978 3 8017 2141 1 Format (B x
Sprache beginnt ohne Worte. Vorsprachliche Entwicklung und die Bedeutung der frühen Elternarbeit
 Sprache beginnt ohne Worte Vorsprachliche Entwicklung und die Bedeutung der frühen Elternarbeit Grundeigenschaften menschlicher Sprache gesprochene Sprache ist akustisch vermittelt kleine Zahl von Lauten
Sprache beginnt ohne Worte Vorsprachliche Entwicklung und die Bedeutung der frühen Elternarbeit Grundeigenschaften menschlicher Sprache gesprochene Sprache ist akustisch vermittelt kleine Zahl von Lauten
Das Kommunikationsmodell von de Saussure
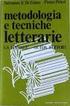 Das Kommunikationsmodell von de Saussure "Dieser Vorgang [Kreislauf des Sprechens] setzt mindestens zwei Personen voraus; das ist als Minimum erforderlich, damit der Kreislauf vollständig sei. Wir nehmen
Das Kommunikationsmodell von de Saussure "Dieser Vorgang [Kreislauf des Sprechens] setzt mindestens zwei Personen voraus; das ist als Minimum erforderlich, damit der Kreislauf vollständig sei. Wir nehmen
Mehrsprachigkeit. Vortrag von Carla De Simoni Seminar: Neurokognition von Hören und Sprache
 Mehrsprachigkeit Vortrag von Carla De Simoni Seminar: Neurokognition von Hören und Sprache 16.05.2011 Inhalt Was ist Bilingualismus? Neuronale Repräsentation von Bilingualismus Kritische Entwicklunsperioden
Mehrsprachigkeit Vortrag von Carla De Simoni Seminar: Neurokognition von Hören und Sprache 16.05.2011 Inhalt Was ist Bilingualismus? Neuronale Repräsentation von Bilingualismus Kritische Entwicklunsperioden
Können Spezialisten für Redeflussstörungen Poltern von Stottern unterscheiden?
 Können Spezialisten für Redeflussstörungen Poltern von Stottern unterscheiden? Susanne Rosenberger, Logopädin, MRes Prof. Peter Howell Definitionen von Stottern Verschiedene anerkannte Definitionen: Stottern
Können Spezialisten für Redeflussstörungen Poltern von Stottern unterscheiden? Susanne Rosenberger, Logopädin, MRes Prof. Peter Howell Definitionen von Stottern Verschiedene anerkannte Definitionen: Stottern
Soziale Determinanten menschlicher Kommunikation Social determinants of human communication
 Soziale Determinanten menschlicher Kommunikation Social determinants of human communication Bohn, Manuel; Stöber, Gregor Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig Korrespondierender Autor
Soziale Determinanten menschlicher Kommunikation Social determinants of human communication Bohn, Manuel; Stöber, Gregor Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig Korrespondierender Autor
Ein PASS beim NHS ist kein PASS fürs Leben. Zur Notwendigkeit und Methodik weiterer Screeningverfahren
 Ein PASS beim NHS ist kein PASS fürs Leben Zur Notwendigkeit und Methodik weiterer Screeningverfahren 11.6.2007 Prof. Dr. Ir. Frans Coninx Institut für Audiopädagogik, Solingen-Ohligs An-Institut der Universität
Ein PASS beim NHS ist kein PASS fürs Leben Zur Notwendigkeit und Methodik weiterer Screeningverfahren 11.6.2007 Prof. Dr. Ir. Frans Coninx Institut für Audiopädagogik, Solingen-Ohligs An-Institut der Universität
Hubert Haider Die Struktur der deutschen Nominalphrase
 Hubert Haider Die Struktur der deutschen Nominalphrase 1. Grundlegende Bemerkungen zur deutschen Nominalphrase 1.1 Rechtsverzweigung: Wie im Englischen ist die Struktur der deutschen Nominalphrase rechtsverzweigend
Hubert Haider Die Struktur der deutschen Nominalphrase 1. Grundlegende Bemerkungen zur deutschen Nominalphrase 1.1 Rechtsverzweigung: Wie im Englischen ist die Struktur der deutschen Nominalphrase rechtsverzweigend
Flektioinsmorphologie in der Psycholinguistik: Einführung
 Flektioinsmorphologie in der : Einführung Einführungsveranstaltung zum Seminar: Grammatiktheoretische und psycholinguistische Aspekte der Flektionsmorphologie Institut für Linguistik Universität Leipzig
Flektioinsmorphologie in der : Einführung Einführungsveranstaltung zum Seminar: Grammatiktheoretische und psycholinguistische Aspekte der Flektionsmorphologie Institut für Linguistik Universität Leipzig
Harvey Sacks: ethnomethodological conversation analysis
 Harvey Sacks: ethnomethodological conversation analysis Harvey Sacks: geboren 1935, gestorben 1975 studierte erst Jura in Yale, dann Soziologie in Cambridge (MIT) bzw. in Berkeley ab 1963 Lehre an der
Harvey Sacks: ethnomethodological conversation analysis Harvey Sacks: geboren 1935, gestorben 1975 studierte erst Jura in Yale, dann Soziologie in Cambridge (MIT) bzw. in Berkeley ab 1963 Lehre an der
Reflektas Ein neuartiges Lane Departure Prevention System auf der Basis reflektorischer Lenkreaktionen. Prof. Dr. Frank Eggert (TU Braunschweig)
 1 Reflektas Ein neuartiges Lane Departure Prevention System auf der Basis reflektorischer Lenkreaktionen Prof. Dr. Frank Eggert (TU Braunschweig) 2 Arten von Querführungsassistenten LANE KEEPING ASSISTANCE
1 Reflektas Ein neuartiges Lane Departure Prevention System auf der Basis reflektorischer Lenkreaktionen Prof. Dr. Frank Eggert (TU Braunschweig) 2 Arten von Querführungsassistenten LANE KEEPING ASSISTANCE
