DIE INTERNATIONALE SCHULDENKRISE
|
|
|
- Helene Schmidt
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 DIE INTERNATIONALE SCHULDENKRISE Rezension von: Kurt Kratena, Das Schuldenproblem der Entwicklungsländer - Lösungsansätze in einer neuen Weltwirtschaftsordnung, Europäische wirtschaftswissenschaftliche Studien, Band 1, herausgegeben vom Forschungsinstitut für vergleichende Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien im Mittelmeerraum, Wien 1989, 273 Seiten, ös 295,- Obwohl die Auslandsschulden der Entwicklungsländer bereits seit Ende der siebziger Jahre explosiv angestiegen waren, hat erst die Einstellung des Schul den dienstes durch Mexiko im Jahr 1982 eine intensivere Beschäftigung mit dieser Problematik erzwungen. Die wirtschaftspolitische Reaktion bestand zunächst in einer Vielzahl von Einzelrnaßnahmen, um einen "Dominoeffekt" und damit einen Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems zu verhindern. Auch in der Literatur dominierten Aufsätze, welche auf mehr oder weniger pragmatische Problemlösungen abzielten. Erst langsam setzte sich das Bewußtsein durch, daß die internationale Schuldenkrise nicht die Folge verschiedener "unglücklicher" Entwicklungen in einzelnen Schuldnerländern bzw. vermeidbarer Fehlentscheidungen in den Industrieländern darstellt, sondern das Ergebnis des Zusammenwirkens der internationalen Güterund Finanzmärkte in einer zunehmend verflochtenen Weltwirtschaft als geschlossenem System. Es ist das Verdienst von Kratena, diesen globalen oder "systemischen" Charakter der internationalen Schuldenkrise ins Zentrum seiner Untersuchung gestellt zu haben. Die Studie von Kratena verfolgt vier Zielsetzungen: - Darstellung der Entstehung der Schuldenkrise und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Entwicklungsländer. - Theoretische und empirische Analyse der Ursachen dieser Entwicklung. - Prognose der Schuldenentwicklung bis Anfang der neunziger Jahre. - Diskussion der wichtigsten Vorschläge zur Überwindung der Schuldenkrise samt Darstellung eines neuen Lösungsansatzes. Im ersten Abschnitt werden die Schuldenkrise und ihre Entwicklung am Beispiel der 15 "heavily indebted countries" des Baker-Planes beschrieben. Die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefaßt: Zwischen 1979 und 1982 waren Exporte und Importe dieser Ländergruppe etwa gleich rasch gewachsen, die Handelsbilanz war nur leicht defizitär, dennoch verschlechterte sich die gesamte Leistungsbilanz rapide, da sich die Zinszahlungen verdreifachten (Folge des Anstiegs der Dollarzinsen seit dem Übergang zu einer monetaristischen Geldpolitik in den USA im Jahr 1979). Nach Ausbruch der Schuldenkrise im Jahr 1982 waren die Entwicklungsländer gezwungen, ihre Importe drastisch einzuschränken. Dadurch gelang es den erwähnten 15 Ländern, starke Handeisbilanzüberschüsse zu erzielen. Diese reichten jedoch nicht aus, um die steigende Zinsenlast zu finanzieren, sodaß die Auslandsschulden weiter stiegen. Insbesondere die für die langfristige Kreditwürdigkeit wichtige Relation zwischen Schuldenstand und Exporterlösen verschlechterte sich weiter; denn trotz realer Ausfuhrsteigerungen gingen ihre Erlöse absolut zurück, da die Rohstoffpreise stark sanken. Dieser empirische Befund weist bereits auf die zentrale Bedeutung des Verhältnisses von Zinssatz und Exportwachstumsrate für den 604
2 Prozeß der Schuldenakkumulation hin. Ist diese Relation merklich positiv, so kann auch ein permanenter Handelsbilanzüberschuß (Ressourcentransfer zugunsten der Industrieländer) nicht ausreichen, um ein dauerndes Anwachsen der Auslandsschuld zu verhindern (diese Konstellation war typisch für die achtziger Jahre). Liegt der Zinssatz umgekehrt unter dem Exportwachstum, so führt auch ein permanentes Handelsbilanzdefizit zu keinem explosiven Anstieg der Auslandsverschuldung (diese Situation kennzeichnete die siebziger Jahre). Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der achtziger Jahre konstituierten für die Entwicklungsländer einen Teufelskreis: Der starke Anstieg der Auslandsschuld führte dazu, daß die Geschäftsbanken ihre Kreditvergabe an Entwicklungsländer drastisch reduzierten. Dies zwang diese Länder zu entsprechenden Importeinschränkungen, wodurch die Investitionen und damit das Wachstumspotential verringert wurden und damit auch die Fähigkeit, die Auslandsschuld langfristig zu bedienen. Gleichzeitig nahm die Verelendung der Lohnabhängigen innerhalb der Schuldnerländer enorm zu, da sie die Hauptlast der Restriktionspolitik zu tragen hatten. Während das reale Brutto-Inlandsprodukt zwischen 1981 und 1984 in Argentinien um insgesamt 6,2 Prozent gesunken und in Brasilien um 0,5 Prozent sowie in Mexiko um 5,6 Prozent gestiegen war, sanken die Reallöhne um 22,9 Prozent (Argentinien) bzw. 40,6 Prozent (Brasilien und Mexiko). Mit der Umverteilung zugunsten der Gläubigerländer aufgrund von Terms-of-Trade-Verschlechterungen (Verfall der Rohstoffpreise) und gestiegener Zinsen war somit ein ebenso ausgeprägter Umverteilungsprozeß innerhalb der Entwicklungsländer zu Lasten der Unselbständigen verbunden. Dieser hat den Anstieg der Auslandsverschuldung zusätzlich beschleunigt, da die zunehmende Kapitalflucht weitere Kreditaufnahmen in erheblichem Ausmaß erforderlich machte. So schätzt die Morgan Guaranty Trust Company den Bestand von Fluchtkapital im Ausland für Argentinien auf 46 Milliarden Dollar, für Brasilien auf 31 Milliarden Dollar und für Mexiko sogar auf 84 Milliarden Dollar (1987). Leider geht Kratena auf diese Zusammenhänge erst im letzten Abschnitt und auch da nur kursorisch ein. Im größten Teil der Studie wird jedoch nicht darauf verwiesen, daß die verwendeten Schuldendaten Bruttogrößen darstellen. Dies ist in zweifacher Hinsicht problematisch: Erstens wird dadurch die Verkoppelung des Konflikts zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern ("Nord/Süd") mit dem Konflikt zwischen Realkapital (Unternehmer), Finanzkapital (Renties) und Lohnabhängigen (Arbeitern) innerhalb der einzelnen Ländergruppen vernachlässigt. Zweitens ergibt sich dadurch ein gewisser Bruch zwischen den von Kratena diskutierten theoretischen Modellen der Verschuldungsdynamik (diese operieren mit Nettoschulden = akkumulierte Leistungsbilanzdefizite) und ihrem Erklärungswert in der Empirie (hier verwendet Kratena Bruttoschulden). Im zweiten Abschnitt behandelt Kratena die wichtigsten theoretischen Modelle der Verschuldensdynamik. Dies ist besonders aus zwei Gründen positiv zu bewerten, erstens, weil die meisten Studien zur Schuldenkrise überwiegend empirisch und pragmatisch orientiert sind, und zweitens, weil die wenigen theoretischen Modelle in verschiedenen Einzelarbeiten publiziert wurden, hier aber zusammenfassend und vergleichend dargestellt werden. Dabei lassen sich drei verschiedene Erklärungsansätze unterscheiden: - Reale makroökonomische Modelle in der Harrod-Domar-Tradition, welche jedoch die Bedeutung des Ressourcentransfers aus dem Ausland für den Wachstumsprozeß einer weniger entwickelten Volks- 605
3 wirtschaft explizit berücksichtigen. - Modelle der Leistungsbilanzentwicklung, welche lediglich den Außensektor spezifizieren. - Die "international financial instability"-hypothese, welche die Bedeutung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen betont (Zinssatz und Wechselkurs des Dollars als Weltwährung, Rohstoffpreise, internationale Realzinsentwicklung), ohne diese Zusammenhänge jedoch in einem formalen Modell darzustellen. Innerhalb des ersten Erklärungsansatzes lassen sich zwei Modelltypen unterscheiden: die "savings gap"-modelle nehmen an, daß in weniger entwickelten Volkswirtschaften die inländische Ersparnis zu gering ist, um jene Investitionen zu finanzieren, welche zum Erreichen eines bestimmten Wirtschaftswachstums notwendig sind. Um dieses Ziel zu realisieren, ist daher ein Transfer jinanzieuer Ressourcen aus dem Ausland und damit eine entsprechende Verschuldung notwendig. Die "trade-gap"-modelle sehen das Wachstum dieser Volkswirtschaft dadurch beschränkt, daß nicht jene Kapitalgüter im Inland produziert werden können, die notwendig sind, um ein bestimmtes Wirtschaftswachstum zu erreichen. Dafür ist daher ein Transfer realer Ressourcen (spezifische Kapitalgüter) aus dem Ausland notwendig, die Auslandsverschuldung ist somit aus technologischen Gründen Voraussetzung für ein längerfristig "selbsttragend" werdendes Wirtschaftswachstum. Leider geht Kratena nicht auf das Problem ein, welcher der beiden Modelltypen sich zur Erklärung der Schuldenkrise der Entwicklungsländer in den achtziger Jahren besser eignet. Aus zwei Gründen scheint die Annahme eines "trade gaps" auf die Situation insbesondere von Großschuldnern wie Argentinien, Brasilien oder Mexiko eher zuzutreffen als die Annahme eines "savings gap". Erstens haben diese Länder schon einen relativ hohen Entwick- lungsstand erreicht, dementsprechend ist auch die Sparquote viel höher als im Durchschnitt der Entwicklungsländer (nicht zuletzt die enorme Kapitalflucht zeigt, daß nicht der Mangel an Inlandsersparnis an sich die eigentliche Wachstumsbeschränkung darstellt). Zweitens benötigen diese Länder für eine erfolgreiche Industrialisierung gerade solche technologisch höherwertige Kapitalgüter, die sie selbst nicht produzieren können. Die Leistungsbilanzmodelle reduzieren die Komplexität der Verschuldungsdynamik im wirtschaftlichen Entwicklungsprozeß, indem lediglich die Schuldenakkumulation in Abhängigkeit von der Entwicklung von Exporten, Importen und Zinssätzen analysiert wird (das von Kratena auch dargestellte Modell von Thirlwall kann freilich für sich allein die Verschuldungsdynamik nicht erklären, da es lediglich die Entwicklung der Außenhandelsströme in Abhängigkeit von Einkommen und Preisen analysiert, nicht aber die Akkumulation der Auslandsschuld als Folge früherer Handelsbilanzdefizite und der Zinsentwicklung). Walther hat das von Domar für die Staatsverschuldung entwickelte Modell auf die Auslandsverschuldung übertragen und folgende zentrale Beziehung abgeleitet: Solange der Zinssatz für die Auslandsschuld niedriger ist als die Wachstumsrate der Exporte, kann sich ein Land auch ein permanentes Handelsbilanzdefizit leisten (und damit einen Ressourcentransfer zu seinen Gunsten), ohne daß die Auslandsverschuldung explosiv ansteigt; im umgekehrten Fall mag auch ein dauernder Handelsbilanzüberschuß (und entsprechende Wachstumsverluste) nicht ausreichen, um zu verhindern, daß die Auslandsschulden stärker steigen als die Exporterlöse. Diese Beziehung erklärt die entscheidende Ursache für die Entwicklung der internationalen Schuldenkrise: Zwischen 1972 und 1980 haben die nicht-erdölexportieren den Entwicklungsländer ihr Han- 606
4 deisbilanzdefizit relativ zu den Exporten und damit den Ressourcentransfer zu ihren Gunsten kräftig ausgeweitet, die sogenannte Netto-Transferquote stieg von 11,9 Prozent auf 15 Prozent, dennoch ging der Schuldenstand relativ zu den Exporten von 96,8 Prozent auf 81,9 Prozent zurück, da der Euro- Dollarzins mit durchschnittlich 9,2 Prozent merklich unter der Exportwachstumsrate von 20,9 Prozent lag (dieser hohe Zuwachs war zum größten Teil inflationsbedingt). Zwischen 1980 und 1986 sank die Netto-Transferquote auf -2,2 Prozent. Trotz dieser realen Ressourcentransfers zugunsten der Industrieländer stieg die Schuld- Export-Quote auf 147 Prozent an, da der Dollarzins durchschnittlich 10,9 Prozent betrug, die nominellen Exporterlöse aber nur um durchschnittlich 2,2 Prozent wuchsen (in erster Linie aufgrund fallender Exportpreise). Entscheidend für das Entstehen der internationalen Schuldenkrise war somit, daß sich der Dollarzins nicht parallel, sondern gegenläufig zur Weltinflation entwickelt. Die Erklärung dieser "Anti-Fisher-Relation" steht im Zentrum der "international financial instability"-hypothese. Im dritten Abschnitt diskutiert Kratena die Relevanz der theoretischen Ansätze zum Verständnis der Schuldenkrise der Entwicklungsländer. Er präsentiert eine Vielzahl von Informationen zu Entstehungsgeschichte und Management der Schuldenkrise, wobei freilich der Zusammenhang zu den theoretischen Modellen mitunter in der Fülle des Datenmaterials unterzugehen droht. Im vierten Abschnitt versucht Kratena, den Beitrag der Entwicklung von Dollarzins und Netto-Transferquote durch Simulationen mit dem Domar-Walther-Modell zu quantifizieren. Problematisch scheint dabei, daß als Folge des "Zinsschocks" nur jener Teil der zusätzlichen Auslandsschuld ermittelt wird, der durch den Zinsanstieg im Vergleich zum Jahr 1978 verursacht wurde. Denn da die Exportpreise absolut gefallen sind, bedeutete auch eine Konstanz des Nominalzinses einen sprunghaften und langfristig nicht tragbaren Anstieg der Realzinsen für internationale Schulden. Der fünfte Abschnitt stellt einen interessanten Exkurs über das Verhalten und den Lernprozeß der Geschäfts banken in der Entwicklungsgeschichte der Schuldenkrise dar, im besonderen werden die Möglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung des Länderrisikos im internationalen Kreditgeschäft deutlich gemacht. Im letzten Teil der Studie stellt Kratena einen neuen Vorschlag zur langfristigen Lösung der internationalen Schuldenproblematik zur Diskussion. Ausgangspunkt ist die Tatsache, daß der Weltverbrauch an Energie und sonstigen Rohstoffen langfristig nur unterdurchschnittlich wächst, sodaß ein den Entwicklungsnotwendigkeiten der Dritten Welt entsprechender Ressourcentransfer nur durch höhere Exportpreise finanziert werden kann. Höhere und insbesondere stabile Rohstoffpreise liegen aber auch im wohlfahrtsökonomischen Interesse der Industrieländer. Denn der Verbrauch vieler Rohstoffe führt zu erheblichen Umweltschäden, ohne daß diese externen Kosten in den Preisen berücksichtigt werden. Dementsprechend ist der Verbrauch solcher Rohstoffe (insbesondere der Energierohstoffe) viel höher als wohlfahrtsökonomisch wünschenswert. Ähnliches gilt auch für jene Rohstoffe, deren Produktion mit hoher Umweltbelastung verbunden ist (viele agrarische Rohstoffe). Kratenas Vorschlag läuft nun darauf hinaus, den Entwicklungsländern durch Stabilisierung der Rohstoffpreise auf höherem als dem derzeitigen Niveau einen größeren Ressourcentransfer und damit ein höheres Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, ohne einen langfristigen Anstieg der Auslandsverschuldung in Kauf zu nehmen. Dies soll durch zwei Maßnahmen erreicht werden, erstens eine Stabilisierung 607
5 des Dollarkurses und zweitens ein langfristiges Abkommen zur Stabilisierung der Rohstoffpreise zwischen Produzenten- und Verbraucherländem. Mit beiden Vorschlägen greift er auf ähnliche Konzepte von Keynes zurück, wobei die ökologische Begründung freilich neu ist. Diese zusätzliche Argumentation scheint allerdings nicht in allen Punkten hinreichend zwingend, um eine solche Neuordnung der Weltwirtschaft auch langfristig durchzusetzen. So müßte etwa aus rein wohlfahrtsökonomischen Aspekten jener Teil der erhöhten Rohstoffpreise, welcher den externen Kosten des Rohstoffverbrauchs entspricht, den Industrieländem zur Beseitigung bzw. zur Vermeidung der entsprechenden Umweltschäden zugute kommen. Dieses Beispiel zeigt, daß die von Kratenas Vorschlag implizite Einkommensumverteilung zugunsten der Entwicklungsländer nicht nur ein Instrument zur Erreichung eines langfristigen ökonomischen und ökologischen Gleichgewichts in der Weltwirtschaft darstellt, sondern auch ein wirtschafts- und weltpolitisches Ziel an sich. Anders ausgedrückt: eine solche Umverteilung ist nicht nur eine Frage der Erkenntnis der ökonomischen und ökologischen Verflechtung der Welt als Gesamtsystem, sondern auch des politischen Willens. Solange ein der Einheit des "Raumschiff Erde" entsprechendes Bewußtsein von Solidarität nicht ausgebildet ist, wird es daher keine entscheidenden Schritte in Richtung auf eine neue Weltwirtschaftsordnung geben. Insgesamt gesehen hat Kratena mit seiner Studie eine umfassende und sehr informative Darstellung der Problematik der Verschuldung der Entwicklungsländer geleistet. Leider entsprach die Endredaktion der Arbeit offensichtlich nicht der Qualität des Inhalts (so überschreitet die Zahl der Druckfehler das übliche Maß erheblich, eine Übersicht ist offensichtlich verlorengegangen). Dieser "Wermutstropfen" kann freilich den positiven Gesamteindruck, den die Studie inhaltlich hinterläßt, nicht wesentlich trüben. Stephan Schulmeister 608
Rohstoffpreise. Index (2008 = 100), in konstanten Preisen*, 1960 bis Index 320,7 241,4 220,8. 171,3 170,1 Nahrung und Genussmittel
 Index 350 325 320,7 300 275 250 225 200 241,4 220,8 175 171,3 170,1 150 125 100 75 50 25 146,6 157,1 125,7 119,5 104,0 117,8 101,9 89,3 65,7 83,5 91,3 86,6 77,7 53,6 52,7 68,2 59,4 100,0 0 1960 1965 1970
Index 350 325 320,7 300 275 250 225 200 241,4 220,8 175 171,3 170,1 150 125 100 75 50 25 146,6 157,1 125,7 119,5 104,0 117,8 101,9 89,3 65,7 83,5 91,3 86,6 77,7 53,6 52,7 68,2 59,4 100,0 0 1960 1965 1970
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell
 Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft
 Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Wie geht es mit dem US-Dollar weiter?
 Multi-Asset-Kommentar von Schroders Wie geht es mit dem US-Dollar weiter? Der US-Dollar war über 15 Jahre schwach und begünstigte dadurch den langfristigen Aufwärtstrend an den Finanzmärkten. Die Aufwertung
Multi-Asset-Kommentar von Schroders Wie geht es mit dem US-Dollar weiter? Der US-Dollar war über 15 Jahre schwach und begünstigte dadurch den langfristigen Aufwärtstrend an den Finanzmärkten. Die Aufwertung
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 3 Die offene Volkswirtschaft
 ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 3 Die offene Volkswirtschaft Version: 26.04.2011 3.1 Offene Gütermärkte Die Wahl zwischen in- und ausländischen Gütern Wenn Gütermärkte offen sind, dann müssen
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 3 Die offene Volkswirtschaft Version: 26.04.2011 3.1 Offene Gütermärkte Die Wahl zwischen in- und ausländischen Gütern Wenn Gütermärkte offen sind, dann müssen
Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität. Y n = C + I (1)
 2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
Makroskop. Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Unser Geldsystem XXXV: Schulden, Schulden ohne Grenzen?
 1 Makroskop Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Unser Geldsystem XXXV: Schulden, Schulden ohne Grenzen? Heiner Flassbeck Freitag den 27. Februar 2015 Wenn es ein Land gibt auf dieser Welt, wo
1 Makroskop Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Unser Geldsystem XXXV: Schulden, Schulden ohne Grenzen? Heiner Flassbeck Freitag den 27. Februar 2015 Wenn es ein Land gibt auf dieser Welt, wo
Reale Austauschverhältnisse (Terms of Trade)
 Index (2000 = ), 1980 bis 2006 Index 170 168 171 160 Süd-Osteuropa und GUS 150 140 130 120 152 117 ökonomisch sich entwickelnde ökonomisch am wenigsten entwickelte 120 116 121 118 150 143 110 90 80 109
Index (2000 = ), 1980 bis 2006 Index 170 168 171 160 Süd-Osteuropa und GUS 150 140 130 120 152 117 ökonomisch sich entwickelnde ökonomisch am wenigsten entwickelte 120 116 121 118 150 143 110 90 80 109
4 Die US-Wirtschaftspolitik versagt
 4 Die US-Wirtschaftspolitik versagt Sie hat sich der US-Geopolitik unterzuordnen. Teil 4 des Zyklus: Motive, Hintergründe und Folgen der Zinswende in den USA Von Hermann Patzak 4.1 Die Geldpolitik der
4 Die US-Wirtschaftspolitik versagt Sie hat sich der US-Geopolitik unterzuordnen. Teil 4 des Zyklus: Motive, Hintergründe und Folgen der Zinswende in den USA Von Hermann Patzak 4.1 Die Geldpolitik der
Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft Prof. Dr. Volker Clausen Makroökonomik II WS 8/9 Folie Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft. Die IS-Funktion in der offenen Volkswirtschaft. Handelsbilanz
Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft Prof. Dr. Volker Clausen Makroökonomik II WS 8/9 Folie Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft. Die IS-Funktion in der offenen Volkswirtschaft. Handelsbilanz
Wechselkurssysteme im Vergleich
 Wechselkurssysteme im Vergleich Monika Haslinger Maria Spieß Überblick Einleitung Mundell s impossible trinity Geld- & Fiskalpolitik bei freien Wechselkursen Geld- & Fiskalpolitik bei fixen Wechselkursen
Wechselkurssysteme im Vergleich Monika Haslinger Maria Spieß Überblick Einleitung Mundell s impossible trinity Geld- & Fiskalpolitik bei freien Wechselkursen Geld- & Fiskalpolitik bei fixen Wechselkursen
Makroökonomie Makroök. Analyse mit flexiblen Preisen. Übersicht Offene Volkswirtschaft
 Übersicht Makroökonomie 1 Prof. Volker Wieland Professur für Geldtheorie und -politik J.W. Goethe-Universität Frankfurt 1. Einführung 2. Makroökonomische Analyse mit Flexiblen Preisen 3. Makroökonomische
Übersicht Makroökonomie 1 Prof. Volker Wieland Professur für Geldtheorie und -politik J.W. Goethe-Universität Frankfurt 1. Einführung 2. Makroökonomische Analyse mit Flexiblen Preisen 3. Makroökonomische
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Staatsverschuldung. Vorlesung Bauwirtschaft Öffentliche Ausgaben
 Staatsverschuldung Vorlesung Bauwirtschaft 31.1.26 Öffentliche Ausgaben Einteilungen der Ausgaben Nach Gebietskörperschaften (Bund, Kantone, Gemeinden) Nach Funktionen Nach Sachgruppen (volkswirtschaftliche
Staatsverschuldung Vorlesung Bauwirtschaft 31.1.26 Öffentliche Ausgaben Einteilungen der Ausgaben Nach Gebietskörperschaften (Bund, Kantone, Gemeinden) Nach Funktionen Nach Sachgruppen (volkswirtschaftliche
Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Christof Römer. Auslandsinvestitionen, Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzeffekte
 Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 26 Christof Römer Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Auslandsinvestitionen, Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzeffekte
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 26 Christof Römer Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Auslandsinvestitionen, Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzeffekte
Landwirtschaftliche Exportproduktion in Entwicklungsländern
 Geographie Larissa Glück Landwirtschaftliche Exportproduktion in Entwicklungsländern Studienarbeit Gliederung 1 Einleitung... 1 1.1 Abstrakt... 1 1.2 Der Begriff Entwicklung... 1 2 Exportproduktion von
Geographie Larissa Glück Landwirtschaftliche Exportproduktion in Entwicklungsländern Studienarbeit Gliederung 1 Einleitung... 1 1.1 Abstrakt... 1 1.2 Der Begriff Entwicklung... 1 2 Exportproduktion von
Währungsreserven ökonomisch sich entwickelnder Staaten
 In absoluten Zahlen und in Relation zum durchschnittlichen Wert eines Monats-Imports, 1980 bis 2006 in Mrd. US-Dollar 3.000 2.750 2.500 9,6 insgesamt Ozeanien Naher Osten Afrika 2.919 2 127 296 10,0 in
In absoluten Zahlen und in Relation zum durchschnittlichen Wert eines Monats-Imports, 1980 bis 2006 in Mrd. US-Dollar 3.000 2.750 2.500 9,6 insgesamt Ozeanien Naher Osten Afrika 2.919 2 127 296 10,0 in
6. Einheit Wachstum und Verteilung
 6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
4 Stabilitäts- und Wachstumspolitik
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft bis 1992
 Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft bis 1992 Die drückendsten Probleme der Weltwirtschaft als Ausgangspunkt Die Entwicklung der Weltwirtschaft wird in den kommenden Jahren entscheidend davon abhängen,
Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft bis 1992 Die drückendsten Probleme der Weltwirtschaft als Ausgangspunkt Die Entwicklung der Weltwirtschaft wird in den kommenden Jahren entscheidend davon abhängen,
Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II
 Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 7 & 8) Friedrich Sindermann JKU 10.05. & 17.05.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Offene VW 2 10.05.
Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 7 & 8) Friedrich Sindermann JKU 10.05. & 17.05.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Offene VW 2 10.05.
Geld und Währung. Übungsfragen
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Klausurvorbereitung. 2. Ein wichtiges Ergebnis aus dem Modell von Solow zum langfristigen Wachstum ist, dass...
 Klausurvorbereitung Teil I: Multiple-Choice-Fragen Kreisen Sie jeweils ein, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Es können mehrere Aussagen wahr bzw. falsch sein. Pro MC-Frage werden fünf richtig eingekreiste
Klausurvorbereitung Teil I: Multiple-Choice-Fragen Kreisen Sie jeweils ein, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Es können mehrere Aussagen wahr bzw. falsch sein. Pro MC-Frage werden fünf richtig eingekreiste
H:\user\schulm\vortrag\WU\weltwirtschaft_wu
 Überblick Währungssysteme in der Dollar als Weltwährung Ausgewählte Probleme der Ökonomie Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Sommersemester 211
Überblick Währungssysteme in der Dollar als Weltwährung Ausgewählte Probleme der Ökonomie Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Sommersemester 211
Ausgewählte Probleme der Ökonomie Weltwirtschaft
 Ausgewählte Probleme der Ökonomie Weltwirtschaft Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Sommersemester 2008 Vortragender: Stephan Schulmeister (WIFO)
Ausgewählte Probleme der Ökonomie Weltwirtschaft Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Sommersemester 2008 Vortragender: Stephan Schulmeister (WIFO)
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft
 Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Aufschwung mit Risiken
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln IW-Konjunkturprognose 08.04.2014 Lesezeit 3 Min Aufschwung mit Risiken Weil die Weltkonjunktur wieder Fahrt aufgenommen hat, macht auch die
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln IW-Konjunkturprognose 08.04.2014 Lesezeit 3 Min Aufschwung mit Risiken Weil die Weltkonjunktur wieder Fahrt aufgenommen hat, macht auch die
H:\user\schulm\vortrag\WU\weltwirtschaft_wu
 Überblick Währungssysteme in der Dollar als Weltwährung Ausgewählte Probleme der Ökonomie Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Vortragender: Stephan
Überblick Währungssysteme in der Dollar als Weltwährung Ausgewählte Probleme der Ökonomie Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Vortragender: Stephan
Thema 4: Das IS-LM-Modell. Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM)
 Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Öffentlicher Schuldenstand*
 Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, 1997 bis 2011 Prozent 165 Griechenland 160 * Bruttoschuld des Staates (konsolidiert) 150 140 145
Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, 1997 bis 2011 Prozent 165 Griechenland 160 * Bruttoschuld des Staates (konsolidiert) 150 140 145
Kapitelübersicht. Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen
 Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen Einführung und Kreditvergabe und multinationale Unternehmen
Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen Einführung und Kreditvergabe und multinationale Unternehmen
ÜBUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Musterlösung Aufgabenblatt 1
 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz ÜBUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Musterlösung Aufgabenblatt 1 Aufgabe 1: Produktivitätswachstum in den
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz ÜBUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Musterlösung Aufgabenblatt 1 Aufgabe 1: Produktivitätswachstum in den
3 Der Außenhandel der EU als Teil des Welthandels. 3.1 Entwicklung des Welthandels nach Industrie- und Entwicklungsländern
 1 3 Der Außenhandel der EU als Teil des Welthandels 3.1 Entwicklung des Welthandels nach Industrie- und Entwicklungsländern Literatur: Dieckheuer (2001), S. 18 27 Wagner (2003), S. 4 7 2 (1) Entwicklung
1 3 Der Außenhandel der EU als Teil des Welthandels 3.1 Entwicklung des Welthandels nach Industrie- und Entwicklungsländern Literatur: Dieckheuer (2001), S. 18 27 Wagner (2003), S. 4 7 2 (1) Entwicklung
Das Finanzsystem: Sparen und Investieren
 Das Finanzsystem: Sparen und Investieren 26 Inhalt Welches sind die wichtigsten Finanzinstitutionen? Wie funktionieren Kreditmärkte? Was ist deren Bezug zur Spar- und Investitionstätigkeit? Wie beeinflussen
Das Finanzsystem: Sparen und Investieren 26 Inhalt Welches sind die wichtigsten Finanzinstitutionen? Wie funktionieren Kreditmärkte? Was ist deren Bezug zur Spar- und Investitionstätigkeit? Wie beeinflussen
M+E-Industrie bleibt Exportbranche Nummer eins
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Metall- und Elektro-Industrie 02.08.2017 Lesezeit 4 Min. M+E-Industrie bleibt Exportbranche Nummer eins Die wichtigste Exportbranche in Deutschland
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Metall- und Elektro-Industrie 02.08.2017 Lesezeit 4 Min. M+E-Industrie bleibt Exportbranche Nummer eins Die wichtigste Exportbranche in Deutschland
WACHSTUM UND ENTWICKLUNG Arbeitsauftrag
 Verständnisfragen Aufgabe 1 Erklären Sie den Begriff Wirtschaftswachstum. Aufgabe 2 Weshalb verwendet man das BIP pro Kopf und nicht das gesamte BIP, um ein Bild vom Wohlstand einer Gesellschaft zu erhalten?
Verständnisfragen Aufgabe 1 Erklären Sie den Begriff Wirtschaftswachstum. Aufgabe 2 Weshalb verwendet man das BIP pro Kopf und nicht das gesamte BIP, um ein Bild vom Wohlstand einer Gesellschaft zu erhalten?
Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels
 Index 16 15 14 Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels Index (1960 = 1), in konstanten Preisen, Entwicklung in Prozent, weltweit 1960 bis 1960 bis : + 1.586,8 % 1960 bis : + 457,2 % 15,6-12,0
Index 16 15 14 Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels Index (1960 = 1), in konstanten Preisen, Entwicklung in Prozent, weltweit 1960 bis 1960 bis : + 1.586,8 % 1960 bis : + 457,2 % 15,6-12,0
Ausgewählte Handelsbilanzen ( Teil 1)
 ( Teil 1) -853,6 Handelsbilanzdefizit -1,7-113,0-2,2-36,5-154,1 USA Großbritannien Deutschland Handelsbilanzüberschuss 4,3 38,4 220,5 Japan 1,9 64,7 80,1 China 0,4 3,4 180,7-0,3-55,9-4,3 Indien in Mrd.
( Teil 1) -853,6 Handelsbilanzdefizit -1,7-113,0-2,2-36,5-154,1 USA Großbritannien Deutschland Handelsbilanzüberschuss 4,3 38,4 220,5 Japan 1,9 64,7 80,1 China 0,4 3,4 180,7-0,3-55,9-4,3 Indien in Mrd.
Handelsanteile ökonomisch sich entwickelnder Staaten
 In absoluten Zahlen und Anteile am Weltwarenexport in Prozent, 1980 bis 2007 Jahr mit hohem BIP pro-kopf (2000) 2.344 16,94% 2007 mit mittlerem BIP pro-kopf (2000) 1.004 7,26% mit niedrigem BIP pro-kopf
In absoluten Zahlen und Anteile am Weltwarenexport in Prozent, 1980 bis 2007 Jahr mit hohem BIP pro-kopf (2000) 2.344 16,94% 2007 mit mittlerem BIP pro-kopf (2000) 1.004 7,26% mit niedrigem BIP pro-kopf
MID-TERM REPETITORIUM MACROECONOMICS I
 MID-TERM REPETITORIUM MACROECONOMICS I - EXERCISES - Autor: Sebastian Isenring Frühlingssemester 2016 Zürich, 15. April 2016 I. Einstiegsaufgaben 1 1.1 VGR & Makroökonomische Variablen 1.1.1 Das BNE entspricht
MID-TERM REPETITORIUM MACROECONOMICS I - EXERCISES - Autor: Sebastian Isenring Frühlingssemester 2016 Zürich, 15. April 2016 I. Einstiegsaufgaben 1 1.1 VGR & Makroökonomische Variablen 1.1.1 Das BNE entspricht
Konjunktur im Herbst 2007
 Konjunktur im Herbst 27 Überblick Die Expansion der Weltwirtschaft setzt sich fort, hat sich im Jahr 27 aber verlangsamt. Auch in 28 wird es zu einer moderaten Expansion kommen. Dabei bestehen erhebliche
Konjunktur im Herbst 27 Überblick Die Expansion der Weltwirtschaft setzt sich fort, hat sich im Jahr 27 aber verlangsamt. Auch in 28 wird es zu einer moderaten Expansion kommen. Dabei bestehen erhebliche
Restriktive Fiskalpolitik im AS-
 Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Internationale Ökonomie I. Vorlesung 5: Das Standard-Handels-Modell. Dr. Dominik Maltritz
 Internationale Ökonomie I Vorlesung 5: Das Standard-Handels-Modell Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick 3. Das Riccardo-Modell: Komparative Vorteile
Internationale Ökonomie I Vorlesung 5: Das Standard-Handels-Modell Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick 3. Das Riccardo-Modell: Komparative Vorteile
Teil I Einleitung 19. Teil II Die kurze Frist 83
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Ein Blick auf die makroökonomischen Daten................................... 23 1.2 Die Entstehung der Finanzkrise
Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Ein Blick auf die makroökonomischen Daten................................... 23 1.2 Die Entstehung der Finanzkrise
Zusammenhang zwischen Ölpreis und Inflation wird überschätzt
 Hüfners Wochenkommentar Zusammenhang zwischen Ölpreis und Inflation wird überschätzt Der Anstieg der Ölpreise in diesem Jahr hat sich kaum in der Inflation niedergeschlagen, beobachtet Assenagon-Chefvolkswirt
Hüfners Wochenkommentar Zusammenhang zwischen Ölpreis und Inflation wird überschätzt Der Anstieg der Ölpreise in diesem Jahr hat sich kaum in der Inflation niedergeschlagen, beobachtet Assenagon-Chefvolkswirt
Grundbegriffe 3. Makroökonomie in einer offenen Volkswirtschaft
 Grundbegriffe 3 Makroökonomie in einer offenen Volkswirtschaft Offene Gütermärkte Exporte: Im Inland produziert Im Ausland nachgefragt Importe: Im Ausland produziert Im Inland nachgefragt Offene Gütermärkte
Grundbegriffe 3 Makroökonomie in einer offenen Volkswirtschaft Offene Gütermärkte Exporte: Im Inland produziert Im Ausland nachgefragt Importe: Im Ausland produziert Im Inland nachgefragt Offene Gütermärkte
Allgemeine Volkswirtschaftslehre I
 Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Euro 19.06.2014 Lesezeit 4 Min Das Trilemma der EZB Als der Eurokurs vor kurzem über 1,40 Dollar zu steigen drohte, wurde lauthals gefordert,
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Euro 19.06.2014 Lesezeit 4 Min Das Trilemma der EZB Als der Eurokurs vor kurzem über 1,40 Dollar zu steigen drohte, wurde lauthals gefordert,
Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I: Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement. Ivan Pavletic, NADEL/ ETH Zürich
 Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I: Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement Ivan Pavletic, NADEL/ ETH Zürich 19.3.2007 1 Einleitung Wechselkursmanagement Wechselkursregime 21. November
Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I: Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement Ivan Pavletic, NADEL/ ETH Zürich 19.3.2007 1 Einleitung Wechselkursmanagement Wechselkursregime 21. November
Ben scheucht die Börsen auf
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Schwellenländer 01.08.2013 Lesezeit 3 Min. Ben scheucht die Börsen auf Die vage Ankündigung einer möglichen Zinswende durch die US-Notenbank
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Schwellenländer 01.08.2013 Lesezeit 3 Min. Ben scheucht die Börsen auf Die vage Ankündigung einer möglichen Zinswende durch die US-Notenbank
Einführung in die Finanzwissenschaft Kapitel 9: Staatsverschuldung
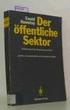 Einführung in die Finanzwissenschaft Kapitel 9: Staatsverschuldung Torben Klarl Universität Augsburg Sommersemester 2013 Contents 1 Grundlagen und Überblick 2 Keynesianisches Modell Ricardianisches Modell
Einführung in die Finanzwissenschaft Kapitel 9: Staatsverschuldung Torben Klarl Universität Augsburg Sommersemester 2013 Contents 1 Grundlagen und Überblick 2 Keynesianisches Modell Ricardianisches Modell
Übungsfragen. Währungspolitik
 Übungsfragen Währungspolitik 4 Zahlungsbilanz und Wechselkurs 4.1 Was bestimmt das Angebot an und die Nachfrage nach Devisen? Erläutern Sie stichpunktartig die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz! Auf
Übungsfragen Währungspolitik 4 Zahlungsbilanz und Wechselkurs 4.1 Was bestimmt das Angebot an und die Nachfrage nach Devisen? Erläutern Sie stichpunktartig die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz! Auf
Wachstum, Produktivität und der Lebensstandard
 Wachstum, Produktivität und der MB Steigerungen im Reales BIP pro Kopf (in 1995 $) von 1870 bis 2000 Land 1870 1913 1950 1979 2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate 1870-2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate
Wachstum, Produktivität und der MB Steigerungen im Reales BIP pro Kopf (in 1995 $) von 1870 bis 2000 Land 1870 1913 1950 1979 2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate 1870-2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate
Makroökonomik. VL 1: Einführung. Prof. Dr. Michael Kvasnicka Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre
 VL 1: Einführung Prof. Dr. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Organisatorisches Vorlesungen Montag, 19:15-20:45, G26-H1 Dienstag, 07:30-09:00, G26-H1 Übungen Beginn: 25. Oktober 2013 (2. Vorlesungswoche)
VL 1: Einführung Prof. Dr. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Organisatorisches Vorlesungen Montag, 19:15-20:45, G26-H1 Dienstag, 07:30-09:00, G26-H1 Übungen Beginn: 25. Oktober 2013 (2. Vorlesungswoche)
Die Entwicklung der rumänischen Wirtschaft in 2013
 Die Entwicklung der rumänischen Wirtschaft in 2013 1. Am 14. Februar 2014 veröffentlichte das Nationale Statistikinstitut die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum in Rumänien im vierten Quartal
Die Entwicklung der rumänischen Wirtschaft in 2013 1. Am 14. Februar 2014 veröffentlichte das Nationale Statistikinstitut die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum in Rumänien im vierten Quartal
Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE. Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Maximale Punktzahl:
 Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Aufgaben-Nr.: 1 2 3 4 Gesamt Maximale Punktzahl: 15 15 15 15 60 Erreichte Punkte: WICHTIGE HINWEISE: Bitte beantworten
Probeklausur zur Lehrveranstaltung MAKROÖKONOMIE Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Aufgaben-Nr.: 1 2 3 4 Gesamt Maximale Punktzahl: 15 15 15 15 60 Erreichte Punkte: WICHTIGE HINWEISE: Bitte beantworten
Der Globale Lohn-Report der ILO: Zusammenfassung
 Der Globale Lohn-Report der ILO: Zusammenfassung Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise drückt weiterhin auf die Löhne. Weltweit stiegen die Reallöhne langsamer als vor Ausbruch der Krise. In den Industrieländern
Der Globale Lohn-Report der ILO: Zusammenfassung Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise drückt weiterhin auf die Löhne. Weltweit stiegen die Reallöhne langsamer als vor Ausbruch der Krise. In den Industrieländern
1.3. Neoklassische Theorie der Staatsverschuldung
 1.3. Neoklassische Theorie der Staatsverschuldung Eekte einer Staatsverschuldung im OLG Modell. Annahmen: exogen gegebener Pfad der Staatsausgaben; Finanzierung über Steuern oder Verschuldung. Finanzierungstausch:
1.3. Neoklassische Theorie der Staatsverschuldung Eekte einer Staatsverschuldung im OLG Modell. Annahmen: exogen gegebener Pfad der Staatsausgaben; Finanzierung über Steuern oder Verschuldung. Finanzierungstausch:
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Name:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Fachrichtung:... Semesterzahl:...
 Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuß der Georg-August-Universität Göttingen Diplomprüfung Klausuren für Volkswirte, Betriebswirte, Handelslehrer und Wirtschaftsinformatiker, BA, MA, Nebenfach
Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuß der Georg-August-Universität Göttingen Diplomprüfung Klausuren für Volkswirte, Betriebswirte, Handelslehrer und Wirtschaftsinformatiker, BA, MA, Nebenfach
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11. Teil 1 Einleitung 15
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Teil 1 Einleitung 15 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 17 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union 18 1.2 Die Vereinigten Staaten 25 1.3 Japan 30 1.4 Wie es weitergeht
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Teil 1 Einleitung 15 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 17 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union 18 1.2 Die Vereinigten Staaten 25 1.3 Japan 30 1.4 Wie es weitergeht
Globale Risiken und politische Maßnahmen bremsen Investitionen
 VSW.Kompakt 27.11.2015 Globale Risiken und politische Maßnahmen bremsen Investitionen 1. Sachsens BIP-Wachstum dank Sondereffekten leicht überdurchschnittlich Das Wirtschaftswachstum in Sachsen lag im
VSW.Kompakt 27.11.2015 Globale Risiken und politische Maßnahmen bremsen Investitionen 1. Sachsens BIP-Wachstum dank Sondereffekten leicht überdurchschnittlich Das Wirtschaftswachstum in Sachsen lag im
Konvergenz und Bedingte Konvergenz. = h 0 ( ) ( ) i 2 0 Zudem sinkt die Wachstumsrate der pro-kopf-produktion mit dem Niveau.
 TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
Trends und externe Schocks im Aussenhandel: Entwicklungsländer als Rohstoffproduzenten. Rolf Kappel, NADEL/ ETH Zürich
 Trends und externe Schocks im Aussenhandel: Entwicklungsländer als Rohstoffproduzenten Rolf Kappel, NADEL/ ETH Zürich 19.3.2007 HS 2009 Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I 2 HS 2009 Entwicklungsländer
Trends und externe Schocks im Aussenhandel: Entwicklungsländer als Rohstoffproduzenten Rolf Kappel, NADEL/ ETH Zürich 19.3.2007 HS 2009 Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I 2 HS 2009 Entwicklungsländer
Ausgewählte Leistungsbilanzen (Teil 1)
 (Teil 1) In absoluten Zahlen und in Prozent des BIP, Betrachtungszeiträume zwischen 1996 und 2007 Leistungsbilanzdefizit Leistungsbilanzüberschuss -239 1996 bis 2000-5,3% -731-545 USA 2001 bis 2005 2007
(Teil 1) In absoluten Zahlen und in Prozent des BIP, Betrachtungszeiträume zwischen 1996 und 2007 Leistungsbilanzdefizit Leistungsbilanzüberschuss -239 1996 bis 2000-5,3% -731-545 USA 2001 bis 2005 2007
Teil I Einleitung 19. Teil II Die kurze Frist 79
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union................................ 22 1.2 Die Vereinigten Staaten....................................................
Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union................................ 22 1.2 Die Vereinigten Staaten....................................................
Die Rolle des IWF bei der Lösung des Verschuldungsproblems am Beispiel der Türkei
 Wirtschaft Davut Cizer / Ahmet Özbeg Die Rolle des IWF bei der Lösung des Verschuldungsproblems am Beispiel der Türkei Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Wirtschaft Davut Cizer / Ahmet Özbeg Die Rolle des IWF bei der Lösung des Verschuldungsproblems am Beispiel der Türkei Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen
 Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
H:\user\schulm\vortrag\WU\weltwirtschaft_wu
 Überblick Währungssysteme in der Dollar als Weltwährung Ausgewählte Probleme der Ökonomie Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Wintersemester 211
Überblick Währungssysteme in der Dollar als Weltwährung Ausgewählte Probleme der Ökonomie Lehrveranstaltung im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsuniversität Wien Wintersemester 211
1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5. 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 81
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5 1 Begriffe 6 2 Aufgaben 8 3 Lernkarten 23 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates 29 1 Begriffe 30 2 Aufgaben
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5 1 Begriffe 6 2 Aufgaben 8 3 Lernkarten 23 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates 29 1 Begriffe 30 2 Aufgaben
Arbeitskräftemangel bremst Wachstum aus
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Perspektive 2035 07.07.2017 Lesezeit 3 Min. Arbeitskräftemangel bremst Wachstum aus Wie wird sich die deutsche Wirtschaftsleistung im demografischen
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Perspektive 2035 07.07.2017 Lesezeit 3 Min. Arbeitskräftemangel bremst Wachstum aus Wie wird sich die deutsche Wirtschaftsleistung im demografischen
Prognose der österreichischen Wirtschaft Robuste Binnenkonjunktur bei hohem außenwirtschaftlichem Risiko
 Prognose der österreichischen Wirtschaft 2018 2019 Robuste Binnenkonjunktur bei hohem außenwirtschaftlichem Risiko 5. Oktober 2018 Internationales Umfeld Internationales Umfeld /1 Weltwirtschaft: Realwirtschaft
Prognose der österreichischen Wirtschaft 2018 2019 Robuste Binnenkonjunktur bei hohem außenwirtschaftlichem Risiko 5. Oktober 2018 Internationales Umfeld Internationales Umfeld /1 Weltwirtschaft: Realwirtschaft
Internationale Wettbewerbsfähigkeit
 Internationale Wettbewerbsfähigkeit Vorzieheffekte beenden verhaltene Entwicklung der Investitionen der letzten Jahre, positive Stabilisierung bis 18. Investitionswachstum 16,9 % 3,7 %,6 % 9 IE, CY, SE
Internationale Wettbewerbsfähigkeit Vorzieheffekte beenden verhaltene Entwicklung der Investitionen der letzten Jahre, positive Stabilisierung bis 18. Investitionswachstum 16,9 % 3,7 %,6 % 9 IE, CY, SE
ENTWICKLUNGSLÄNDER UND WELTWIRTSCHAFT
 BRUNO KNALL NORBERT WAGNER ENTWICKLUNGSLÄNDER UND WELTWIRTSCHAFT EINE EINFÜHRUNG 1986 WISSENSCHAFTLICHE BUCH GESELLSCHAFT DARMSTADT INHALTSVERZEICHNIS Verzeichnis der Tabellen Verzeichnis der Abbildungen
BRUNO KNALL NORBERT WAGNER ENTWICKLUNGSLÄNDER UND WELTWIRTSCHAFT EINE EINFÜHRUNG 1986 WISSENSCHAFTLICHE BUCH GESELLSCHAFT DARMSTADT INHALTSVERZEICHNIS Verzeichnis der Tabellen Verzeichnis der Abbildungen
Kapitel 2: Gütermarkt. Makroökonomik I - Gütermarkt
 Kapitel 2: Gütermarkt 1 Ausblick: Gütermarkt IS-Funktion (offene VW) Handelsbilanz und Produktion im Gleichgewicht Änderung von in- und ausländischer Nachfrage Wirtschaftspolitik in der offenen Volkswirtschaft
Kapitel 2: Gütermarkt 1 Ausblick: Gütermarkt IS-Funktion (offene VW) Handelsbilanz und Produktion im Gleichgewicht Änderung von in- und ausländischer Nachfrage Wirtschaftspolitik in der offenen Volkswirtschaft
Konjunktur und Geldpolitik
 Konjunktur und Geldpolitik Lage und Ausblick Wirtschaftspolitik und Internationale Beziehungen 28. November 2014 Konjunktur und Geldpolitik I. Konjunktur in Deutschland - Wo stehen wir? - Wie geht s weiter?
Konjunktur und Geldpolitik Lage und Ausblick Wirtschaftspolitik und Internationale Beziehungen 28. November 2014 Konjunktur und Geldpolitik I. Konjunktur in Deutschland - Wo stehen wir? - Wie geht s weiter?
Wahr/Falsch: Gütermarkt
 Wahr/Falsch: Gütermarkt Das Gütermarktgleichgewicht wird durch Y = a + b Y T dd mm beschrieben. Dabei ist a eine Konstante, b die marginale Konsumneigung, d die Zinsreagibilität der Investitionen und m
Wahr/Falsch: Gütermarkt Das Gütermarktgleichgewicht wird durch Y = a + b Y T dd mm beschrieben. Dabei ist a eine Konstante, b die marginale Konsumneigung, d die Zinsreagibilität der Investitionen und m
Wirtschaftswissenschaften 6 Stabilitätsgesetz. Kai Kleinwächter, M.A.
 Wirtschaftswissenschaften 6 Stabilitätsgesetz Kai Kleinwächter, M.A. Zentrale Begriffe - Wirtschaftspolitik - Stabilitätsgesetz => stetiges / angemessenes Wirtschaftswachstum => Preisniveaustabilität =>
Wirtschaftswissenschaften 6 Stabilitätsgesetz Kai Kleinwächter, M.A. Zentrale Begriffe - Wirtschaftspolitik - Stabilitätsgesetz => stetiges / angemessenes Wirtschaftswachstum => Preisniveaustabilität =>
Produktivität und Wachstum
 Produktivität und Wachstum Ist Wachstum als Wohlstandsmaß das richtige Maß? Fakten Säuglingssterblichkeit: 20% im ärmsten 1/5 aller Länder 0.4% im reichsten 1/5 85% der Menschen in Pakistan leben von weniger
Produktivität und Wachstum Ist Wachstum als Wohlstandsmaß das richtige Maß? Fakten Säuglingssterblichkeit: 20% im ärmsten 1/5 aller Länder 0.4% im reichsten 1/5 85% der Menschen in Pakistan leben von weniger
Krisensignale aus Fernost
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln China 30.07.2015 Lesezeit 4 Min Krisensignale aus Fernost Innerhalb von nur wenigen Wochen ist der Shanghai Composite, Chinas wichtigster Aktienindex,
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln China 30.07.2015 Lesezeit 4 Min Krisensignale aus Fernost Innerhalb von nur wenigen Wochen ist der Shanghai Composite, Chinas wichtigster Aktienindex,
Konjunktur Wochenrückblick
 Konjunktur Wochenrückblick 24. Oktober 28. Oktober 2016 Übersicht Frankreich Einkaufsmanagerindex knackt Wachstumsschwelle Eurozone Einkaufsmanagerindex mit stärkstem Zuwachs seit Jahresbeginn Deutschland
Konjunktur Wochenrückblick 24. Oktober 28. Oktober 2016 Übersicht Frankreich Einkaufsmanagerindex knackt Wachstumsschwelle Eurozone Einkaufsmanagerindex mit stärkstem Zuwachs seit Jahresbeginn Deutschland
Horst Siebert. Weltwirtschaft. mit 88 Abbildungen und 19 Tabellen. Lucius & Lucius Stuttgart
 Horst Siebert Weltwirtschaft mit 88 Abbildungen und 19 Tabellen Lucius & Lucius Stuttgart Vorwort V 1 Die weltwirtschaftliche Sicht 1 1.1 Sieben weltwirtschaftliche Bilder 1 1.2 Die globale Dimension 7
Horst Siebert Weltwirtschaft mit 88 Abbildungen und 19 Tabellen Lucius & Lucius Stuttgart Vorwort V 1 Die weltwirtschaftliche Sicht 1 1.1 Sieben weltwirtschaftliche Bilder 1 1.2 Die globale Dimension 7
**PRESSEMITTEILUNG***PRESSEMITTEILUNG**
 **PRESSEMITTEILUNG***PRESSEMITTEILUNG** Sorgenkind Inflation Donnerstag, 8. März 2012 Laut aktueller Vorausschätzung von Eurostat ist die Inflationsrate im Euroraum trotz der gegenwärtigen Rezession im
**PRESSEMITTEILUNG***PRESSEMITTEILUNG** Sorgenkind Inflation Donnerstag, 8. März 2012 Laut aktueller Vorausschätzung von Eurostat ist die Inflationsrate im Euroraum trotz der gegenwärtigen Rezession im
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
 Internationale Wirtschaftsbeziehungen Christian Breuer TU Chemnitz 1 Organisatorisches Vorlesung, Montag 15:30 17:00, Raum 2/W012 09.10. 16.10. 23.10. keine Veranstaltung 30.10. 06.11. Übung: 14 tgl. ab
Internationale Wirtschaftsbeziehungen Christian Breuer TU Chemnitz 1 Organisatorisches Vorlesung, Montag 15:30 17:00, Raum 2/W012 09.10. 16.10. 23.10. keine Veranstaltung 30.10. 06.11. Übung: 14 tgl. ab
/A\ 0 D k. Deutsche Konjunktur im Aufwind - Europäische Schuldenkrise schwelt weiter. tt. U " \ I r r-< LS-V
 0 D k /A\ T Deutsche Konjunktur im Aufwind - Europäische Schuldenkrise schwelt weiter tt. U D " \ I r r-< LS-V04-000.138 A Inhalt Kurzfassung 5 7 Überblick 7 Konjunkturelle Risiken der Staatsschuldenkrise
0 D k /A\ T Deutsche Konjunktur im Aufwind - Europäische Schuldenkrise schwelt weiter tt. U D " \ I r r-< LS-V04-000.138 A Inhalt Kurzfassung 5 7 Überblick 7 Konjunkturelle Risiken der Staatsschuldenkrise
B-BAE / B-SW / B-RS / B-HK / LA RS / LA GY
 B-BAE / B-SW / B-RS / B-HK / LA RS / LA GY Prüfungsfach/Modul: Makroökonomik Pflichtmodul Klausur: Makroökonomik (80 Minuten) (211751) Prüfer: Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff Matrikel-Nr.: Prüfungstag:
B-BAE / B-SW / B-RS / B-HK / LA RS / LA GY Prüfungsfach/Modul: Makroökonomik Pflichtmodul Klausur: Makroökonomik (80 Minuten) (211751) Prüfer: Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff Matrikel-Nr.: Prüfungstag:
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft
 Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft
 Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Studie zum Anlegerverhalten im vierten Quartal 2009
 Studie zum Anlegerverhalten im vierten Quartal 2009 Aktienmärkte: immer weniger Pessimisten Gesamtwirtschaft: sprunghafte Zunahme der Optimisten Preise und Zinsen: Inflationserwartung steigt weiter an
Studie zum Anlegerverhalten im vierten Quartal 2009 Aktienmärkte: immer weniger Pessimisten Gesamtwirtschaft: sprunghafte Zunahme der Optimisten Preise und Zinsen: Inflationserwartung steigt weiter an
Konjunktur Wochenrückblick
 Konjunktur Wochenrückblick 31. Oktober 04. November 2016 Übersicht Deutschland Arbeitslosenzahlen gehen weiter zurück Japan Industrieproduktion wächst langsamer als gedacht UK Einkaufsmanagerindex im Auf
Konjunktur Wochenrückblick 31. Oktober 04. November 2016 Übersicht Deutschland Arbeitslosenzahlen gehen weiter zurück Japan Industrieproduktion wächst langsamer als gedacht UK Einkaufsmanagerindex im Auf
Makroökonomische Fluktuationen
 Makroökonomische Fluktuationen In dieser Vorlesung Was bestimmt die Grösse des BIP? Was bestimmt die Grösse der einzelnen Komponenten des BIP auf der Verwendungsseite? Ein (einfaches) Modell der makroökonomischen
Makroökonomische Fluktuationen In dieser Vorlesung Was bestimmt die Grösse des BIP? Was bestimmt die Grösse der einzelnen Komponenten des BIP auf der Verwendungsseite? Ein (einfaches) Modell der makroökonomischen
Makroökonomik. Übung 4 - Erweiterungen der Modelle. 4.1 Erweiterungen der VGR. 4.2 Erweiterungen im Keynesianischen Kreuz
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/15 Makroökonomik
Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/15 Makroökonomik
Globalisierung und Wirtschaftswachstum
 Globalisierung und Wirtschaftswachstum Prof. Dr. Volker Clausen Universität Duisburg-Essen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Globalisierung und Wirtschaftswachstum Prof. Dr. Volker Clausen Universität Duisburg-Essen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Einführung und Begriffe. 1 Die Planetarische Zirkulation Die Passatzirkulation Sonderphänomene innerhalb der Passatzirkulation 7
 Inhalt Vorwort Einführung und Begriffe l Naturräumliches Potenzial der Tropen und Subtropen 3 1 Die Planetarische Zirkulation 3 1.1 Die Passatzirkulation 6 1.2 Sonderphänomene innerhalb der Passatzirkulation
Inhalt Vorwort Einführung und Begriffe l Naturräumliches Potenzial der Tropen und Subtropen 3 1 Die Planetarische Zirkulation 3 1.1 Die Passatzirkulation 6 1.2 Sonderphänomene innerhalb der Passatzirkulation
