Egon Döring. Werkstoffkunde der Elektrotechnik
|
|
|
- Arnim Sachs
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Egon Döring Werkstoffkunde der Elektrotechnik
3 Literatur rur das ,. Grundstudium Mathematik für Ingenieure, Band von L. Papula Übungsbuch zur Mathematik für Ingenieure von L. Papula Mathematische Formelsammlung von L. Papula Physik für Ingenieure von H. Lindner Physikalische Aufgaben von H. Lindner Elektroaufgaben von H. Lindner, 3 Bände Grundlagen und Rechenverfahren der Elektrotechnik von G. Schnell, K. Hoyer und M. Vömel Elemente der angewandten Elektronik von E. Böhmer Elektrische Meßtechnik von K. Bergmann Werkstoftkunde für Elektrotechnik von E. Döhring Mechanik und Festigkeitslehre vona. Böge Lehr- und Übungsbuch der Technischen Mechanik von H. H. Gloistehn, 3 Bände
4 Egon Döring Werkstoffkunde der Elektrotechnik Mit 206 Bildern, 48 Tabellen, 56 Beispielen und über 100 Aufgaben und Wiederholungsfragen mit Lösungen 2., verbesserte Auflage Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
5 1. Auflage , verbesserte Auflage 1988 Alle Rechte vorbehalten Springer Fachmedien Wiesbaden Ursprünglich erschienen bei Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbh, Braunschweig 1988 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Hanswerner Klein, Leverkusen Satz: Vieweg, Wiesbaden ISBN ISBN (ebook) DOI /
6 Vorwort Im Maschinenbau hatte die Werkstoffkunde stets eine fundamentale Bedeutung, da es dem Ingenieur auf diesem Arbeitsgebiet unmöglich war, ein einwandfreies Produkt ohne genaue Materialkenntnisse zu entwickeln. Solange sich die Elektrotechnik bei der konstruktiven Gestaltung weitgehend auf den Maschinenbau abstützen konnte, genügten dem Elektroingenieur die Werkstoffgrundkenntnisse aus dem Maschinenbau. Um dieses Grundwissen kommt er allerdings auch heute noch nicht herum. Die Entwicklung der modernen Mikroelektronik und ihre Folgen sind aber so eng mit den spezifisch elektrischen Problemen verknüpft, daß die Werkstoffkunde der Elektrotechnik zu einem immer eigenständigeren Gebiet herangewachsen ist. Waren es zunächst die magnetischen Werkstoffe, die ein umfangreiches Sonderwissen verlangten, so haben schließlich die Halbleiter mit ihren in den Festkörper verlegten Funktionsmechanismen auf allen Gebieten zu einer viel intensiveren Beschäftigung mit der Materie geführt. Als Konsequenz daraus sind altbekannte Werkstoffeigenschaften in ungeahntem Maße weiterentwickelt worden. Es sei hier nur an neue Dauermagnetwerkstoffe oder amorphe Metalle erinnert. Um die in der Zukunft anstehenden Probleme der Elektrotechnik einwandfrei lösen zu können, bedarf der Ingenieur eines immer umfangreicheren Wissens nicht nur auf seinem Spezialgebiet, sondern auch vom einzusetzenden Werkstoff und dessen Möglichkeiten. Dieses Grundlagenwissen muß während des Studiums notwendigerweise bereits zu einem frühen Zeitpunkt vermittelt werden. Das vorliegende Buch wendet sich daher besonders an Studenten der Anfangssemester Elektrotechnik. Dementsprechend wurde der mathematische Aufwand möglichst niedrig gehalten und von der höheren Mathematik nur sparsam Gebrauch gemacht. So sind z.b. vektorielle Darstellungen auf ein Minimum beschränkt worden. Unbedingt vorausgesetzt werden allerdings solide Kenntnisse in der Chemie, sowie des magnetischen und elektrischen Feldes. Mit der Struktur der Materie beginnend wird der Leser über die Legierungsbildung zu den speziellen elektrotechnischen Eigenschaften von elektrischen, magnetischen und dielektrischen Werkstoffen geführt. Bei den Halbleiterwerkstoffen ist auch noch den für die Technologie wichtigen Zusammenhängen breiter Raum gewidmet worden. Sowohl die Erläuterungen der Grundzusammenhänge, als auch die Beschreibungen der technisch ausgeführten Werkstoffe werden immer wieder durch ausführlich gerechnete Beispiele ergänzt. Dazu kommen dann noch Aufgaben zur Bearbeitung durch den Leser. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meiner Frau für die Reinschrift und allgemeine Durchsicht des Manuskriptes. Der Autor wünscht sich, daß dieses Buch mit dazu beitragen möge, dem Ingenieur durch die Wahl des richtigen Werkstoffes zu funktionstüchtigen und zuverlässigen Geräten zu verhelfen. Garbsen, im Februar 1981 E.Döring
7 VI Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau der festen Körper Werkstoffe Metalle Kristalle Elementarzelle Millersche Indizes Gitterfehler....' Fehlordnungen bei reinen Stoffen Fehlordnungen bei zusammengesetzten Stoffen Wiederholungsfragen Legierungen Entstehung von Zustandsdiagrammen Arten von Zustandsdiagrammen Flüssig und fest beliebig löslich Flüssig beliebig, fest gar nicht löslich Flüssig beliebig, fest begrenzt löslich mit Mischungslücke (allgemeiner Fall) Intermetallische Verbindungen Beständige intermetallische Verbindungen Unbeständige intermetallische Verbindungen Reale Zustandsdiagramme Blei-Zinn-Diagramm Eisen-Kohlenstoff-Diagramm Werkstoffkennzeichnung Werkstoffkurzzeichen Werkstoffnummern Mikrostruktur Röntgenuntersuchung Schliffbilder Schleifen und Polieren Ätzen Wiederholungsfragen
8 Inhaltsverzeichnis VII 3 Elektrische Leitfähigkeit Stromleitung Supraleitung BCS-Theorie Stabilisierung Halleffekt Hallgenerator Feldplatte Wiederholungsfragen Elektrische Leiter Normalleiter Supraleiter Wiederholungsfragen Magnetische Leitfähigkeit Modellvorstellung zum Magnetismus Verhalten von Materie im Magnetfeld Diamagnetismus Paramagnetismus Ferromagnetismus Antiferromagnetismus Ferrimagnetismus Magnetisierung Magnetisierungskurve Verluste Hystereseschleifen Normale Hystereseschleife Rechteckschleife Perminvarschleife Isopermschleife Arbeitsbereiche der Hystereseschleife Permeabilität Anfangspermeabilität Wechselfeldpermeabilität Effektive Permeabilität Reversible Permeabilität Impulspermeabilität Komplexe Permeabilität
9 VIII Inhaltsverzeichnis Verzerrungen durch die Hystereseschleife Rayleighschleife Stromverzerrungen Larmorfrequenz Wiederholungsfragen Magnetika Metalloxide (Ferrite) Weichmagnetika Metalle Legierungen Amorphe Metalle Magnetische Abschirmung Kernbleche Weichmagnetische Ferrite Arten weichmagnetischer Ferrite Kernformen... : Hartmagnetika (Dauermagnete) Entmagnetisierungskennlinie Hartmangetische Legierungen Hartmagnetische Metalloxide (Ferrite) Dauermagnetberechnung Impulsbetrieb Impulsübertrager Impulsspeicherung Wiederholungsfragen Halbleiter Halbleiter-Mechanismus Leiterdefinition Dotierung Umdotierung Einkristalle Reinheitsanforderungen Reindarstellung von Halbleitermaterialien Zonenschmelzen Kristallziehen Verarbeitung der Einkristalle p-n-obergang Legierungstechnologie Planartechnologie
10 Inhaltsverzeichnis IX Epitaxie Ionenimplantation Stoffe mit Halbleitereigenschaften Elementhalbleiter Verbindungshalbleiter Leitungstyp Halleffekt bei Dotierung Halleffekt bei gemischter Dotierung Thermokraft Wiederholungsfragen Dielektrische Eigenschaften Modellvorstellung zur dielektrischen Polarisation Elektronenpolarisation Ionenpolarisation Ordnungspolarisation Grenzflächenpolarisation Dielektrische Materialeinteilung Ferroelektrika Piezoelektrika Pyroelektrika Elektrische Materialeinteilung Isolatoren Kondensatoren Wiederholungsfragen Dielektrika Natürliche anorganische Dielektrika Glimmer Quarz Gase Natürliche organische Dielektrika Papiere Textilstoffe öle Künstliche anorganische Dielektrika Porzellan Steatit Titanate
11 X Inhaltsverzeichnis 9.4 Künstliche organische Dielektrika Zellulosekunststoffe Polykondensationsprodukte Polymerisationsprodukte Silikone Lösungen zu den Aufgaben Antworten zu den Wiederholungsfragen Literaturhinweise Sachwortverzeichnis
12 1 1 Aufbau der festen Körper 1.1 Werkstoffe Chemie und Physik sind die ursprünglichen Quellen der Gebiete, die heutzutage unter dem Begriff Werkstoffkunde zusammengefaßt sind. Der Stoffbegriff ist dabei vollständig aus der Chemie übernommen, erfährt jedoch eine Einschränkung aus der Praxis. Wir defi nieren danach: Werkstoffe sind Materialien zur Herstellung technischer (Gebrauchs-)Güter. Diese Festlegung schränkt das Angebot der Chemie sehr stark ein, da nur eine geringe Anzahl von Stoffen "technisch nutzbar" ist. Dies gilt besonders, wenn der durch die Klammer angedeutete Fall der Gebrauchsgüter, d.h. Massenproduktion betrachtet werden soll. Die Verbindung zur Chemie tritt in den Hintergrund, wenn es sich um die Eigenschaften der Werkstoffe bei den verschiedenen Anwendungsfällen handelt, dann werden physikalisches und elektrotechnisches Wissen erforderlich, um die anstehenden Probleme zu verstehen. Zunächst wollen wir uns jedoch einmal ganz allgemein dem Werkstoff zuwenden. Gemäß Defmition soll damit etwas hergestellt, d.h. gestaltet werden, wobei sich dieses Gestalten nach den Erfordernissen der Anwendung zu richten hat. Dieser Zusammenhang fuhrt uns in eine gewisse Schwierigkeit, denn gefordert wird "elektrisch", gestaltet werden muß aber "mechanisch". Hier tritt die Wechselwirkung zwischen dem jeweiligen Anwendungsbereich und der Beanspruchung eines Werkstoffes hervor. Eine Tabelle {Tab. 1.1) soll das deutlich machen. Beginnen wir mit dem Anwendungsbereich Mechanik, so ist eindeutig, daß Kräfte die primären Beanspruchungen sind. Sekundär mögen dann vielleicht noch thermische o.a. Wirkungen hinzukommen. In der Elektrik haben wir primär die Wirkung von Feldern, die dann allerdings im Regelfall zu einer Beanspruchung des Werkstoffes durch Kräfte fuhren, d.h. wieder zur Mechanik zurückleiten. Hierin liegt eine sehr wesentliche Problematik flir den Ingenieur in der Elektrotechnik, denn seine "elektrischen Tabelle 1.1 Anwendungsbereiche und Beanspruchungen von Werkstoffen Bereich BeanSpruchungen 1 2 Mechanik Kräfte, z.b. Zug, Druck, Sonstige Beanspruchungen, je nach Anwendung Biegung usw. z.b. Temperatur, Abrieb usw. Elektrik Felder, elektrische Kräfte und magnetische ähnlich Mechanik
13 2 1 Aufbau der festen Körper Zustand o o 0 o 0 0 gasförmig ~~ lcxx X X X flüssig fest XX XX Form Volumen nein nein nein ja ja ja Bild 1.1 Aggregatzustände Ideen" sind nur über die,,mechanische Konstruktion" zu realisieren. Dazu bedarf es aber wiederum des Werkstoffes, der entscheidend die konstruktive, d.h. mechanische Gestaltung beeinflußt. Wir müssen uns also, ehe wir die elektrischen Eigenschaften der Werkstoffe näher betrachten, einigen ihrer grundlegenden mechanischen Probleme zuwenden. Wichtigster Punkt ist hierbei zunächst einmal die Tatsache, daß wir es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle mit festen Stoffen zu tun haben. Fest ist hierbei im Sinne des Aggregatzustandes zu verstehen. Wie in Bild 1.1 dargestellt, sind die Aggregatzustände an verschiedene Ordnungsstufen gebunden. Im (idealen) Gas bewegen sich die Teilchen mit großem Abstand voneinander völlig regellos durcheinander. Sie sind volumenlos, d.h. sie passen sich jedem vorhandenen Raum an. Bei einer Flüssigkeit haben sich die Teilchen so weit genähert, daß die Gesamtheit zwar bereits ein bestimmtes Volumen aufweist, aber die Verschieblichkeit der Teilchen gegeneinander ist immer noch sehr hoch. Der Energieinhalt des Systems hat, im Vergleich zum Gas, abgenommen. Eine weitere Energieabnahme läßt die Bindungskräfte soweit wirksam werden, daß wir einen geordneten Zustand der Teilchen, ein Gitter, erhalten. Je nach Art der Teilchen unterscheiden wir Atom-, Ionen- oder Molekülgitter. Die Bindungskräfte gehen auf die von der Chemie her bekannten 4 Bindungsarten zurück (Bild 1.2). Ionenbindung, auch heteropolare Bindung genannt (Bild 1.2a). Die verschiedenen Atome tauschen Ladungen (Elektronen) aus und werden zu Ionen (Edelgaskonfiguration). Daraus folgen starke Anziehungskräfte und stabile Kristalle. Typischer Fall: anorganische Verbindungen. Charakteristische Eigenschaften: geringe elektrische Leitfahigkeit, Wasserlöslichkeit und elektrolytische Dissoziation, hoher Schmelzpunkt. Atombindung, auch homöopolare oder kovalente Bindung (Bild 1.2b ). Benachbarte Atome haben gemeinsame Elektronen(paare). Typischer Fall: nichtmetallische Elemente, organische Verbindungen. Charakteristische Eigenschaften: geringe elektrische Leitfahigkeit, oft durchsichtig und hohe Lichtbrechung.
14 1.2 Metalle 3 a) &8 + - Bild 1.2 Bindungsarten a) Ionenbindung oder heteropolare Bindung, z. B. Na+Clb) Atombindung, auch homöopolare oder kovalente Bindung, z. B. Ge c) metallische Bindung, z. B. Cu d) V an der Waals- oder Molekülbindung, z. B. Ar (kristallisiert) Metallische Bindung (Bild 1.2c ). Die Atome haben (wie in Bild 1.2a) ein Elektron abgegeben, d.h. sie liegen als positiv geladene Ionen vor, die abgegebenen Elektronen sind aber als bewegliche Leitungselektronen (Elektronengas) allen Atomrümpfen gemeinsam zugeordnet. Diese Bindungsart ist die Grundlage der elektrischen Leitfähigkeit. Typischer Fall: metallische Elemente. Charakteristische Eigenschaften: gute elektrische Leitfähigkeit, gute Wärmeleiter, Metallglanz, undurchsichtig. V an der Waals oder zwischenmolekulare Bindung (Bild 1.2d). Jedes Teilchen (Atom oder Molekül) erhält durch den Nachbarn ein Dipolmoment und erzeugt wiederum ein solches im Nachbarn. Dadurch ergeben sich - schwache -anziehende Kräfte. Diese Bindungsart ist nicht besonders stabil. Typischer Fall: Edelgase bei tiefen Temperaturen, organische Kristalle. Charakteristische Eigenschaften: niedriger Schmelzpunkt, als Kristall geringe Stabilität. Allgemein ist zu sagen, daß in der Regel zwar die eine oder andere Bindungsart überwiegt, in der Praxis aber immer mit Kombinationen der vier Bindungsarten zu rechnen ist. 1.2 Metalle Für die weiteren Betrachtungen ist nun die Sonderstellung der Metalle wichtig. Einmal wegen ihrer elektrischen Leitfähigkeit, die mit der metallischen Bindung verkoppelt ist, und zum anderen wegen der stabilen Kristallstruktur, als Grundlage der guten mechanischen Eigenschaften. Darüber hinaus sind von den z. Zt. bekannten 104 Elementen die meisten Metalle. Nur ca. 15 zählen zu den Nichtmetallen und ca. 8 fallen unter die - in der modernen Elektrotechnik besonders interessanten - Halbmetalle. Die Stellung der Halbmetalle oder Übergangselemente ist aus der in Bild 1.3 gezeigten Kurzform (nur Hauptgruppen) des Periodensystems am besten zu erkennen. Dabei wird auch das "ca." vor den obigen Angaben deutlich, da die Grenzziehung zwischen den Elementen nicht eindeutig ist (s. auch 7 Halbleiter).
15 4 1 Aufbau der festen Körper 6C 7N II Stickstoff 15 p 80 16S Schwefel 1 H 111 Phos- Sauerstoff Wasserstoff 9F Fluor 17 Cl Chlor IV V 34 Se Seien 35 Br Brom 53 J : : 3 s K~: :~rypton:....,... ; I.. " ' VI Bild 1.3 Hauptgruppen des Periodensystem der Elemente (Kurzform des Periodensystems) ~Metalle c::::=j Nichtmetalle ~ Obergangselemente,_,,.,._,,. J Edelgase 1.3 Kristalle Gemeinsam ist allen Elementen die bereits verschiedentlich erwähnte Gitter- oder Kristallstruktur. Wir halten hierzu fest: Ein Kristall ist die regelmäßige, räumlich periodische Anordnung kleinster Teilchen (Atome, Ionen oder Moleküle) zu einem festen Körper. Stoffe, die nicht regelmäßig, also nicht kristallin aufgebaut sind, bezeichnet man als amorph, d.h. gestaltlos. Zunächst einmal sei die periodische Anordnung der Teilchen in allen drei Raumkoordinaten gleichmäßig und ohne Störungen, dann erhalten wir den sog. IdealkristalL In der Praxis müssen wir immer mit Irregularitäten rechnen, damit gelangen wir zum Realkristall. Von den Abmessungen her gesehen, kann der Kristall sehr klein - z. B. nur mikroskopisch erkennbar - sein, wir nennen ihn dann Kristallit oder Korn. Erst die Zusammenlagerung vieler Kristallite liefert dann ein größeres Gebilde, den sog. Polykristall. Hat der Kristallit die Möglichkeit, beliebig weiter in den makroskopischen Bereich hineinzuwachsen, so erhalten wir einen Einkristall. Ein typisches Beispiel aus dem Alltag ist hierzu der Zucker. Zunächst einmal handelt es sich bei Zucker um organische Kristalle, die üblicherweise einige zehntel Millimeter groß
16 1.3 Kristalle 5 a) b) c) Bild 1.4 Zucker als Beispiel flir Kristalle a) Kristallite, b) Polykristall, c) Einkristall sind, d.h. also Kristallite darstellen (Bild 1.4a). Ballen sie sich zu einem größeren,,klumpen" zusammen, so ist das ein Polykristall (Bild 1.4b). Wohingegen Kandiszucker (Bild 1.4c) Einkristalle repräsentiert EiementaneUe Zerkleinem wir einen Kristalliten immer weiter, so bleibt die Kristallstruktur bis zur sog. Elementarzelle erhalten. Wir definieren damit: Eine Elementarzelle ist die kleinste - periodisch im Kristall wiederkehrende - Einheit, die bereits die Kristallstruktur aufweist. Eine größere Anzahl dieser regelmäßig angeordneten Elementanellen fuhrt zum sog. Raumgitter oder Kristallgitter. Bei hinreichender Ausdehnung entsteht daraus letztendlich der Kristallit. Damit müßten die Begrenzungsflächen der Kristallite im Grunde stets regelmäßig sein, aber Wachstumsstörungen, besonders in Polykristallen, verhindern dieses. Die Ordnung in einem Kristall sorgt dafür, daß manche Eigenschaften des Materials richtungsabhängig oder anisotrop sind. So ist z. B. Glimmer nur in ganz bestimmten Richtungen spaltbar. Im Gegensatz dazu weisen amorphe Stoffe im allgemeinen keine Richtungsabhängigkeit ihrer Eigenschaften auf; sie sind richtungsunabhängig oder isotrop. isotrop: eine (vektorielle) Eigenschaft ist richtungsunabhängig. anisotrop: eine (vektorielle) Eigenschaft ist richtungsabhängig. Betrachtet man die Atome in erster Näherung als Kugeln, so wird der Aufbau der Kristallgitter aus Elementarzellen eine Frage der Anordnung von Kugeln im Raum. Zur einfacheren Darstellung der auftretenden Probleme beginnen wir zunächst einmal in der Ebene (Bild 1.5). Statt der Kugeln können wir Kreise zeichnen, ftir die sich die zwei
17 6 1 Aufbau der festen Körper o) Bild 1.5 Kugelpackungen in ebener Darstellung mit Kreisen als Projektionen von Kugeln auf die Ebene a) primitive (quadratische) Packung, b) dichteste Packung möglichen Anordnungen a und b in Bild 1.5 ergeben. Die Bezeichnung dichteste Kugelpackung ftir die Anordnung nach Bild l.sb wird sofort ersichtlich, denn obwohl in beiden Fällen vier "Lagen" dargestellt sind, erreicht der rechte Stapel (b) nicht die Höhe des linken (a). Der Zusammenhang ergibt sich auch sehr schnell rechnerisch... Beispiell.1: Kugelpackung Nennen wir den Kreis(Kugel)durchmesser d und die Lagenhöhen a1 (Bild 1.5a) bzw. a2 (Bild 1.5b), so ist: 01 = d a2 = V3f4 d = 0,866 d (1.1a u. b) Für die Packungsdichte ermitteln wir den Anteil der Kreisfläche pro (umschlossener) Grundfläche. Das heißt für die quadratische Grundfläche (in Bild l.sa verstärkt gezeichnet) in der 4/4 = 1 ganzer Kreis vorhanden ist: 7Td2 1T 2 = 4 = 78,5 % 4dj Bei der sechseckigen Grundfläche (stark umrandet in Bild l.sb) werden 6/3 + 1 = 3 ganze Kreisflächen umschlossen, woraus folgt: 31Td 2 1 1T ;3 a~ 2.../3 ' = (1.2) -- = 907% (1.3) Während also die quadratische Anordnung nur 78,5 % der Grundfläche bedeckt, nutzt die dichteste Packung immerhin fast 91 % aus. Nach dieser Einfiihrung in einer ebenen Darstellung nun zu den räumlichen Anordnungen. Von der primitiven quadratischen Grundstruktur gelangen wir durch die räumliche Erweiterung zum Würfel (Bild 1.6), der sog. kubisch-primitiven (kp) Elementarzelle (engl.: simple cubic sc). Wie das Bild 1.6a zeigt, berühren die Kugeln entlang der Kanten eines (gedachten) Würfels. Den Abstand der Kugelmittelpunkte längs einer Würfelkante bezeichnen wir als Gitterkonstante (a). Diese Verhältnisse sind aus der konstruierten Darstellung (Bild 1.6b) wesentlich besser zu erkennen als aus dem KugelmodelL Für eine praktische und übersichtliche Zeichnung gehen wir noch einen Schritt weiter und ersetzen die Kugeln durch dicke Gitterpunkte, womit gleichzeitig die Stellen im Gitter als besetzt gelten sollen. Diese allgemein übliche Art der Darstellung finden wir in Bild 1.7a. Für alle weite-
18 1.3 Kristalle 7 a) b) Bild 1.6 Kubisch primitive Elementarzelle a) Kugelmodell b) Kugelmodell mit Elementarzellenwürfel, a Gitterkonstante, d Kugeldurchmesser ren Fälle wollen wir uns dieser einfachen Konstruktion bedienen. Durch Einbringen weiterer Atome ergeben sich Abwandlungen zum kubisch primitiven Gitter. Ein zusätzliches Atom in der Raummitte (Bild 1.7b) fuhrt zum kubisch-raumzentrierten (krz) Gitter (engl.: body centred cubic bcc). Wird auf jeder Flächenmitte ein Atom eingefügt, so gelangen wir zum kubisch-flächenzentrierten (kfz) Gitter (Bild 1.7c) (engl.: face centred cubic fcc). Die beiden letztgenannten sind übrigens die häufigsten metallografischen Gittertypen. Würfel IAiomin / ~ ~krz a) ~ /Atom rnjeder ~ ::, b) c) hdp d) Bild 1.7 Elementarzellen a) kp kubisch primitiv, b) krz kubisch raumzentriert c) kfz kubisch tlächenzentriert, d) hdp hexagonal dichtest gepackt, a, b, c Gitterkonstanten
19 8 1 Aufbau der festen Körper Die Packungsdichte Pergibt sich hier ähnlich wie in der Ebene zu: nj.a P=- VE (1.4) wobein die Besetzungszahl, d.h. die Anzahl der Atome pro Elementarzelle, und VE deren Volumen ist. J.A steht für das Volumen eines (kugelförmigen) Atoms im Gitter. Zur Bestimmung der Packungsdichte P ist grundsätzlich zunächst die Besetzungszahl n zu ermitteln. Die dabei auftretende Schwierigkeit des Abzählens soll mit Bild 1.8 behoben werden. Aus Bild 1.7a zählt man unwillkürlich im ersten Augenblick 8 Atome pro Elementarzelle. Das ist falsch, denn eine Elementarzelle ist nur Teil eines Gesamtgitters. In Bild 1.8 ist dies deutlich zu sehen. Die 8 Atome der dick herausgezeichneten zentralen Elementarzelle sind jeweils an 8 Zellen beteiligt. D.h. für die gekennzeichnete Elementarzelle liefert jedes Atom nur 1/8 seines Volumens! Da dieses wiederum 8-mal geschieht, bleibt letztlich beim kp-gitter 1 Atom pro Elementarzelle übrig. Damit ist sofort ersichtlich, daß die Besetzungszahl beim krz-gitter 2 und beim kfz-gitter 4 beträgt. / / / / V V V / V / V /,/./ V ~ ""' / / // / V "'" / V V / / / / / / / / / / V V / / / / Bild 1.8 Atome einer Elementarzelle zur Bestimmung der Besetzungszahl, Erläuterung im Text... Beispiel 1.2: Packungsdichte Die Packungsdichte soll jetzt einmal für die kp-elementarzelle bestimmt werden. Mit der Gitterkonstanten a gilt: 1rd3 Pkp = -3 (1.5) 6a Der Zusammenhang zwischen d und a ergibt sich über eine Linie im Gitter, längs der sich die Atome berühren. Im Falle kp ist dies eine Kante der Elementarzelle, d. h. a = 2 ~ = d! Damit wird die Packungsdichte 1r Pkp = 6 = 0,52 = 52% (1.6) Wir haben in Beispiel 1.2 den Zusammenhang zwischen a und d mit a = d benutzt. Sehen wir uns die anderen Elementarzellentypen an (Bild 1.7), so erkennen wir sehr schnell die in Tabelle 1.2 niedergelegten Zahlenverhältnisse. (Noch fehlende Zahlenwerte ergeben sich aus späteren Aufgaben und sind dann hier zu ergänzen!)
20 1.3 Kristalle 9 Tabelle 1.2 Gitterkonstanten und Packungsdichten von Elementarzellen (noch fehlende Eintragungen sind nach Berechnung zu ergänzen) Elementar- zelle kp kfz krz hex 2d 2d 2d a= -=d -= 1 41d -= 115d d 2.,fi' -./3 ' dia c= Gitterkonstante Packungsdichte 0,52 0,34 Ein Zahlenvergleich läßt unmittelbar erkennen, daß offensichtlich das kfz-gitter - bei gleichen Atomdurchmessern - am "weitesten" ist. "Weit" könnte aber auch eine geringe Packungsdichte bedeuten. Um hier Klarheit zu schaffen, sind die Zahlenwerte der kfzund krz-packungsdichten zu ermitteln. Aufgabe 1.1: Packungsdichten Bestimmen Sie die Packungsdichten für krz- und kfz-elementarzellen und tragen die gefundenen Zahlenwerte in die Tabelle 1.2 ein. Wie die ergänzte Tabelle 1.2 zeigt, erweist sich die kfz-elementarzelle bislang als die dichtest gepackte. Es kann schon jetzt gesagt werden, daß dieser Wert von keinem anderen Gitter überschritten und nur noch gleichfalls erreicht wird. In der Metallkunde ist allerdings noch eine weitere Elementarzelle bedeutsam, die sich aus der dichtesten Kugelpackung in der Ebene ergibt, die Elementarzelle mit der hexagonal dichtesten Packung (hdp) (Bild 1.7d) (engl. : hexagonal close packed hcp). Die Folgelagen liegen - wie das Bild 1.9 gut zeigt - in den Vertiefungen der vorhergehenden Ebenen, so daß eine hohe Packungsdichte wahrscheinlich ist. Zur Erhärtung diene wieder eine Aufgabe. Bild 1.9 Elementarzelle mit hexagonal dichtester Packung
Hier: Beschränkung auf die elektrische Eigenschaften
 IV. Festkörperphysik Hier: Beschränkung auf die elektrische Eigenschaften 3 Aggregatzustände: fest, flüssig, gasförmig: Wechselspiel Anziehungskräfte der Teilchen gegen die thermische Energie kt. Zustand
IV. Festkörperphysik Hier: Beschränkung auf die elektrische Eigenschaften 3 Aggregatzustände: fest, flüssig, gasförmig: Wechselspiel Anziehungskräfte der Teilchen gegen die thermische Energie kt. Zustand
3. Struktur des Festkörpers
 3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,
3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,
Gliederung der Vorlesung im SS
 Gliederung der Vorlesung im SS A. Struktureller Aufbau von Werkstoffen. Atomare Struktur.. Atomaufbau und Periodensystem der Elemente.2. Interatomare Bindungen.3. Aggregatzustände 2. Struktur des Festkörpers
Gliederung der Vorlesung im SS A. Struktureller Aufbau von Werkstoffen. Atomare Struktur.. Atomaufbau und Periodensystem der Elemente.2. Interatomare Bindungen.3. Aggregatzustände 2. Struktur des Festkörpers
Ionenbindungen, Ionenradien, Gitterenergie, Born-Haber-Kreisprozess, Madelung-Konstante
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindungen, Ionenradien, Gitterenergie, Born-Haber-Kreisprozess, Madelung-Konstante Thema heute: 1) Kovalente Gitter, 2) Metalle 280 Kovalente und molekulare
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindungen, Ionenradien, Gitterenergie, Born-Haber-Kreisprozess, Madelung-Konstante Thema heute: 1) Kovalente Gitter, 2) Metalle 280 Kovalente und molekulare
Aufgabensammlung Technische Mechanik 2
 Otto Bruhns Aufgabensammlung Technische Mechanik 2 F estigkeitslehre fur Bauingenieure und Maschinenbauer Aus dem Programm Grundstudium Mathematik fur Ingenieure und Naturwissenschaftler von L. Papula,
Otto Bruhns Aufgabensammlung Technische Mechanik 2 F estigkeitslehre fur Bauingenieure und Maschinenbauer Aus dem Programm Grundstudium Mathematik fur Ingenieure und Naturwissenschaftler von L. Papula,
Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie
 Hans Fischer, Hansgeorg Hofmann, Jürgen Spindler Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie ISBN-10: 3-446-40707-3 ISBN-13: 978-3-446-40707-7
Hans Fischer, Hansgeorg Hofmann, Jürgen Spindler Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie ISBN-10: 3-446-40707-3 ISBN-13: 978-3-446-40707-7
Werkstoffe in der Elektrotechnik
 Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften Prüfung - Anwendung - Technologie von Hansgeorg Hofmann und Jürgen Spindler begründet von Hans Fischerf 6., neu bearbeitete Auflage
Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen - Aufbau - Eigenschaften Prüfung - Anwendung - Technologie von Hansgeorg Hofmann und Jürgen Spindler begründet von Hans Fischerf 6., neu bearbeitete Auflage
Inhaltsverzeichnis. Vorwort. Wie man dieses Buch liest. Periodensystem der Elemente
 Inhaltsverzeichnis Vorwort Wie man dieses Buch liest Periodensystem der Elemente v vii xiv 1 Flüssigkristalle 1 1.1 Motivation und Phänomenologie.................. 1 1.2 Was ist ein Flüssigkristall?.....................
Inhaltsverzeichnis Vorwort Wie man dieses Buch liest Periodensystem der Elemente v vii xiv 1 Flüssigkristalle 1 1.1 Motivation und Phänomenologie.................. 1 1.2 Was ist ein Flüssigkristall?.....................
2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle. Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle. Li Be B C N O F. Na Mg Al Si P S Cl
 2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ga Ge As Se Br Rb Sr In Sn Sb Te I Cs Ba Tl Pb Bi Po At Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle Metalle etwa
2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ga Ge As Se Br Rb Sr In Sn Sb Te I Cs Ba Tl Pb Bi Po At Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle Metalle etwa
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Festkörper, ausgewählte Beispiele spezieller Eigenschaften von Feststoffen, Kohlenstoffmodifikationen, Nichtstöchiometrie, Unterscheidung kristalliner und amorpher
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Festkörper, ausgewählte Beispiele spezieller Eigenschaften von Feststoffen, Kohlenstoffmodifikationen, Nichtstöchiometrie, Unterscheidung kristalliner und amorpher
Grundlagen der Chemie Metalle
 Metalle Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Metalle 75% aller chemischen Elemente sind Metalle. Typische
Metalle Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Metalle 75% aller chemischen Elemente sind Metalle. Typische
Klaus Stierstadt. Physik. der Materie VCH
 Klaus Stierstadt Physik der Materie VCH Inhalt Vorwort Tafelteil hinter Inhaltsverzeichnis (Seiten TI-T XVII) V Teil I Mikrophysik - Die Bausteine der Materie... l 1 Aufbau und Eigenschaften der Materie
Klaus Stierstadt Physik der Materie VCH Inhalt Vorwort Tafelteil hinter Inhaltsverzeichnis (Seiten TI-T XVII) V Teil I Mikrophysik - Die Bausteine der Materie... l 1 Aufbau und Eigenschaften der Materie
E.Hornbogen H.Warlimont. Metalle. Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen. 5., neu bearbeitete Auflage. Mit 281 Abbildungen.
 E.Hornbogen H.Warlimont Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen 5., neu bearbeitete Auflage Mit 281 Abbildungen ö Springer Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Allgemeiner Überblick 1
E.Hornbogen H.Warlimont Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen 5., neu bearbeitete Auflage Mit 281 Abbildungen ö Springer Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Allgemeiner Überblick 1
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde:
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindung, Koordinationspolyeder, ionische Strukturen, NaCl, CsCl, ZnS, Elementarzelle, Gitter, Gitterkonstanten, 7 Kristallsysteme, Ionenradien, Gitterenergie
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindung, Koordinationspolyeder, ionische Strukturen, NaCl, CsCl, ZnS, Elementarzelle, Gitter, Gitterkonstanten, 7 Kristallsysteme, Ionenradien, Gitterenergie
Anorganische Chemie III - Festkörperchemie
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Chemie Abteilung Anorganische Chemie/Festkörperchemie Prof. Dr. Martin Köckerling Vorlesung Anorganische Chemie III - Festkörperchemie 1 Wiederholung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Chemie Abteilung Anorganische Chemie/Festkörperchemie Prof. Dr. Martin Köckerling Vorlesung Anorganische Chemie III - Festkörperchemie 1 Wiederholung
3. Struktur des Festkörpers
 3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,
3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,
Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie
 Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie Sommersemester 2011 Vorlesung 21 30.06.2011 Physik IV - Einführung in die Atomistik Vorlesung 21 Prof. Thorsten Kröll 30.06.2011 1 H 2
Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie Sommersemester 2011 Vorlesung 21 30.06.2011 Physik IV - Einführung in die Atomistik Vorlesung 21 Prof. Thorsten Kröll 30.06.2011 1 H 2
Ionenbindungen. Chemie. Library
 Chemie Ionenbindungen Library IONENBINDUNGEN Begriffserklärung 1 Formeltabelle 1 Ladungsermittlung 2 Formale Ladung 3 Hydrogen-Ionen 3 Verhältnisformeln 4 Nomenklatur 4 Gitterenthalpie 4 Eigenschaften
Chemie Ionenbindungen Library IONENBINDUNGEN Begriffserklärung 1 Formeltabelle 1 Ladungsermittlung 2 Formale Ladung 3 Hydrogen-Ionen 3 Verhältnisformeln 4 Nomenklatur 4 Gitterenthalpie 4 Eigenschaften
2 Bindung, Struktur und Eigenschaften von Stoffen. 2.1 Ionenbindung und Ionenkristall s Modell der Ionenbindung
 2 Bindung, Struktur und Eigenschaften von Stoffen 2.1 Ionenbindung und Ionenkristall s. 0.6 Modell der Ionenbindung 8 - Bindung zwischen typischen Metallen und Nichtmetallen, EN > 1,7 - stabile Edelgaskonfiguration
2 Bindung, Struktur und Eigenschaften von Stoffen 2.1 Ionenbindung und Ionenkristall s. 0.6 Modell der Ionenbindung 8 - Bindung zwischen typischen Metallen und Nichtmetallen, EN > 1,7 - stabile Edelgaskonfiguration
Gliederung der Vorlesung Festkörperelektronik
 Gliederung der Vorlesung Festkörperelektronik 1. Grundlagen der Quantenphysik 2. Elektronische Zustände 3. Aufbau der Materie 4. Elektronen in Kristallen 5. Halbleiter 6. Quantenstatistik 7. Dotierte Halbleiter
Gliederung der Vorlesung Festkörperelektronik 1. Grundlagen der Quantenphysik 2. Elektronische Zustände 3. Aufbau der Materie 4. Elektronen in Kristallen 5. Halbleiter 6. Quantenstatistik 7. Dotierte Halbleiter
Metalle. Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen. Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont
 Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont überarbeitet 2006. Buch. xi, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 540 34010 2 Format (B x L): 15,5
Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont überarbeitet 2006. Buch. xi, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 540 34010 2 Format (B x L): 15,5
Vorlesung Allgemeine Chemie (CH01)
 Vorlesung Allgemeine Chemie (CH01) Für Studierende im B.Sc.-Studiengang Chemie Prof. Dr. Martin Köckerling Arbeitsgruppe Anorganische Festkörperchemie Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut
Vorlesung Allgemeine Chemie (CH01) Für Studierende im B.Sc.-Studiengang Chemie Prof. Dr. Martin Köckerling Arbeitsgruppe Anorganische Festkörperchemie Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut
1. Einleitung Werkstoffkundliche Grundlagen 17
 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 13. 1.1. Gegenstand der Werkstoffkunde 13 1.2. Einteilung der Werkstoffkunde 14 1.3. Technische und ökonomische Bedeutung der Werkstoffkunde.. 15. Aufgaben 1.1 bis 1.6
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 13. 1.1. Gegenstand der Werkstoffkunde 13 1.2. Einteilung der Werkstoffkunde 14 1.3. Technische und ökonomische Bedeutung der Werkstoffkunde.. 15. Aufgaben 1.1 bis 1.6
J. A. A. KETELAAR. Chemische Konstitution
 J. A. A. KETELAAR Chemische Konstitution J. A. A. K ETELAAR Chemische Konstitution Eine Einführung in die Theorie der chemischen Bindung Mit 35 Bildern SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH 1964 Autorisierte
J. A. A. KETELAAR Chemische Konstitution J. A. A. K ETELAAR Chemische Konstitution Eine Einführung in die Theorie der chemischen Bindung Mit 35 Bildern SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH 1964 Autorisierte
Atomaufbau. Elektronen e (-) Atomhülle
 Atomaufbau Institut für Elementarteilchen Nukleonen Protonen p (+) Neutronen n (o) Elektronen e (-) Atomkern Atomhülle Atom WIBA-NET 2005 Prof. Setzer 1 Elementarteilchen Institut für Name Symbol Masse
Atomaufbau Institut für Elementarteilchen Nukleonen Protonen p (+) Neutronen n (o) Elektronen e (-) Atomkern Atomhülle Atom WIBA-NET 2005 Prof. Setzer 1 Elementarteilchen Institut für Name Symbol Masse
HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII
 Prof. Dr. F. Koch Dr. H. E. Porteanu fkoch@ph.tum.de porteanu@ph.tum.de SS 2005 HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII 19.05.05 Festkörperphysik - Kristalle Nach unserem kurzen Ausflug in die Molekülphysik
Prof. Dr. F. Koch Dr. H. E. Porteanu fkoch@ph.tum.de porteanu@ph.tum.de SS 2005 HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII 19.05.05 Festkörperphysik - Kristalle Nach unserem kurzen Ausflug in die Molekülphysik
Gerd Czycholl. Theoretische Festkörperphysik Band 1. Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage
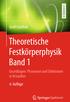 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage Theoretische Festkörperphysik Band 1 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen
Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage Theoretische Festkörperphysik Band 1 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen
Kristallstruktur der Metalle
 Bedeutung Metallische Werkstoffe sind in der Regel kristallin aufgebaut. Die vorliegende Kristallstruktur hat einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften des Werkstoffs, wie z.b. die Festigkeit, Verformbarkeit,
Bedeutung Metallische Werkstoffe sind in der Regel kristallin aufgebaut. Die vorliegende Kristallstruktur hat einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften des Werkstoffs, wie z.b. die Festigkeit, Verformbarkeit,
Grundtypen der Bindung. Grundtypen chemischer Bindung. Oktettregel. A.8.1. Atombindung
 Grundtypen der Bindung Grundtypen chemischer Bindung Oktettregel A.8.1. Atombindung 1 A.8.1 Atombindung Valenz (Zahl der Bindungen) Atombindung auch: kovalente Bindung, ElektronenpaarBindung Zwei Atome
Grundtypen der Bindung Grundtypen chemischer Bindung Oktettregel A.8.1. Atombindung 1 A.8.1 Atombindung Valenz (Zahl der Bindungen) Atombindung auch: kovalente Bindung, ElektronenpaarBindung Zwei Atome
Werkstoffe der Elektrotechnik im Studiengang Elektrotechnik
 Werkstoffe der Elektrotechnik im Studiengang Elektrotechnik - Festkörper - Prof. Dr. Ulrich Hahn WS 2008/2009 Grundtypen Gläser, amorphe Festkörper Nahordnung der Teilchen 5 10 Atom- unterkühlte Flüssigkeiten
Werkstoffe der Elektrotechnik im Studiengang Elektrotechnik - Festkörper - Prof. Dr. Ulrich Hahn WS 2008/2009 Grundtypen Gläser, amorphe Festkörper Nahordnung der Teilchen 5 10 Atom- unterkühlte Flüssigkeiten
1.1 Gegenstand der Technischen Mechanik Lernziele und Lernmethoden... 9
 3 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Technische Mechanik 1 Einführung 1.1 Gegenstand der Technischen Mechanik... 8 1.2 Lernziele und Lernmethoden... 9 2 Winkel und Winkelfunktionen 2.1 Winkel und Winkelmaße...
3 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Technische Mechanik 1 Einführung 1.1 Gegenstand der Technischen Mechanik... 8 1.2 Lernziele und Lernmethoden... 9 2 Winkel und Winkelfunktionen 2.1 Winkel und Winkelmaße...
Bohrsches Atommodell
 Atome und ihre Bindungen Atomaufbau Im Atomkern befinden sich die Protonen (positiv geladen) und die Neutronen (neutral). P und N sind ungefähr gleich schwer und machen 99% der Atommasse aus. Um den Kern
Atome und ihre Bindungen Atomaufbau Im Atomkern befinden sich die Protonen (positiv geladen) und die Neutronen (neutral). P und N sind ungefähr gleich schwer und machen 99% der Atommasse aus. Um den Kern
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Atome und Bindungen. Was sollen Sie mitnehmen?
 Was sollen Sie mitnehmen? Elementare Grundlagen: Atome und Bindungen Schalenmodell Orbitalmodell Periodensystem der Elemente Typische Eigenschaften der Elemente Die vier Bindungstypen Kovalente Bindung
Was sollen Sie mitnehmen? Elementare Grundlagen: Atome und Bindungen Schalenmodell Orbitalmodell Periodensystem der Elemente Typische Eigenschaften der Elemente Die vier Bindungstypen Kovalente Bindung
Vorlesung Anorganische Chemie
 Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Lernziele Block 4 Molekülstruktur Ausnahmen von der Oktettregel Hypervalente Verbindungen VSEPR Hybridisierung Molekülorbitale
Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Lernziele Block 4 Molekülstruktur Ausnahmen von der Oktettregel Hypervalente Verbindungen VSEPR Hybridisierung Molekülorbitale
Kristalle und deren Fehler Was sollen Sie mitnehmen? ...Weihnachten...!
 Kristalle und deren Fehler Was sollen Sie mitnehmen? Definition und Aufbau eines Kristalls Elementarzellen Typische Gitter nach Verbindungsklassen Navigation im Kristall: Richtung, Ebenen Allotropie Fehlertypen
Kristalle und deren Fehler Was sollen Sie mitnehmen? Definition und Aufbau eines Kristalls Elementarzellen Typische Gitter nach Verbindungsklassen Navigation im Kristall: Richtung, Ebenen Allotropie Fehlertypen
Atome und Bindungen. Was sollen Sie mitnehmen?
 Was sollen Sie mitnehmen? Elementare Grundlagen: Atome und Bindungen Schalenmodell Orbitalmodell Periodensystem der Elemente Typische Eigenschaften der Elemente Die vier Bindungstypen Kovalente Bindung
Was sollen Sie mitnehmen? Elementare Grundlagen: Atome und Bindungen Schalenmodell Orbitalmodell Periodensystem der Elemente Typische Eigenschaften der Elemente Die vier Bindungstypen Kovalente Bindung
Grundlagen der Chemie
 1 Die Metallbindung Hartstoffe 75% aller chemischen Elemente sind. Typische Eigenschaften: 1. Die Absorption für sichtbares Licht ist hoch. Hieraus folgt das große Spiegelreflexionsvermögen. Das ist die
1 Die Metallbindung Hartstoffe 75% aller chemischen Elemente sind. Typische Eigenschaften: 1. Die Absorption für sichtbares Licht ist hoch. Hieraus folgt das große Spiegelreflexionsvermögen. Das ist die
Werkstoffkunde Chemische Bindungsarten
 Folie 1/27 Die Elektronen auf der äußersten Schale eines Atoms (Außenelektronen oder Valenzelektronen genannt) bestimmen maßgeblich die chemischen Eigenschaften. Jedes Atom hat dabei das Bestreben die
Folie 1/27 Die Elektronen auf der äußersten Schale eines Atoms (Außenelektronen oder Valenzelektronen genannt) bestimmen maßgeblich die chemischen Eigenschaften. Jedes Atom hat dabei das Bestreben die
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome. Chemische Reaktionen. Verbindungen
 Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 284 4. Chemische Reaktionen 4.1. Allgemeine Grundlagen (Wiederholung) 4.2. Energieumsätze chemischer
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 284 4. Chemische Reaktionen 4.1. Allgemeine Grundlagen (Wiederholung) 4.2. Energieumsätze chemischer
Welche beiden Metalle prägten eine Epoche?
 Posten 1a Welche beiden Metalle prägten eine Epoche? a) Silber / Gold (=> Posten 2a) b) Bronze / Eisen (=> Posten 3d) c) Eisen / Gold (=> Posten 4j) d) Silber / Bronze (=> Posten 5s) Posten 2d Welcher
Posten 1a Welche beiden Metalle prägten eine Epoche? a) Silber / Gold (=> Posten 2a) b) Bronze / Eisen (=> Posten 3d) c) Eisen / Gold (=> Posten 4j) d) Silber / Bronze (=> Posten 5s) Posten 2d Welcher
Grundwissen Chemie 8. Klasse NTG
 Grundwissen Chemie 8. Klasse NTG Reinstoff hat gleich bleibende Eigenschaften (Stoffebene) besteht aus einer Sorte gleichartiger Teilchen z.b.: dest. Wasser, Kupfer, Gold, Salz 8.1 C NTG Element sind nicht
Grundwissen Chemie 8. Klasse NTG Reinstoff hat gleich bleibende Eigenschaften (Stoffebene) besteht aus einer Sorte gleichartiger Teilchen z.b.: dest. Wasser, Kupfer, Gold, Salz 8.1 C NTG Element sind nicht
Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf. Grundwissen Chemie. 8. Jahrgangsstufe
 Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf Grundwissen Chemie 8. Jahrgangsstufe Teilchenmodell und Stoffeigenschaften Teilchenmodell: Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, vereinfacht dargestellt als Kugeln.
Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf Grundwissen Chemie 8. Jahrgangsstufe Teilchenmodell und Stoffeigenschaften Teilchenmodell: Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, vereinfacht dargestellt als Kugeln.
Freiwillige Übungsaufgaben zum Stoff vorangegangener Vorlesungen zur Selbstkontrolle für den 2. April 2008 (wird nicht bewertet)
 AC II - 2. April 2008 Übungen Anke Zürn Zusammenfassung & Wiederholung Dichteste Kugelpackungen (KP) Freiwillige Übungsaufgaben zum Stoff vorangegangener Vorlesungen zur Selbstkontrolle für den 2. April
AC II - 2. April 2008 Übungen Anke Zürn Zusammenfassung & Wiederholung Dichteste Kugelpackungen (KP) Freiwillige Übungsaufgaben zum Stoff vorangegangener Vorlesungen zur Selbstkontrolle für den 2. April
Kompendium der allgemeinen und anorganischen Chemie
 Kompendium der allgemeinen und anorganischen Chemie Von Dr. rer. nat. habil. Peter Hermann Wissenschaftlicher Oberassistent am Physiologisch-Chemischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Kompendium der allgemeinen und anorganischen Chemie Von Dr. rer. nat. habil. Peter Hermann Wissenschaftlicher Oberassistent am Physiologisch-Chemischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Vorkurs Allgemeine Chemie für Ingenieure und Biologen 20. Oktober 2015 Dr. Helmut Sitzmann, Apl.-Professor für Anorganische Chemie
 Vorkurs Allgemeine Chemie für Ingenieure und Biologen 20. Oktober 2015 Dr. Helmut Sitzmann, Apl.-Professor für Anorganische Chemie DIE CHEMISCHE BINDUNG Ionische Bindung, Beispiel Natriumchlorid Trifft
Vorkurs Allgemeine Chemie für Ingenieure und Biologen 20. Oktober 2015 Dr. Helmut Sitzmann, Apl.-Professor für Anorganische Chemie DIE CHEMISCHE BINDUNG Ionische Bindung, Beispiel Natriumchlorid Trifft
Grundlagen-Vertiefung PW3. Kristalle und Kristallstrukturen Version von 15. Oktober 2013
 Grundlagen-Vertiefung PW3 Kristalle und Kristallstrukturen Version von 15. Oktober 2013 Kristalle besitzen einen geordneten und periodischen Gitteraufbau. Die überwiegende Mehrzahl der anorganischen Festkörper
Grundlagen-Vertiefung PW3 Kristalle und Kristallstrukturen Version von 15. Oktober 2013 Kristalle besitzen einen geordneten und periodischen Gitteraufbau. Die überwiegende Mehrzahl der anorganischen Festkörper
Periodensystem der Elemente - PSE
 Periodensystem der Elemente - PSE Historische Entwicklung Möglichkeiten der Reindarstellung seit 18. Jhdt. wissenschaftliche Beschreibung der Elemente 1817 Johann Wolfgang Döbereiner: ähnliche Elemente
Periodensystem der Elemente - PSE Historische Entwicklung Möglichkeiten der Reindarstellung seit 18. Jhdt. wissenschaftliche Beschreibung der Elemente 1817 Johann Wolfgang Döbereiner: ähnliche Elemente
Die Stoffteilchen (II): Ionengruppen und ihre Ionen
 Die Stoffteilchen (II): Ionengruppen und ihre Ionen Ionen sind die Bausteine der Ionengruppen, den gedachten Stoffteilchen der Salze. Was haben Ionengruppen mit der Formel von Salzen zu tun? DARUM GEHT
Die Stoffteilchen (II): Ionengruppen und ihre Ionen Ionen sind die Bausteine der Ionengruppen, den gedachten Stoffteilchen der Salze. Was haben Ionengruppen mit der Formel von Salzen zu tun? DARUM GEHT
Konzepte der anorganischen und analytischen Chemie II II
 Konzepte der anorganischen und analytischen Chemie II II Marc H. Prosenc Inst. für Anorganische und Angewandte Chemie Tel: 42838-3102 prosenc@chemie.uni-hamburg.de Outline Einführung in die Chemie fester
Konzepte der anorganischen und analytischen Chemie II II Marc H. Prosenc Inst. für Anorganische und Angewandte Chemie Tel: 42838-3102 prosenc@chemie.uni-hamburg.de Outline Einführung in die Chemie fester
Anorganische Chemie III
 Seminar zu Vorlesung Anorganische Chemie III Wintersemester 2013/14 Christoph Wölper Universität Duisburg-Essen # Elektronengas # Bändermodell Bindungsmodelle Metallbindung > Bindungsmodelle Elektronengas
Seminar zu Vorlesung Anorganische Chemie III Wintersemester 2013/14 Christoph Wölper Universität Duisburg-Essen # Elektronengas # Bändermodell Bindungsmodelle Metallbindung > Bindungsmodelle Elektronengas
0.6 Einfache Modelle der chemischen Bindung
 0.6 Einfache Modelle der chemischen Bindung Ionenbindung Ionenbindungen entstehen durch Reaktion von ausgeprägt metallischen Elementen (Alkalimetalle und Erdalkalimetalle mit geringer Ionisierungsenergie)
0.6 Einfache Modelle der chemischen Bindung Ionenbindung Ionenbindungen entstehen durch Reaktion von ausgeprägt metallischen Elementen (Alkalimetalle und Erdalkalimetalle mit geringer Ionisierungsenergie)
Aufgabensammlung Fertigungstechnik
 Aufgabensammlung Fertigungstechnik Ulrich Wojahn Aufgabensammlung Fertigungstechnik Mit ausführlichen Lösungswegen und Formelsammlung 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von Thomas
Aufgabensammlung Fertigungstechnik Ulrich Wojahn Aufgabensammlung Fertigungstechnik Mit ausführlichen Lösungswegen und Formelsammlung 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von Thomas
Bau der Metalle Eigenschaften plastisch verformbar elektrisch leitfähig hohe Siede- und Schmelztemperaturen
 Metallbindungen Bau der Metalle bestehen aus positiv geladene Atomrümpfe (= Atomkern und alle Elektrone auβer den Vallenzelektronen) + frei beweglichen Auβenelektronen Atomrümpfe sind sehr fest angeordnet
Metallbindungen Bau der Metalle bestehen aus positiv geladene Atomrümpfe (= Atomkern und alle Elektrone auβer den Vallenzelektronen) + frei beweglichen Auβenelektronen Atomrümpfe sind sehr fest angeordnet
Oktett-Theorie von Lewis
 Oktett-Theorie von Lewis Oktettregel Atome versuchen durch die Nutzung gemeinsamer Elektronenpaare möglichst ein Elektronenoktett zu erlangen. allgemeiner: Edelgasregel Atome streben durch Vereinigung
Oktett-Theorie von Lewis Oktettregel Atome versuchen durch die Nutzung gemeinsamer Elektronenpaare möglichst ein Elektronenoktett zu erlangen. allgemeiner: Edelgasregel Atome streben durch Vereinigung
Kristallstruktur 1 Tetraederwinkel Die Millerschen Indizes Die hcp-struktur Bravais-Gitter 3
 In ha Itsverzeichn is Vorwort V 1 ALl Al.2 A1.3 Al.4 Al.5 Al.6 Al.7 Al.8 Kristallstruktur 1 Tetraederwinkel.............................................................. 1 Die Millerschen Indizes......................................................
In ha Itsverzeichn is Vorwort V 1 ALl Al.2 A1.3 Al.4 Al.5 Al.6 Al.7 Al.8 Kristallstruktur 1 Tetraederwinkel.............................................................. 1 Die Millerschen Indizes......................................................
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Gitterpunkte, Gittergeraden, Gitterebenen, Weiß'sche Koeffizienten, Miller Indizes Symmetrie in Festkörpern, Symmetrieelemente, Symmetrieoperationen, Punktgruppenymmetrie,
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Gitterpunkte, Gittergeraden, Gitterebenen, Weiß'sche Koeffizienten, Miller Indizes Symmetrie in Festkörpern, Symmetrieelemente, Symmetrieoperationen, Punktgruppenymmetrie,
Eine Einführung in die Organische Chemie
 Kapitel 10 Eine Einführung in die Organische Chemie Abb. 10.1: Das erste e Molekül. Seit der Begründung der Naturwissenschaft Chemie haben die Stoffe der belebten Natur, von Organismen, einen besonderen
Kapitel 10 Eine Einführung in die Organische Chemie Abb. 10.1: Das erste e Molekül. Seit der Begründung der Naturwissenschaft Chemie haben die Stoffe der belebten Natur, von Organismen, einen besonderen
Grundwissen Chemie 9. Jahrgangsstufe
 Grundwissen Chemie 9. Jahrgangsstufe 1. Stoffe und Reaktionen Gemisch: Stoff, der aus mindestens zwei Reinstoffen besteht. Homogen: einzelne Bestandteile nicht erkennbar Gasgemisch z.b. Legierung Reinstoff
Grundwissen Chemie 9. Jahrgangsstufe 1. Stoffe und Reaktionen Gemisch: Stoff, der aus mindestens zwei Reinstoffen besteht. Homogen: einzelne Bestandteile nicht erkennbar Gasgemisch z.b. Legierung Reinstoff
Anorganische Chemie! der unbelebten Natur keine Kohlenstoffverbindung (Kohlenstoffatome C) Metall Nichtmetallverbindungen Ionenbindung
 3 Chemie / Physik 3.1 Eigenheiten der Chemie und Physik Chemie ist die Lehre von den Stoffen, ihrer Zusammensetzung, dem Aufbau, der Struktur und ihrer Umwandlung Die Chemie untersucht und beschreibt die
3 Chemie / Physik 3.1 Eigenheiten der Chemie und Physik Chemie ist die Lehre von den Stoffen, ihrer Zusammensetzung, dem Aufbau, der Struktur und ihrer Umwandlung Die Chemie untersucht und beschreibt die
Vom Atombau zum Königreich der Elemente
 Vom Atombau zum Königreich der Elemente Wiederholung: Elektronenwellenfunktionen (Orbitale) Jedes Orbital kann durch einen Satz von Quantenzahlen n, l, m charakterisiert werden Jedes Orbital kann maximal
Vom Atombau zum Königreich der Elemente Wiederholung: Elektronenwellenfunktionen (Orbitale) Jedes Orbital kann durch einen Satz von Quantenzahlen n, l, m charakterisiert werden Jedes Orbital kann maximal
Grundwissen 9.Klasse SG 1 Grundwissen 9.Klasse SG 1. Grundwissen 9.Klasse SG 2 Grundwissen 9.Klasse SG 2. Stoffebene.
 Grundwissen 9.Klasse SG 1 Grundwissen 9.Klasse SG 1 Stoff Reinstoff mischen Gemisch Einteilung der Stoffe Bei gleichen Bedingungen (Temp., Druck) immer gleiche Eigenschaften (z.b. Schmelz- /Siedetemp.,
Grundwissen 9.Klasse SG 1 Grundwissen 9.Klasse SG 1 Stoff Reinstoff mischen Gemisch Einteilung der Stoffe Bei gleichen Bedingungen (Temp., Druck) immer gleiche Eigenschaften (z.b. Schmelz- /Siedetemp.,
Festkörperphysik. Einführung in die Grundlagen. 4y Springer. Siebte Auflage mit 277 Abbildungen, 18 Tafeln und 104 Übungen
 Harald Ibach Hans Lüth Festkörperphysik Einführung in die Grundlagen Siebte Auflage mit 277 Abbildungen, 18 Tafeln und 104 Übungen r ^ 4y Springer Inhaltsverzeichnis 1. Die chemische Bindung in Festkörpern
Harald Ibach Hans Lüth Festkörperphysik Einführung in die Grundlagen Siebte Auflage mit 277 Abbildungen, 18 Tafeln und 104 Übungen r ^ 4y Springer Inhaltsverzeichnis 1. Die chemische Bindung in Festkörpern
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium. 9. Klasse. Chemie SG
 Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 9. Klasse Chemie SG Es sind insgesamt 18 Karten für die 9. Klasse erarbeitet. Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 9. Klasse Chemie SG Es sind insgesamt 18 Karten für die 9. Klasse erarbeitet. Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Empfohlene Hilfsmittel zum Lösen der Arbeitsaufträge: Arbeitsblätter, Theorieblätter, Fachbuch, Tabellenbuch und Ihr Wissen aus dem Praxisalltag
 2.1.1 Aufbau der Materie (Arbeitsaufträge) Empfohlene Hilfsmittel zum Lösen der Arbeitsaufträge: Arbeitsblätter, Theorieblätter, Fachbuch, Tabellenbuch und Ihr Wissen aus dem Praxisalltag 1. Beim Bearbeiten
2.1.1 Aufbau der Materie (Arbeitsaufträge) Empfohlene Hilfsmittel zum Lösen der Arbeitsaufträge: Arbeitsblätter, Theorieblätter, Fachbuch, Tabellenbuch und Ihr Wissen aus dem Praxisalltag 1. Beim Bearbeiten
Festkörperphysik. Aufgaben und Lösun
 Festkörperphysik. Aufgaben und Lösun von Prof. Dr. Rudolf Gross Dr. Achim Marx Priv.-Doz. Dr. Dietrich Einzel Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Kristallstruktur 1 ALI Tetraederwinkel
Festkörperphysik. Aufgaben und Lösun von Prof. Dr. Rudolf Gross Dr. Achim Marx Priv.-Doz. Dr. Dietrich Einzel Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Kristallstruktur 1 ALI Tetraederwinkel
Festkörperphys i. Einführung in die Grundlagen
 Harald Ibach Hans Lüth Festkörperphys i Einführung in die Grundlagen 1. Die chemische Bindung in Festkörpern 1 1.1 Das Periodensystem 1 1.2 Kovalente Bindung 4 1.3 DieIonenbindung 9 1.4 Metallische Bindung
Harald Ibach Hans Lüth Festkörperphys i Einführung in die Grundlagen 1. Die chemische Bindung in Festkörpern 1 1.1 Das Periodensystem 1 1.2 Kovalente Bindung 4 1.3 DieIonenbindung 9 1.4 Metallische Bindung
Repetitionen Chemie und Werkstoffkunde
 BEARBEITUNGSTECHNIK REPETITONEN Kapitel 2 Repetitionen Chemie und Werkstoffkunde Thema 2 Begriffe der Chemie und Werkstoffkunde Verfasser: Hans-Rudolf Niederberger Elektroingenieur FH/HTL Vordergut 1,
BEARBEITUNGSTECHNIK REPETITONEN Kapitel 2 Repetitionen Chemie und Werkstoffkunde Thema 2 Begriffe der Chemie und Werkstoffkunde Verfasser: Hans-Rudolf Niederberger Elektroingenieur FH/HTL Vordergut 1,
[ ] 1. Stoffe und Reaktionen (Kartei 8.8, 8.10 und 8.13) Stoffe + - Moleküle aus gleichen Atomen. Ionen. Moleküle aus verschiedenen Atomen
![[ ] 1. Stoffe und Reaktionen (Kartei 8.8, 8.10 und 8.13) Stoffe + - Moleküle aus gleichen Atomen. Ionen. Moleküle aus verschiedenen Atomen [ ] 1. Stoffe und Reaktionen (Kartei 8.8, 8.10 und 8.13) Stoffe + - Moleküle aus gleichen Atomen. Ionen. Moleküle aus verschiedenen Atomen](/thumbs/68/58264490.jpg) 1. Stoffe und Reaktionen (Kartei 8.8, 8.10 und 8.13) Stoffe Gemische Reinstoffe Elemente Verbindungen gleiche Atome Moleküle aus gleichen Atomen Moleküle aus verschiedenen Atomen Ionen + Kation Anion z.b.
1. Stoffe und Reaktionen (Kartei 8.8, 8.10 und 8.13) Stoffe Gemische Reinstoffe Elemente Verbindungen gleiche Atome Moleküle aus gleichen Atomen Moleküle aus verschiedenen Atomen Ionen + Kation Anion z.b.
Grundwissen C8 NTG. 1. Stoffe und Reaktionen. Reinstoff
 Grundwissen C8 NTG 1. Stoffe und Reaktionen Reinstoff Stoffgemisch - besitzt unter bestimmten Bedingungen (z.b. Temperatur, Druck ) kennzeichnende Eigenschaften, z.b. Farbe, Geruch, Geschmack, Dichte,
Grundwissen C8 NTG 1. Stoffe und Reaktionen Reinstoff Stoffgemisch - besitzt unter bestimmten Bedingungen (z.b. Temperatur, Druck ) kennzeichnende Eigenschaften, z.b. Farbe, Geruch, Geschmack, Dichte,
Vom Atom zum Molekül
 Vom Atom zum Molekül Ionenverbindungen Na + Cl NaCl lebensgefährlich giftig lebensgefährlich giftig lebensessentiell Metall + Nichtmetall Salz Beispiel Natriumchlorid Elektronenkonfiguration: 11Na: 1s(2)
Vom Atom zum Molekül Ionenverbindungen Na + Cl NaCl lebensgefährlich giftig lebensgefährlich giftig lebensessentiell Metall + Nichtmetall Salz Beispiel Natriumchlorid Elektronenkonfiguration: 11Na: 1s(2)
II Werkstofftechnik. A Innerer Aufbau der Metalle
 -II.A1- A Innerer Aufbau der Metalle In natürlicher Größe erscheinen die Metalle als einheitlicher Stoff ohne Untergliederung. Betrachtet man die angeätzte Oberfläche eines Metalls rund 10000fach vergrößert,
-II.A1- A Innerer Aufbau der Metalle In natürlicher Größe erscheinen die Metalle als einheitlicher Stoff ohne Untergliederung. Betrachtet man die angeätzte Oberfläche eines Metalls rund 10000fach vergrößert,
Einführung in die Kristallographie
 WILL KLEBER Einführung in die Kristallographie 18., stark bearbeitete Auflage von Hans-Joachim Bautsch und Joachim Böhm Verlag Technik Berlin Inhaltsverzeichnis Einleitung 11 1. Kristallstrukturlehre und
WILL KLEBER Einführung in die Kristallographie 18., stark bearbeitete Auflage von Hans-Joachim Bautsch und Joachim Böhm Verlag Technik Berlin Inhaltsverzeichnis Einleitung 11 1. Kristallstrukturlehre und
1 Aufbau der Materie. 1.1 Anfänge und Kernhüllenmodell. Bauchemie / Bauphysik II Modul M-T 6
 1 Aufbau der Materie 1.1 Anfänge und Kernhüllenmodell 400 J. v. Chr. suchte Demokrit als erster die kleinsten Teile der Materie. Und weil auch er diese damals nicht sehen konnte, entwickelte er eine Modellvorstellung
1 Aufbau der Materie 1.1 Anfänge und Kernhüllenmodell 400 J. v. Chr. suchte Demokrit als erster die kleinsten Teile der Materie. Und weil auch er diese damals nicht sehen konnte, entwickelte er eine Modellvorstellung
Funktionswerkstoffe. supraleitend. Halbleiter. Elektronische Eigenschaften - Einleitung
 Funktionswerkstoffe Elektronische Eigenschaften - Einleitung Bandstruktur Elektronenverteilung (Fermi-Dirac) Elektronenbeweglichkeit und Leitfähigkeit Metalle Elektronenanregung Leitfähigkeitsänderungen
Funktionswerkstoffe Elektronische Eigenschaften - Einleitung Bandstruktur Elektronenverteilung (Fermi-Dirac) Elektronenbeweglichkeit und Leitfähigkeit Metalle Elektronenanregung Leitfähigkeitsänderungen
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde:
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Hybridisierung und Molekülstruktur, sp 3 -Hybridorbitale (Tetraeder), sp 2 - Hybridorbitale (trigonal planare Anordnung), sp-hybridorbitale (lineare Anordnung),
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Hybridisierung und Molekülstruktur, sp 3 -Hybridorbitale (Tetraeder), sp 2 - Hybridorbitale (trigonal planare Anordnung), sp-hybridorbitale (lineare Anordnung),
Inhaltsverzeichnis. 1 Allgemeine Chemie VII. Vorwort Grundbegriffe, Grundgesetze... 3 Chemische Reaktionen... 3
 VII Vorwort... V 1 Allgemeine Chemie 1.0 Grundbegriffe, Grundgesetze... 3 Chemische Reaktionen... 3 1.1 Atombau... 4 1.1.1 Aufbau der Atome... 4 1.1.2 Isotope... 10 1.1.3 Radioaktiver Zerfall... 14 1.1.4
VII Vorwort... V 1 Allgemeine Chemie 1.0 Grundbegriffe, Grundgesetze... 3 Chemische Reaktionen... 3 1.1 Atombau... 4 1.1.1 Aufbau der Atome... 4 1.1.2 Isotope... 10 1.1.3 Radioaktiver Zerfall... 14 1.1.4
Definiere den Begriff Chemischer Vorgang! Definiere den Begriff Physikalischer Vorgang!
 Chemischer Vorgang! Stoffänderung, keine Zustandsänderung, mit Energiebeteiligung Physikalischer Vorgang! Zustandsänderung, keine Stoffänderung (z.b. Lösen, Aggregatzustände,...) Erkläre die Begriffe heterogenes
Chemischer Vorgang! Stoffänderung, keine Zustandsänderung, mit Energiebeteiligung Physikalischer Vorgang! Zustandsänderung, keine Stoffänderung (z.b. Lösen, Aggregatzustände,...) Erkläre die Begriffe heterogenes
Kristalle und deren Fehler Was sollen Sie mitnehmen? ...Weihnachten...!
 Kristalle und deren Fehler Was sollen Sie mitnehmen? Definition und Aufbau eines Kristalls Elementarzellen Typische Gitter nach Verbindungsklassen Navigation im Kristall: Richtung, Ebenen Allotropie Fehlertypen
Kristalle und deren Fehler Was sollen Sie mitnehmen? Definition und Aufbau eines Kristalls Elementarzellen Typische Gitter nach Verbindungsklassen Navigation im Kristall: Richtung, Ebenen Allotropie Fehlertypen
Grundwissen 8.Klasse 1 Grundwissen 8.Klasse 1. Grundwissen 8.Klasse 2 Grundwissen 8.Klasse 2. Stoffebene. Teilchen -ebene
 Grundwissen 8.Klasse 1 Grundwissen 8.Klasse 1 Stoff Reinstoff mischen Gemisch Einteilung der Stoffe Bei gleichen Bedingungen (Temp., Druck) immer gleiche Eigenschaften (z.b. Schmelz- /Siedetemp., Löslichkeit,
Grundwissen 8.Klasse 1 Grundwissen 8.Klasse 1 Stoff Reinstoff mischen Gemisch Einteilung der Stoffe Bei gleichen Bedingungen (Temp., Druck) immer gleiche Eigenschaften (z.b. Schmelz- /Siedetemp., Löslichkeit,
Modul: Allgemeine Chemie
 Modul: Allgemeine Chemie 5. Grundlagen der chemischen Bindung Ionenbindung Eigenschaften, Ionengitter, Kugelpackung Strukturtypen, Kreisprozesse Kovalente Bindung Lewis Formeln, Oktettregel, Formalladungen
Modul: Allgemeine Chemie 5. Grundlagen der chemischen Bindung Ionenbindung Eigenschaften, Ionengitter, Kugelpackung Strukturtypen, Kreisprozesse Kovalente Bindung Lewis Formeln, Oktettregel, Formalladungen
Elektrische und magnetische Materialeigenschaften
 Die elektrischen Eigenschaften von Dielektrika und Paraelektrika sind keine speziellen Eigenschaften fester oder kristalliner Substanzen. So sind diese Eigenschaften z.b. auch in Molekülen und Flüssigkeiten
Die elektrischen Eigenschaften von Dielektrika und Paraelektrika sind keine speziellen Eigenschaften fester oder kristalliner Substanzen. So sind diese Eigenschaften z.b. auch in Molekülen und Flüssigkeiten
Werkstoffkunde 1. Wo find ich was? Erstellt am 30. Dezember 2004
 Werkstoffkunde 1 Dozent Autor / Student U. Ritter A. Höller Erstellt am 30. Dezember 2004 Wo find ich was? STRUKTURELLER AUFBAU DER MATERIE 2 ALLGEMEINER AUFBAU DER WERKSTOFFE 2 Hauptvalenzbindungen 2
Werkstoffkunde 1 Dozent Autor / Student U. Ritter A. Höller Erstellt am 30. Dezember 2004 Wo find ich was? STRUKTURELLER AUFBAU DER MATERIE 2 ALLGEMEINER AUFBAU DER WERKSTOFFE 2 Hauptvalenzbindungen 2
Die Stoffteilchen (II): Ionengruppen und ihre Ionen
 Die Stoffteilchen (II): Ionengruppen und ihre Ionen Ionen sind die Bausteine der Ionengruppen, den gedachten Stoffteilchen der Salze. Was haben Ionengruppen mit der Formel von Salzen zu tun? DARUM GEHT
Die Stoffteilchen (II): Ionengruppen und ihre Ionen Ionen sind die Bausteine der Ionengruppen, den gedachten Stoffteilchen der Salze. Was haben Ionengruppen mit der Formel von Salzen zu tun? DARUM GEHT
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN
 ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung des Wissens allgemeiner chemischen Grundlagen und Vorstellungen, die für alle Bereiche der Naturwissenschaften notwendig sind; Modellvorstellungen
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung des Wissens allgemeiner chemischen Grundlagen und Vorstellungen, die für alle Bereiche der Naturwissenschaften notwendig sind; Modellvorstellungen
Festkörperchemie SYNTHESE. Shake and bake Methode: Sol-Gel-Methode. Am Beispiel :
 Festkörperchemie SYNTHESE Shake and bake Methode: Am Beispiel : Man zerkleinert die Salze mechanisch, damit eine möglichst große Grenzfläche zwischen den beiden Komponenten entsteht und vermischt das ganze.
Festkörperchemie SYNTHESE Shake and bake Methode: Am Beispiel : Man zerkleinert die Salze mechanisch, damit eine möglichst große Grenzfläche zwischen den beiden Komponenten entsteht und vermischt das ganze.
Sandor Vajna Reinhard Ledderbogen. CATIAV5 - kurz und bündig
 Sandor Vajna Reinhard Ledderbogen CATIAV5 - kurz und bündig Aus dem Programm Maschinenelemente und Konstruktion Lehrwerk RolofffMatek Maschinenelemente von D. Muhs, H. Wittel, D. Jannasch, M. Becker und
Sandor Vajna Reinhard Ledderbogen CATIAV5 - kurz und bündig Aus dem Programm Maschinenelemente und Konstruktion Lehrwerk RolofffMatek Maschinenelemente von D. Muhs, H. Wittel, D. Jannasch, M. Becker und
Vieweg Programmbibliothek Mikrocomputer 39. Simulationen in BASIC mit dem IBM PC, XT, AT
 Vieweg Programmbibliothek Mikrocomputer 39 Simulationen in BASIC mit dem IBM PC, XT, AT Aus dem Programm,----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mikrocomputer Angewandte Matrizenrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung
Vieweg Programmbibliothek Mikrocomputer 39 Simulationen in BASIC mit dem IBM PC, XT, AT Aus dem Programm,----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mikrocomputer Angewandte Matrizenrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung
Unterschied zwischen Physik und Chemie:
 Unterschied zwischen Physik und Chemie: Der Begriff Physik bezeichnet die Lehre über Zustände und Zustandsänderungen die Chemie hingegen beschäftigt sich mit Stoffen und stofflichen Veränderungen. Unterteilung
Unterschied zwischen Physik und Chemie: Der Begriff Physik bezeichnet die Lehre über Zustände und Zustandsänderungen die Chemie hingegen beschäftigt sich mit Stoffen und stofflichen Veränderungen. Unterteilung
Zeichnen von Valenzstrichformeln
 Zeichnen von Valenzstrichformeln ür anorganische Salze werden keine Valenzstrichformeln gezeichnet, da hier eine ionische Bindung vorliegt. Die Elektronen werden vollständig übertragen und die Ionen bilden
Zeichnen von Valenzstrichformeln ür anorganische Salze werden keine Valenzstrichformeln gezeichnet, da hier eine ionische Bindung vorliegt. Die Elektronen werden vollständig übertragen und die Ionen bilden
Mechanisch-thermische. Materialeigenschaften VL # 2
 Mechanisch-thermische Materialeigenschaften VL # 2 Vladimir Dyakonov dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de Experimental Physics VI, Julius-Maximilians-University of Würzburg und Bayerisches Zentrum für Angewandte
Mechanisch-thermische Materialeigenschaften VL # 2 Vladimir Dyakonov dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de Experimental Physics VI, Julius-Maximilians-University of Würzburg und Bayerisches Zentrum für Angewandte
2.3 Intermolekulare Anziehungskräfte und Molekülkristalle
 2.3 Intermolekulare Anziehungskräfte und Molekülkristalle Kinetische Energie der Moleküle / Aggregatzustand Bau und Struktur der Moleküle Intermolekulare Anziehungskräfte Kräfte zwischen Molekülen Van-der-Waals-Kräfte
2.3 Intermolekulare Anziehungskräfte und Molekülkristalle Kinetische Energie der Moleküle / Aggregatzustand Bau und Struktur der Moleküle Intermolekulare Anziehungskräfte Kräfte zwischen Molekülen Van-der-Waals-Kräfte
Chemie-Grundwissen der 9.Klasse
 Chemie-Grundwissen der 9.Klasse Stoffebene = Makroskopische (sichtbare) Ebene Betrachtung einer Stoffportion mit den erkennbaren und messbaren Eigenschaften Teilchenebene = Submikroskopische Ebene Betrachtung
Chemie-Grundwissen der 9.Klasse Stoffebene = Makroskopische (sichtbare) Ebene Betrachtung einer Stoffportion mit den erkennbaren und messbaren Eigenschaften Teilchenebene = Submikroskopische Ebene Betrachtung
Inhaltsverzeichnis. 0 Einleitung... 1
 0 Einleitung... 1 1 Periodische Strukturen... 5 1.1 Kristallstruktur, Bravais-Gitter, Wigner-Seitz-Zelle...... 5 1.1.1 Kristallisation von Festkörpern....... 5 1.1.2 Kristall-System und Kristall-Gitter...
0 Einleitung... 1 1 Periodische Strukturen... 5 1.1 Kristallstruktur, Bravais-Gitter, Wigner-Seitz-Zelle...... 5 1.1.1 Kristallisation von Festkörpern....... 5 1.1.2 Kristall-System und Kristall-Gitter...
Materie im Magnetfeld
 . Stromschleifen - Permanentmagnet Materie im Magnetfeld EX-II SS007 = > µmag = I S ˆn S = a b µ bahn = e m L µ spin = e m S Stromschleife im Magnetfeld Magnetisierung inhomogenes Magnetfeld = D = µmag
. Stromschleifen - Permanentmagnet Materie im Magnetfeld EX-II SS007 = > µmag = I S ˆn S = a b µ bahn = e m L µ spin = e m S Stromschleife im Magnetfeld Magnetisierung inhomogenes Magnetfeld = D = µmag
1.8. Aufgaben zur Elektronenpaarbindung
 1.8. Aufgaben zur Elektronenpaarbindung Aufgabe 1: Elektronenpaarbindung a) Welche anderen Bezeichnungen gibt es für die Elektronenpaarbindung? b) Wie erreichen Nichtmetallatome die Edelgaskonfiguration,
1.8. Aufgaben zur Elektronenpaarbindung Aufgabe 1: Elektronenpaarbindung a) Welche anderen Bezeichnungen gibt es für die Elektronenpaarbindung? b) Wie erreichen Nichtmetallatome die Edelgaskonfiguration,
