Dossier zur Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
|
|
|
- Leander Langenberg
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Dokumentvorlage, Version vom Dossier zur Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V Etelcalcetid (Parsabiv ) Amgen GmbH Modul 2 Allgemeine Angaben zum Arzneimittel, zugelassene Anwendungsgebiete Stand:
2 Inhaltsverzeichnis Seite Tabellenverzeichnis... 2 Abbildungsverzeichnis... 3 Abkürzungsverzeichnis Modul 2 allgemeine Informationen Allgemeine Angaben zum Arzneimittel Administrative Angaben zum Arzneimittel Angaben zum Wirkmechanismus des Arzneimittels Zugelassene Anwendungsgebiete Anwendungsgebiete, auf die sich das Dossier bezieht Weitere in Deutschland zugelassene Anwendungsgebiete Beschreibung der Informationsbeschaffung für Modul Referenzliste für Modul
3 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 2-1: Allgemeine Angaben zum zu bewertenden Arzneimittel... 5 Tabelle 2-2: Pharmazentralnummern und Zulassungsnummern für das zu bewertende Arzneimittel... 6 Tabelle 2-3: Unterschiede Etelcalcetid und Cinacalcet im Überblick Tabelle 2-4: Zugelassene Anwendungsgebiete, auf die sich das Dossier bezieht Tabelle 2-5: Weitere in Deutschland zugelassene Anwendungsgebiete des zu bewertenden Arzneimittels Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 2 von 19
4 Abbildungsverzeichnis Seite Abbildung 1: Regelkreis der Calcium-Phosphat-Homöostase... 8 Abbildung 2: Wirkweisen der aktuell verfügbaren Therapieoptionen bei der Behandlung des shpts Abbildung 3: Schematische Darstellung zum Wirkmechanismus von Etelcalcetid in den Zellen der Nebenschilddrüsen Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 3 von 19
5 Abkürzungsverzeichnis Abkürzung Bedeutung ATC-Code Anatomisch-Therapeutisch-Chemischer Code Ca Calcium CaSR Calciumsensitiver Rezeptor (calcium sensing receptor) cca x P Calcium-Phosphat-Produkt CKD Chronische Nierenerkrankung (chronic kidney disease) CYP Cytochrom P450 EMA European Medicines Agency (Europäische Zulassungsagentur) EPAR European Public Assessment Report FGF-23 Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 (fibroblast growth factor 23) G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss GFR Glomeruläre Filtrationsrate i.v. Intravenös KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes P Phosphat PTH Parathormon PZN Pharmazentralnummer shpt Sekundärer Hyperparathyreoidismus zvt Zweckmäßige Vergleichstherapie Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 4 von 19
6 2 Modul 2 allgemeine Informationen Modul 2 enthält folgende Informationen: Allgemeine Angaben über das zu bewertende Arzneimittel (Abschnitt 2.1) Beschreibung der Anwendungsgebiete, für die das zu bewertende Arzneimittel zugelassen wurde (Abschnitt 2.2); dabei wird zwischen den Anwendungsgebieten, auf die sich das Dossier bezieht, und weiteren in Deutschland zugelassenen Anwendungsgebieten unterschieden. Alle in den Abschnitten 2.1 und 2.2 getroffenen Aussagen sind zu begründen. Die Quellen (z. B. Publikationen), die für die Aussagen herangezogen werden, sind in Abschnitt 2.4 (Referenzliste) eindeutig zu benennen. Das Vorgehen zur Identifikation der Quellen ist im Abschnitt 2.3 (Beschreibung der Informationsbeschaffung) darzustellen. Im Dokument verwendete Abkürzungen sind in das Abkürzungsverzeichnis aufzunehmen. Sofern Sie für Ihre Ausführungen Tabellen oder Abbildungen verwenden, sind diese im Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis aufzuführen. 2.1 Allgemeine Angaben zum Arzneimittel Administrative Angaben zum Arzneimittel Geben Sie in Tabelle 2-1 den Namen des Wirkstoffs, den Handelsnamen und den ATC-Code für das zu bewertende Arzneimittel an. Tabelle 2-1: Allgemeine Angaben zum zu bewertenden Arzneimittel Wirkstoff: Etelcalcetid Handelsname: Parsabiv ATC-Code: H05BX04 Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 2-2 an, welche Pharmazentralnummern (PZN) und welche Zulassungsnummern dem zu bewertenden Arzneimittel zuzuordnen sind, und benennen Sie dabei die zugehörige Wirkstärke und Packungsgröße. Fügen Sie für jede Pharmazentralnummer eine neue Zeile ein. Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 5 von 19
7 Tabelle 2-2: Pharmazentralnummern und Zulassungsnummern für das zu bewertende Arzneimittel Pharmazentralnummer (PZN) Zulassungsnummer Wirkstärke Packungsgröße EU/1/16/1142/003 2,5 mg 12 Durchstechflaschen à 0,5 ml EU/1/16/1142/007 5 mg 12 Durchstechflaschen à 1 ml EU/1/16/1142/ mg 12 Durchstechflaschen à 2 ml Angaben zum Wirkmechanismus des Arzneimittels Beschreiben Sie den Wirkmechanismus des zu bewertenden Arzneimittels. Begründen Sie Ihre Angaben unter Nennung der verwendeten Quellen. Beschreibung des Anwendungsgebietes Der shpt ist Teil der Störungen des Mineral- und Knochenhaushalts, der als Komplikation einer chronischen, progredienten Nierenerkrankung auftritt und unbehandelt zu schwerwiegenden kardiovaskulären und ossären Folgeerscheinungen sowie disseminierten Gewebeverkalkungen führt (Cunningham 2011; Goodman 2008; KDIGO CKD MBD Work Group 2016; Saliba 2009; Zerbi 2008). Die Störung des Mineral- und Knochenhaushalts bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ist ein vielfältiger, progredienter und maladaptiver Prozess. Etelcalcetid (Parsabiv ) wird angewendet zur Behandlung des sekundären Hyperparathyreoidismus (shpt) bei erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD, chronic kidney disease), die sich einer Hämodialysetherapie unterziehen (Amgen GmbH 2016a). Regelkreis des Mineral- und Knochenhaushalts Die Calcium-Phosphat-Homöostase ist essentiell für die Aufrechterhaltung der Körperzellfunktionen. Dieses Gleichgewicht wird in einem Stoffwechselregelkreis über ein fein abgestimmtes Zusammenspiel verschiedener Organe, insbesondere Nieren, Magen- Darmtrakt (Intestinum), Nebenschilddrüsen und Knochen, reguliert. Dabei nehmen die Hormone Vitamin D, Parathormon (PTH) und der Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 (fibroblast growth factor 23, FGF-23) Schlüsselfunktionen ein. Im Folgenden werden die wichtigsten Mechanismen dieses Regelkreises beschrieben. Vitamin D Vitamin D3 wird unter Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet und in der Leber zu 25(OH)Vitamin D3 hydroxiliert. Die physiologisch aktive Form 1,25(OH)2Vitamin D3 (Calcitriol) wird vor allem in den Nieren gebildet. Calcitriol stimuliert die Produktion der zur Resorption von Calcium und Phosphat benötigten Transportproteine im Intestinum. Vitamin D Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 6 von 19
8 führt somit zu einer erhöhten Aufnahme von Calcium und Phosphat und nimmt dadurch eine essentielle Rolle in der Calcium-Phosphat-Homöostase ein (Cunningham 2011). PTH Bei kurzfristig erhöhtem Calciumbedarf wird vermehrt PTH von den Hauptzellen der Nebenschilddrüsen produziert und freigesetzt. Dies wird über den calciumsensitiven Rezeptor (calcium sensing receptor, CaSR) reguliert. Sinkt der Serumcalciumspiegel, wird die PTH- Produktion angeregt. Steigt der Serumcalciumspiegel hingegen, wird die PTH-Produktion gemäßigt. Zur Erhöhung des Calciumspiegels, setzt PTH Calcium aus dem Knochen frei, zudem wird die Rückresorption von Calcium aus dem Primärharn erhöht und die Aktivierung von Vitamin D stimuliert (Cunningham 2011; Goodman 2008; Saliba 2009). FGF-23 In Folge einer stark erhöhten intestinalen Aufnahme, in katabolen Phasen (d. h. Abbauprozesse überwiegen im Stoffwechsel gegenüber Aufbauprozessen) oder bei einer verminderten renalen Ausscheidung, kann es zu Phosphatüberschuss kommen. Damit die Calcium-Phosphat-Homöostase nicht ins Ungleichgewicht gerät, wird in der Folge vermehrt FGF-23 produziert. FGF-23 ist ein phosphaturisches Hormon, das im Knochen gebildet wird. Es hemmt die Aktivierung von Vitamin D und fördert die Ausscheidung des Phosphats über die Niere. Insgesamt kommt es durch die FGF-23-Wirkung zur Reduktion der Phosphat- und Calciumspiegel (Cunningham 2011). Wechselseitige Regulation Diese Schlüsselhormone unterliegen einer wechselseitigen Regulation und führen so in einem intakten Stoffwechsel dazu, dass das Gleichgewicht in der Calcium-Phosphat-Homöostase bestehen kann. PTH fördert die Vitamin D3-Aktivierung. Aktives Vitamin D3 fördert die Sekretion von FGF-23 und hemmt die PTH-Produktion. FGF-23 hemmt sowohl die PTH- Produktion, als auch die Vitamin D3-Aktivierung (Cunningham 2011; Goodman 2008; Saliba 2009). In Abbildung 1 wird dieses komplexe und feinregulierte Zusammenspiel dargestellt und verdeutlicht. Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 7 von 19
9 Abbildung 1: Regelkreis der Calcium-Phosphat-Homöostase Quelle: adaptiert nach Hu 2013 Sekundärer Hyperparathyreoidismus (shpt) bei chronischer Nierenerkrankung und Hämodialysetherapie Dauerhafte Dysregulationen im Calcium-Phosphat-Stoffwechselregelkreis können letztendlich zum Versagen der Homöostase führen. Die Ursache für eine Störung des Stoffwechselregelkreises ist oftmals eine abnehmende Nierenfunktion aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung. Eine reduzierte renale Phosphatausscheidung löst eine erhöhte FGF-23-Ausschüttung aus. FGF-23 hemmt dabei konsekutiv die Bildung von Calcitriol. Der Mangel an aktivem Vitamin D führt zu einer verminderten Calciumaufnahme aus dem Darm und reaktiv zu einer verstärkten Sekretion des PTHs, welches wiederum für eine Calciumfreisetzung aus dem Knochen sorgt (Cunningham 2011; Goodman 2008; Isakova 2011; Saliba 2009; Slatopolsky 1999). Sofern eine glomeruläre Filtrationsrate (GFR) von mehr als 20 ml/min aufrechterhalten wird, ist eine Hemmung der Phosphat-Rückresorption aufgrund der Wirkung von FGF-23 möglich. Anteilig wird so eine Hyperphosphatämie verhindert. Fällt infolgedessen der Calciumspiegel zu stark ab, wirkt PTH entgegen. Ein Anstieg von FGF-23 und PTH kann für eine bestimmte Zeit auch bei chronischer Nierenerkrankung zunächst die Calcium-Phosphat-Homöostase aufrechterhalten. Da die FGF-23 vermittelte Phosphatausscheidung im Laufe der progredienten chronischen Nierenerkrankung ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet wird, kann die Calcium-Phosphat-Homöostase nicht mehr aufrechterhalten werden. Dies tritt spätestens bei terminaler Nierenerkrankung im dialysepflichtigem Stadium ein (Cunningham 2011; Goodman 2008; Isakova 2011; Saliba 2009; Slatopolsky 1999). Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 8 von 19
10 Da FGF-23 weiterhin stark erhöht bleibt, nimmt die Aktivierung von Vitamin D immer weiter ab. Der Calciumspiegel wird vermindert und gleichzeitig kommt es zu einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen und damit zu einer konstanten Überproduktion von PTH. Es entwickelt sich der shpt. Diese Entwicklung führt unbehandelt letztlich zu Hypertrophien und Hyperplasien der Nebenschilddrüsen (Goodman 2008). Mit zunehmender Vergrößerung der Drüsen können diese autonom, d. h. unempfänglicher für Signale von außen werden. Dabei wird unabhängig von Rückkopplungssignalen PTH produziert. Ein autonomer shpt ist mit einer erhöhten Mortalität assoziiert (Block 2004; Block 2010; Cunningham 2011; Floege 2011; Jehle 2013; Natoli 2013; Saliba 2009). Klinisch äußert sich der shpt zunächst u. a. durch Abgeschlagenheit, Juckreiz, Gelenk- und Knochenschmerzen, sowie Muskelschwäche, Myalgien und Stimmungsschwankungen (Chertow 2012; KDIGO CKD MBD Work Group 2016; Malindretos 2012; Zerbi 2008). Permanent erhöhte PTH-Spiegel und damit verbundene unverhältnismäßig hohe ossäre Calciumausscheidungen führen zu einer hohen Umsatzrate der Knochensubstanz (high turnover bone). Unbehandelt, führt dies in der Regel zur Ausbildung einer Osteitis fibrosa. Hierbei wird aufgrund der starken Demineralisierung Knochensubstanz durch Bindegewebe ersetzt. Die Knochenintegrität nimmt ab und das Frakturrisiko steigt (Blayney 2008; DGfN 2016; Jadoul 2006; Saliba 2009). Dialysepflichtige Patienten sind durch die Volumenschwankungen kardial stark belastet und aufgrund der extrakorporalen Blutwäsche dauerhaften Entzündungsreizen ausgesetzt. Das Risiko an Herzkreislauferkrankungen zu erkranken oder zu versterben, ist damit stark erhöht. Beim shpt steigt das Calcium-Phosphat-Produkt (cca x P) an und es kommt zu disseminierten Gewebeverkalkungen der vitalen Organstrukturen, insbesondere von Aorta, Herzklappen, Gefäßen, Gelenken und weiteren Geweben. Bei Patienten mit terminaler Nierenerkrankung schreitet der Prozess der disseminierten Gewebeverkalkungen rapide fort und die betroffenen Strukturen versteifen. Häufig kommt es bei diesen Patienten zu koronarer Herzkrankheit, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, Arrhythmie oder Schlaganfall (Block 2000; Block 2010; Chertow 2012; Moe 2003; USRDS 2015; Zerbi 2008). Behandlungsmöglichkeiten des shpts Diätetische Maßnahmen Die aktuellen Behandlungsleitlinien empfehlen bei Patienten mit einer terminalen Nierenerkrankung eine diätetische Phosphatrestriktion, um die Phosphatspiegel zu normalisieren (KDIGO CKD MBD Work Group 2016). Da Phosphat in vielen verarbeiteten Lebensmitteln als Stabilisator hinzugefügt wird, und die Menge an Phosphat in Grundnahrungsmitteln von Patienten schwer abzuschätzen ist, gestaltet sich eine diätetische Phosphatrestriktion schwierig. Zudem ist der Phosphatgehalt von Lebensmitteln in den häufigsten Fällen unzureichend gekennzeichnet (Hahn 2013). Luis et al. konnten in einer Studie zeigen, dass die Empfehlungen der Leitlinien zur diätetischen Phosphatrestriktion in der Regel Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 9 von 19
11 nicht ausreichen oder nicht eingehalten werden (Luis 2016). Dies macht eine ergänzende medikamentöse Therapie bei diesen Patienten unumgänglich (Toussaint 2011). Phosphatbinder Phosphatbinder sind eine Therapieoption zur Behandlung der Hyperphosphatämie bei Störungen des Mineral- und Knochenhaushalts bei chronischer Nierenerkrankung. Phosphatbinder reduzieren die intestinale Phosphataufnahme (KDIGO CKD MBD Work Group 2016). Im Stoffwechsel freigesetztes Phosphat kann unter dieser Behandlungsmöglichkeit allerdings nicht beeinflusst werden, weshalb bei Patienten mit terminaler Nierenerkrankung die Störung der Calcium-Phosphat-Homöostase nicht vollständig adressiert werden kann (Ketteler 2013). Vitamin D-Präparate Vitamin D-Präparate stellen eine weitere Behandlungsmöglichkeit bei Störungen des Mineral- und Knochenhaushaltes bei chronischer Nierenerkrankung dar (KDIGO CKD MBD Work Group 2016). Da die Niere nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Vitamin D zu aktivieren, kommen häufig hochwirksame Vitamin D-Präparate bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung zur Anwendung. Vitamin D-Präparate werden primär dazu eingesetzt, Hypokalzämien und damit indirekt dem shpt entgegenzuwirken. Das einzig zugelassene Vitamin D-Präparat zur Behandlung des shpts bei chronischer Nierenerkrankung ist Paricalcitol (AbbVie 2015). Zusätzlich wird die Aufnahme von Phosphat erhöht. Dies ist vor allem bei bereits erhöhten Phosphatspiegel nachteilig und kann zu einem Anstieg des cca x Ps führen, womit sich das Risiko für Gewebeverkalkungen erhöhen kann (Slatopolsky 2001; Thadhani 2012). Calcimimetika Calcimimetische Substanzen, wie Cinacalcet (Amgen GmbH 2016b) oder Etelcalcetid (Amgen GmbH 2016a), reduzieren den PTH-Spiegel bei gleichzeitiger Senkung der Calcium-, Phosphat- und FGF-23-Spiegel. Für betroffene Patienten stellen Calcimimetika die aktuell einzige verfügbare und zugelassene zielgerichtete Therapieoption dar, die es erlaubt, die in Folge der progredienten chronischen Nierenerkrankung auftretenden Stoffwechselentgleisungen ganzheitlich zu behandeln (Moe 2003). Beide Substanzen können als Monotherapie oder bei Bedarf als Teil eines therapeutischen Regimes, das Vitamin D-Präparate und/oder Phosphatbinder enthält, angewendet werden (G-BA 2015; KDIGO CKD MBD Work Group 2016). Abbildung 2 fasst die derzeit verfügbaren Therapieoptionen und deren Wirkweisen zusammen. Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 10 von 19
12 Abbildung 2: Wirkweisen der aktuell verfügbaren Therapieoptionen bei der Behandlung des shpts PTH: Parathormon. Quelle: Amgen GmbH 2017b, eigene Darstellung Das Wirkprinzip von Etelcalcetid Der CaSR auf der Oberfläche der Hauptzellen der Nebenschilddrüsen ist der Schlüsselregulator der PTH-Sekretion. Ist ausreichend Calcium im Blut vorhanden, wird nach Bindung von Calcium über den Rezeptor ein Signal zur Minderung der PTH-Sekretion vermittelt. Bei geringem Calciumspiegel bleibt dieses Signal aus und es kommt zur Erhöhung der PTH- Freisetzung (Amgen GmbH 2016a). Etelcalcetid ist ein lang wirksames, synthetisches Peptid, das allosterisch an den CaSR bindet. Es gehört zur Substanzklasse der Calcimimetika. Calcimimetika suggerieren an den Hauptzellen der Nebenschilddrüsen einen erhöhten Calciumspiegel. Somit wird die intrazelluläre Signalkaskade, an deren Ende die Reduktion der PTH-Freisetzung aus der Zelle steht, eingeleitet. Die Reduktion des PTH-Spiegels korreliert mit einer gleichzeitigen Reduktion der Calcium-, Phosphat-, sowie FGF-23-Spiegel im Serum (Amgen GmbH 2016a; EMA 2016). Etelcalcetid reduziert nach einer einzelnen i.v.-anwendung von 5 mg den PTH-Spiegel im Serum innerhalb von 30 Minuten nach der Anwendung. Eine Reduktion des PTH-Spiegels korreliert mit den Plasmakonzentrationen von Etelcalcetid bei Hämodialysepatienten. Diese anhaltende Wirkung hat sich bei der in der Fachinformation empfohlenen dreimal wöchentlichen i.v.-anwendung bestätigt (Amgen GmbH 2016a). Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 11 von 19
13 Beschreiben Sie, ob und inwieweit sich der Wirkmechanismus des zu bewertenden Arzneimittels vom Wirkmechanismus anderer bereits in Deutschland zugelassener Arzneimittel unterscheidet. Differenzieren Sie dabei zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten, für die das zu bewertende Arzneimittel zugelassen ist. Begründen Sie Ihre Angaben unter Nennung der verwendeten Quellen. Sowohl Etelcalcetid als auch Cinacalcet wirken allosterisch am CaSR. Sie ahmen die Wirkung des Calciums am CaSR nach. Dies führt dazu, dass die PTH-Produktion und -Sekretion reduziert wird. Cinacalcet ist eine niedermolekulare Verbindung, die an der Transmembrandomäne des CaSRs bindet. Im Gegensatz dazu bindet Etelcalcetid, ein synthetisches Peptid, an der extrazellulären Domäne. Abbildung 3 stellt die molekularen Wirkmechanismen beider Calcimimetika dar. Abbildung 3: Schematische Darstellung zum Wirkmechanismus von Etelcalcetid in den Zellen der Nebenschilddrüsen Ca: Calcium; CaSR: calciumsensitiver Rezeptor; PTH: Parathormon. Quelle: Amgen GmbH 2017a, eigene Darstellung Im Gegensatz zu Cinacalcet besteht für Etelcalcetid kein bekanntes Risiko für pharmakokinetische Wechselwirkungen. Etelcalcetid wird im Vergleich zu Cinacalcet nicht über das Cytochrom P450-System (CYP) mikrosomal metabolisiert. Es sind daher unter Etelcalcetid keine pharmakokinetischen Wechselwirkungen mit Stoffen und Arzneimitteln (z. B. mit den häufig bei chronischer Nierenerkrankung angewendeten Arzneimitteln Metoprolol oder Desipramin), die über diesen Weg umgesetzt werden, bekannt (Amgen GmbH 2016a, 2016b). Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 12 von 19
14 Etelcalcetid verfügt über eine längere Halbwertszeit und zeigt gegenüber Cinacalcet eine überlegene und wirksamere PTH-Reduktion (Amgen GmbH 2016a; Block 2017; EMA 2016; Martin 2014). Außerdem werden unter Etelcalcetid im Vergleich zu Cinacalcet die charakteristischen Parameter der Mineralstoffwechselentgleisung (PTH-, FGF-23-, P- und Ca-Spiegel) bei vergleichbarer Verträglichkeit stärker gesenkt (Amgen GmbH 2015; Block 2017; Martin 2014). Während die Anwendung von Cinacalcet täglich oral erfolgt, wird Etelcalcetid dreimal wöchentlich i.v. angewendet. Die Anwendung von Etelcalcetid erfolgt durch das medizinische Fachpersonal, wodurch sich die Therapietreue und das Patientenmanagement unter Etelcalcetid im Vergleich zu Cinacalcet verbessern dürften. Auch könnte über eine Feinadjustierung der angewendeten Dosis eine optimale Einstellung des PTH-Spiegels erreicht werden. Die i.v.- Anwendung von Etelcalcetid erfolgt an den Dialysetagen am Ende der Dialysesitzung über den bereits für die Behandlung gelegten i.v.-zugang. Darüber hinaus wird eine orale Therapie ersetzt, wodurch die Tablettenlast nicht weiter erhöht wird (Fissell 2016). Täglich einzunehmende zusätzliche orale Therapeutika erschweren die Therapietreue zusätzlich (de Francisco 2016). Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 13 von 19
15 Tabelle 2-3: Unterschiede Etelcalcetid und Cinacalcet im Überblick Etelcalcetid Cinacalcet Strukturformel ATC-Code H05BX04 H05BX01 Stoffklasse Synthetisches Peptid Niedermolekulare Verbindung Wirkort am CaSR Allosterisch an extrazellulärer Domäne Anwendungsform Intravenös Oral Anwendungshäufigkeit Zugelassene Dosierung PTH-Nadir Bekannte pharmakokinetische Wechselwirkungen Elimination Pharmakokinetik Intravenös 3-mal pro Woche im Rahmen der Dialysesitzung Allosterisch an Transmembrandomäne Tägliche Einnahme 2,5 15 mg mg ca. 30 Minuten nach Gabe und bleibt erhalten Keine Vorwiegend renale Elimination bzw. Ausscheidung über das Dialysat Pharmakokinetische Beeinflussung nicht bekannt/ nicht festgestellt ca. 2 bis 6 Stunden nach Einnahme. Die PTH-Spiegel steigen danach bis 12 Stunden nach Anwendung und bleiben danach konstant Metabolisierung über das CYP- System (CYP3A4 und CYP1A2; Inhibition von CYP2D6) Renale Ausscheidung bei einer terminalen Halbwertszeit von 30 bis 40 Stunden Pharmakokinetik kann beeinflusst sein durch Leberfunktion, Geschlecht und Rauchen Quelle: Amgen GmbH 2016a, 2016b ATC-Code: Anatomisch-Therapeutisch-Chemischer Code; CaSR: Calciumsensitiver Rezeptor; CYP: Cytochrom P450; PTH: Parathormon Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 14 von 19
16 2.2 Zugelassene Anwendungsgebiete Anwendungsgebiete, auf die sich das Dossier bezieht Benennen Sie in der nachfolgenden Tabelle 2-4 die Anwendungsgebiete, auf die sich das vorliegende Dossier bezieht. Geben Sie hierzu den Wortlaut der Fachinformation an. Sofern im Abschnitt Anwendungsgebiete der Fachinformation Verweise enthalten sind, führen Sie auch den Wortlaut an, auf den verwiesen wird. Fügen Sie für jedes Anwendungsgebiet eine neue Zeile ein, und vergeben Sie eine Kodierung (fortlaufende Bezeichnung von A bis Z ) [Anmerkung: Diese Kodierung ist für die übrigen Module des Dossiers entsprechend zu verwenden]. Tabelle 2-4: Zugelassene Anwendungsgebiete, auf die sich das Dossier bezieht Anwendungsgebiet (Wortlaut der Fachinformation inkl. Wortlaut bei Verweisen) orphan (ja / nein) Datum der Zulassungserteilung Kodierung im Dossier a Parsabiv wird angewendet zur Behandlung des sekundären Hyperparathyreoidismus (shpt) bei erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (chronic kidney disease, CKD), die sich einer Hämodialysetherapie unterziehen. 1 Nein A a: Fortlaufende Angabe A bis Z. 1: Quelle: Amgen GmbH 2016a; EMA 2016 Benennen Sie die den Angaben in Tabelle 2-4 zugrunde gelegten Quellen. Die Angaben wurden der Fachinformation (Amgen GmbH 2016a) sowie dem European Public Assessment Report (EPAR) von Parsabiv entnommen (EMA 2016) Weitere in Deutschland zugelassene Anwendungsgebiete Falls es sich um ein Dossier zu einem neuen Anwendungsgebiet eines bereits zugelassenen Arzneimittels handelt, benennen Sie in der nachfolgenden Tabelle 2-5 die weiteren in Deutschland zugelassenen Anwendungsgebiete des zu bewertenden Arzneimittels. Geben Sie hierzu den Wortlaut der Fachinformation an; sofern im Abschnitt Anwendungsgebiete der Fachinformation Verweise enthalten sind, führen Sie auch den Wortlaut an, auf den verwiesen wird. Fügen Sie dabei für jedes Anwendungsgebiet eine neue Zeile ein. Falls es kein weiteres zugelassenes Anwendungsgebiet gibt oder es sich nicht um ein Dossier zu einem neuen Anwendungsgebiet eines bereits zugelassenen Arzneimittels handelt, fügen Sie in der ersten Zeile unter Anwendungsgebiet kein weiteres Anwendungsgebiet ein. Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 15 von 19
17 Tabelle 2-5: Weitere in Deutschland zugelassene Anwendungsgebiete des zu bewertenden Arzneimittels Anwendungsgebiet (Wortlaut der Fachinformation inkl. Wortlaut bei Verweisen) Kein weiteres Anwendungsgebiet Datum der Zulassungserteilung Benennen Sie die den Angaben in Tabelle 2-5 zugrunde gelegten Quellen. Falls es kein weiteres zugelassenes Anwendungsgebiet gibt oder es sich nicht um ein Dossier zu einem neuen Anwendungsgebiet eines bereits zugelassenen Arzneimittels handelt, geben Sie nicht zutreffend an. Nicht zutreffend. 2.3 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Modul 2 Erläutern Sie an dieser Stelle das Vorgehen zur Identifikation der im Abschnitt 2.1 und im Abschnitt 2.2 genannten Quellen (Informationsbeschaffung). Sofern erforderlich, können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen benennen. Zur Ermittlung der Angaben zum Wirkmechanismus von Etelcalcetid wurde auf die Fachinformation sowie Sekundärliteratur (siehe Quellenangaben) zurückgegriffen. 2.4 Referenzliste für Modul 2 Listen Sie nachfolgend alle Quellen (z. B. Publikationen), die Sie in den vorhergehenden Abschnitten angegeben haben (als fortlaufend nummerierte Liste). Verwenden Sie hierzu einen allgemein gebräuchlichen Zitierstil (z. B. Vancouver oder Harvard). Geben Sie bei Fachinformationen immer den Stand des Dokuments an. 1. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (AbbVie) Fachinformation Zemplar 5 Mikrogramm/ml Injektionslösung: Stand Oktober Verfügbar unter: abgerufen am: Amgen GmbH Studienbericht Studie : A Multicenter, Multiple-dose, Twoarm, Active-controlled, Double-blind, Double-dummy Study to Compare the Therapeutic Efficacy and Safety of Oral Doses of Cinacalcet HCl With Intravenous Doses of AMG 416 in Hemodialysis Subjects With Secondary Hyperparathyroidism. Data on file. 3. Amgen GmbH 2016a. Fach- und Gebrauchsinformation Parsabiv 2,5 mg/5 mg/10 mg Injektionslösung. Verfügbar unter: _Product_Information/human/003995/WC pdf, abgerufen am: Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 16 von 19
18 4. Amgen GmbH 2016b. Fachinformation Mimpara 30 mg/60 mg/90 mg Filmtabletten: Stand Dezember Verfügbar unter: abgerufen am: Amgen GmbH 2017a. Schematische Darstellung zum Wirkmechanismus von Etelcalcetid an den Hauptzellen der Nebenschilddrüsen. Data on file. 6. Amgen GmbH 2017b. Wirkweisen der aktuell verfügbaren Therapieoptionen bei der Behandlung des shpt. Data on file. 7. Blayney M. J., Pisoni R. L., Bragg-Gresham J. L. et al High alkaline phosphatase levels in hemodialysis patients are associated with higher risk of hospitalization and death. Kidney International 74 (5), S Block G. A., Bushinsky D. A., Cheng S. et al Effect of Etelcalcetide vs Cinacalcet on Serum Parathyroid Hormone in Patients Receiving Hemodialysis With Secondary Hyperparathyroidism: A Randomized Clinical Trial. Journal of the American Medical Association 317 (2), S Block G. A., Klassen P. S., Lazarus J. M. et al Mineral metabolism, mortality, and morbidity in maintenance hemodialysis. Journal of the American Society of Nephrology 15 (8), S Block G. A. und Port F. K Re-evaluation of risks associated with hyperphosphatemia and hyperparathyroidism in dialysis patients: recommendations for a change in management. American Journal of Kidney Diseases : the official journal of the National Kidney Foundation 35 (6), S Block G. A., Zaun D., Smits G. et al Cinacalcet hydrochloride treatment significantly improves all-cause and cardiovascular survival in a large cohort of hemodialysis patients. Kidney International 78 (6), S Chertow G. M., Lu Z. J., Xu X. et al Self-reported symptoms in patients on hemodialysis with moderate to severe secondary hyperparathyroidism receiving combined therapy with cinacalcet and low-dose vitamin D sterols. Hemodialysis International. International Symposium on Home Hemodialysis 16 (2), S Cunningham J., Locatelli F. und Rodriguez M Secondary hyperparathyroidism: pathogenesis, disease progression, and therapeutic options. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 6 (4), S de Francisco A. L. M., Gillespie I. A., Gioni I. et al Anti-parathyroid treatment effectiveness and persistence in incident haemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Nefrologia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola Nefrologia 36 (2), S Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Nierenzentren e.v. sowie der Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie (GPN): Fassung vom Verfügbar unter: 23_Dialysestandard.pdf, abgerufen am: Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 17 von 19
19 16. European Medicines Agency (EMA) Assessment report Parsabiv: International non-proprietary name: etelcalcetide Procedure No. EMEA/H/C/003995/0000. Verfügbar unter: _Public_assessment_report/human/003995/WC pdf, abgerufen am: Fissell R. B., Karaboyas A., Bieber B. A. et al Phosphate binder pill burden, patient-reported non-adherence, and mineral bone disorder markers: Findings from the DOPPS. Hemodialysis International. International Symposium on Home Hemodialysis 20 (1), S Floege J., Kim J., Ireland E. et al Serum ipth, calcium and phosphate, and the risk of mortality in a European haemodialysis population. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association 26 (6), S Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) Niederschrift zum Beratungsgespräch gemäß 8 AM-NutzenV Beratungsanforderung 2015-B-133 Etelcalcetide zur Behandlung des sekundären Hyperparathyreoidismus 2015-B-133. Data on file. 20. Goodman W. G. und Quarles L. D Development and progression of secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease: lessons from molecular genetics. Kidney International 74 (3), S Hahn K., Kuhlmann M. K. und Ritz E Phosphat und Nahrung. Nephrologe 8 (1), S Hu M. C., Shiizaki K., Kuro-o M. et al Fibroblast growth factor 23 and Klotho: physiology and pathophysiology of an endocrine network of mineral metabolism. Annual Review of Physiology 75, S Isakova T., Wahl P., Vargas G. S. et al Fibroblast growth factor 23 is elevated before parathyroid hormone and phosphate in chronic kidney disease. Kidney International 79 (12), S Jadoul M., Albert J. M., Akiba T. et al Incidence and risk factors for hip or other bone fractures among hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Kidney International 70 (7), S Jehle P. M., Schucht H., Rehm K. et al Chronische und dialysepflichtige Niereninsuffizienz vom Stadium III bis Stadium VD Was ist diagnostisch sinnvoll und wann? Welche Vitamin-D-Form, welches PTH, welche alkalische Phosphatase messen? Nieren- und Hochdruckkrankheiten 42 (8), S Ketteler M Phosphatbinder. Nephrologe 8 (1), S Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD MBD Work Group (KDIGO CKD MBD Work Group) KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease mineral and bone disorder (CKD MBD): Public Review Draft. Verfügbar unter: Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 18 von 19
20 MBD%20Update/KDIGO%20CKD-MBD%20Update_Public%20Review_Final.pdf, abgerufen am: Luis D., Zlatkis K., Comenge B. et al Dietary Quality and Adherence to Dietary Recommendations in Patients Undergoing Hemodialysis. Journal of Renal Nutrition : The Official Journal of the Council on Renal Nutrition of the National Kidney Foundation 26 (3), S Malindretos P., Sarafidis P., Lazaridis A. et al A study of the association of higher parathormone levels with health-related quality of life in hemodialysis patients. Clinical Nephrology 77 (3), S Martin K. J., Pickthorn K., Huang S. et al AMG 416 (velcalcetide) is a novel peptide for the treatment of secondary hyperparathyroidism in a single-dose study in hemodialysis patients. Kidney International 85 (1), S Moe S. M. und Drueke T. B Management of secondary hyperparathyroidism: the importance and the challenge of controlling parathyroid hormone levels without elevating calcium, phosphorus, and calcium-phosphorus product. American Journal of Nephrology 23 (6), S Natoli J. L., Boer R., Nathanson B. H. et al Is there an association between elevated or low serum levels of phosphorus, parathyroid hormone, and calcium and mortality in patients with end stage renal disease? A meta-analysis. BMC Nephrology 14 (88), S Saliba W. und El-Haddad B Secondary hyperparathyroidism: pathophysiology and treatment. Journal of the American Board of Family Medicine 22 (5), S Slatopolsky E., Brown A. und Dusso A Pathogenesis of secondary hyperparathyroidism. Kidney International 56 (Suppl. 73), S. S-14 - S Slatopolsky E., Brown A. und Dusso A Role of phosphorus in the pathogenesis of secondary hyperparathyroidism. American Journal of Kidney Diseases : the official journal of the National Kidney Foundation 37 (1 Suppl 2), S. S Thadhani R., Appelbaum E., Pritchett Y. et al Vitamin D therapy and cardiac structure and function in patients with chronic kidney disease: the PRIMO randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association 307 (7), S Toussaint N. D., Pedagogos E., Beavis J. et al Improving CKD-MBD management in haemodialysis patients: barrier analysis for implementing better practice. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association 26 (4), S United States Renal Data System (USRDS) USRDS Annual Data Report Volume 2: End-Stage Renal Disease (ESRD) in the United States. Verfügbar unter: abgerufen am: Zerbi S., Ruggiero P. und Pedrini L. A Massive soft tissue calcifications and cinacalcet. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 93 (4), S Etelcalcetid (Parsabiv ) Seite 19 von 19
KNOCHENSTOFFWECHSEL UND NIERENINSUFFIZIENZ
 KNOCHENSTOFFWECHSEL UND NIERENINSUFFIZIENZ Dr.Katharina Hohenstein Nephrologie und Dialyse AKH Wien Der Knochenstoffwechsel PTH Ca 2+ 1,25(OH) 2 D 3 P K/DOQI: Laborzielwerte für den Mineral- und Knochenstoffwechsel
KNOCHENSTOFFWECHSEL UND NIERENINSUFFIZIENZ Dr.Katharina Hohenstein Nephrologie und Dialyse AKH Wien Der Knochenstoffwechsel PTH Ca 2+ 1,25(OH) 2 D 3 P K/DOQI: Laborzielwerte für den Mineral- und Knochenstoffwechsel
Ergebnisse aus EuCliD 2. Quartal Knochen- und Mineralhaushalt. Dr. Helmut Bink, Dortmund,
 Ergebnisse aus EuCliD 2. Quartal 2016 Dr. Helmut Bink, Dortmund, Email: dr.bink@t-online.de 1 Die Regulation des es ist ein komplexer Vorgang, der durch Serumparameter bestimmt wird, die sich im Sinne
Ergebnisse aus EuCliD 2. Quartal 2016 Dr. Helmut Bink, Dortmund, Email: dr.bink@t-online.de 1 Die Regulation des es ist ein komplexer Vorgang, der durch Serumparameter bestimmt wird, die sich im Sinne
Ich habe meinen Phosphatspiegel im Griff!
 Patientenbroschüre_RZ 31.05.2010 16:27 Uhr Seite 1 Information für Dialysepatienten / Gesundheitsrisiko Hyperphosphatämie Ich habe meinen Phosphatspiegel im Griff! Ein Service von Patientenbroschüre_RZ
Patientenbroschüre_RZ 31.05.2010 16:27 Uhr Seite 1 Information für Dialysepatienten / Gesundheitsrisiko Hyperphosphatämie Ich habe meinen Phosphatspiegel im Griff! Ein Service von Patientenbroschüre_RZ
Kurzfassung des Vortrages von Dr. Gudrun Zürcher, Freiburg Diätetische Prophylaxe und Therapie der chronischen Niereninsuffizienz
 Kurzfassung des Vortrages von Dr. Gudrun Zürcher, Freiburg Diätetische Prophylaxe und Therapie der chronischen Niereninsuffizienz Der natürliche Verlauf einer chronischen Niereninsuffizienz ist durch eine
Kurzfassung des Vortrages von Dr. Gudrun Zürcher, Freiburg Diätetische Prophylaxe und Therapie der chronischen Niereninsuffizienz Der natürliche Verlauf einer chronischen Niereninsuffizienz ist durch eine
Vitamin D renale Anämie ein Update
 Vitamin D renale Anämie ein Update Jährliche kardiovaskuläre Mortalität % Mortalität Hämodialysepatienten 100 10 X 10 Dialysis Male 1 0.1 X 1000 P Dialysis Female Dialysis Black Dialysis White 0.01 0.001
Vitamin D renale Anämie ein Update Jährliche kardiovaskuläre Mortalität % Mortalität Hämodialysepatienten 100 10 X 10 Dialysis Male 1 0.1 X 1000 P Dialysis Female Dialysis Black Dialysis White 0.01 0.001
Zusammenfassung. Einleitung: Studienkollektiv und Methoden: Ergebnisse:
 Zusammenfassung Einleitung: Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz werden duplexsonographisch bestimmte intrarenale Widerstandsindices zur Prognoseeinschätzung des Voranschreitens der Niereninsuffizienz
Zusammenfassung Einleitung: Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz werden duplexsonographisch bestimmte intrarenale Widerstandsindices zur Prognoseeinschätzung des Voranschreitens der Niereninsuffizienz
Nephrologie für Nicht- Nephrologen update PD Dr. med. Andreas Kistler Leitender Arzt Nephrologie und Dialyse Kantonsspital Frauenfeld
 Nephrologie für Nicht- Nephrologen update 2015 PD Dr. med. Andreas Kistler Leitender Arzt Nephrologie und Dialyse Kantonsspital Frauenfeld 2 Diagnose und Stadieneinteilung Chronische Niereninsuffizienz
Nephrologie für Nicht- Nephrologen update 2015 PD Dr. med. Andreas Kistler Leitender Arzt Nephrologie und Dialyse Kantonsspital Frauenfeld 2 Diagnose und Stadieneinteilung Chronische Niereninsuffizienz
Welcher PD-Patient sollte lipidsenkend behandelt werden?
 Welcher PD-Patient sollte lipidsenkend behandelt werden? Christoph Wanner Medizinische Klinik und Poliklinik I Schwerpunkt Nephrologie 97080 Würzburg Praxis der Peritonealdialysetherapie, 20. Workshop,
Welcher PD-Patient sollte lipidsenkend behandelt werden? Christoph Wanner Medizinische Klinik und Poliklinik I Schwerpunkt Nephrologie 97080 Würzburg Praxis der Peritonealdialysetherapie, 20. Workshop,
Optimale Behandlung des kalzifizierten Patienten
 Optimale Behandlung des kalzifizierten Patienten Jürgen Floege Juergen.floege@rwth-aachen.de Division of Nephrology & Immunology K. Zerres 2004 Atherosklerose Entzündlich Lipid Ablagerung Ischämie, Okklusion
Optimale Behandlung des kalzifizierten Patienten Jürgen Floege Juergen.floege@rwth-aachen.de Division of Nephrology & Immunology K. Zerres 2004 Atherosklerose Entzündlich Lipid Ablagerung Ischämie, Okklusion
Therapie des Hyperparathyreoidismus nach Nierentransplantation
 Therapie des Hyperparathyreoidismus nach Nierentransplantation Gibt es einen Platz für Cinacalcet? Markus Mohaupt Abteilung für Hypertonie der Universität Bern Klinik und Poliklinik für Nephrologie/Hypertonie,
Therapie des Hyperparathyreoidismus nach Nierentransplantation Gibt es einen Platz für Cinacalcet? Markus Mohaupt Abteilung für Hypertonie der Universität Bern Klinik und Poliklinik für Nephrologie/Hypertonie,
Statine bei Dialysepatienten: Gibt es
 Statine bei Dialysepatienten: Gibt es noch eine Indikation? Christoph Wanner, Würzburg 22. Berliner DialyseSeminar 4. 5. Dezember 2009 Statine Lipidsenkung bei CKD 3 und 4 2003 2004 2006 2011 2012 AJKD
Statine bei Dialysepatienten: Gibt es noch eine Indikation? Christoph Wanner, Würzburg 22. Berliner DialyseSeminar 4. 5. Dezember 2009 Statine Lipidsenkung bei CKD 3 und 4 2003 2004 2006 2011 2012 AJKD
BAnz AT 20.11.2014 B3. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Thrombosemanagement mit NMH Wichtiges worauf Sie achten sollten
 Thrombosemanagement mit NMH Wichtiges worauf Sie achten sollten Thrombosemanagement mit niedermolekularem Heparin (NMH) bei Niereninsuffizienz: Worauf Sie unbedingt achten sollten. Beantworten Sie die
Thrombosemanagement mit NMH Wichtiges worauf Sie achten sollten Thrombosemanagement mit niedermolekularem Heparin (NMH) bei Niereninsuffizienz: Worauf Sie unbedingt achten sollten. Beantworten Sie die
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Welche Medikamente werde ich während der Dialyse nehmen? Avitum
 Welche Medikamente werde ich während der Dialyse nehmen? Avitum Muss ich jetzt nach Beginn der Dialysetherapie meine Medikamente weiter einnehmen? Die Dialyse kann einige Aufgaben der Nieren übernehmen.
Welche Medikamente werde ich während der Dialyse nehmen? Avitum Muss ich jetzt nach Beginn der Dialysetherapie meine Medikamente weiter einnehmen? Die Dialyse kann einige Aufgaben der Nieren übernehmen.
Das Kreatinin steigt Was tun?
 10.12.2009 Noch geht die Niere: Was essen? 1 Das Kreatinin steigt Was tun? 20. November 2009 in Wien Irmgard Landthaler Diätassistentin Praxis für Ernährungsberatung Neuhauser Strasse 15 80331 München
10.12.2009 Noch geht die Niere: Was essen? 1 Das Kreatinin steigt Was tun? 20. November 2009 in Wien Irmgard Landthaler Diätassistentin Praxis für Ernährungsberatung Neuhauser Strasse 15 80331 München
BAnz AT 11.11.2014 B1. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Der Typ 2 Diabetiker mit arterieller Hypertonie. 1. zu spät gehandelt. 2. zu spät behandelt. 3. zu ineffektiv therapiert.
 1. zu spät gehandelt 2. zu spät behandelt 3. zu ineffektiv therapiert Torsten Schwalm Häufige Koinzidenz, Problemstellung - gemeinsame pathogenetische Grundlagen - Diabetiker sind 3 x häufiger hyperton
1. zu spät gehandelt 2. zu spät behandelt 3. zu ineffektiv therapiert Torsten Schwalm Häufige Koinzidenz, Problemstellung - gemeinsame pathogenetische Grundlagen - Diabetiker sind 3 x häufiger hyperton
Phosphat - ein knapper Mineralstoff
 Phosphat - Funktionen Phosphat - nicht nur giftig für Dialysepatienten Dr. med. Dipl. oec. troph. Ursula Bonacker essentieller Nährstoff für den Körper, fundamental für Wachstum, Erhalt und Reparatur von
Phosphat - Funktionen Phosphat - nicht nur giftig für Dialysepatienten Dr. med. Dipl. oec. troph. Ursula Bonacker essentieller Nährstoff für den Körper, fundamental für Wachstum, Erhalt und Reparatur von
Weshalb muss mein Blut so häufig untersucht werden?
 Blutwerte verstehen Weshalb muss mein Blut so häufig untersucht werden? Einmal im Monat nehmen wir eine Reihe von Blutproben, um zu sehen, wie gut Ihre Dialyse wirkt und wie gut Sie auf die Behandlung
Blutwerte verstehen Weshalb muss mein Blut so häufig untersucht werden? Einmal im Monat nehmen wir eine Reihe von Blutproben, um zu sehen, wie gut Ihre Dialyse wirkt und wie gut Sie auf die Behandlung
Diabetes mellitus The silent killer. Peter Diem Universitätspoliklinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung Inselspital - Bern
 Diabetes mellitus The silent killer Peter Diem Universitätspoliklinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung Inselspital - Bern Diabetes mellitus und KHK Diabetiker leiden häufig an KHK
Diabetes mellitus The silent killer Peter Diem Universitätspoliklinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung Inselspital - Bern Diabetes mellitus und KHK Diabetiker leiden häufig an KHK
Hyperkalzämie. Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik. Dr. Derik Hermsen
 Hyperkalzämie Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik Dr. Derik Hermsen 1 Calciumstoffwechsel Nahrung 1000 mg 300 mg Extrazelluläres 500 mg Darm 175 mg Calcium 900 mg Knochen 125 mg 500
Hyperkalzämie Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik Dr. Derik Hermsen 1 Calciumstoffwechsel Nahrung 1000 mg 300 mg Extrazelluläres 500 mg Darm 175 mg Calcium 900 mg Knochen 125 mg 500
BAnz AT 25.04.2014 B4. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
 Begleitmedikation bei gefäßkranken Patienten Was ist evidenzbasiert? N. Attigah Klinischer Abend 27.07.2007 Therapieerfolg -Strenge Indikation -Akkurate OP-Technik -Konsequente Nachsorge -(Best Medical
Begleitmedikation bei gefäßkranken Patienten Was ist evidenzbasiert? N. Attigah Klinischer Abend 27.07.2007 Therapieerfolg -Strenge Indikation -Akkurate OP-Technik -Konsequente Nachsorge -(Best Medical
Niereninsuffizienz als kardiovaskulärer Risikofaktor
 Bayerischer Internistenkongress München, 07.-08.11.2009 Niereninsuffizienz als kardiovaskulärer Risikofaktor Ulf Schönermarck Schwerpunkt Nephrologie Medizinische Klinik I Klinikum der Universität München
Bayerischer Internistenkongress München, 07.-08.11.2009 Niereninsuffizienz als kardiovaskulärer Risikofaktor Ulf Schönermarck Schwerpunkt Nephrologie Medizinische Klinik I Klinikum der Universität München
HINWEIS ABSCHNITT I: VERWENDUNG DER LEITLINIEN ABSCHNITT II: OFFENLEGUNG
 KDIGO LEITLINIEN ZUR KLINISCHEN DIAGNOSTIK, BEWERTUNG, VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG VON STÖRUNGEN DES MINERAL- UND KNOCHENSTOFFWECHSELS BEI CHRONISCHER NIERENERKRANKUNG ZUSAMMENFASSUNG Version des Veröffentlichungsentwurfs
KDIGO LEITLINIEN ZUR KLINISCHEN DIAGNOSTIK, BEWERTUNG, VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG VON STÖRUNGEN DES MINERAL- UND KNOCHENSTOFFWECHSELS BEI CHRONISCHER NIERENERKRANKUNG ZUSAMMENFASSUNG Version des Veröffentlichungsentwurfs
BAnz AT 06.08.2014 B2. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Wartezeit in Deutschland auf eine Nierentransplantation: Aktuelle Aspekte oder Das Blutgruppe 0-Problem
 Wartezeit in Deutschland auf eine Nierentransplantation: Aktuelle Aspekte oder Das Blutgruppe 0-Problem Wartezeit und Ergebnisse nach NTX USA Waiting time on dialysis as the strongest modifiable risk factor
Wartezeit in Deutschland auf eine Nierentransplantation: Aktuelle Aspekte oder Das Blutgruppe 0-Problem Wartezeit und Ergebnisse nach NTX USA Waiting time on dialysis as the strongest modifiable risk factor
Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät beim Dialysepatienten
 10.12.2009 Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät bei Dialysepatienten 1 Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät beim Dialysepatienten Irmgard Landthaler München 10.12.2009 Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät bei Dialysepatienten
10.12.2009 Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät bei Dialysepatienten 1 Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät beim Dialysepatienten Irmgard Landthaler München 10.12.2009 Zwischen Zuviel und Zuwenig: Diät bei Dialysepatienten
Störung des Mineral- und Knochenstoffwechsels bei chronischer Nierenerkrankung
 Prof. Dr. med. Helmut Geiger, Universitätsklinikum Frankfurt VNR: 2760512015149360014 Gültigkeitsdauer: 01.10.2015 30.09.2016 3 CME-Punkte Zertifiziert von der Ärztekammer Nordrhein Chronische Niereninsuffizienz
Prof. Dr. med. Helmut Geiger, Universitätsklinikum Frankfurt VNR: 2760512015149360014 Gültigkeitsdauer: 01.10.2015 30.09.2016 3 CME-Punkte Zertifiziert von der Ärztekammer Nordrhein Chronische Niereninsuffizienz
Nutzenbewertung. von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB V. Wirkstoff: Nepafenac. nach 2 Abs. 2 VerfO des G-BA
 Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB V Wirkstoff: Nepafenac nach 2 Abs. 2 VerfO des G-BA Datum der Veröffentlichung: 1. Oktober 2013 1 Nepafenac Zugelassenes Anwendungsgebiet
Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB V Wirkstoff: Nepafenac nach 2 Abs. 2 VerfO des G-BA Datum der Veröffentlichung: 1. Oktober 2013 1 Nepafenac Zugelassenes Anwendungsgebiet
Mann oh Mann. Mein TESTOSTERON. Wissenswertes über Testosteron. Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V.
 Mann oh Mann Mein TESTOSTERON Wissenswertes über Testosteron Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. www.mann-und-gesundheit.com Inhalt dieser Broschüre Testosteron Jeder Mann sollte darüber
Mann oh Mann Mein TESTOSTERON Wissenswertes über Testosteron Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. www.mann-und-gesundheit.com Inhalt dieser Broschüre Testosteron Jeder Mann sollte darüber
Bei Depressionen. schnell wirksam, stark 2
 Bei Depressionen schnell wirksam, stark 2 Cipralex - der RI der zweiten Generation 1 Wie wichtig ist Ihnen der bleibende Erfolg? Effektivität mit guter Verträglichkeit kombiniert 3 Und wie wichtig ist
Bei Depressionen schnell wirksam, stark 2 Cipralex - der RI der zweiten Generation 1 Wie wichtig ist Ihnen der bleibende Erfolg? Effektivität mit guter Verträglichkeit kombiniert 3 Und wie wichtig ist
Neueste Studienergebnisse in der Therapie der PAH
 Dualer Endothelin-Rezeptor-Antagonismus: Neueste Studienergebnisse in der Therapie der PAH Von Prof. Ralf Ewert, Greifswald Lübeck (10. April 2008) - Das Wissen um die Pathophysiologie der Pulmonalen Arteriellen
Dualer Endothelin-Rezeptor-Antagonismus: Neueste Studienergebnisse in der Therapie der PAH Von Prof. Ralf Ewert, Greifswald Lübeck (10. April 2008) - Das Wissen um die Pathophysiologie der Pulmonalen Arteriellen
Zertifikate: Nutzen für wen?
 Zertifikate: Nutzen für wen? Zertifikate = Bessere Qualität? Hans Ulrich Rothen, Vorsitzender Qualitätskommission Inselspital Zertifizierungen Überprüfung von Prozessen (Arbeitsabläufen) und deren Ergebnisse
Zertifikate: Nutzen für wen? Zertifikate = Bessere Qualität? Hans Ulrich Rothen, Vorsitzender Qualitätskommission Inselspital Zertifizierungen Überprüfung von Prozessen (Arbeitsabläufen) und deren Ergebnisse
Anhang III. Änderungen an relevanten Abschnitten der Fachinformation und der Packungsbeilage
 Anhang III Änderungen an relevanten Abschnitten der Fachinformation und der Packungsbeilage Hinweis: Änderungen an der Fachinformation und der Packungsbeilage müssen unter Umständen im Anschluss durch
Anhang III Änderungen an relevanten Abschnitten der Fachinformation und der Packungsbeilage Hinweis: Änderungen an der Fachinformation und der Packungsbeilage müssen unter Umständen im Anschluss durch
Erstellung eines eines Beispiels einer einer kostensensiblen Leitlinie (KSLL) in in der der Kardiologie im im Hinblick auf auf den den Einsatz
 Erstellung eines eines Beispiels einer einer kostensensiblen Leitlinie (KSLL) in in der der Kardiologie im im Hinblick auf auf den den Einsatz von von ICDs ICDs Dipl.-Kffr. Daniela Freyer Janine Biermann,
Erstellung eines eines Beispiels einer einer kostensensiblen Leitlinie (KSLL) in in der der Kardiologie im im Hinblick auf auf den den Einsatz von von ICDs ICDs Dipl.-Kffr. Daniela Freyer Janine Biermann,
Tragende Gründe. Therapiehinweis zu Sitagliptin. vom 18. Oktober 2007. Inhaltsverzeichnis. 1. Rechtsgrundlagen 2. 2. Eckpunkte der Entscheidung 2
 Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in Anlage 4: Therapiehinweis zu Sitagliptin vom 18.
Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in Anlage 4: Therapiehinweis zu Sitagliptin vom 18.
Kardiomyopathien. Kardiomyopathien -I- Dilatative, hypertrophe, restriktive und andere. Prof. Dr. med. Matthias Paul
 Kardiomyopathien Kardiomyopathien -I- -I- Dilatative, hypertrophe, restriktive und andere Dilatative, hypertrophe, restriktive und andere Prof. Dr. med. Matthias Paul Department für Kardiologie und Angiologie
Kardiomyopathien Kardiomyopathien -I- -I- Dilatative, hypertrophe, restriktive und andere Dilatative, hypertrophe, restriktive und andere Prof. Dr. med. Matthias Paul Department für Kardiologie und Angiologie
Strukturierung auf dem Niveau einer Textgliederung
 Klaus Menges, BfArM Mainz, 27. September 2011 Status Gesetzliche Vorgaben basieren auf der Richtlinie 2001/83/EG Nationale Implementierung durch 11a AMG Weitere strukturelle Vorgaben über so genannte QRD
Klaus Menges, BfArM Mainz, 27. September 2011 Status Gesetzliche Vorgaben basieren auf der Richtlinie 2001/83/EG Nationale Implementierung durch 11a AMG Weitere strukturelle Vorgaben über so genannte QRD
GV 2015 von SOLV-LN Swiss Organ Living-Donor Health Registry SOL-DHR Jürg Steiger, Basel
 GV 2015 von SOLV-LN Swiss Organ Living-Donor Health Registry SOL-DHR Jürg Steiger, Basel Häufig gestellte Fragen an SOL-DHR Sind Nachkontrollen überhaupt notwendig? Wie schätzt man die Nierenfunktion?
GV 2015 von SOLV-LN Swiss Organ Living-Donor Health Registry SOL-DHR Jürg Steiger, Basel Häufig gestellte Fragen an SOL-DHR Sind Nachkontrollen überhaupt notwendig? Wie schätzt man die Nierenfunktion?
Mimpara ist zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen nicht zugelassen.
 München, 25.03.2013 Mimpara (Cinacalcet) Wichtige sicherheitsrelevante Informationen für Angehörige der medizinischen Heilberufe bezüglich eines tödlich verlaufenden Falles einer schweren Hypokalzämie
München, 25.03.2013 Mimpara (Cinacalcet) Wichtige sicherheitsrelevante Informationen für Angehörige der medizinischen Heilberufe bezüglich eines tödlich verlaufenden Falles einer schweren Hypokalzämie
BAnz AT 07.07.2016 B4. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Dossier zur Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
 Dokumentvorlage, Version vom 18.04.2013 Dossier zur Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V Insulin degludec (Tresiba ) Novo Nordisk Pharma GmbH Modul 1 Zusammenfassung der Aussagen im Dossier Stand: 26.02.2015
Dokumentvorlage, Version vom 18.04.2013 Dossier zur Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V Insulin degludec (Tresiba ) Novo Nordisk Pharma GmbH Modul 1 Zusammenfassung der Aussagen im Dossier Stand: 26.02.2015
Subkutan oder intravenös? Besonderheiten bei der sub- kutanen Injektion von Herceptin
 Universität St. Gallen 5./6. September 2013 Subkutan oder intravenös? Besonderheiten bei der sub- kutanen Injektion von Herceptin Anja Kröner, MScN, HöFa I Onkologie, RN Pflegeexpertin Hämatologie und
Universität St. Gallen 5./6. September 2013 Subkutan oder intravenös? Besonderheiten bei der sub- kutanen Injektion von Herceptin Anja Kröner, MScN, HöFa I Onkologie, RN Pflegeexpertin Hämatologie und
Begleiten Sie Ihre Osteoporose-Patienten Wir begleiten Sie bei der Diagnostik der Osteoporose
 Begleiten Sie Ihre Osteoporose-Patienten Wir begleiten Sie bei der Diagnostik der Osteoporose Knochenmarker aus einer Hand Biomarker Osteoporose ist durch erniedrigte Knochenmasse und strukturelle Veränderungen
Begleiten Sie Ihre Osteoporose-Patienten Wir begleiten Sie bei der Diagnostik der Osteoporose Knochenmarker aus einer Hand Biomarker Osteoporose ist durch erniedrigte Knochenmasse und strukturelle Veränderungen
Schließen Sie gezielt Vitaminlücken bei Epilepsie.
 Schließen Sie gezielt Vitaminlücken bei Epilepsie. Weitere Fragen zum Thema Vitaminlücken bei Epilepsie beantworten wir Ihnen gerne: Desitin Arzneimittel GmbH Abteilung Medizin Weg beim Jäger 214 22335
Schließen Sie gezielt Vitaminlücken bei Epilepsie. Weitere Fragen zum Thema Vitaminlücken bei Epilepsie beantworten wir Ihnen gerne: Desitin Arzneimittel GmbH Abteilung Medizin Weg beim Jäger 214 22335
BAnz AT B3. Beschluss
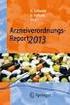 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
GEHT DA MEHR? Fragen und Antworten zum Thema Erektionsstörung
 GEHT DA MEHR? Fragen und Antworten zum Thema Erektionsstörung EREKTIONSSTÖRUNGEN Gute Nachrichten: Man(n) kann was tun! Wenn die Liebe auf kleiner Flamme brennt, kann dies eine vorübergehende Abkühlung
GEHT DA MEHR? Fragen und Antworten zum Thema Erektionsstörung EREKTIONSSTÖRUNGEN Gute Nachrichten: Man(n) kann was tun! Wenn die Liebe auf kleiner Flamme brennt, kann dies eine vorübergehende Abkühlung
Dr. med. M. Menzen Chefarzt der Abteilung Innere Medizin - Diabetologie. Vitamin Diabetes mellitus wie hängt das zusammen
 Dr. med. M. Menzen Chefarzt der Abteilung Innere Medizin - Diabetologie Vitamin Diabetes mellitus wie hängt das zusammen Vitamin Diabetes mellitus wie hängt das zusammen EINLEITUNG Holick, M. F., BMJ
Dr. med. M. Menzen Chefarzt der Abteilung Innere Medizin - Diabetologie Vitamin Diabetes mellitus wie hängt das zusammen Vitamin Diabetes mellitus wie hängt das zusammen EINLEITUNG Holick, M. F., BMJ
Beschluss. I. Die Anlage XII wird in alphabetischer Reihenfolge um den Wirkstoff Vortioxetin wie folgt ergänzt:
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Calcium/Vitamin-D3. in der Therapie mit Cortisonpräparaten. Osteoporose wirksam vorbeugen
 /Vitamin-D3 in der Therapie mit Cortisonpräparaten Osteoporose wirksam vorbeugen Liebe Leserin, lieber Leser, bei Rheuma, chronischen Lungenerkrankungen oder anderen entzündlichen Prozessen im Körper sowie
/Vitamin-D3 in der Therapie mit Cortisonpräparaten Osteoporose wirksam vorbeugen Liebe Leserin, lieber Leser, bei Rheuma, chronischen Lungenerkrankungen oder anderen entzündlichen Prozessen im Körper sowie
Die spezifische Vitaminkombination in nur einer Tablette.
 Die spezifische Vitaminkombination in nur einer Tablette. Die gezielte Vitaminergänzung bei medikamentös behandelter Epilepsie. Schließen Sie Ihre Vitaminlücken ganz gezielt. Hinweis EPIVIT ist ein ernährungsmedizinisch
Die spezifische Vitaminkombination in nur einer Tablette. Die gezielte Vitaminergänzung bei medikamentös behandelter Epilepsie. Schließen Sie Ihre Vitaminlücken ganz gezielt. Hinweis EPIVIT ist ein ernährungsmedizinisch
MediPreis Produktsteckbrief
 MediPreis Produktsteckbrief DOCPELIN NACHTSTERNE DOCPELIN Nachtsterne Filmtabletten Pelikan-Apotheke PZN: 04386054 Menge: 20 St Art: Filmtabletten Link: https://www.medipreis.de/04386054 Anwendungsgebiete
MediPreis Produktsteckbrief DOCPELIN NACHTSTERNE DOCPELIN Nachtsterne Filmtabletten Pelikan-Apotheke PZN: 04386054 Menge: 20 St Art: Filmtabletten Link: https://www.medipreis.de/04386054 Anwendungsgebiete
What`s new in arrhythmias? Highlights vom ESC 2006 in Barcelona
 What`s new in arrhythmias? Highlights vom ESC 2006 in Barcelona Bielefeld, 13.09.2006 ACC/AHA/ESC Guidelines 2006 for the Management of Patients With Atrial Fibrillation ACC/AHA/ESC Guidelines 2006 for
What`s new in arrhythmias? Highlights vom ESC 2006 in Barcelona Bielefeld, 13.09.2006 ACC/AHA/ESC Guidelines 2006 for the Management of Patients With Atrial Fibrillation ACC/AHA/ESC Guidelines 2006 for
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
2. Anzahl der Patienten bzw. Abgrenzung der für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Dialyseeineitung bei GFR < 8 ml/min PRO
 Dialyseeineitung bei GFR < 8 ml/min PRO 02. Dezember 2011 Martin K. Kuhlmann Vivantes Klinikum im Friedrichshain Berlin Anstieg der egfr bei Dialyseeinleitung in den USA Weiner D et al. AJKD 2011-2- 896,546
Dialyseeineitung bei GFR < 8 ml/min PRO 02. Dezember 2011 Martin K. Kuhlmann Vivantes Klinikum im Friedrichshain Berlin Anstieg der egfr bei Dialyseeinleitung in den USA Weiner D et al. AJKD 2011-2- 896,546
Satellitensymposium: AT1-Rezeptorblocker Gegenwart und Zukunft - 74. Jahrestagung der Deutschen
 Satellitensymposium: AT1-Rezeptorblocker Gegenwart und Zukunft - 74. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie am 27. März 2008 in Mannheim MORE Mehr Gefäßschutz durch Olmesartan Mannheim
Satellitensymposium: AT1-Rezeptorblocker Gegenwart und Zukunft - 74. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie am 27. März 2008 in Mannheim MORE Mehr Gefäßschutz durch Olmesartan Mannheim
Sekundärprävention von TVT/LE
 Sekundärprävention von TVT/LE Sekundärprävention TVT/ LE Studienlage Rivaroxaban (Xarelto ) Dabigatranetexilat (Pradaxa ) Apixaban (Eliquis ) Edoxaban (Lixiana ) Vergleich der 4 Substanzen bezogen auf
Sekundärprävention von TVT/LE Sekundärprävention TVT/ LE Studienlage Rivaroxaban (Xarelto ) Dabigatranetexilat (Pradaxa ) Apixaban (Eliquis ) Edoxaban (Lixiana ) Vergleich der 4 Substanzen bezogen auf
Medizinische Klinik II Medizinische Klinik IV
 CAMPUS GROSSHADERN CAMPUS INNENSTADT LOREM IPSUM SETUR ALARME Medizinische Klinik II Medizinische Klinik IV Effect of Mipomersen on LDL-Cholesterol levels in Patients with Severe LDL-Hypercholesterolemia
CAMPUS GROSSHADERN CAMPUS INNENSTADT LOREM IPSUM SETUR ALARME Medizinische Klinik II Medizinische Klinik IV Effect of Mipomersen on LDL-Cholesterol levels in Patients with Severe LDL-Hypercholesterolemia
des beeinträchtigten Sehvermögens aufgrund eines durch Diabetes verursachten Makulaödems;
 EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit Aflibercept Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für. Hierin wird erläutert,
EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit Aflibercept Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für. Hierin wird erläutert,
Endfassung vom. 13. März 2006
 DFG - Senatskommission zur Beurteilung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln Prof. Dr. G. Eisenbrand - Vorsitzender SKLM Natürliche Lebensmittel-Inhaltsstoffe: Beurteilung der Toxizität
DFG - Senatskommission zur Beurteilung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln Prof. Dr. G. Eisenbrand - Vorsitzender SKLM Natürliche Lebensmittel-Inhaltsstoffe: Beurteilung der Toxizität
Medikamentöse Therapie: Was brauche ich wirklich?
 Medikamentöse Therapie: Was brauche ich wirklich? Nebenwirkungen Dr. Christoph Hammerstingl Medizinische Klinik und Poliklinik II Universitätsklinikum tsklinikum Bonn Direktor Prof. Dr. G. Nickenig AGENDA
Medikamentöse Therapie: Was brauche ich wirklich? Nebenwirkungen Dr. Christoph Hammerstingl Medizinische Klinik und Poliklinik II Universitätsklinikum tsklinikum Bonn Direktor Prof. Dr. G. Nickenig AGENDA
Neue Daten zur endokrinen Therapie des Mammakarzinoms
 2010 Neue Daten zur endokrinen Therapie des Mammakarzinoms C. Wolf Medizinisches Zentrum ULM - Kooperatives Brustzentrum ULM/ NEU ULM Adjuvante Therapie Postmenopause: NCIC CTG MA.27 (Paul Goss) Prämenopause:
2010 Neue Daten zur endokrinen Therapie des Mammakarzinoms C. Wolf Medizinisches Zentrum ULM - Kooperatives Brustzentrum ULM/ NEU ULM Adjuvante Therapie Postmenopause: NCIC CTG MA.27 (Paul Goss) Prämenopause:
Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis
 Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe G and Scarabin PY. BMJ May 2008;336:1227-1231
Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe G and Scarabin PY. BMJ May 2008;336:1227-1231
Kostenreduktion durch Prävention?
 Gesundheitsökonomische Aspekte der Prävention: Kostenreduktion durch Prävention? Nadja Chernyak, Andrea Icks Jahrestagung DGSMP September 2012 Agenda Spart Prävention Kosten? Ist Prävention ökonomisch
Gesundheitsökonomische Aspekte der Prävention: Kostenreduktion durch Prävention? Nadja Chernyak, Andrea Icks Jahrestagung DGSMP September 2012 Agenda Spart Prävention Kosten? Ist Prävention ökonomisch
How does the Institute for quality and efficiency in health care work?
 Health Care for all Creating Effective and Dynamic Structures How does the Institute for quality and efficiency in health care work? Peter T. Sawicki; Institute for Quality and Efficiency in Health Care.
Health Care for all Creating Effective and Dynamic Structures How does the Institute for quality and efficiency in health care work? Peter T. Sawicki; Institute for Quality and Efficiency in Health Care.
Vitamin D: auch Bedeutung beim Diabetes?
 Vitamin D: auch Bedeutung beim Diabetes? Armin Steinmetz St.Nikolaus-Stiftshospital Akad. Lehrkrankenhaus der Uni. Bonn, Andernach Weimar 23.4.16 Vitamin D Mangel bei deutschen Erwachsenen 1763 Männer
Vitamin D: auch Bedeutung beim Diabetes? Armin Steinmetz St.Nikolaus-Stiftshospital Akad. Lehrkrankenhaus der Uni. Bonn, Andernach Weimar 23.4.16 Vitamin D Mangel bei deutschen Erwachsenen 1763 Männer
Ein Kind, ein Zahn? Vollwertige Ernährung nach DGE schützt vor Calcium-Mangel in der Schwangerschaft und Stillzeit
 Ein Kind, ein Zahn? Vollwertige Ernährung nach DGE schützt vor Calcium-Mangel in der Schwangerschaft und Stillzeit Erik David DA-Kurs 06 Fach: Ernährungslehre Gliederung Aufgaben im Körper Resorption und
Ein Kind, ein Zahn? Vollwertige Ernährung nach DGE schützt vor Calcium-Mangel in der Schwangerschaft und Stillzeit Erik David DA-Kurs 06 Fach: Ernährungslehre Gliederung Aufgaben im Körper Resorption und
The Cochrane Library
 The Cochrane Library Was ist die Cochrane Library? Die Cochrane Library bietet hochwertige, evidenzbasierte medizinische Fachinformation zur fundierten Unterstützung bei Diagnose und Behandlung. http://www.cochranelibrary.com/
The Cochrane Library Was ist die Cochrane Library? Die Cochrane Library bietet hochwertige, evidenzbasierte medizinische Fachinformation zur fundierten Unterstützung bei Diagnose und Behandlung. http://www.cochranelibrary.com/
KDIGO Clinical Practice Guideline. Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease - Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD)
 KDIGO Clinical Practice Guideline Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease - Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) Neue KDIGO CKD-MBD Leitlinien Markus Ketteler Klinikum
KDIGO Clinical Practice Guideline Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease - Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) Neue KDIGO CKD-MBD Leitlinien Markus Ketteler Klinikum
28. Berliner DialyseSeminar Spezifische Pharmakologie der renalen Anämie: Eisen, EPO und Erythrozyten
 28. Berliner DialyseSeminar Spezifische Pharmakologie der renalen Anämie: Eisen, EPO und Erythrozyten Dominik Uehlinger Klinik für Nephrologie, Hypertonie und Klinische Pharmakologie, Universität Bern,
28. Berliner DialyseSeminar Spezifische Pharmakologie der renalen Anämie: Eisen, EPO und Erythrozyten Dominik Uehlinger Klinik für Nephrologie, Hypertonie und Klinische Pharmakologie, Universität Bern,
Die Schwerhörigkeit im Alter. Martin Burian KH der Barmherzigen Schwestern Linz Abteilung für Hals Nasen Ohrenheilkunde
 Die Schwerhörigkeit im Alter Martin Burian KH der Barmherzigen Schwestern Linz Abteilung für Hals Nasen Ohrenheilkunde Definition: Presbyakusis ( Altersschwerhörigkeit, englisch presbycusis, auch presbyacusis)
Die Schwerhörigkeit im Alter Martin Burian KH der Barmherzigen Schwestern Linz Abteilung für Hals Nasen Ohrenheilkunde Definition: Presbyakusis ( Altersschwerhörigkeit, englisch presbycusis, auch presbyacusis)
Willkommen zum. Weltnierentag 2012. Stadtspital Waid Zürich! Nephrologie
 Willkommen zum Weltnierentag 2012 am Stadtspital Waid Zürich! Vortrag Video Erfahrungsbericht eines Patienten Fragen und Diskussion Apéro Nierentest 3 Steckbriefe von Nierenkranken Wie manifestiert
Willkommen zum Weltnierentag 2012 am Stadtspital Waid Zürich! Vortrag Video Erfahrungsbericht eines Patienten Fragen und Diskussion Apéro Nierentest 3 Steckbriefe von Nierenkranken Wie manifestiert
Nephrologischer Sommer 2015
 Nephrologischer Sommer 2015 4.bis 5. September 2015 Kurzentrum Bad Hofgastein, Salzburg Total Nutrition Therapy Renal Festakt zum 30 Jahre Jubiläum der Dialyse in Bad Hofgastein Organisatoren: Prof. Dr.
Nephrologischer Sommer 2015 4.bis 5. September 2015 Kurzentrum Bad Hofgastein, Salzburg Total Nutrition Therapy Renal Festakt zum 30 Jahre Jubiläum der Dialyse in Bad Hofgastein Organisatoren: Prof. Dr.
Definition der Osteoporose
 Definition der Osteoporose Ø SVGO 2010, (DVO Leitlinien 2009) Systemische Skeletterkrankung, die durch eine verminderte Knochenmasse und Störung der Knochenarchitektur (Knochenintegrität) zu einer verminderten
Definition der Osteoporose Ø SVGO 2010, (DVO Leitlinien 2009) Systemische Skeletterkrankung, die durch eine verminderte Knochenmasse und Störung der Knochenarchitektur (Knochenintegrität) zu einer verminderten
Impressum. Verlag Kirchheim + Co GmbH Kaiserstraße 41, Mainz, Telefon / Verantwortlicher Redakteur: Dr. med.
 Verkalkung Impressum Verlag Kirchheim + Co GmbH Kaiserstraße 41, 55116 Mainz, Telefon 0 61 31 / 9 60 70-0 Verantwortlicher Redakteur: Dr. med. Albert Röder Titelillustration: Agentur Focus/SPL Herausgeber:
Verkalkung Impressum Verlag Kirchheim + Co GmbH Kaiserstraße 41, 55116 Mainz, Telefon 0 61 31 / 9 60 70-0 Verantwortlicher Redakteur: Dr. med. Albert Röder Titelillustration: Agentur Focus/SPL Herausgeber:
Die spezifische Vitaminkombination in nur einer Tablette.
 Die spezifische Vitaminkombination in nur einer Tablette. Die gezielte Vitaminergänzung bei medikamentös behandeltem Morbus Parkinson. Schließen Sie Ihre Vitaminlücken ganz gezielt. Hinweis PARKOVIT ist
Die spezifische Vitaminkombination in nur einer Tablette. Die gezielte Vitaminergänzung bei medikamentös behandeltem Morbus Parkinson. Schließen Sie Ihre Vitaminlücken ganz gezielt. Hinweis PARKOVIT ist
Prof. Dr. Dr. Martin HärterH
 Effekte von Shared Decision-Making Forschungsstand zur Adherence Prof. Dr. Dr. Martin HärterH Fachtagung Adherence Berlin 11.12.2009 Definition Adherence ist definiert als das Ausmaß, in welchem das Verhalten
Effekte von Shared Decision-Making Forschungsstand zur Adherence Prof. Dr. Dr. Martin HärterH Fachtagung Adherence Berlin 11.12.2009 Definition Adherence ist definiert als das Ausmaß, in welchem das Verhalten
Chronische und dialysepflichtige Niereninsuffizienz
 Übersicht Review Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Jahrgang 42, Nr. /2013, S. 1 6 Chronische und dialysepflichtige Niereninsuffizienz vom Stadium III bis Stadium VD Was ist diagnostisch sinnvoll und wann?
Übersicht Review Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Jahrgang 42, Nr. /2013, S. 1 6 Chronische und dialysepflichtige Niereninsuffizienz vom Stadium III bis Stadium VD Was ist diagnostisch sinnvoll und wann?
BAnz AT 23.04.2015 B2. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Ärzteforum Davos Chronische Niereninsuffizienz. Topics. Definition und Stadieneinteilung
 Ärzteforum Davos Chronische Niereninsuffizienz Prof. Thomas Fehr Chefarzt Departement Innere Medizin Kantonsspital Graubünden Topics Chronische Niereninsuffizienz Definition und Stadieneinteilung Renales
Ärzteforum Davos Chronische Niereninsuffizienz Prof. Thomas Fehr Chefarzt Departement Innere Medizin Kantonsspital Graubünden Topics Chronische Niereninsuffizienz Definition und Stadieneinteilung Renales
GFR / Kreatinin Clearance < 60 ml/min/ 1,73m 2. Δ Serum Kreatinin Anstieg > 50% Niereninsuffizienz ja oder nein? Wie heisst der Referent?
 Quelle: youtube.com Wie heisst der Referent? Niereninsuffizienz ja oder nein? GFR / Kreatinin Clearance < 60 ml/min/ 1,73m 2 Soll man die Kreatinin Clearance messen oder berechnen?? Δ Serum Kreatinin Anstieg
Quelle: youtube.com Wie heisst der Referent? Niereninsuffizienz ja oder nein? GFR / Kreatinin Clearance < 60 ml/min/ 1,73m 2 Soll man die Kreatinin Clearance messen oder berechnen?? Δ Serum Kreatinin Anstieg
Der Nephrologe. Elektronischer Sonderdruck für. P.M. Jehle. High-turnover-Osteodystrophie. Ein Service von Springer Medizin
 Der Nephrologe Zeitschrift für Nephrologie und Hypertensiologie Organ der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin Organ des Berufsverbandes Deutscher Internisten Elektronischer Sonderdruck für P.M. Jehle
Der Nephrologe Zeitschrift für Nephrologie und Hypertensiologie Organ der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin Organ des Berufsverbandes Deutscher Internisten Elektronischer Sonderdruck für P.M. Jehle
Haut, Haare, Nägel. Ratgeber für Patienten
 Haut, Haare, Nägel Ratgeber für Patienten Inhalt Unsere Haut: Spiegel von Seele und Körper... 2 Schöne Haut an und für sich............. 4 Mit Haut und Haar...................... 6 Wozu braucht unser
Haut, Haare, Nägel Ratgeber für Patienten Inhalt Unsere Haut: Spiegel von Seele und Körper... 2 Schöne Haut an und für sich............. 4 Mit Haut und Haar...................... 6 Wozu braucht unser
Isotonische Kochsalzlösung 0,9% Infusionslösung
 Gebrauchsinformation und Fachinformation SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12 95119 Naila Isotonische Kochsalzlösung 0,9% Infusionslösung Diese Packungsbeilage beinhaltet: 1. Was ist Isotonische
Gebrauchsinformation und Fachinformation SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12 95119 Naila Isotonische Kochsalzlösung 0,9% Infusionslösung Diese Packungsbeilage beinhaltet: 1. Was ist Isotonische
C. Reviews, Editorials
 C. Reviews, Editorials 77. HASSLACHER C., WOLF G., KEMPE P., RITZ E Praxis-Leitlinien DDG: Nephropathie bei Diabetes Diabetologie 2014; 9: S111 S114 (http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-13854089) 76. HASSLACHER
C. Reviews, Editorials 77. HASSLACHER C., WOLF G., KEMPE P., RITZ E Praxis-Leitlinien DDG: Nephropathie bei Diabetes Diabetologie 2014; 9: S111 S114 (http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-13854089) 76. HASSLACHER
Ödeme, Hypertonie und Herzinsuffizienz wurden im Zusammenhang mit NSAID - Behandlung berichtet.
 Alle rezeptpflichtigen nicht-selektiven NSAIDs zur systemischen Anwendung Für alle Präparate ohne fixes Dosierungsschema: 4.2. Dosierung, Art und Dauer der Anwendung 4.3. Gegenanzeigen Schwere Herzinsuffizienz
Alle rezeptpflichtigen nicht-selektiven NSAIDs zur systemischen Anwendung Für alle Präparate ohne fixes Dosierungsschema: 4.2. Dosierung, Art und Dauer der Anwendung 4.3. Gegenanzeigen Schwere Herzinsuffizienz
Einsatz neuer Medikamente: GLP1-Analoga & DPP4-Hemmer
 16. Welt Diabetes Tag an der Charité Einsatz neuer Medikamente: GLP1-Analoga & DPP4-Hemmer Lenka Bosanska Was bedeutet: GLP-1 DPP-4 Hormone des Glucosestoffwechsels Pankreas (Bauchspeicheldrüse) Insulin
16. Welt Diabetes Tag an der Charité Einsatz neuer Medikamente: GLP1-Analoga & DPP4-Hemmer Lenka Bosanska Was bedeutet: GLP-1 DPP-4 Hormone des Glucosestoffwechsels Pankreas (Bauchspeicheldrüse) Insulin
Langzeitfolgen durch Dialysebehandlung. Langzeitfolgen durch bei Dialysebehandlung. Probleme der Langzeitdialyse
 Langzeitfolgen durch Dialysebehandlung Seminar Junge Nierenkranke Deutschland e.v., Bonn 19. März 2004 PD Dr. Bernd Krumme Zentrum für Nieren- und Hochdruckkrankheiten an der Deutschen Klinik für Diagnostik
Langzeitfolgen durch Dialysebehandlung Seminar Junge Nierenkranke Deutschland e.v., Bonn 19. März 2004 PD Dr. Bernd Krumme Zentrum für Nieren- und Hochdruckkrankheiten an der Deutschen Klinik für Diagnostik
A. Wutte, J. Plank, M. Bodenlenz, C. Magnes, W. Regittnig, F. Sinner, B. Rønn, M. Zdravkovic, T. R. Pieber
 Proportional ose Response Relationship and Lower Within Patient Variability of Insulin etemir and NPH Insulin in Subjects With Type 1 iabetes Mellitus A. Wutte, J. Plank, M. Bodenlenz, C. Magnes, W. Regittnig,
Proportional ose Response Relationship and Lower Within Patient Variability of Insulin etemir and NPH Insulin in Subjects With Type 1 iabetes Mellitus A. Wutte, J. Plank, M. Bodenlenz, C. Magnes, W. Regittnig,
Nierenersatzverfahren
 Diese erlaubt es den Zuhörern ihre Einschätzung durch Knopfdruck für eine der von Euch vorbereiteten Antwortoptionen kundzutun. Innert weniger Sekunden wird dann das Voting Ergebnis projiziert. Dies erlaubt
Diese erlaubt es den Zuhörern ihre Einschätzung durch Knopfdruck für eine der von Euch vorbereiteten Antwortoptionen kundzutun. Innert weniger Sekunden wird dann das Voting Ergebnis projiziert. Dies erlaubt
Gebrauchsinformation: Information für Anwender
 Gebrauchsinformation: Information für Anwender Vitagutt Vitamin E 670 mg, Weichkapsel Zur Anwendung bei Erwachsenen Wirkstoff: 1000 mg all-rac-alpha-tocopherolacetat (entsprechend 670 mg RRR-alpha- Tocopherol-Äquivalente).
Gebrauchsinformation: Information für Anwender Vitagutt Vitamin E 670 mg, Weichkapsel Zur Anwendung bei Erwachsenen Wirkstoff: 1000 mg all-rac-alpha-tocopherolacetat (entsprechend 670 mg RRR-alpha- Tocopherol-Äquivalente).
Die Schilddrüse. Herzlich willkommen
 Herzlich willkommen Hast du Über oder Unterfunktion? Woran die Schilddrüse alles schuld sein soll. Missverständnisse über die Schilddrüse Referent: Ansgar Hantke Facharzt für Allgemeinmedizin Steckbrief
Herzlich willkommen Hast du Über oder Unterfunktion? Woran die Schilddrüse alles schuld sein soll. Missverständnisse über die Schilddrüse Referent: Ansgar Hantke Facharzt für Allgemeinmedizin Steckbrief
