1. Einleitung. Einleitung 1
|
|
|
- Heinz Auttenberg
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einleitung 1 1. Einleitung Acetylphosphat ist ein wichtiges energiereiches Stoffwechselintermediat, das jedoch selten durch Substratphosphorylierung entsteht und als Cosubstrat für die Synthese von ATP zur Energiekonservierung dient. Zu den Enzymen, die die Bildung von Acetylphosphat katalysieren, gehören die Phosphotransacetylase (Stadtman, 1955), die Phosphoketolase (Merkler und Retey, 1981) und die Pyruvat-Oxidase (Müller und Schulz, 1993). Acetylphosphat ist jedoch auch das Produkt der Reduktion der proteinogenen Aminosäure Glycin in einer Stickland-Reaktion, in der die Synthese von Acetylphosphat als letzter Energie konservierender Schritt durch das Protein C der Glycin-Reduktase katalysiert wird (Arkowitz und Abeles, 1989; Schräder und Andreesen, 1992; Stadtman, 1989). Analog zur Coenzym A abhängigen Katalyse der Phosphotransacetylase erfolgt hier die Bildung von Acetylphosphat aus einem an Protein C gebundenen Acetylthioester und freiem Phosphat (Arkowitz und Abeles, 1991). Zu den Organismen, die diesen Weg der Bildung von Acetylphosphat einschlagen, zählen u. a. Eubacterium acidaminophilum, Clostridium purinolyticum, C. litorale, C. sticklandii, T. creatinophila, Peptostreptococcus micros und P. magnus (Andreesen, 1994; Andreesen, 1994; Andreesen et al., 1989; Arkowitz und Abeles, 1989; Dürre und Andreesen, 1982; Dürre und Andreesen, 1983; Harms et al., 1998; Schräder und Andreesen, 1992; Stadtman, 1989). E. acidaminophilum, ein grampositives, obligat anaerobes Bakterium (Zindel et al., 1988), gehört zu den am besten untersuchten Organismen mit einer Stickland-Reaktion, die sowohl Glycin als auch die beiden Glycin-Derivate Betain und Sarkosin reduzieren kann (Andreesen, 1994). In einer Stickland-Reaktion werden zwei Aminosäuren fermentiert, eine wird als Elektronendonator oxidiert und die andere als Elektronenakzeptor reduziert. E. acidaminophilum ist in der Lage, Glycin als alleinige Kohlenstoffquelle sowohl zu reduzieren als auch zu oxidieren. Die Oxidation von Glycin verläuft über die Glycin- Decarboxylase, Methylen-Tetrahydrofolat-Dehydrogenase, N5,10-Methenyl-tetrahydrofolat- Cyclohydrolase, N10-Formyl-Tretrahydrofolat-Synthetase und die Formiat-Dehydrogenase (Freudenberg und Andreesen, 1989; Freudenberg et al., 1989) zu Kohlendioxid und NAD(P)H+H +, dessen Redoxäquivalente anschließend über Thioredoxin-Reduktase und Thioredoxin der Reduktion von Glycin zugeführt werden (Dietrichs et al., 1991). Die beiden methylierten Glycin-Derivate Sarkosin und Betain werden von E. acidaminophilum nur als Elektronenakzeptoren genutzt und zu Methylamin bzw. Trimethylamin und Acetylphosphat reduziert (Hormann und Andreesen, 1989). Dafür nötige Redoxäquivalente werden z. B. durch NADPH+H + aus der Oxidation von Formiat durch die Formiat-Dehydrogenase über das Thioredoxin-System bereitgestellt (Granderath, 1993; Zindel et al., 1988). Die Glycin-, Betain- und Sarkosin-Reduktase bestehen aus drei Proteinkomplexen A, B und C. Protein A und jeweils eine Untereinheit des Substrat-spezifischen Proteins B, PB Glycin, PB Betain und PB Sarkosin, enthalten Selen in Form von Selenocystein (Cone et al., 1976; Wagner et al., 1999). Das Glycin-spezifische Selenoprotein PB Glycin und das Sarkosin-spezifische Selenoprotein PB Sarkosin bestehen jeweils aus drei Untereinheiten mit Molekülmassen von 47 kda, 25 kda und 22 kda, während das Betain-spezifische PBBetain nur aus zwei Untereinheiten der Größen 48 kda und 45 kda besteht. Erstaunlicherweise liegen diesen Untereinheiten in allen Fällen zwei Genprodukte zugrunde (Abb. 1). Die 47 kda- Untereinheiten der Glycin- und Sarkosin-spezifischen und die 45 kda-untereinheit des Betain-spezifischen Selenoproteins B, die GrdB, GrdF und GrdH genannt werden (Abb. 1), enthalten das Selenocystein (U) in der mutmaßlich redoxaktiven Sequenz UXXCXXC (Sonntag, 1998; Wagner et al., 1999). Für die 25 kda-untereinheiten und 22 kda- Untereinheiten des Protein B der Glycin- und Sarkosin-Reduktase wurde nach Vergleich von
2 Einleitung 2 Peptid-Sequenzen der 25 kda- und 22 kda-untereinheiten mit den Aminosäuresequenzen der Genprodukte von grde und grdg eine Entstehung durch autoproteolytische Cysteinolyse der Proproteine GrdE (PB Glycin ) und GrdG (PB Sarkosin ) (Wagner et al., 1999) postuliert. In vitro wurde diese Spaltung am rekombinanten Proprotein GrdE der Glycin-Reduktase aus C. sticklandii nach heterologer Expression in Escherichia coli nachgewiesen (Bednarski, 1999). PB Betain besteht lediglich aus der selenocysteinhaltigen 45 kda-untereinheit GrdH und einer 48 kda-untereinheit GrdI (Meyer et al., 1995), die nicht Produkte einer Spaltung sind. Dies könnte mit der möglichen unterschiedlichen Art der Substratbindung im Fall von Betain als quartäre Ammoniumverbindung zusammenhängen, die über ionische Wechselwirkung erfolgen könnte (Meyer et al., 1995). Das universelle Selenoprotein A der Reduktasen aus E. acidaminophilum besitzt ein Molekulargewicht von 17 kda (Lübbers und Andreesen, 1993) und enthält wie die Selenoproteine B Selen in Form von Selenocystein (Cone et al., 1976) in der redoxaktiven Konsensus-Sequenz CXXU (Lübbers und Andreesen, 1993). Protein C (Abb. 1) der Glycin-, Betain-und Sarkosin-Reduktasen besteht aus zwei Untereinheiten GrdC mit einer apparenten Molekülmasse von 57 kda und GrdD mit der von 48 kda (Schräder und Andreesen, 1992). Die Gene aller Untereinheiten der Substrat-spezifischen Selenoproteine B der Glycin-, Sarkosin-und Betain-Reduktasen und des Selenoproteins A aus E. acidaminophilum wurden kloniert und liegen in mehreren Gensätzen angeordnet chromosomal lokalisiert vor (Lübbers, 1993; Lübbers und Andreesen, 1993; Wagner et al., 1999). Im folgenden wird der postulierte Mechanismus der Reduktion von Glycin, Betain und Sarkosin dargestellt: Die Substrate werden durch die spezifischen Selenoproteine B gebunden, wobei die Bindung von Glycin und Sarkosin als Schiffsche Base kovalent an einer Carbonylfunktion der 47 kda- Untereinheiten erfolgt, während Betain als quartäre Ammoniumverbindung über ionische Wechselwirkungen an die 45 kda-untereinheit gebunden sein sollte. Die Rolle der anderen Untereinheiten ist unklar. In Betain verursacht das quartanäre Ammoniumion bereits die Polarisierung der C-N-Bindung. In allen drei Substraten (Glycin, Sarkosin und Betain) sollte die C-N-Bindung nach Aktivierung so polarisiert vorliegen, daß ein nucleophiler Angriff des Selenol-Anions zum Carboxymethylselenoether führt. Im nächsten Schritt erfolgt ein Angriff der Selenol-Gruppe des Selenocysteins an das α-c- Atom der polarisierten C-N-Bindung, so daß ein Protein B gebundener Carboxymethylselenoether (Abb. 1) unter späterer z. T. hydrolytischen Freisetzung von Ammoniak, Methylamin bzw. Trimethylamin gebildet wird. Ursprünglich wurde dieser Schritt der ersten Selenoether-Bildung erst für die Übertragung auf Selenoprotein A postuliert (Andreesen, 1994; Arkowitz und Abeles, 1990; Garcia und Stadtman, 1991), jedoch ist nach dem Nachweis von Selenocystein in den 47 kda-untereinheiten und der 45 kda-untereinheit (Sonntag, 1998; Wagner et al., 1999) die Carboxymethylselenoether-Bildung an den Selenoproteinen B sehr wahrscheinlich, zumal eine kovalente Bindung der radioaktiv markierten Substrate Glycin bzw. Sarkosin nach Borhydrid-Behandlung an die entsprechenden Proteine B gezeigt werden konnte (Harms et al., 1998; Meyer et al., 1995). Im nächsten Schritt erfolgt eine Umetherung des Carboxymethyl-Rests von Selenoprotein B auf Selenoprotein A (Arkowitz und Abeles, 1990; Garcia und Stadtman, 1991), das als Überträger des Carboxymethyl-Rests nach Protein C fungiert. Das nach dieser Redoxreaktion an Selenoprotein A vorliegende Selenid-Sulfid wird in der internen Stickland-Reaktion über die Redoxäquivalente von NADPH+H + der Oxidation über das Thioredoxin-System (Dietrichs et al., 1990) zur Selenol/Thiol-Gruppe reduziert, so daß es wieder für eine erneute Carboxymethylselenoether-Bindung zur Verfügung steht (Abb. 1).
3 Einleitung 3 Der Carboxymethylselenoether an Selenoprotein A ist das Substrat der Katalyse von Protein C, bei der über einen Protein C gebundenen Acetylthioester und freiem Phosphat Acetylphosphat entsteht (Abb. 1). Das Protein C der Glycin-, Sarkosin-und Betain-Reduktase aus E. acidaminophilum war Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Acetylphosphat wurde als Endprodukt der Reaktion von carboxymethylierten Selenoprotein A, Protein C und freiem Phosphat nachgewiesen (Arkowitz und Abeles, 1989; Schräder und Andreesen, 1992; Stadtman, 1989). Die Hypothese, nach der vor Bildung von Acetylphosphat die Umwandlung des Carboxymethylselenoether gebunden an Selenoprotein A in einen Acetylthioester an Protein C erfolgt, wurde nach der Isolierung und Charakterisierung eines Acetyl-Protein C- Intermediats (Arkowitz und Abeles, 1991) aufgestellt. Neben der Bildung von Acetylphosphat katalysiert Protein C aber auch in der rückläufigen Reaktion, die arsenatabhängige Hydrolyse von Acetylphosphat, unter eventueller Bildung eines Acetylthioesters an Protein C zu Acetat, Phosphat und Arsenat. Aus dieser unphysiologischen Rückreaktion wurde ein Enzymtest etabliert, über den die Enzymaktivität von Protein C aus den Organismen C. sticklandii (Stadtman, 1989), E. acidaminophilum (Schräder und Andreesen, 1992) und T. creatinophila (Harms et al., 1998) bestimmt und die Proteine gereinigt wurden. Durch Inkubation mit dem thiolspezifischen Reagenz Jodacetat wird Protein C irreversibel inaktiviert (Stadtman, 1989; Stadtman und Davis, 1991). Die Inaktivierung blieb aus, wenn vor der Inkubation mit Jodacetat das unphysiologische Substrat Acetylphosphat zugegeben wurde. Möglicherweise schützte die Acetylthioesterbildung an einer katalytisch essentiellen Thiol-Gruppe Protein C vor einer irreversiblen Inaktivierung durch Carboxymethylierung (Stadtman und Davis, 1991). Diese Enzymaktivität von Protein C ist Mg 2+ -abhängig und wird durch Zugabe reduzierender Agenzien stimuliert (Harms et al., 1998; Schräder und Andreesen, 1992; Stadtman, 1989). Acetylphosphat wirkt als Substratinhibitor auf die Enzymaktivität (Harms et al., 1998; Schräder und Andreesen, 1992). Das Protein C aller drei Organismen besteht aus zwei verschiedenen Untereinheiten. Bei der Bestimmung der nativen Molekülmasse im Bereich von 45 bis 400 kda zeigte sich ein ausgeprägtes Assoziations-Dissoziationsverhalten dieses Proteinkomplexes (Harms et al., 1998; Schräder und Andreesen, 1992; Stadtman, 1989). An welchem Cystein-Rest der beiden Untereinheiten von Protein C die Bildung des Acetylthioesters stattfindet, wurde nicht geklärt. Nach der Reinigung von Protein C aus E. acidaminophilum wurde postuliert, daß an der 48 kda-untereinheit die Bildung des Acetylthioesters und die Freisetzung von Acetylphosphat erfolgt, denn die Untereinheit wurde von der 57 kda-untereinheit partiell getrennt gereinigt und war in der Lage, die arsenatabhängige Hydrolyse von Acetylphosphat zu katalysieren (Schräder und Andreesen, 1992). Welche Thiol-Gruppe in der 48 kda-untereinheit für die Acetylthioesterbildung in Frage kam, war noch ungeklärt, da beide Kopien des Gens der 48 kda-untereinheit grdd1 und grdd2 in E. acidaminophilum noch unvollständig kloniert stromabwärts der beiden Gene grdc1 und grdc2 vorlagen (Lübbers, 1993) und daher die Zahl der Cystein-Reste von GrdD noch unklar war. Der Transfer des Carboxymethyl-Rests von Selenoprotein A nach GrdD war noch völlig unverstanden. Da es durch die Charakterisierung des Acetyl-Enzym-Intermediats Hinweise auf eine Acetylthioesterbildung an Protein C gab (Arkowitz und Abeles, 1991), mußte es zu einer reduktiven Spaltung des an Selenoprotein A gebundenen Carboxymethylselenoethers unter Freisetzung von H 2 O kommen. Dies wäre bei einem möglichen nucleophilen Angriff einer reaktiven Thiol-Gruppe an den Carbonyl-Kohlenstoff und einer primären Acetylthioesterbildung an GrdC unter Freisetzung von H 2 O der Fall. Der Acetyl-Rest könnte durch eine anschließende Transacetylierung auf GrdD übertragen werden, an dem dann die Bildung und Freisetzung von Acetylphosphat erfolgt. Die 57 kda-untereinheit konnte in
4 Einleitung 4 Selenoprotein B Selenoprotein A Protein C Glycin GrdB GrdE GrdB-Carboxymethylselenoether Sarcosin GrdF GrdG GrdF-Carboxymethylselenoether GrdA- Se-CH2-COOH GrdC GrdD ~Acetyl P i Acetyl~P Betain GrdH GrdI GrdH-Carboxymethylselenoether GrdA- - Se GrdA- S Se Trx S Trx S Abb. 1 Schematische Darstellung der Reduktion von Glycin, Sarkosin und Betain, katalysiert durch die Proteine der Glycin-, Sarkosin- und Betain-Reduktase in E. acidaminophilum. Dargestellt ist der Carboxymethylselenoether an den Untereinheiten GrdB, GrdF und GrdH der Substrat-spezifischen Proteine B der Reduktase-Komplexe. Anschließend erfolgt die Umetherung auf Selenoprotein A. Der Carboxymethyl-Rest wird nach Protein C transferiert, wo ein energiereiches Acetyl-Protein C-Intermediat an den Untereinheiten sowie oxidiertes Selenoprotein A gebildet wird. Der an Protein C gebundenene Acetylthioester wird als Acetylphosphat freigesetzt. Das Selenid-Sulfid an Selenoprotein A wird zu einem Selenol-Thiol durch Redoxäquivalente aus dem Thioredoxin-System überführt. GrdB: selenocysteinhaltige 47 kda-untereinheit von Selenoprotein B Glycin, GrdE: Proprotein der 25- und 22 kda-untereinheiten von Selenoprotein B Glycin, GrdF: selenocysteinhaltige 47 kda-untereinheit von Selenoprotein B Sarkosin, GrdG: Proprotein der 25- und 22 kda- Untereinheiten von Selenoprotein B Sarkosin, GrdH: selenocysteinhaltige 45 kda-untereinheit von Selenoprotein B Betain, GrdI: 48 kda-untereinheit von Selenoprotein B Betain, GrdA: Selenoprotein A, GrdC: 57 kda-untereinheit von Protein C, GrdD: 48 kda-untereinheit von Protein C, Trx: Thioredoxin bisher durchgeführten Untersuchungen nur unter denaturierenden Bedingungen von der 48 kda-untereinheit abgetrennt werden (Harms, 1995), daher ist ihre Rolle noch völlig unklar. Bei der Überführung des Carboxymethyl-Rests von Selenoprotein A in einen Acetylthioester an Protein C wurde die Entstehung eines reaktiven Keten-Intermediats postuliert, welches durch eine von Protein C gebildete hydrophobe Tasche vor einem Angriff durch H 2 O geschützt und anschließend als Acetylthioester an Protein C gebunden wird (Buckel, 1990). Die Aminosäuresequenz der 57 kda-untereinheit GrdC enthält sechs Cystein-Reste, an deren Thiol-Gruppen eine solche Acetylthioesterbildung erfolgen könnte (Lübbers, 1993). Die Aminosäuresequenzen wurden aus den Kopien des Gens der 57 kda-untereinheit grdc1 und grdc2 abgeleitet und sind zu 99 % identisch (Lübbers, 1993). grdc1 wurde mit dem Gensatz I der Glycin-Reduktase kloniert und befand sich stromabwärts von grda1, einer Kopie des Gens von Selenoprotein A. Im Gensatz II der Glycin-Reduktase stromabwärts von trxa2, einer Kopie des Gens des Thioredoxins, lag eine zweite Kopie grdc2 (Lübbers, 1993; Lübbers und Andreesen, 1993). Am Transfer des Carboxymethyl-Rests nach Protein C, könnte Zn 2+ als Cofaktor beteiligt sein. Eine Beteiligung von Zn 2+, das bei der Aktivierung des Substrats für einen nucleophilen Angriff eine wesentliche Rolle spielt, ist in Enzymen, die den Transfer von Methyl-Resten aus Methanol und Isoprenoid-Gruppen auf Thiol-Gruppen katalysieren, gezeigt worden (Matthews und Goulding, 1997).
5 Einleitung 5 Eine Zielstellung dieser Arbeit war die Identifikation der katalytischen Thiol-Gruppe der Untereinheit GrdD, an der die Freisetzung von Acetylphosphat stattfinden sollte, durch gerichtete Mutagenese bzw. Markierung der Cystein-Reste. Dazu mußte die vollständige Sequenz von grdd bekannt sein. Dies war die Voraussetzung für eine getrennte Charakterisierung der beiden Untereinheiten GrdC und GrdD nach heterologer Expression in E. coli. Eine Trennung beider Untereinheiten war ebenso Vorbedingung, um erste Untersuchungen zum Zn 2+ -Gehalt in GrdC durchzuführen, als Hinweis auf die Beteiligung von Zn 2+ an der Katalyse von Protein C. Die erste vollständig vorliegende Aminosäuresequenz beider Untereinheiten von Protein C ermöglichte weiterhin einen Vergleich mit homologen Proteinen aus anderen Organismen und mit anderen Proteinklassen, um Hinweise auf konservierte Aminosäurereste und Domänen zu erhalten.
1 Einleitung 1. EINLEITUNG 1. KISKER et al. 1999; MENDEL 1997; HILLE 1996). Abgesehen von der Nitrogenase wird das
 1. EINLEITUNG 1 1 Einleitung Wolfram wurde durch die nahezu identischen chemischen Eigenschaften traditionell als Antagonist der biologischen Funktionen des Molybdäns betrachtet. Molybdän ist als bioaktives
1. EINLEITUNG 1 1 Einleitung Wolfram wurde durch die nahezu identischen chemischen Eigenschaften traditionell als Antagonist der biologischen Funktionen des Molybdäns betrachtet. Molybdän ist als bioaktives
Grundlagen der Physiologie
 Grundlagen der Physiologie Gärungen und anaerobe Atmungsprozesse www.icbm.de/pmbio Glykolyse C 6 H 12 O 6 2 C 3 H 4 O 3 + 4 [H] (+ 2 ATP) Entsorgung überschüssiger Reduktionsequivalente durch Übertragung
Grundlagen der Physiologie Gärungen und anaerobe Atmungsprozesse www.icbm.de/pmbio Glykolyse C 6 H 12 O 6 2 C 3 H 4 O 3 + 4 [H] (+ 2 ATP) Entsorgung überschüssiger Reduktionsequivalente durch Übertragung
VO-5. Organische Chemie 2. Priv. Doz. DI Dr. Wolfgang Schoefberger Johannes Kepler Universität Linz Altenberger Str. 69, 4040 Linz, Austria.
 VO-5 Organische Chemie 2 Priv. Doz. DI Dr. Wolfgang Schoefberger Johannes Kepler Universität Linz Altenberger Str. 69, 4040 Linz, Austria. wolfgang.schoefberger@jku.at 89 Mesomerer Effekt verringert die
VO-5 Organische Chemie 2 Priv. Doz. DI Dr. Wolfgang Schoefberger Johannes Kepler Universität Linz Altenberger Str. 69, 4040 Linz, Austria. wolfgang.schoefberger@jku.at 89 Mesomerer Effekt verringert die
Bioorganische Chemie Enzymatische Katalyse 2011
 Ringvorlesung Chemie B - Studiengang Molekulare Biotechnologie Bioorganische Chemie Enzymatische Katalyse 2011 Prof. Dr. A. Jäschke INF 364, Zi. 308, Tel. 54 48 51 jaeschke@uni-hd.de Lehrziele I Kenntnis
Ringvorlesung Chemie B - Studiengang Molekulare Biotechnologie Bioorganische Chemie Enzymatische Katalyse 2011 Prof. Dr. A. Jäschke INF 364, Zi. 308, Tel. 54 48 51 jaeschke@uni-hd.de Lehrziele I Kenntnis
Stoffwechsel. Metabolismus (1)
 Vorlesung Zell- und Molekularbiologie Stoffwechsel Metabolismus (1) Zum Nachlesen Bücher Campbell: Kap. 6 59.95 Kap. 3 Kap. 13-14 29.95 www.icbm.de/pmbio - - - > Teaching diese Folien, VL Physiologie der
Vorlesung Zell- und Molekularbiologie Stoffwechsel Metabolismus (1) Zum Nachlesen Bücher Campbell: Kap. 6 59.95 Kap. 3 Kap. 13-14 29.95 www.icbm.de/pmbio - - - > Teaching diese Folien, VL Physiologie der
Klausur zur Vorlesung Biochemie III im WS 2000/01
 Klausur zur Vorlesung Biochemie III im WS 2000/01 am 15.02.2001 von 15.30 17.00 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 40 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach unbedingt angeben (3 1.
Klausur zur Vorlesung Biochemie III im WS 2000/01 am 15.02.2001 von 15.30 17.00 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 40 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach unbedingt angeben (3 1.
Enzyme (Teil 1) Aminosäuren, Aufbau, Eigenschaften & Funktion. Mag. Gerald Trutschl
 Enzyme (Teil 1) Aminosäuren, Aufbau, Eigenschaften & Funktion Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Einführung 2. Aufbau: - Aminosäuren - Peptidbindung - Primärstruktur - Sekundärstruktur - Tertiär- und Quatärstrukturen
Enzyme (Teil 1) Aminosäuren, Aufbau, Eigenschaften & Funktion Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Einführung 2. Aufbau: - Aminosäuren - Peptidbindung - Primärstruktur - Sekundärstruktur - Tertiär- und Quatärstrukturen
Versuch 6. Leitenzyme
 Versuch 6 Leitenzyme Protokollant: E-mail: Studiengang: Gruppen-Nr: Semester: Betreuer: Max Mustermann max@quantentunnel.de X X X Dr. Kojro Einleitung Ziel dieses Versuches ist der Nachweis von bestimmten
Versuch 6 Leitenzyme Protokollant: E-mail: Studiengang: Gruppen-Nr: Semester: Betreuer: Max Mustermann max@quantentunnel.de X X X Dr. Kojro Einleitung Ziel dieses Versuches ist der Nachweis von bestimmten
BIOCHEMIE. Prof. Manfred SUSSITZ. über(be)arbeitet und zusammengestellt nach Internetvorlagen:
 BIOCHEMIE Prof. Manfred SUSSITZ über(be)arbeitet und zusammengestellt nach Internetvorlagen: Medizinische Fakultät, Universität Erlangen http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-mediziner-neu/start.html
BIOCHEMIE Prof. Manfred SUSSITZ über(be)arbeitet und zusammengestellt nach Internetvorlagen: Medizinische Fakultät, Universität Erlangen http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-mediziner-neu/start.html
Rekombinante Antikörper
 Frank Breitling und Stefan Dübel 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Rekombinante Antikörper Technische
Frank Breitling und Stefan Dübel 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Rekombinante Antikörper Technische
Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen. Prof. Dr. Thomas Kirner
 Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen Prof. Dr. Thomas Kirner 21.07.2015 Voraussetzungen Fermentation von Biomasse Mikroorganismen interagieren in einem komplexen
Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen Prof. Dr. Thomas Kirner 21.07.2015 Voraussetzungen Fermentation von Biomasse Mikroorganismen interagieren in einem komplexen
Proteine. Claudia Schierbaum WS 04/05 Löffler / Petrides: Biochemie & Pathobiochemie, 7.Auflage, Springer-Verlag Berlin Kapitel 3.4 und 3.
 Proteine Claudia Schierbaum WS 04/05 Löffler / Petrides: Biochemie & Pathobiochemie, 7.Auflage, Springer-Verlag Berlin Kapitel 3.4 und 3.5 Faltung, Fehlfaltung und Denaturierung von Proteinen Denaturierung
Proteine Claudia Schierbaum WS 04/05 Löffler / Petrides: Biochemie & Pathobiochemie, 7.Auflage, Springer-Verlag Berlin Kapitel 3.4 und 3.5 Faltung, Fehlfaltung und Denaturierung von Proteinen Denaturierung
Übungen zu den Vorlesungen Aminosäuren und Peptide Proteine
 Übungen zu den Vorlesungen Aminosäuren und Peptide Proteine Dr. Katja Arndt Institut für Biologie III http://www.molbiotech.uni-freiburg.de/ka Übungen zur Vorlesung Aminosäuren, Peptide, Proteine Dr. Katja
Übungen zu den Vorlesungen Aminosäuren und Peptide Proteine Dr. Katja Arndt Institut für Biologie III http://www.molbiotech.uni-freiburg.de/ka Übungen zur Vorlesung Aminosäuren, Peptide, Proteine Dr. Katja
Studiengang Biowissenschaften Modulbegleitende Prüfung zum Praktikum in Organischer Chemie (gemäß MPO vom 12.09.2005) 21.07.2015
 Studiengang Biowissenschaften Modulbegleitende Prüfung zum Praktikum in Organischer Chemie (gemäß MPO vom 12.09.2005) 21.07.2015 Name: Vorname: Matrikel-Nr.: geborenam: in: Wiederholer dieser Klausur:
Studiengang Biowissenschaften Modulbegleitende Prüfung zum Praktikum in Organischer Chemie (gemäß MPO vom 12.09.2005) 21.07.2015 Name: Vorname: Matrikel-Nr.: geborenam: in: Wiederholer dieser Klausur:
Aminosäuren & Ketosäuren BIOGENE AMINE
 BIOGENE AMINE Von Mohammed Jaber BIOGENE AMINE: Biogene Amine sind AS ohne COOH-Gruppe! Und warum sind sie so wichtig? Von Mohammed Jaber und Proteine BIOGENE AMINE: Durch die Abspaltung der COOH- Gruppe
BIOGENE AMINE Von Mohammed Jaber BIOGENE AMINE: Biogene Amine sind AS ohne COOH-Gruppe! Und warum sind sie so wichtig? Von Mohammed Jaber und Proteine BIOGENE AMINE: Durch die Abspaltung der COOH- Gruppe
Expression der genetischen Information Skript: Kapitel 5
 Prof. A. Sartori Medizin 1. Studienjahr Bachelor Molekulare Zellbiologie FS 2013 12. März 2013 Expression der genetischen Information Skript: Kapitel 5 5.1 Struktur der RNA 5.2 RNA-Synthese (Transkription)
Prof. A. Sartori Medizin 1. Studienjahr Bachelor Molekulare Zellbiologie FS 2013 12. März 2013 Expression der genetischen Information Skript: Kapitel 5 5.1 Struktur der RNA 5.2 RNA-Synthese (Transkription)
Primärstoffwechsel. Prof. Dr. Albert Duschl
 Primärstoffwechsel Prof. Dr. Albert Duschl Aufgaben Der Primärstoffwechsel sorgt für Aufbau (Anabolismus) und Abbau (Katabolismus) biologischer Moleküle, wie Aminosäuren, Lipide, Kohlenhydrate und Nukleinsäuren.
Primärstoffwechsel Prof. Dr. Albert Duschl Aufgaben Der Primärstoffwechsel sorgt für Aufbau (Anabolismus) und Abbau (Katabolismus) biologischer Moleküle, wie Aminosäuren, Lipide, Kohlenhydrate und Nukleinsäuren.
Gärung (Fermentation)
 Gärung (Fermentation) Welche Gärer Nehmen welche Wege des Glukoseabbaus? die meisten Gärer Zymomonas Oxidativer Pentose- Embden-Meyerhof Entner-Doudoroff Phosphoketolase phosphat-weg heterofermenta- tive
Gärung (Fermentation) Welche Gärer Nehmen welche Wege des Glukoseabbaus? die meisten Gärer Zymomonas Oxidativer Pentose- Embden-Meyerhof Entner-Doudoroff Phosphoketolase phosphat-weg heterofermenta- tive
Enzyme SPF BCH am
 Enzyme Inhaltsverzeichnis Ihr kennt den Aufbau von Proteinen (mit vier Strukturelementen) und kennt die Kräfte, welche den Aufbau und die Funktion von Enzymen bestimmen... 3 Ihr versteht die Einteilung
Enzyme Inhaltsverzeichnis Ihr kennt den Aufbau von Proteinen (mit vier Strukturelementen) und kennt die Kräfte, welche den Aufbau und die Funktion von Enzymen bestimmen... 3 Ihr versteht die Einteilung
Grundlagen der Physiologie
 Grundlagen der Physiologie Regulation www.icbm.de/pmbio Mensch und Affe Was unterscheidet uns vom Affen? 5 %? 1 Nachbar Was unterscheidet Sie von Ihrem Nachbarn? Was unterscheidet uns vom Affen? Was unterscheidet
Grundlagen der Physiologie Regulation www.icbm.de/pmbio Mensch und Affe Was unterscheidet uns vom Affen? 5 %? 1 Nachbar Was unterscheidet Sie von Ihrem Nachbarn? Was unterscheidet uns vom Affen? Was unterscheidet
7. Regulation der Genexpression
 7. Regulation der Genexpression 7.1 Regulation der Enzymaktivität Stoffwechselreaktionen können durch Kontrolle der Aktivität der Enzyme, die diese Reaktionen katalysieren, reguliert werden Feedback-Hemmung
7. Regulation der Genexpression 7.1 Regulation der Enzymaktivität Stoffwechselreaktionen können durch Kontrolle der Aktivität der Enzyme, die diese Reaktionen katalysieren, reguliert werden Feedback-Hemmung
Enzyme (Teil 2) Enzymatische Reaktion, Thermodynamik & Enzyme im Detail. Mag. Gerald Trutschl
 Enzyme (Teil 2) Enzymatische Reaktion, Thermodynamik & Enzyme im Detail Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Enzym Reaktion im Detail 2. Thermodynamische Reaktion 3. Katalysemechanismen 4. Michaelis-Menten-Konstante
Enzyme (Teil 2) Enzymatische Reaktion, Thermodynamik & Enzyme im Detail Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Enzym Reaktion im Detail 2. Thermodynamische Reaktion 3. Katalysemechanismen 4. Michaelis-Menten-Konstante
Grundzüge des Energiestoffwechsels I
 Grundzüge des Energiestoffwechsels I 4.5 Grundzüge des Energiestoffwechsels 4.5.2 Glykolyse 4.5.3 Pyruvatdecarboxylierung 4.5.4 Citratzyklus 4.5.5 Glyoxylatzyklus und Gluconeogenese 4.5.6 Atmung, Endoxidation
Grundzüge des Energiestoffwechsels I 4.5 Grundzüge des Energiestoffwechsels 4.5.2 Glykolyse 4.5.3 Pyruvatdecarboxylierung 4.5.4 Citratzyklus 4.5.5 Glyoxylatzyklus und Gluconeogenese 4.5.6 Atmung, Endoxidation
Von Nadine Ufermann und Marcus Oldekamp
 Von Nadine Ufermann und Marcus Oldekamp Photosynthese: Allgemein und Lichtreaktion Photosysteme: PSI und PSII, Entdeckung und Funktion Mangan und Manganenzyme: Speziell sauerstoffentwickelnder Mn Cluster
Von Nadine Ufermann und Marcus Oldekamp Photosynthese: Allgemein und Lichtreaktion Photosysteme: PSI und PSII, Entdeckung und Funktion Mangan und Manganenzyme: Speziell sauerstoffentwickelnder Mn Cluster
Ein neues stärke-relevantes Enzym in Arabidopsis thaliana: Die Phosphoglukan-Wasser-Dikinase
 Ein neues stärke-relevantes Enzym in Arabidopsis thaliana: Die Phosphoglukan-Wasser-Dikinase RHOMBOS-VERLAG Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Ein neues stärke-relevantes Enzym in Arabidopsis thaliana: Die Phosphoglukan-Wasser-Dikinase RHOMBOS-VERLAG Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Referat : Aufbau v. Proteinen u. ihre Raumstruktur
 Referat : Aufbau v. Proteinen u. ihre Raumstruktur 1. Einleitung Unsere Körperzellen enthalten einige Tausend verschiedene Proteine wobei man schätzt, das insgesamt über 50 000 verschiedene Eiweißstoffe
Referat : Aufbau v. Proteinen u. ihre Raumstruktur 1. Einleitung Unsere Körperzellen enthalten einige Tausend verschiedene Proteine wobei man schätzt, das insgesamt über 50 000 verschiedene Eiweißstoffe
DNA Replikation ist semikonservativ. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 DNA Replikation ist semikonservativ Entwindung der DNA-Doppelhelix durch eine Helikase Replikationsgabel Eltern-DNA Beide DNA-Stränge werden in 5 3 Richtung synthetisiert DNA-Polymerasen katalysieren die
DNA Replikation ist semikonservativ Entwindung der DNA-Doppelhelix durch eine Helikase Replikationsgabel Eltern-DNA Beide DNA-Stränge werden in 5 3 Richtung synthetisiert DNA-Polymerasen katalysieren die
Vortrag Enzyme. Sebastian Kurfürst. sebastian(at)garbage-group.de.
 Enzyme Vortrag Enzyme Sebastian Kurfürst /bio.html sebastian(at)garbage-group.de 1 Gliederung 1.Einführung 2.Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen 3.Enzyme ein Biokatalysator 4.Aufbau 5.Substrat-,
Enzyme Vortrag Enzyme Sebastian Kurfürst /bio.html sebastian(at)garbage-group.de 1 Gliederung 1.Einführung 2.Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen 3.Enzyme ein Biokatalysator 4.Aufbau 5.Substrat-,
Metabolismus Umwandlung von Stoffen und Energie nach den Gesetzen der Thermodynamik
 Metabolismus Umwandlung von Stoffen und Energie nach den Gesetzen der Thermodynamik Der Metabolismus oder Stoffwechsel ist die Gesamtheit der in einem Organismus ablaufenden (bio)chemischen Prozesse Der
Metabolismus Umwandlung von Stoffen und Energie nach den Gesetzen der Thermodynamik Der Metabolismus oder Stoffwechsel ist die Gesamtheit der in einem Organismus ablaufenden (bio)chemischen Prozesse Der
Faltung, Dynamik und strukturelle Evolution der Proteine (Voet Kapitel 8)
 Faltung, Dynamik und strukturelle Evolution der Proteine (Voet Kapitel 8) 1. Proteinfaltung: Theorie und Experiment 2. Proteindynamik 3. Strukturelle Evolution A. Protein-Renaturierung Denaturierung in
Faltung, Dynamik und strukturelle Evolution der Proteine (Voet Kapitel 8) 1. Proteinfaltung: Theorie und Experiment 2. Proteindynamik 3. Strukturelle Evolution A. Protein-Renaturierung Denaturierung in
Enzyme in der organischen Synthese ausgewählte Beispiele
 Enzyme in der organischen Synthese ausgewählte Beispiele Jürgen Weippert Institut für Organische Chemie Seminar zum Fortgeschrittenenpraktikum KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales
Enzyme in der organischen Synthese ausgewählte Beispiele Jürgen Weippert Institut für Organische Chemie Seminar zum Fortgeschrittenenpraktikum KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales
Themen heute: Säuren und Basen, Redoxreaktionen
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Massenwirkungsgesetz, Prinzip des kleinsten Zwangs, Löslichkeitsprodukt, Themen heute: Säuren und Basen, Redoxreaktionen Vorlesung Allgemeine Chemie, Prof. Dr.
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Massenwirkungsgesetz, Prinzip des kleinsten Zwangs, Löslichkeitsprodukt, Themen heute: Säuren und Basen, Redoxreaktionen Vorlesung Allgemeine Chemie, Prof. Dr.
Organische Chemie für Verfahrensingenieure, Umweltschutztechniker und Werkstoffwissenschaftler
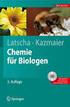 Prof. Dr. J. Christoffers Institut für Organische Chemie Universität Stuttgart 29.04.2003 Organische Chemie für Verfahrensingenieure, Umweltschutztechniker und Werkstoffwissenschaftler 1. Einführung 2.
Prof. Dr. J. Christoffers Institut für Organische Chemie Universität Stuttgart 29.04.2003 Organische Chemie für Verfahrensingenieure, Umweltschutztechniker und Werkstoffwissenschaftler 1. Einführung 2.
Redoxprozesse. Warum ist Sauerstoff für uns lebensnotwendig?
 Redoxprozesse Diese Lerneinheit befasst sich mit der Knallgasexplosion und Atmungskette - eine biologische Betrachtung von Redoxreaktionen mit den folgenden Lehrzielen: Warum ist Sauerstoff für uns lebensnotwendig?
Redoxprozesse Diese Lerneinheit befasst sich mit der Knallgasexplosion und Atmungskette - eine biologische Betrachtung von Redoxreaktionen mit den folgenden Lehrzielen: Warum ist Sauerstoff für uns lebensnotwendig?
Musterklausur 1 zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie
 Musterklausur 1 zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie Achtung: Taschenrechner ist nicht zugelassen. Aufgaben sind so, dass sie ohne Rechner lösbar sind. Weitere Hilfsmittel: Periodensystem der Elemente
Musterklausur 1 zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie Achtung: Taschenrechner ist nicht zugelassen. Aufgaben sind so, dass sie ohne Rechner lösbar sind. Weitere Hilfsmittel: Periodensystem der Elemente
Vorgehen bei der qualitativen Analyse. Nachweisreaktion. Nachweisreaktionen. molekular gebauter Stoffe
 Vorgehen bei der qualitativen Analyse 1. Vorprobe liefert Hinweise auf die mögliche Zusammensetzung der Probe ; Bsp. Flammenfärbung 2. Blindprobe zeigt aus Aussehen der Nachweisreagenzien; Vergleichsprobe
Vorgehen bei der qualitativen Analyse 1. Vorprobe liefert Hinweise auf die mögliche Zusammensetzung der Probe ; Bsp. Flammenfärbung 2. Blindprobe zeigt aus Aussehen der Nachweisreagenzien; Vergleichsprobe
Mitochondriale Elektronentransportkette (Atmungskette)
 Mitochondriale Elektronentransportkette (Atmungskette) Mitochondriale Elektronentransportkette (Atmungskette) Komplex I und II übetragen Elektronen auf Coenzym Q (Ubichinon) Gekoppelte Elektronen-Protonen
Mitochondriale Elektronentransportkette (Atmungskette) Mitochondriale Elektronentransportkette (Atmungskette) Komplex I und II übetragen Elektronen auf Coenzym Q (Ubichinon) Gekoppelte Elektronen-Protonen
Chemische Evolution. Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007
 Chemische Evolution Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007 Aristoteles lehrte, aus Schlamm entstünden Würmer, und aus Würmern Aale. Omne vivum ex vivo. (Alles Leben entsteht aus Leben.) Pasteur
Chemische Evolution Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007 Aristoteles lehrte, aus Schlamm entstünden Würmer, und aus Würmern Aale. Omne vivum ex vivo. (Alles Leben entsteht aus Leben.) Pasteur
Peptide Proteine. 1. Aminosäuren. Alle optisch aktiven proteinogenen Aminosäuren gehören der L-Reihe an: 1.1 Struktur der Aminosäuren
 1. Aminosäuren Aminosäuren Peptide Proteine Vortragender: Dr. W. Helliger 1.1 Struktur 1.2 Säure-Basen-Eigenschaften 1.2.1 Neutral- und Zwitterion-Form 1.2.2 Molekülform in Abhängigkeit vom ph-wert 1.3
1. Aminosäuren Aminosäuren Peptide Proteine Vortragender: Dr. W. Helliger 1.1 Struktur 1.2 Säure-Basen-Eigenschaften 1.2.1 Neutral- und Zwitterion-Form 1.2.2 Molekülform in Abhängigkeit vom ph-wert 1.3
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie. Bettina Siebers
 Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Polyacrylamide Gelelektrophorese (PAGE) Denaturierende
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Polyacrylamide Gelelektrophorese (PAGE) Denaturierende
1) Welche Aussagen über die Hauptgruppenelemente im Periodensystem sind richtig?
 1) Welche Aussagen über die Hauptgruppenelemente im Periodensystem sind richtig? 1) Es sind alles Metalle. 2) In der äußeren Elektronenschale werden s- bzw. s- und p-orbitale aufgefüllt. 3) Sie stimmen
1) Welche Aussagen über die Hauptgruppenelemente im Periodensystem sind richtig? 1) Es sind alles Metalle. 2) In der äußeren Elektronenschale werden s- bzw. s- und p-orbitale aufgefüllt. 3) Sie stimmen
Asmaa Mebrad Caroline Mühlmann Gluconeogenese
 Gluconeogenese Asmaa Mebrad Caroline Mühlmann 06.12.2004 Definition: wichtiger Stoffwechselweg, bei dem Glucose aus Nicht-Kohlenhydrat-Vorstufen synthetisiert wird Ablauf bei längeren Hungerperioden dient
Gluconeogenese Asmaa Mebrad Caroline Mühlmann 06.12.2004 Definition: wichtiger Stoffwechselweg, bei dem Glucose aus Nicht-Kohlenhydrat-Vorstufen synthetisiert wird Ablauf bei längeren Hungerperioden dient
Weitergabe genetischer Information: DNA-Replikation Beispiel: Escherichia coli.
 Weitergabe genetischer Information: DNA-Replikation Beispiel: Escherichia coli. zirkuläres bakterielles Chromosom Replikation (Erstellung einer identischen Kopie des genetischen Materials) MPM 1 DNA-Polymerasen
Weitergabe genetischer Information: DNA-Replikation Beispiel: Escherichia coli. zirkuläres bakterielles Chromosom Replikation (Erstellung einer identischen Kopie des genetischen Materials) MPM 1 DNA-Polymerasen
Dr. Jens Kurreck. Otto-Hahn-Bau, Thielallee 63, Raum 029 Tel.: 83 85 69 69 Email: jkurreck@chemie.fu-berlin.de
 Dr. Jens Kurreck Otto-Hahn-Bau, Thielallee 63, Raum 029 Tel.: 83 85 69 69 Email: jkurreck@chemie.fu-berlin.de Prinzipien genetischer Informationsübertragung Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemie 5. Auflage,
Dr. Jens Kurreck Otto-Hahn-Bau, Thielallee 63, Raum 029 Tel.: 83 85 69 69 Email: jkurreck@chemie.fu-berlin.de Prinzipien genetischer Informationsübertragung Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemie 5. Auflage,
Michelle Kammel David Speck
 Michelle Kammel David Speck 10.07.2013 Was ist bisher bekannt? Zentrum des Signalwegs ist der Ubiquitin Ligase SCF TIR1 Komplex Gray et al. (2001) Abbau der Aux/IAA aktiviert Transkriptionsfaktoren (ARFs)
Michelle Kammel David Speck 10.07.2013 Was ist bisher bekannt? Zentrum des Signalwegs ist der Ubiquitin Ligase SCF TIR1 Komplex Gray et al. (2001) Abbau der Aux/IAA aktiviert Transkriptionsfaktoren (ARFs)
3 150 ml-bechergläser als Wasserbäder Thermometer 2 ml-plastikpipetten Parafilm
 Nachweis der Enzymaktivität und Enzymhemmung Chemikalien: Harnstofflösung (10% w/v) Phenolphtalein-Lösung Urease rohe Kartoffel Wasserstoffperoxid-Lösung (30 % w/v) Bäckerhefe verdünnte Lösung von Methylenblau
Nachweis der Enzymaktivität und Enzymhemmung Chemikalien: Harnstofflösung (10% w/v) Phenolphtalein-Lösung Urease rohe Kartoffel Wasserstoffperoxid-Lösung (30 % w/v) Bäckerhefe verdünnte Lösung von Methylenblau
Der Citratzyklus (= Trikarbonsäurezyklus, Krebszyklus)
 Der Citratzyklus (= Trikarbonsäurezyklus, Krebszyklus) Biochemischer Kreisprozeß Ablauf in der mitochondrialen Matrix Glykolyse β-oxidation Atmungskette AS-Abbau Der Citratzyklus Der Citratzyklus: Übersicht
Der Citratzyklus (= Trikarbonsäurezyklus, Krebszyklus) Biochemischer Kreisprozeß Ablauf in der mitochondrialen Matrix Glykolyse β-oxidation Atmungskette AS-Abbau Der Citratzyklus Der Citratzyklus: Übersicht
Enzyme. Prof. Dr. Albert Duschl
 Enzyme Prof. Dr. Albert Duschl Katalyse Reaktionen laufen normalerweise nicht spontan ab, auch wenn insgesamt dabei Energie gewonnen werden sollte. Es muß zunächst eine Aktivierungsenergie aufgebracht
Enzyme Prof. Dr. Albert Duschl Katalyse Reaktionen laufen normalerweise nicht spontan ab, auch wenn insgesamt dabei Energie gewonnen werden sollte. Es muß zunächst eine Aktivierungsenergie aufgebracht
Master Biotechnologie 1. Seminar
 Master Biotechnologie 1. Seminar Patrick Pilak Biosynthesis of Sandalwood Oil Santalum album CYP76F Cytochromes P450 Produce Santalols and Bergamotol Bohlmann et al. 2013 1 Zielsetzung Die Zielsetzung
Master Biotechnologie 1. Seminar Patrick Pilak Biosynthesis of Sandalwood Oil Santalum album CYP76F Cytochromes P450 Produce Santalols and Bergamotol Bohlmann et al. 2013 1 Zielsetzung Die Zielsetzung
Biologie I: Funktionen des Blattes
 Biologie I: Funktionen des Blattes Chloroplasten und Photosyntheseapparat Prinzipien der Energiegewinnung und Energienutzung Lichtreaktion der Photosynthese Dunkelreaktion der Photosynthese Copyright Hinweis:
Biologie I: Funktionen des Blattes Chloroplasten und Photosyntheseapparat Prinzipien der Energiegewinnung und Energienutzung Lichtreaktion der Photosynthese Dunkelreaktion der Photosynthese Copyright Hinweis:
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Die Stickstoff-Fixierung: Enzymatik
 Die Stickstoff-Fixierung: Enzymatik Präsentation von Philipp Schumann Stephan Christel Die Stickstoff-Fixierung Stickstoff ist das vierthäufigste Element in Zellen Er liegt in reduzierter Form in Aminosäuren,
Die Stickstoff-Fixierung: Enzymatik Präsentation von Philipp Schumann Stephan Christel Die Stickstoff-Fixierung Stickstoff ist das vierthäufigste Element in Zellen Er liegt in reduzierter Form in Aminosäuren,
Irena Isabell Knappik (Autor) Charakterisierung der biologischen und chemischen Reaktionsprozesse in Siedlungsabfällen
 Irena Isabell Knappik (Autor) Charakterisierung der biologischen und chemischen Reaktionsprozesse in Siedlungsabfällen https://cuvillier.de/de/shop/publications/349 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Irena Isabell Knappik (Autor) Charakterisierung der biologischen und chemischen Reaktionsprozesse in Siedlungsabfällen https://cuvillier.de/de/shop/publications/349 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Grundwissen Chemie Mittelstufe (9 MNG)
 Grundwissen Chemie Mittelstufe (9 MNG) Marie-Therese-Gymnasium Erlangen Einzeldateien: GW8 Grundwissen für die 8. Jahrgangsstufe GW9 Grundwissen für die 9. Jahrgangsstufe (MNG) GW9a Grundwissen für die
Grundwissen Chemie Mittelstufe (9 MNG) Marie-Therese-Gymnasium Erlangen Einzeldateien: GW8 Grundwissen für die 8. Jahrgangsstufe GW9 Grundwissen für die 9. Jahrgangsstufe (MNG) GW9a Grundwissen für die
Versuch: Denaturierung von Eiweiß
 Philipps-Universität Marburg 29.01.2008 rganisches Grundpraktikum (LA) Katrin Hohmann Assistent: Ralph Wieneke Leitung: Dr. Ph. Reiß WS 2007/08 Gruppe 10, Amine, Aminosäuren, Peptide Versuch: Denaturierung
Philipps-Universität Marburg 29.01.2008 rganisches Grundpraktikum (LA) Katrin Hohmann Assistent: Ralph Wieneke Leitung: Dr. Ph. Reiß WS 2007/08 Gruppe 10, Amine, Aminosäuren, Peptide Versuch: Denaturierung
Das Prinzip der DNA-Sequenzierung Best.- Nr. 201.3055
 Das Prinzip der DNA-Sequenzierung Best.- Nr. 201.3055 Allgemeine Informationen Prinzip der DNA-Sequenzierung Ziel dieses Versuchs ist einen genauen Überblick über die Verfahrensweise der DNA- Sequenzierung
Das Prinzip der DNA-Sequenzierung Best.- Nr. 201.3055 Allgemeine Informationen Prinzip der DNA-Sequenzierung Ziel dieses Versuchs ist einen genauen Überblick über die Verfahrensweise der DNA- Sequenzierung
Stellungnahme zur Ernährung von Tumorpatienten auf der Grundlage der "Anti TKTL1 - Diät"
 Deutsche Krebsgesellschaft Stellungnahme zur Ernährung von Tumorpatienten auf der Grundlage der "Anti TKTL1 - Diät" Berlin (18. März 2010) - Tumorpatienten wird derzeit ein neues Ernährungsprinzip mit
Deutsche Krebsgesellschaft Stellungnahme zur Ernährung von Tumorpatienten auf der Grundlage der "Anti TKTL1 - Diät" Berlin (18. März 2010) - Tumorpatienten wird derzeit ein neues Ernährungsprinzip mit
Grundzüge des Energiestoffwechsels I
 Grundzüge des Energiestoffwechsels I 4.5 Grundzüge des Energiestoffwechsels 4.5.2 Glykolyse 4.5.3 Pyruvatdecarboxylierung 4.5.4 Citratzyklus 4.5.5 Glyoxylatzyklus und Gluconeogenese 4.5.6 Atmung, Endoxidation
Grundzüge des Energiestoffwechsels I 4.5 Grundzüge des Energiestoffwechsels 4.5.2 Glykolyse 4.5.3 Pyruvatdecarboxylierung 4.5.4 Citratzyklus 4.5.5 Glyoxylatzyklus und Gluconeogenese 4.5.6 Atmung, Endoxidation
Die Cytochrom c Reduktase Höherer Pflanzen
 - z/a o Die Cytochrom c Reduktase Höherer Pflanzen Charakterisierung des bifunktionalen Cytochrom c Reduktase / Processing Peptidase - Komplexes aus den Mitochondrien von Solanum tuberosum und Triticum
- z/a o Die Cytochrom c Reduktase Höherer Pflanzen Charakterisierung des bifunktionalen Cytochrom c Reduktase / Processing Peptidase - Komplexes aus den Mitochondrien von Solanum tuberosum und Triticum
Autotrophe und heterotrophe Organismen
 Grundlagen der Umwelttechnik 5. Biomoleküle und Grundlagen des Stoffwechsels Vorlesung an der ochschule Augsburg Dr. Siegfried Kreibe 1 Autotrophe und heterotrophe rganismen Autotrophe rganismen: bauen
Grundlagen der Umwelttechnik 5. Biomoleküle und Grundlagen des Stoffwechsels Vorlesung an der ochschule Augsburg Dr. Siegfried Kreibe 1 Autotrophe und heterotrophe rganismen Autotrophe rganismen: bauen
Gerinnung von Proteinen
 V11 Gerinnung von Proteinen Fach Klasse Überthema Feinthema Zeit Chemie Q2 Aminosäuren, Peptide, Polypeptide Proteine 20 Minuten Zusammenfassung: Die Gerinnung von Eiklar wird durch Zugabe von gesättigter
V11 Gerinnung von Proteinen Fach Klasse Überthema Feinthema Zeit Chemie Q2 Aminosäuren, Peptide, Polypeptide Proteine 20 Minuten Zusammenfassung: Die Gerinnung von Eiklar wird durch Zugabe von gesättigter
Beschreiben Sie den Aufbau und die Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe. Beschreiben Sie die Alkane allgemein.
 den Aufbau und die Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe. nur Kohlenstoff- und Wasserstoffatome mit einander verbunden Kohlenstoffatom ist vierbindig Wasserstoffatom ist einbindig Skelett aller KW wird
den Aufbau und die Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe. nur Kohlenstoff- und Wasserstoffatome mit einander verbunden Kohlenstoffatom ist vierbindig Wasserstoffatom ist einbindig Skelett aller KW wird
Zusammenfassung Einleitung 3
 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 1 1. Einleitung 3 1.1. Vorkommen und Bedeutung nichtsegmentierter Negativstrang Viren 3 1.2. Persistierende Infektionen 4 1.2.1. Humanmedizinische Bedeutung 4 1.2.2.
Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 1 1. Einleitung 3 1.1. Vorkommen und Bedeutung nichtsegmentierter Negativstrang Viren 3 1.2. Persistierende Infektionen 4 1.2.1. Humanmedizinische Bedeutung 4 1.2.2.
8. Aminosäuren - (Proteine) Eiweiß
 8. Aminosäuren - (Proteine) Eiweiß Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaut. Aminosäuren bilden die Grundlage der belebten Welt. 8.1 Struktur der Aminosäuren Aminosäuren sind organische Moleküle, die mindestens
8. Aminosäuren - (Proteine) Eiweiß Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaut. Aminosäuren bilden die Grundlage der belebten Welt. 8.1 Struktur der Aminosäuren Aminosäuren sind organische Moleküle, die mindestens
Überblick von DNA zu Protein. Biochemie-Seminar WS 04/05
 Überblick von DNA zu Protein Biochemie-Seminar WS 04/05 Replikationsapparat der Zelle Der gesamte Replikationsapparat umfasst über 20 Proteine z.b. DNA Polymerase: katalysiert Zusammenfügen einzelner Bausteine
Überblick von DNA zu Protein Biochemie-Seminar WS 04/05 Replikationsapparat der Zelle Der gesamte Replikationsapparat umfasst über 20 Proteine z.b. DNA Polymerase: katalysiert Zusammenfügen einzelner Bausteine
Stickstofffixierung Ökologie. Von Deborah Leaney und Viola Tacke
 Stickstofffixierung Ökologie Von Deborah Leaney und Viola Tacke Stickstoffkreislauf Quelle: http://www.makumee.de/assets/images/stickstoffkreislauf_2.jpg Stickstoff Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=datei:dinitroge
Stickstofffixierung Ökologie Von Deborah Leaney und Viola Tacke Stickstoffkreislauf Quelle: http://www.makumee.de/assets/images/stickstoffkreislauf_2.jpg Stickstoff Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=datei:dinitroge
Stoffwechselphysiologie
 Stoffwechselphysiologie 9 m 3 m 3 m Nahrung- und Flüssigkeitsaufnahme in 40 Jahren: 36000 l Wasser 6000 kg Nahrungsmittel Aufgaben des Stoffwechsels Gewinnung von chemischer Energie aus anorganischen und
Stoffwechselphysiologie 9 m 3 m 3 m Nahrung- und Flüssigkeitsaufnahme in 40 Jahren: 36000 l Wasser 6000 kg Nahrungsmittel Aufgaben des Stoffwechsels Gewinnung von chemischer Energie aus anorganischen und
Marianti Manggau. Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten
 Marianti Manggau Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Manggau, Marianti: Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten
Marianti Manggau Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Manggau, Marianti: Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten
Organische Chemie. Kohlenwasserstoffe. Alkane. Alkane
 1 1 Organische Chemie beschäftigt sich mit Verbindungen, die C- Atome enthalten 2 2 Kohlenwasserstoffe bestehen ausschließlich aus C- und H- Atomen 3 3 es existieren nur C-H Einfachbindungen C-C Einfachbindung
1 1 Organische Chemie beschäftigt sich mit Verbindungen, die C- Atome enthalten 2 2 Kohlenwasserstoffe bestehen ausschließlich aus C- und H- Atomen 3 3 es existieren nur C-H Einfachbindungen C-C Einfachbindung
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen... VIII Verzeichnis der Abkürzungen und Trivialnamen... XI I Einleitung... 1
 Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen... VIII Verzeichnis der Abkürzungen und Trivialnamen... XI I Einleitung... 1 1 Extremophile Organismen... 1 2 Halophile Mikroorganismen... 2 2.1 Lebensräume und
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen... VIII Verzeichnis der Abkürzungen und Trivialnamen... XI I Einleitung... 1 1 Extremophile Organismen... 1 2 Halophile Mikroorganismen... 2 2.1 Lebensräume und
Katalysator vor und nach der Reaktion
 Katalysator vor und nach der Reaktion Braunstein als Katalysator bei der Zersetzung von Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid ist wenig stabil und zerfällt leicht. Dabei entsteht Sauerstoff, der mit Hilfe
Katalysator vor und nach der Reaktion Braunstein als Katalysator bei der Zersetzung von Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid ist wenig stabil und zerfällt leicht. Dabei entsteht Sauerstoff, der mit Hilfe
Funktionelle Gruppen Alkohol
 Alkohol Unter Alkohol versteht man (als hemiker) alle Verbindungen, in denen eine ydroxyl-gruppe an ein aliphatisches oder alicyclisches Kohlenstoffgerüst gebunden ist. ydroxylgruppe: funktionelle Gruppe
Alkohol Unter Alkohol versteht man (als hemiker) alle Verbindungen, in denen eine ydroxyl-gruppe an ein aliphatisches oder alicyclisches Kohlenstoffgerüst gebunden ist. ydroxylgruppe: funktionelle Gruppe
Übung Nr. 13. Vorlesung Allgemeine Chemie II Teil Organische Chemie Frühjahrssemester Mi bzw. Fr
 Übung Nr. 13 Mi. 30.05.2012 bzw. Fr. 01.06.2012 1. Eliminierungen I Geben Sie für die untenstehenden Reaktionen die jeweiligen Produkte an! Um welche Namensreaktion handelt es sich? Welcher Typ Eliminierung
Übung Nr. 13 Mi. 30.05.2012 bzw. Fr. 01.06.2012 1. Eliminierungen I Geben Sie für die untenstehenden Reaktionen die jeweiligen Produkte an! Um welche Namensreaktion handelt es sich? Welcher Typ Eliminierung
Hydrierung von Kohlenmonoxid zu Methanol Kataly?sche Umsetzung von Ethen mit Wasser zu Ethanol
 Oxida&onsreak&onen Von Alkenen und Alkokolen zu Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren H. Wünsch 2012 1 Vorbemerkung Grundlage der hier betrachteten Reak?onen sind Alkene und Alkohole. Alkohole sind Produkte
Oxida&onsreak&onen Von Alkenen und Alkokolen zu Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren H. Wünsch 2012 1 Vorbemerkung Grundlage der hier betrachteten Reak?onen sind Alkene und Alkohole. Alkohole sind Produkte
1. EINLEITUNG EINLEITUNG 1
 EINLEITUNG 1 1. EINLEITUNG Die Entstehung von reaktiven Sauerstoffderivaten als Nebenprodukte im aeroben Stoffwechsel ist unvermeidlich. Molekularer Sauerstoff besitzt zwei ungepaarte Elektronen mit parallelem
EINLEITUNG 1 1. EINLEITUNG Die Entstehung von reaktiven Sauerstoffderivaten als Nebenprodukte im aeroben Stoffwechsel ist unvermeidlich. Molekularer Sauerstoff besitzt zwei ungepaarte Elektronen mit parallelem
15.11.2010. VL Limnochemie
 VL Limnochemie Mikrobiologie 2: Stoffwechsel Und heute wie Enzyme arbeiten wie der bakterielle Stoffwechsel grundsätzlich funktioniert was Bakterien zum Wachstum brauchen welche mikrobiologischen Redoxprozesse
VL Limnochemie Mikrobiologie 2: Stoffwechsel Und heute wie Enzyme arbeiten wie der bakterielle Stoffwechsel grundsätzlich funktioniert was Bakterien zum Wachstum brauchen welche mikrobiologischen Redoxprozesse
Kontrolle der Genexpression auf mrna-ebene. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Kontrolle der Genexpression auf mrna-ebene Abb. aus Stryer (5th Ed.) RNA interference (RNAi) sirna (small interfering RNA) mirna (micro RNA) Abb. aus Stryer (5th Ed.) Transcriptional silencing Inhibition
Kontrolle der Genexpression auf mrna-ebene Abb. aus Stryer (5th Ed.) RNA interference (RNAi) sirna (small interfering RNA) mirna (micro RNA) Abb. aus Stryer (5th Ed.) Transcriptional silencing Inhibition
Vom Gen zum Protein. Zusammenfassung Kapitel 17. Die Verbindung zwischen Gen und Protein. Gene spezifizieren Proteine
 Zusammenfassung Kapitel 17 Vom Gen zum Protein Die Verbindung zwischen Gen und Protein Gene spezifizieren Proteine Zellen bauen organische Moleküle über Stoffwechselprozesse auf und ab. Diese Prozesse
Zusammenfassung Kapitel 17 Vom Gen zum Protein Die Verbindung zwischen Gen und Protein Gene spezifizieren Proteine Zellen bauen organische Moleküle über Stoffwechselprozesse auf und ab. Diese Prozesse
Western Blot. Zuerst wird ein Proteingemisch mit Hilfe einer Gel-Elektrophorese aufgetrennt.
 Western Blot Der Western Blot ist eine analytische Methode zum Nachweis bestimmter Proteine in einer Probe. Der Nachweis erfolgt mit spezifischen Antikörpern, die das gesuchte Protein erkennen und daran
Western Blot Der Western Blot ist eine analytische Methode zum Nachweis bestimmter Proteine in einer Probe. Der Nachweis erfolgt mit spezifischen Antikörpern, die das gesuchte Protein erkennen und daran
Ei ne P ä r sentati ti on vo n T om D ro t s e, P t e er Haak k und Patrick Schürmann
 Ei P ä tti T D t P t H k d Eine Präsentation von Tom Droste, Peter Haak und Patrick Schürmann Inhaltsverzeichnis Allgemein: Was ist Stickstofffixierung? Welche Arten der Fixierung gibt es? Welchen Zweck
Ei P ä tti T D t P t H k d Eine Präsentation von Tom Droste, Peter Haak und Patrick Schürmann Inhaltsverzeichnis Allgemein: Was ist Stickstofffixierung? Welche Arten der Fixierung gibt es? Welchen Zweck
27 Funktionelle Genomanalysen Sachverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Ausarbeitung zum Seminar Post-production of industrial enzymes
 Ausarbeitung zum Seminar Post-production of industrial enzymes 3. Folie Enzyme Enzyme sind umweltverträgliche Katalysatoren mit einem breiten Reaktionsspektrum. Industriell finden sie unteranderem Anwendung
Ausarbeitung zum Seminar Post-production of industrial enzymes 3. Folie Enzyme Enzyme sind umweltverträgliche Katalysatoren mit einem breiten Reaktionsspektrum. Industriell finden sie unteranderem Anwendung
Nichtessentielle Aminosäuren. Stoffwechsel Nahrungskarenz
 Nichtessentielle Aminosäuren Stoffwechsel Nahrungskarenz Einleitung 11 nichtessentielle AS Können von Säugetierzellen selbstsynthetisiert werden. Im Vergleich zu essentiellen AS einfache Synthesewege Nichtessentiell
Nichtessentielle Aminosäuren Stoffwechsel Nahrungskarenz Einleitung 11 nichtessentielle AS Können von Säugetierzellen selbstsynthetisiert werden. Im Vergleich zu essentiellen AS einfache Synthesewege Nichtessentiell
Aufbau, Struktur, Funktion von DNA, RNA und Proteinen
 Aufbau, Struktur, Funktion von DNA, RNA und Proteinen Mitarbeiterseminar der Medizinischen Fakultät Ruhr-Universität Bochum Andreas Friebe Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie Aufbau, Struktur,
Aufbau, Struktur, Funktion von DNA, RNA und Proteinen Mitarbeiterseminar der Medizinischen Fakultät Ruhr-Universität Bochum Andreas Friebe Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie Aufbau, Struktur,
0.3 Formeln, Gleichungen, Reaktionen
 0.3 Formeln, Gleichungen, Reaktionen Aussage von chemischen Formeln Formeln von ionischen Verbindungen - Metallkation, ein- oder mehratomiges Anion - Formel entsteht durch Ausgleich der Ladungen - Bildung
0.3 Formeln, Gleichungen, Reaktionen Aussage von chemischen Formeln Formeln von ionischen Verbindungen - Metallkation, ein- oder mehratomiges Anion - Formel entsteht durch Ausgleich der Ladungen - Bildung
Zeichnen von Valenzstrichformeln
 Zeichnen von Valenzstrichformeln ür anorganische Salze werden keine Valenzstrichformeln gezeichnet, da hier eine ionische Bindung vorliegt. Die Elektronen werden vollständig übertragen und die Ionen bilden
Zeichnen von Valenzstrichformeln ür anorganische Salze werden keine Valenzstrichformeln gezeichnet, da hier eine ionische Bindung vorliegt. Die Elektronen werden vollständig übertragen und die Ionen bilden
Mikrobiologie des Abwassers
 Mikrobiologie des Abwassers Kläranlage (Belebtschlamm und Faulturm) www.klaeranlage-online.de Aufbau einer Kläranlage Kläranlage Schwerte Abbildung aus Mudrack, 1988 Daten zur Kläranlage Oldenburg (Wehdestraße
Mikrobiologie des Abwassers Kläranlage (Belebtschlamm und Faulturm) www.klaeranlage-online.de Aufbau einer Kläranlage Kläranlage Schwerte Abbildung aus Mudrack, 1988 Daten zur Kläranlage Oldenburg (Wehdestraße
Immunoassays http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/elisa.html
 Immunoassays http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/elisa.html Fanden erstmal in den 50er Jahren Verwendung Zuerst nur radioaktive Markierungen für Immunoassays Ab den 70er Jahren
Immunoassays http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/elisa.html Fanden erstmal in den 50er Jahren Verwendung Zuerst nur radioaktive Markierungen für Immunoassays Ab den 70er Jahren
5 Diskussion und Ausblick
 5 Diskussion und Ausblick Für biochemischen Untersuchungen wie das Testen potentieller inhibitorischer Substanzen oder Strukturuntersuchungen durch Proteinkristallisation oder NMR-Spektroskopie, aber auch
5 Diskussion und Ausblick Für biochemischen Untersuchungen wie das Testen potentieller inhibitorischer Substanzen oder Strukturuntersuchungen durch Proteinkristallisation oder NMR-Spektroskopie, aber auch
Korrosion in Biogasanlagen
 Korrosion in Biogasanlagen Dr.rer.nat. Jan Küver kuever@mpa-bremen.de Biogas Fachtagung Thüringen 24.November 2015, Bösleben 1 Mögliche Korrosionen Korrosion durch Kohlensäure (Betonkorrosion) Korrosion
Korrosion in Biogasanlagen Dr.rer.nat. Jan Küver kuever@mpa-bremen.de Biogas Fachtagung Thüringen 24.November 2015, Bösleben 1 Mögliche Korrosionen Korrosion durch Kohlensäure (Betonkorrosion) Korrosion
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie. Bettina Siebers
 Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers (4) Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Proteinreinigung Techniken & Methoden der Proteinreinigung
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers (4) Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Proteinreinigung Techniken & Methoden der Proteinreinigung
Ergänzungsfach Chemie Kohlenhydrate, Fette, Proteine
 Gymnasium Oberwil Maturprüfung 2009 / ch2 Ergänzungsfach Chemie Kohlenhydrate, Fette, Proteine ilfsmittel Taschenrechner mit gelöschtem Speicher Tabellenheft Chemie Tabelle Monosaccharide inweise für das
Gymnasium Oberwil Maturprüfung 2009 / ch2 Ergänzungsfach Chemie Kohlenhydrate, Fette, Proteine ilfsmittel Taschenrechner mit gelöschtem Speicher Tabellenheft Chemie Tabelle Monosaccharide inweise für das
Ernährung, Kultivierung &! Metabolismus von! Mikroorganismen!
 Ernährung, Kultivierung & Metabolismus von Mikroorganismen Mikrobielles Periodensystem Mikrobielle Ernährung: Makronährstoffe in Kulturmedien Makronährstoffe: benötigt in grossen Mengen Mikronährstoffe:
Ernährung, Kultivierung & Metabolismus von Mikroorganismen Mikrobielles Periodensystem Mikrobielle Ernährung: Makronährstoffe in Kulturmedien Makronährstoffe: benötigt in grossen Mengen Mikronährstoffe:
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 14. März Prof. Dr. T. Jüstel. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 14. März 2007 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 14. März 2007 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Overview on the Biotechnological Production of L-DOPA
 Overview on the Biotechnological Production of L-DOPA Kyoungseon Min; Kyungmoon Park; Don-Hee Park; Young Je Yoo; Appl Microbiol Biotechnol (2015); MINIREVIEW 1. Einleitung: L-DOPA, oder auch 3,4-Dihydroxyphenyl-L-Alanin
Overview on the Biotechnological Production of L-DOPA Kyoungseon Min; Kyungmoon Park; Don-Hee Park; Young Je Yoo; Appl Microbiol Biotechnol (2015); MINIREVIEW 1. Einleitung: L-DOPA, oder auch 3,4-Dihydroxyphenyl-L-Alanin
Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen Blatt 1/5
 Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen Blatt 1/5 1 Elektronenübertragung, Oxidation und Reduktion Gibt Natrium sein einziges Außenelektron an ein Chloratom (7 Außenelektronen) ab, so entsteht durch diese
Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen Blatt 1/5 1 Elektronenübertragung, Oxidation und Reduktion Gibt Natrium sein einziges Außenelektron an ein Chloratom (7 Außenelektronen) ab, so entsteht durch diese
Einführung in die Biochemie, Aminosäuren. Prof. Dr. Albert Duschl
 Einführung in die Biochemie, Aminosäuren Prof. Dr. Albert Duschl Themen der Vorlesung Einführung in die Biochemie; Aminosäuren Peptide und Proteine Enzyme Proteinfunktionen Kohlenhydrate Lipide Nukleotide
Einführung in die Biochemie, Aminosäuren Prof. Dr. Albert Duschl Themen der Vorlesung Einführung in die Biochemie; Aminosäuren Peptide und Proteine Enzyme Proteinfunktionen Kohlenhydrate Lipide Nukleotide
Störung der helikalen Struktur
 DA-Schäden UV-Strahlung Absorptionsmaximum der Basen Konsequenzen: Pyrimidin-Dimere (T-T, C-T, C-C) nicht abschirmbar cis-syn-(t-t)-cyclobutan-dimer T(6-4)T-Photoprodukt Störung der helikalen Struktur
DA-Schäden UV-Strahlung Absorptionsmaximum der Basen Konsequenzen: Pyrimidin-Dimere (T-T, C-T, C-C) nicht abschirmbar cis-syn-(t-t)-cyclobutan-dimer T(6-4)T-Photoprodukt Störung der helikalen Struktur
