|
|
|
- Bertold Kopp
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 W. Grießhaber Zum Verfahren der Sprachprofilanalyse (Grießhaber ) Überblick Profilstufen Profile: Schriftlich / Mündlich Linguistischer Hintergrund Profilbogen ZSE Informationen zum Verfahren der Sprachprofilanalyse Das Verfahren der Profilanalyse kombiniert zwei Forschungsrichtungen. Der erste Strang stützt sich auf Ergebnisse der Zweitspracherwerbsforschung von Manfred Pienemann (1981). Er hat in einer einjährigen Beobachtung des Deutscherwerbs von drei achtjährigen italienischen Grundschülerinnen eine feste Reihenfolge des Erwerbs von Satzstrukturen ermittelt. Diese Reihenfolge ergab sich auch bei einer Längsschnittstudie des Deutscherwerbs von Arbeitsmigranten (ZISA 1983). In späteren Studien untersuchte Pienemann (1986), ob sich die ermittelte Reihenfolge durch Sprachunterricht gezielt und beliebig verändern lässt. Er stellte fest, dass der Erwerb von Einheiten, die eine Stufe über dem bereits erreichten Sprachstand liegen, durch den Unterricht beschleunigt werden kann. Wenn der Unterrichtsstoff jedoch Strukturen enthält, die mehr als eine Stufe über dem aktuell erreichten Erwerbsstand liegen, kann der bereits erreichte Sprachstand sogar gestört werden. Daraus leitete er die Empfehlung ab, sich bei der Fremdund Zweitsprachvermittlung an den empirisch ermittelten Spracherwerbsstufen zu orientieren. Das bedeutet z.b., dass bei Korrekturen und Bewertungen solche Fehler nicht bewertet werden, die nach dem erreichten Sprachstand unvermeidlich sind. Der Ansatz wurde in den vergangen Jahren in der französischsprachigen Schweiz in einem mehr-jährigen schulischen Großversuch eindrucksvoll bestätigt (Diehl u.a. 2000): die Deutschkenntnisse entwickelten sich praktisch unabhängig von den durch die Lehrpläne vorgegebenen Inhalten, entsprachen aber den Erwerbsstufen (s.u.). Für die Zwecke der Einstufung entwickelte Pienemann 1986 ein computergestütztes Sprachstandsdiagnoseverfahren. Clahsen 1985 (wie Pienemann Mitglied des ZISA-Teams) übertrug die in England entwickelte Technik der Profilanalyse (Crystal et al. 1984) auf die Spracherwerbsstufen des Deutschen. Das Verfahren wird in einer differenzierten Form zur Ermittlung von Störungen des Erstspracherwerbs eingesetzt (Clahsen 1986). Der Profilbogen von Clahsen unterteilt die einzelnen Stufen in mehrere Unterstufen, z.b. die Stufe 3 mit Vertauschung von Subjekt und finitem Verb je nach Art der
2 vorangestellten Konstituenten in drei Unterkategorien. Außerdem werden noch unterschiedliche Stufen des Erwerbs von Fragesätzen und negierten Sätzen berücksichtigt. Eine aussagekräftige Analyse erfordert zuallererst eine ausreichend große Datenmenge. Man nimmt allgemein an, daß freie Gespräche von 15 bis 30 Minuten Dauer pro Proband genügen. Die differenzierten Einschätzungen sind mit der erforderlichen Genauigkeit nur anhand von Tonaufnahmen realiserbar, die deshalb von Crystal et al. und Clahsen für die logopädische Praxis vorgesehen sind. Für die zuverlässige Ermittlung des Sprachstands und besonders des möglichen Förderbedarfs von Grundschulkindern ist dieses Verfahren zu aufwendig und nicht praktikabel. Deshalb wurde der von Clahsen vorgeschlagene Profilbogen für das Projekt "Deutsch und PC" in zwei Punkten radikal vereinfacht: zum einen wird wird auf Tonaufnahmen verzichtet und zum anderen wurden die differenzierten Beurteilungsraster auf die Stellung des Finitums als Hauptmerkmal der Spracherwerbsstufen reduziert (Å Sprachprofilbogen). Die Methode der Profilanalyse wurde für die Sprachstandsermittlung im Förderprojekt "Deutsch und PC" vorgeschlagen, nachdem sich ihr differenzierendes Potential auch für diese Zielgruppe bei einer explorativen Anwendung auf montägliche Sitzkreiserzählungen und auf freie Schülertexte bestätigt hatte. Auch der Vergleich der spontanen Einschätzungen der Vorschulkinder bei den Struwwelpeter-Geschichten mit den Profilen der Kinder bestätigte das Differenzierungsvermögen. Inzwischen liegt eine Untersuchung zu den Zusammenhängen zwischen den Profilstufen und der Entwicklung grammatischer Strukturen und des Wortschatzes vor (Grießhaber 2005 Å PDF-Datei). Zum psycholinguistischen Hintergrund der Erwerbsstufen Beim Blick auf die vier Erwerbsstufen und die Kriterien ihrer Ermittlung stellt sich die Frage, warum ausgerechnet diese geringen Informationen zuverlässige Indikatoren des erreichten Sprachstandes sein sollen. Denn noch Lerner auf den höheren zwei Stufen verstoßen gegen elementare Regeln der deutschen Grammatik. Sie verwenden z.b. falsche Kasus, nehmen eine falsche Genuszuweisung vor oder verwenden unpassende Präpositionen oder machen Wortstellungsfehler oder lassen in manchen Sätzen die Kopula sein aus usw. Außerdem wird der Umfang des Wortschatzes überhaupt nicht ermittelt. Doch trotz derartiger Fehler lassen sich die Lerner anhand der Kriterien den Erwerbsstufen zuordnen. Die Stufen wurden zunächst anhand einer breit angelegten Analyse von Lerneräußerungen ermittelt, die während eines längeren Lernprozesses
3 erhoben wurden. Dadurch hatte man eine zeitlich klare Abfolge der äußerungen. Schließlich konnte ermittelt werden, dass es Fehler gab, die bei allen Lernen innerhalb eines bestimmten Erwerbsabschnittes auftauchten, während andere Fehler individuell unabhängig von diesen Erwerbsabschnitten variierten. Zu den frei variierenden Fehlern zählt z.b. die Auslassung der Kopula, typisch für das sog. Gastarbeiterdeutsch. Eine intensive Auseinandersetzung mit den erwerbsbedingten Strukturen und Fehlern zeigte, dass sie sprachspezifisch sind, in dieser konkreten Form also nur für das Deutsche gelten. Ihre Reihenfolge ist nicht zufällig, sondern dadurch bedingt, dass sie zunehmend komplexere Prozesse bei der psychischen Verarbeitung beim Sprechen erfordern und die jeweils niedrigere Stufe voraussetzen. 1. Die erste Stufe enthält Äußerungen mit einer psycholinguistisch elementaren Abfolge von Aktor, Aktion (Prädikat) und Objekt der Aktion. Diese kanonische Wortstellung stimmt mit der grundlegenden Wortstellung der mitteleuropäischen Sprachen überein. 2. Bei der zweiten Stufe wird die für das Deutsche sehr charakteristische Trennung von finitem Verb und infiniten Verbteilen erworben. Damit sind eine Vielzahl differenzierter Aussagen möglich: Modifizierung einer äußerung nach der Modalität (mit Modalverben) oder der Nichtaktualität (Hilfsverb zur Perfektbildung) und schließlich die schon von Mark Twain anschaulich geschilderte und beklagte Trennung von Verbstamm und abgetrennter Vorsilbe, die notwendig wird, wenn man Aktionen mit trennbaren Vorsilben differenzierter und genauer ausdrücken will. Die deutsche Wortstellung verlangt vom Sprecher (und vom Hörer), dass er Informationen trennt, die eigentlich zusammengehören (z.b. Hilfsverb und Vollverb beim Perfekt) und die in den meisten Sprachen auch in Kontaktstellung realisiert werden. Der Sprecher muß also diese kompakte Information in mehrere Wörter aufteilen und dann zwischen die gespreizten Wörter Informationen packen, die 'logisch' erst nach dem kompakten Prädikat folgen. Damit diese Operation beim freien Sprechen funktioniert, müssen vorher schon ele-mentare Operationen erworben und automatisiert worden sein. 3. Bei der dritten Stufe werden nach vorangestellten Adverbialen Verb und Subjekt vertauscht. Dies ist ebenfalls eine Eigentümlichkeit des Deutschen. Die Voranstellung eröffnet dem Sprecher mit der Frontierung von Informationen am Satzanfang neue expressive Ausdrucksmöglichkeiten. Bei kindlichen Erzählungen ermöglicht sie die einfache Verkettung von einzelnen Aussagen zu einer zusammengehörenden Folge (erst später werden auch andere Mittel der Verkettung erworben). Die grammatisch bedingte Inversion von Subjekt und Finitum stellt ebenfalls eine änderung der kanonischen Abfolge von
4 äußerungseinheiten dar. Ein Verstoß wird von deutschen Muttersprachlern sehr sensibel als Fehler registriert. Mit der Voranstellung von Adverbialen verschiebt sich der Fokus auf das dem Verb folgende Subjekt, das bei normaler Stellung unbetont bliebe. Offensichtlich wird diese Stellungsvertauschung erst dann erworben, wenn vorher schon die Trennung des Prädikats in verschiedene Wörter erworben wurde. 4. Bei der vierten Stufe wird schließlich die Nebensatzstellung mit Endstellung des Finitums erworben. Auch diese Wortstellungsregel mit der Variation des Finitums je nach Status des Satzes stellt eine deutsche Besonderheit dar. Hier erwirbt der Lerner die ganze Fülle differenzierter Ausdrucksmöglichkeiten, die ihm Nebensätze eröffnen. Dabei muß er lernen, dass nach subordinierenden Konjunktionen (dass, wenn, ) das Finitum an das äußerungsende rückt. Auch dies stellt wieder hohe Ansprüche an die mentale Planung. Die kanonische Abfolge von Aktor, Aktion (Verb) und Objekt wird grundlegend geändert. Dabei muß schon bei der Planbildung der äußerung die Art der Aktion (des Verbs) irgendwie angelegt sein, doch mit ihrer Realisierung muß gewartet werden, bis das von der Aktion logisch betroffene Objekt schon versprachlicht ist. Diese Operation wird offensichtlich erst dann erworben, wenn schon die Vertauschung von Subjekt und Finitum beherrscht wird. Diese Regeln operieren unabhängig davon, ob die sprachliche Form der Wörter den grammatischen Regeln entspricht. Auffällige Formfehler, die man im Gespräch und an Texten sofort als Regelverstoß wahrnimmt, versperren den Blick auf die tieferliegenden Regelmäßigkeiten. Die Lerner müssen im Erwerbsprozeß offenbar über Fehler gehen. Auch im Mutterspracherwerb machen Kinder viele Fehler, sie regularisieren z.b. unregelmäßige Verben (gehte statt ging). Dennoch käme niemand auf die Idee, daraus zu schließen, dass sie ihre Muttersprache nicht lernen. Bei Zweitsprachlernern ist aber festzustellen, dass bei vielen der Erwerbsprozeß schon in frühen Stufen einfriert, fossilisiert. Sie haben sich u. U. ein Repertoire an Redewendungen angeeignet, das zur Befriedigung ihrer kommunikativen Bedürfnisse genügt. Damit sie Fortschritte machen, müssen wohl vor allem ihre kommunikativen Bedürfnisse geweckt werden. Wortschatzerwerb im Spracherwerb Wo bleibt der Wortschatz bei dieser Sicht? Zum einen ist festzustellen, dass die Ermittlung des Wortschatzes sehr schwierig ist, da der rezeptive
5 Wortschatz erheblich umfangreicher ist als der produktive und da der produktive Wortschatz sich in der Kommunikation, im Gespräch erweitern kann. Der Gesprächspartner kann neue Wörter liefern, Äußerungen des Gesprächspartners können Assoziationen auslösen, über die lange nicht mehr verwendete Wörter wieder zugänglich werden, einem einfallen usw. Dies sind Probleme bei der Erhebung des Wortschatzes, die sich eventuell lösen lassen, die aber keine ausreichende Erklärung dafür sind, warum der Wortschatz bei dem Verfahren nicht systematisch ermittelt wird. Zum anderen setzt der Erwerb komplexer Strukturen, die im freien Gespräch verwendet werden, einen bestimmten Wortschatz voraus. Eine höhere Spracherwerbsstufe setzt demnach einen umfangreicheren Wortschatz voraus, die Stufe 2 z.b. Hilfs- und Modalverben. Diese Zusammenhänge hat Grießhaber 2005 (Å PDF-Datei) empirisch nachgewiesen. Aus den Forschungen zum Erst- und Zweitspracherwerb ergibt sich, dass der Erwerb grammatischer Regeln jeweils auf einer gewissen Menge von Elementen operiert, aus denen die betreffende Regel abgeleitet werden kann (für den Erstspracherwerb s. Elsen 1999). Erst dann, wenn eine gewisse Menge an Nomen und Verben erworben wurde, sind irgendwann auch genügend Modal- und Hilfsverben dabei, mit deren Verwendung die Separierung erforderlich wird. Wichtig ist, dass der Erwerbsprozeß voranschreitet. Man kann sich dies wie beim Radfahren vorstellen: da das Trägheitsmoment, das einen am Umfallen hindert, mit der Fahrtgeschwindigkeit steigt, fährt man bei höherer Geschwindigkeit stabiler. Beim Lernen des Fahrradfahrens muß man wesentlich mehr balancieren als später. Wer langsam fährt, muß selbst mit Lenkkorrekturen und Gewichtsverlagerungen das Kippen verhindern. Mit steigender Geläufigkeit und Sicherheit wird diese bewusste Steuerung reduziert, da sich das Zweirad mit dem höheren Trägheitsmoment praktisch selbst stabilisiert. Ganz ähnlich kann man sich den Spracherwerb vorstellen. Ein bewusster Unterricht über grammatische Regeln zwingt den Lerner zur Beachtung einer Vielzahl unterschiedlichster Regeln. Ab einem gewissen Erwerbstempo steigt mit der Quantität der erworbenen Mittel auch das Vermögen, diese Mittel unbewusst regelkonform zu verwenden. An bestimmten Punkten können gezielte Hinweise (Regeln, prägnante Beispiele) die Handhabung erleichtern. Allerdings kann sich der Erwerbsprozeß über einen längeren Zeitraum erstrecken. Außerdem ist zwischen der spontanen, unreflektierten Sprachproduktion und dem Vermögen zur Bildung und Verwendung der korrekten Regeln zu unterscheiden. Im Bereich der Bildung unregelmäßiger Vergangenheitsformen verwenden Zweitsprachlerner selbst noch nach mehr als drei Jahren Grundschule inkorrekte regelmäßig gebildete Vergangenheitsformen, z.b. singten statt sangen.
6 Den Zusammenhang zwischen Tempo des Erwerbsprozesses und erreichbarem Erwerbsfortschritt unterstreichen auch die Ergebnisse des Genfer Großprojekts. Auf den höheren Klassenstufen bis zur Maturität (Abitur) werden die individuellen Unterschiede zwischen den Lernern größer. Diejenigen, die höhere Stufen erreichen, haben schon früh mehr gelernt als diejenigen, die dann immer weiter zurückbleiben. D.h., ein zügiger Erwerbsprozeß führt zu einem höheren Entwicklungsstand als ein gemächlicher. Vor diesem Hintergrund ist die intensive Förderung der schwachen Schüler ein absolut positives Element des Förderprojekts "Deutsch und PC": die frühe und massive Förderung des Zweitspracherwerbs ermöglicht aus der Sicht der Zweitspracherwerbsforschung einen zügigen und weitreichenden Spracherwerb. Dazu sollten Bedingungen geschaffen werden, die denen des 'normalen' Spracherwerbs möglichst nahekommen: eine Vielzahl erfahrungsbezogener Sprachhandlungskonstellationen, mit viel Sprachinput und sanktionsfreiem Erproben der sprachlichen Mittel. Kinder, die in der Schule in eine deutschsprachige Handlungskonstellation eintauchen, durchlaufen oft eine Zeit, in der sie selbst nicht viel sprechen, aber sich regelrecht 'mit Sprache voll saugen' (v. Auer). Erst nach dieser rezeptiven Phase beginnen sie dann mit dem Reden Literatur: * Clahsen, Harald (1985) Profiling second language development: A procedure for assessing L2 proficiency. In: Hyltenstam, K. & Pienemann, M. (eds.) Modelling and Assessing Second Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters, * Clahsen, Harald (1986) Die Profilanalyse. Ein linguistisches Verfahren für die Sprachdiagnose im Vorschulalter. Berlin: Marhold * ZISA: Clahsen, Harald & Meisel, Jürgen M. & Pienemann, Manfred (1983) Deutsch als Zweitsprache: Der Spracherwerb ausländischer Arbeiter. Tübingen: Narr * Crystal, David & Fletcher, Paul & Garman, Michael (1984) The Grammatical Analysis of Language Disability. A Procedure for Assessment and Remediation. Victoria: Arnold * Diehl, Erika & Christen, Helen & Leuenberger, Sandra & Pelvat, Isabelle & Studer, Thérèse (2000) Grammatikunterricht: Alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch. Tübingen: Niemeyer * Elsen, Hilke (1999) Ansätze zu einer funktionalistisch-kognitiven Grammatik. Konsequenzen aus Regularitäten des Erstspracherwerbs. Tübingen: Niemeyer
7 * Grießhaber, Wilhelm (2002) Erwerb und Vermittlung des Deutschen als Zweitsprache. In: Deutsch in Armenien Teil 1: 2001/1, 17-24; Teil 2: 2001/2, 5-15 Jerewan: Armenischer Deutschlehrerverband (Å HTML- Infos) * Grießhaber, Wilhelm (2005) Sprachstandsdiagnose im Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse. (erscheint in: Arbeiten zur Mehrsprachigkeit; PDF-Datei) * Pienemann, Manfred (1981) Der Zweitspracherwerb ausländischer Arbeiterkinder. Bonn: Bouvier * Pienemann, Manfred (1986) Analyzing language acquisition data with a microcomputer: CO-LIAN. Sydney: University of Sydney (mimeo) * Pienemann, Manfred (1986) Is language teachable? Psycholinguistic experiments and hypo-theses. In: Australian Working Papers in Language Development 1.3/86 (auch: Hamburg: Arbeiten zur Mehrsprachigkeit 21/87), W. Grießhaber
Zweitspracherwerb: Kasus und Syntax
 Zweitspracherwerb: Kasus und Syntax 22.Mai 2017 Annemarie Hülsmann Kurze Wiederholung aus der letzten Sitzung: 2 Profilstufen nach Grießhaber Grießhaber hat in mehreren Arbeiten die Ergebnisse der Zweitspracherwerbsforschung
Zweitspracherwerb: Kasus und Syntax 22.Mai 2017 Annemarie Hülsmann Kurze Wiederholung aus der letzten Sitzung: 2 Profilstufen nach Grießhaber Grießhaber hat in mehreren Arbeiten die Ergebnisse der Zweitspracherwerbsforschung
Unterwegs zur Integration: Die Bedeutung von Spracherwerbsstufen für DaF/DaZ
 Unterwegs zur Integration: Die Bedeutung von Spracherwerbsstufen für DaF/DaZ Wilhelm Grießhaber W. Grießhaber 1 0. Thesen zum Erwerb und zur Vermittlung von Deutsch (4) Die Erwerbsstufen bilden die Basis
Unterwegs zur Integration: Die Bedeutung von Spracherwerbsstufen für DaF/DaZ Wilhelm Grießhaber W. Grießhaber 1 0. Thesen zum Erwerb und zur Vermittlung von Deutsch (4) Die Erwerbsstufen bilden die Basis
Vermittlung von Grammatikkenntnissen. Dr. Ellen Schulte-Bunert Europa-Universität Flensburg
 Vermittlung von Grammatikkenntnissen Komponenten des Spracherwerbs Kenntnisse Wortschatz Grammatik Landeskunde Fertigkeiten mündlich Hörverstehen Sprechen rezeptiv produktiv Leseverstehen Schreiben schriftlich
Vermittlung von Grammatikkenntnissen Komponenten des Spracherwerbs Kenntnisse Wortschatz Grammatik Landeskunde Fertigkeiten mündlich Hörverstehen Sprechen rezeptiv produktiv Leseverstehen Schreiben schriftlich
Hintergrund: Zweitspracherwerb Grammatikerwerb C-Test Diagnostisch relevante Merkmale Klammerstrukturen Profilermittlung
 Hintergrund: Zweitspracherwerb Grammatikerwerb C-Test Diagnostisch relevante Merkmale Klammerstrukturen Profilermittlung Januar 2011 W. Grießhaber, 1 SCHLÄGEREI: Bildimpuls Grundlagen Profilanalyse Lernertexte
Hintergrund: Zweitspracherwerb Grammatikerwerb C-Test Diagnostisch relevante Merkmale Klammerstrukturen Profilermittlung Januar 2011 W. Grießhaber, 1 SCHLÄGEREI: Bildimpuls Grundlagen Profilanalyse Lernertexte
Wortstellung = Indikator für andere sprachliche Mittel
 [Sprachstrukturen] & Einblicke in Lernersprachen & Förderung gemessen erschlossen Syntax-Wortstellung Literalität Kasusrealisierung Wortschatz Wortstellung = Indikator für andere sprachliche Mittel 1 Sprachdiagnose
[Sprachstrukturen] & Einblicke in Lernersprachen & Förderung gemessen erschlossen Syntax-Wortstellung Literalität Kasusrealisierung Wortschatz Wortstellung = Indikator für andere sprachliche Mittel 1 Sprachdiagnose
Sprachentwicklungstests BEATE LINGNAU UNIVERSITÄT BIELEFELD
 Sprachentwicklungstests BEATE LINGNAU UNIVERSITÄT BIELEFELD 17.11.2006 Übersicht Statistische Begriffe Übersicht Sprachentwicklungstests Leitlinien Beispiele Statistische Begriffe Statistische Begriffe
Sprachentwicklungstests BEATE LINGNAU UNIVERSITÄT BIELEFELD 17.11.2006 Übersicht Statistische Begriffe Übersicht Sprachentwicklungstests Leitlinien Beispiele Statistische Begriffe Statistische Begriffe
Hintergrund: Zweitspracherwerb Grammatikerwerb Diagnostisch relevante Merkmale Klammerstrukturen Profilermittlung
 Hintergrund: Zweitspracherwerb Grammatikerwerb Diagnostisch relevante Merkmale Klammerstrukturen Profilermittlung 1 Sprachdiagnose mehrsprachiger Kinder A Mai 2014 W. Grießhaber, Münster 1 Deutsch in Variationen
Hintergrund: Zweitspracherwerb Grammatikerwerb Diagnostisch relevante Merkmale Klammerstrukturen Profilermittlung 1 Sprachdiagnose mehrsprachiger Kinder A Mai 2014 W. Grießhaber, Münster 1 Deutsch in Variationen
Erwerb der Satzgliedabfolge
 Thema 4: Erwerb der Satzgliedabfolge Erwerb der Satzgliedabfolge 1 Thema 4: Erwerb der Satzgliedabfolge Spielzeit 2 Thema 4: Erwerb der Satzgliedabfolge Syntaxspiel: Transportspiel Welches Team arbeitet
Thema 4: Erwerb der Satzgliedabfolge Erwerb der Satzgliedabfolge 1 Thema 4: Erwerb der Satzgliedabfolge Spielzeit 2 Thema 4: Erwerb der Satzgliedabfolge Syntaxspiel: Transportspiel Welches Team arbeitet
Formelbasierter Zweitspracherwerb bei erwachsenen Lernern
 Germanistik Christine Porath Formelbasierter Zweitspracherwerb bei erwachsenen Lernern Eine konstruktionsgrammatische Analyse von Äußerungen italienischer Lerner des Deutschen (L2) im ungesteuerten Zweitspracherwerb
Germanistik Christine Porath Formelbasierter Zweitspracherwerb bei erwachsenen Lernern Eine konstruktionsgrammatische Analyse von Äußerungen italienischer Lerner des Deutschen (L2) im ungesteuerten Zweitspracherwerb
Einführung in die Linguistik, Teil 4
 Einführung in die Linguistik, Teil 4 Spracherwerb Markus Bader, Frans Plank, Henning Reetz, Björn Wiemer Einführung in die Linguistik, Teil 4 p. 1/25 Spracherwerb Fragestellung Wie erwerben Kinder ihre
Einführung in die Linguistik, Teil 4 Spracherwerb Markus Bader, Frans Plank, Henning Reetz, Björn Wiemer Einführung in die Linguistik, Teil 4 p. 1/25 Spracherwerb Fragestellung Wie erwerben Kinder ihre
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Von der Sprachdiagnose zur individuellen Sprachförderplanung
 Von der Sprachdiagnose zur individuellen Sprachförderplanung Sprache der Schule Geschichte der Sprachstandsfeststellung Aktuelle Diskussion: Diagnosegestützte Förderung Verfahrenstypen zur Sprachstandsfeststellung
Von der Sprachdiagnose zur individuellen Sprachförderplanung Sprache der Schule Geschichte der Sprachstandsfeststellung Aktuelle Diskussion: Diagnosegestützte Förderung Verfahrenstypen zur Sprachstandsfeststellung
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Anfangsunterricht. Sprachstand, Förderziele, methodische Entscheidungen. Stefan Jeuk, PH Ludwigsburg
 Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Anfangsunterricht. Sprachstand, Förderziele, methodische Entscheidungen Stefan Jeuk, PH Ludwigsburg 1 Gliederung 1. Kompetenzen und Schwierigkeiten 2. Förderziele
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Anfangsunterricht. Sprachstand, Förderziele, methodische Entscheidungen Stefan Jeuk, PH Ludwigsburg 1 Gliederung 1. Kompetenzen und Schwierigkeiten 2. Förderziele
Prof. Dr. Gabriele Kniffka ZWEITSPRACHERWERB BEITRÄGE AUS DER AKTUELLEN FORSCHUNG
 Prof. Dr. Gabriele Kniffka ZWEITSPRACHERWERB BEITRÄGE AUS DER AKTUELLEN FORSCHUNG 04.05.2011 Spracherwerbstypen Erstspracherwerb Erlernen der ersten Sprache (L1) monolingual : Erwerb nur einer L1 bilingual
Prof. Dr. Gabriele Kniffka ZWEITSPRACHERWERB BEITRÄGE AUS DER AKTUELLEN FORSCHUNG 04.05.2011 Spracherwerbstypen Erstspracherwerb Erlernen der ersten Sprache (L1) monolingual : Erwerb nur einer L1 bilingual
SPRACH-TANDEM. Workshop zum Sprachenlernen in gesteuerten Sprachbegegnungen Renate Freudenberg-Findeisen Universität Trier
 SPRACH-TANDEM Workshop zum Sprachenlernen in gesteuerten Sprachbegegnungen Renate Freudenberg-Findeisen Universität Trier Spracherwerb: Lernen oder Erwerben? LERNEN Prozess der Aneignung, der durch Unterricht
SPRACH-TANDEM Workshop zum Sprachenlernen in gesteuerten Sprachbegegnungen Renate Freudenberg-Findeisen Universität Trier Spracherwerb: Lernen oder Erwerben? LERNEN Prozess der Aneignung, der durch Unterricht
Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik
 Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Konzept für Deutsch als Zweitsprache
 Grundschule Aufenau Schule des Main-Kinzig-Kreises Konzept für Deutsch als Zweitsprache 1. Fassung: August 2015 1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines.3 2. Leitgedanken für den Unterricht.. 3 3. Förderkurse.
Grundschule Aufenau Schule des Main-Kinzig-Kreises Konzept für Deutsch als Zweitsprache 1. Fassung: August 2015 1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines.3 2. Leitgedanken für den Unterricht.. 3 3. Förderkurse.
Die sprachliche Entwicklung und die Ausdrucksmöglichkeiten von Grundschülerinnen und Grundschülern im Englischunterricht
 a Die sprachliche Entwicklung und die Ausdrucksmöglichkeiten von Grundschülerinnen und Grundschülern im Englischunterricht Anke Lenzing & Jana Roos DGFF 2011 Langzeituntersuchung: Spracherwerb im frühen
a Die sprachliche Entwicklung und die Ausdrucksmöglichkeiten von Grundschülerinnen und Grundschülern im Englischunterricht Anke Lenzing & Jana Roos DGFF 2011 Langzeituntersuchung: Spracherwerb im frühen
Referat Wortstellung. 1. Generelle Theorien zu Wortstellung Stellungsfeldermodell
 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik WiSe 2004/2005, HS: Korpuslinguistische Behandlung von Phänomenen des Deutschen Referentin: Gruppe 6 (Wortstellung) Yuko Makata,
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik WiSe 2004/2005, HS: Korpuslinguistische Behandlung von Phänomenen des Deutschen Referentin: Gruppe 6 (Wortstellung) Yuko Makata,
Schuljahr 2015/16. Kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer
 Gemeinschaftliche Organisation des Arbeitens und Lernens in einer Schulklasse Kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer Begleitung der schulischen Entwicklung und Interesse am Schulleben
Gemeinschaftliche Organisation des Arbeitens und Lernens in einer Schulklasse Kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer Begleitung der schulischen Entwicklung und Interesse am Schulleben
Die Sprachlernfähigkeit des Menschen
 Die Sprachlernfähigkeit des Menschen Prof. Dr. Christine Dimroth Germanistisches Institut & Centrum für Spracherwerb und Mehrsprachigkeit WWU Münster Wie lernen Menschen Sprachen?? Wie unterscheidet sich
Die Sprachlernfähigkeit des Menschen Prof. Dr. Christine Dimroth Germanistisches Institut & Centrum für Spracherwerb und Mehrsprachigkeit WWU Münster Wie lernen Menschen Sprachen?? Wie unterscheidet sich
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Sprache verstehen: Herausforderungen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache
 Sprache verstehen: Herausforderungen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache Prof. Dr. Petra Schulz Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Sprache verstehen: Herausforderungen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache Prof. Dr. Petra Schulz Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Beobachtung des Zweitspracherwerbs im Anfangsunterricht Schwerpunkt Grammatik 1 Zur Begründung des Beobachtungsverfahrens
 1 Beobachtung des Zweitspracherwerbs im Anfangsunterricht Schwerpunkt Grammatik 1 Zur Begründung des Beobachtungsverfahrens Viele Kinder haben die grundsätzlichen grammatikalischen Kategorien im Erstspracherwerb
1 Beobachtung des Zweitspracherwerbs im Anfangsunterricht Schwerpunkt Grammatik 1 Zur Begründung des Beobachtungsverfahrens Viele Kinder haben die grundsätzlichen grammatikalischen Kategorien im Erstspracherwerb
Vorwort 1.
 Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 1.2 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 1.2 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Deutsch lernen im Kindergarten
 Wolf gang Maier Deutsch lernen im Kindergarten Die Praxis der Integration ausländischer Kinder Don Bosco Verlag Inhalt Vorwort 9 I.Teil: Grundlagen und Voraussetzungen 11 1. Die voraussichtliche Entwicklung
Wolf gang Maier Deutsch lernen im Kindergarten Die Praxis der Integration ausländischer Kinder Don Bosco Verlag Inhalt Vorwort 9 I.Teil: Grundlagen und Voraussetzungen 11 1. Die voraussichtliche Entwicklung
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der infiniten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der infiniten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestmung der Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestmung der Verben An anderer Stelle diente der unten stehende Text bereits zur Bestmung der Formen des. Unterstreiche
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestmung der Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestmung der Verben An anderer Stelle diente der unten stehende Text bereits zur Bestmung der Formen des. Unterstreiche
Workshop: Sprachstandserhebungen an Grundschulen am Beispiel von HAVAS 5
 Thillm-Lehrerfortbildung, 23.10.2014, Bad Berka, Britta Hövelbrinks Workshop: Sprachstandserhebungen an Grundschulen am Beispiel von HAVAS 5 Britta Hövelbrinks Thillm-Fortbildung, 23.10.2014, Bad Berka
Thillm-Lehrerfortbildung, 23.10.2014, Bad Berka, Britta Hövelbrinks Workshop: Sprachstandserhebungen an Grundschulen am Beispiel von HAVAS 5 Britta Hövelbrinks Thillm-Fortbildung, 23.10.2014, Bad Berka
Beobachtungsbogen 1. Klasse Deutsch als Zweitsprache
 von Hilde Hess Steinhauer RAA / Büro für interkulturelle Arbeit Essen Beobachtungsbogen 1. Klasse Deutsch als Zweitsprache Name: Familiensprache: Zeitraum: Einschätzung: + / ++ / +++ Beobachtungskriterien
von Hilde Hess Steinhauer RAA / Büro für interkulturelle Arbeit Essen Beobachtungsbogen 1. Klasse Deutsch als Zweitsprache Name: Familiensprache: Zeitraum: Einschätzung: + / ++ / +++ Beobachtungskriterien
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht
 Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Sprachspiele, Spracherwerb und Sprachvermittlung 2., korrigierte Auflage Von Gerlind Belke Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung zur zweiten
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Sprachspiele, Spracherwerb und Sprachvermittlung 2., korrigierte Auflage Von Gerlind Belke Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung zur zweiten
Geburtsschrei. Mit ca. 6 Wochen soziales Lächeln. 2 Gurrlaute, Quietschen, Brummen, Gurren
 Tabellarische Darstellung zum Spracherwerb Um die Komplexität des physiologischen Spracherwerbs darzustellen und um den Bereich des Wortschatzes in den Gesamtkontext der Sprachentwicklung einordnen zu
Tabellarische Darstellung zum Spracherwerb Um die Komplexität des physiologischen Spracherwerbs darzustellen und um den Bereich des Wortschatzes in den Gesamtkontext der Sprachentwicklung einordnen zu
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Sprachförderung: 102 Gespensterchen. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Sprachförderung: 102 Gespensterchen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 102 Gespensterchen edidact.de - Arbeitsmaterialien
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Sprachförderung: 102 Gespensterchen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 102 Gespensterchen edidact.de - Arbeitsmaterialien
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Schwache und starke Verben. Ein grammatisches "Krafttraining" zur Präsens-, Präteritum- und Perfektbildung (Klasse 5/6) Das komplette
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Schwache und starke Verben. Ein grammatisches "Krafttraining" zur Präsens-, Präteritum- und Perfektbildung (Klasse 5/6) Das komplette
MS Naturns Fachcurriculum Deutsch überarbeitet 2016
 Jahrgangsstufe: 1. Klasse Basiswissen Thema: Personenbeschreibung/Beschreibung Thema: Erzählung Kompetenzen Der Schüler/die Schülerin kann. detailliert beobachten und Gegenstände beschreiben passende Adjektive
Jahrgangsstufe: 1. Klasse Basiswissen Thema: Personenbeschreibung/Beschreibung Thema: Erzählung Kompetenzen Der Schüler/die Schülerin kann. detailliert beobachten und Gegenstände beschreiben passende Adjektive
Inhaltsverzeichnis. Danksagung. Abbildungs Verzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse. 1
 1 Wilhelm Grießhaber Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse. 1 Abstract Language Competence Assessment in Child Second Language Acquisition:
1 Wilhelm Grießhaber Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse. 1 Abstract Language Competence Assessment in Child Second Language Acquisition:
Martina Stroh
 .. Sprache und Handlungsintelligenz bei Down- Syndrom im Erwachsenenalter Martina Stroh Krankheitsbild Down-Syndrom A, Entstehung und Ursachen Freie Trisomie (ca. %; Murken ) Mosaikstruktur (ca. %; Wunderlich
.. Sprache und Handlungsintelligenz bei Down- Syndrom im Erwachsenenalter Martina Stroh Krankheitsbild Down-Syndrom A, Entstehung und Ursachen Freie Trisomie (ca. %; Murken ) Mosaikstruktur (ca. %; Wunderlich
Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag
 Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000
 Realschule Jahrgang: 9/10 Fach: Französisch Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000 Die Schülerinnen und Schüler
Realschule Jahrgang: 9/10 Fach: Französisch Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000 Die Schülerinnen und Schüler
2. Erläutern Sie die Möglichkeiten des Einsatzes von Lernspielen im DaZ-Unterricht!
 Herbst 2012 1. Wortschatzarbeit im interkulturellen Sprachunterricht. Stellen Sie theoretische Grundlagen vor und leiten Sie daraus unterrichtspraktische Vorschläge ab. 2. Der Lehrplan für das Fach Deutsch
Herbst 2012 1. Wortschatzarbeit im interkulturellen Sprachunterricht. Stellen Sie theoretische Grundlagen vor und leiten Sie daraus unterrichtspraktische Vorschläge ab. 2. Der Lehrplan für das Fach Deutsch
Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen
 Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Schriftspracherwerb in der Zweitsprache
 Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Eine qualitative Längsschnittstudie von Tabea Becker 1. Auflage Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Becker schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Eine qualitative Längsschnittstudie von Tabea Becker 1. Auflage Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Becker schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Sylvette Penning. Leitfaden. Mit vielen praktischen Tipps für Ihren Unterricht.
 Sylvette Penning Leitfaden Mit vielen praktischen Tipps für Ihren Unterricht. Inhalt 1 2 3 Das Lehrwerk Schritte: Die Komponenten 3 Die Zielgruppe 4 Rahmenbedingungen 3.1. Schritte und der Gemeinsame Europäische
Sylvette Penning Leitfaden Mit vielen praktischen Tipps für Ihren Unterricht. Inhalt 1 2 3 Das Lehrwerk Schritte: Die Komponenten 3 Die Zielgruppe 4 Rahmenbedingungen 3.1. Schritte und der Gemeinsame Europäische
Vorlesung DaF/ DaZ Gesteuerter und ungesteuerter Spracherwerb
 HS 2013, Mittwoch, 13:15-14:45 Vorlesung DaF/ DaZ Gesteuerter und ungesteuerter Spracherwerb Sitzung 10: Grammatikerwerb (Fokus: Erwerbssequenzen) Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache Thomas
HS 2013, Mittwoch, 13:15-14:45 Vorlesung DaF/ DaZ Gesteuerter und ungesteuerter Spracherwerb Sitzung 10: Grammatikerwerb (Fokus: Erwerbssequenzen) Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache Thomas
Inhalt. Kapitel 1. Vorwort. Einleitung und Überblick 1
 Inhalt Vorwort IX Kapitel 1 Einleitung und Überblick 1 Zur aktuellen Problemlage: Unter/orderung ist Unter/orderung 4 Theoretische Voraussetzungen: Sprachwissenschaftliche und spracherwerbstheoretische
Inhalt Vorwort IX Kapitel 1 Einleitung und Überblick 1 Zur aktuellen Problemlage: Unter/orderung ist Unter/orderung 4 Theoretische Voraussetzungen: Sprachwissenschaftliche und spracherwerbstheoretische
Inhalt. I. Einleitung und allgemeine Hinweise II. Vorbereitung: Themenfelder, Wortschatz und Grammatik. 1.2 Hörverstehen Wortschatz und Grammatik
 Inhalt I. Einleitung und allgemeine Hinweise II. Vorbereitung: Themenfelder, Wortschatz und Grammatik 1. Aufbau der schriftlichen Prüfung 1.1 Leseverstehen 1.2 Hörverstehen Wortschatz und Grammatik 1.3
Inhalt I. Einleitung und allgemeine Hinweise II. Vorbereitung: Themenfelder, Wortschatz und Grammatik 1. Aufbau der schriftlichen Prüfung 1.1 Leseverstehen 1.2 Hörverstehen Wortschatz und Grammatik 1.3
CLab. Web-basiertes virtuelles Laboratorium zur Computerlinguistik LERNEINHEIT. Chunk Parsing. Universität Zürich. Institut für Computerlinguistik
 CLab Web-basiertes virtuelles Laboratorium zur Computerlinguistik LERNEINHEIT Chunk Parsing Universität Zürich Institut für Computerlinguistik Prof. Dr. Michael Hess 1. Voraussetzungen 2 Sie sollten wissen,
CLab Web-basiertes virtuelles Laboratorium zur Computerlinguistik LERNEINHEIT Chunk Parsing Universität Zürich Institut für Computerlinguistik Prof. Dr. Michael Hess 1. Voraussetzungen 2 Sie sollten wissen,
Oktober BSL- Nachrichten. Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache
 Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz
Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz
Sprachentwicklungsstörungen: Diagnostik und Therapie. Univ.-Prof. Dr. Annerose Keilmann
 Sprachentwicklungsstörungen: Diagnostik und Therapie Univ.-Prof. Dr. Annerose Keilmann Entwicklung der Sprachwahrnehmung 1. LM 4. LM 6. LM 8. LM Sensitivität für Sprache und Stimmen, Fähigkeit zur Unterscheidung
Sprachentwicklungsstörungen: Diagnostik und Therapie Univ.-Prof. Dr. Annerose Keilmann Entwicklung der Sprachwahrnehmung 1. LM 4. LM 6. LM 8. LM Sensitivität für Sprache und Stimmen, Fähigkeit zur Unterscheidung
Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche von ihnen Hilfe brauchen
 Fachtagung Sprache hat System Sprachförderung braucht System. Lernersprache Deutsch. Wie Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche
Fachtagung Sprache hat System Sprachförderung braucht System. Lernersprache Deutsch. Wie Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche
Das Feldermodell im Deutschunterricht
 Bildungsplan 2016 Das Feldermodell im Deutschunterricht Erfahrungen zu praktischen Umsetzung in Klasse 5/6 Prof. Gerda Richter, Esslingen Stuttgart, 15.02.2017 Das Feldermodell im Deutschunterricht Erfahrungen
Bildungsplan 2016 Das Feldermodell im Deutschunterricht Erfahrungen zu praktischen Umsetzung in Klasse 5/6 Prof. Gerda Richter, Esslingen Stuttgart, 15.02.2017 Das Feldermodell im Deutschunterricht Erfahrungen
Vorwort Einleitung... 13
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 11 1 Einleitung... 13 A Theorien und Befunde der Spracherwerbsforschung 2 Zweitspracherwerbstypen... 23 2.1 Der simultane Erwerb zweier Sprachen... 24 2.2 Der sukzessive kindliche
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 11 1 Einleitung... 13 A Theorien und Befunde der Spracherwerbsforschung 2 Zweitspracherwerbstypen... 23 2.1 Der simultane Erwerb zweier Sprachen... 24 2.2 Der sukzessive kindliche
DURACIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN CONTENIDOS. 40 horas. E-learning
 ALEMÁN. NIVEAU B2.KURS 1 DURACIÓN 40 horas MODALIDAD E-learning DESCRIPCIÓN Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, sich korrekt auf einem fortgeschrittenen, unabhängigen Niveau auszudrücken.
ALEMÁN. NIVEAU B2.KURS 1 DURACIÓN 40 horas MODALIDAD E-learning DESCRIPCIÓN Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, sich korrekt auf einem fortgeschrittenen, unabhängigen Niveau auszudrücken.
Grammatiktheoretische und psycholinguistische Aspekte der Flexionsmorphologie Embick und Marantz (2005) über regelmäßige und unregelmäßige Verben
 Grammatiktheoretische und psycholinguistische Aspekte der Flexionsmorphologie Embick und Marantz (2005) über regelmäßige und unregelmäßige Verben Gereon Müller & Andreas Opitz Institut für Linguistik Universität
Grammatiktheoretische und psycholinguistische Aspekte der Flexionsmorphologie Embick und Marantz (2005) über regelmäßige und unregelmäßige Verben Gereon Müller & Andreas Opitz Institut für Linguistik Universität
Stichwortverzeichnis. Anhang. Bedingungssatz siehe Konditionalsatz Befehlsform
 Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik
 Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz. 2. Entwicklung und Progression in Lehrwerken
 Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Einführung Syntaktische Funktionen
 Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
1 Das Lernen der norwegischen Sprache Begrifflichkeit... 11
 Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13
Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung)
 Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
2. Grammatikprogression
 2. Grammatikprogression Die Grammatikprogression betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen. 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt
2. Grammatikprogression Die Grammatikprogression betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen. 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt
Wie Kinder Sprachen lernen
 Rosemarie Tracy Wie Kinder Sprachen lernen Und wie wir sie dabei unterstützen können 2., überarbeitete Auflage Inhalt Vorwort Vorwort zur zweiten Auflage IX XI Kapitel 1 Einleitung und Überblick 1 Zur
Rosemarie Tracy Wie Kinder Sprachen lernen Und wie wir sie dabei unterstützen können 2., überarbeitete Auflage Inhalt Vorwort Vorwort zur zweiten Auflage IX XI Kapitel 1 Einleitung und Überblick 1 Zur
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
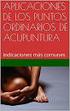 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Erwerbsstufen für L2 Deutsch im Überblick. Beispiele für die Erwerbsstufen: Erwerbsstufen & sprachliche Mittel (Grammatik)
 Profilanalyse schriftlich: Überblick Erwerbsstufen für L Deutsch im Überblick Durchführung Beispiele für die Erwerbsstufen: Stufe 0 Stufe Stufe Stufe Stufe 4 Erwerbsstufen & sprachliche Mittel (Grammatik)
Profilanalyse schriftlich: Überblick Erwerbsstufen für L Deutsch im Überblick Durchführung Beispiele für die Erwerbsstufen: Stufe 0 Stufe Stufe Stufe Stufe 4 Erwerbsstufen & sprachliche Mittel (Grammatik)
Band Deutsch als Bildungssprache / Deutsch als Zweitsprache
 GSV-Band: Individuell fördern Kompetenzen stärken Klassen 0/1/2 Band Deutsch als Bildungssprache / Deutsch als Zweitsprache Havva Engin PH Heidelberg engin@ph-heidelberg.de Grundphilosophie bzw. inhaltliche
GSV-Band: Individuell fördern Kompetenzen stärken Klassen 0/1/2 Band Deutsch als Bildungssprache / Deutsch als Zweitsprache Havva Engin PH Heidelberg engin@ph-heidelberg.de Grundphilosophie bzw. inhaltliche
DURACIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN CONTENIDOS. 40 horas. E-learning
 ALEMÁN. NIVEAU B2. KURS 2 DURACIÓN 40 horas MODALIDAD E-learning DESCRIPCIÓN Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, verschiedene Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften zu beschreiben
ALEMÁN. NIVEAU B2. KURS 2 DURACIÓN 40 horas MODALIDAD E-learning DESCRIPCIÓN Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, verschiedene Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften zu beschreiben
GER_C2.0606S. Bilinguale Erziehung. Education and children Speaking & Discussion Level C2 GER_C2.0606S.
 Bilinguale Erziehung Education and children Speaking & Discussion Level C2 www.lingoda.com 1 Bilinguale Erziehung Leitfaden Inhalt Viele Kinder, deren Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen sprechen,
Bilinguale Erziehung Education and children Speaking & Discussion Level C2 www.lingoda.com 1 Bilinguale Erziehung Leitfaden Inhalt Viele Kinder, deren Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen sprechen,
Landschule an der Eider. Schulinternes Fachcurriculum Deutsch - Primarbereich Kompetenzbereich 4: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
 1 Landschule an der Eider Schulinternes Fachcurriculum Deutsch - Primarbereich Kompetenzbereich 4: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 1. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über erste Einsichten
1 Landschule an der Eider Schulinternes Fachcurriculum Deutsch - Primarbereich Kompetenzbereich 4: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 1. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über erste Einsichten
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Tipps & Tricks Inhaltsverzeichnis. 1.1 Der bestimmte Artikel Der unbestimmte Artikel...
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Tipps & Tricks... 10 1 Der Artikel... 17 1.1 Der bestimmte Artikel... 17 1.2 Der unbestimmte Artikel... 19 2 Das Substantiv... 20 2.1 Das Genus...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Tipps & Tricks... 10 1 Der Artikel... 17 1.1 Der bestimmte Artikel... 17 1.2 Der unbestimmte Artikel... 19 2 Das Substantiv... 20 2.1 Das Genus...
Wie identifiziert und fördert man im DaF- und DaZ-Unterricht bildungssprachliches Sprachhandeln? Brigitte Sorger
 Wie identifiziert und fördert man im DaF- und DaZ-Unterricht bildungssprachliches Sprachhandeln? Brigitte Sorger brigitte.sorger@phwien.ac.at Projektbeschreibung 2 Bilaterales Forschungs- und Entwicklungsprojekt
Wie identifiziert und fördert man im DaF- und DaZ-Unterricht bildungssprachliches Sprachhandeln? Brigitte Sorger brigitte.sorger@phwien.ac.at Projektbeschreibung 2 Bilaterales Forschungs- und Entwicklungsprojekt
Spracherwerb. Markus Bader. 10. Februar Einleitung 2
 Spracherwerb Markus Bader 10. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Spracherwerb: Grundlegende Eigenschaften 2 2.1 Spracherwerb ohne expliziten Untericht....................... 2 3 Spracherwerb
Spracherwerb Markus Bader 10. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Spracherwerb: Grundlegende Eigenschaften 2 2.1 Spracherwerb ohne expliziten Untericht....................... 2 3 Spracherwerb
Hörverstehen und Sprechen. Dr. Ellen Schulte-Bunert Europa-Universität Flensburg
 Hörverstehen und Sprechen Komponenten des Spracherwerbs Kenntnisse Wortschatz Grammatik Landeskunde Fertigkeiten mündlich Hörverstehen Sprechen rezeptiv produktiv Leseverstehen Schreiben schriftlich Hörverstehen
Hörverstehen und Sprechen Komponenten des Spracherwerbs Kenntnisse Wortschatz Grammatik Landeskunde Fertigkeiten mündlich Hörverstehen Sprechen rezeptiv produktiv Leseverstehen Schreiben schriftlich Hörverstehen
Wie viel Grammatik braucht der Mensch? Ready to teach Line
 Wie viel Grammatik braucht der Mensch? Ready to teach Line Dr. Frank Haß Institut für Angewandte Didaktik Struktur des Webinars I. Welchen Stellenwert hat Grammatik im kompetenzorientierten Englischunterricht?
Wie viel Grammatik braucht der Mensch? Ready to teach Line Dr. Frank Haß Institut für Angewandte Didaktik Struktur des Webinars I. Welchen Stellenwert hat Grammatik im kompetenzorientierten Englischunterricht?
Sprachförderung im kath. Kiga Christ König
 Sprachförderung im kath. Kiga Christ König I. Aufgaben und Ziele der Sprachförderung 1. Sprachförderung von einzelnen Kindern und in Kleingruppen Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von Kindern mit
Sprachförderung im kath. Kiga Christ König I. Aufgaben und Ziele der Sprachförderung 1. Sprachförderung von einzelnen Kindern und in Kleingruppen Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von Kindern mit
DIAGNOSE & FÖRDERUNG. Thale Beatrix Heilmann
 DIAGNOSE & FÖRDERUNG Thale 4.2.2015 Beatrix Heilmann Übersicht 1. Profilanalyse 1. Grundlagen der Profilanalyse 2. Durchführung der Profilanalyse Wie kann die Profilanalyse in der Praxis eingesetzt werden?
DIAGNOSE & FÖRDERUNG Thale 4.2.2015 Beatrix Heilmann Übersicht 1. Profilanalyse 1. Grundlagen der Profilanalyse 2. Durchführung der Profilanalyse Wie kann die Profilanalyse in der Praxis eingesetzt werden?
Die Profilanalyse für Deutsch als Diagnoseinstrument zur Sprachförderung
 Wilhelm Grießhaber (September 2013) Die Profilanalyse für Deutsch als Diagnoseinstrument zur Sprachförderung Überblick 1 Die Profilanalyse ermöglicht die schnelle Ermittlung der grammatischen Komplexität
Wilhelm Grießhaber (September 2013) Die Profilanalyse für Deutsch als Diagnoseinstrument zur Sprachförderung Überblick 1 Die Profilanalyse ermöglicht die schnelle Ermittlung der grammatischen Komplexität
Seminarunterlagen. Auditives Feedback - System. Erwachsene sind Sprachvorbild: Monat: Erstes Sprachverständnis
 Vorlagen zur Nutzung für PowerPoint - Präsentationen Spracherwerb Wie erlernen/erwerben Kinder Sprache? Erwachsene sind Sprachvorbild: Empfehlungen: Blickkontakt Zuhören, Sprache anregen, aussprechen lassen,
Vorlagen zur Nutzung für PowerPoint - Präsentationen Spracherwerb Wie erlernen/erwerben Kinder Sprache? Erwachsene sind Sprachvorbild: Empfehlungen: Blickkontakt Zuhören, Sprache anregen, aussprechen lassen,
Erstspracherwerb und Sprachentwicklung. Corinna Saar Carolin Wolkenhaar Marie Wüstenberg
 Erstspracherwerb und Sprachentwicklung Corinna Saar Carolin Wolkenhaar Marie Wüstenberg Gliederung Individuelle Unterschiede beim Spracherwerb Unterschiede in der Schnelligkeit des Spracherwerbs Spracherwerbsstrategien
Erstspracherwerb und Sprachentwicklung Corinna Saar Carolin Wolkenhaar Marie Wüstenberg Gliederung Individuelle Unterschiede beim Spracherwerb Unterschiede in der Schnelligkeit des Spracherwerbs Spracherwerbsstrategien
Lösungsmuster und Korrekturhinweise zu Sprache untersuchen
 Lösungsmuster und Korrekturhinweise zu Sprache untersuchen Bitte beachten: - Halbe werden nicht vergeben. - Rechtschreibfehler sind nicht zu werten. Aufgabe 1: (... / 1 P.) Aufgabe 1 - Nur wenn alle Satzglieder
Lösungsmuster und Korrekturhinweise zu Sprache untersuchen Bitte beachten: - Halbe werden nicht vergeben. - Rechtschreibfehler sind nicht zu werten. Aufgabe 1: (... / 1 P.) Aufgabe 1 - Nur wenn alle Satzglieder
Inhaltsverzeichnis. Vorwort Wovon ist in dieser Arbeit die Rede? Grundlegende Aspekte 11
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 1. Wovon ist in dieser Arbeit die Rede? Grundlegende Aspekte 11 2. Wie hat sich die Problematik in der Vergangenheit entwickelt? Historische Aspekte 17 2.1.
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 1. Wovon ist in dieser Arbeit die Rede? Grundlegende Aspekte 11 2. Wie hat sich die Problematik in der Vergangenheit entwickelt? Historische Aspekte 17 2.1.
Überblick. Diagnose: warum? wie? Theoretischer Rahmen: Processability Theory Erwerbsbasierte Diagnose: Rapid Profile
 Überblick Diagnose: warum? wie? Theoretischer Rahmen: Processability Theory Erwerbsbasierte Diagnose: Rapid Profile Testen und Diagnostizieren scope-precision dilemma rating scales (norm-referenced): aim
Überblick Diagnose: warum? wie? Theoretischer Rahmen: Processability Theory Erwerbsbasierte Diagnose: Rapid Profile Testen und Diagnostizieren scope-precision dilemma rating scales (norm-referenced): aim
Sprachbildung und DaZ mit Zebra. Dr. Christina Hein
 Sprachbildung und DaZ mit Zebra 1 Sprachkompetenz Hörverstehen Leseverstehen rezeptiv Sprechen Schreiben produktiv Wortschatz Grammatik kognitiv (vgl. Nodari, 2002) 2 Bedeutung der Sprache Sprache ist
Sprachbildung und DaZ mit Zebra 1 Sprachkompetenz Hörverstehen Leseverstehen rezeptiv Sprechen Schreiben produktiv Wortschatz Grammatik kognitiv (vgl. Nodari, 2002) 2 Bedeutung der Sprache Sprache ist
SPRACHTRAINING DENKANSTÖßE HILFESTELLUNGEN.
 SPRACHTRAINING DENKANSTÖßE HILFESTELLUNGEN elisabeth.grammel@phsalzburg.at Inhalte Wie man eine neue Sprache erwirbt Sensibler Umgang mit Sprache(n) Inhalte eines Sprachtrainings Was man im Ehrenamt leisten
SPRACHTRAINING DENKANSTÖßE HILFESTELLUNGEN elisabeth.grammel@phsalzburg.at Inhalte Wie man eine neue Sprache erwirbt Sensibler Umgang mit Sprache(n) Inhalte eines Sprachtrainings Was man im Ehrenamt leisten
Mündlich. Wilhelm Grießhaber Sprachenzentrum der WWU Münster Herbst Erwerbsstufen für L2 Deutsch im Überblick
 Mündlich Wilhelm Grießhaber Sprachenzentrum der WWU Münster Herbst 2007 Überblick Erwerbsstufen für L2 Deutsch im Überblick Beispiele für die Erwerbsstufen: Stufe 0 Stufe Stufe 2 Stufe Stufe 4 Erwerbsstufen
Mündlich Wilhelm Grießhaber Sprachenzentrum der WWU Münster Herbst 2007 Überblick Erwerbsstufen für L2 Deutsch im Überblick Beispiele für die Erwerbsstufen: Stufe 0 Stufe Stufe 2 Stufe Stufe 4 Erwerbsstufen
2
 1 2 3 4 5 Inhalt Bildkarten Seite 2 Impressum Seite 5 Einleitung Seite 7 Anweisung zur Durchführung Seite 6 Fragenkatalog für den zweiten Durchgang (Nachfrage) Seite 9 Protokollbogen, leer Seite 11 Anweisung
1 2 3 4 5 Inhalt Bildkarten Seite 2 Impressum Seite 5 Einleitung Seite 7 Anweisung zur Durchführung Seite 6 Fragenkatalog für den zweiten Durchgang (Nachfrage) Seite 9 Protokollbogen, leer Seite 11 Anweisung
Sprachentwicklung beim Kind
 Gisela Szagun Sprachentwicklung beim Kind Ein Lehrbuch Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 Einleitung 11 1 Linguistische Grundbegriffe 17 1.1 Sprache und Kommunikation
Gisela Szagun Sprachentwicklung beim Kind Ein Lehrbuch Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 Einleitung 11 1 Linguistische Grundbegriffe 17 1.1 Sprache und Kommunikation
Diese Lektion stammt aus meinem Ebook: Deutsche Grammatik einfach erklärt
 Diese Lektion stammt aus meinem Ebook: Deutsche Grammatik einfach erklärt Mehr Informationen zum Ebook: https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/ Blick ins Buch: https://www.youtube.com/watch?v=ts5wa56lpto
Diese Lektion stammt aus meinem Ebook: Deutsche Grammatik einfach erklärt Mehr Informationen zum Ebook: https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/ Blick ins Buch: https://www.youtube.com/watch?v=ts5wa56lpto
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das Grammatikfundament: Wortarten. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Grammatikfundament: Wortarten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Uta Livonius Das Grammatikfundament: Wortarten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Grammatikfundament: Wortarten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Uta Livonius Das Grammatikfundament: Wortarten
Schulinterner Lehrplan für das Fach Latein, Sekundarstufe I Latein ab der Jahrgangsstufe 6
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Latein, Sekundarstufe I Latein ab der Jahrgangsstufe 6 Verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Latein für den Unterricht in der Jahrgangsstufe 6 Schiller-Gymnasium
Schulinterner Lehrplan für das Fach Latein, Sekundarstufe I Latein ab der Jahrgangsstufe 6 Verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Latein für den Unterricht in der Jahrgangsstufe 6 Schiller-Gymnasium
Was heisst eigentlich Sprachkompetenz?
 Claudio Nodari Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Bibliographischer Verweis: Nodari, C. (2002): Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom
Claudio Nodari Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Bibliographischer Verweis: Nodari, C. (2002): Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom
4. Grammatikunterricht als Schule der Aufmerksamkeit
 4. Grammatikunterricht als Schule der Aufmerksamkeit 1. Umgang mit Fehlern I Negotiation of form 2. Der Begriff der Grammatik 3. Implizites und explizites Sprachwissen 4. Aufgabe der Grammatik 5. Automatisierung
4. Grammatikunterricht als Schule der Aufmerksamkeit 1. Umgang mit Fehlern I Negotiation of form 2. Der Begriff der Grammatik 3. Implizites und explizites Sprachwissen 4. Aufgabe der Grammatik 5. Automatisierung
Gute Sprache? Schlechte Sprache? Alltagssprache? Fachsprache? Unterrichtssprache? Bildungssprache?
 Humboldt-Universität zu Berlin Warum Sprache für das fachliche Lernen wichtig ist: Methoden für einen sprachsensiblen Fachunterricht Bundesseminar, 6. Mai 2013, Retz Gute Sprache? Schlechte Sprache? Alltagssprache?
Humboldt-Universität zu Berlin Warum Sprache für das fachliche Lernen wichtig ist: Methoden für einen sprachsensiblen Fachunterricht Bundesseminar, 6. Mai 2013, Retz Gute Sprache? Schlechte Sprache? Alltagssprache?
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Inhalt. Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4
 Inhalt Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I 1 Deklination des Substantivs I 13 I Deklination mit dem bestimmten Artikel 13 II Deklination mit dem unbestimmten Artikel 13 III Pluralbildung
Inhalt Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I 1 Deklination des Substantivs I 13 I Deklination mit dem bestimmten Artikel 13 II Deklination mit dem unbestimmten Artikel 13 III Pluralbildung
Unterrichtsentwurf im Deutschunterricht zum Thema Satzglieder (3. Klasse)
 Germanistik Ann-Kathrin Christiansen Unterrichtsentwurf im Deutschunterricht zum Thema Satzglieder (3. Klasse) Unterrichtsentwurf Schriftlicher Unterrichtsentwurf für die Stunde am 16.05.2008 1 Name der
Germanistik Ann-Kathrin Christiansen Unterrichtsentwurf im Deutschunterricht zum Thema Satzglieder (3. Klasse) Unterrichtsentwurf Schriftlicher Unterrichtsentwurf für die Stunde am 16.05.2008 1 Name der
4 Farben Kernwortschatz des Situationsbildes kennenlernen, Adjektive zusammensetzen...30 Kernwortschatz silbieren und im Satz verwenden...
 Inhaltsverzeichnis Das Abc Nachschlagen üben Seite Inhalte des Wörterbuchs kennenlernen 6 Räumliche Begriffe verwenden: davor, dahinter, Vorgänger, Nachfolger 7 Das Abc lernen 8 Wörter nach dem Abc ordnen
Inhaltsverzeichnis Das Abc Nachschlagen üben Seite Inhalte des Wörterbuchs kennenlernen 6 Räumliche Begriffe verwenden: davor, dahinter, Vorgänger, Nachfolger 7 Das Abc lernen 8 Wörter nach dem Abc ordnen
GeR-Niveau A1 1. Keine Deskriptoren verfügbar. Keine Deskriptoren verfügbar
 GeR-Niveau A1 1 GeR-Niveau A1 Kommunikative Aktivitäten und Strategien PRODUKTIVE AKTIVITÄTEN UND STRATEGIEN Mündliche Produktion Zusammenhängendes monologisches Sprechen: Erfahrungen beschreiben Zusammenhängendes
GeR-Niveau A1 1 GeR-Niveau A1 Kommunikative Aktivitäten und Strategien PRODUKTIVE AKTIVITÄTEN UND STRATEGIEN Mündliche Produktion Zusammenhängendes monologisches Sprechen: Erfahrungen beschreiben Zusammenhängendes
